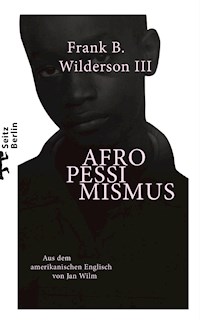
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was es heißt, Schwarz zu sein: Afropessimismus ist ein Aufschrei und eine radikale Antwort auf eine der drängendsten Fragen unserer Zeit Wie erklärt sich die brutale Alltäglichkeit der Gewalt gegen Schwarze Menschen? Warum bestimmt die Geschichte der Sklaverei ihre Erfahrungen bis heute? Wie kommt es, dass Rassismus jeden Aspekt des sozialen, politischen und geistigen Lebens berührt? Frank B. Wilderson III begegnet diesen Fragen in einer Weise, die so komplex ist wie unsere Verstrickungen in sie: Teils einschneidende Analyse, teils bewegendes Memoir, zeugt "Afropessimismus" davon, was es heißt, Schwarz – und das heißt für Wilderson immer zugleich, kein Mensch – zu sein. Er schildert eine nur scheinbar idyllische Kindheit in einem weißen Vorort von Minneapolis, die politisierten 1970er- und 1980er-Jahre, seinen Aktivismus gegen die südafrikanische Apartheid und die Gewalt, die ihm als Wissenschaftler noch heute begegnet. Wildersons Aufmerksamkeit für die Verheerungen eines Schwarzen Lebens in einer weißen Welt zeigen, dass die Unterdrückung der Schwarzen kein Relikt der Vergangenheit ist. Vielmehr bildet sie die unhintergehbare Grundlage jedes Verständnisses von Kultur, Fortschritt und Subjektivität. Auch die unbestreitbaren Erfolge des Civil Rights Movements oder von Black Lives Matter konnten sie nicht grundlegend infrage stellen. Ausgangspunkt von Wildersons Denken ist deshalb die Ausweglosigkeit. "Afropessimismus" fragt, wie sich das Leben als versklavte Person überhaupt erzählen lässt: eine herausfordernde und notwendige Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Frank B. Wilderson III
Afropessimismus
Aus dem amerikanischen Englisch von Jan Wilm
Gewidmet Anita Wilkins –mit Dank für deine Liebe.
Gewidmet Dres. Ida-Lorraine und Frank B. Wilderson jr. –mit Dank für das Formen meines Geistes.
Gewidmet Assata Shakur und Winnie Mandela –mit Dank für alles.
INHALT
Teil I
1. Zu Halloween wusch ich mein Gesicht
2. Saft aus einem Halsknochen
3. Hattie McDaniel ist tot
4. Strafpark
Teil II
5. Das Problem mit Menschen
6. Bitte Vorsicht am Bahnsteig
7. Mario’s
Epilog: Das neue Jahrhundert
Danksagung
Anmerkungen
Habt den Mut, Wilderson zu lesen!Nachwort des Übersetzers
TEIL I
Ich kam auf die Welt, darum bemüht,
den Sinn der Dinge zu ergründen,
und meine Seele war von dem Wunsch erfüllt,
am Ursprung der Welt zu sein, und dann entdeckte ich mich
als Objekt inmitten anderer Objekte.
Frantz Fanon1
Am meisten wert bin ich als Vektor,
durch den andere sich selbst verwirklichen können.
Cecilio M. Cooper2
KAPITEL EINS
Zu Halloween wusch ich mein Gesicht
I
Eine psychotische Episode ist kein Picknick, besonders dann, wenn man weiß, dass man sie nicht als Wahnsinn bezeichnen kann, denn Wahnsinn setzt einen Wetterumschwung voraus, eine vorausgegangene Jahreszeit der geistigen Gesundheit.
Ich stöhnte. Schluchzte. Das knisternde Einweglaken, das die Bahre bedeckte, ratschte, wenn ich mich bewegte. Als sie den Raum betraten, setzte ich mich auf. Niemand würde mich fixieren. Allerdings stand ich nicht von der Bahre auf, aus Angst, ihnen einen Grund dafür zu geben, es doch zu tun. Im Fluoreszierlichterglanz waren sie – der Arzt und die Krankenschwester – weiß wie Staub. Die Bahre klapperte von meinem Zittern und Weinen. Sie kamen nicht näher. Sie riefen nicht um Hilfe, weder für sich selbst noch für mich, einen monströsen Aphasiker, der zu schwarz war für ihre Pflege. So, glaubte ich, müssten sie mich sehen. Und mein Drang, sie vor mir selbst zu bewahren, übertraf meinen Wunsch, geheilt zu werden. Doch ich konnte nicht sprechen. Nicht einmal, um ihnen mitzuteilen, dass ich sie vor mir schützen wollte.
Streubomben brachen in meinem Herzen. Ich umklammerte meine Brust und schrie auf. Machten sie darauf einen Schritt zurück? Ist es das Herz?, fragte der Arzt. Ich wollte lachen. Das Komische an einem Mund ist, dass er sich nicht nur öffnen, sondern auch schließen muss, wenn ein Wort gesagt werden soll. Meiner würde sich nicht schließen; ich wusste, wenn er sich schlösse, bekäme ich ihn nicht wieder auf. Die Scharniere meines Kiefers erzeugten Stöhnen oder Heulen, jedoch keine Worte. Ich dachte: Wie lustig ist das? Ich antwortete ihm mit den Worten eines Vogels, dessen Kehle man aufgeschlitzt hat.
Sie greifen sich ständig an Ihre Brust, sagte er. Spüren Sie einen stechenden Schmerz irgendwo in der Herzgegend? Ich nickte mit dem Kopf. Erzählen Sie mir mehr darüber, sagte er. Doch ich fühlte, wie sich meine Lippen grotesk verzogen; ich wollte nicht wieder anfangen zu schluchzen. Er sagte, ich solle mir Zeit lassen. Die Krankenschwester nickte auf eine ernste Art, als starrte sie einen mopsnasigen Welpen in seinem Käfig an. Ich hatte den Drang, ihren Blick mit einem mopsnasigen Welpenkläffen zu beantworten. Während dieser Drang in mir anwuchs, vertiefte sich ihre Traurigkeit. Mein Bellen und ihre betrübten, geweiteten Augen steuerten auf einen Zusammenstoß zu. Wauwau! Wauwau! Gib mir ein Leckerli! In meinem Kopf spürte ich heftige Erschütterungen, und auch mein Zwerchfell war erschüttert, auf ganz andere Weise. Der sehr verehrte Sir Schenkelklopfer erhob sich von meinem Oberkörper und stieß auf Mister Warum-zur-Hölle-bin-ich-überhaupt-am-Leben, der durch meinen tosenden Schädel gekracht und in meiner Kehle gelandet war. Die Traurigkeit sickerte aus den Augen der Krankenschwester. Sie war wieder ganz ihr verschüchtertes Selbst. Die Welpenliebe hatte sich verwandelt in ihr Bedürfnis nach Selbsterhaltung im Angesicht dieser unförmigen schwarzen Masse mit filzigem, ungekämmtem Haar und Feuerwerkskörpern, die aus den Höhlen herausschossen, in denen sich eigentlich die Augen befinden sollten.
Der Arzt saß auf einem Hocker, ein Fuß auf die untere Sprosse gestützt, der andere Fuß auf dem Boden. Die Krankenschwester blieb jedoch stehen. Er massierte eine üppige Augenbraue mit seinem Zeigefinger und wartete. Lachen ist gut, sagte er. Warum erzählen Sie uns nicht, was Sie so amüsiert? Ich wollte sagen: Wäre es in Ordnung, wenn ich bellen würde? Allerdings bemerkte ich, dass ich verrückter wirkte, wenn ich ihn um Erlaubnis zum Bellen bitten würde, als wenn ich Initiative zeigen und, ohne größere Anstalten zu machen, einfach loskläffen würde. Ich stürzte in die Kluft zwischen Lachen und Tränen.
Niemand hatte mich in das Studierendenkrankenhaus gebracht. Ich war auf eigene Faust hierhergekommen. Während ich wimmernd auf der Trage saß und die Angst vor der Welt in den Augen des Arztes und der Krankenschwester fürchtete, konnte ich nur eine ihrer Fragen (Ist jemand bei Ihnen?) durch Kopfschütteln beantworten. Wie sind Sie hergekommen? Wer hat Sie hergebracht? Als Antwort vernarbten die Tränen mein Gesicht. Sind Sie selbst gefahren?, sagte eine der beiden Personen. Ich schüttelte den Kopf. Sie bemerkten die Autoschlüssel in meiner Hand. Sie hatten immer noch nicht meinen Puls oder meinen Blutdruck gemessen. Der Arzt wies mich an, auszuruhen. Er sagte, sie seien gleich wieder zurück.
Als sie fort waren, stachen mir die fluoreszierenden Lichter in die Augen wie Eisdolche, die in den Wintern meiner Kindheit von den Villen heruntergehangen hatten. Ich hatte nicht genügend Vertrauen in meinen Gleichgewichtssinn, um von der Bahre herunterzurutschen und die Lichter auszuschalten. Ich wollte nicht auf dem Bauch liegen und nur dieses knitternde Wegwerflaken zwischen der Vorderseite meines Körpers und einer kalten Matratze haben, die mich mit dem Geräusch eines trockenen Hustens zurechtwies, wann immer ich mich regte. Also blieb ich auf dem Rücken liegen. Schloss ich meine Augen vor dem grellen Licht, explodierten Rosen an meinen Lidern.
War ich heute Morgen gerade beim Rasieren, als ich austickte? Ich trug einen Bart, also nein, es geschah nicht beim Rasieren. Doch ich wusste, es hatte angefangen, als ich in den Spiegel starrte. Ich wusch mir gerade das Gesicht, als die Strophe eines Gedichts in meine Gedanken aufstieg. Es begann mit einem Gefühl von Hitze im Gesicht und mit einem Engegefühl in der Brust. So wie ich mich häufig als Kind gefühlt hatte, wenn ich es morgens nicht ertragen konnte, der Tatsache ins Gesicht zu sehen, einen Tag voller Spott in einer weißen Grundschule durchstehen zu müssen, jener Grundschule, die in der Nähe des gesprenkelten Wassers eines langen, mit Weidenbäumen gesäumten Sees lag. Mein Fleisch zitterte, als wäre mein Hemd aus Insekten gemacht, und die Haut an meinem Rücken bewegte sich, wie sie es immer tat, wenn meine Mutter morgens die Tür hinter mir geschlossen hatte. Die Erinnerung an diesen ängstlichen kleinen Jungen, der auf meinen Namen hörte, ächzte in meinen Ohren wie die Echos der Ruderlager über einem ruhigen, menschenleeren Meer. Ich ruderte ans Ufer, wo jeder Kummer meiner Kindheit auf mich wartete.
Ich bin ein Doktorand mittleren Alters, waren die Worte, die ich zu dem Bild gesagt hatte, das der Spiegel zersplittert hatte. Ich. Reiße. Mich. Zusammen. Doch der stechende Schmerz in meiner Brust hatte einfach nicht auf mich gehört. Er wollte sich erinnern und dem Gedicht lauschen, das vor wenigen Augenblicken durch meinen Geist hindurchgeflossen war.
Mir war klar, dass ich hier rausmusste, bevor ich, ganz allein in meinem Badezimmer, an einem Herzinfarkt stürbe. Vom Gehen schien ich beinahe ohnmächtig zu werden. Die Wohnung war klein; nur ein Badezimmer, dann ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer. In jedem Zimmer fand ich etwas, woran ich mich mit der Hand festklammern konnte – die Schranktür, den Herd, die Lehne eines Küchenstuhls, die Reihen an Bücherregalen im Wohnzimmer, die bis zur Eingangstür reichten. Die Eingangstür fiel hinter mir ins Schloss.
Mir wurde schwindelig, als ich jene sieben Stufen hinabblickte, als schaute ich in eine tiefe Schlucht. Der Drang, in Ohnmacht zu fallen, und der Drang, zu erbrechen, bekämpften sich in meinem Körper. Schlechtes Karma, dachte ich hinter meinen tränenfeuchten, verschwommenen Augen. Ich glaubte, ich würde ohnmächtig werden. Mein Honda Civic döste am Bordstein wie eine kleine blaue Eidechse.
Meine Schlüssel schrappten gegen das gusseiserne Geländer, als ich die Treppe hinunterstolperte. Süßes, sonst gibt’s Saures, dachte ich mit einem Lachen, wir haben uns das Gesicht gewaschen, und wir stecken in unseren Schuluniformen. Eine wahnsinnig wütende Bestie rang darum, in einem Guss aus Blut und Galle aus meiner Haut zu fahren. Ich wollte heulen. Eine Handfläche stemmte sich gegen die Fensterscheibe. Eine Hand fummelte an den Schlüsseln herum. »Kann mir jemand helfen?«, schluchzte ich vor mich hin, hoffend, dass mich keine weiße Person hören konnte. »Kann mir bitte jemand helfen?«
Während ich nun auf der Bahre lag, erinnerte ich mich an die silbernen Kotzfäden, die sich auf der Motorhaube meines Autos kringelten. Dann, ohne zu wissen, wie oder warum, saß ich in einem Bus, der durch die Innenstadt von Berkeley fuhr. Ich sah dabei zu, wie ich mich selbst durch die Augen der Fahrgäste im Bus sah, während ich zur Seite sackte und leise schluchzte. Sie sollen sich sicher fühlen, hatte ich mir gedacht, auch wenn ich mich selbst noch nie so unsicher gefühlt hatte. Ich dachte noch einmal an diesen Moment zurück, als die Krankenschwester und der Arzt zum ersten Mal diese weiße Gruft betraten, in der ich aufgebahrt war. Sie sollen sich sicher fühlen – die Hauptregel der internationalen Negro-Diplomatie.
Jetzt, allein in der Klinik, blessierten Lichtposaunen meine Augen, und es wurde kalt im Raum. Schloss ich jedoch meine Lider, rauschte eine Kette vergangener Leben durch meinen Schädel wie ein Zug, der über einer Schlucht entgleiste. Jeder einzelne Eisenbahnwagen war ein Waggon aus Zeit. Die Lok war das Jetzt, die Zeit dieses gegenwärtigen Moments auf der Bahre. Anschließend stürzte ein Zeitwaggon herunter, der mein Leben im Apartheid-Südafrika in sich trug, wo Mandelas Versprechen flackerten und erstickten wie die letzten Japser von Straßenlaternen. All das Blutvergießen für eine Flaggen-und-Hymnen-Nation, für den Nebel der Mythologien, und die scharfe Kritik von Mandelas Kumpanen, die die sogenannte Ultralinke tadelte mit Worten wie: »Kameraden, jetzt müsst ihr endlich begreifen, dass ihr euch nicht von euren Prinzi pien ernähren könnt.« Der nächste Waggon, der die Felswand hinunterrauschte, waren die 1980er-Jahre: Ein Ersteklasseabteil voller Sorgen und Magengeschwüren. Ich war ein frischgebackener Universitätsabgänger, der glaubte, mit Schmerz könnte man auf dem Börsenparkett handeln, so wie mit allem anderen im Leben auch. Acht Jahre lang, von der Zeit, als ich meinen Universitätsabschluss machte, bis zu der Zeit, als ich nach Südafrika auswanderte, um gegen die Apartheid zu kämpfen, arbeitete ich als Börsenmakler. Der erste Schwarze Börsenhändler von Minnesota, wie mir damals von dem Sales Manager gesagt wurde, der mich stolzgeschwellt einstellte.
2
Jene acht Jahre haben meine Gesundheit fast vollständig ruiniert. Eine meiner Gesichtshälften zuckte und schauderte nach Belieben. Ein Geschwür zerfraß meine Magenschleimhaut. Mein Internist war nicht der erste Mensch, der diese Prognose gestellt hatte. Jasmine, eine Sekretärin in der Hauptverwaltung von Merrill Lynch an der Wall Street, die ich eines Sommers während eines Weiterbildungsmonats kennengelernt hatte, hatte mir ebenfalls gesagt, dass ich in diesem Berufsfeld nichts verloren hätte. Sie hatte recht, und auch ich wusste es damals, doch Geld ist eine enorme Motivation; jetzt bot sich mir die Gelegenheit, all das Geld für meine gesundheitliche Langzeitpflege auszugeben, wenn ich nicht sofort etwas unternahm.
»Sie sind kein Kapitalist«, sagte mir mein Internist. »Sie besitzen nicht den Mut, den man dazu braucht.«
»Ich will Geld. Ich brauche Geld.«
»Sie trinken acht Tassen Kaffee am Tag. Ihre Wange flackert wie eine Morselampe. Meinen Sie, dass Sie warten sollen, bis Ihr Geschwür die Größe meines kleinen Fingers hat, ist es das, was Sie machen sollten?«
Ich versuchte, kürzer zu treten, was bedeutete, dass ich weniger Umsatz machte, und bald war mir klar, dass ich kündigen sollte, bevor der Sales Manager mich in Verlegenheit brächte und mich hinausgeleiten würde. Ich trat eine Stelle als Kellner in einem exklusiven Beach Club am See an, der erst Ende der 1960er-Jahre Juden als Mitglieder aufnahm und erst Mitte der 1970er-Jahre sein erstes Schwarzes Mitglied hatte. Die Kundschaft reichte von Dan Aykroyd und Jim Belushi, deren Gefolge das Innere des Ballsaals so zurückgelassen hatte, dass es, gelinde gesagt, renoviert werden musste, bis zu den alten blaublütigen Familien, die 1962 versucht hatten, meine Eltern aus ihrer Nachbarschaft fernzuhalten. Eines Tages ging ich in den Ballsaal und balancierte ein großes Tablett mit neun Caesar-Salaten auf meiner Schulter. Das Tablett geriet ins Wanken und fiel mir fast hinunter, als ich die Gesichter an dem Tisch erblickte, an den ich geschickt worden war. Es waren Kollegen – ehemalige Kollegen – der Firma, bei der ich vor zwei Monaten gekündigt hatte. Langsam wurde ich der Lüge habhaft, die ich ihnen erzählt hatte, als ich damals ging. »Leute, ich bin es leid, fürs Establishment zu schuften. Ich probiere es jetzt als privater Dealmaker mit ein bisschen Finanzplanung nebenher.« Nach und nach servierte ich ihnen ihre Salate. Mein Name blubberte aus ihren Mündern: »Frank?« – eine Frage, die in ein Japsen gehüllt war. Ich kündigte auch hier eine Woche später – was keinen Sinn machte, denn sie hatten mich ja gesehen, die Lüge war bloßgelegt worden – und arbeitete dann für weniger Gehalt in einem Kunstmuseum.
Ich arbeitete als Wachmann im Walker Art Center mit seinem Blick über Downtown Minneapolis, und ich leckte meine Wunden von der Zeit im Calhoun Beach Club und meinen acht ethisch bankrotten Jahren als Börsenmakler. In Palästina hatte gerade die Erste Intifada begonnen, und ich hatte einen lieben Freund aus Ramallah, der ebenfalls als Wachmann im Museum angestellt war. Sein Name war Sameer Bishara. Er war Fotograf und studierte an der Kunsthochschule von Minneapolis. Wir teilten die politische Einstellung: Revolutionär; und das Sternzeichen: Widder. Zwei Menschen, die sich häufig irrten, aber keinen Zweifel kannten. »Wenn wir in einem Flugzeug säßen«, sagte Sameer einmal zu mir, »und wir in der Wüste abstürzten und eine Gruppe aus den Überlebenden gebildet würde, dann hätten einige von ihnen die Aufgabe, Wasser zu finden, andere hätten die Aufgabe, Nahrung und Feuerholz aufzutreiben, und wir bräuchten ein Team, um einen Unterschlupf aus all dem zu bauen, was nach dem Absturz geborgen werden könnte. Aber du, Frank, du wärst derjenige, der sich zurücklehnen und uns Befehle erteilen würde.« Ich habe ihm die Genugtuung, die er bei dieser Spitze empfand, nicht dadurch getrübt, dass ich ihm sagte, er habe mir Charakterzüge zugeschrieben, die geradeso gut auf ihn zuträfen.
Die meisten der Wachleute waren entweder Künstlerinnen oder Schriftsteller oder Studierende. Aber nur Sameer teilte meine Politik des Aufstands. Früh wurden wir Freunde und hielten uns von den andern fern. Ich erzählte ihm von meinen Träumen während der College-Zeit, nach Simbabwe zu gehen und für die ZANU/ZAPU zu kämpfen, oder nach New York, um mich Assata Shakur und der Black Liberation Army, der Schwarzen Befreiungsarmee, anzuschließen. Sameer hatte den Traum, nach Ramallah zurückzukehren, um einen, wie er meinte, bedeutenderen Beitrag zur Intifada zu leisten als die Vorträge, die er vor Liberalen mit wässrigen Augen in Minnesota hielt. Er war 25. Ich war 31. In fünf Jahren würde ich so alt sein, wie Frantz Fanon war, als er im Gewahrsam der CIA verstarb. Als Fanon 1961 starb, war er aus seiner Heimat Martinique geflüchtet, hatte sich De Gaulles Armee angeschlossen und war im Kampf gegen die Nazis verwundet worden. Außerdem hatte er sein praktisches Jahr in Psychiatrie und Medizin absolviert, hatte sich während der algerischen Revolution der Nationalen Befreiungsfront angeschlossen und vier Bücher über Revolution und Psychoanalyse verfasst. Ich hatte fünf Jahre Zeit, um ihn einzuholen – eine Messlatte, die mir mein Dämon der Schande gesetzt hatte. Überheblichkeit bei völliger Niedergeschlagenheit – so lebte ich. Etwas ganz Ähnliches traf auch auf Sameer zu. Was für eine Verschwendung, sagte er mir, Skandinavier und Eistaucher zu fotografieren, während er glaubte, er sollte besser in seiner Heimat sein und Bomben bauen. Wir hatten unterschiedliche Schultern, doch sie trugen das gleiche Kreuz. Davon war ich überzeugt, seit er eines Morgens lächelnd zur Arbeit gekommen war, obwohl sein rechtes Auge leicht geschwollen und geschlossen war.
»Letzte Nacht«, erzählte er mir, »lernte ich mit einem Freund aus Palästina zwei unglaublich schöne Frauen kennen. Weiße natürlich«, fügte er flüsternd hinzu, und ich machte mir nicht die Mühe, sein »natürlich« infrage zu stellen, denn ich war mir nicht sicher, dass er falschlag. Dass es selbstverständlich ist, dass »weiß« gleichbedeutend ist mit Schönheit – das ist die Botschaft, die man sein ganzes Leben lang aufgezwungen bekommt. Das Gegenteil zu behaupten, ist so, als sagte man, Es geht nicht ums Geld, nachdem man übers Ohr gehauen wurde.
Sameer sagte, er und sein Freund hätten sie mit nach Hause nehmen können, wenn nicht drei reiche Kuwaiter in den Salon geschlendert gekommen wären. Als einer der Kuwaiter sich an die Frau ranmachte, mit der sich Sameer gerade unterhielt, sagte Sameer ihm freundlich, er solle zu seinem Tisch zurückgehen.
Der Mann höhnte: »Ihr habt ja nicht mal ein eigenes Land.«
Doch er ging zurück. Im Laufe des Abends schickten die Kuwaiter Champagner an Sameers Tisch. Dann kamen alle drei an den Tisch. Sie boten an, die Frauen zu einer exklusiven Afterparty in ein Penthouse im Vorort von Edina mitzunehmen.
»Nur ihr beide«, sagte der Kuwaiter, den Sameer weggeschickt hatte, zu den Frauen, »nicht diese Staatenlosen.«
Weil die Kuwaiter zu dritt und Sameer und sein Freund zu zweit waren, gingen die Kuwaiter auf Sameers Angebot ein, die »Details« der Afterparty auf dem Parkplatz zu klären.
Die Zähne der Stechuhr durchbohrten Sameers Stechkarte. Ich folgte ihm, als er sich einen der blauen Museumsblazer anzog, die wir alle trugen. Wir gingen zusammen in die Hauptgalerie. Als ich vorausging, um meine Position im Zwischengeschoss einzunehmen, lächelte er und flüsterte: »Wir haben diese Kuwaiter verprügelt, bis wir nicht mehr konnten.«
Es war nicht so sehr, dass die ineinander verkeilten Geweihe ob des Besitzerstolzes zweier verbotener Frauen den Wirbel auf dem Parkplatz ausgelöst hatten – auch wenn das sicher ein Teil davon war. Was ihn so sehr zur Weißglut getrieben hatte, war die Verhöhnung von Sameers Staatenlosigkeit durch die Kuwaiter. Ich meinte, auch ich hätte diesen Verlust erlitten, da ich glaubte, mein Leiden sei dem von Sameer sehr ähnlich. Damals war ich kein Afropessimist.
»Ich hätte sie auch verdroschen«, sagte ich.
Ein hoher, grasbewachsener Hügel grenzte an das Gebäude, in dem das Walker Art Center beherbergt war. Die Anhöhe ist heute verschwunden, sauber abgetragen wie nach einer Wurzelbehandlung, um Platz zu schaffen für ein Restaurant. Als es jedoch noch ein Hügel war, aßen Sameer und ich dort zu Mittag. Im Frühling, wenn die Kälte nachließ und der Himmel sich aufhellte, bot die Kuppe des Hügels einen umfassenden Blick auf die weißen Schwäne, die den See des Loring-Parks abschwammen. Entfernte Autos in den Innenstadtstraßen funkelten paillettengleich in der Sonne. Von diesem Hügel aus konnte man die Kupferkuppel der Basilica of Saint Mary erkennen, die durch geschmolzenen Schnee und strömenden Regen zu einem einzigen blaugrünen Glänzen korrodiert war und mich glauben machte, der Verfall sei das einzig wahre Objekt der Liebe. Auch war der Hügel ein Aussichtspunkt, von dem aus man den sich anbahnenden Tod erkennen würde. Direkt darunter befand sich der Bottleneck, eine Kreuzung, an der drei Straßen zu einer einzigen zusammenliefen, ein Ort, an dem sich einige der schrecklichsten Unfälle ereigneten. Als ich in meinen Zwanzigern Spionageromane las, stellte ich mir den Bottleneck manchmal als einen Abschnitt der deutschen Autobahn vor, auf der John le Carrés unglücklicher Spion Alec Leamas zwei Kinder in einem Kleinwagen beobachtete, die ihm fröhlich zuwinkten; und er im nächsten Moment sah, wie der Wagen zwischen zwei großen Lastwagen zerquetscht wurde. Dies war der Hügel, auf dem mir Sameer von seinem Cousin erzählte, der in Ramallah getötet worden war – in die Luft gesprengt beim Bau einer Bombe. Doch er war kein Selbstmordattentäter. Es war ein Unfall. Sameer gab sich selbst die Schuld, so wie es Überlebende häufig tun, ganz gleich, wie nah oder wie fern – räumlich oder zeitlich – ihre Toten auch sind. Er hatte überlebt, weil er hier war und nicht dort.
Mein Freund sprach offen, während wir zusahen, wie die Welt unter uns vorbeirauschte, ohne zu uns aufzuschauen und uns ihren Respekt zu zollen. Irgendwann erzählte Sameer davon, wie er an israelischen Grenzposten angehalten und kontrolliert worden war. Er sprach auf eine Weise, für die meine Anwesenheit scheinbar nicht notwendig war. Nie zuvor hatte ich dieses Maß an Konzentration und Distanz an ihm erlebt. Es war in Ordnung. Er trauerte.
»Die beschämende und demütigende Art und Weise, wie die Soldaten ihre Hände über deinen Körper gleiten lassen«, sagte er. Dann fügte er hinzu: »Aber die Scham und die Demütigung ist noch viel schlimmer, wenn der israelische Soldat ein Jude aus Äthiopien ist.« Der Boden unter meinen Füßen brach weg. Der Gedanke, dass mein Platz im Unbewussten der Palästinenser:innen, die für ihre Freiheit kämpfen, der gleiche unehrenhafte Platz war, den ich in den Köpfen der Weißen in Amerika und Israel einnahm, ließ mich erschaudern. Ich besaß genügend Geistesgegenwärtigkeit, um ihm zu sagen, dass seine Ansichten merkwürdig waren, wenn man bedachte, dass Palästinenser:innen sich in einem Krieg mit Israelis befanden, und dazu noch mit weißen Israelis. Wie kam es, dass die Leute, die sich sein Land aneigneten und seine Verwandten abschlachteten, in seiner Vorstellung irgendwie eine geringere Bedrohung darstellten als Schwarze Juden, die so oft Werkzeuge des israelischen Wahnsinns waren und gelegentlich ihre Drecksarbeit verrichteten? Was, fragte ich mich im Stillen, was an Schwarzen (an mir) war es, das uns so ersetzbar machte, dass man uns in den Köpfen der Unterdrücker und Unterdrückten derartig herumwürfeln konnte?
Ich war konfrontiert mit der Erkenntnis, dass palästinensische Aufständische im kollektiven Unbewussten mehr mit dem israelischen Staat und der israelischen Zivilgesellschaft gemeinsam haben als mit Schwarzen. Was sie teilen, ist ein größtenteils unbewusster Konsens, dass Blackness, Schwarzsein, ein Raum von Abjektion, von Elendigkeit, ist,3 der sich beliebig instrumentalisieren lässt. Einmal ist Blackness ein entstelltes und entstellendes phobisches Phänomen; dann wieder ist Blackness ein empfindungsfähiges Werkzeug,4 das freimütig eingesetzt wird zu Zwecken und mit Zielen, die wenig mit Black Liberation, Schwarzer Befreiung, gemein haben. Da saß ich also und sehnte mich, solidarisch mit der Sehnsucht meines palästinensischen Freundes, nach der vollständigen Wiederherstellung palästinensischer Souveränität; ich trauerte, solidarisch mit der Trauer meines Freundes, über den Verlust seines aufständischen Cousins; ich sehnte mich also nach der historischen und politischen Erlösung dessen, was ich für eine verletzte Gemeinschaft von Menschen hielt, der wir beide angehörten – bis mein Freund plötzlich ins Unbewusste seines Volkes hinuntergriff und mir einen nassen Turnschuh von unten übers Kinn zog: die erschreckende Erkenntnis, dass ich nicht nur von Anfang an vom Ausgang der geschichtlichen und politischen Erlösung ausgeschlossen bin, sondern dass die Grenzen der Erlösung gleichermaßen von Weißen und Nicht-Weißen kontrolliert werden, obwohl sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen.
Es ist sogar noch schlimmer als das. Ich, als Schwarze Person (falls Person, Subjekt, Wesen geeignete Begriffe sind, denn Mensch ist es nicht), bin vom Ausgang der gesellschaftlichen und geschichtlichen Erlösung ausgeschlossen und werde gleichzeitig dafür gebraucht, dass Erlösung irgendeine Form von Kohärenz erlangen kann. Ohne den Ausdruck einer geteilten Negrophobogenese, die zwischen Israel und Palästina vermittelt, würde die narrative Kohärenz ihres blutigen Konflikts einfach verpuffen. Die Negrophobogenese meines Freundes und seiner palästinensischen Landsleute bildet das Fundament, die Betonplatten, auf denen jedes Gebäude von menschlichem Ausdruck (ob Liebe oder Krieg) errichtet wird. Die erniedrigte Menschheit (Palästinenser:innen) kann von der erhabenen Menschheit (aschkenasische Jüd:innen) gefilzt werden, und die Mauern der Vernunft bleiben stehen (ungeachtet der universellen Würdelosigkeit von unmotivierten Durchsuchungsaktionen). Doch wenn der Soldat stattdessen ein äthiopischer Jude ist …
Meine Brust war von Schmerz durchstoßen. Sameer und ich waren Gegner, nicht weil wir als Freunde ungleich waren, und auch nicht weil unsere politischen Einstellungen unvereinbar waren; sondern weil die Imago des Schwarzen »für alle irgend entstehenden Konflikte verantwortlich ist«.5 Denn die libidinöse Ökonomie, die die Schwarze Imago als phobogenes* Objekt positioniert, durchtränkt das kollektive Bewusstsein;** ich werde durch sie angeeignet als ein Werkzeug für die Sorgen aller Nationen – sogar zweier Nationen, die sich bekriegen –, jedoch niemals als ein Nutznießer dieser Sorgen.
1988 war ich kein Afropessimist. Mit anderen Worten, ich betrachtete mich selbst als erniedrigten Menschen und betrachtete meine Notlage analog zur Notlage der Palästinenser:innen, der indigenen Einwohner:innen der USA sowie der Arbeiter:innenklasse. Heute weiß ich, diese Analogie war falsch. Ich war die Kontrastfigur zur Menschheit. Die Menschheit blickte auf mich, wenn sie sich über sich selbst im Unklaren war. Mit einem existenziellen Seufzer konnte die Menschheit durch mich sagen: »Wenigstens sind wir nicht er.« Um Saidiya Hartman zu zitieren: »Der Sklave ist weder ein zivilisierter Mensch noch ein freier Arbeiter, sondern vielmehr ausgeschlossen von der Erzählung ›we the people‹, durch die sich die Verbindung zwischen modernem Individuum und Staat vollzieht […]. Die täglichen Praktiken der Versklavten geschehen abgespalten vom Politischen, in Ermangelung der Menschenrechte oder der Sicherheiten des selbstbestimmten Individuums und vielleicht sogar ohne eine ›Person‹ im herkömmlichen Sinne des Begriffes.«6
Schwarze Menschen verkörpern eine Meta-Aporie des politischen Denkens und Handelns (was etwas anderes ist, als zu sagen, sie sind immer gewillt oder es ist ihnen immer gestattet, diese Meta-Aporie auch auszudrücken).
Die meisten kritischen Denker:innen, die nach 1968 geschrieben haben, verwenden das Wort Aporie, um einen Widerspruch innerhalb eines Textes oder eines theoretischen Unterfangens zu bezeichnen. So deutet Jacques Derrida beispielsweise an, eine Aporie kennzeichne »einen Punkt der Unentscheidbarkeit, der jene Stelle markiert, an der ein Text am deutlichsten seine eigene rhetorische Struktur unterläuft oder sich selbst dekonstruiert«.7 Wenn ich jedoch sage, Schwarze Personen verkörpern eine Meta-Aporie des politischen Denkens und Handelns, so geht die Vorsilbe Meta- über das hinaus, was Derrida und der Poststrukturalismus damit meinen – es erhöht den Grad von Abstraktion und damit auch den Einsatz.
In der Epistemologie, einem Teilbereich der Philosophie, der sich mit der Theorie von Wissen beschäftigt, wird die Vorsilbe Meta- verwendet für über (seine eigene Kategorie reflektierend). Metadaten sind beispielsweise Daten über Daten (wer sie produziert hat und wann, welches Format die Daten haben und so weiter). In der Linguistik sieht man eine Grammatik als etwas an, das in einer Metasprache ausgedrückt wird, als eine Sprache, die auf einer höheren Stufe der Abstraktion operiert, um die Eigenschaften von einfacher Sprache (anstatt sich selbst) zu beschreiben. Eine Metadiskussion ist eine Diskussion über Diskussionen (nicht über ein spezielles Thema einer Diskussion, sondern über Diskussion an sich). Und in der Informatik mag eine theoretische Softwareprogrammiererin sich mit Metaprogrammierung beschäftigen (das heißt mit dem Schreiben von Programmen, die Programme manipulieren).
Afropessimismus ist also weniger eine Theorie als vielmehr eine Metatheorie: ein kritisches Projekt, das Blackness als Interpretationslinse verwendet, um die unausgesprochene logische Vorannahme des Marxismus, des Postkolonialismus, der Psychoanalyse und des Feminismus zu hinterfragen, und zwar durch eine streng theoretische Betrachtung ihrer Eigenschaften und Vorannahmen, zum Beispiel ihrer Grundlagen, ihrer Methoden, ihrer Form und ihrer Nützlichkeit; und diese Theorie tut dies wiederum auf einer höheren Abstraktionsebene als die Diskurse und Theorien, die sie hinterfragt. Noch einmal: Afropessimismus ist in erster Linie eher eine Metatheorie als eine Theorie. Sie ist pessimistisch, was die Aussagen von Theorien des Liberalismus betrifft, sofern diese Theorien versuchen, Schwarzes Leiden zu erklären, oder sofern sie Schwarzes Leiden mit dem Leiden anderer unterdrückter Lebewesen in Analogie bringen. Der Afropessimismus tut dies, indem er die Meta-Aporien ausgräbt und aufdeckt, die wie Landminen verstreut sind in alledem, was diese Theorien sogenannter universeller Befreiung als Wahrheit erachten.
Wenn, wie der Afropessimismus argumentiert, Schwarze keine menschlichen Subjekte sind, sondern strukturell unbewegliche Requisiten, Werkzeuge für die Ausführung weißer und nicht-Schwarzer Fantasien und sadomasochistischer Vergnügungen, dann bedeutet dies auch, dass auf einer höheren Abstraktionsebene die Ansprüche der allgemeinen Menschlichkeit, denen die oben genannten Theorien anhängen, von einer Meta-Aporie behindert werden: ein Widerspruch, der sich immer dann manifestiert, wenn man sich ernsthaft mit der Struktur von Schwarzem Leiden im Vergleich mit der vermuteten universellen Struktur aller fühlenden Wesen beschäftigt. Auch hier verkörpern Schwarze eine Meta-Aporie des politischen Denkens und Handelns – Schwarze sind der Stock in den Speichen.
Schwarze nehmen nicht dieselbe Rolle ein wie politische Subjekte; stattdessen werden unsere Körper und unsere Energien für postkoloniale, migrantische, feministische, LGBTQ-, Transgender- und Arbeiter-Agenden instrumentalisiert. Diese sogenannten Verbündeten werden niemals durch Schwarze Agenden autorisiert, die auf den ethischen Dilemmata der Schwarzen selbst basieren. Eine Schwarze radikale Agenda ist für die meisten Linken zutiefst verstörend – man erinnere sich an Bernie Sanders –, denn sie entstammt dem Umstand eines Leidens, für das keine denkbare Strategie der Wiedergutmachung existiert – kein Narrativ sozialer, politischer oder nationaler Erlösung. Diese Krise, nein, diese Katastrophe, diese Erkenntnis, dass ich ein fühlendes Wesen bin, das Worte wie »Sein« oder »Person« nicht zur Selbstbeschreibung verwenden kann, ohne Anführungszeichen oder die hochgezogenen Augenbrauen von jemandem in Hörweite zu riskieren, war paralysierend.
Ich war überzeugt, wenn eine Geschichte der palästinensischen Erlösung erzählbar wäre …, dann würde ihre Auflösung in der Rückgabe des Landes, einer räumlichen, kartografischen Erlösung gipfeln; und wenn eine Geschichte von der Erlösung der Klassen erzählt werden könnte …, dann würde ihre Auflösung in der Wiederherstellung des Arbeitstages kulminieren, sodass die Arbeit endete, wenn der Mehrwert auf den Müllhaufen der Geschichte verbannt würde, eine Erlösung des Zeitlichen; mit anderen Worten: Wenn eine Erzählung von postkolonialer Erlösung und die Erlösung der Arbeiter:innenklassen möglich war, dann müsste es auch ein Narrativ geben, das die Erlösung der Schwarzen erzählte und die Zeit wie den Ort ihrer Unterwerfung zurückerstattete. Ich habe mich geirrt.
Ich hatte nicht tief genug gegraben, um zu erkennen, dass die Schwarzen zwar die zeitliche und räumliche Unterwerfung durch die kartografische Entwurzelung und die Hydraulik des kapitalistischen Arbeitstages erleiden, dass wir aber auch als die Wirte menschlicher Parasiten leiden, obwohl diese Menschen selbst die Wirte des parasitären Kapitals und des Kolonialismus sein konnten. Ich hatte mich der Theorie zugewandt (zunächst im kreativen Schreiben und erst viel später als kritischer Theoretiker), auf dass sie mir dabei hilft, die Geschichte von der Befreiung der Schwarzen – der politischen Erlösung der Schwarzen – zu finden und zu erfinden. Was ich stattdessen fand, war, dass Erlösung als Erzähltechnik parasitär war und sich zu Zwecken ihrer Kohärenz von mir ernährte. Alles, was in meinem Leben Bedeutung besaß, war unter den Begriffen der »kritischen Theorie« und der »radikalen Politik« rubriziert, und die Parasiten waren das Kapital, der Kolonialismus, das Patriarchat und die Homophobie gewesen. Und nun war mir klar, dass ich den Anschluss verpasst hatte. Meine Parasiten waren Menschen, alle Menschen – die Habenden wie die Habenichtse. Wenn kritische Theorie und radikale Politik sich von dem Parasitismus befreien wollen, den sie bisher mit den radikalen und progressiven Bewegungen der Linken gemeinsam hatten, das heißt, wenn wir nicht leugnen wollen, sondern uns befassen wollen mit dem Unterschied zwischen Menschen, die unter einer »Ökonomie der Verfügbarkeit«8 leiden, und Schwarzen, die einen »sozialen Tod«9 erleiden, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie die Erlösung der Subalternen (eine Erzählung zum Beispiel von palästinensischer Fülle, Verlust und Wiederherstellung) gerade durch die (Wieder-)Einsetzung eines Gewaltregimes ermöglicht wird, das Schwarze von der Erlösungserzählung ausschließt. Dies erfordert erstens ein Verständnis des Unterschieds zwischen Verlust und Mangel und zweitens ein Verständnis dafür, wie die Erzählung von subalternem Verlust auf den Trümmern Schwarzen Mangels errichtet ist.
Sameer und ich teilten keine universelle postkoloniale Grammatik des Leidens. Sameers Verlust ist greifbar: Land. Das Paradigma seiner Enteignung entfaltet den Kapitalismus und die Kolonie. Wenn es nicht greifbar ist, so ist es zumindest kohärent, wie beim Verlust von Arbeitskraft. Doch wie soll man den Verlust beschreiben, der die Welt ausmacht, wenn alles, was man über diesen Verlust sagen kann, in der Welt verkapselt ist? Wie erzählt man den Verlust des Verlustes? Was ist der »Unterschied zwischen […] etwas zu retten […] [und nichts] zu verlieren zu haben«? 10 Sameer zwang mich, der Tiefe meiner Isolation auf eine Art und Weise gegenüberzutreten, die ich hatte vermeiden wollen; eine tiefe Grube, aus der mich weder die postkoloniale Theorie noch der Marxismus oder die Geschlechterpolitik eines unnachgiebigen Feminismus zu retten vermochten.
Warum ist Gewalt gegen Schwarze keine Form von rassistischem Hass, sondern das Genom der menschlichen Erneuerung; ein therapeutischer Balsam, den das Menschengeschlecht zu seiner Selbstvergewisserung und zu seiner Heilung bedarf? Warum muss die Welt diese Gewalt reproduzieren, diesen sozialen Tod, sodass das soziale Leben die Menschen regeneriert und davor bewahrt, die Katastrophen einer psychischen Inkohärenz zu erleiden, sprich eines Mangels? Warum muss die Welt sich von Schwarzem Fleisch ernähren?
3
Als der Arzt und die Krankenschwester zurückkamen, war ich endlich in der Lage zu sprechen. Sie fragten, wie es zu meinem Zusammenbruch gekommen sei. Ich sagte ihnen, es sei der Stress der Graduiertenschule. Der beste Weg, mit einem Verhör klarzukommen, ist, ein wenig Wahrheit in die Lüge einzuweben. Ich konnte ihnen nicht sagen, dass mir plötzlich klar geworden war, was es heißt, ein Afropessimist zu sein; dass mein Zusammenbruch durch einen Durchbruch ausgelöst worden war, bei dem ich endlich verstanden hatte, warum ich zu schwarz war, um gepflegt und umsorgt zu werden. Wie eine Fledermaus, die durch eine Höhle flitzt, suchte mein Geist nach Antworten durch Echoortung. Doch keine Fackel warf ihr Licht auf die Medikamente, die ich einnahm; stattdessen fand ich die vergessenen Zeilen meines Gedichts.
zu Halloween wusch ich mein
Gesicht und zog meine
Schulkleidung an ging von Tür zu
Tür als Alptraum.
for Halloween I washed my
face and wore my
school clothes went door to
door as a nightmare.
*Etwas, das durch Angst hervorgerufen oder verursacht wird.
**Jared Sexton beschreibt libidinöse Ökonomie als »die Ökonomie, oder Distribution und Arrangement, von Begierde und Identifikation (ihre Kondensation und Verschiebung) sowie die komplexe Beziehung zwischen Sexualität und Unbewusstem.« Zweifellos agiert die libidinöse Ökonomie in verschiedenen Ausmaßen und ist so »objektiv« wie die politische Ökonomie. Es ist wichtig zu sehen, dass sie nicht nur in Verbindung steht mit Formen von Anziehung, Zuneigung, Allianz, sondern auch mit Formen von Aggression, Zerstörung und der Gewalt von tödlichem Konsum. Marriott unterstreicht, die libidinöse Ökonomie sei »die gesamte Struktur des psychischen und emotionalen Lebens«, etwas, das die von Gramsci und anderen Marxist:innen beschriebene »Gefühlsstruktur« einbezieht und über sie hinausgeht; sie ist eine »Ausschüttung von Energien, Sorgen, Aufmerksamkeiten, Lüsten, Geschmäckern, Abneigungen und Phobien, die sowohl zu enormer Beweglichkeit als auch hartnäckiger Fixation in der Lage sind.«
KAPITEL ZWEI
Saft aus einem Halsknochen
1
Im Alter von elf Jahren lag ich nachts allein im Dunkeln auf dem Fußboden unseres Wohnzimmers und lauschte gregorianischen Gesängen, Tonbandaufnahmen des Chors, in dem meine Mutter sang, des Chors in der Basilica of Saint Mary in der Innenstadt von Minneapolis. Allein im Dunkeln sah ich mich zehn Jahre in der Zukunft, in eine weiße Soutane gehüllt, gerahmt von zwei Ministranten, die mir den kalten steinernen Gang nachfolgten. Die kühle Kathedralenluft war mit einer Spur Weihrauch gewürzt. Im Sommer 1967 war es schwül in Minnesota. Der Sommer der Liebe an der Küste Kaliforniens war im Land der zehntausend Seen eine luftfeuchte, von Moskitos durchschwärmte Jahreszeit. Doch auf dem Boden war es kühl, sodass ich ohne Hemd auf dem Teppich lag und meine Haut den volltönenden Klängen überließ, Kielwasser um Kielwasser aufsteigender Wellen, die ich durchtauchte und mich als Priester imaginierte. Sanktuarium.
Im Alter von elf Jahren war ich kein Afropessimist, und meinem Wissen über das, was mir so viel Angst machte, fehlte ein Critical-Race-Vokabular. Doch ich wusste, dass ich Schwarz war; nicht weil der Geruch von Filé-Pulver und Räucherwurst, die in einer angedickten Gumbo-Mehlschwitze köchelten, aus meinem und keinem anderen Haus in der Nachbarschaft aufstieg, sondern weil wir die Einzigen waren, die sie Negro nannten. Erst im folgenden Jahr, 1968, als ich zwölf wurde, würde ich zu einem Schwarzen. Im Dunkeln, als ich mit elf Jahren auf dem Boden des Wohnzimmers lag, wusste ich, dass ich ein Negro war, nicht aufgrund meiner Kultur, sondern weil diese Tatsache die Quelle meiner Scham war; einer Scham, die in der Nachbarschaft niemand teilte. Die gregorianischen Gesänge zitterten in meiner Brust und weiteten die Dunkelheit zu breiten, kavernenhaften Katakomben aus, die sich durch mich hindurch und aus mir hinaus erstreckten zur anderen Seite hin, zu jener Seite, wo ich mich in der Zukunft sah, einer Zukunft, in der ich von meinen Gemeindemitgliedern verehrt würde, anstatt geschmäht zu werden, wie mich in der ersten Klasse ein kleines Mädchen geschmäht hatte, das meine Hand nicht halten wollte aus Angst, dass der Ruß meiner Haut sie beflecken könnte. Im Klangtunnel meiner Zukunft fielen die Kinder und meine Lehrerinnen und Lehrer vor mir auf die Knie, wenn ich an ihnen vorbeiging, sie standen und knieten auf meinen Befehl hin, sie beichteten mir ihre Sünden, bevor sie des Leibes Christi würdig wurden. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich wollte seine Hand nicht halten, weil sein Ruß auf mich abfärben würde. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich nannte ihn einen Affen, als er im Sportunterricht das Tau hochkletterte. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich drückte meine Zunge zwischen Zähne und Oberlippe und kratzte mir die Achseln, als er sich herunterhangelte. Vergib mir, Vater, denn wir haben gesündigt. Wir lachten. Vergib mir, Vater, denn wir haben gesündigt. Wir drückten sein Gesicht in den Schnee. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich nannte ihn »Freund« und brachte ihn aufgrund der Neugier meiner Mutter mit nach Hause. Wie fühlt es sich an, fragte sie, ein Negro zu sein? Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich brachte ihn dazu, sich vor die Klasse zu stellen und uns den Treueschwur auf die Vereinigten Staaten aufzusagen.
Meine Brust, meine Arme und der cabernetfarbene Teppich saugten ihre Beichten auf wie ein Weizenfeld, das den Klang des Regens wiedergibt. Wenn meine Tanten und Onkel aus New Orleans oder von jenem Ort mit dem süßlich-beißend riechenden Boden vierzig Meilen flussaufwärts von New Orleans zu Besuch kamen, fragten sie mich, ob ich das Licht eingeschaltet haben wollte. Im Süden brüteten Kinder nicht im Dunkeln vor sich hin. Nein, Tante Joyce, ich will die Dunkelheit. Entspannst du dich, Ba-by? Ja, antwortete ich, ich entspanne mich. Was ich wirklich meinte, war, dass ich meine Hymne der Erlösung komponierte.
Ich ruhte mich aus, doch ich entspannte nicht. Entspannung ist ein Zustand, in der Gegenwart zu ein, in Szenen der Gegenwart zu leben. Als Junge lebte ich nur selten in der Gegenwart. Es schmerzte mich zu sehr, in der Gegenwart zu sein. Wenn ich an mich dachte, befand ich mich selbst in der Zukunft. Die Gegenwart war die Buße, das, was ich für meinen Ruß ableisten musste. Ich träumte, eines Tages würde die Gegenwart vorbeigehen. Doch jedes Jahr, das ich erreichte, musste ich feststellen, dass die Gegenwart ihre Koffer längst gepackt und sich auf den Weg zu mir gemacht hatte. Sie wartete mit meinem Zimmerschlüssel in der Lobby auf mich. Noch während ich auf dem Boden unseres Wohnzimmers lag und den Sünder:innen der Gegenwart in ihrer Inkarnation als Bittstellende von morgen die Beichte abnahm, wusste ich an irgendeinem untergründigen Ort hinter den Gesängen, dass die Gegenwart immer auf mich warten würde: Am Ende dieses Sommers wäre die sechste Klasse nicht anders als das langsame, saure Dahintropfen vergangener Jahre; ein weiteres Jahr, in dem ich mich selbst mit den Augen anderer sehen würde: Unser junger Negro-Nachbar. Der Wilderson-Bub. Gepflegter, als man gedacht hätte. Höflich. Kann sich gut ausdrücken. Wohlriechend. Kämpferisch. Kommt in Rechtschreibung nicht mit. Hat den andern in Rechtschreibung was voraus. Kann besser lesen als seine Klassenkameraden. Hinterher mit seinen Mathe-Hausaufgaben. Gräuliche Beine. Gorilla-Lippen. Als Bettnässer bekannt.
Die gerade vergangene Weihnacht legte mir meine Lehrerin nahe, die fünfte Klasse zu wiederholen. In der vierten Klasse sagten sie, ich sei so klug, dass ich die fünfte Klasse überspringen könnte; allerdings gefiel es meinen Eltern nicht, dass Kinder Klassen überspringen. In der fünften Klasse ging es schließlich los, dass ich ins Bett machte, und mein Verstand war lahmgelegt. Ich konnte oder wollte morgens nicht mehr aufstehen. Ganze Monate vergingen, ohne dass ich ein einziges Mal Hausaufgaben machte. Als ich in jenem Sommer den gregorianischen Gesängen lauschte, staunte ich nicht schlecht, dass ich die fünfte Klasse geschafft hatte. Im März hatte ich meine Lehrerin um all die Hausaufgaben gebeten, die ich nicht abgegeben hatte.
Sie sagte: »Wie wär’s mit den Aufgaben von Oktober an?«
In den Osterferien verbarrikadierte ich mich in meinem Zimmer und erledigte die Mathe- und Leseaufgaben von sechs Monaten innerhalb von einer Woche. Im April klatschte ich sie ihr auf den Schreibtisch. Sie korrigierte sie alle, und ich bekam nur Einsen und Zweien. Es dauerte eine Woche, bis sie alles korrigiert hatte, und sie schimpfte mit mir, dass ich ihr das ganze Jahr über solche Angst um mich gemacht hatte. Ich bekam mein Lob auf indirektem Weg.
Wäre ich weiß gewesen, hätten mich meine Sportlichkeit und mein Charme beliebt gemacht. Auch hätte ich beliebte Freunde gehabt. Doch meine Freunde stammten aus dem Land der ungeeigneten Spielzeuge. Liam Gundersen fühlte sich genauso bedroht von einem Bären wie von einem Schmetterling. Er hyperventilierte und biss sich in den Arm, wenn jemand die Hand gegen ihn erhob. Sein Vater und seine Mutter kamen aus Norwegen und waren in einem japanischen Internierungslager gefoltert worden, als sie Missionare in China waren. Die Kinder auf dem Spielplatz drehten durch, wenn Liam sich in die Arme biss. Er war der Jüngste von dreizehn Kindern, die alle erwachsen und ausgezogen waren. Seine Brüder hatten ihm Romane von Graham Greene, John le Carré und Ian Fleming im Haus hinterlassen. Liam und ich verbrachten viele Stunden damit, sie auf seinem Dachboden zu lesen. In den drei Jahren von meinem elften bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr auf Liams Dachboden verstand ich diese Bücher nicht ganz so gut wie Liam; ebenso wenig konnte ich die Brocken von französischen Wörtern übersetzen, die Graham Greene wie Kleingeld auf seinen Seiten verteilte. Liam allerdings schon. Oskar Nilsens Vater war Chiropraktiker, was mit »Hexendoktor« gleichbedeutend war in der reichen weißen Enklave von Kenwood, wo die Eltern leitende Angestellte waren und Bankiers, Architektinnen, Anwälte, Ärztinnen und Staatsmänner wie der Senator und künftige Vizepräsident Walter Mondale sowie Mark Dayton, ein Politiker, dessen Familie die Läden Target und B. Dalton Bookseller gehörten. Dann war da noch Elgar Davenport, der klein und klobig war und die Welt durch lupendicke Brillengläser betrachtete, mit einem linken Auge, das wie verloren umherirrte. Elgar war ein stiller Grund zur Scham für seine Mutter, die blond, schlank und sportlich war und immer vor ihm herging. Elgar hatte rotes Haar und Sommersprossen. Mister Davenport fuhr eine rote Corvette und »spekulierte an der Börse«. Ich glaubte, es wäre cool, wenn mein Vater einen Sportwagen in meiner Farbe kaufen würde; dann aber, so schnell mir der Gedanke in den Sinn gekommen war, erschloss sich mir die Kehrseite. Ich spürte die Kehrseite davon, einen Sportwagen in meiner Farbe zu besitzen, ohne dass ich Worte dafür besaß. Wissen ist häufig weit mehr, als sich in Worten ausdrücken lässt.
Elgar Davenport, Liam Gundersen, Oskar Nilsen und ich spielten Geheimagenten auf dem Gelände einer dunklen Steinvilla gegenüber von unserem Haus. Die Villa hatte einen Aufzug und, wie man mir erzählte, zehn Schlafzimmer, wobei ich in den sechzehn Jahren, die ich gegenüber wohnte, nie in der Villa gewesen war. Sie wechselte ihre Besitzer:innen: einmal eine wohlhabende Familie mit fast so vielen Kindern wie Schlafzimmern (auch wenn sie zu jung waren, um mit mir zu spielen); ein anderes Mal Senator Mark Dayton. Es war der Wohnsitz seiner Familie, wenn sie nicht in Washington waren, und sie lebten dort, bis er Gouverneur wurde und den Gouverneurssitz in St. Paul bezog. Wir spielten Geheimagenten am Ende dieses Grundstücks, weit entfernt vom Hauptgebäude, in der Nähe einer Ein-Zimmer-Remise am Ende der breiten Kiesauffahrt. Die Remise erfüllte ihren Zweck; sie war für die Inszenierung unserer Spionagegeplänkel von entscheidender Bedeutung. Manchmal war sie die sowjetische Botschaft in einer dunklen, bewaldeten Ecke von Washington, D. C. Manchmal war sie eine SMERSH-Division zur Ausbildung von Attentätern, die für den Mord an James Bond trainiert wurden. Unsere Spionagespiele hatten eher etwas von Salvador Dalí als von Ian Fleming. Zum Beispiel säumte ein niedriger Drahtzaun, der den Hinterhof eines kleineren Herrenhauses von der Dayton-Villa trennte, ein Ende des Grundstücks. Wir nannten diesen Drahtzaun die Berliner Mauer, ohne irgendwelche geografischen Korrekturen vorzunehmen, wie etwa die Verlegung des Herrenhauses von Washington, D. C. nach Berlin. Die Surrealisten in uns waren stärker als die kartografischen Realisten.
Wenn wir keine Streichhölzer zogen, waren wir am Ende einfach vier Jungs, die alle CIA-Agenten spielten, ohne einen einzigen Kommunisten. Eines unfreundlichen Tages zogen Elgar und ich die Streichhölzer, die uns zu sowjetischen Spionen machten. Liam und Oskar waren die Guten. Unser Spiel beinhaltete zwei rennende und schreiende einfältige Sowjets und zwei einfältige Amerikaner, die ebenfalls rannten und schrien, während sie versuchten, den niedrigen Drahtzaun der Berliner Mauer zu überwinden und zum Checkpoint Charlie zurückzugelangen, bevor die Sowjets sie erwischten.
Elgar und ich kauerten hinter der Remise am Ende der Kiesauffahrt. Die Amerikaner würden von irgendwo in der Nähe der Remise kommen, doch wir wussten nicht, von welcher Seite des Gebäudes aus sie auftauchen würden. Gewöhnlich war einer der Jungen, die die Guten spielten, der Lockvogel, derjenige, der hinter einem Baum an der Seite der Remise hervorkommen und mit halsbrecherischer Geschwindigkeit zu einer weit entfernten Stelle des Zaunes laufen würde, während der andere Junge wartete, bis beide Sowjets abgezogen wären. Dann würde er versuchen, zu entkommen. Elgar und ich lugten hinter der Remise hervor und warteten auf die beiden amerikanischen Spione. Unsere Daumen und Zeigefinger formten wir zu Ringen und hielten sie als Ferngläser vor unsere Augen.
»Hey«, raunte Elgar mir zu.
»Ja«, flüsterte ich zurück.
»Meine Mom hat mir gesagt, ich soll dich mal fragen, wie du dich als Negro fühlst.«
»Keine Ahnung«, sagte ich nicht mehr ganz so leise.
»Warum denn?«
»Ziemlich gut … schätze ich.«
»Da kommen sie!«
Oskar und Liam hatten sich in Bewegung gesetzt! Wir erwischten Liam, während es Oskar gelang, sich bis zum Checkpoint Charlie im Garten der McDermotts durchzuschlagen.
Das nächste Mal, als ich Elgar sah, teilte er mir mit, dass seiner Mutter meine Antwort nicht gefiel. Ich war besorgt. Ich fragte ihn, ob sie wütend sei. Nein, sagte er. Ich fragte ihn, ob er sich ganz sicher sei. Sicher, ich bin ganz sicher, sagte er, sie will, dass du zu uns zum Mittagessen kommst. Ich sagte, okay, aber ich müsste erst meine Mom fragen.
Celina Davenport war wesentlich größer als ihr Mann, Elgar senior. Sie hatte kein rotes Haar, wie Elgar junior und Elgar senior es hatten. Bevor wir uns zum Mittagessen hinsetzten, nahm sie mich mit ins Wohnzimmer und zeigte mir den Kaminsims mit ihren Tennistrophäen eines Colleges, von dem sie sagte, es sei eines der »Seven Sisters« an der Ostküste, wo keine Jungen studieren dürften. Mit ihrer heiseren Stimme, die nach zahllosen trockenen Martinis klang, sagte sie, dass sie an diesem Ort geradezu die Wände hochgegangen war.
»Elgar weiß, wie ich die Wände hochgehe«, sagte sie und verstrubbelte seine Haare.
Sie führte uns in die Küche. Ich war so verkrampft, dass ich überhaupt hier war, und ich wusste nicht, warum ich hier war, sodass ich ihr nur halb zuhörte und so bloß halb verstand, was sie meinte. Doch war mir beigebracht worden, dass man, wenn man nicht weiß, was man zu jemandem sagen soll, anstatt eine unbe hagliche Stille aufkommen zu lassen, einfach eine Frage in die Stille stellen solle. Also fragte ich sie, warum sie die Wände hochgehen wollte. Sie sah mich an, als hätte ich sie gefragt, ob zum Abendessen Katzenfutter auf den Tisch komme. Dann lachte sie und rief ihr Dienstmädchen, Mrs. Szymanski, um das Mittagessen zu servieren. Wir aßen in der Küche, Celina Davenport, Elgar und ich. Mrs. Szymanski stellte einen Teller mit Sandwiches auf den Tisch und goss Limonade für Elgar und mich ein. Auch Mrs. Davenport trank Limonade, allerdings mit einem Schlückchen Gin. So verstohlen, wie ich konnte, hob ich eine Seite der Brotscheibe an, um einen Blick darunter zu werfen. Ich war nicht verstohlen genug gewesen.
»Stimmt was nicht mit dem Sandwich, Frankie?«, fragte Mrs. Davenport.
»Der Name gefällt ihm nicht, Mom.«
»Welcher Name gefällt dir, Schätzchen?«
»Frank«, sagte ich und versuchte, nicht so schroff zu klingen wie Elgar.
»Deine Mutter nennt dich Frankie, wenn sie dich bittet, ins Haus zu kommen.« Das erschreckte mich, denn mir war nicht klar gewesen, dass sie meine Mutter überhaupt kannte. Ich wusste, dass meine Mutter ihr bekannt war, denn die Davenports hatten eine Petition mit fünfhundert Haushalten unterzeichnet, um uns aus Kenwood fernzuhalten; und die meisten der Nachbarinnen und Nachbarn hatten nie ein Wort mit meiner Mutter gewechselt. Ich sagte nichts.
Sie fragte noch einmal: »Was stimmt nicht mit dem Sandwich … Frank?«
»Nichts, Mrs. Davenport.«
»Nun sag schon. Ich bin nicht beleidigt, wenn du meine Sandwiches nicht magst.« Die Ironie ihrer Aussage entging mir damals, denn es waren nicht ihre Sandwiches. Mrs. Szymanski hatte sie zubereitet.
»Ich wollte nur mal sehen, wo das Fleisch ist, damit ich es in die Mitte schieben kann.«
Amüsiert sagte Elgars Mutter: »Es ist ein italienisches Sandwich: Provolone, Spinat und Tomaten und eine Idee Pesto. Man bekommt Blähungen, wenn man bei dieser Hitze Fleisch isst.«
»Meine Mutter sagt das auch«, meinte ich. »Sie macht die auch manchmal.«
»Ach, tut sie das?« Mrs. Davenport nickte und zündete sich eine Pall Mall an. »Quäl dich bitte nicht. Du brauchst es nicht zu essen.«
Das war eine vorübergehende Gnadenfrist vor dem Todesurteil, bis ich mich daran erinnerte, dass meine Mutter mir aufgetragen hatte, ich solle mich von meiner besten Seite zeigen. Ich nahm einen großen Bissen. Eine Übelkeit kitzelte meinen Magen, als ich versuchte zu schlucken. Die Mayonnaise, der gummiartige Käse und die sauren Tomaten, kombiniert mit diesem Hauch von Pesto, kämpften sich in teigigen, halb zerkauten Pfropfen meine Speiseröhre runter.
Dann stellte Celina Davenport die Frage, die Elgar mir an der Remise vor der Berliner Mauer gestellt hatte. Auf einem Stuhl direkt gegenüber von mir nippte sie an ihrer mit Gin gespickten Limonade, nahm einen weiteren Zug an ihrer Zigarette und starrte mir ins Gesicht, während sie auf meine Antwort wartete.
Ich hörte auf zu essen. (»Ich würde nie einen Mann einstellen, der eine Mahlzeit vor dem Essen salzt.« Einer der Grundsätze meines Vaters. »Das bedeutet, dass du nichts Unüberlegtes sagen oder voreilig handeln solltest, Frankie. Wenn du die Antwort nicht weißt, denke nach und nimm dir einen Moment Zeit, um herauszufinden, was gefragt wurde.«) Aufmerksam sah ich mich in dem Raum um. Ihre Spitzenvorhänge, die sich im Wind vor den Küchenfenstern wölbten; ihr polierter grüner Gasherd mit antiken goldenen Knöpfen; ihr Frigidaire-Kühlschrank, der wie der Silver Surfer im Marvel Comic schimmerte, mit einem Eiswürfelbereiter in der Tür und einem Wasserspender, sodass Eis und Wasser ausgegeben werden konnten, ohne dass man das Gerät öffnen musste, etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte; ihr weißer Tennisrock mit Bügelfalten, ihre weißen Turnschuhe, ihre wohlgeformten Beine und die Art und Weise, wie sie wartete, ohne zu blinzeln. Sie starrt mich an wie ein ostdeutscher Grenzsoldat. Die falsche Antwort, und du wirst es nicht zurückschaffen. Sie ist nicht nur eine hübsche Tennislady, und das sind nicht nur hübsche Tennisschuhe; in den Spitzen ihrer Schuhe sind ausfahrbare Messerklingen verborgen, und sie wird dich ins Schienbein treten, wenn du Papas Grundsatz vergisst und etwas Unüberlegtes sagst.
»Mutter«, sagte Elgar, »ich habe dir schon gesagt, was er gesagt hat.«
»Ich kann dir nicht mal vertrauen, dass du das richtige Wechselgeld nach Hause bringst, Elgar. ›Ziemlich gut. Schätze ich‹? Elgar, du redest so. Sein Vater ist Pädagoge.«
»Ich hab noch mehr sagen wollen,« entschuldigte ich mich.
»Na sicher wolltest du das. Elgar hat dir nicht die Möglichkeit dazu gegeben.«
Sie wirkte zufrieden. Ich wollte, dass das so bleibt. Jeder Spion weiß, wie man die Wachleute bei Laune hält.
Ich erzählte ihr, es sei nett, ein Negro zu sein. Sie stieß einen weiteren schmalen Rauchzyklon aus. Sie guckte nicht gerade erfreut drein. Also sagte ich ihr, dass Negros coole Sachen machen dürfen.
»Was zum Beispiel?«, fragte sie aufgeweckter.
Ich war aus der Fassung gebracht, und so erzählte ich ihr vom Masongate Resort am Gull Lake in der Nähe von Brainerd, Minnesota. Ich erzählte, dass unsere Familie und eine ganze Menge anderer Negro-Familien dort jeden August eine Woche zusammenkämen zum Angeln, Schwimmen, Boot- und Wasserskifahren. Das Masongate Resort war ihr bekannt, doch irgendetwas von meiner Geschichte passte nicht zu dem, was sie darüber wusste. Sie fragte mich, ob ich das Masongate Resort vielleicht mit einem anderen Ort verwechselte.
Sie stand auf und lehnte sich auf den Tresen, mit dem Rücken zum Fenster. Mit ihrer ersten Zigarette zündete sie sich eine weitere an und schnippte den Stummel der ersten zum Fenster raus.
»Was würde Smokey der Bär denn dazu sagen?«, fragte Elgar alarmiert.
»Irgendwann wird aus dir mal ne richtig gute Ehefrau, Elgar«, sagte sie, schaute während ihrer Worte jedoch zu mir.
Das erste und einzige Mal, dass sie ihre Augen von mir abgewandt hatte, war, als sie ihr Feuerzeug benutzte, um sich ihre erste Zigarette anzustecken. Jetzt löste sie ihren Blick von mir und blies den Rauch zur Seite aus. Als sie mich wieder ansah, war in ihrem Gesicht noch immer kein Anflug von Wärme zu spüren.
Ich log, und sie wusste es. Wir hatten nie im Masongate Resort gewohnt; wir wohnten in den Twilight Loon Cabins, zwei Meilen entfernt von Masongate, am Ufer des Sees mit Sümpfen anstatt Sandstränden. An einem Teil des Sees, wo es keine Schnellboote gab, keine Grand Lodge mit Abendunterhaltung, keine Wassersportarten wie Jetskiing, kein elegantes Restaurant, in dem Amerikanischer Hecht mit Bratkartoffeln serviert wurde. Statt der üppigen, klimatisierten Räume von Masongate gab es in den Twilight Loon Cabins Selbstversorgerhütten mit Fliegengittertüren, von denen die Farbe abblätterte, und die Geräusche, wenn sie geschlossen wurden, erschallten klatschend über den gesamten See. Die Lichter auf dem Gelände lagen so weit auseinander, dass man nachts eine Taschenlampe brauchte, um von einer Hütte zur nächsten zu gelangen. Erst im Jahr zuvor, 1966, hatten die vier Negro-Familien begonnen, die Kinder mit nach Masongate zu nehmen, um dort zu Abend zu essen und die dort angebotenen Freizeitmöglichkeiten zu nutzen. Wir wohnten jedoch nicht dort, und irgendetwas sagte mir, dass Mrs. Davenport das wusste. Sie löschte die Glut der neuen Zigarette unter dem Wasserhahn.
»Elgar senior glaubt nicht, dass es die Twins dieses Jahr in die World Series schaffen werden«, sagte sie, als spräche sie mit jemandem, der nicht anwesend war. Sie ließ ein Glas mit Wasser aus dem Hahn volllaufen und trank einen Schluck davon. »Was ist aus seinem Stolz für seine Heimatmannschaft geworden?«
2
Pappige Klümpchen aus Mayonnaise, Tomaten, Käse und blanken Nerven, gut vermengt mit der neuen Erfahrung von Pesto, schwappten mir im Magen herum, während ich von Elgars Haus hügelaufwärts zu meinem Haus eilte. Als ich die hintere Verandatreppe hinaufkam, hörte ich im Radio ein Lied von Dinah Washington. Die grünen S&H-Rabattmarken und ein Sammelbüchlein zum Einkleben lagen auf dem Küchentisch neben einem Lehrbuch über Statistik fürs Psychologiestudium. Mom machte gerade eine Lernpause und klebte Rabattmarken in das Buch ein.
»Und?«, sagte sie.
»Die haben kein Fleisch in ihren Sandwiches.« Mom lachte und drehte das Radio runter.
»Wir sind in Minnesota«, sagte sie, »aber wir sind nicht aus Minnesota. Bull Connor hätte sich das Geld für seine Kampfhunde sparen können, wenn er das Essen dieser Frau gehabt hätte.«
»Mom?«
»Ja?«
»Ach, nichts.«
»Was ist los?«
»Wie fühlst du dich?«
»Ich fühle mich, als sollte ich mit einem Mint Julep auf meiner Veranda stehen und mir kühle Luft zufächern, anstatt mir wegen Statistiken den Kopf zu verrenken oder Rabattmarken abzulecken.«
Ich hatte mich nicht geregt.
»Warum fragst du?« Sie saß auf genau der richtigen Höhe, um mir in die Augen zu schauen.
»Damit ich weiß, was ich das nächste Mal sagen muss.«
»Welches nächste Mal?«
»Das nächste Mal, wenn Mrs. Davenport mich fragt, wie es sich anfühlt, ein Negro zu sein.«
»Nein!« In ihrem Gesicht stand ein wütender Wunsch. »Nein, das hat sie dich nicht gefragt.« Sie presste ihre Handflächen auf den Tisch, als wollte sie unmittelbar aufstehen und Mrs. Davenport außer Gefecht setzen. Und was dann?, muss sie sich gefragt haben, denn sie blieb sitzen. Und was dann?
Sie lernte etwas Wichtiges über weiße Nordstaatler:innen der Oberschicht, etwas, das sie vor ihrem Umzug nach Kenwood nicht für möglich gehalten hätte: wie sich ein Krieg stellvertretend durch das Kind einer anderen führen ließ. Sie wusste nun, wie es sich anfühlen musste, von einer Lenkrakete getötet zu werden. Was für eine Frau würde dich mithilfe deines Kindes verletzen? »Das Gute, das Schöne und das Wahre«, lautete ein Grundsatz von Du Bois, den meine Mutter sehr schätzte. »Dies müssen unsere Bestrebungen sein. Und alles beginnt damit, wie man Menschen behandelt.« Dieses Langstrecken-Herumgepfusche mit meinem Verstand, und mein Sohn als deine Lenkrakete; falls es das war, was sie dachte, als ich nach Hause kam, dann hatte die Celina Davenport tief in ihrem Kopf meine Mom auch daran erinnert, wie sie Elgar und all die Kinder in dieser Nachbarschaft dazu brachte, sich zu Hause zu fühlen, wenn sie bei uns zu Besuch waren; wie sie die Eistüten für die Kinder immer mit einer halben Kugel extra vollschöpfte; wie sie am vierten Juli rote, weiße und blaue Malerhüte für die Kinder bastelte und ihnen die Wunderkerzen anzündete, wenn sie in einer Parade den Hügel hinaufstolzierten. Aber du verdrehst meinem Sohn den Magen und machst ihm Angst.
Eines Nachts, als ich älter und kurz davor war, allein zu leben, kam ich spät und leise nach Hause. Mutter war allein im Dunkeln vor einem Kaminfeuer. Vater lag auf dem Sofa ausgestreckt und schlief. Das weiche Glühen im Kamin war das einzige Licht im Raum. Mom steckte Nadeln in kleine Stoffpüppchen und gab ihnen die Namen von zwei ihrer weißen Kolleginnen. »Und die hier«, sagte sie lustvoll, als sie die Puppe piekte, »wird zittrig und gelähmt.« Ich lächelte und ging ins Bett, und sie ahnte nicht, dass ich sie gesehen hatte. Sie ist geistig gesund geblieben, dachte ich, als ich ins Bett ging. Nach allem, was sie durchgemacht hat, ist sie geistig gesund geblieben.
3
Das nächste Mal, als wir auf dem Villengelände gegenüber Geheimagenten spielten, zog ich ein Sowjet-Streichholz.
»Schon wieder?«, beschwerte ich mich.
Liam Gundersen war zusammen mit mir sowjetischer Agent; Elgar und Oskar waren beim MI6. Ich erwischte Elgar an der Berliner Mauer und sperrte ihn ins Wachhaus mit den imaginären Mauern aus Luft. Ich rannte am Zaun entlang, um Liam beim Fangen von Oskar behilflich zu sein, bevor Oskar nach Westberlin gelangen konnte. Ich war noch nicht weit gekommen, als ich Elgar schreien hörte.
»Ich bin entkommen!«
Sein kurzer, kräftiger Körper rollte über den Zaun.
Ich schrie zurück: »Du bist gefangen, du musst im Wachhaus bleiben!«
Er schrie: »Du hast mir keine Handschellen angelegt!«
Nun befand er sich hinter dem Zaun und raste durch den Garten der McDermotts, auf dem Weg in den Garten der Tysons. Ich war fuchsteufelswild.
»Bleib stehen, du Arschgesicht!«
Sein rotes Haar wellte sich im Wind. Er drehte sein sommersprossiges Gesicht zu mir um und lachte.
Mein Fuß stieß gegen etwas Festes auf der Erde neben dem Zaun. Es war eine Plastikflasche mit smaragdfarbener Palmolive-Spülseife. Ich bückte mich und hob sie auf. Ihre Schwere in meiner Hand war beträchtlich, denn sie war noch fast voll. Ich umklammerte die Flasche am Hals. Ich fühlte, wie mein Arm nach hinten schwang und sich dann nach vorne schleuderte. Die grüne Flasche drehte sich wirbelnd durch die Luft, bald ein Tomahawk, bald ein Zauberstab, während sie auf die Sonne zuschoss; das Zwölf-Uhr-Mittagslicht stieß durch die grüne Flüssigkeit wie durch ein Prisma, bis die Flasche im Schlund der Sonne verschwand. Um nicht zu erblinden, schloss ich meine Augen.
Plopp! Platsch!
Elgars Knie knickten ein. Er lag mit dem Gesicht nach unten im Garten der McDermotts.
Wir rannten an seine Seite. Grüne Spülseife sickerte aus einem Riss in der Plastikflasche ins Gras. Blut sickerte aus Elgars Schädel. Einer der Bügel seiner lupendicken Brillengläser war aus dem Scharnier gebrochen und lag neben seinem Kopf auf der Erde.
Doch es bedurfte einiger Augenblicke, bis das Wort Blut zu mir durchkam. Zuerst sah ich auf der Rückseite seines Schädels eine Haarlocke, ein rotes Haarbüschel, das schief abstand. Dann sah ich es als einen kleinen Wasserstrahl, wie den Wasserstrahl aus dem Trinkbrunnen vor Mrs. Andersons Klassenraum, der so klein war, dass die Lippen den Wasserhahn berührten, wenn man trank.
Liam und Oskar liefen los, um Hilfe zu holen.





























