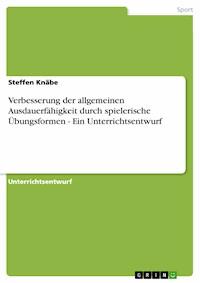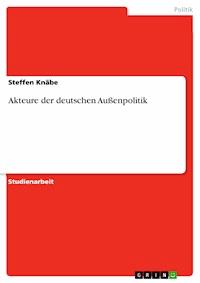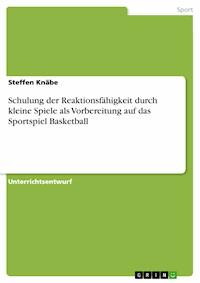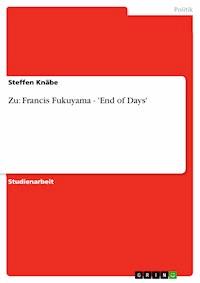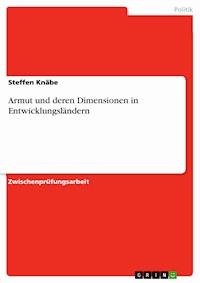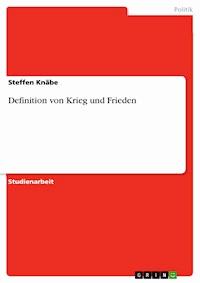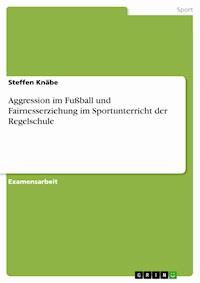
Aggression im Fußball und Fairnesserziehung im Sportunterricht der Regelschule E-Book
Steffen Knäbe
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Didaktik - Sport, Sportpädagogik, Note: 1,3, Universität Erfurt (Sport - und Bewegungswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Dass durch individuelle oder gesellschaftliche sportliche Betätigung ein reicher Schatz an Erfahrungen und ein gewisses seelisches Wohlbefinden für jeden Einzelnen möglich ist, scheint schon seit langem ein Aushängeschild der Körperertüchtigung. Dass der Sport auch in jedem Falle die Möglichkeit bietet, seinen eigenen individuellen Vorstellungen entsprechende Sportarten zu betreiben, und durch positiv wirkende psychische und physische Interaktionen, jeden Einzelnen zu integrieren versteht, geht mit Vorherigem durchaus einher. Man weiß, dass die Liste an positiven Faktoren des Sportes durchaus Blätter füllen könnte, aber man weiß auch, dass er gegenüber dem Alltag in unserer Gesellschaft einen entscheidenden Vorteil in sich trägt. Denn wenn oben bereits erwähnte körperliche oder verbale Interaktionen den Sport bestimmen, ist dieser in ein strenges Reglement eingefasst. Diese sportartspezifisch manifestierten Regeln gewähren, dass alle am Spiel beteiligten Parteien gleiche Bedingungen vorfinden, um erstens eine Chancengleichheit zwischen ihnen herzustellen, zweitens aber auch, und das stellt den Bezug zur vorliegenden Arbeit dar, immer wieder auftretende Aggressionen sofort negativ sanktionieren zu können, um entsprechende Eskalierungen nachhaltig zu unterbinden. Eine Regeltreue gibt es in unserer Gesellschaft nur bedingt. Deshalb sind moralische Werte, wie eine gewisse ´Fairness´ zwischen den Menschen unabdingbar. Im Rahmen dieser Arbeit werden die gerade angesprochenen Themenfelder Aggression und Fairness bearbeitet. Dabei wird anfangs eine theoretische Grundlage zu den Aggressionen geschaffen, die nach meiner Ansicht notwendig ist, um später gezielt auf das Handlungsfeld des Fußballs eingehen zu können. Involviert sind hierbei Ausführungen zu Formen und Arten aggressiver Handlungen, sowie eine spezielle Analyse des vermeidlichen Indikators aggressiver Verhaltensweisen im Sport, des sogenannten ´Foulspiels´. Nach Ausführungen zur Katharsis-Hypothese wird sich dann der Thematik ´Aggression in Schulen´ gewidmet, um abschließend praxisnahe Beispiele zur notwendigen Fairnesserziehung in Regelschulen zu liefern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2004
Ähnliche
Page 1
Page 3
2. Aggression in Schulen 36 Vorüberlegungen 36 2.1 Begriffsklärung 37 2.2 Bedingungsfaktoren aggressiven Schülerverhaltens 39 2.3 Typendifferenzierung 41 3. Soziales Lernen und Fairnesserziehung im Sportunterricht der Regelschule - unter besonderer Berücksichtigung des Sportspiels ´Fußball´ 43
3.1 Begriffsklärungen und Inhalte 43
3.2 Pädagogische Konsequenzen der Bedingungsfaktoren aggressiven Schülerverhaltens 53
3.3 Möglichkeiten zur Fairnesserziehung im Sportunterricht der Regelschule 57 Fazit 60 Literaturverzeichnis 62
Page 4
Vorüberlegungen
Dass durch individuelle oder gesellschaftliche sportliche Betätigung ein reicher Schatz an Erfahrungen und ein gewisses seelisches Wohlbefinden für jeden Einzelnen möglich ist, scheint schon seit langem ein Aushängeschild der Körperertüchtigung.
Dass der Sport auch in jedem Falle die Möglichkeit bietet, seinen eigenen individuellen Vorstellungen entsprechende Sportarten zu betreiben, und durch positiv wirkende psychische und physische Interaktionen, jeden Einzelnen zu integrieren versteht, geht mit Vorherigem durchaus einher.
Man weiß, dass die Liste an positiven Faktoren des Sportes durchaus Blätter füllen könnte, aber man weiß auch, dass er gegenüber dem Alltag in unserer Gesellschaft einen entscheidenden Vorteil in sich trägt. Denn wenn oben bereits erwähnte körperliche oder verbale Interaktionen den Sport bestimmen, ist dieser in ein strenges Reglement eingefasst. Diese sportartspezifisch manifestierten Regeln gewähren, dass alle am Spiel beteiligten Parteien gleiche Bedingungen vorfinden, um erstens eine Chancengleichheit zwischen ihnen herzustellen, zweitens aber auch, und das stellt den Bezug zur vorliegenden Arbeit dar, immer wieder auftretende Aggressionen so-fort negativ sanktionieren zu können, um entsprechende Eskalierungen nachhaltig zu unterbinden. Eine Regeltreue gibt es in unserer Gesellschaft nur bedingt. Deshalb sind moralische Werte, wie eine gewisse Fairness zwischen den Menschen unabdingbar.
Im Rahmen dieser Arbeit werden die gerade angesprochenen Themenfelder Aggression und Fairness bearbeitet. Dabei wird anfangs eine theoretische Grundlage zu den Aggressionen geschaffen, die nach meiner Ansicht notwendig ist, um später gezielt auf das Handlungsfeld des Fußballs eingehen zu können. Involviert sind hierbei Ausführungen zu Formen und Arten aggressiver Handlungen, sowie eine spezielle Analyse des vermeidlichen Indikators aggressiver Verhaltensweisen im Sport, des sogenannten ´Foulspiels´. Nach Ausführungen zur Katharsis-Hypothese wird sich dann der Thematik ´Aggression in Schulen´ gewidmet, um abschließend praxisnahe Beispiele zur notwendigen Fairnesserziehung in Regelschulen zu liefern.
Page 5
1. Aggression
1.1 Definitionsproblematik
Die Diskussionen um den Begriff der Aggression verlaufen nicht erst seit gestern äußerst kontrovers. Seit vielen Jahrzehnten versuchen sich Wissenschaftler und Gelehrte einer gemeinsamen Definition dieses schwammigen Begriffes anzunähern. Allein unter dem Aspekt, dass sich in sämtlicher Literatur zu diesem Thema weit mehr als eine Theorie über die Entstehung von Aggressionen wieder finden lassen, kann darauf geschlossen werden, dass die Forscher auch in Fragen der Definition aus verschiedenen Richtungen auf eine allgemeine und operationalisierbar erscheinende Begriffsbestimmung eingehen.
Bis heute ist es also nicht gelungen eine einheitliche und befriedigende Klärung des Inhaltes vorzunehmen. Da es mir aber wichtig erscheint, den bloßen Charakter entsprechender Aggressionen zu verstehen, bevor man auf verschiedene Bereiche eingeht, in denen sie - in meinem Fall der Mannschaftssport Fußball - eine Rolle spielen, werde ich in kommendem Abschnitt meiner Arbeit die mir am wichtigsten und allgemein konsensfähigsten Definitionsansätze aufzeigen. Zudem scheint es mir auch bedeutend, die Begrifflichkeit ´Aggression´ von dem vermeidlichen Vorläufer ´Aggressivität´ zu trennen und danach das Wesen einer Gewalttat darzustellen und mit einer aggressiven Handlung zu vergleichen, da die Begriffe ´Gewalt´ und auch ´Aggression´ in ihrem Bedeutungsgehalt sehr vielschichtig und inkonsistent sind und auch oft in der Alttagssprache verwendet und in Verbindung gebracht werden. Nach diesen allgemeinen Definitionsansätzen und als Abschluss des Punktes 1.2 werde ich die Begriffe jeweils im Handlungsfeld des Fußballs aufgreifen und von-einander abzugrenzen.
Der Thematik der Autoaggression werde ich mich in dieser Arbeit nicht stellen, da sie mir im Hinblick auf Aggressionen im Fußball und Möglichkeiten der Fairnesserziehung im Sportunterricht als eher unwichtig erscheint.
Page 6
1.2 Begriffsklärungen
1.2.1 Aggression
Bevor ich auf die verschiedenen Definitionsversuche eingehen werde, sollte vorab geklärt sein, wo und in welcher Sprache der Begriff ´Aggression´ seinen Ursprung hat, da eine Begriffsetymologie oft schon den richtigen Weg zu einer Definition in sich trägt.
Die Herkunft des Wortes ´Aggression´ ist im Lateinischen zu finden, hier aber noch in verwandter Form, als Verb ´aggredior´. Der Inhalt liegt aber noch nicht im Zusammenhang mit einer Schädigung eines Individuums oder ganz allgemein eines Objektes, wie oft ein aggressives Verhalten definiert wird, sondern eigentlich nur in einem Annähern an eine andere Person. Erst in abgeleiteten und verwandten Substantiven kann man Inhalte, wie ´zielgerichtetes Angreifen´ oder ´Anlaufen´ ableiten (vgl. LENZEN, Bd. 1, 20).
Wie bereits erwähnt, gibt es unterschiedliche Sichtweisen, von denen aus auf eine aggressive Handlung geblickt werden kann. NOLTING ist der Ansicht, dass man als erstes eine Trennung von einer weiten und einer engen Definition treffen sollte. Der weite Aggressionsbegriff geht von der eben schon geschilderten ursprünglichen Bedeutung aus, der also Aggression mit jeder Form von Aktivität gleichsetzt. Aus diesem Blickwinkel kann ich den Aggressionsbegriff natürlich nicht durchleuchten, da in Hinsicht auf das eigentliche Thema dieser Arbeit, die gesamten Spielhandlungen im Fußball wohl als aggressiv bezeichnet werden könnten, und somit der Charakter dieser Sportart verfälscht dargestellt würde. Im Gegensatz zu der Weiten, versucht NOLTING durch eine enge Definition die Aggression von anderen Verhaltensweisen klar abzugrenzen. Das heißt, dass er eine aggressive Handlung in enger Sichtweise, ähnlich wie andere Autoren, mit einer Schädigung oder zumindest einer Intention dazu in Verbindung bringt. (vgl. NOLTING 1997, 22-26) Andere Autoren, wie MERZ, oder SELG teilen die Ansicht, dass „... jene Verhaltensweisen, mit denen die direkte oder indirekte Schädigung eines Individuums, meist eines Artgenossen, intendiert wird...“ (MERZ in GERISCH 2002, 176), als Aggression zu bezeichnen ist. Er geht also wie DANN (1972) davon aus, dass selbst die bloße Absicht jemanden zu schädigen, schon mit einer Aggression zu beschreiben ist. Drei Jahre später wurde MERZ´ s, von ihm selbst als „... vorläufige Definition...“ (2002, 176) beschriebene Begriffsbestimmung von SELG konkretisiert: „Eine
Page 7
Aggression besteht in einem gegen einen Organismus oder ein Organismussurrogat gerichteten Austeilen schädigender Reize (´schädigen´ meint beschädigen, verletzen, zerstören und vernichten; es impliziert aber auch wie ´iniuriam facere´ oder ´to injure´ schmerzzuführende, störende, Ärger erregende und beleidigende Verhaltensweisen, welche der direkten Verhaltensbeobachtung schwer zugänglich sind); eine Aggression kann offen (körperlich, verbal) oder verdeckt (phantasiert), sie kann positiv (von der Kultur gebilligt oder negativ (missbilligt) sein.“ (SELG in GERISCH 2002, 176) Der von SELG benutzte Begriff eines ´Organismussurrogats´ meint nichts anderes, als ein Organismusersatz oder ein Ersatzmittel (vgl. DROSKOWSKY/BAER 1994, 1324). Das heißt, dass eine aggressive Handlung nicht immer direkt, sondern auch indirekt gegen ein Objekt gerichtet sein kann. Dem Problem, einer vermeidlich fahrlässigen bzw. unabsichtlichen Verletzung oder Schädigung haben sich DOLLARD, DOOB, MILLER, MOWRER, und SEARS gewidmet. Der Schluss zu dem sie gekommen sind ist, dass eine Aggression als eine Handlung definiert wird, „... deren Zielreaktion die Verletzung eines Organismus (oder Organismus-Ersatzes) ist...“ (DOLLARD et al. 1994, 19). Weiter heißt es : „Eine Person kann eine andere durch bloßen Zufall verletzen. Solche Handlungen gelten nicht als Aggressionen, da sie keine Zielreaktionen sind.“ (DOLLARD et al. 1994, 19) Für viele Autoren bestimmt also die Handlungsintention, ob ein Geschehen aggressiver Natur ist, oder eventuell auch nicht.
Natürlich gibt es im großen Felde der Aggressionsforscher, viele Autoren, die gleiche, ähnliche oder auch andere Definitionsansätze versucht haben empirisch zu belegen, aber ich denke, dass die von mir aufgeführten Anstöße zur Begriffsklärung als Grundlage für das weitere Verwenden des Aggressionsbegriffes, die Wichtigsten und Konsensfähigsten sind.
1.2.2 Aggressivität
Um eine Gleichmachung der beiden Begrifflichkeiten `Aggression´ und ´Aggressivität´ zu vermeiden und sie im Vorhinein gleich voneinander abzugrenzen, ist es unumgänglich gewisse inhaltliche Unterschiede aufzuzeigen. GERISCH weist daraufhin, dass unter Aggression „... aggressives Handeln verstanden wird. Aggressivität bezeichnet dagegen die Disposition zur Aggression, d.h. eine innere Bereit-