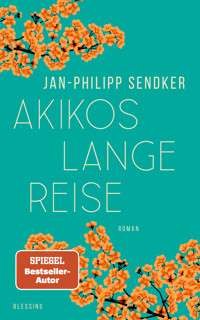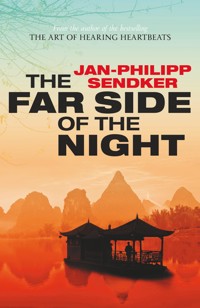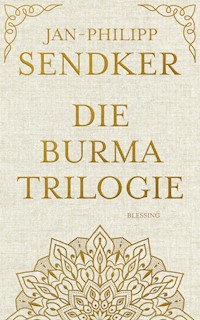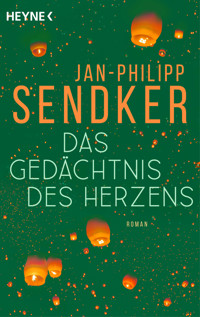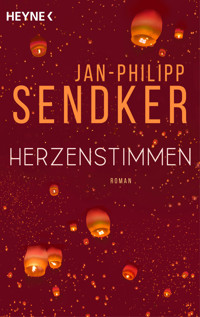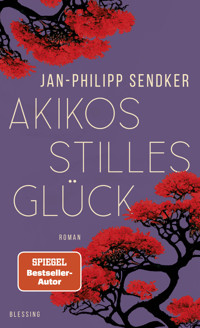
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Japan-Reihe
- Sprache: Deutsch
Im modernen Japan sucht eine junge Frau nach ihren Wurzeln
Die neunundzwanzigjährige Akiko lebt als Single und in selbstgewählter Einsamkeit in Tokio. Eines Abends begegnet sie zufällig Kento wieder, ihrer ersten Liebe aus Schulzeiten. Kento führt ein zurückgezogenes Leben als ein Hikikomori, der sich nur nachts auf die Straße traut. Gleichzeitig entdeckt Akiko im Nachlass ihrer Mutter eine Lebenslüge, die all ihre Gewissheiten infrage stellt. Sie muss sich eingestehen, dass sie nicht weiß, wer sie ist. Mit Kentos Hilfe begibt sich Akiko auf eine Reise zu ihrer eigenen Geschichte, die ihr Leben in unverhoffte Bahnen lenkt und sie zu den Fragen führt, die sie sich bisher nicht zu stellen wagte: Wie will ich leben? Und habe ich den Mut, jemanden zu lieben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der Inhalt
»Habe ich dir schon gesagt, dass ich heiraten werde?«
Er deutete ein Kopfschütteln an. Es sah nicht so aus, als interessierte ihn das sonderlich.
»Wann?«, fragte er in einem beiläufigen Ton.
»Demnächst.«
An seiner Mimik konnte ich nicht erkennen, ob ihn die Nachricht berührte oder nicht. Enttäuscht schwieg ich. Nach einer langen Pause fragte ich, ob er wissen wolle, wen. Er nickte.
Um die Spannung zu erhöhen, ließ ich mir mit der Antwort ein paar Sekunden Zeit. »Mich.«
Kento drehte sich zu mir, in seinen Augen lag ehrliches Erstaunen. »Du … du möchtest dich selbst heiraten?« Offenbar hatte er von dem Konzept »Solo Wedding« noch nie etwas gehört.
»Keine gute Wahl?«
Er ignorierte meinen Scherz. »Hast du dir das auch gut überlegt?«
Ich musste lachen. Das klang nach einer typischen Frage, die besorgte Eltern oder Großeltern stellen würden, nicht ein Gleichaltriger. Von meiner Mutter hätte ich sie nie gehört.
»Ich … ich meine, kennst du dich? Du willst niemanden heiraten, den du nicht kennst, oder?«
»Ich kenne mich seit fast dreißig Jahren«, erwiderte ich, ohne über die tiefere Bedeutung seiner Frage nachzudenken.
Er hingegen überlegte noch länger als sonst, bevor er antwortete. »Du verbringst seit fast dreißig Jahren Zeit mit dir. Das bedeutet aber nicht, dass du dich kennst.«
Der Autor
Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre lang Amerika- und Asienkorrespondent des Stern. Heute lebt er mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung Risse in der Großen Mauer. Nach dem Roman-Bestseller Das Herzenhören (2002) folgten Das Flüstern der Schatten (2007), Drachenspiele (2009), Herzenstimmen (2012), Am anderen Ende der Nacht (2016), Das Geheimnis des alten Mönches (2017, Das Gedächtnis des Herzens (2019) und Die Rebellin und der Dieb (2021). Seine Romane sind in mehr als 35 Sprachen übersetzt. Mit weltweit über 3 Millionen verkauften Büchern ist er einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren.
JAN-PHILIPP SENDKER
AKIKOS
STILLES
GLÜCK
Roman
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Jan-Philipp Sendker
Copyright © 2024 by Karl Blessing Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: t. mutzenbach design, München
Umschlagabbildung: © Corri Seizinger und Peppeneppe/Shutterstock
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-22767-8V003
www.blessing-verlag.de
Für Anna
1
Ich erkannte die Komposition nach den ersten Tönen. Chopin. Eine Nocturne. Die achte. Am Klavier saß eine unscheinbare Frau im Alter meiner Mutter. Links und rechts von ihr standen zwei prall gefüllte Einkaufstüten. Sie spielte mit geschlossenen Augen und so gut, dass schnell die ersten Passanten stehen blieben. Das Stück war eigentlich viel zu ruhig für ein öffentliches Klavier in einer lauten Einkaufspassage, gleichwohl schlug sie immer mehr Zuhörer in ihren Bann. Schon bald war kein Schritt mehr zu hören, kein Husten, kein Flüstern.
Die Frau nahm sich Zeit.
Ihr Oberkörper wiegte sich langsam im Rhythmus der Musik, ich konnte nicht glauben, wie viel diese Fremde in der Öffentlichkeit von sich preisgab, welche Töne sie dem Instrument entlockte.
Jeder einzelne versetzte mir einen Stich ins Herz.
Da, wo es am meisten wehtut. Wo sonst niemand hinkommt.
Ausgerechnet die Lieblingskomposition meiner Mutter.
Seit dem Tag ihrer Einäscherung hatte ich sie nicht mehr gehört.
Ich schluckte und biss mir auf die Lippen.
Nach dem letzten Ton ließ die Frau ihre Arme sinken und verharrte einen Moment regungslos. Um uns herum herrschte Stille. Niemand bewegte sich.
Sie öffnete die Augen, bemerkte ihr Publikum. Ein kurzes Lächeln flog über ihr Gesicht, unsicher und verlegen. Zögernd stand sie auf, griff nach ihren Einkaufstaschen und verschwand in der Menge, als wäre nichts gewesen.
Es dauerte, bis die Menschen ihrer Wege gingen. Ich blieb allein zurück.
Mein Herz pochte, als wäre ich gerannt.
»Bitte entschuldige die Verspätung.« Vor mir stand Naoko, sie war außer Atem. »Was ist mit dir? Geht es dir nicht gut?«
»Doch, warum fragst du?«
»Du zitterst!«
»Alles gut. Wahrscheinlich habe ich nur Hunger.« Was sollte ich sagen? Naoko interessierte sich nicht für Musik.
Sie hakte sich bei mir unter, und wir gingen in ein Izakaya, in dem wir schon häufiger gegessen hatten. Das Essen war gut und günstig, der Sake ebenfalls. Wir bestellten Edamame, Sashimi, gegrillten, in Miso marinierten Fisch, Tamagoyaki, ein paar Yakitori-Spieße und zwei große Gläser Bier.
Noch immer ging mir Chopins Melodie nicht aus dem Kopf.
»Alles in Ordnung?«, fragte Naoko noch einmal.
Ich nickte.
Nachdem der Kellner gegangen war, zog sie ein pinkfarbenes Fotoalbum aus ihrer Tasche und legte es vor mir auf den Tisch. Auf dem Cover klebte das Foto einer strahlend schönen Frau in einem weißen Brautkleid. In der Hand hielt sie einen Brautstrauß. Das Bild war von der Seite aufgenommen, die Frau hatte den Kopf leicht gedreht und lachte in die Kamera. Durch die tief stehende Sonne oder einen Scheinwerfer erstrahlte sie in einem warmen, weichen Licht. Mein Blick wanderte von dem Album zu Naoko und wieder zurück.
»Bist du das?«, entfuhr es mir.
»Wer sonst?«
Zu erstaunt, um etwas zu antworten, starrte ich auf das Bild. So schön hatte ich Naoko noch nie gesehen, wenn ich ehrlich war, überraschte es mich, dass sie überhaupt so schön aussehen konnte. Nicht, dass sie eine hässliche, unscheinbare Frau gewesen wäre, überhaupt nicht. Naoko war einen halben Kopf kleiner als ich, etwas stämmig, mit großen Brüsten und kräftigen Oberarmen und Beinen, ohne dabei plump oder dick zu wirken. Sie hatte ein rundes, etwas flaches Gesicht, volle Lippen, schmale Augen, und trug, seit ich sie kannte, einen Pagenschnitt, der ihr ausgezeichnet stand. Sie stammte aus Osaka und war die einzige Frau in der Firma, die sich traute, bunte Farben zu tragen. Gelbe Strickjacken. Geblümte Blusen. Rosa, grüne oder pinkfarbene Schals. In ihrem roten Mantel war sie auf der Straße oder im Bahnhof in dem Meer von schwarz, grau und dunkelblau gekleideten Passanten immer schon von Weitem zu erkennen.
Auf Männer hatte sie eine besondere Wirkung. Ich vermute, bei uns in der Abteilung gab es kaum einen Mann, der nicht gerne mal mit ihr in ein Love Hotel gegangen wäre.
Beeindruckt schlug ich die erste Seite des Albums auf. Auf dem nächsten Bild sah sie noch schöner aus. Es war von vorn aufgenommen, im Ausschnitt ihres eng geschnittenen Kleids zeichneten sich die Umrisse ihres Dekolletés ab, im Hintergrund erkannte ich verschwommen die Silhouette eines Tempels. Sie strahlte, und das war kein Lächeln, das ich von ihr kannte.
Vorsichtig blätterte ich Seite um Seite um. Die Fotos zeigten eine glückliche Naoko beim Anprobieren verschiedener Hochzeitskleider. Naoko beim Friseur. Naoko beim Make-up. Naoko in einem Blumengeschäft. Immer umringt von lachenden, ihr zugewandten Frauen, die ihr die Haare machen, Augenbrauen nachziehen, einen Schleier halten oder eine Wagentür öffnen. Naoko in einer Limousine, fröhlich aus dem offenen Fenster winkend. Naoko in einem Garten auf einer roten Brücke, davor ein Schwan.
Was fehlte, war ein Bild von ihr und dem Bräutigam, was kein Wunder war. Naoko hatte sich selbst geheiratet.
Als sie mir vor einem Jahr von ihrer Idee erzählt hatte, dachte ich, sie mache einen Scherz. Sie werde bald dreißig Jahre alt und wolle vorher noch heiraten. Schon als kleines Mädchen habe sie von einer Hochzeit in Weiß geträumt, von sich als Braut mit einem Schleier, einer Krone im Haar und in einem Kleid, wie eine Frau es nur einmal in ihrem Leben trägt.
Aber nie von einem Bräutigam.
Daran, erklärte sie, habe sich bis heute nichts geändert. Sie wolle ihr Leben nicht mit einem Mann verbringen, und auch nicht mit einer Frau. Sie wolle nicht jeden Abend neben demselben Menschen einschlafen und am Morgen neben ihm aufwachen. Sie wolle ihr Frühstück mit niemandem teilen. Sie wolle ins Bett gehen, wenn ihr danach sei und nicht, wenn es von ihr erwartet werde. Sie wolle auf niemanden warten müssen, und, noch wichtiger, sie wolle sich nicht schlecht fühlen, weil sie jemand anderen warten ließ. Sie hasse den Geruch eines anderen Menschen in ihrem Bett oder in ihrem Badezimmer, weshalb sie eine regelmäßige Besucherin von Love Hotels sei.
Weil sie aber nicht auf eine Hochzeit verzichten wollte, hatte sie beschlossen, sich selbst zu heiraten.
In den folgenden Monaten erzählte Naoko mir jedes Mal, wenn wir uns trafen, von ihren Hochzeitsvorbereitungen. Sie beschrieb ausführlich, welche Art von Kleid sie in Betracht zog und wie viel Spaß ihr die Anproben machten. Sie wollte von mir wissen, ob sie einen Schleier tragen solle und wo ich an ihrer Stelle die Hochzeitsnacht verbringen würde.
Ich hatte mir alles angehört und trotzdem nicht geglaubt, dass sie es wirklich machen würde. Nun klappte ich das Album zu und war sprachlos. »Wow«, war alles, was ich herausbrachte.
Der Kellner stellte unser Bier auf den Tisch. Wir stießen auf das Brautpaar an.
»Hättest du gedacht, dass ich so schön aussehen könnte?«
»Nein … ich meine, ja«, stammelte ich etwas verlegen.
»Ich nicht. Wirklich nicht. Am Anfang dachte ich, es geht nur um ein paar gerahmte Fotos und ein Album zur Erinnerung, aber da habe ich mich getäuscht. Ich schaue mir die Bilder an und sehe, wie schön ich sein kann. Ich, ganz allein, ohne Mann.«
Sie hob ihr Glas. »Kampai.«
»Kampai«, erwiderte ich.
Eine Kellnerin brachte einen Teller mit rohem Thunfisch. Wir bestellten gleich noch zwei Gläser Sake.
»Selbst meiner Mutter hat das Album gefallen.«
»Du hast es deiner Mutter gezeigt?«
»Und meiner Schwiegermutter …«
»Was hat sie gesagt?«
»Ich hätte eine gute Wahl getroffen.«
Wir kicherten und lachten, bis uns der Küchenchef hinter dem Tresen einen neugierigen Blick zuwarf. Naoko bat um Entschuldigung, was wir im Laufe des Abends noch mehrmals taten, so laut waren wir. Wir überlegten, wohin die Hochzeitsreise gehen könnte, was es für ein Segen war, dass Naoko ihre Schwiegermutter schon so gut kannte und mochte und dass es zwischen Eltern und Schwiegereltern in dieser Ehe vermutlich keinen Streit geben würde, wobei Naoko einwandte, dass man bei ihren Eltern nie sicher sein konnte. Ich fand, es wäre von großem Vorteil, dass in Naokos Ehe kein Partner den anderen betrügen und belügen könnte, worauf sie mir jedoch widersprach. Es gebe genug Menschen, die sich selbst belügen und betrügen würden. Nach kurzem Nachdenken stimmte ich ihr zu. Sorgen bereitete uns eine eventuelle Scheidung: Wie trennt man sich von sich selbst?
Es war spät geworden. Wir verabschiedeten uns an der Shinjuku Station, sie fuhr Richtung Shibuya, ich ging weiter zur Odakyu-Linie.
Als ich durch die langen Gänge zu den Gleisen lief, kam mir die Pianistin wieder in den Sinn. Im Nachhinein bereute ich es, ihr nicht gefolgt zu sein, um mich zu bedanken. Es war lange her, dass mir jemand so viel von sich gegeben hatte. Ich sah sie vor mir, mit ihren strähnigen Haaren, ihrer etwas altmodischen Jacke und den gefüllten Einkaufstaschen. Sie hatte wie eine gewöhnliche Hausfrau ausgesehen.
Ich dachte an meine Mutter. Übermorgen war ihr dritter Todestag.
Ich glaube nicht an Zufälle, hatte sie immer gesagt. Alles, was passiert, geschieht aus einem Grund.
Zu Hause öffnete ich noch eine Dose Bier. »Fisch muss schwimmen«, war eine Redewendung meiner Mutter gewesen, wenn sie sich zum Essen ein weiteres Bier oder die Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank holte.
Mein Handy summte. Naoko schickte mir ihr Hochzeitsfoto mit einem dicken roten Herz und den Worten »trau dich« darunter. Sie hatte mir angemerkt, wie sehr mich die Bilder und ihre Erzählung beeindruckt hatten. Ich staunte über mich selbst. Eine Hochzeit hatte bis zu diesem Abend in meinen Gedanken keine Rolle gespielt. Erst recht nicht in meinen Träumen. Ich hatte keinen Freund und wollte auch keinen. Ich hatte noch nie eine Dating-App benutzt. Die gelegentlichen Einladungen von einem Kollegen zu einem Essen, Kaffee oder Kinobesuch lehnte ich so freundlich wie möglich ab. Ich fühlte mich unwohl zu zweit, es sei denn, ich traf mich mit Naoko oder Tomomi, und selbst ihre Gesellschaft war mir an manchen Abenden zu viel. Ich mochte keine Fragen von Fremden über mich beantworten. Ich fand es anstrengend, darüber zu reden, was ich über einen Film, ein Buch oder eine neue Manga-Serie dachte, wer meine Lieblingsschauspieler waren, ob ich Fisch lieber roh, gegrillt oder gebraten aß. Ob ich schon einmal auf Okinawa oder Hawaii gewesen war oder ob ich davon träumte, dorthin zu fahren.
In der Gruppe fühlte ich mich wohler als zu zweit. Es fiel mir nicht schwer, mitzulachen, das Essen zu loben, Sake nachzuschenken und hin und wieder an den richtigen Stellen zustimmend zu nicken. Das genügte, um bei meinen Kolleginnen und Kollegen nicht aufzufallen und mir das Gefühl zu geben, nicht wieder eine Außenseiterin zu sein, mit der niemand etwas zu tun haben will.
Als ich Naokos Hochzeitsfoto anschaute, passierte etwas in mir. Plötzlich stellte ich mir vor, wie ich in einem weißen Brautkleid mit Schleier und Blumen aussehen würde. Ich sah mich in einem Park posieren und den Zweig eines blühenden Kirschbaums halten. Welche Akiko würde ich auf den Fotos von einer Hochzeit mit mir selbst entdecken?
Wollte ich das wissen?
Warum eigentlich nicht?
* * *
Ich erwachte mit Kopfschmerzen. Es war Samstag, der Tag, an dem ich nicht viel mehr tat, als mich von der Woche zu erholen. Die Arbeit im Büro war nicht sonderlich interessant, aber anstrengend, und die Tage lang.
Oft blieb ich am Samstag bis mittags im Bett, erledigte nachmittags ein paar Einkäufe, machte die Wäsche, schaute einen Film, las ein Manga oder ein Buch, übte französische Vokabeln und ging früh schlafen. Jedes zweite Wochenende hatte ich eine Stunde Französischunterricht bei Madame Montaigne.
Ich machte mir Kaffee und wärmte ein Croissant auf.
Je länger ich über Naokos Hochzeit nachdachte, umso besser gefiel mir die Idee.
Bei Google fand ich unter »Solo Wedding« mehrere Millionen Einträge. Es gab Agenturen in Tokio, Osaka, Kobe oder Kyoto, die die verschiedensten Varianten solcher Hochzeiten anboten. Manche arrangierten zwei- bis dreistündige oder halbtägige Fotoshootings im Studio, Brautkleid, Make-up und Haarstylist inklusive. Ihre Webseiten zeigten Fotos von jungen Frauen in Brautkleidern, mit Schleiern oder einer kleinen Krone auf dem Kopf. Manche waren jünger als ich, einige von ihnen grinsten wie Schulmädchen in die Kamera. Sie sahen verkleidet aus wie bei einer Cosplay-Veranstaltung. In anderen Gesichtern hingegen sah ich das gleiche Glück, die gleiche Freude, den gleichen Stolz, das gleiche Staunen wie auf den Aufnahmen von Naoko.
Andere Firmen organisierten aufwendige ganztägige Events in Hotels, man konnte Freunde und Trauzeugen mitbringen oder sogar einen Bräutigam und Gäste dazubuchen. Es gab All-inclusive-Angebote oder lange Preislisten mit Extras wie Limousinenservice und Hotelsuiten für die Hochzeitsnacht. Das war nicht, was ich suchte. Mich faszinierten die Bilder von Naoko. Mich faszinierte die Tatsache, dass sie sich so verwandeln konnte: von einer Freundin und Kollegin in eine strahlende Braut, und dass sie keinen anderen Menschen brauchte, um so schön auszusehen.
Ich duschte, zog mich an und machte die Wohnung sauber. Mit ihren zwei Zimmern und der Küche war sie eigentlich zu groß und zu teuer für mich allein. Doch ich hing an ihr, und meine Mutter hatte mir eine für unsere Verhältnisse erstaunlich hohe Lebensversicherung hinterlassen. Als alleinerziehende Mutter hatte sie früher vermutlich Angst gehabt, was aus mir werden sollte, wenn sie plötzlich starb, und wollte mit dem Geld sicherstellen, dass ich zumindest studieren konnte und für eine Weile versorgt wäre.
Für die nächsten Jahre musste ich mir finanziell keine Sorgen machen.
Ich wischte die Tatamis und die Küche, saugte den Flur, belud eine Waschmaschine und hängte bald darauf die Wäsche auf.
Beim Putzen des Bades fiel mein Blick in den Spiegel, ich richtete mich auf, stand still und betrachtete mich. Ohne Make-up war meine Haut blass, fast weiß und noch ohne eine Falte. Mein Gesicht war schmaler als das der meisten Frauen, die ich kannte, meine Nase länger und etwas spitzer, die Augen runder und größer. Das kleine schwarze Muttermal auf der rechten Wange hatte ich früher gehasst, jetzt machte es mir nichts mehr aus. Die Lippen waren voll und von Natur aus rot, sodass ich nur einen dezenten Lippenstift benutzte. Ich strich die Haare aus dem Gesicht und hielt sie zu einem Zopf zusammen, drehte den Kopf von einer Seite zur anderen. Meine Ohren fand ich zu groß, und sie standen leicht ab. Deshalb trug ich selten einen Pferdeschwanz. Früher hatte ich unter meinem Aussehen gelitten, heute empfand ich mich weder als besonders schön noch als besonders hässlich. Ich war keine Frau, die die Blicke von Männern auf sich zog, und das war mir recht. Würde ich mich auf meinen Hochzeitsbildern trotzdem so verwandeln wie Naoko?
Am Abend machte ich einen Spaziergang durch Shimokita. Es war ein warmer Frühsommertag, die Straßen waren voller Menschen. Seitdem die Bahngleise unterirdisch verliefen, hatte sich das Viertel verändert. Den großen, etwas chaotischen Markt um die Station Shimokitazawa, auf dem meine Mutter und ich in den ersten Jahren an den Wochenenden oft gegessen und getrunken hatten, gab es schon lange nicht mehr. In den Secondhandläden lagen nun neben getragenen Hemden, T-Shirts und Jeans gebrauchte Kleider und Schuhe von Prada oder Taschen von Louis Vuitton. Eine große Muji-Filiale hatte eröffnet, ein neues Hotel, ein Biosupermarkt. Trödelläden, kleinere Restaurants und Bars wie die meiner Mutter verschwanden zusehends.
Später kaufte ich im Lawson-Supermarkt an der Higashi-Kitazawa-Station noch einen kalten Tee und ein Stück Baumkuchen. Als ich aus dem Geschäft kam, bemerkte ich schräg gegenüber einen Mann. Er war auffallend groß gewachsen, hatte lange, lockige Haare und trug eine dunkelgraue Kapuzenjacke. Mit seinem leicht nach vorn gebeugten Oberkörper und dem etwas eingezogenen Kopf sah er aus, als wollte er sich kleiner machen, als er war.
Er schaute in meine Richtung, und unsere Blicke trafen sich, sofort wandte er sich wieder ab.
Ohne es zu ahnen, hatte ich Kento-kun wiedergesehen. Kobayashi Kento-kun. Zum ersten Mal seit dreizehn Jahren.
2
Es war der dritte Todestag meiner Mutter. Ein Sonntag.
Am ersten hatte ich an ihrem Sterbebett gesessen.
Den zweiten hatte ich allein zu Hause verbracht.
Für den dritten hatte ich mir vorgenommen, ihre Asche dem Meer zu übergeben.
Im Sommer waren wir an Wochenenden hin und wieder an den Tsujido Beach zum Baden gefahren, sonntags war ihre Bar geschlossen. Sie liebte das Meer. Das Rauschen der Brandung. Den langen Strand. In Tsujido war er besonders breit, und man hatte von dort einen beeindruckenden Blick auf den Fuji. Meine Mutter bereitete das Picknick vor, ich packte unsere Badesachen.
Das Wasser war angenehm warm, wir verbrachten viel Zeit nebeneinander schwimmend oder setzten uns in den Sand und schauten den Surfern zu. Ich hatte ein paar Zeitschriften dabei oder las auf meinem Handy ein Buch, sie blickte einfach nur in die Ferne oder ging am Strand spazieren. Dabei hüpfte sie manchmal wie ein Kind oder drehte sich im Kreis, als würde sie tanzen. Am späten Nachmittag holte sie das Essen und das Bier aus dem Rucksack, jedes Mal wunderte ich mich, wie es ihr gelang, es trotz der Hitze gekühlt zu halten. Wir aßen Sandwich mit Eiersalat und Schinken, Tamagoyaki und zum Nachtisch Erdbeeren. Schweigend beobachteten wir, wie sich die Sonne dem Horizont näherte und im Meer versank. In diesen Stunden umgab meine Mutter eine Leichtigkeit, wie ich sie sonst bei ihr nicht erlebte.
Ein paar Tage vor ihrem Tod fragte ich sie, was mit ihrer Asche geschehen solle, und sie bat mich, sie im Meer zu verstreuen.
Dafür gab es keinen passenderen Ort als Tsujido. Ich hatte es schon mehrmals vorgehabt und immer wieder verschoben.
Ihre Urne stand seit zwei Jahren auf der kleinen Holzkommode neben dem Esstisch. Daneben hatte ich ein Foto von ihr gestellt. Es zeigt sie am Tag der Eröffnung ihrer Weinbar in Shimokita. Mit einem Glas Rotwein in der Hand steht sie vor der Tür unter dem roten Neonschriftzug und strahlt. Sie selbst hatte es noch als »offizielles« Trauerbild ausgewählt. Jeden Morgen stellte ich ein kleines, mit Rotwein gefülltes Glas dazu oder legte eine Kaki oder eine Mandarine davor. Abends stieß ich in Gedanken mit ihr an, und wenn mir danach war, sprach ich mit ihr. Erzählte vom Büro. Von Naoko. Von meinen Ausflügen an den Strand oder in den InokashiraPark, von den Stunden bei Madame Montaigne, meinen Fortschritten in Französisch und dass wir sie vermissten. In den ersten Monaten war mir der Anblick der Urne unheimlich gewesen. Ich verstand nicht, wie dieses gewöhnliche, unscheinbare Gefäß aus weißem Porzellan die Überreste meiner Mutter beinhalten sollte. Es war lächerlich zu glauben, dass etwas so Wundervolles, Besonderes, in etwas so Schlichtes, Belangloses passen konnte. Dann sagte ich mir, dass es ja nicht meine Mutter war, sondern nur ihre Asche. Mit der Zeit gewöhnte ich mich daran. Jetzt würde mir etwas fehlen, wenn sie nicht mehr da wäre. Es gab keine Vorschrift, die besagte, dass man die Asche seiner Mutter an ihrem dritten Todestag verstreuen musste. Ich konnte sie bei mir behalten, solange ich wollte.
Ein Mensch stirbt, wie er gelebt hat, habe ich einmal gelesen. Ich kann nicht sagen, ob das für jeden Menschen zutrifft, bei meiner Mutter stimmte es.
Vom Tag der Diagnose an ertrug sie ihre Krankheit mit großer Tapferkeit. Ich hatte darauf bestanden, sie zu dem Termin im Krankenhaus, an dem die Untersuchungsergebnisse besprochen werden sollten, zu begleiten. Den Ausführungen des Arztes war sie ruhig gefolgt, hin und wieder stumm nickend. Nach seinem letzten Satz blickte er betreten auf seinen Schreibtisch, sie blieb noch einen Moment still auf ihrem Stuhl sitzen. Schluckte. Schloss die Augen. Ich sah, wie ihre Lippen zitterten, ihr Kinn. Der Arzt rutschte auf seinem Stuhl hin und her, spielte mit seinem Kugelschreiber, ich glaube, er fürchtete, meine Mutter könnte die Beherrschung verlieren. Er war nicht der Typ, der damit gut umgehen konnte. Ich wusste, dass das nicht geschehen würde. In meinem Leben hatte ich sie nur einmal weinen sehen.
In den zwei Jahren bis zu ihrem Tod hat sie nicht ein Mal gefragt, warum ausgerechnet ich? Warum muss ich so jung sterben? Womit habe ich das verdient? Sie wusste, dass es darauf keine Antwort gab.
Meine Hilfe nahm sie nur an, wenn es gar nicht mehr anders ging. Sie sprach weder über ihre Ängste noch über ihre Schmerzen, und ich fragte auch nicht.
Ihrer Krankheit begegnete sie mit der gleichen Stärke und Disziplin, mit der sie mich als alleinerziehende Mutter großgezogen hatte. Mit der gleichen stillen Entschlossenheit, mit der sie in Nara ihren Sunakku geführt und in Tokio ihre französische Weinbar eröffnet hatte. Und so wie sie sich die Ratschläge ihrer Kunden und wenigen Freundinnen geduldig anhörte und selten befolgte, so verfuhr sie auch mit den Empfehlungen der Ärzte. Sie trank nach wie vor Wein, Sake und Bier, rauchte, ging spät ins Bett, schlief zu wenig, arbeitete, statt sich zu schonen. Sie heuerte eine jüngere Stammkundin als Aushilfe an und reduzierte die Öffnungszeiten, statt zu schließen. Erst wenige Tage vor ihrem Tod bat sie mich, das Schild »Wegen Urlaub vorübergehend geschlossen« an die Tür zu hängen. Das Wort »vorübergehend« hatte ich hinzugefügt.
Ich bewunderte meine Mutter für ihren Mut.
Ihr Körper wurde schwächer, nicht ihr Geist. Sie lamentierte nicht. Sie klagte nicht, selbst als es ihr immer schlechter ging. In den letzten Wochen war mir, als stünde der Tod vor ihrem Bett, und sie schaute ihm direkt in die Augen. Ohne zu blinzeln. Ohne Furcht.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt etwas gab, was ihr wirklich Angst machte.
Und als sie beschloss zu sterben, ging es schneller, als die Ärztin und die Krankenschwester, die sie pflegten, es für möglich gehalten hatten. Sie weigerte sich, etwas zu essen oder zu trinken. Meine Mutter wollte selbst bestimmen, wann es mit ihr zu Ende ging.
Nach ihrem Tod schrieb ich ihren Eltern einen kurzen Brief. Ich vermute, meine Mutter wäre damit nicht einverstanden gewesen, doch ich fand, meine Großeltern hatten ein Anrecht darauf zu erfahren, dass die ältere ihrer beiden Töchter nicht mehr lebte. Es war ein höfliches, sehr formelles Schreiben. Ich gab mir Mühe. Sie sollten nicht denken, dass meine Mutter mich schlecht erzogen hatte. Geantwortet haben sie nicht.
Ich überlegte, was ich für sie an diesem besonderen Tag tun könnte. Ihre alte Chopin-Playlist spielen, auch wenn es mir schwerfiel? Er war ihr »französischer« Lieblingskomponist gewesen, darauf beharrte sie, egal wie oft ich ihr sagte, dass er nicht Franzose, sondern Pole gewesen war.
»Pole? Bei dem Nachnamen? Das glaubst du doch selbst nicht«, erwiderte sie jedes Mal wider besseres Wissen, nur um mich ein wenig zu ärgern. Chopin, erklärte sie mir eines Abends nach einigen Gläsern Wein in ihrer Bar, drücke wie kein anderer in Noten aus, was sie zeit ihres Lebens fühle: eine unermessliche, unerfüllte Sehnsucht. Ich habe sie weder an jenem Abend noch später gefragt, wonach sie sich sehnte. Ich weiß nicht, ob sie darauf eine Antwort gehabt hätte.
Zögernd verband ich mein Telefon mit den Lautsprechern und suchte nach der Nocturne Nummer acht mit Maria João Pires. Meine Mutter hatte die portugiesische Pianistin verehrt, für sie spielte niemand Chopin mit so viel Tiefe und Emotion.
Ich hielt kurz inne, bevor ich auf »abspielen« drückte.
Nach wenigen Takten begann ich zu weinen. Tränen strömten mir die Wangen hinunter, und ich war dankbar für den Trost, den die Musik zu geben vermochte.
3
Im Büro war noch mehr los als sonst. Es gab Probleme mit der Buchhaltung unserer Filiale in Bangkok, und wir sollten jede Abrechnung aus den vergangenen zwei Jahren ein zweites Mal prüfen. Eine langweilige, monotone Arbeit, meine einzige Abwechselung bestand aus einem kurzen Mittagessen mit Satō-san und Nakagawa-san. Sie arbeiteten in der Kreativabteilung unserer Agentur und waren auf der Suche nach einem Slogan für einen Großkunden aus der Kosmetikindustrie. Ihre Deadline war in zwei Tagen, die Kampagne war für die Präsentation vorbereitet, was ihnen noch fehlte, war die Überschrift, das Hauptthema.
Seit ich ihnen vor zwei Jahren zufällig mit dem Werbespruch »Wir verbinden Menschen« für Japan Railways ausgeholfen hatte, fragten sie mich um Rat, wenn sie nicht weiterkamen. Was regelmäßig geschah. Manchmal konnte ich ihnen helfen, manchmal nicht. Es freute mich, wenn ich später einen von meinen kurzen Werbetexten auf Plakaten oder in einem YouTube-Video entdeckte und niemand wusste, dass er von mir stammte. Satō-san und Nakagawa-san hielten es für klüger, unsere kurzen Brainstorming-Treffen für sich zu behalten, und revanchierten sich immer mit ein oder zwei Flaschen besonders gutem Sake. Mir genügte das.
Wir trafen uns in einem koreanischen Restaurant in der Nähe unseres Büros, beide waren sichtlich angespannt und nervös, der Kunde war wichtig. Satō-san zeigte mir zwei Dutzend Fotos von Models aus allen Kontinenten, die sehr verschieden aussahen: lange Nasen, kurze Nasen, große Augen, kleine Augen, weiße, braune, schwarze Haut, glatte Haare, Rastalocken. Zum Schluss kam das Bild einer jungen Japanerin, die mit einem roten Stift provozierend ihre Lippen nachzieht, gefolgt von dem Logo der Kosmetikfirma.
Ich überlegte kurz. Mir fiel entweder spontan etwas ein oder gar nicht. »Die Welt verändert sich. Du auch? Trau dich.«
Die beiden schauten sich an und nickten. Das fanden sie offenbar besser als alles, was ihnen bisher eingefallen war.
Ich freute mich auf die Flasche Sake.
Abends war ich so müde, dass ich in der Bahn einnickte, ich kam nicht vor neun Uhr nach Hause. Meine Kraft reichte gerade noch für eine Fertignudelsuppe oder eine Pizza aus der Mikrowelle, ich trank ein Bier oder auch zwei und fiel ins Bett. Morgens weckte mich mein Handy um sechs Uhr. Ich hätte auch um sieben aufstehen können, aber diese Stunde war die einzige Zeit am Tag, die ich für mich hatte, die ich in Ruhe und in meinem eigenen Tempo verbringen konnte, ohne vor Erschöpfung einzuschlafen. Ich machte mir Tee und Toast, frühstückte im Bett, schrieb ein wenig in meinem Tagebuch oder genoss es einfach, dazusitzen, die graue Wand anzuschauen und keine Zahlen addieren zu müssen, keine Abrechnungen zu prüfen, keine Fragen zu beantworten.
Am Freitag lud mich Naoko in ein Shabu-Shabu-Restaurant ein. Ich freute mich. Nach dem Tod meiner Mutter war sie der Mensch, der mir am nächsten stand. Wir arbeiteten seit fünf Jahren in derselben Abteilung; nach dem Lockdown hatten wir zu den Ersten gehört, die wieder ins Büro kamen, weil wir uns beide im Homeoffice nicht wohlfühlten, und wir hatten uns mit der Zeit angefreundet, auch wenn wir sehr verschieden waren. Vielleicht gerade deshalb. Zunächst war ich etwas eingeschüchtert von ihrem Humor und ihrer offenen Art. Sie hatte zu den meisten Dingen eine Meinung und scheute sich nicht, diese zu äußern. Ein Mensch wie Naoko war mir zuvor noch nicht begegnet. Je näher wir uns kennenlernten, umso mehr mochte ich sie.
Sie stammte aus einer Familie von Angestellten, ihre Mutter war Buchhalterin, ihre große Schwester ebenfalls, ihr Vater arbeitete in der Personalabteilung einer Kaufhauskette. Sie hatte noch einen jüngeren Bruder, der in einem Dorf in der Nähe von Nagasaki lebte und, wenn ich mich richtig erinnerte, etwas mit Musik machte. Die Familie sah sich nicht oft, aber sie telefonierte viel miteinander, und ich hörte gern zu, wenn sie von ihren Geschwistern oder ihren Eltern erzählte.
Wir setzten uns an den Tresen und bestellten beide das Shabu-Shabu-Mittagsmenü. Sie war schlecht gelaunt, weil sie sich am Morgen mit einem Kollegen gestritten hatte, der ihr vorwarf, zu »dominant« zu sein. Plötzlich legte sie ihre Stirn in Falten, hob kurz die Augenbrauen und verzog den Mund zu einem spöttischen Grinsen.
»Männer haben Angst vor Frauen.«
»Wie kommst du denn jetzt auf die Idee?«
Sie zuckte leicht mit den Schultern, als würde sich diese Frage von selbst beantworten.
»So allgemein kann man das, glaube ich, nicht sagen«, wandte ich vorsichtig ein.
»Natürlich kann man das.«
»Alle Männer?«
»Die einen mehr, die anderen weniger. Eingestehen tun es aber weder die einen noch die anderen. Ich glaube, es sitzt irgendwo ganz tief in ihnen, die allermeisten wissen es wahrscheinlich nicht einmal, und das ist das Schlimmste. Wenn sie es wenigstens zugeben würden«, sagte sie mit einem Seufzer. »Dann könnten wir ihnen vielleicht helfen, ihre Angst zu überwinden. Aber so…«
Eine Kellnerin stellte zwei Töpfe mit heißem Wasser auf eine Herdplatte vor uns. Darin schwammen Pilze, Gemüse und kleine Tofustücke.
Ich dachte an meine Mutter. Von ihr hatte ich diesen Satz auch einige Male gehört.
Männer haben Angst vor Frauen.
Naoko riss mich aus meinen Gedanken.
»Was meinst du, warum wir noch nie eine Premierministerin hatten? Warum kein großes Unternehmen von einer Frau geführt wird? Was glaubst du, warum bei uns in der Firma keine Abteilung von einer Frau geleitet wird? Warum im vergangenen Jahr Ibuki-san die Stelle im Büro in Singapur bekam und nicht Mikadori-san, obwohl sie dreimal schneller, intelligenter und kreativer ist als die Schlaftablette? Immerhin war Ibuki so klug, das selbst zuzugeben. Was glaubst du, warum es unter den dreißig leitenden Angestellten nur eine Frau gibt? Die selbstverständlich keine Kinder hat und auch noch aussieht und redet wie ein Mann. Weil wir zu dumm sind? Weil uns bedauerlicherweise ein paar Gehirnwindungen fehlen? Weil wir großherzig auf unsere Karrieren zugunsten der Männer verzichten?«
Sie beantwortete sich ihre Fragen gleich selbst. »Natürlich nicht. Sie halten uns klein. Sie halten uns klein, weil sie Angst vor uns haben. Weil wir schneller sind. Weil wir drei Dinge gleichzeitig erledigen können und sie nicht. Weil Leben in uns wächst und in ihnen nicht. Weil sie nie sicher sein können, ob sie die Väter unserer Kinder sind oder ein anderer. Und wir sind auch noch so blöd und lassen uns das gefallen. Wir lassen uns kleinhalten. Aber ehrlich gesagt, die meisten Männer tun mir leid. Es muss furchtbar anstrengend sein, immer in Angst zu leben, meinst du nicht? Was für ein Stress.«
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemals ein Mann Angst vor mir haben könnte, und wiegte zweifelnd den Kopf hin und her. Ich wollte das Thema wechseln. Männer und ihre Ängste interessierten mich nicht sonderlich.
Naoko beugte sich zu mir, ihr Blick wanderte einmal durch das Lokal. »Sieh sie dir doch nur an«, sagte sie flüsternd.
Ich schaute mich um. Um uns herum saß ein Dutzend Männer, fast alle in unserem Alter. Sie starrten auf ihre Telefone und aßen nebenbei gedankenverloren ihr Shabu-Shabu. Sie trugen schlecht sitzende Anzüge, waren schmächtig und blass und machten alle den nervösen und gleichzeitig erschöpften Eindruck von Salarymen in ihrer Mittagspause.
»Ich glaube nicht, dass das eine repräsentative Auswahl ist«, sagte ich und musste lachen.
»Doch«, widersprach Naoko. »Die Älteren haben nur teurere Anzüge an, essen in teureren Restaurants und fahren SUVs. Ihre Angst ist dieselbe. Glaub mir.«
Wie es häufig ihre Art war, sprach sie so laut, dass die Gäste in unserer Nähe jedes Wort verstanden. Der Mann neben ihr warf uns einen verstörten Blick zu. Ich wandte mich ab, damit er mein Lachen nicht bemerkte. Ich wollte niemanden provozieren.
Naoko tunkte gelassen eine Scheibe Fleisch in ihre heiße Brühe. Ich fragte, ob sie am Sonntag mit mir auf einen Flohmarkt gehen wolle. Die Wochenenden waren lang, und ich dachte, es wäre schön, nicht jedes allein zu verbringen.
Leider war sie schon verabredet. »Mit einem dieser Schisshasen«, raunte sie mir zu und grinste. »Ich kann fragen, ob er einen Freund mitbringt, dann treffen wir uns zu viert und machen ihnen mal so richtig Angst.«
Ich schüttelte den Kopf, und dabei beließen wir es. Meine Beziehungen zu Männern waren ein Thema, über das wir selten redeten. Naoko konnte nicht verstehen, dass ich weder an ihnen noch an Frauen Interesse hatte. Ihre hartnäckigen Fragen dazu hatten mich einige Male missgestimmt, seitdem vermieden wir das Gespräch darüber.
Es wurde noch ein langer Tag im Büro. Eine Kollegin war krank, ich erledigte ihre Sachen mit und blieb bis nach zehn Uhr in der Agentur. Die Gassen in Shimokita waren menschenleer, als ich von der Bahn nach Hause ging. Aus einigen Bars klang ruhiger Jazz auf die Straße, in zwei oder drei Izakayas saßen noch Gäste bei Sake und Yakitori. Ich war zwar hungrig, aber viel zu müde, um noch irgendwo etwas zu essen. Ich bog in meine Straße ein, mir kam eine Frau mit Hund entgegen, kurz darauf der Mann, der mir vor dem Supermarkt aufgefallen war. Ich erkannte ihn an seiner Größe, der leicht gebeugten Haltung und der dunkelgrauen Jacke, deren Kapuze er weit über den Kopf gezogen hatte. An den Seiten hingen lange Locken heraus. Er bemerkte mich nicht sofort und erschrak, als wir aneinander vorbeigingen. Im Schein der Straßenlaterne sah ich sein Gesicht. Kobayashi Kento-kun schoss es mir durch den Kopf. Die hohe Stirn, ungewöhnlich große Augen, der Gang, die Haltung, die lockigen Haare. Es könnte Kento sein, auch wenn ich ihn mir nicht mit schulterlangen Haaren vorstellen konnte. Als ich die Haustür aufschloss, drehte ich mich nach ihm um. Die Straße lag verlassen da.
Am nächsten Abend traf ich ihn vor dem Konbini an der Higashi-Kitazawa-Station wieder. Ich war in Shinjuku im Kino gewesen, es war nach Mitternacht, als ich aus dem Bahnhof kam, er stand halb verdeckt hinter einem Auto, trug die gleiche Kapuzenjacke und hatte dem Laden den Rücken zugewandt. Ich nahm meinen Mut zusammen, überquerte die kleine Straße und ging auf ihn zu.
»Entschuldigung.«
Schweigen.
»Entschuldigung«, wiederholte ich. »Bist du nicht Kobayashi-kun?«
Er schüttelte den Kopf.
»Kobayashi Kento-kun.«
Er räusperte sich mehrmals, als hätte er sich an etwas verschluckt. »Du … du musst mich verwechseln«, erwiderte er leise.
Die Stimme verunsicherte mich. Sie war nicht so weich und hell, wie ich sie in Erinnerung hatte, sondern flach, fast tonlos.
»Ich bin es. Akiko.«
Er antwortete nicht.
»Nakamura Akiko. Aus Nara.«
Für einen Moment beschlichen mich Zweifel.
»Von der Junior High School. Aus der 3b.«
Er tat, als hätte er mich nicht gehört. Kurz überlegte ich, ihn in Ruhe zu lassen. »Wir waren in demselben Bukatsu, dem Fotoclub. Erinnerst du dich?«
Statt etwas zu sagen, drehte er sich um und schaute mich an. Er war blass und sah müde aus. Am Kinn und über der Oberlippe sprossen ein paar Barthaare. Sein Blick, der Ausdruck in seinem Gesicht hatten sich nicht verändert, er schaute mich genauso melancholisch an wie vor dreizehn Jahren.
»Wohnst du hier in der Gegend?«
Er nickte.
»Schon lange?«
»Hm.«
»Ich auch.«
Er räusperte sich schon wieder. »Ich weiß.« Seine Stimme klang, als hätte er eine Erkältung.
Woher weißt du das?, wollte ich fragen, verkniff es mir jedoch.
Wo und wann hatten wir uns das letzte Mal gesehen? Nach der Junior High School waren Kento und ich auf verschiedene Schulen gewechselt. Danach hatten wir uns ein paarmal zufällig im Bus und auf der Straße getroffen, uns gegrüßt, aber nicht miteinander geredet. Ich traute mich nicht, ihn anzusprechen, und er hatte vermutlich kein Interesse. In Osaka hatte ich ihn in einem Buchladen beobachtet, wie er ein halbes Dutzend Bücher kaufte. Wir hatten an zwei unterschiedlichen Kassen angestanden, ich sagte Hallo, er bemerkte mich nicht oder tat zumindest so.
Ein paar Wochen nach dem Abschluss meiner Highschool zogen meine Mutter und ich nach Tokio, seitdem bin ich nie wieder in Nara gewesen.
»Die langen Haare stehen dir«, sagte ich, nur um etwas zu sagen.
Wir standen uns gegenüber, er hatte den Blick gesenkt, und im grellen Licht des Schaufensters fiel mir zum ersten Mal auf, wie ärmlich er gekleidet war. Die Kapuzenjacke war an den Ärmeln abgewetzt, die Schuhe ausgetreten, er trug eine ausgeblichene Jogginghose, auf der sich selbst bei diesem Licht kleine und große Flecken abzeichneten.
»Tut mir leid, wenn ich dich gestört habe. Ich mache mich auf den Weg. War ein langer Tag«, sagte ich und machte Anstalten zu gehen.
»Wo ist deine Mutter?«, hörte ich ihn plötzlich fragen.
Mir fiel auf, dass ihm sein linker Schneidezahn fehlte. »Sie … ist tot.«
»Ohh«, entfuhr es ihm laut und erschrocken. Er senkte den Kopf, kratzte mit der Spitze seines linken Schuhs auf dem Asphalt, beide Hände in der Jacke vergraben. »Das wusste ich nicht. Tut mir leid, dass ich gefragt habe«, flüsterte er.
»Schon in Ordnung.« Wir blieben noch einen Moment stehen. Ich hätte gern etwas gesagt, aber mir fiel nichts ein. Mich überkam eine tiefe Schwere, mein Körper fühlte sich an, als hätte jemand eine Weste aus Blei darübergehängt, ich wollte nach Hause. »Ich bin müde«, sagte ich.
Er nickte.
»Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Mach’s gut.«
»Hm«, erwiderte er und machte keine Anstalten zu gehen.
Nach kurzem Zögern drehte ich mich um und machte mich auf den Weg.
Kento. Ausgerechnet Kento. In den drei Jahren der Junior High School waren wir in dieselbe Klasse gegangen und hatten in einer der hinteren Reihen nebeneinandergesessen, nur getrennt durch den Gang. Wir hatten sogar in derselben Straße gewohnt. Er in einer Villa am oberen Ende, in der Nähe des Waldes, meine Mutter und ich in einer kleinen Wohnung am unteren Ende. Das Haus der Familie lag hinter einer Mauer, über die säuberlich beschnittene Pinien, Kirschbäume, Bambus und ein Pflaumenbaum wuchsen. Auf meinen Spaziergängen in den Wald ging ich häufig daran vorbei und stellte mir vor, was für ein schöner Garten sich hinter der Mauer verstecken mochte.
In der Schule wäre Kento eigentlich das typische Mobbingopfer gewesen. Als er die ersten Male das Klassenzimmer betrat, kicherten die meisten, so sonderbar sah er aus. Die Proportionen seines Körpers stimmten nicht. Er war der Größte in der Klasse, aber spindeldürr, seine Arme und Beine waren zu lang, seine Hände zu groß, seine Finger zu dünn. Sein Kopf war sehr schmal und zu groß für seine schmächtige Statur. Am auffallendsten war sein Gesicht. Es hatte feine Züge, eine hohe Stirn, große Augen und volle Lippen, fast wie ein Mädchen. Er gehörte zu den stillen Jungs, vielleicht war er sogar der ruhigste von allen. Er sah oft müde aus und schlief regelmäßig im Unterricht ein. In den Pausen hielt er sich von den anderen fern, er verbrachte sie lesend auf dem Schulhof oder schlafend im Klassenraum. Auf der Junior High School wuchs sich sein Körper zurecht, und im letzten Schuljahr wurde aus ihm ein ziemlich gut aussehender Junge. Er war noch immer der Größte in der Klasse, aber nun passten die Proportionen. Kento war der einzige Junge mit lockigen Haaren, was er in der siebten und achten Klasse zu verbergen suchte, indem er sich die Haare ganz kurz schnitt. In der neunten ließ er sie ein wenig länger wachsen, was ihm, wie ich fand, gut stand.
Im Unterricht sagten wir beide selten etwas. Er meldete sich nie; sprach ein Lehrer ihn direkt an, schwieg er oder gab knappe Antworten, die manchmal sogar falsch waren. Ich vermutete, er mache das mit Absicht, weil er mit seinem Wissen nicht angeben wollte. In fast allen Fächern gehörten wir mit Abstand zu den Besten in der Klasse, unsere schriftlichen Arbeiten glichen unsere schwache mündliche Beteiligung aus. Er war besonders gut in Musik und Mathematik, ich in Japanisch und Englisch. Sport war unser schlechtestes Fach, aber im Gegensatz zu mir verbesserte er sich von Jahr zu Jahr.
Ich mochte ihn von Beginn an, auch wenn wir nicht viel miteinander sprachen. Mit seiner stillen Art, seinem immer etwas melancholischen Blick unterschied er sich von den anderen Jungs, die, sobald kein Lehrer in der Nähe war, laut und angeberisch wurden, mit Leistungen prahlten, die mich nicht interessierten, und um Antworten nie verlegen waren. Kento half den schwächeren Schülern bei ihren Aufgaben, hatte jemand seine Bento-Box vergessen, gab er bereitwillig ein Stück Apfel oder Onigiri ab.
Die Jungs ließen ihn in Ruhe. Es fiel kein böses Wort wegen seines Aussehens, seiner Locken oder seiner hellen Stimme. Ich habe mich damals gefragt, warum er nie schikaniert wurde. Er hatte keine Freunde, die ihn hätten schützen können. Niemand in der Klasse wäre ihm zu Hilfe gekommen, so wie mir auch nie jemand zu Hilfe kam. Kento besaß etwas anderes, etwas Geheimnisvolles, eine Aura, die die anderen einschüchterte. In den Pausen sagte er selten etwas, erhob niemals die Stimme, aber wenn er etwas sagte, wählte er seine Worte mit Bedacht, sprach leise und wie gedruckt, und alle hörten zu.
Manchmal hatte ich das Gefühl, er wäre gar nicht da. Dann schaute er uns auf eine seltsame Art an, als würde er die anderen weder sehen noch hören. Als wäre ihm vollkommen gleichgültig, was um ihn herum geschah.
Einmal behaupteten zwei Mitschüler, sie hätten von ihren Eltern gehört, Kento sei ein musikalisches Wunderkind. Angeblich könne er lange Kompositionen am Klavier auswendig und besser spielen als jeder Erwachsene, und aus ihm würde eines Tages ein berühmter Pianist werden. Ein Mädchen wollte von ihm wissen, ob das stimme, er ignorierte ihre Frage einfach. Im Schulorchester machte er nicht mit, und als die Musiklehrerin ihn aufforderte, nach vorn zu kommen und für uns etwas zu spielen, blieb er schweigend und mit gesenktem Blick sitzen. Sie bat ihn höflich ein zweites Mal, er reagierte wieder nicht. Wenn bei Veranstaltungen Schülerinnen oder Schüler in der Aula Klavier vorspielen mussten, gehörte er nie dazu. Deshalb kamen wir in der Klasse zu dem Schluss, dass das nur ein Gerücht sei.
Zu Beginn des dritten Schuljahres in der Junior High School teilten die Lehrer Kento und mich häufig zu gemeinsamen Arbeitsdiensten ein. Ich wusste nicht, ob es Zufall war oder ob sie fanden, dass wir uns gut ergänzen würden. Wir fegten und wischten den Klassenraum zusammen, putzten die Treppenstufen, sammelten Laub und Abfall auf dem Hof. Dabei sprachen wir wenig, was mir sehr entgegenkam.
Für den Nachmittag trugen wir uns, ohne es zu ahnen, für denselben Bukatsu ein: Fotografie. In unserer Junior High School mussten wir an mindestens einem Schulclub teilnehmen, und von den Sportclubs, die sich fast jeden Tag und auch an Wochenenden trafen, kam keiner für mich infrage. Kalligrafie, Blumenbinden, japanisches Bogenschießen oder Teezeremonie interessierten mich ebenso wenig wie der Chor oder das Orchester. Ich wollte in Ruhe gelassen werden. Der Fotoclub traf sich nur einmal in der Woche und wurde von einem älteren Lehrer betreut, der dafür bekannt war, sich für die Aktivitäten der Schüler nicht mehr sonderlich zu interessieren. Ich entschied mich für Fotografie, auch wenn ich nicht einmal einen Fotoapparat besaß. Den bekamen alle Kursteilnehmer von der Schule geliehen. In unserem Bukatsu waren wir zu zehnt, neun Mädchen und Kento. Wir fotografierten die Woche über und trafen uns jeden Mittwoch nach der Schule, um uns unsere Bilder zu zeigen. Die anderen nahmen sich hauptsächlich gegenseitig auf: Wie sie zu zweit oder zu dritt durch Nara zogen, Tapioka tranken, Rehe fütterten, Ramen oder Crêpes aßen. Dabei grinsten sie auf jedem Foto mit dem gleichen dämlichen Ausdruck im Gesicht in die Kamera und spreizten Mittel- und Zeigefinger zu einem V. Ein Foto sah wie das andere aus, und ich gähnte vor Langeweile, wenn sie sie zeigten.
Der Lehrer bestand darauf, dass die Gruppe auch Kentos und meine Bilder zu sehen bekam, und es fiel gleich auf, dass wir beide Motive ohne Menschen gewählt hatten. Ich hatte mich auf Blumen konzentriert, er auf den Himmel. Meine Fotos waren Schnappschüsse von Rosen, Hyazinthen oder Pflaumen- und Kirschblüten, Kento hatte wochenlang nichts als Wolken oder blauen Himmel fotografiert. Er öffnete auf dem Computer eine Datei mit Hunderten von Aufnahmen, die er uns eine nach der anderen zeigen wollte und die auf den ersten Blick, bis auf wenige Ausnahmen, alle ähnlich aussahen: Auf den einen war der Himmel mit grauweißen Wolken verhangen, auf den anderen strahlte er in einem tiefen Blau.
Irgendwann verstanden die Mädchen, dass das alles war, was sie zu sehen bekommen würden, sie begannen, wie blöde zu kichern, verloren das Interesse und wandten sich ab. Selbst der Lehrer schüttelte irgendwann nur wortlos den Kopf. Nach dem, gefühlt, hundertfünfzigsten Wolken-Himmel-Foto saßen nur noch Kento und ich vor dem Bildschirm. Er machte nicht den Eindruck, als wenn ihn das störte. In aller Ruhe klickte er auf ein Bild nach dem anderen, wir betrachteten sie lange, und je mehr ich sah, desto besser verstand ich, dass jedes anders aussah, dass sie nur für den flüchtigen Betrachter austauschbar waren.
»Sie sind ganz toll«, sagte ich irgendwann. Ich wusste nicht, ob ich zu leise gesprochen hatte oder ob ihm meine Meinung gleichgültig war, jedenfalls reagierte er nicht.
In der folgenden Woche fragte er, ob er mich fotografieren dürfe. Nur ein Porträt, ich müsse nichts machen, außer in die Kamera zu schauen. Dabei dürfe ich nicht lächeln. Ich spürte, wie meine Wangen vor Verlegenheit ganz heiß wurden, vermutlich sah ich aus wie eine pickelige Tomate. Ja, wollte ich antworten, ja, sehr gern, selbstverständlich, so oft du möchtest. Doch ich brachte keinen Ton heraus.
Er verstand meine Reaktion falsch.
Nach einem entsetzlich langen Moment des Schweigens entschuldigte er sich für die Frage, deutete eine Verbeugung an und drehte sich um. Halt, warte bitte, das ist ein Missverständnis, hätte ich in dem Moment rufen müssen. Ich bin nur schüchtern. Ganz entsetzlich schüchtern. Ich fände es schön, wenn du Fotos von mir machst. Ich fände es schön, wenn wir mal zusammen einen Nachmittag verbringen. In den Park gehen. Ins Kino.
Wir könnten Freunde sein.
Aber natürlich sagte ich nichts.
Zu Hause weinte ich vor Wut und Enttäuschung. Ich war ein kleiner, jämmerlicher Angsthase. Mir fehlte der Mut zu sagen, was ich fühlte. Was ich mir wünschte. Hätte ich ihn gehabt, wäre ich eine andere Akiko. Dann würde ich anderen sagen, was sie zu tun und lassen hatten, so wie es Eriko und Tomoko taten. Dann wäre ich vielleicht Klassensprecherin, und kein Mädchen käme auf die Idee, mir auf dem Weg nach Hause aufzulauern. Später tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass Kento diese andere Akiko vielleicht gar nicht gefragt hätte, so wie er Eriko und Tomoko nicht gefragt hatte.
An dem Nachmittag spürte ich, dass ich etwas für ihn empfand, was ich für keinen anderen Menschen fühlte. Da es das erste Mal war, hatte ich keine Worte dafür und wusste nicht, was es zu bedeuten hatte.
Sobald er in meiner Nähe war, bekam ich Herzklopfen. Ich ließ vor ihm ein Blatt Papier, meine Stäbchen oder einen Stift fallen, weil ich wusste, dass er sie aufheben und mir reichen würde. Er tat das mit großer Geduld. Wahrscheinlich hielt er mich für einen Bewegungstrottel. Ich achtete mehr auf mein Äußeres, betrachtete mich oft im Spiegel und fragte mich, was Kento in meinem Gesicht gesehen haben mochte, dass er Bilder von mir machen wollte. Den Tag, an dem sich der Fotoclub traf, konnte ich nicht abwarten. Selbst meiner Mutter fiel die Veränderung an mir auf.
Jede Woche nahm ich mir vor, ihm zu sagen, dass er mich gern fotografieren könne, jede Woche war die Angst größer als mein Wunsch, mit ihm Zeit zu verbringen. Kurz vor Ende des Trimesters schlug der Lehrer vor, wir sollten uns für die kommende Woche eine Partnerin suchen und Porträts vom anderen machen. Er würde Studiolicht und eine weiße Leinwand besorgen. Die anderen hatten sich schnell verabredet, Kento und ich waren die Einzigen, die übrig blieben. Ich freute mich die ganze Woche auf das nächste Treffen.
Abends, wenn ich allein zu Hause saß, weil meine Mutter in der Bar arbeitete, dachte ich an ihn, stellte mir vor, was er in seinem Zimmer am anderen Ende der Straße machte. Ich träumte davon, dass er mich zu einem Ausflug einladen würde, zu einer Tapioka oder wenigstens zu einem Spaziergang in einen der Parks; dass ich ihn besuchen würde in der schönen Villa. Ich sah mich die Holztür beiseite schieben, durch den moosbewachsenen Garten mit den Bonsaibäumen gehen. Seine Mutter begrüßte mich am Eingang. Ich verbeugte mich höflich, zog meine Schuhe aus, sie führte mich durch einen Raum mit Tatamis vorbei an einem schwarz glänzenden Flügel in den ersten Stock zu seinem Zimmer. Dort wartete er bereits auf mich. Wir setzten uns vor seinen Computer, und er zeigte mir die vielen Porträts und Fotos, die er von mir gemacht hatte.
Natürlich geschah nichts davon.
In der nächsten Woche erschien Kento nicht zum Fotoclub. In der darauffolgenden auch nicht. Stattdessen informierte uns der Lehrer, dass Kento den Bukatsu offiziell und entschuldigt verlassen habe. Der Club und die damit verbundenen Anforderungen seien ihm zu viel und zu einer Belastung geworden.
Jedes Mal, wenn wir uns in der Klasse sahen, fühlte ich einen Stich im Körper. Kento war wie ein Spiegel, in den ich schaute. Und was ich sah, war ein ängstliches junges Mädchen, das ich wegen seiner Feigheit nicht ausstehen konnte.
Das war einer der Gründe, warum ich seltener in die Schule ging. Außerdem langweilte ich mich und ertrug die Gehässigkeiten der anderen nicht mehr. Egal ob sie mir galten oder ich Zeugin wurde, wie andere geärgert oder gequält wurden.
Bei gutem Wetter verbrachte ich viel Zeit im Wald. Dort begegnete ich selten einem anderen Menschen. Meine Mutter war überzeugt, dass es dort Geister gäbe, und ich glaube, sie hatte recht. Aber ich hatte keine Angst vor ihnen, und sie ließen mich in Ruhe. Oft hockte ich auf einem moosbewachsenen Stein am Ufer eines Baches und beobachtete das fließende Wasser. Es gluckste und gurgelte, und ich stellte mir vor, dass der Bach fortwährend etwas erzählte in einer Sprache, die ich nicht verstand. Ich konnte ihm lange zuhören, ohne dass es mich langweilte. Oder ich streunte zwischen den Bäumen umher, bis mir kalt wurde.
Im Winter oder bei schlechtem Wetter ging ich in die Stadtbibliothek. Dort saßen immer noch andere Jugendliche, die nicht zur Schule wollten. Wir hockten alle in einer Ecke und lasen. Stundenlang. Ohne ein Wort zu wechseln. Wir wussten, warum wir dort waren. Es gab nichts zu reden.
Die Bücher waren unsere kleinen Fluchten. Sie dienten uns als Schutzburgen, in die wir uns zurückzogen und in denen uns die Welt, die uns umgab, nichts anhaben konnte. Ich bewunderte die Menschen, die sie mit ihrer Fantasie für uns geschaffen hatten. Sobald ich ein Buch aufschlug, schaute ich zuerst nach der Autorin oder dem Autor, wo und wann sie geboren waren, wo sie lebten, ob sie Familie hatten, welche anderen Bücher es von ihnen gab. Meistens waren es Frauen, und ich war jeder einzelnen von ihnen dankbar.