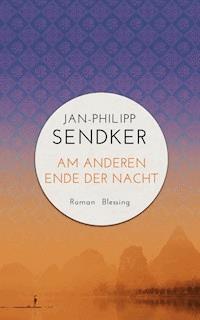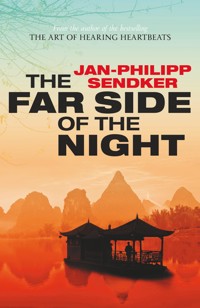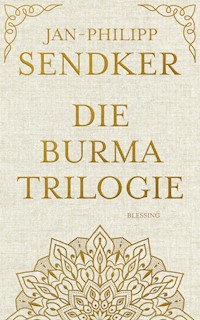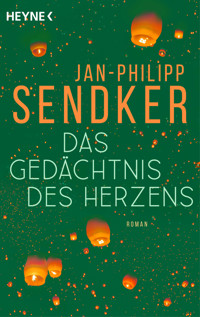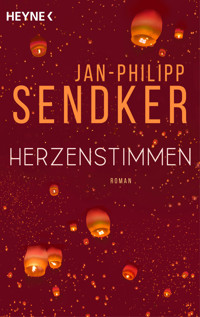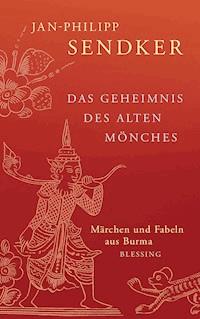
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Geschichten, die das Herz berühren, gesammelt vom großen Burmakenner Jan-Philipp Sendker
»Ich habe Burma seit 1995 mehrere Dutzend Male bereist, und bei den Recherchen für meine Romane Das Herzenhören und Herzenstimmen wurden mir immer wieder Märchen und Fabeln erzählt. Zum einen waren das bewegende Geschichten, die von dem mythologischen Reichtum der verschiedenen Völker Burmas erzählten, von der Spiritualität der Menschen und wie tief buddhistisches Denken die Gesellschaft über Jahrhunderte geprägt hat. Andere waren so fremd und skurril und kamen ohne eine sich mir erschließende Moral aus, sodass ich sie gar nicht einordnen konnte. Wieder andere erinnerten mich an die Märchen meiner Kindheit, nur dass hier Affen, Tiger, Elefanten und Krokodile die Fantasiewelt bevölkerten statt Igeln, Eseln oder Gänsen. Die Lehren, die sie vermitteln wollten, ähneln denen der Brüder Grimm oder Hans Christian Andersens und ich verstand, wie sehr sich alle Kulturen in ihren Mythen aus dem universellen Fundus menschlicher Weisheit bedienen.« Jan-Philipp Sendker
Geschichten, die das Herz berühren – gesammelt und erzählt vom großen Burmakenner Jan-Philipp Sendker gemeinsam mit Lorie Karnath und Jonathan Sendker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Ähnliche
Die schönsten Märchen und Fabeln aus dem geheimnisvollen Land der Pagoden.
»Ich habe Burma seit 1995 mehrere Dutzend Male bereist, und bei den Recherchen für meine Romane Das Herzenhören und Herzenstimmen wurden mir immer wieder Märchen und Fabeln erzählt. Zum einen waren das bewegende Geschichten, die von dem mythologischen Reichtum der verschiedenen Völker Burmas erzählten, von der Spiritualität der Menschen und wie tief buddhistisches Denken die Gesellschaft über Jahrhunderte geprägt hat. Andere waren so fremd und skurril und kamen ohne eine sich mir erschließende Moral aus, sodass ich sie gar nicht einordnen konnte. Wieder andere erinnerten mich an die Märchen meiner Kindheit, nur dass hier Affen, Tiger, Elefanten und Krokodile die Fantasiewelt bevölkerten statt Igeln, Eseln oder Gänsen. Die Lehren, die sie vermitteln wollten, ähneln denen der Brüder Grimm oder Hans Christian Andersens und ich verstand, wie sehr sich alle Kulturen in ihren Mythen aus dem universellen Fundus menschlicher Weisheit bedienen.«
Jan-Philipp Sendker
Geschichten, die das Herz berühren – gesammelt und erzählt vom großen Burmakenner Jan-Philipp Sendker gemeinsam mit Lorie Karnath und Jonathan Sendker.
JAN-PHILIPP
SENDKER
gemeinsam mit Lorie Karnath
und Jonathan Sendker
DAS GEHEIMNIS
DES ALTEN
MÖNCHES
Märchen und Fabeln
aus Burma
BLESSING
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Jan-Philipp Sendker
Copyright © 2017 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-20210-1V001
www.blessing-verlag.de
Für unsere Eltern
VORWORT
Als die amerikanische Autorin Lorie Karnath an mich herantrat und fragte, ob wir nicht gemeinsam ein Buch über burmesische Märchen, Fabeln und Parabeln schreiben sollten, war ich sofort interessiert.
Ich hatte die ehemalige britische Kolonie seit 1995 mehrere Dutzend Male bereist, zunächst als Journalist, aber schon bald als Schriftsteller, und bei den Recherchen für meine Romane Das Herzenhören und Herzenstimmen waren mir immer wieder Geschichten aus dem Reich der Märchen und Legenden zugetragen worden. Sie weckten meine Neugierde, weil es oft bewegende Erzählungen waren, die von dem mythologischen Reichtum der verschiedenen Völker Burmas berichteten, von der Spiritualität der Menschen und davon, wie tief das buddhistische Denken die Gesellschaft über Jahrtausende geprägt hat. Mönche und das Klosterleben spielen in vielen dieser Geschichten eine wichtige Rolle, ebenso der fest verwurzelte Glaube an die Wiedergeburt. Immer wieder wunderte ich mich, wie oft darin Menschen starben und dann in einer neuen Reinkarnation zurückkehrten, um Gutes zu tun oder Unheil anzurichten.
Andere Erzählungen waren so fremd, so skurril und kamen ohne eine sich mir erschließende Moral aus, sodass ich sie gar nicht einordnen konnte. Wieder andere erinnerten mich an die Märchen meiner Kindheit, nur dass hier Affen, Tiger, Elefanten und Krokodile die Fantasiewelt bevölkern anstelle von Igeln, Eseln oder Gänsen. Die Lehren, die sie vermitteln wollen, ähneln denen der Gebrüder Grimm oder Hans Christian Andersens, und ich verstand, wie sehr sich alle Kulturen der Welt in ihren Mythen aus dem universellen Fundus menschlicher Weisheit bedienen.
Lorie Karnath ist mit dem Land und seinen Menschen nicht weniger vertraut als ich. Sie ist in den frühen Neunzigerjahren zum ersten Mal dort gewesen, einer Zeit, in der die Militärregierung jeden Fremden misstrauisch beäugte, das Reisen viel beschwerlicher war als heute und sie sich oft noch auf Ochsenkarren oder Pferdekutschen fortbewegen musste. Seither hat sie Burma, seine Geschichte und Kultur, auf vielen Fahrten in die verschiedenen Provinzen ausgiebig erkundet und sich dabei intensiv mit den Legenden und Sagen des Landes beschäftigt. Lorie hat bereits mehrere Essays und ein Buch über Burma veröffentlicht.
Mein Sohn Jonathan hielt sich in der Zeit, als die Idee zu diesem Buch entstand, in Nyaung Shwe auf, einer kleinen Stadt am Ufer des Inle-See in den Shan-Staaten, wo er gemeinsam mit einem Freund als Freiwilliger in zwei Waisenhäusern Englisch unterrichtete. Er hatte sogleich Lust mitzuarbeiten, und zusammen mit Janek Mattheus begab er sich auf die Suche nach weiteren Geschichten. In den fünf Monaten, die sie in Burma verbrachten, hörten sie sich bei den Nachbarn um, besuchten Schulen, Klöster und Restaurants und kehrten mit prall gefüllten Notizbüchern zurück.
Bei weiteren Recherchen haben wir in den Buchläden Yangons nach alten, vergriffenen Märchenbänden gesucht und in zerfledderten Schulbüchern Fabeln und Märchen entdeckt.
So ist dieses Buch das Ergebnis einer Teamarbeit. Jeder von uns hat Geschichten gesammelt und dann die schönsten von ihnen aufgeschrieben, ich habe sie editiert und das Buch mit einer Einleitung und einem Nachwort versehen. Dabei habe ich mich bemüht, meinen beiden Koautoren ihre eigene Erzählstimme zu lassen, sodass sich die Texte in Stil, Tempo und Länge unterscheiden.
Nicht selten haben wir verschiedene Varianten derselben Geschichte gehört und uns dann für eine entschieden oder sie zu einer Version zusammengefügt. Häufiger bekamen wir ein Märchen ohne Titel erzählt und konnten trotz mehrfachen Nachfragens nicht herausfinden, wie es heißt. Für diese Geschichten haben wir uns Titel ausgedacht.
Unser Vorhaben, die Märchen und Fabeln in Kapitel wie »Liebe«, »Neid« oder »Glaube« zu gliedern, haben wir schnell aufgegeben. Dafür sind sie zu vielschichtig, zu unterschiedlich; es wäre eine artifizielle Ordnung gewesen, die den Geschichten unrecht getan hätte.
Manche von ihnen werden Sie zum Schmunzeln bringen, andere werden Ihnen zu Herzen gehen, Sie irritieren oder nachdenklich stimmen.
In jedem Fall sind die folgenden Seiten eine Reise in eine andere, zuweilen fremd anmutende und dann auch wieder vertraute Welt. Als Autoren haben wir dabei gelernt, dass uns Menschen bei allen kulturellen und historischen Unterschieden, bei aller Exotik und Fremdheit, doch viel mehr verbindet als trennt.
Jan-Philipp Sendker, im April 2017
MEIN BURMA
Jan-Philipp Sendker
Als ich das erste Mal vom Zauber Burmas hörte, von seiner Schönheit, seinen freundlichen Menschen, ihrer Spiritualität und ihrem Aberglauben, saß ich umgeben von Trümmern an einer Straßenecke in Kobe. Ein verheerendes Erdbeben hatte die Metropole verwüstet, ich war, zusammen mit dem amerikanischen Fotografen Greg Davis, als Asienkorrespondent des stern in Japan unterwegs, um über die Naturkatastrophe zu berichten. Es brannten noch zahllose Feuer in der Stadt, Rauchsäulen stiegen aus den Trümmern empor, Menschen irrten durch die Straßen auf der Suche nach vermissten Familienangehörigen. Wir waren beide völlig erschöpft und gezeichnet von den Erlebnissen der vergangenen Tage. Ich brauchte dringend eine Pause.
Greg war kurz zuvor in Burma gewesen. Vielleicht sehnten wir uns inmitten all der Zerstörung, inmitten von Leid und Tod, nach etwas Trost. Vielleicht wollte er uns in diesem Moment einfach ein wenig ablenken mit einer Geschichte über andere Leben. Jedenfalls begann Greg unvermittelt von Burma zu erzählen. Ein Land, wie er es, der als Fotograf schon in der halben Welt unterwegs gewesen war, noch nicht gesehen hatte. Unberührt von unserer westlichen Konsumgesellschaft, Bewohner, die dem fremden Besucher voller Neugierde und Gastfreundschaft begegneten, kaum Autos, kaum Telefone, südostasiatische Dörfer, Städte und Landschaften wie vor fünfzig oder hundert Jahren. In meinen Ohren klang das wie eine Art Shangri-La, und irgendwann entstand in jenen Stunden mein dringlicher Wunsch, nach Burma zu reisen.
Es war nicht leicht, den stern davon zu überzeugen, mich dorthin zu schicken. Damals interessierte sich kein Mensch für die ehemalige britische Kolonie. Nach einem Militärputsch hatte eine Junta aus Generälen 1962 die Macht übernommen und das einst prosperierende Land durch Inkompetenz, Korruption und Misswirtschaft in den Ruin getrieben. Die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi stand unter Hausarrest, Tausende von politischen Gefangenen saßen in Gefängnissen, Proteste von Studenten hatte das Militär 1988 blutig niedergeschlagen, mehrere Tausend Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Der Westen reagierte mit Sanktionen. Burma, das auf Befehl der Diktatoren neuerdings Myanmar hieß, war politisch und wirtschaftlich isoliert.
Auch auf der touristischen Weltkarte spielte es keine Rolle. Jahrzehntelang gab es, wenn überhaupt, nur ein Visum für sieben Tage, eine zu kurze Zeitspanne, um ein Land von der Größe Frankreichs zu bereisen. Aber die Regierung hatte 1996 zum Jahr des Tourismus ausgerufen, und ich wollte eine Reportage darüber schreiben, wie sich das weltabgewandte Burma auf den erhofften Besucheransturm vorbereitete.
Der Flug von Bangkok nach Yangon dauerte rund eine Stunde, und ich merkte schon kurz nach meiner Ankunft, dass ich in dieser Zeit um mindestens fünfzig Jahre zurück in die Vergangenheit gereist war.
Auf dem Rollfeld stand kein anderes Flugzeug. Das einstöckige Terminal hatte die Größe eines kleinen Supermarktes. Der Bus, der uns vom Flugzeug zur Ankunftshalle bringen sollte, stand verloren auf dem Rollfeld, eine Tür hing schief in ihren Scharnieren. Das Fahrzeug war kaputt.
Das Gepäckband auch.
Vor dem Ausgang warteten vielleicht zwei Dutzend Taxifahrer auf die wenigen Passagiere. Sie alle trugen weiße Hemden und Longyis, eine Art burmesischen Wickelrock, und lächelten freundlich. Einer von ihnen griff nach meinem Koffer, den ich ihm widerwillig gab. Er führte mich zu seinem Wagen, einem alten, verbeulten Toyota ohne Armaturenbrett. Beim dritten Versuch sprang der Motor an.
Wir fuhren langsam in die Stadt. Es gab kaum Autos oder Ampeln, die meisten Menschen gingen zu Fuß, Kinder spielten auf den Straßen, in Höfen und Gassen brannten Feuer, es wurde gekocht. Es gab keine Werbung, keine Neonreklamen, keine Hochhäuser, nur wenige Geschäfte. Unser Weg führte an alten Teakvillen, Klöstern und Pagoden vorbei. Nichts deutete auf die Welt, aus der ich kam und die doch nur eine Flugstunde entfernt lag. Irgendwann war ich so verwirrt, dass ich den Fahrer fragte, ob es einen McDonald’s in der Stadt gäbe.
Er dachte lange nach. Dann drehte er sich um und fragte höflich: »Ist der Herr vielleicht Schotte?«
Wir fuhren an der berühmten Shwedagon-Pagode vorbei, die in der Abendsonne golden glänzte, der Fahrer nahm kurz die Hände vom Lenkrad und verneigte sich.
Es war heiß und feucht. Mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius ist der Mai der wärmste Monat in Burma. Mir lief der Schweiß Stirn und Nacken hinunter, das Hemd klebte mir am Körper. Ich fragte, ob sein Wagen eine Belüftung oder gar Klimaanlage besäße. Ja, selbstverständlich. Ob er sie vielleicht anstellen könnte? Nein, sie war kaputt, bedauerlicherweise.
Irgendwann hielten wir vor einem alten Hotel aus der britischen Kolonialzeit, in dem angeblich bereits George Orwell übernachtet hatte. Es war früher Abend, die Straßen waren voller Menschen, vor vielen Häusern saßen Männer und Frauen auf Hockern und Schemeln, tranken Tee, fächelten sich Luft zu, redeten, lachten. Ich brachte schnell meinen Koffer aufs Zimmer und wollte nichts lieber, als diese fremde, seltsame Stadt erkunden.
Wo immer ich hinkam, empfingen mich die Blicke der Passanten: überrascht, freundlich, neugierig. Hin und wieder wurde ich angesprochen, zumeist von älteren Herren: »Where are you from, Sir?«, wollten sie wissen. Ihr Akzent klang britisch oder indisch.
Ich vermutete, dass sie mir irgendwelche nutzlosen Dinge verkaufen wollten, erwiderte knapp »Germany« und ging weiter, bis ich bemerkte, dass es kaum etwas zu kaufen gab. Die Herren waren nur an einer kleinen Konversation interessiert, erfreut, einen Ausländer zu sehen, mit dem sie Englisch sprechen konnten.
Plötzlich vernahm ich ein lautes, knallendes Geräusch, und es wurde dunkel. Stromausfall. Ein, wie ich schnell lernen sollte, tägliches Ärgernis. Aber die Menschen waren daran gewöhnt und vorbereitet, sie zündeten Kerzen an. Heute springen in diesen Momenten überall Generatoren an, und ihr dumpfes Dröhnen füllt die Straßen, doch damals gab es die Geräte kaum. Innerhalb weniger Minuten war das ganze Viertel nur von Kerzen beleuchtet. Sie standen auf Fensterbänken, Stufen, Gehwegen und den Tischen der Teehäuser und tauchten die Stadt in ein magisches Licht. Da keine Autos fuhren und es keine Elektrizität gab, vernahm ich kaum andere Geräusche als die menschliche Stimme. Gelächter. Flüstern. Kindergeschrei. Gesang.
Es war der Gesang, der mich am meisten überraschte, und ich folgte den Tönen. Wo immer sie mich hinführten, ob in eine Toreinfahrt, einen Hinterhof oder an das Ufer eines Flusses, entdeckte ich dasselbe Bild: Ein junges Paar saß beieinander, und der Mann sang der Frau Lieder vor. Später sollte ich erfahren, dass das eine burmesische Tradition ist für frischverliebte Paare.
Ich dachte voller Dankbarkeit an Greg.
Am nächsten Tag wanderte ich ziellos und schwitzend durch die Stadt. Nach einer Weile entdeckte ich über einem Hauseingang eine vom Regen ausgewaschene Schrift: »Bagan book store – english books«.
Da ich kein Burmesisch sprach und niemanden in der Stadt kannte, hoffte ich auf einen ersten Kontakt und betrat den Laden.
Er war klein, keine zwanzig Quadratmeter, in Holzregalen, die aussahen wie selbst gebaut, stapelten sich alte Bücher fast bis unter die Decke. In der Mitte des Raums hockte ein alter Mann an einem flachen Tisch, über ihm drehte sich träge ein Ventilator. Er trug einen verblichenen Longyi und ein zerlöchertes, weißes Unterhemd. Er blickte auf und fragte, was ich wollte.
Mich mal umschauen, erwiderte ich.
Er nickte und widmete sich wieder seiner Arbeit. Vor ihm lag aufgeschlagen ein Buch in erbärmlichem Zustand. Die Seiten zerfleddert und voller Löcher. Daneben standen zwei kleine Töpfe, einer war voller winziger Papierschnipsel, der andere enthielt Klebstoff. Der alte Buchhändler fischte mit einer Pinzette einen Schnipsel aus einem der Behälter, tunkte ihn in den Leim und klebte ihn auf eines der Löcher auf der Buchseite. Dann nahm er einen schwarzen Stift und eine Lupe und zog sorgfältig den fehlenden Buchstaben nach. Das Buch war mindestens dreihundert Seiten dick, und er war erst am Anfang. Auf seiner Stirn standen dünne Schweißperlen, die er sich immer wieder mit einem Lappen abwischte. Im Laden war es noch heißer als auf der Straße.
Auf dem Fußboden lagen mehrere Stapel Bücher, alle in ähnlich schlechtem Zustand.
Ich schaute mich in den Regalen um. Dort standen ein paar Dutzend abgegriffene Taschenbücher, Urlaubslektüre, die ihm vermutlich Reisende hinterlassen hatten. Den meisten Platz nahmen Bücher über Burma ein, über die Geschichte und Kultur des Landes, seine Traditionen, seine Kunst, seine Tiere und Pflanzen.
»Suchen Sie etwas Bestimmtes?«
»Nein«, erwiderte ich.
»Sind Sie das erste Mal hier?« Er sprach perfektes Englisch mit britischem Akzent.
»Ja. Woher sprechen Sie so gut Englisch?«, erkundigte ich mich.
»Das habe ich von den Engländern gelernt.« Als er mein Erstaunen bemerkte, fügte er hinzu: »Aber das ist schon lange her.«
Ich betrachtete die aufgeschlagenen Seiten vor ihm. »Was machen Sie da, wenn ich fragen darf?«
»Ich restauriere ein Buch.«
»Wie lange brauchen Sie für einen Band?«
»Zwei bis drei Monate«, erwiderte er.
Ich nickte. Die Hitze ermüdete mich, und ich fragte, ob ich mich für einen Moment setzen dürfte. Er zog einen Hocker heran. Eine Weile beobachtete ich ihn stumm bei der Arbeit.
»Möchten Sie etwas trinken?«, fragte er unvermittelt.
»Sehr gern.«
Der alte Buchhändler erhob sich und verschwand in einem Raum am Ende des Ladens. Kurz darauf kehrte er mit einer Thermoskanne Tee und zwei Bechern zurück. Wir begannen vorsichtig ein Gespräch, unterbrochen von langen Pausen, das sich über die folgenden Tage fortsetzte. Jeden Nachmittag ging ich bei ihm vorbei und blieb bei jedem Besuch etwas länger, während er mir vom Schicksal seiner Familie berichtete. Sie hatten früher zu den Wohlhabenden und Gebildeten im Land gehört. Nach dem Militärputsch 1962 und der anschließenden Diktatur hatten sie alles verloren – bis auf die Bücher. »Soldaten interessieren sich nur selten für Literatur«, sagte er mit einem kurzen Lächeln. »Glücklicherweise.«
Um die Bücher vor dem Verfall zu bewahren, restaurierte er sie, kopierte und band sie und verkaufte diese Kopien an einige der seltenen Touristen, Diplomaten oder Geschäftsleute, die es in jenen Jahren nach Burma verschlug. Aber eigentlich fühlte er sich mehr wie der Hüter eines Schatzes, den er für die folgenden Generationen bewahren wollte. Er deutete auf ein kleines Mädchen, das auf der Straße spielte, hin und wieder durch den Laden rannte und in der dahinterliegenden Wohnung verschwand. Es war seine Enkelin. »Wenn ich mich nicht um die Bücher kümmere, wird sie nie in der Lage sein, sie zu lesen.«
Je länger wir uns unterhielten, je mehr ich durch Yangon streifte, umso intensiver begann ich mich für sein Land und dessen Geschichte zu interessieren.
Als es an der Zeit war, weiter in den Norden zu reisen, überreichte er mir zum Abschied ein Geschenk. Ein Buch, das er selber restauriert, kopiert und gebunden hatte. Ich sei ein ausgesprochen neugieriger Mensch und hätte so viele Fragen über Burma, auf einige von ihnen würde ich in diesem Buch Antworten finden.
Ich war dankbar und gerührt. Vorsichtig schlug ich die ersten Seiten auf. »The Soul of a People«, Die Seele eines Volkes, lautete der Titel. Publiziert in London 1902. Als Korrespondent hatte ich normalerweise nicht die Zeit, Bücher zu lesen, die vor hundert Jahren erschienen waren. Ein wenig enttäuscht klappte ich es wieder zu.
»Herzlichen Dank«, sagte ich. »Aber es ist ja schon ein bisschen alt.«
Er legte nachdenklich die Stirn in Falten, als wäre ihm diese Tatsache noch gar nicht aufgefallen. »Das stimmt«, antwortete er nach einer Pause. »Aber es macht nichts. Die Seele eines Volkes ändert sich nicht so schnell.«
Am späten Nachmittag stand ich mit Hunderten von anderen Reisenden am Hauptbahnhof von Yangon, einem imposanten Gebäude aus den Fünfzigerjahren, erbaut in traditionellem burmesischen Stil. Ich wollte mit der Bahn ins gut sechshundert Kilometer entfernte Mandalay reisen. Der »Nachtzug nach Mandalay« klang verheißungsvoll und romantisch, er sollte laut Fahrplan vierzehn Stunden brauchen. Eher sechzehn, hatte mich der Buchhändler gewarnt. Oder achtzehn. Oder vierundzwanzig. Je nach Zustand der Strecke, den Launen des Wetters und diversen anderen schwer zu kalkulierenden Faktoren.
Wir verließen den Bahnhof pünktlich am frühen Abend, und die ersten zwei, drei Stunden gehörten zu den schönsten, die ich je in einem Zug verbracht habe. Wir rumpelten mit zwanzig, dreißig Kilometern pro Stunde, oft aber auch in Schrittgeschwindigkeit, über die Schienen. Warme Luft wehte durch die offenen Fenster herein. Fliegende Händler liefen nebenher, sprangen auf, gingen durch die Waggons und verkauften Currys, Tee oder Suppen in Plastiktüten, Obst, Kekse, Wasser. Irgendwann sprangen sie einfach wieder ab.
Draußen zog eine asiatische Bilderbuchlandschaft vorbei. Reisfelder, kleine Flüsse, Kinder, die auf Wasserbüffeln ritten. Hinter Palmen ging die Sonne unter.
Es war die ideale Geschwindigkeit für die menschlichen Sinne. Ich hörte die Stimmen der spielenden Kinder. Der Geruch von brennenden Lagerfeuern, auf denen Abendessen zubereitet wurde, zog durch die Waggons. Näherten wir uns einem Fluss, kühlte die Luft ab, nur einen Hauch und doch spürbar.
Aber dann wurde es dunkel, und es gab nichts mehr zu sehen. Die Holzbank, auf der ich saß, wurde mit jeder Stunde härter, es blieb unerträglich heiß und feucht. An Schlaf war nicht zu denken. Nach zehn Stunden war ich völlig erschöpft, nach zwölf Stunden wollte ich nur noch raus aus dem »Nachtzug nach Mandalay«.
Beim nächsten Halt nahm ich meinen Rucksack und stieg aus. Im Morgengrauen stand ich auf dem Bahnhof von Thazi, umgeben von Hunderten schlafenden Menschen, die auf dem Bahnsteig lagen, den Gepäckwagen, den Treppen. Sie warteten auf irgendwelche Anschlusszüge, die irgendwann kommen würden. Zugfahrpläne, so sollte ich lernen, sind in Burma nur sehr grobe Anhaltspunkte.
Vor dem Bahnhof stand einer dieser weißen Toyotas, die oft als Taxi dienten. Darin lag ein Mann und schlief. Ein paar Meter weiter hatte bereits ein Imbiss geöffnet, über einem Feuer hing ein Kessel, die ersten Kunden hockten müde auf Schemeln und schlürften ihren Tee. Ich setzte mich zu ihnen, bestellte einen burmesischen Tee und wartete, bis der Fahrer erwachte.
Er brachte mich Stunden später nach Kalaw. Von einem australischen Diplomaten hatte ich in Yangon zwei Kontaktnamen bekommen. Ich sollte nach Vater Angelo und Tommy fragen, jeder im Ort würde sie kennen.
Vater Angelo war weit über achtzig, ein italienischer Missionar, der seit Jahrzehnten in Burma lebte. Er führte mich zu Tommy Ezdani. Vor mir stand ein kleiner Mann, um die fünfzig Jahre alt und von fast zierlicher Gestalt, der mich mit neugierigen Augen musterte. Auf dem Kopf trug er, zu einer Art Turban gebunden, ein gelbes Badehandtuch. Er bemerkte meine Irritation und erklärte amüsiert, dass dies der Kopfschmuck der Pa-O sei, einer ethnischen Minderheit, die in den Shan-Staaten lebt. Er sei gerade aus einem ihrer Dörfer zurückgekehrt.
Wir verstanden uns sofort. Er sollte mich in den folgenden Wochen auf verschiedene Exkursionen begleiten, und bis heute vergeht kaum eine Reise, auf der ich ihn nicht in den Shan-Staaten besuche. Tommy war in Kalaw geboren, ist aber Paschtune. Die Engländer als Kolonialherren hatten seinen Großvater aus Afghanistan nach Burma geholt. Schon als Kind begleitete er seinen Vater, einen Arzt, häufig in die umliegenden Dörfer der Pa-O, Palong, der Shan und der Karen, und lernte so von früh auf die Sprachen der verschiedenen ethnischen Minderheiten, die in den Bergen rings um Kalaw leben. Als wir uns kennenlernten, hatte er kurz zuvor eine Hilfsorganisation gegründet, die in den entlegenen Siedlungen Schulen, Brunnen und Brücken baute.
Nach einigen Tagen in Kalaw fragte er mich, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm einige der Dörfer zu besuchen, wir würden von Ort zu Ort laufen, dort übernachten und ich könnte so eine ganz andere Seite Burmas kennenlernen.
Auf unserer Wanderung begegneten wir nach einigen Stunden einer Frau, die Tommy offenbar gut kannte. Sie war hager, hatte lange Arme mit großen, kräftigen Händen. Auf dem Rücken trug sie ein großes Bündel Feuerholz, das sie im Wald gesammelt hatte. Die beiden unterhielten sich angeregt, aber während der ganzen Zeit ließ sie mich nicht aus den Augen. Sie musterte mich nicht unfreundlich, eher neugierig, prüfend. Schließlich kam sie auf mich zu und wollte meine Oberarme berühren. Ich trat einen Schritt zurück und fragte Tommy, was sie von mir wollte.
»Sie will dich heiraten.«
Ich blickte ihn verwirrt an.
»Und sie bietet fünf Kühe für dich. Aber ich habe ihr schon gesagt, dass das zu viele sind. Du bist ja schon fünfunddreißig.«
Das war, erklärte er mir, für burmesische Verhältnisse alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug nur dreiundfünfzig Jahre.
Aber sie ließ sich nicht beirren. Ich sähe ganz anders aus als die Einheimischen. Sie vermutete, dass ich länger halten würde.
Wir wanderten weiter und erreichten gegen Abend ein Dorf der Pa-O. Für die Bewohner war Tommy ein guter Bekannter. Er hatte vor Kurzem eine Rohrleitung von einer zwei Kilometer entfernt liegenden Wasserquelle ins Dorf legen lassen. Nun gab es wenigstens einen Brunnen, und niemand musste mehr kilometerlang laufen, um auch nur einen Eimer frisches Wasser zu bekommen. Er war mit ihrer Sprache und Kultur vertraut und ein häufiger und gern gesehener Gast. Wir wurden von Kindern begrüßt, die mich mit großen Augen anstarrten. Sie begleiteten uns zum Oberhaupt des Dorfes. Sein Haus war aus altem Teakholz und stand auf Pfählen. Darunter grunzte ein Schwein.
Der Mann und seine Familie begrüßten uns herzlich und luden Tommy und mich ein, über Nacht bei ihnen zu bleiben.
Am Abend hockten wir um ein Feuer, die Familie hatte mir zu Ehren ein Huhn geschlachtet und eine Art Curry zubereitet. Selbstverständlich häuften sich auf meinem Teller die kostbaren Fleischstückchen, niemand wollte etwas essen, bevor ich nicht fertig war. Erst wenn der Gast satt ist, fangen in Burma die Gastgeber an zu essen. Die Dorfältesten waren gekommen, Männer und Frauen, und sie beobachteten neugierig jede meiner Bewegungen. Ich hörte das Feuer knistern und das Flüstern und Kichern von Kindern in der Dunkelheit. Ein Baby wimmerte, beruhigte sich aber schnell wieder. Nicht weit entfernt saß eine ältere Frau, umringt von ein paar Kindern, denen sie flüsternd etwas erzählte. Auch wenn ich kein Wort verstand von dem, was sie sagte, so hatte der melodische Singsang ihrer Stimme doch etwas Magisches. Ich fragte Tommy, wer die Frau sei und was sie mache. Eine Großmutter, die ihren Enkeln Märchen erzähle, erklärte er mir. Das war in Burma, so lernte ich auf meinen folgenden Reisen, vor allem unter den ethnischen Minderheiten und in den Dörfern noch eine sehr lebendige Tradition.
Ich begann meine Gastgeber auszufragen und dachte irgendwann, es wäre vielleicht interessant, wenn auch sie mir Fragen stellen würden.
Sie berieten sich, und schließlich wollte einer von ihnen wissen, wie lange ich zu ihnen unterwegs gewesen sei. Mit dem Ochsenkarren.
Ich schätzte, wie lange das wohl von Hongkong dauern würde. Ein Jahr? Zwei?
Über ein Jahr, erwiderte ich.
Großes Staunen. Die Frau des Dorfoberhauptes wollte wissen, wie viele Sonnen es bei mir gäbe.
Ich verstand ihre Frage nicht.
Sie rechnete mir vor, dass ich vermutlich drei Jahre meine Felder nicht beackern konnte. Ein Jahr für die Hinreise zu ihnen. Eines für die Rückreise. Damit sich die lange Fahrt auch lohne, würde ich wahrscheinlich ein Jahr bei ihnen bleiben. So eine lange Abwesenheit könnten sie sich niemals leisten. Ganz gleich, wie fleißig sie arbeiteten. Das ginge nur, wenn meine Felder ganz außergewöhnlich ertragreich seien, und das konnte sie sich nur mit mehreren Sonnen erklären, die länger schienen als die zwölf bis vierzehn Stunden, die ihnen vergönnt waren.
Als es an der Zeit war, schlafen zu gehen, zeigten sie mir mein Bett: eine papierdünne Matte auf den Holzbalken. An meinem entsetzten Gesicht mussten sie erkannt haben, dass ich es nicht gew0hnt war, auf dem Fußboden zu schlafen. Ohne dass ich etwas sagte, trugen sie Decken und Tücher zusammen und bauten mir eine Matratze. Ich musste mehrmals Probe liegen, und erst als ich darin versank, waren sie zufrieden.
Als wir uns am nächsten Morgen verabschiedeten, hatte sich fast das ganze Dorf versammelt, um uns eine gute Weiterreise zu wünschen. Für mich gab es, wie in Burma üblich, ein Abschiedsgeschenk. Man lässt keinen Freund ziehen, ohne ihm eine kleine Gabe mitzugeben.
Das Oberhaupt des Dorfes überreichte mir einen riesigen Sack prall gefüllt mit schwarzem Tee. Ich trinke gerne Tee, aber die Menge hätte vermutlich bis an mein Lebensende gereicht. Ich bedankte mich höflich und erklärte, dass das vielleicht ein wenig zu viel des Guten für mich sei, ob sie nicht unter Umständen ein kleines Säckchen, einen Beutel vielleicht, hätten.
Das Geschenk sei natürlich nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie, war die Antwort.
Aber ich lebe allein, erwiderte ich. Es dauerte eine Weile, bis Tommy es übersetzt und sich der Umstand unter den Dorfbewohnern herumgesprochen hatte.
»Allein?«, fragten sie verwundert.
Ich nickte.
Noch nie in meinem Leben war ich von so vielen Menschen mit so viel Mitleid angeblickt worden wie in jenem Augenblick.
Allein.
In Burma lebt man nicht allein. Ob Junggeselle oder Witwe, die Menschen leben im Kreise ihrer ausgedehnten Familie. Man muss schon ein ziemlich unangenehmer Charakter sein, erklärte mir Tommy auf dem Rückweg, wenn niemand mit einem leben möchte.
Um die Situation zu entspannen, erzählte ich, dass ich verheiratet sei, dass meine Frau aber noch in New York lebe, um dort ihr Studium zu beenden, und ich in Hongkong, dass ich sie aber, wenn irgend möglich, jeden Abend anriefe. Das sprach sich herum, die Menschen tuschelten, nickten und lächelten wieder entspannter.
»Wirklich jeden Abend?«, vergewisserte sich das Oberhaupt des Dorfes mit zweifelnder Stimme.
Ich nickte.
»Dann musst du aber eine laute Stimme haben.«
Fast genau ein Jahr später kehrte ich zurück nach Kalaw. Tommy fragte mich, ob ich Zeit hätte, wieder mit ihm in das Dorf zu wandern. Er sei seit unserem Besuch häufiger dort gewesen und die Menschen würden jedes Mal nach mir fragen und sich mit Sicherheit sehr freuen, mich wiederzusehen.
Er hatte nicht übertrieben. Kaum hatten wir den Ort erreicht, waren wir auch schon umringt von einer kleinen Menschenmenge. Alle wollten den fremden Freund begrüßen. Für die Kinder hatte ich Luftballons und ein wenig Spielzeug mitgebracht.
Wir wurden wieder eingeladen, über Nacht zu bleiben, doch diesmal war die Stimmung anders. Freudig aufgeregt, fast etwas festlich. Nach dem Essen versammelten sich im Haus des Dorfvorstehers viel mehr Menschen als noch vor einem Jahr, wir nahmen in langen, engen Reihen vor einem Schrank auf dem Fußboden Platz. Man wollte mir ganz offensichtlich etwas Besonderes zeigen. Irgendwann stand der Gastgeber auf und öffnete feierlich die Schranktüren. Zum Vorschein kam ein Fernseher. Die Militärjunta hatte, wurde mir gesagt, in den Dörfern batteriebetriebene TV-Geräte verteilt, damit sie ihre Propaganda besser verbreiten konnte. Doch die Menschen waren nicht dumm, sie ignorierten die offiziellen Sendungen. Es gab nur einen Staatssender, und der zeigte einmal in der Woche einen Film aus dem Ausland. Durch eine glückliche Fügung sei ich genau an diesem Wochentag zu ihnen gekommen.
In den folgenden fünfundvierzig Minuten sahen wir auf Englisch und ohne Untertitel eine stumpfsinnige Krimiserie aus Amerika. Sie spielte in Los Angeles, und es passierte nicht viel, außer dass fortwährend dicke Straßenkreuzer ineinander krachten, Helikopter explodierten, Menschen andere Menschen erschossen oder erdolchten. Fassungslos starrten die Dorfbewohner auf den Bildschirm, hin und wieder warf mir jemand einen erschrockenen Blick zu. Ich hatte, zumindest äußerlich, ja doch viel Ähnlichkeit mit den Menschen, die sich da ununterbrochen so viel Böses antaten.
Als der Film zu Ende war, erhob sich der Hausherr, stellte das Gerät aus, klappte die Türen wieder zu, drehte sich um und musterte mich sehr lange. Ich wich seinem Blick aus. Betretenes Schweigen im Raum. Er räusperte sich.
»Wenn du möchtest, Jan-Philipp, kannst du gerne bei uns bleiben. Dort, wo du lebst, scheint es ja sehr gefährlich zu sein.«
Ich bin nicht geblieben, aber seitdem sehr oft nach Burma zurückgekehrt. Zunächst als Journalist – zweimal konnte ich die damalige Oppositionsführerin und heutige Regierungschefin Aung San Suu Kyi in ihrem Haus besuchen –, später als Schriftsteller, um für meine in Burma spielenden Romane Das Herzenhören und Herzenstimmen zu recherchieren. Mit jeder Reise wuchs meine Faszination. Ich sammelte Eindrücke und Geschichten und begann mich für burmesische Märchen, Fabeln und Sagen zu interessieren. Wann immer ich eine Frau sah, die ihren Kindern oder Enkeln Geschichten erzählte, setzte ich mich nach Möglichkeit dazu und ließ sie mir übersetzen. Ich erfuhr, dass auch in ihren Märchen Tiere eine wichtige Rolle spielen, nur sind es hier naturgemäß eher Tiger, Elefanten, Krokodile und Affen.
Auffallend war auch, dass in Burma häufig von der bösen Schwiegermutter die Rede ist. Die teuflische Stiefmutter dagegen hat in burmesischen Märchen keine so große Bedeutung wie bei uns.
Wenn ich Klöster besuchte oder dort übernachtete, fragte ich die Mönche nach buddhistischen Fabeln und Parabeln. Ich hörte viele Geschichten über die Weisheit Buddhas, aber auch darüber, wie schwierig es selbst für Mönche sein kann, diese Lehren im Alltag zu befolgen, wovon unter anderem die Geschichten der beiden Bildhauer erzählt, die sich im Streit totschlagen [[siehe hier]]. Oder die des jungen Mönchs, der in »Der lange Weg zur Weisheit« glaubt, sich zwischen Buddha und seinen Eltern entscheiden zu müssen [[siehe hier]].
Jahre später, als ich durch das Land reiste, um für meinen ersten Roman zu recherchieren, beschloss ich, gezielt burmesische Märchen zu sammeln, um vielleicht einige von ihnen im Roman zu erzählen. Und so verbrachte ich mehrere Abende mit Frauen um ein Lagerfeuer sitzend, die mir, etwas verwundert über das Interesse des Fremden, Märchen, Sagen und Fabeln erzählten. Manche erinnerten mich an Geschichten, wie ich sie aus meiner Kindheit kannte. Das Märchen von Hase und Igel gibt es auch in Burma, nur ist es hier eine langsame Schildkröte, die mit List und Tücke über ein eingebildetes und siegesgewisses Pferd triumphiert.
Es gibt viele Sagen und Legenden, die von der Herkunft der zahlreichen mythischen Figuren, Geister und Götter erzählen.
Zuweilen war ich erschüttert von der Grausamkeit mancher Geschichten, wie in »Die Flut« [[siehe hier]], wo ein ganzes Dorf ein schreckliches Verbrechen begeht und entsetzlich dafür büßen muss. Dann fielen mir »Hänsel und Gretel« ein oder »Der Wolf und die sieben Geißlein«, und ich erinnerte, dass es auch bei den Gebrüdern Grimm alles andere als zimperlich zuging.
Manche Geschichten sind von bestürzender Traurigkeit. So wie das Märchen von »Bruder und Schwester« [[siehe hier]], in dem zwei Geschwister verhungern und noch heute als Vögel einsam durch das Land fliegen auf der Suche nacheinander.
Ich musste an die Märchen von Hans Christian Andersen denken, besonders an das Schicksal vom »Mädchen mit den Schwefelhölzchen«, dessen Armut und Einsamkeit mich als Kind immer wieder aufs Neue zu Tränen gerührt hatte.
Während der Arbeit am Herzenhören entschloss ich mich, die wunderschöne Liebesgeschichte von der Prinzessin, dem Prinzen und dem Krokodil in das Buch aufzunehmen. Sie war mir an einem Lagerfeuer von mehreren Frauen erzählt worden. Die Hauptfigur des Romans, Tin Win, ein Burmese, der in den 1940er-Jahren von seiner Familie nach New York geschickt wurde und dort lange blieb, erzählt in Herzenhören seiner kleinen Tochter Julia burmesische Märchen, und diese Geschichte ist ihr die liebste. Tin Wins Frau, eine Amerikanerin kann mit den Legenden aus der Heimat ihres Mannes überhaupt nichts anfangen. Sie seien bizarr und verworren, ohne jede Moral und für Kinder völlig ungeeignet, behauptet sie. Julia hingegen liebt diese Mythen und die Fabelwelten, die so anders sind als jene Erzählungen, die sie von ihrer Mutter hört. Eine kleine Auswahl aus Tin Wins Fundus findet sich in diesem Band.
Es geht um die großen Themen der Menschheit: Liebe. Glaube. Gier. Vertrauen. Verrat. Vergebung.
Der oder das Gute gewinnt nicht immer. Aus manchen Geschichten spricht ein tiefer Fatalismus, aus anderen wiederum die Hoffnung auf Gerechtigkeit und die magische Kraft der Liebe.
Sie erlauben uns einen Blick in eine fremde, manchmal auch exotische Gedanken- und Glaubenswelt, die uns wenige Seiten später in ihrer Menschlichkeit auch wieder auf wunderbare Weise ganz vertraut ist.
Die Menschen in Burma abergläubisch zu nennen wäre irreführend. Aberglaube klingt nach Hokuspokus, naiver Leichtgläubigkeit oder kindlicher Unvernunft.
Für die meisten Menschen in Burma ist es jedoch eine absolute Selbstverständlichkeit, dass die Sterne Einfluss auf unser Leben haben, dass es Daten und Tage gibt, die Glück bringen, und andere, in denen das Unheil zu Hause ist. Sie würden gar nicht verstehen, wie man daran zweifeln kann. Es gehört so selbstverständlich zu ihrem Alltag und ihrer Sicht auf die Welt, dass es weder einer Erklärung noch der Erwähnung bedarf. Ich habe bei meinen Erkundungen immer mal wieder Menschen gefragt, ob sie abergläubisch seien. Die haben das tief überzeugt verneint, gar weit von sich gewiesen, um mir im nächsten Moment von einem Nat, einem Geist zu berichten, der in einem Baum in ihrem Garten wohnt und jeden Morgen von ihnen Opfergaben bekommt. Oder von ihrem letzten Besuch beim Astrologen.
Während meiner ersten Reise nach Yangon fuhr mich ein junger Mann durch die Stadt in einem kaum verkehrstüchtigen Auto, dessen Lenkrad sich auf der rechten Seite befand, obgleich im Land Rechtsverkehr herrschte, was das Überholen zu einer äußerst schwierigen, um nicht zu sagen lebensgefährlichen Angelegenheit machte. Er erzählte mir, dass der Verkehr vor vielen Jahren, auf Anraten eines Astrologen, über Nacht von links auf rechts umgestellt worden sei. Es klang nicht so, als fände er das sonderlich bemerkenswert.
Am Armaturenbrett seines Wagens klebte das Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau mit einem Säugling im Arm. Ich fragte neugierig, wer das sei. Er lächelte stolz und erklärte, es wären seine Frau und seine kleine Tochter. Sie sei vier Monate alt, aber leider würde er sie viel zu selten sehen, da er gezwungen sei, sehr viel zu arbeiten. Er habe hohe Schulden, die er abzahlen müsse.
Ich war verwundert, dass ein so junger Mann schon Gläubiger hatte, und erkundigte mich, ob er sich für das Auto hatte verschulden müssen.
Nein, erzählte er, für die Geburt seiner Tochter. Ein Astrologe hatte den besten Tag, ja sogar die günstigste Stunde für ihre Geburt errechnet, und um nichts dem Zufall zu überlassen, hatten sie sich für einen Kaiserschnitt entschieden. Und der war sehr, sehr teuer.
Für mich war das der Beginn einer Reise in eine mir gänzlich unvertraute Welt, bevölkert von Geistern und Gespenstern, Dämonen und anderen geheimnisvollen Erscheinungen. Eine Welt voll rätselhafter Rituale und magischer Zahlenkombinationen, in der ein Astrologe, ein Geisterbeschwörer oder ein Medium nicht selten das letzte Wort hat.
Beispiele für den Aberglauben fand ich täglich und oft in völlig unerwarteten Momenten. Einmal war ich mit einem burmesischen Freund auf dem Land unterwegs, und wir quälten uns über eine der notorisch schlechten Straßen voller Schlaglöcher. Plötzlich verwandelte sich diese Straße in eine zweispurige Autobahn mit perfektem Belag, Markierungen und Mittelstreifen. Kurz darauf war der Spuk wieder vorbei, und wir wurden wie gewohnt heftig durchgeschüttelt. Ich fragte verwirrt, warum die Strecke plötzlich in so gutem Zustand gewesen sei. Mein Freund erklärte mir, dass ein Astrologe dem für den Bezirk verantwortlichen Militärkommandanten empfohlen hatte, etwas zu bauen, um die Sterne günstig zu stimmen. Andernfalls bestünde die Gefahr der Degradierung. Es musste ein Objekt sein, das der Allgemeinheit diene, mit Verkehr in Verbindung stehe und auch mit den Zahlen vier und fünf. Darauf befahl der General den Bau dieser vierspurigen Straße mit einer Länge von genau fünfhundert Metern.
Ich wollte wissen, ob es etwas genutzt habe.
Mein Freund zuckte mit den Schultern. Zumindest sei der Kommandant noch im Amt.
Während dieser Fahrt erzählte er mir von diversen politischen Entscheidungen, die auf den Ratschlägen von Astrologen beruhten. Den Tag und die Uhrzeit für die Feier zur Unabhängigkeit hatte zur Konsterniertheit der Briten ein Sternendeuter festgelegt: Sie musste am 4. Januar 1948 um vier Uhr zwanzig in der Früh stattfinden. Viel Glück haben diese Zahlen dem Land, das zu den ärmsten in der Region zählt, bisher allerdings nicht gebracht.
Die schweren politischen Unruhen in den Jahren 1987/88 hatten ebenfalls ein Astrologe und ein ihm höriger General – in diesem Fall Ne Win, der mächtigste Mann im Land – ausgelöst. Damals waren über Nacht die 25-, 35- und 75-Kyat Banknoten für ungültig erklärt und durch 90- und 45-Scheine ersetzt worden. Ein Sternendeuter hatte dem Diktator angeblich Unheil prophezeit, nur seine Glückszahl Neun könne das Schicksal positiv beeinflussen. Die brachte Ne Win dann in größtmöglicher Zahl in Umlauf. Weil er den Leuten nicht gestattete, ihre nun wertlosen Kyat-Scheine in die neuen 90- oder 45-Noten umzutauschen und deshalb viele Menschen ihre Ersparnisse verloren, kam es zu heftigen Protesten, die das Militär blutig niederschlug.