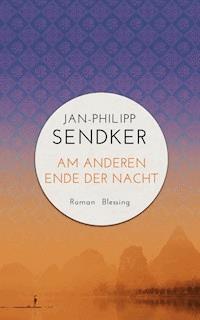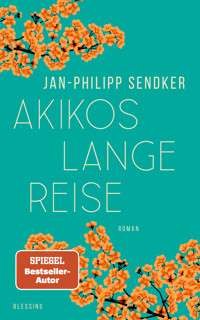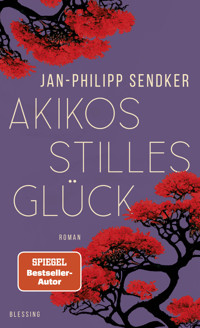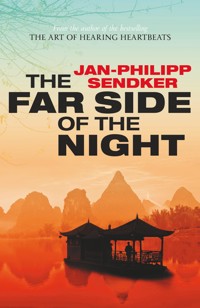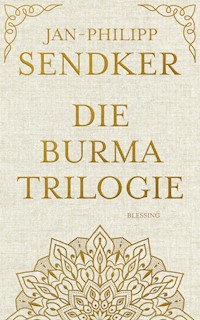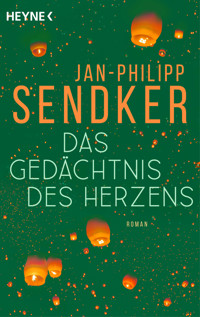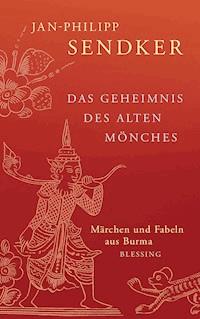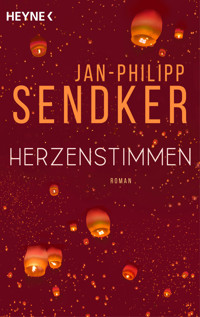
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Burma-Serie
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des Bestsellers
Zehn Jahre ist es her, dass Julia Win aus Burma als anderer Mensch zurückgekehrt ist. Doch mittlerweile hat sie das rastlose westliche Leben und ihre Karriere in einer New Yorker Anwaltskanzlei wieder eingeholt. Da erreicht sie ein rätselhafter Brief ihres Halbbruders U Ba, und eine fremde, innere Stimme beginnt zu ihr zu sprechen. Bald erkennt sie, dass sie noch einmal zurück muss nach Burma, um dem Geheimnis dieser Stimme auf den Grund zu gehen und die Quelle ihres persönlichen Glücks wiederzuentdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jan-Philipp Sendker
Herzenstimmen
Roman
Blessing Verlag
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: t.mutzenbach design
unter Verwendung eines Motivs
von © Shutterstock.com (Krunja_Lichter)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-07988-8V005
www.blessing-verlag.de
Für
Anna, Florentine, Theresa und Jonathan
Erster Teil
1
Der Tag, an dem meine Welt aus den Fugen geriet, begann unter einem tiefblauen, wolkenlosen Himmel. Es war ein klirrend kalter Freitag in der Woche vor Thanksgiving. Ich habe mich seitdem oft gefragt, ob ich es hätte kommen sehen können. Weshalb hatte ich nichts bemerkt? Wie konnte sich ein so folgenschweres Ereignis in meinem Leben anbahnen, ohne dass ich auch nur eine Ahnung davon gehabt hatte? Ausgerechnet ich, die Überraschungen so verabscheute. Die sich auf alles, jede Verhandlung, jede Reise, selbst einen Ausflug am Wochenende oder ein gemeinsames Kochen mit Bekannten so gewissenhaft wie möglich vorbereitete. Ich überließ nichts gern dem Zufall. Ich ertrug das Unerwartete nur schwer. Es zählte nicht zu meinen Freunden.
Amy war sich sicher, es habe erste Symptome gegeben. Es gebe sie immer. Wir seien nur so sehr in unseren Alltag vertieft, Gefangene unserer Routinen, dass wir den Blick für sie verloren haben.
Für die kleinen Geschichten, die uns Großes erzählen.
Sie war überzeugt, dass jeder Mensch sich selbst das größte Rätsel ist und unsere lebenslange Aufgabe darin besteht, der Lösung dieses Rätsels näher zu kommen. Lösen, behauptete sie, würden wir es nie. Aber auf den Weg dorthin müssten wir uns machen. Ganz gleich, wie lang er ist oder wohin er uns führt.
Ich war mir nicht sicher. Amy und ich waren oft unterschiedlicher Meinung. Das sollte nicht heißen, dass ich ihr in diesem Fall nicht bis zu einem gewissen Grad recht gab. Vermutlich hatte es in den Monaten zuvor immer wieder Momente gegeben, die mich hätten warnen können. Aber wie viel Zeit können wir tagein und tagaus damit verbringen, in uns hineinzuhorchen, um mögliche Signale und Zeichen für irgendetwas zu entschlüsseln?
Ich gehörte nicht zu den Menschen, die jede körperliche Veränderung sofort als Anzeichen einer Störung ihres seelischen Gleichgewichts deuteten.
Die kleinen, roten Pickel am Hals, die sich innerhalb weniger Tage in einen schmerzhaft brennenden Hautausschlag verwandelten, für den kein Arzt eine Erklärung fand, und die nach einigen Wochen so plötzlich wieder verschwanden, wie sie gekommen waren, konnten viele Ursachen haben. Das gelegentliche Rauschen in den Ohren ebenfalls. Meine Schlaflosigkeit. Meine zunehmende Gereiztheit und die Ungeduld, die sich in den allermeisten Fällen gegen mich selber richtete. Beides war mir nicht unbekannt, und ich führte das auf die Belastungen im Büro zurück. Der Preis, den jeder von uns in der Kanzlei zahlte und auch zu zahlen bereit war. Ich beklagte mich nicht.
Der Brief lag in der Mitte meines Schreibtisches. Es war ein leicht zerknitterter, hellblauer Luftpostumschlag, wie ihn heute kaum noch jemand benutzt. Ich erkannte seine Handschrift sofort. Niemand schrieb mit solcher Hingabe. Nur er nahm sich die Zeit, aus Briefen kleine Kunstwerke zu machen. Die geschwungenen Linien hatte er mit schwarzer Tinte so fein säuberlich gezogen, als handle es sich um eine Kalligrafie. Jeder Buchstabe ein Geschenk. Zwei Seiten eng beschrieben, jeder Satz, jede Zeile mit einer Sorgfalt und Leidenschaft aufs Papier gebracht, wie es nur Menschen vermögen, für die das Schreiben eine Gabe ist, die man nicht hoch genug achten kann.
Auf dem Kuvert klebte eine amerikanische Briefmarke. Er musste es einem Touristen mitgegeben haben, das war der schnellste und sicherste Weg. Ich schaute auf die Uhr. In zwei Minuten sollte die nächste Konferenz beginnen, nicht genug Zeit, um den ganzen Brief zu lesen, aber meine Neugier war zu groß. Ich öffnete den Umschlag und überflog in aller Eile die ersten Zeilen.
Kalaw, der neunte November, im Jahre zweitausendundsechs
»Meine liebe kleine Schwester,
ich hoffe, … erreicht Dich … guter Gesundheit. Bitte … Schweigen, das letzte Mal … ein paar Zeilen …?
Eine Ewigkeit … erkrankt … bald sterben … ein Kommen und Gehen … das Leben … wie schnell sich Deine Welt dreht.
Gestern … etwas Sonderbares … Eine Frau … tot zusammengebrochen. … um Vergebung gebeten. Tränen … groß wie Erdnüsse …«
Ein kräftiges Klopfen holte mich zurück. Mulligan stand in der Tür. Sein wuchtiger, durchtrainierter Körper füllte fast den ganzen Rahmen aus. Ich wollte ihn um einen Augenblick Geduld bitten. Ein Brief meines Bruders aus Burma. Ein kleines Kunstwerk, das … Er lächelte, und bevor ich ein Wort sagen konnte, tippte er mit dem Finger auf seine große Armbanduhr. Ich nickte. Mulligan war einer der Partner von Simon & Koons, unser bester Anwalt, aber von Tränen, groß wie Erdnüsse, verstand er nichts. Von Buchstaben als Geschenk auch nicht. Seine Handschrift war unleserlich.
Die anderen Kollegen warteten bereits. Es roch nach frischem Kaffee, Marc steckte sich den letzten Bissen eines Muffins in den Mund und grinste mir zu. Wir hatten eine Wette laufen, ob es ihm gelingen würde, bis Weihnachten fünf Kilo abzunehmen. Es wurde ruhiger, als wir uns setzten. In der kommenden Woche würden wir eine Klageschrift für unseren wichtigsten Mandanten einreichen müssen. Eine komplizierte Geschichte. Copyright-Verletzungen, Raubkopien aus Amerika und China, mutmaßliche Wirtschaftsspionage. Internationales Wirtschaftsrecht. Schadenssumme mindestens hundert Millionen Dollar. Die Zeit war knapp.
Mulligan versenkte nach und nach vier Zuckerwürfel in seinem Kaffee, rührte in Ruhe um und wartete, bis es völlig still geworden war. Er sprach leise, und doch drang seine tiefe Stimme bis in den letzten Winkel des Raums. Mir aber fiel es schon nach wenigen Sätzen schwer, ihm zu folgen. Ich versuchte, mich auf seine Worte zu konzentrieren, doch irgendetwas zog mich weg. Fort aus diesem Raum. Fort aus dieser Welt von Verdächtigungen, Beschuldigungen, Vorwürfen und Gegenvorwürfen.
Ich dachte an meinen Bruder in Burma. Er war mir plötzlich so gegenwärtig, als hätte er mir nicht einen Brief geschrieben, sondern wäre persönlich gekommen. Ich dachte an unsere erste Begegnung in dem heruntergekommenen Teehaus in Kalaw. Wie er mich angestarrt hatte, plötzlich aufgestanden und auf mich zugekommen war. In seinem vergilbten weißen Oberhemd, seinem verwaschenen Longy, den ausgeleierten Gummisandalen. Mein Halbbruder, von dem ich nichts gewusst, nicht einmal etwas geahnt hatte. Für einen verarmten Alten hatte ich ihn gehalten, der mich anbetteln wollte. Ich erinnerte mich, wie er sich zu mir setzte, um mir eine Frage zu stellen. »Glauben Sie an die Liebe, Julia?« Noch heute habe ich den Klang seiner Worte im Ohr. Als wäre die Zeit für diese Frage stehen geblieben. Ich hatte laut lachen müssen – und er hatte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Während Mulligan etwas vom »Wert des geistigen Eigentums« erzählte, fielen mir seine ersten Sätze wieder ein. Wort für Wort. »Ich meine es ernst«, war U Ba nach meinem Lachen unbeirrt fortgefahren. »Ich spreche von der Liebe, die Blinde zu Sehenden macht. Von der Liebe, die stärker ist als die Angst. Ich spreche von der Liebe, die dem Leben einen Sinn einhaucht …«
Nein, hatte ich ihm irgendwann geantwortet. Nein, daran glaubte ich nicht.
In den folgenden Tagen war ich von ihm eines Besseren belehrt worden. Und jetzt? Fast zehn Jahre später? Glaubte ich noch an eine Kraft, die Blinde zu Sehenden macht? Würde ich in diesem Kreis jemanden überzeugen können, dass der Mensch über Eigensucht triumphieren kann? Sie würden mich auslachen.
Mulligan sprach vom »wichtigsten Fall des Jahres … deshalb müssen wir …« Ich bemühte mich noch einmal mit aller Kraft um Konzentration, doch meine Gedanken drifteten fort, willenlos wie ein Stück Holz, mit dem die Wellen spielen.
»Julia.« Mulligan zerrte mich zurück nach Manhattan. »Du bist dran.«
Ich nickte ihm zu, warf einen hilflosen Blick auf meine Notizen, wollte mit ein paar Standardsätzen beginnen, als mich ein zaghaftes Flüstern unterbrach.
Ich stockte.
Wer bist du?
Hingehaucht und doch nicht zu überhören.
Wer bist du?
Eine Frauenstimme. Immer noch leise, aber klar und deutlich.
Ich schaute über meine rechte Schulter, um zu sehen, wer mich mit so einer Frage ausgerechnet in diesem Moment unterbrach. Niemand.
Wo mochte sie sonst herkommen?
Wer bist du?
Ich drehte mich unwillkürlich nach links. Nichts. Ein Flüstern aus dem Nirgendwo.
Was wollen die Männer von dir?
Gespannte Stille um mich herum. Ich atmete tief ein und wieder aus. Mir wurde warm. Ich schwieg beklommen und hielt die Augen gesenkt. Jemand räusperte sich.
Nimm dich in Acht vor ihnen.
»Julia?«
Kein Wort. Nicht eins. Atemnot. Woher kam diese Stimme? Wer sprach zu mir? Was wollte sie? Warum sollte ich mich vor meinen Kollegen hüten?
»Du kannst beginnen. Wir sind ganz Ohr.« Mulligans wachsende Ungeduld. Erstes Hüsteln.
Du musst ganz vorsichtig sein. Pass auf, was du sagst. Pass auf, wen du anschaust.
Ich hob den Kopf und ließ meinen Blick vorsichtig kreisen. Das unruhige Wippen mancher Oberkörper. Marcs besorgte Miene, er litt mit mir. Vermutete ich. Über Franks breites Gesicht flog ein spöttisches Lächeln. Als hätte er immer geahnt, dass der Tag käme, an dem ich den Druck nicht mehr aushalten und kläglich scheitern würde.
Du darfst ihnen nicht trauen, egal was sie sagen.
Die Stimme schnürte mir die Kehle zu. Ich war wie gelähmt. Vor meinen Augen begannen die Gesichter zu verschwimmen. Handschweiß. Ich spürte, wie mein Herz schneller zu schlagen begann.
»Julia. Ist dir nicht gut?«
Keiner wird dir helfen.
»Entschuldigung«, sagte ich.
Sofort herrschte wieder Ruhe. Es hatte lauter geklungen als nötig. Mehr ein Schrei als eine höfliche Bitte um Aufmerksamkeit. Ihre Blicke. Die folgende Stille. Mir schwindelte. Ich war dabei zu versagen.
»Möchtest du etwas trinken?«
Es klang besorgt. Oder täuschte ich mich? Musste ich mich in Acht nehmen?
Sag nichts. Schweig.
Vor mir tat sich ein dunkler Abgrund auf, der mit jeder Sekunde wuchs. Ich wollte mich verstecken, mich irgendwo verkriechen. Was war nur in mich gefahren? Ich hörte eine Stimme, laut und unmissverständlich. Eine Stimme, über die ich keine Kontrolle besaß. Eine Fremde. In mir. Ich fühlte mich immer kleiner werden. Kleiner und bedürftiger. Kein Wort würde ich von mir geben können, solange nicht Ruhe in meinen Kopf einkehrte. Ich griff mir an die Ohren und drückte einige Male kurz und kräftig, wie ich es tat, wenn das gelegentliche Rauschen zu laut wurde. Ich versuchte es noch einmal mit tiefem Ein- und Ausatmen und wusste sofort, dass es nichts nützen würde.
Sie meinen es nicht gut mit dir. Ihr Lächeln war nicht echt. Sie sind gefährlich.
Schreien. Sie mit meiner wahren Stimme übertönen. LASS MICH IN RUHE. SEI ENDLICH STILL. STILL. STILL.
Kein Wort. Nicht eins.
Mulligans und mein Blick trafen sich. Seine Stirn lag in Falten, die Lippen waren ein schmaler Strich, seine hellblauen Augen fokussierten mich. Ich begriff, dass mir in diesem Raum wirklich niemand helfen konnte. Ich musste raus. Sofort. Ich wollte auf die Toilette, in mein Büro, nach Hause, egal wohin, Hauptsache weg. Sie erwarteten einen Vortrag, sie erwarteten Ideen und Vorschläge, und wenn ich dazu nicht in der Lage war, erwarteten sie zumindest eine Erklärung für mein Verhalten. Eine Entschuldigung. Nichts davon konnte ich ihnen geben. Mir fehlte die Kraft. Ich hatte nichts zu sagen. Ein kurzes Zögern, dann richtete ich mich langsam auf, schob meinen Stuhl nach hinten und erhob mich. Meine Beine zitterten.
Was tust du?
»Julia, um Himmels willen, was ist mit dir los?«
Ich nahm meine Unterlagen, wandte mich ab und ging zur Tür. Mulligan rief etwas, aber ich verstand nicht mehr, was er sagte.
Ich öffnete die Tür, trat hinaus und schloss sie leise wieder.
Und jetzt?
Ich ging an den Toiletten vorbei den Gang zu meinem Büro entlang, legte die Akten auf den Tisch, nahm meinen Mantel, steckte U Bas Brief in meine Handtasche und verließ, ohne Hast und ohne ein weiteres Wort, die Kanzlei.
Ich ahnte noch nicht, dass ich mich, ohne mir dessen bewusst zu sein, auf den Weg gemacht hatte.
An diesem klirrend kalten, wolkenlosen Herbsttag in der Woche vor Thanksgiving.
2
Sie erinnerte sich nicht mehr an jede Einzelheit. Ein Ziehen im Bauch, ein leichtes zunächst. Eines, dem man keine Beachtung schenken musste. Sie saß am Fenster und schaute hinaus. Ein wolkenloser Morgen. Unter ihnen lag Hartford.
Das Ziehen nahm zu. Ein unangenehmer Schmerz, aber vermutlich ganz normal für die ersten Wochen. Glaubte sie. Wollte sie glauben.
Niemand hatte sie gewarnt. Niemand hatte ihr gesagt, was auf dem Spiel stand. Oder doch? Sich schonen, Stress und Aufregung vermeiden. Keinen Alkohol. Was Ärzte so sagen, hatte sie gedacht. Möglichst nicht fliegen. Möglichst. Nicht: auf keinen Fall.
New York–Boston. Flugzeit nicht einmal eine Stunde. Was sollte da passieren?
Natürlich hätte sie den Zug nehmen können. Fünf Stunden. Kurz hatte sie daran gedacht. Der Termin war um 10 Uhr und nicht zu verlegen. Sie hätte am Abend zuvor fahren müssen. Umständlich und zeitaufwendig.
Möglichst. Nicht: auf keinen Fall. Wir hören nur, was wir hören wollen.
Retroamniales Hämatom. Sie konnte sich darunter nichts vorstellen. Ein Bluterguss hinter der Gebärmutter. Es klang in ihren Ohren nicht besorgniserregend, auch wenn das Gesicht des Arztes eine andere Geschichte erzählte. Von der wollte sie nichts wissen. Ein Bluterguss war ein Bluterguss und nichts Bedrohliches, dachte sie, egal wo er lag.
Wann beginnt Leben? Mit dem Akt der Befruchtung? Bei der Geburt? Irgendwann dazwischen. Aber wann?
Hatte sie getötet? Oder den Tod zumindest in Kauf genommen? Billigend? Leichtfertig? Oder war es eine Willkür der Natur gewesen? Schicksal. Wer hatte darauf eine Antwort? Wer wollte sich anmaßen, hier der Richter zu sein?
Neun Wochen alt. Groß wie ein Streichholz. Natürlich nicht lebensfähig. Noch lange nicht. Und trotzdem.
Sie fühlte in den Ohren, dass etwas nicht stimmte. Ein leichtes Problem mit dem Kabinendruck. Nichts, worüber sie sich Sorgen machen müssten, sagte der Pilot und entschuldigte sich für mögliche Unannehmlichkeiten. Sie verließen die Reiseflughöhe, und nach wenigen Minuten war es wieder vorbei. Nur die Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen blieb. Als hätte sie sich ein kleines Glas warmes Wasser über den Schoß geschüttet. Und noch eins.
Nach der Landung hielt sie sich den Bauch. Sie war die Letzte, die das Flugzeug verließ, ihr erster Weg führte auf die Toilette. Dort endete es.
Ein Versprechen, streichholzgroß.
Kein Leben, aber eine Hoffnung darauf.
3
Kalaw, der neunte November, im Jahre zweitausendundsechs
Meine liebe kleine Schwester,ich hoffe, dieser Brief erreicht Dich wohlauf und bei guter Gesundheit. Bitte verzeih mein langes Schweigen, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich das letzte Mal die Zeit gefunden habe, Dir ein paar Zeilen zu schreiben. War es in der Hitze des Sommers gewesen oder noch vor dem Wechsel des Monsuns?
Eine Ewigkeit scheint seither vergangen, ohne dass allzu viel passiert wäre in meinem Leben oder in Kalaw. Die Frau des Astrologen ist erkrankt und wird bald sterben, die Tochter des Besitzers jenes Teehauses, in dem wir uns zum ersten Mal trafen, hat einen Sohn bekommen. Es ist ein Kommen und Gehen, wie überall auf der Welt, nicht wahr? Aber das Leben hier hat einen anderen Rhythmus als bei Dir, erinnerst Du Dich noch? Was mich betrifft, so muss ich zugeben, dass es mir an der Phantasie fehlt, mir vorzustellen, wie schnell sich Deine Welt dreht.
Mir selbst geht es gut. Ich restauriere noch immer meine alten Bücher, auch wenn es mit der Zeit immer beschwerlicher und mühsamer wird. Die Augen, liebe Schwester, die Augen werden von Tag zu Tag schlechter, ich erreiche allmählich das Alter des abnehmenden Lichts. Außerdem nimmt die unangenehme Angewohnheit meiner rechten Hand, ein wenig zu zittern, weiter zu, was es nicht leichter macht, die kleinen Papierschnipsel auf die Löcher zu kleben, die das gefräßige Ungeziefer unerbittlich in die Seiten bohrt. Früher habe ich ein Vierteljahr benötigt, um eines meiner Bücher wieder in einen lesbaren Zustand zu verwandeln, jetzt ist es ein halbes und bei dicken Büchern sogar mehr. Doch was macht es für einen Unterschied, frage ich mich manchmal, wenn ich mich selbst zur Eile mahne? Wenn ich von etwas genug besitze, dann ist es Zeit. Ihre Kostbarkeit wissen wir erst im Alter wirklich zu schätzen, und ich bin ein reicher Mann. Aber was belästige ich Dich überhaupt mit den Zipperlein eines alten Mannes. Wenn ich meinen Stift nicht zügele, machst Du Dir noch Sorgen um Deinen Bruder, und nichts wäre unbegründeter. Mir fehlt es an nichts.
Bei Dir müsste der Herbst angebrochen sein, habe ich recht? In einem meiner Bücher habe ich einmal gelesen, der Herbst sei die schönste Jahreszeit in New York. Stimmt das? Ach, wie wenig ich doch weiß von Deinem Leben.
Bei uns neigt sich die Regenzeit dem Ende zu, die Luft ist wieder trocken und klar, es wird kühler, und es wird auch nicht mehr lange dauern, dann liegt der erste Raureif auf den Gräsern in meinem Garten. Oh, wie sehr ich den Anblick des zarten Weiß auf den tiefgrünen Blättern schätze.
Gestern hat sich hier etwas Sonderbares zugetragen. Eine Frau ist unter dem Banyanbaum an der großen Kreuzung tot zusammengebrochen. Zuvor, so wurde mir von meiner Nachbarin, die Zeugin des Vorfalls war, berichtet, hatte sie Wehklagen ausgestoßen. Sie war auf dem Weg zum Markt gewesen, hatte sich, wegen eines unvermittelten Schwächeanfalls, auf ihre sie begleitende Schwester gestützt und immer wieder laut um Vergebung gebeten. Dabei waren ihr gewaltige Tränen über die Wangen gelaufen, groß wie Erdnüsse sollen sie gewesen sein, was ich nur schwer zu glauben vermag, Du weißt ja, dass die Menschen bei uns nicht selten zu Übertreibungen neigen. Plötzlich hatte sie sich von ihrer Schwester abgewandt, um einem jungen, ihr unbekannten Mann zu folgen, und fortwährend einen Namen gerufen, den niemand im Ort zuvor gehört hatte. Als der junge Mann sich, erstaunt über den Lärm hinter seinem Rücken, umdrehte, trafen sich ihre Blicke, die Frau erstarrte und sank tot zu Boden. Als hätte sie ein Blitz erschlagen an diesem klaren, wolkenlosen Tag. Niemand fand eine Erklärung dafür. Ihre Schwester, mit der sie seit Jahren am Rande unseres Ortes zurückgezogen lebte, ist untröstlich. Freunde hatten die beiden offenbar wenige, und auch die Nachbarn wissen von nichts, sehr ungewöhnlich, möchte ich meinen, die wissen sonst immer alles. Der Vorfall beherrscht seither die Gespräche in unserer kleinen Stadt, in den Teehäusern und auf dem Markt. Manche Menschen behaupten, der junge Mann besitze magische Kräfte und habe die Frau mit seinen Blicken getötet. Der arme Kerl bestreitet dies natürlich und beteuert seine Unschuld. Nun ist er erst einmal zu seiner Tante nach Taunggyi geflüchtet.
Und Du, meine liebe Schwester? Sind die Hochzeitspläne, die Du in Deinem letzten Brief so zaghaft angedeutet hast, von Dir und Herrn Michael weiter gediehen, oder komme ich mit meiner Frage womöglich zu spät und Ihr habt bereits geheiratet? In dem Fall bleibt mir nur, Euch von Herzen alles Gute zu wünschen. Ich habe die wenigen Jahre, die mir mit meiner Frau vergönnt gewesen waren, immer als großes, ja vielleicht größtes Glück empfunden.
Nun ist mein Brief viel länger geworden, als es meine Absicht war, die Geschwätzigkeit des Alters, fürchte ich und hoffe, dass ich nicht allzu viel Deiner Zeit in Anspruch genommen habe. Ich werde schließen, die Dämmerung ist angebrochen, und um die Elektrizität war es in Kalaw in den vergangenen Wochen nicht gut bestellt. Meine Glühbirne unter der Decke flackert so heftig, als wolle sie mir geheime Signale senden. Ich vermute jedoch, sie kündigt nur einen weiteren Stromausfall an.
Julia, meine Liebe, mögen die Sterne, möge das Leben, möge das Schicksal Dir wohlgesinnt sein. Ich denke an Dich, ich trage Dich in meinem Herzen, pass auf Dich auf.
In tiefer Verbundenheit
Dein
U Ba
Ich legte den Brief zur Seite. Die Angst vor einer Rückkehr der Stimme hatte nachgelassen, stattdessen überkam mich das Gefühl einer großen Vertrautheit, verbunden mit Sehnsucht und einer tiefen Melancholie. Wie gern hätte ich meinem Bruder jetzt gegenübergesessen. Ich erinnerte mich an seine altmodische Art sich auszudrücken, seine Angewohnheit, sich ohne Grund ständig für irgendetwas zu entschuldigen. Seine Höflichkeit und Bescheidenheit, die mich so gerührt hatten. Vor meinen Augen tauchte seine kleine, auf Stelzen stehende Hütte aus schwarzem Teak auf, das grunzende, im Dreck wühlende Schwein, die Hühner im Hof, der abgewetzte Ledersessel, auf dessen Sitzkissen sich die Sprungfedern abzeichneten, ein Sofa mit verschlissenem Bezug, auf dem ich mehrere Nächte verbracht hatte. Mittendrin ein Bienenschwarm, der sich bei ihm eingenistet hatte und dessen Honig er nicht anrührte, weil er nichts benutzen wollte, was ihm nicht gehörte.
Ich sah ihn vor mir sitzen, zwischen zwei Petroleumlampen tief über seinen Tisch gebeugt, umgeben von Büchern. Sie standen in Regalen, die vom Boden bis zur Decke reichten. Sie lagen in Stapeln auf den Holzbohlen und türmten sich auf einem zweiten Sofa. Ihre Seiten sahen aus wie Lochkarten. Auf dem Tisch lagen verschiedene Pinzetten, Scheren, dazwischen zwei kleine Gefäße, eins mit weißem, zähem Klebstoff, das andere voller winziger Papierschnipsel. Stundenlang hatte ich zugeschaut, wie er mit einer der Pinzetten einen Schnipsel nahm, ihn in die Klebe tunkte, auf eines der Löcher legte, um dann, sobald er festklebte, den fehlenden Buchstaben mit einem Stift nachzuziehen. So hatte er über die Jahre Dutzende von Büchern restauriert.
Das Leben meines Bruders, das so gar nichts mit dem meinen zu tun und mich doch so tief berührt hatte.
Mein Blick fiel auf das Regal, in dem die Erinnerungsstücke meiner Burmareise standen, halb verdeckt von Büchern und Zeitschriften. Ein holzgeschnitzter Buddha, das Geschenk meines Bruders. Eine kleine, verstaubte Lackdose, verziert mit Elefanten und Äffchen. Ein Foto von U Ba und mir, das wir kurz vor meiner Abreise in Kalaw gemacht hatten. Ich überragte ihn um mehr als einen Kopf. Er trug einen neuen, grün-schwarzen Longy, ein weißes Hemd, das er selbst am Abend zuvor noch gewaschen hatte, damit es auch ja sauber war, um den Kopf hatte er sich ein rosafarbenes Tuch gewickelt, wie es bei älteren Shan früher üblich gewesen war. Ernst und feierlich blickte er in die Kamera.
Mich selbst erkannte ich kaum wieder. Beglückt von den aufregendsten Tagen meines Lebens, beseelt von der schönsten Liebesgeschichte, die ich je hören würde, der Geschichte meines Vaters, strahlte ich entspannt, fast ein wenig entrückt, in Richtung Fotograf. Als ich Freunden das Bild zeigte, wollten sie nicht glauben, dass ich das war. Als Michael es zum ersten Mal sah, fragte er, ob ich dort völlig bekifft in Indien neben meinem Guru stünde. Später hatte er sich über meinen Gesichtsausdruck oft lustig gemacht und behauptet, ich hätte vor der Aufnahme zu tief an einer burmesischen Opiumpfeife gezogen.
Zehn Jahre waren seither vergangen. Zehn Jahre, in denen ich mir immer wieder fest vorgenommen hatte zurückzukehren, das Grab meines Vaters zu besuchen, Zeit mit U Ba zu verbringen. Ich hatte die Reise von einem Jahr auf das andere verschoben. Zweimal hatte ich Flüge reserviert und im letzten Moment wieder storniert, weil etwas Wichtigeres dazwischengekommen war. Etwas so Wichtiges, dass ich heute nicht einmal mehr sagen konnte was es gewesen war. Irgendwann hatte der Alltag die Intensität der Erinnerungen verblassen lassen, der Wunsch verlor seine Dringlichkeit und wurde zu einem vagen Vorhaben in einer unbestimmten Zukunft.
Ich wusste nicht mehr, wann ich U Ba das letzte Mal ein paar Zeilen geschickt hatte. Er bat um Verzeihung für sein langes Schweigen. Ich war es, die ihm eine Antwort auf seinen letzten Brief schuldig geblieben war. Vermutlich auch auf den vorletzten, ich erinnerte mich nicht. In den ersten Jahren nach meiner Rückkehr hatten wir uns regelmäßig geschrieben, mit der Zeit nahm die Häufigkeit unserer Korrespondenz jedoch ab. Er hatte mir alle zwei Jahre eines seiner restaurierten Bücher geschickt, von denen ich jedoch, ich musste es mir eingestehen, keines je ganz gelesen hatte. Sie waren, trotz seiner Bemühungen, von den Jahren gezeichnet, vergilbt, verstaubt, verschmutzt. Wenn ich sie in die Hand nahm, wusch ich mir anschließend die Finger. Er hatte sie mit liebevollen Widmungen versehen, und jedes von ihnen lag zunächst neben meinem Bett, bald darauf im Wohnzimmer, bis es schließlich in irgendeiner Kiste verschwand.
Ich hatte ihm einige Male durch einen Kontakt in der amerikanischen Botschaft in Rangun Geld zukommen lassen, insgesamt mögen es an die zehntausend Dollar gewesen sein. In seinem nächsten Brief bestätigte er den Erhalt jeweils eher beiläufig, ohne sich in vielen Worten zu bedanken oder zu erklären, was er mit dem, für burmesische Verhältnisse, vielen Geld machte, was mich vermuten ließ, dass ihm meine Geldgeschenke eher unangenehm waren. Irgendwann ließ ich es sein, und er kam auch nie wieder darauf zu sprechen. Ich hatte ihn mehrmals eingeladen, mich in New York zu besuchen, und erklärt, mich um alle Formalitäten zu kümmern und selbstverständlich alle Kosten zu übernehmen. Am Anfang hatte er mich vertröstet und dann ein ums andere Mal aus Gründen, die ich nicht verstand, höflich, aber sehr bestimmt abgelehnt.
Ich fragte mich, warum ich es in all den Jahren nicht geschafft hatte, ihn wiederzusehen, obgleich ich bei meiner Abreise uns beiden versprochen hatte, in wenigen Monaten zurückzukehren. Wie hatte er, dem ich so viel verdankte, wieder aus meinem Leben entschwinden können? Warum schieben wir das uns wirklich Wichtige so oft auf? Ich hatte darauf keine Antwort. In den kommenden Tagen würde ich ihm ausführlich schreiben.
Die Erinnerungen an Burma hatten mich abgelenkt und beruhigt. Ich hatte Mulligan noch aus dem Taxi eine E-Mail geschrieben, mich mit akuten Kreislaufproblemen entschuldigt und versprochen, ihm alles Weitere am Montag zu erklären. Ich überlegte, ob ich den Nachmittag nutzen sollte, um meine Wohnung aufzuräumen. Sie sah schlimm aus. Die Putzfrau war seit zwei Wochen krank, und in den Ecken hatte sich der Staub gesammelt. Im Schlafzimmer standen noch immer mehrere unausgepackte Kartons, an den Wänden lehnten Bilder, die darauf warteten, aufgehängt zu werden, obwohl schon vier Monate vergangen waren, seit Michael und ich uns getrennt hatten und ich zurück in mein altes Apartment gezogen war. Meine Freundin Amy behauptete, der Zustand meiner Wohnung spiegele meine Weigerung, die Trennung von Michael zu akzeptieren. Das war Unsinn. Wenn die Unordnung etwas verriet, dann die Enttäuschung darüber, dass ich mit achtunddreißig Jahren wieder in derselben Wohnung lebte wie mit achtundzwanzig. Es fühlte sich wie ein Rückschritt an. Ich war vor vier Jahren ausgezogen, weil ich nicht mehr allein, sondern mit Michael leben wollte. Die Wohnung erinnerte mich jeden Tag aufs Neue daran, dass dieser Versuch gescheitert war.
Warum bist du allein?
Dieselbe Stimme. Kein Flüstern mehr, aber immer noch leise. Sie ging mir durch den ganzen Körper, ließ mich erschauern.
Warum bist du allein?
Sie klang näher, dringender als im Büro. Als wäre jemand an mich herangerückt.
Warum antwortest du mir nicht?
Mir wurde heiß. Wieder begann mein Herz schneller zu schlagen. Handschweiß. Die Symptome von heute Morgen. Ich konnte nicht still sitzen, stand auf und ging in meinem kleinen Wohnzimmer auf und ab.
Warum bist du allein?
– Wer sagt, dass ich allein bin?
Würde sie Ruhe geben, wenn ich ihr antwortete?
Wo sind denn die anderen?
– Welche anderen?
Dein Mann.
– Ich bin nicht verheiratet.
Hast du keine Kinder?
– Nein.
Oh.
– Was heißt oh?
Nichts. Es ist nur … keine Kinder … das ist traurig.
– Nein. Ist es überhaupt nicht.
Wo ist dein Vater?
– Der ist tot.
Und deine Mutter?
– Die lebt in San Francisco.
Hast du keine Geschwister?
– Doch, einen Bruder.
Warum ist der nicht hier?
– Er lebt auch in San Francisco.
Bist du hier bei deinen Onkeln und Tanten geblieben?
– Ich habe keine Onkel und Tanten.
Keine Onkel und Tanten?
– Nein.
Warum lebst du dann nicht bei deiner Familie?
– Weil es nicht schlecht ist, wenn ein Kontinent zwischen uns liegt.
Also bist du doch allein.
– Nein. Ich bin nicht allein. Ich lebe nur allein.
Warum?
– Warum? Warum? Weil ich es so schöner finde.
Warum?
– Du gehst mir auf die Nerven mit deinem Warum.
Warum lebst du allein?
– Weil ich es hasse, in der Nacht vom Schnarchen eines Mannes geweckt zu werden. Weil ich am Morgen lieber in Ruhe meine Zeitung lese. Weil ich Barthaare im Waschbecken nicht mag. Weil ich mich nicht rechtfertigen möchte, wenn ich um Mitternacht aus dem Büro komme. Weil ich es liebe, niemandem etwas erklären zu müssen. Kannst du das verstehen?
Schweigen.
– Hallo? Kannst du das verstehen?
Stille.
– Hallo? Warum sagst du nichts mehr?
Ich blieb stehen und wartete. Das sonore Brummen des Kühlschranks, Stimmen auf dem Flur, eine zufallende Tür.
– Wo bist du?
Das Telefon klingelte. Amy. Sie merkte an meinem Ton, dass etwas nicht stimmte.
»Geht es dir nicht gut?«
»Doch.«
Warum sagst du schon wieder die Unwahrheit?
Als hätte mich jemand von hinten mit Wucht gestoßen. Ich stolperte und hätte fast das Gleichgewicht verloren.
»Es, es ist nur …«, stammelte ich verwirrt.
»Julia, was ist los mit dir?«, fragte sie erschrocken. »Wollen wir uns sehen? Soll ich zu dir kommen?«
Ich wollte raus aus meiner Wohnung.
»Ich … ich komm lieber zu dir. Wann hast du Zeit?«
»Wann du willst.«
»Ich bin in einer Stunde bei dir.«
4
Amy Lee lebte in zwei kleinen Studios in der Lower East Side. Sie lagen nebeneinander im obersten Stock eines dreistöckigen Hauses. Ein Apartment nutzte sie zum Wohnen, das andere zum Arbeiten. Für mich hatte es in den vergangenen Jahren keinen Ort gegeben, an dem ich mich mehr aufgehoben fühlte. Wir verbrachten ganze Wochenenden auf ihrem Sofa, guckten »Sex and the City«, aßen Eis, tranken Rotwein, machten uns über Männer lustig oder trösteten uns gegenseitig, wenn wir unter Liebeskummer litten.
Amy und ich hatten uns gleich zu Beginn unseres Jurastudiums, Schwerpunkt Wirtschaftsrecht, an der Columbia-Universität kennengelernt. Beim Ausfüllen eines Formulars hatten wir durch Zufall entdeckt, dass wir am selben Tag geboren wurden, sie in Hongkong, ich in New York. Sie hatte die ersten neunzehn Jahre ihres Lebens in Hongkong verbracht und war von ihren Eltern zum Studieren nach Amerika geschickt worden. Amy behauptete, ein Astrologe hätte ihr schon in Hongkong prophezeit, dass sie jemandem mit denselben Geburtsdaten begegnen würde, der sie ihr Leben lang begleiten würde, und so hatten wir, fand sie, gar keine andere Wahl, als Freundinnen zu werden.
Ich glaubte damals nicht an Astrologie, aber ich mochte Amy sofort. Wir ergänzten uns, wie ich es zuvor noch nie mit einer Freundin erlebt hatte.
In vielen Dingen war sie das genaue Gegenteil von mir: Einen Kopf kleiner, kräftiger, sie färbte ihre schwarzen Haare gern bunt, machte ungern Pläne, liebte Überraschungen, war schlagfertig und nur sehr schwer aus der Ruhe zu bringen. Sie meditierte, war Buddhistin, konsultierte trotzdem regelmäßig Astrologen und war so abergläubisch, dass es mich manchmal wahnsinnig machte. Sie trug immer etwas Rotes am Körper. Stieg im Fahrstuhl niemals im neunten Stock aus. Weigerte sich, Taxis zu nehmen, deren Kennzeichen auf sieben endete.
Sie war der einzige Mensch, dem ich die Geschichte meines Vaters erzählte. Und sie hat mir geglaubt. Wort für Wort, ohne Fragen zu stellen. Als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, dass es Menschen gibt, die Herzen hören können.
Im Gegensatz zu meiner Mutter und meinem Bruder, die nichts hatten hören wollen von meiner Reise. Sie interessierte ausschließlich, ob unser Vater noch am Leben war. Als ich das verneinte und berichten wollte, was ich in Burma erlebt hatte und warum er zum Sterben in das Land seiner Geburt zurückgekehrt war, weigerten sie sich, mir zuzuhören. Es war der Beginn unserer Entfremdung. Meine Suche nach meinem Vater hatte die Familie entzweit. Meine Mutter und mein Bruder auf der einen Seite, mein Vater und ich auf der anderen. Amy war überzeugt, dass diese Teilung schon immer bestanden hatte und ich sie erst spät bemerkt oder vorher nicht hatte wahrhaben wollen. Wahrscheinlich hatte sie recht. Vor fünf Jahren war meine Mutter in die Nähe meines Bruders nach San Francisco gezogen, und wir sahen uns nur noch ein-, zweimal im Jahr.
Amy hingegen gab keine Ruhe. Wann ich endlich U Ba besuche, wollte sie immer mal wieder wissen. Was mit dem Erbe meines Vaters geschehen sei, dem Glauben an die magische Kraft der Liebe? Ob er mir in New York wieder verloren gegangen sei? Warum ich nicht besser darauf achtgegeben hätte? Ob ich nicht danach suchen wolle? Fragen, denen ich auswich, weil ich darauf keine Antworten hatte; was sie nur ermunterte, sie mir hin und wieder zu stellen.
Amy studierte, im Gegensatz zu mir, ohne großen Ehrgeiz. Eigentlich hatte sie Malerin werden wollen und Jura nur gewählt auf Druck von oder aus Liebe zu ihren Eltern, die Begründung wechselte, je nach ihrer Stimmung. Trotzdem gehörte sie zu den Besten unseres Jahrgangs. Als ihr Vater vier Wochen vor den letzten Prüfungen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, verschwand Amy für zwei Monate nach Hongkong. Zurück in New York, erklärte sie ihr Studium für beendet. Nicht einen Tag mehr wollte sie in der Universität verbringen. Das Leben sei zu kurz für Umwege. Wer einen Traum habe, müsse ihn leben.
Seither schlug sie sich mit Gelegenheitsjobs als Bühnenmalerin am Broadway durch und lehnte es ab, ihre Bilder einem Galeristen auch nur zu zeigen. Sie war weder an Ausstellungen noch am Verkauf ihrer Werke interessiert. Sie male für sich, nicht für andere. Amy war der freieste Mensch, den ich kannte.
Die Tür zu ihrem Studio war angelehnt. Sie hasste verschlossene Türen, wie sie überhaupt alle Schlösser verabscheute und fest davon überzeugt war, dass Menschen, die fortwährend damit beschäftigt waren, etwas ab- oder einzuschließen, irgendwann sich selbst verschlössen. Sie weigerte sich sogar, ihr Fahrrad irgendwo anzuketten. Seltsamerweise war sie die Einzige aus meinem Freundeskreis, der in New York noch nie eines gestohlen worden war.
Sie saß auf einem rollenden Hocker vor einer Leinwand, die sie mit einem dunklen Orange bestrich. Ihre rot gefärbten Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie trug ein viel zu großes, weißes T-Shirt voller Farbflecken und eine graue, ausgewaschene Jogginghose, ihre Arbeitskleidung. Es roch nach frischer Farbe und Lacken, der Boden war mit bunten Klecksen übersät, an den Wänden und Staffeleien lehnten Bilder, viele von ihnen in verschiedenen Rottönen. Amy behauptete, sie sei unglücklicherweise in ihrer Barnett-Newman-Phase stecken geblieben, statt Streifen malte sie Kreise, und wenn sie sich daraus nicht bald befreie, könne ich sie demnächst Bernadette Neumann nennen. Aus ihrer kleinen Anlage erklang Jack Johnson.
Sie hörte meine Schritte auf den Holzbohlen und drehte sich um. Ihre dunkelbraunen, fast schwarzen Augen schauten mich überrascht an.
»Wie siehst du denn aus?«
Ich ließ mich in einen alten Sessel fallen, meine Hände und Füße waren eiskalt. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Es war, als fiele in diesen Sekunden die Anspannung der vergangenen Stunden von mir ab. Sie blickte mich mit sorgenvoller Miene an, gab ihrem Hocker einen kräftigen Schubs und kam zu mir herübergerollt.
»Was ist los?«
Ich zuckte hilflos mit den Schultern.
»Lass mich raten: Mulligan hat dich rausgeschmissen.«
Ich deutete ein Kopfschütteln an.
»Deine Mutter ist gestorben.«
Ich schluckte die ersten Tränen herunter.
Amy seufzte tief. »O.k., es ist etwas Ernstes!«
Vielleicht war es ihr Humor, den ich am meisten an ihr mochte.
»Sag schon, was ist passiert?«
»Wie sehe ich denn aus?«, versuchte ich ihrer Frage auszuweichen.
»Wie ein verängstigtes Hühnchen.«
Ich schwieg eine Weile, Amy wartete geduldig auf eine Antwort.
Es fiel mir schwer, den Satz auszusprechen, der seit einer Stunde unaufhörlich durch meinen Kopf geisterte. »Ich habe Angst, verrückt zu werden.«
Sie musterte mich nachdenklich. »Und was genau, wenn ich fragen darf, gibt dir Anlass zu dieser Befürchtung?«
»Ich habe das Gefühl, jemand verfolgt mich.«
»Ein Stalker? Sieht er gut aus?«
»Kein Stalker. Ich höre eine Stimme.« Ich erschrak über den Satz. Er war mir peinlich, selbst Amy gegenüber.
»Seit wann?«, fragte sie jetzt sehr ernst, ohne dabei jedoch sonderlich überrascht zu klingen.
»Seit heute Morgen«, antwortete ich und erzählte, was im Büro und zu Hause geschehen war.
Amy verharrte regungslos auf ihrem Hocker und hörte zu. Manchmal nickte sie, als wüsste sie genau, wovon ich sprach. Als ich fertig war, stand sie auf, legte den Pinsel beiseite und ging zwischen ihren Bildern auf und ab. Das tat sie oft, wenn sie angestrengt nachdachte.
»Ist es das erste Mal?«, fragte sie und blieb stehen.
»Ja.«
»Droht sie dir?«
»Nein, wie kommst du darauf?«
»Beschimpft sie dich?«
»Beschimpfen?«
»Sagt sie dir, dass du eine nichtsnutzige alte Schlampe bist? Eine lausige Anwältin? Dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis alle merken, wie blöd du eigentlich bist?«
Verwirrt schüttelte ich den Kopf. »Nein.«
»Erteilt sie dir Befehle?«
Ich wusste nicht, worauf sie mit ihren Fragen hinauswollte.
»Sagt sie dir, dass du Mulligan eine Tasse Kaffee ins Gesicht kippen sollst? Aus dem Fenster springen musst? Nicht in gelbe Taxis steigen darfst, weil dich sonst der Fahrer vergewaltigt oder nach Pakistan verschleppt und zu seiner Drittfrau macht?«
»Nein. Wie kommst du auf so einen Unsinn?«
Amy überlegte. »Was sagt sie dann?«
»Nicht viel. Im Büro hat sie mich vor den Kollegen gewarnt, sonst stellt sie nur Fragen.«
»Was für Fragen?«
»Wer bist du? Warum lebst du allein? Weshalb hast du keine Kinder?«
Ein erleichtertes Lächeln flog über ihr Gesicht. »Interessante Fragen.«
»Wieso interessant?«
»Ich kenne noch jemanden, den deine Antworten interessieren würden. Haben unsere Stimmen vielleicht Ähnlichkeit?«
»Hör auf, dich über mich lustig zu machen«, sagte ich enttäuscht. Spürte sie nicht, wie sehr ich ihren Zuspruch brauchte?
»Mache ich nicht«, sagte sie, kam zu mir, hockte sich neben mich und strich mir liebevoll über den Kopf.
»Aber diese Fragen klingen nicht so dramatisch. Ich hatte andere Befürchtungen.«
»Was für Befürchtungen?«
»Stimmen hören ist oft eine psychotische Reaktion. Es ist ein typisches Symptom bei einer beginnenden Schizophrenie. Da ist die Prognose schlecht. Nur schwer heilbar. Aber in solchen Fällen fühlen sich die Betroffenen von den Stimmen bedroht. Sie bekommen Befehle erteilt. Springen von Hausdächern oder erstechen ihren Nachbarn. Melancholiker hören oft Beschimpfungen. Das trifft auf dich alles nicht zu.«
»Woher«, fragte ich verwundert, »weißt du so viel über Menschen, die Stimmen hören?«
»Habe ich dir nie erzählt, dass mein Vater auch eine Stimme hörte?«
Ich starrte sie überrascht an. »Nein.«
»Meine Mutter hat es mir ein paar Jahre nach seinem Tod erzählt. Danach habe ich alles gelesen, was ich über das Thema finden konnte.«
»War dein Vater schizophren?«
»Nein. Ich glaube, bei ihm war es ein relativ harmloses Phänomen.«
»Was hat er dagegen gemacht?«
»Nichts.«
»Nichts?«
»Ich vermute, er hat die Stimme als jemanden empfunden, der ihm hin und wieder Ratschläge gab.« Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Leider hat er nicht immer darauf gehört.«
»Was heißt das?«
»Meine Mutter sagt, am Tag des Absturzes hätte die Stimme ihm erklärt, er müsse umkehren. Er dürfe nicht in diese Maschine einsteigen. Er hat sie noch vom Flughafen aus angerufen.«
»Warum hat er nicht auf sie gehört«, fragte ich zweifelnd.
»Wenn ich das wüsste. Vielleicht hatte er Angst, ihr zu viel Macht über sein Leben zu geben. Wer will sich von einer Stimme sagen lassen, welches Flugzeug er nehmen darf und welches nicht?«
»Warum hast du mir davon noch nie erzählt?«
»Ich dachte, ich hätte es getan. Aber vielleicht ging ich davon aus, du würdest es mir nicht glauben.«
Ich war nicht sicher, ob ich es jetzt tat. Ich musste an meinen Bruder in Burma denken. »Nicht alles, was wahr ist, kann man erklären, und nicht alles, was man erklären kann, ist wahr«, hatte er mir damals gesagt. Wie oft hatte ich in den ersten Jahren nach meiner Rückkehr an diesen Satz gedacht. In Kalaw hatte ich irgendwann verstanden, was er meinte, in seiner Welt mit ihren abergläubischen Menschen machte das für mich Sinn, zurück in New York, war ich wieder unsicher geworden. Warum sollte nicht alles wahr sein, was man erklären kann? Warum sollte man nicht alles erklären können, was wahr ist? Vielleicht gab es in Kalaw Wahrheiten, die woanders nicht galten.
»Du glaubst mir nicht«, sagte Amy, als hätte sie meine Zweifel gespürt.
»Nein. Doch. Natürlich glaube ich dir, dass deine Mutter das erzählt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Vater von einer Stimme vor seinem letzten Flug gewarnt wurde.«
»Warum nicht?«
»Du kennst mich. Dafür bin ich zu rational.«
»Dein Vater konnte Herzen hören. Er konnte Schmetterlinge an ihrem Flügelschlag erkennen. Wie erklärst du dir das?«
»Dafür gibt es keine Erklärung, ich weiß. Das heißt aber nicht, dass ich deshalb jeden …« Ich suchte nach einem Wort, das Amy nicht verletzen würde.
»… esoterischen Quatsch glaube«, vollendete sie meinen Satz.
»Genau«, sagte ich und musste selber lachen.
»Sollst du auch nicht«, fuhr sie fort. »Aber jetzt hörst du eine Stimme. Hast du dafür eine Erklärung?«
»Nein«, antwortete ich kleinlaut.
Wir schwiegen beide nachdenklich.
»Wollen wir irgendwo was trinken gehen?«, fragte sie nach einer langen Pause und richtete sich auf.
Ich zögerte. »Lieber würde ich hierbleiben. Mir ist nicht nach fremden Menschen.«
Sie nickte. »Möchtest du einen Espresso?«
»Lieber ein Glas Wein.«
»Noch besser.« Sie ging in die offene Küche, öffnete eine Flasche Rotwein, kam mit einem Tablett, Gläsern, Schokolade und Nüssen zurück und schenkte uns ein. Sie zündete ein paar Kerzen an, wir nahmen zwei Kissen, setzten uns auf den Boden und schwiegen. Das konnten wir gut. Im Beisein von Amy verlor die Stille alles Trennende.
»Hörst du sie jetzt?«, fragte sie irgendwann.
Ich horchte in mich hinein und schüttelte den Kopf.
»Schade. Ich hätte mich gern mal mit ihr unterhalten.«
Ich warf ihr über mein Weinglas hinweg einen leicht gequälten Blick zu. »Sie sagt nichts, Amy. Sie stellt nur Fragen.«
»Ich frage mich, ob diese Stimme auch einen Nutzen haben könnte?«
Ich frage mich. Eine typische Amy-Redewendung. Sie benutzte sie oft, wenn ihre Frage eigentlich eine Aussage war. Ich kannte sie gut genug, um zu wissen, was sie meinte: Julia! Diese Stimme hat einen Sinn.
»Welchen Nutzen?«
»Meinem Vater war es unangenehm, darüber zu sprechen, aber er hat die Stimme, meiner Mutter zufolge, nicht als Bedrohung empfunden. Mehr als so eine Art Lebensbegleiter, mit dem er sich in regelmäßigen Abständen austauschte, glaube ich.«
Ich schüttelte den Kopf. Es war nicht, was ich hören wollte. Ich hätte aber auch nicht sagen können, welche Sätze mir in dieser Situation gutgetan hätten. Wollte ich nur ein wenig Mitleid, verbunden mit der Versicherung, dass es mir in ein paar Tagen wieder besser gehen würde? Wie bei einem grippalen Infekt?
»Ich brauche keinen Lebensbegleiter. Zumindest keinen, den ich nicht sehen und berühren kann.«
Amy nippte in Gedanken versunken an ihrem Wein. »Und wenn du ihre Fragen beantwortest?«
»Wozu?«
»Möglicherweise gibt sie dann Ruhe. Wer weiß?«
»Das habe ich versucht. Es hat nur zu mehr Fragen geführt.«
Sie wiegte den Kopf hin und her und schaute mich lange an. »Was macht dir an dieser Stimme Angst«?
»Was mir Angst macht? Dass ich keine Kontrolle über sie habe.«
»Ist das so schlimm?«
»Ja! Ich habe wortlos und ohne Erklärung eine Bürokonferenz verlassen. Eine wichtige!«
»Ein plötzlicher Schwächeanfall. Mulligan wird es dir nachsehen.«
»Aber kein zweites Mal. In der kommenden Woche müssen wir eine ziemlich komplizierte Klageschrift einreichen. Wir müssen unserem Mandanten unsere Strategie erklären, ein Teil davon ist mein Job. Was passiert, wenn sie sich mitten in der Präsentation wieder meldet?«
Sie überlegte. »Dann bleibst du ganz ruhig und sagst ihr, dass sie warten muss.«
Ich seufzte. »Sie hört nicht auf mich.«
»Dann ist das eben so.«
»Amy!« Warum verstand sie mich nicht? »Ich kann es mir nicht leisten, so die Kontrolle zu verlieren. Ich muss funktionieren. Ich male keine Bilder. Ich habe nicht die Wahl.«
»Die haben wir immer.«
Es gab nichts, worüber wir uns leidenschaftlicher streiten konnten. Sie gehörte nicht zu den Menschen, die äußere Zwänge akzeptierten. Für Amy waren wir alle für unser Schicksal selbst verantwortlich. Ausnahmslos.
Alles, was wir taten, hatte Konsequenzen. Und für diese waren wir verantwortlich. Wir hatten die Wahl. Ja oder nein.
Das Leben ist zu kurz für Umwege.
Wer einen Traum hat, muss ihn leben.
Ich leerte mein Glas und schenkte mir nach. »In meinem Kopf traktiert mich eine Stimme. Ich will wissen, woher sie kommt. Ich will wissen, wie ich sie wieder loswerde. Und zwar so schnell wie möglich.«
»Dann musst du zum Arzt und es mit Medikamenten versuchen. Ein Psychiater wird dir helfen können. Zumindest kurzfristig.«
Ich sah in ihren Augen, in der Art wie sie die Lippen kräuselte, wie wenig sie von der Idee hielt.
»O.k., und was würdest du machen?«
»Ich bin überzeugt, dass diese Stimme einen Sinn hat.«
»Und welcher könnte das sein?« Mein skeptischer Ton war nicht zu überhören.
»Du hast in diesem Jahr viel durchgemacht. Du hast viel verloren …« Sie machte eine bedeutungsschwere Pause.
Das Gespräch nahm eine Wendung, gegen die ich mich sträubte. Es gab Sachen, über die ich nicht reden wollte. Auch mit Amy nicht. »Ich weiß, worauf du hinauswillst. Aber mit dem, was im Frühjahr geschehen ist, hat die Stimme nichts zutun.«
»Bist du sicher?«
»Absolut. Wie kommst du darauf?«
Sie zuckte mit den Schultern. »War nur eine Idee.«
Wir tranken unseren Wein, aßen Nüsse und sagten lange nichts.
»Du verlangst viel von dir.«
»Tun wir doch alle.«
»Quatsch. Du bist der selbstdisziplinierteste Mensch, den ich kenne. Du gönnst dir seit Jahren keine Pause.«
»Wir beide waren im Sommer auf Long Island«, widersprach ich.
»Zwei Tage. Dann musstest du früher zurück, weil Mulligan dich brauchte. Als du dich von Michael getrennt hast und ausgezogen bist, hast du auf den Umzugkartons gesessen und Briefe an Mandanten geschrieben, weil es angeblich wahnsinnig wichtige Terminsachen gab, die keinen Aufschub duldeten.«
»Sie waren wichtig«, entgegnete ich mit matter Stimme.
»Du warst gerade dabei, deinen Freund zu verlassen, mit dem du drei Jahre zusammengelebt hattest. Du bist nicht die einzige Anwältin in eurer Kanzlei.«
Ich nickte.
»Vielleicht ist diese Stimme ein Zeichen …«
»Du glaubst, ich höre eine Art unterdrücktes Ich, das ich immer vernachlässigt habe, stimmt’s? Aber ich führe keinen inneren Dialog mit mir. Die Stimme ist real. Ich höre sie. Ich kann sie dir beschreiben.«
»Wie klingt sie?«
»Älter als ich. Ein wenig kratzend manchmal. Tief für eine Frau. Streng.«
Ein bedächtiges Schweigen war ihre Antwort.
»Ich habe Angst«, sagte ich leise.
Sie nickte, ihr Blick wanderte an mir vorbei auf ein großes Bild an der Wand. Ein roter Kreis auf einem dunkelroten Hintergrund, darauf hatte sie ganze Hände voll rot gefärbter Hühnerfedern geklebt. »Buddha im Hühnerstall« stand darunter.
»Ich fahre übernächste Woche für ein paar Tage aufs Land. Hast du Lust mitzukommen?«
Ich schüttelte den Kopf. Amy zog sich regelmäßig zum Meditieren in ein buddhistisches Zentrum in Upstate New York zurück. Sie hatte mich schon häufiger gefragt, ob ich sie nicht begleiten wollte, und ich hatte sie jedes Mal vertröstet. Mir war es ein Rätsel, wie sie eine Stunde oder auch länger still sitzen und an nichts denken konnte. Die wenigen Male, die ich es in Yogakursen versucht hatte, gingen mir so viele Gedanken, Bilder und Erinnerungen durch den Kopf, dass ich es kaum aushielt. Ich hatte das Gefühl, er würde gleich platzen. Jedes Mal brach ich die Übung nach wenigen Minuten ab. Amy glaubte, es hätte mir nur an der richtigen Anleitung gefehlt, ich bezweifelte das.
Langsam spürte ich den Wein, und eine fast lähmende Müdigkeit überkam mich.
»Ich glaube, ich mach mich auf den Weg.«
»Du kannst gern hier schlafen.«
»Ich weiß, danke. Aber ich habe am Wochenende so viel zu tun und will morgen nicht zu spät anfangen.«
Sie lächelte und nahm mich in den Arm. Es war schön, ihren Körper zu spüren. Am liebsten wäre ich geblieben.
Ich war noch keinen Häuserblock auf der Rivington Street gegangen, da hörte ich sie wieder.
Wer bist du?
5
Es vergingen zwei Wochen, bis sie es ihm sagte.
Zwei einsame, tieftraurige, elend lange Wochen, in denen die Lüge ihre mächtigen Flügel ausbreitete und sie wachsen ließ, bis sie den Himmel verdunkelten.
Zwei Termin-gefüllte-Mulligan-beladene-Besprechungen-von-morgens-bis-abends-ich-komme-zu-nichts-Wochen.
Zwei wortreiche Wochen ohne Worte.
Einen Tag hätte er ihr vielleicht verziehen. Möglicherweise auch zwei. Aber vierzehn?
Sie hatte es kommen sehen. Und doch nicht verhindern können.
So wurde aus einem Unfall ein Geheimnis. Und so wie das Gift eines Schlangenbisses seinen Weg durch den Körper findet, bis es das Herz erreicht und es zum Schweigen bringt, so bahnte sich ihr Schweigen seinen Weg durch ihre Liebe, bis es das Herz erreichte und es zum Schweigen brachte.
Eine Lüge kann genügen. Eine Lüge, streichholzgroß.
Das Gegengift wäre die Wahrheit gewesen. Es war ihr nicht gegeben. Nicht in diesen zwei Wochen.
Sie hatte es kommen sehen.
Wann beginnt das Leben? Wann beginnt die Liebe? Wann hört sie auf?
Nicht lebensfähig. Noch lange nicht. Und trotzdem.
Sie hatte vergessen, wie zerbrechlich Vertrauen war. Wie kostbar. Wie viel Licht es braucht. Wie dunkel es wird, wenn die Lüge ihre Flügel ausbreitet.
Sie hatte vergessen, wovon es sich nährt. Wie viel Zuwendung es braucht.
Sie bat ihn um Verzeihung. Nicht um eine zweite Chance. Als hätte sie gewusst, dass es sie nicht geben würde.
So endete es. Nach vier Jahren.
Keine Liebe fürs Leben, aber eine Hoffnung darauf.
6
Wie dünn ist die Wand, die uns vom Wahnsinn trennt? Niemand weiß, wie sie beschaffen ist. Niemand weiß, wie viel Druck sie erträgt. Bis sie nachgibt.
Wir leben alle am Rande.
Es ist nur ein Schritt. Ein kleiner. Den einen ist es bewusst, den anderen nicht.
Ich hatte lange geschlafen, mich bemüht, meine samstägliche Routine beizubehalten, ohne mich aus der Ruhe bringen zu lassen. Spät gefrühstückt, lange Zeitung gelesen, einige E-Mails an Freunde geschrieben, die Wäsche gemacht. Trotzdem wuchs meine Anspannung den Morgen über mit jeder Stunde. Ich traute der Stille in mir nicht mehr. Das Gefühl, als schaute mir bei allem, was ich tat, eine unsichtbare Macht über die Schulter. Die Stimme folgte mir, daran hatte ich keinen Zweifel mehr. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sie sich wieder melden würde.
Vor mir lag der Entwurf unserer Klageschrift. Links und rechts stapelten sich Akten und Schriftwechsel, ein arbeitsreiches Wochenende wartete auf mich.
Warum hast du keine Kinder?
Ich erschrak jedes Mal aufs Neue. Aus der Nachbarwohnung klang gedämpfte Klaviermusik, der Fahrstuhl klingelte, Polizeisirenen tönten von der Second Avenue herauf, die Stimme wiederholte ihre Frage. Es klang, als stünde sie hinter mir und spräche mir direkt ins Ohr. Ich wollte mich wehren. Aber wie? Gegen wen?
Warum hatte ich keine Kinder? Eine Frage, die ich hasste. Warum muss sich eine Frau für ihr kinderloses Leben rechtfertigen? Niemand käme auf die Idee, eine Mutter zu fragen, warum sie Kinder hat. Wie kam sie ausgerechnet auf diese Frage? Ich tat, als hätte ich nichts gehört.
Du solltest nicht allein leben. Das ist nicht gut.
Die Stimme bekam unvermittelt einen forscheren Ton. Es war das erste Mal, dass sie keine Frage stellte. Ich dachte an Amys Worte. Sprich mit ihr. Hör dir an, was sie zu sagen hat.
Du solltest …
– Wo kommst du her?, unterbrach ich sie barsch.
Stille. Ich wiederholte den Satz und wartete. Als schulde sie mir eine Antwort.
Das … das weiß ich nicht, erwiderte sie leise.
– Warum nicht?
Ich erinnere nichts.
– Was willst du von mir?
Nichts.
– Warum stellst du dann all die Fragen?
Weil ich wissen möchte, wer du bist.
– Warum?
Weil ich in dir lebe. Weil ich ein Teil von dir bin.
– Nein! Du gehörst nicht zu mir, widersprach ich.
Doch.
– Nein. Ich kenne mich.
Bist du sicher? Wer kennt sich schon?
– Du bist eine Fremde, beharrte ich.
Ich bin ein Teil von dir und werde es bleiben.
Mir wurde schlecht.
– Wenn du wirklich ein Teil von mir bist, dann will ich, dass du schweigst.
Ich gehöre zu dir, aber du kannst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Das entscheide ich.
Meine Hände begannen zu zittern.
Wovor hast du Angst?
– Wer sagt, dass ich Angst habe?
Warum zitterst du sonst?
– Weil ich friere.
Wovor hast du Angst?
– Ich. Habe. Keine. Angst.
Hast du. Mit Angst kenne ich mich aus.
Ich stutzte.
– Warum kennst du dich mit Angst aus?
Stille.
Weil Angst mein täglicher Begleiter war.
– Wann?
Wenn ich das wüsste. Alles ist verschwommen. Nur an die Angst erinnere ich mich.
– Wo war das?
Alles ist weit weg.
– Was ist weit weg? Wovor hattest du Angst?
Ich habe alles verloren.
– Was hast du verloren?
Alles. Mehr weiß ich nicht.
Sie verstummte. Ich wartete, ob sie sich wieder melden würde. Ich stand auf und lief aufgeregt in meiner Wohnung umher.
– Was hast du verloren? Wo kommst du her? Sag doch etwas.
Es blieb ruhig in mir.
– Warum antwortest du mir nicht?
Was war nur in mich gefahren? Wer sprach da zu mir? War es möglich, dass sich meine Persönlichkeit von einem Tag zum anderen gespalten hatte? War das die Definition von Schizophrenie?
Ich öffnete meinen Laptop und googelte »Schizophrenie«. Wikipedia definierte sie als eine »schwere psychische Erkrankung, gekennzeichnet durch Störungen des Denkens, der Wahrnehmung und der Affektivität«. Sie begann oft plötzlich, ohne dass es vorher nach außen auffällige Merkmale gegeben hätte. »Typisch für die inhaltlichen Denkstörungen ist Wahnbildung.« Ich hielt inne und überlegte kurz, ob ich den Computer nicht besser zuklappen sollte. Wahnbildung. Was sollte das heißen? Beunruhigt las ich weiter: »Häufig treten akustische Halluzinationen auf: Etwa 84 Prozent der an einer schizophrenen Psychose Erkrankten nehmen Gedanken wahr, deren Ursprung von den Betroffenen außerhalb verortet wird (Stimmen hören). Ein solches Erlebnis kann für die Betroffenen allein und inmitten von Sätzen, die umstehende Menschen sagen, auftreten. Befehle sind dabei eher selten. Behandlung: Bis heute sind schizophrene Störungen nicht im eigentlichen Sinne ›heilbar‹. In einer akuten Phase steht häufig die medikamentöse Behandlung im Vordergrund.«
Mit jedem Satz ging es mir schlechter. Ich litt nicht unter einer Psychose. Halluzinationen hatte ich auch nicht. Diese Stimme gab es. Ich bildete sie mir nicht ein.
Bei Amazon suchte ich nach Büchern, die sich mit inneren Stimmen beschäftigten. »Schizophrenie heilen«, »Halluzinationen heilen«, »Höre die Stimme des Lords« waren die beliebtesten Titel. Nichts, was ich lesen wollte.
Unter dem Stichwort »Stimmen hören« gab es im Internet über eine Million Fundstellen. Bei der ersten handelte es sich um eine Radiosendung. Darunter bot ein Netzwerk »Informationen, Unterstützung und Verständnis für Menschen, die Stimmen hören« an. »WrongDiagnosis.com« versprach eine Liste mit sieben Krankheiten, die das Phänomen verursachen können, und entsprechende Behandlungsmethoden. Ich öffnete die Seite.
»Ursachen: Schizophrenie. Psychosen. Psychotische Depression. Halluzinationen.«
Unter »Behandlung« stand die Empfehlung, dringend einen Arzt aufzusuchen, gefolgt von vier angeblich hilfreichen Videos. In einem sollte ich lernen, dem Arzt meines Kindes die richtigen Fragen zu stellen. Im anderen ging es um »Emotionales Essen: Wie Sie verhindern, dass Ihre Gefühle Ihre Essgewohnheiten kontrollieren«. Es folgte eines über »Stressfreie Familienausflüge im Auto« und eines über den Zusammenhang zwischen Nikotinentzug und Gewichtszunahme. Menschen, die Stimmen hörten, schienen demnach unter kranken oder schreienden Kindern zu leiden und Probleme mit ihrem Gewicht zu haben. Beides traf auf mich nicht zu. Am Ende der Seite entdeckte ich ein Forum mit Erlebnisberichten Betroffener. Neugierig öffnete ich den ersten.
»Deepwater« schrieb: »Ich höre seit zwei Jahren Stimmen. Zunächst nur gelegentlich, aber seit einem Jahr nehmen sie zu. Sie werden lauter und drängender und mischen sich immer mehr in mein Leben ein. Sie sagen, ich sei klein und hässlich und ein Versager. Vergangene Woche befahlen sie mir, aus dem Haus zu gehen, mich auf den Rasen zu legen, mit den Armen zu rudern und dabei laut zu schreien, bis die Nachbarn kommen. Ich nehme starke Psychopharmaka dagegen, aber die helfen nicht. Mein Psychiater sagt, ich muss Geduld haben. Aber ich kann nicht mehr. Außerdem glaube ich, dass es unter Psychopharmaka schwieriger ist, mit höheren Mächten in Kontakt zu treten. In einem Buch habe ich gelesen, dass wir lernen müssen, mit unserem dritten Auge zu sehen. Dort liegt die Lösung. Aber wie sehe ich mit meinem dritten Auge? Hat da jemand praktische Erfahrung? Ist das die Lösung? Ich will nicht verzweifelt klingen, aber die Stimmen fangen an, mir zu sagen, was ich tun soll. Das macht mir Angst. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?«
»Sleeping-beauty« antwortete: »Hast du es mit Beten versucht? Jesus hat die Antwort. Er hat auf alles eine Antwort, du musst ihm nur vertrauen. Er will, dass du ihm vertraust und …«