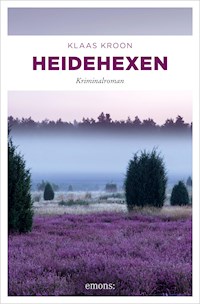Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Polizeihauptmeisterin Sabine Langkafel
- Sprache: Deutsch
In einem Wald bei Gartow wird eine tote Frau gefunden. Erdrosselt. Die Dorfpolizistin Sabine Langkafel identifiziert das Mordopfer als Journalistin Martina Breesen aus Salzwedel. Zunächst geraten ominöse Umweltschützer ins Visier der Polizistin und ihrer Kollegin Melanie Gierke von der Kripo Lüneburg. Bei ihren Ermittlungen stoßen die beiden außerdem auf ein Unfallopfer aus der Nacht der Grenzöffnung 1989. Ein verwirrendes Spiel rund um Täuschungen und verschwundene Akten beginnt - und bringt Sabine in tödliche Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaas Kroon
Akte Wendland
Kriminalroman
Zum Buch
Schatten der Vergangenheit Ein Leichenfund in einem Waldstück nahe Gartow ruft die Dorfpolizistin Sabine Langkafel und ihre Kollegin Melanie Gierke von der Kripo Lüneburg auf den Plan. Bei der Toten handelt es sich um die Lokaljournalistin Martina Breesen aus Salzwedel. Was sie in Gartow wollte, bleibt unklar. Zunächst geraten Mitglieder des Vereins Naturbelassen e. V. ins Visier der Polizistinnen. Ist die Journalistin den ominösen Umweltschützern mit ihren Recherchen etwa in die Quere gekommen? Je tiefer die beiden graben, umso mysteriöser und verworrener wird die Situation. Bis sie auf einen alten Fall stoßen, der mit dem Mord an der Journalistin zusammenzuhängen scheint: den Unfalltod eines DDR-Bürgers in der Nacht der Grenzöffnung 1989. »Akte Wendland« ist ein packender Kriminalroman, in dem inmitten der Wendland-Idylle düstere Geheimnisse der jüngeren deutschen Geschichte ans Licht kommen …
Klaas Kroon ist das Pseudonym eines 1960 in Düsseldorf geborenen Journalisten und Marketingmanagers. Seit 2017 schreibt Kroon Krimis, die in Hamburg, Lüneburg und dem Wendland spielen. Kroon hat ein Faible für originelle Figuren und verzwickte Fälle mit Bezug zu historischen Ereignissen und gesellschaftlichen Themen. Er lebt in Hamburg. Das Wendland und die Lüneburger Heide bereist er seit Jahren intensiv mit Rennrad und Motorrad.
Im Gmeiner-Verlag erschien 2021 der erste Fall mit Sabine Langkafel: »Mord im Wendland«.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Udo Kruse / stock.adobe.com
ISBN 978-3-7349-3004-1
Prolog
10. November 1989
»Der ist gut durch«, sagte der Kerl von der Feuerwehr, während er den Schlauch einrollte, den er zuvor auf dem Waldweg akribisch ausgelegt hatte.
»Ja, danke, Kollege, das sehe ich auch«, entgegnete Polizeihauptmeister Johannes Langkafel von der Polizeidienststelle Gartow, der dieser Art von Katastrophenhumor nichts abgewinnen konnte. Es war weiß Gott nicht das erste Brandopfer, mit dem Langkafel in seiner fast 30-jährigen Laufbahn zu tun hatte, aber er fand es immer wieder schockierend. Das Feuer machte aus Menschen bizarre, grauenhafte Skulpturen. Bei diesem Opfer ragten die Arme in die Höhe, als hätte der Mensch im Todeskampf versucht, die Flammen zu verscheuchen. »Fechterstellung« nannten die Fachleute das, hatte Langkafel gelernt. Beim Verbrennen kommt es zur Kontraktion bestimmter Muskeln und das führt zu dieser Haltung. Der Mund des Toten war weit aufgerissen, und Johannes glaubte fast, die Schmerzensschreie des Mannes – oder war es eine Frau? – zu hören.
Fast so bizarr wie der verbrannte Mensch war das Autowrack, in dem er lag und das ihm offenbar zur Todesfalle geworden war. Ein dunkelgraues Gerippe, vom Löschschaum wie mit Zuckerguss bedeckt. Kein verkohltes Blech, kein geschmolzener Lack, nur das eiserne Gerippe.
»Hat bestimmt gebrannt wie Zunder, die Scheißkarre«, sagte Kollege Willy Jörgens, der mit Johannes von der Leitstelle lange vor Sonnenaufgang zu diesem Unfall geschickt worden war. Wer den Notruf von wo abgesetzt hatte, wussten sie nicht. Johannes schlich um das Wrack herum, das mit der Front gegen eine schlanke Kiefer geprallt war.
»Gut, dass es seit Tagen regnet«, sagte der Feuerwehrmann. »Sonst hätten wir auch gleich noch einen Waldbrand.«
»Ist so ein Trabbi wirklich aus Pappe?«, fragte Johannes.
»Nee, Pappe nicht«, sagte der Feuerwehrmann, »Duroplast nennt sich das Zeug. So was Ähnliches wie Kunstharz. Fängt schon bei 800 Grad Feuer, verbrennt fast vollständig und setzt dabei sicher einen Haufen Giftstoffe frei.«
»Und wieso brennt die Karre sofort, wenn sie frontal gegen einen Baum kracht? Sind Motor und Tank nicht hinten?«, fragte Willy.
»Nein, Kollege«, sagte der Feuerwehrmann lachend. »Da vertust du dich gewaltig. Motor und Tank sitzen vorne, schön kuschelig beieinander, und wenn der Zweitakter richtig Temperatur hat, geht das ruckzuck. Dafür musst du gar nicht gegen nen Baum fahren.«
»Genau. Vielleicht hat der Trabbi auch zuerst gebrannt und ist dann gegen den Baum geknallt«, mischte sich ein anderer Feuerwehrmann ein, während er seine Camel-Packung in die Runde hielt. Alle bedienten sich und begannen zu rauchen. »Aber um das genau zu wissen, müssten wir Brandspuren auf der Straße finden, was bei dem Regen unmöglich ist.«
»War das Fahrzeug schon komplett ausgebrannt, als ihr ankamt?«, fragte Johannes die Feuerwehrmänner.
»Ja, es hat nur noch gequalmt. Gelöscht haben wir nur zur Sicherheit. Es gab eigentlich kein Futter mehr für die Flammen.«
»Und wie lange hat es gebrannt? Habt ihr ne Idee?«, fragte Johannes weiter.
»Gute Frage, wir haben keine Erfahrung. Wir löschen nicht so oft Trabbis. Das ist mein erster«, sagte der Feuerwehrmann mit den Zigaretten.
»Meiner auch«, erwiderte sein Kollege und lachte. »Aber sicher nicht der letzte. Die kommen ja jetzt zu Hunderten rüber.«
»Ja«, sagte Willy, »es wurden auch schon ein paar angehalten. Allerdings mit lebenden Insassen. In Lüchow auf der Wache liegen ein paar DDR-Führerscheine, die Kollegen besoffenen Fahrern abgenommen haben. Und die Party hat gerade erst angefangen.«
»Für den hier ist die Party vorbei, und dort kann man auch sehen, warum«, sagte Johannes und deutete in den Beifahrerfußraum. Darin lagen vier verrußte Flaschen, die sicher mal Schnaps enthalten hatten.
Der Anblick des verbrannten Körpers machte Johannes traurig. Da feierten die Brüder und Schwestern aus dem Osten seit Mitternacht die Befreiung von Mauer und Stacheldraht, und für den Menschen im ausgebrannten Trabbi war der Traum vom neuen Leben 25 Kilometer hinter der frisch geöffneten Grenzübergangsstelle Bergen/Dumme schon ausgeträumt.
»Wir müssen hier warten«, sagte Johannes schließlich zum Einsatzleiter der Feuerwehr. »Ungeklärte Identität. Ungeklärte Todesursache. Vielleicht gab es einen Beifahrer. Es kommt noch die Kripo aus Lüneburg. Das kann dauern. Also, wenn ihr fertig seid, könnt ihr ruhig abhauen. Wir passen auf, dass niemand was klaut.«
»Okay«, sagte der Feuerwehrmann. »Was einen Beifahrer angeht, da haben zwei von uns die ganze Gegend schon abgesucht. Nirgendwo liegt ein Schwerverletzter. Da kann ich euch beruhigen.«
Drei Wochen nach der Nacht mit dem ausgebrannten Trabbi erhielt Johannes Langkafel den Abschlussbericht der Kriminalpolizei in Lüneburg.
Auf drei Seiten legten die Kollegen dar, dass der Fahrer alkoholisiert gegen den Baum gefahren und bewusstlos geworden ist. Darum konnte er sich nicht aus dem brennenden Fahrzeug retten. Beim Unfallopfer handelte es sich um den Halter des Trabant 601 – Baujahr 1979 –, den 30-jährigen Anstreicher Christian Müller aus Salzwedel. Die Überreste seiner Habseligkeiten im Fahrzeug ließen vermuten, dass er alleine unterwegs gewesen war. Dies bestätigte auch seine Lebensgefährtin bei der Befragung durch die DDR-Volkspolizei in Salzwedel. Müller wollte nur mal Westluft schnuppern, hatte die Frau ausgesagt, und bald zurückkommen. Müllers Leiche war von der Kripo freigegeben und nach Salzwedel überführt worden.
Akte geschlossen, ein Leben viel zu früh und völlig sinnlos beendet, dachte Johannes Langkafel.
Kapitel 1
Attila Yilmaz, Polizeimeister in der Polizeidienststelle Gartow, tat, was er zu oft tat: Er saß, die Füße auf dem Schreibtisch, im Büro, spähte durch das Sprossenfenster der schmucken Fachwerkwache in den verregneten Märzmittag und langweilte sich. Darüber durfte er sich nicht wundern. Sie hatten ihn gewarnt. Jakob Metzger, Polizeichef von Gartow, der sich um diese Zeit immer zum Mittagsschlaf in seine kleine Wohnung über der Wache zurückzog, hatte im Bewerbungsgespräch vor einem Jahr gesagt: »Junge, ich weiß, dass du mal ein guter Polizist wirst, aber nicht bei uns in Schlummerland. Bleib in Lüneburg oder geh nach Hamburg oder Berlin.«
Und Sabine Langkafel, Polizeiobermeisterin in Gartow und die heimliche Chefin in dem Laden, hatte ihn angefleht: »Attila, tu das nicht. Was willst du hier? Du weißt doch, dass in Gartow nichts los ist. Wenn du es nur meinetwegen tust, dann mach dich auf eine Enttäuschung gefasst.«
»Ich tue es deinetwegen, Sabine«, hatte Attila beteuert, »aber nicht, wie du denkst. Ich tue es, weil ich weiß, dass ich von dir viel lernen kann.«
Das hatte er tatsächlich ernst gemeint. Als er fast drei Jahre zuvor während seiner Anwärterzeit ein paar Monate in Gartow hatte aushelfen dürfen, war er an der Aufklärung eines spektakulären Falles mit sechs Toten beteiligt gewesen. Damals hatte er mehr gelernt als während seiner ganzen Ausbildung in Lüneburg.
Aber klar, er hatte sich auch in Sabine verliebt, irgendwie. Sie war schön, klug, nett. Und sie war 33, acht Jahre älter als er. Ihm war das egal. Warum war es Sabine nicht ebenfalls egal? Er musste Geduld haben.
Wenn er, Attila, ein Stück zu groß war für Gartow, war es Sabine erst recht. Sie tat nur deshalb Dienst in der 4.000-Einwohner-Gemeinde im Wendland, um bei ihrem Vater zu sein, dem 83-jährigen Ex-Polizisten Johannes Langkafel. Er war der letzte Rest Familie, den sie noch hatte.
Der alte Mann war auch der Grund, warum sie Attila in seiner Langeweile alleine auf der Wache gelassen hatte. Johannes Langkafel lag in Dannenberg im Krankenhaus, und Sabine besuchte ihn, so oft es ging.
Sabines Vater befand sich nicht etwa wegen irgendwelcher Alte-Leute-Sachen im Krankenhaus. Nein, der Alte turnte normalerweise jeden Tag durch seinen Garten, baute Gemüse an, versorgte ein paar Hühner und hackte Holz. Und dabei hatte er sich eine Blutvergiftung zugezogen, die ihn in Lebensgefahr gebracht hatte. Sabine hatte Attila erzählt, dass sie diesen Zwischenfall zum Anlass nehmen wollte, dem Vater jede riskante Arbeit zu verbieten, doch sie wusste selbst, dass das nicht funktionieren würde.
Das Telefon klingelte. Endlich was los, aber sicher wieder nur irgendein Mist. Nachbarn zu laut, plattgefahrenes Eichhörnchen auf der Straße, Geldautomat bei der Sparkasse kaputt. Attila wunderte sich immer wieder, aus welchen Gründen die Leute die Polizei anriefen.
»Polizeidirektion Gartow, Sie sprechen mit Polizeimeister Yilmaz. Was kann ich für Sie tun?«
»Haha, Attila du Scherzkeks«, sagte Sybille von der Leitstelle in Lüchow ins Telefon, »Polizeidirektion, haha. Und du bist der Polizeipräsident, oder was?« Sie lachte.
»Noch nicht, aber bald, Sybille, wart’s ab.«
»Scherz beiseite, Süßer, ich hab was für euch. Da kam ein Notruf rein. Angeblich eine leblose Person im Wald. Ein paar Kids haben angerufen und waren ziemlich durch den Wind. Möglich, dass die sich vertun oder uns verarschen. Bevor ich die Kavallerie hinschicke, würde ich euch bitten, mal zu schauen, was da los ist. Das ist ganz bei euch in der Nähe. Sagst du Jakob oder Sabine Bescheid?«
»Die sind gerade nicht abkömmlich, ich kümmere mich selbst darum«, sagte Attila forsch.
»Echt? Also ich weiß nicht …«
»Hey, Sybille, ich bin kein Anwärter mehr, check das endlich mal.«
»Sorry. Aber mach schnell. Und melde dich dann sofort.«
Mit Blaulicht und Vollgas raste Attila zu der Stelle an der B493 Richtung Trebel, die Sybille ihm durchgegeben hatte. Die Fahrt dauerte keine fünf Minuten. Die neu asphaltierte Straße führte schnurgerade durch den Wald. Von Weitem sah Attila an der Einfahrt zu einem Waldweg zwei Jungs mit ihren Fahrrädern stehen. Sie winkten aufgeregt. Als Attila bremste, liefen die Jungen in den Waldweg und bedeuteten ihm, ihnen zu folgen. Keine 30 Meter weiter blieben sie stehen und zeigten in den Wald. Attila stoppte den Wagen und stieg aus.
»Hallo, Jungs«, sagte er kumpelhaft, »was gibt’s denn?« Die Jungen waren vielleicht 14 Jahre alt, trugen Regenjacken, Jeans und Boots. Der Nieselregen hatte sie sichtlich durchnässt, aber das schienen sie in der Aufregung gar nicht zu bemerken.
»Da hinten, da liegt jemand im Gebüsch«, rief der eine.
Und der andere ergänzte: »ne Frau, die ist bestimmt tot.«
An dieser Stelle war der Wald generalstabsmäßig gepflanzt, ein Nutzwald, bei dem alle Kiefern auf Linie standen. Nur an wenigen Stellen hatten die Forstleute Haufen von Altholz, Gebüsch, Wildwuchs zugelassen. Es hatte sich wohl herumgesprochen, dass die Tiere diese Schutzräume brauchten. 20 Meter tief im Wald war ein solches Gebüsch, und aus dem Gebüsch ragten zwei Füße in hellblauen Wanderschuhen heraus.
Attila ging näher. Die Jungen folgten ihm, doch er gab ihnen mit strengem Blick den Befehl, auf dem Weg zu bleiben.
Attila beugte sich über das Gebüsch und sah nun den Körper. Es war eine Frau, nicht besonders groß, sie lag auf dem Bauch. Sie war mit einer beigen Hose bekleidet, einer Trekking-Hose mit vielen Taschen. Auch die Jacke war beige und verschmutzt mit Erde und Moos. Die Frau lag mit dem Gesicht nach unten, Attila sah nur die dunkelgrauen Haare und dort, wo der Kragen der Jacke verrutscht war, fiel sein Blick auf den Nacken der Frau. Er ging noch einen Schritt näher, obwohl es ihn graute und obwohl er wusste, dass er nicht am Tatort herumtrampeln durfte.
Es war nicht Attilas erste Leiche. Bei Verkehrsunfällen hatte er schon Tote gesehen. Einmal war ein Motorradfahrer vor seinen Augen unter den Händen der Sanitäter gestorben. Der Mann war in seinem Alter gewesen. Er hatte noch gestöhnt, dann war plötzlich Stille gewesen. Schrecklich. Die Toten, die vor drei Jahren auf diesem Bauernhof ganz in der Nähe entdeckt worden waren, hatte er nicht gesehen. Die hatte Sabine gefunden. Er kannte nur Fotos davon. Die waren schlimm genug gewesen.
Attila entdeckte am Hals der Frau ein Kabel, das dicke blaurote Striemen hinterlassen hatte. Auch ohne Rechtsmediziner konnte er feststellen, dass die Frau erdrosselt worden war.
Langsam ging er zurück zum Waldweg, wobei er darauf achtete, in seinen eigenen Spuren zu bleiben.
»Sybille?«, sagte er leise ins Handy. Er benutzte bewusst nicht das Funkgerät im Wagen, weil da die gesamte Polizei der Gegend mithörte. Die Kollegin in der Leitstelle spürte sicher, dass er nicht mehr zum Scherzen aufgelegt war. »Sybille? Positiv. Eine Frau, älter, vermutlich erdrosselt. Sie liegt in einem Gebüsch.«
»Definitiv tot?«, fragte Sybille.
»Ja.«
»Bekleidet? Vollständig bekleidet?«
»Ja.«
»Okay«, sagte Sybille ruhig. »Suizid?«
»Hä?«, fragte Attila verwirrt. Er merkte, wie die Jungen ihn fasziniert beobachteten. Hielten sie ihn für einen coolen Bullen oder für einen Anfänger?
»Na ja, hat sie sich erhängt? Ist da ein abgebrochener Ast, oder so?«, fragte Sybille etwas hektisch.
Attila trat wieder ein paar Schritte auf das Gebüsch zu. Sein Gang war unsicher, seine Knie weich. Merkten die Jungs, dass er Angst hatte?
Er betrachtete die Kiefer, unter der die Leiche lag. Die untersten Äste wuchsen in vielleicht sechs, sieben Meter Höhe aus dem Stamm und wirkten schwach und brüchig.
»Nein. Nichts in der Art.«
»Sind die beiden Zeugen noch da?«, fragte Sybille. »Diese Jungs?«
»Ja.«
»Dann nimm ihre Personalien auf und schick sie nach Hause. Ich setze die Kripo in Bewegung.«
»Ja, gut«, stammelte Attila und ärgerte sich darüber, dass die Frau in der Leitstelle 15 Kilometer entfernt so schnell das Kommando übernommen hatte. Er wusste doch, was zu tun war. Er war kein Anfänger. Wie alt musste er noch werden, bis sie ihn für voll nahmen?
Kapitel 2
Sabine Langkafel traf noch vor der Lüneburger Kripo am Tatort ein. Sie war auf dem Weg vom Krankenhaus zur Wache in Gartow gewesen, als Attila sie anrief. Sabine war mit dem Privatwagen des Chefs unterwegs, einem alten Mercedes-Kombi, der immer wieder als Ersatzfahrzeug herhalten musste. Es gab nur einen Streifenwagen in Gartow, in dem nun Attila wartete und sofort heraussprang, als er Sabine kommen sah. Er stutzte kurz, sicher, weil sie keine Uniform trug, sondern eine blaue Regenjacke und Jeans.
»Hey, Sabine, gut, dass du da bist«, rief er und lief ihr entgegen.
»Mensch, Attila«, sagte Sabine, »kaum lässt man dich allein, gibt es gleich Mord und Totschlag.«
»Da hinten liegt sie«, sagte Attila aufgeregt. Er war blass und zitterte ein wenig. »Komm.«
»Nee, wir bleiben hier. Da ist genug herumgetrampelt worden. Warten wir mal auf die Kollegen.« Attila wirkte enttäuscht.
Sabine hatte gute Laune. Papa ging es besser, und er würde am nächsten Tag nach Hause entlassen werden. Und nun gab es Arbeit. Sabine ertappte sich immer öfter dabei, dass sie sich nach größeren Fällen sehnte. Nach mehr Action. Das durfte doch nicht sein. Wie weit war sie noch vom Klischee des Feuerwehrmanns entfernt, der Brände legt, damit sein Leben endlich einen Sinn bekommt? Den Großstadt-Kollegen in den Brennpunkten von Gewalt und Wahnsinn ging es sicher genau umgekehrt. Sie waren froh um jeden Notruf, der sich als Fake oder Kleinigkeit entpuppte.
Da lag nun eine Frau im Wald, tot. Vermutlich hatte sie Schlimmes erlebt, bevor sie starb. Das war kein Grund zur Freude.
»Was haben die Jungs gesagt, die sie gefunden haben?«, fragte Sabine Attila, der Nägel kauend am Streifenwagen lehnte. Der Nieselregen ruinierte seine sicher mit viel Mühe gestylte Gel-Frisur.
»Die sind wohl auf dem Weg gefahren und haben zufällig im Gebüsch die Füße von der Frau entdeckt.« Er deutete zum Fundort.
Ja, dachte Sabine, die kann man gar nicht übersehen, die hellblauen Wanderschuhe. »Sind sie näher rangegangen?«, fragte sie.
»Angeblich nicht«, antwortete Attila.
»Aber du.«
Attila schwieg und senkte den Blick. Sabine verdrehte die Augen. Das reichte bei Attila als Vorwurf, so gut kannte sie ihn.
»Was machen die Burschen bei diesem Sauwetter hier?«, fragte sie weiter, einfach, um gegen die gespenstische Stille im feuchten, halbdunklen Wald anzureden. Kaum Vogelgezwitscher, kein Verkehr auf der Landstraße, und das am Nachmittag.
»Was Jungs halt so machen, weißt schon«, sagte Attila und vermied es, sie anzusehen.
»Nee, Attila, weiß ich nicht, ich war nie ein Junge«, sagte Sabine.
»Na ja, also …«, stammelte Attila.
»Du hast sie gar nicht gefragt.«
Nach einem Jahr mit Attila an ihrer Seite hatte Sabine eher gemischte Gefühle dem jungen Kollegen gegenüber. Attila war sympathisch, clever und verdammt engagiert. Er dachte mit und übernahm Verantwortung bei den Aufgaben, die in ihrem kleinen, harmlosen Wirkungskreis so anfielen. Aber es war genau das eingetreten, wovor Sabine den jungen Mann damals gewarnt hatte. Er war unterfordert, langweilte sich, wollte mehr Action. Das alles konnte Sabine ihm nicht bieten. Und was sie ihm erst recht nicht bieten konnte, war Zuneigung oder mehr. Seine teeniehafte Verknalltheit äußerte sich immer häufiger in einer hündischen Ergebenheit, die schon peinlich war. Attila wollte nicht nur alles richtig machen, er wollte alles so erledigen, dass Sabine beeindruckt war. Das konnte ja nur schiefgehen.
Attila sah gut aus mit seinen rabenschwarzen Haaren, dem gepflegten, kurz geschnittenen Vollbart und den freundlichen braunen Augen. Seit sie ihn vor drei Jahren kennengelernt hatte, war er vom Jungen zum Mann geworden, hatte auch reichlich Muskeln aufgebaut. Vermutlich ging er irgendwo im Studio pumpen oder stemmte in seinem kleinen Appartement in Gartow jeden Abend Gewichte. Aber das reichte nicht, um Sabine zu erobern. Was glaubte der Junge, was Sabine suchte? Einen netten Kerl? Sabine hatte sich von Männern in den letzten Jahren weitgehend ferngehalten. Im Urlaub im vergangenen Jahr im Club Robinson in Griechenland war dieser gutaussehende Typ, mit dem sie Spaß gehabt hatte. Mehr nicht. Und mit ihrem Ex, dem Lehrer Harald – Sport und Englisch – aus Lüneburg, hatte es einen dreiwöchigen Rückfall gegeben. Es war eine gute Zeit gewesen, bis Harald wieder anfing Forderungen zu stellen, zu klammern. Das waren Männer: eigenständig, einigermaßen reif, leider auch anstrengend. So ein Mann zu sein, davon war Attila weit entfernt. Und wenn Sabine einen Mann suchen würde, dann bestimmt keinen Polizisten.
Bevor das nutzlos und schweigend im Nieselregen Stehen unangenehm werden konnte, rauschten die Kollegen an. Schon von Weitem war der Tross auf der Landstraße zu erkennen.
Zwei Zivil-PKW, ein Sprinter der Spurensicherung und ein Leichenwagen. Dahinter, als würde er dazu gehören, ein PKW mit dem Logo der Lüneburger Stimme mit zwei hungrigen Reportern an Bord. Lungern die eigentlich den ganzen Tag vor der Polizeidirektion rum, um sich im richtigen Moment an eine Einheit dranzuhängen, fragte sich Sabine.
»Die sollen verschwinden«, sagte Sabine zu Attila und deutete auf das Auto der Reporter. Attila sprintete los, und augenblicklich schämte sich Sabine dafür, wie selbstverständlich sie inzwischen die Ergebenheit des Kollegen ausnutzte.
Blitzartig wurde der ruhige Waldweg zu einem Tummelplatz kriminalistischer Experten. Paravents wurden aufgestellt, um den Blick der Reporter und der vorbeifahrenden Autofahrer auf das Geschehen zu versperren. Fotos und Videos wurden gemacht. In weiß gewandete Menschen huschten Waldelfen gleich zwischen den Bäumen umher. Es war lange her, dass Sabine einen solchen Einsatz miterleben durfte. In solchen Momenten kam sie sich als Dorfpolizistin ganz schön klein vor. War es nicht völlig schräg, dass sie den Weitergang ihrer Karriere von der Lebenszeit ihres Vaters abhängig machte? Was, wenn er 100 würde? Dann wäre sie 50, wenn sie Gartow verlassen konnte, zu alt für die Kripo in Lüneburg oder das LKA in Hannover.
»Na, wenn das keine Freude ist«, riss eine Frauenstimme Sabine aus ihren Gedanken. Sie drehte sich um und blickte in ein vertrautes Gesicht.
»Melanie«, sagte Sabine und war nicht sicher, ob sie sich freuen oder ärgern sollte. »Das ist ja schön. Wie geht es dir? Siehst gut aus.«
»Und du erst. Das ruhige Leben hier in der Wildnis bekommt dir offenbar gut. Und sexy Kollegen hast du auch.« Melanie deutete mit dem Kopf auf Attila, der etwas verloren zwischen den dynamischen Beamten herumtippelte. Sabine verdrehte die Augen.
Melanie Gierke – unter Kollegen, und wenn sie es nicht hörte, EmGee genannt – war Hauptkommissarin bei der Kripo in Lüneburg. Drei Jahre zuvor hatte sie mit Sabine zusammen den Fall von mehreren Toten in einem nahegelegenen Gehöft aufgeklärt. Es war eine verzwickte Geschichte, in der ein verstörtes Kind und ein irrer Guru vorkamen. Damals durfte Sabine nicht nur an der Erfahrung und Professionalität der nun 46-jährigen Kollegin teilhaben, sondern nebenbei viel zu tief in deren Abgründe blicken. Melanie war zu der Zeit nicht ganz trockene Alkoholikerin, nahm Antidepressiva und Schmerzmittel und schwankte in ihrer kriminalistischen Performance zwischen rabiatem Supergirl und bedauernswerter Bahnhofspennerin. Sabine hatte Melanies Abstürze gedeckt, die im Gegenzug übersah, dass Sabine in den Ermittlungen eine Menge Regeln verletzte.
Sabine würde nicht behaupten, dass sie Freundinnen geworden wären. Melanie hatte auch dringend von einer solchen Verbindung abgeraten und sich selbst als toxische Freundin bezeichnet, womit sie sicher ganz richtiglag. Sabine hatte ihr empfohlen, sich in Therapie zu begeben. Ob sie das je getan hatte, wusste sie nicht. Seit dem Ende der Ermittlungen hatten die beiden Frauen nichts mehr voneinander gehört. Im Prozess um den Fall war Sabine nicht als Zeugin geladen gewesen. In den ersten Monaten hatte Sabine manchmal noch den Impuls gehabt, Melanie anzurufen, zu fragen, wie es ihr ging. Doch sie hielt es für unangemessen als die Jüngere und Rangniedrigere. Irgendwann hatte sie Melanie dann fast vergessen.
Die Kommissarin sah gut aus. Die Haare ein wenig länger, aber immer noch schwarz und stachelig gestylt, sie hatte abgenommen, das stand ihr. Vor drei Jahren hatte sie allerdings auch immer gut ausgesehen, wenn die Tagesform es zuließ und sie Zeit fürs Styling gehabt hatte. Sabine hatte Melanie jedoch auch völlig derangiert erlebt, wie um zehn Jahre gealtert.
»Und?«, fragte Melanie, offenbar entschlossen keine Wiedersehensfeier abzuhalten und über alte Zeiten zu plaudern, sondern an die Arbeit zu gehen. »Was ist Schreckliches passiert im dunklen wendländischen Forst?«
»Ältere Frau, zwei Teenager haben sie gefunden«, berichtete Sabine.
»Erdrosselt«, warf Attila ein, der sich angeschlichen hatte.
»Ach ja?«, fragte Melanie und blickte Attila durchdringend an. »Haben Sie die Tote bereits eingehend untersucht?«
Attila zuckte zusammen. »Nein, natürlich nicht. Ich habe nichts angefasst. Wir haben auf Sie gewartet.«
Ein Beamter der Spurensicherung sprach Melanie an. »Es macht den Eindruck, als sei der Körper vom Waldweg zum Gebüsch geschleift worden. Spuren am Boden weisen darauf hin. Es ist hier aber auch ganz schön herumgetrampelt worden, scheint mir.«
Melanie sah Attila und Sabine vorwurfsvoll an. »Der Kollege hat sich kurz vergewissert«, bemühte sich Sabine um eine Erklärung, die weder sie noch Attila als Trottel dastehen ließ, »dass die Person wirklich tot ist. Sonst ist niemand dort herumgelaufen.«
»Wo ist Bozetti?«, fragte Melanie den Spurensicherer.
»Da kommt er«, sagte der Beamte und deutete auf einen silberfarbenen BMW, der gerade von der Landstraße in den Waldweg einbog. Dr. Antonio Bozetti, das wusste sogar Sabine, war der Rechtsmediziner in Lüneburg, der schon mehrfach im Zusammenhang mit spektakulären Fällen in den Medien aufgetaucht war. Auch aus Hamburg und Hannover wurde der angesehene Forensiker angefordert. Der Mann war um die 60 und trug immer Dreiteiler mit Fliege. Auch am Tatort. Sein Wagen wurde an diesem Tag von einem jungen Kollegen gesteuert, vermutlich sein Assistent. Über Bozetti wurde in Polizeikreisen mit anzüglichem Grinsen erzählt, dass seine allesamt männlichen und attraktiven Assistenten ihrem Chef nicht nur bei der Arbeit zur Hand gingen. Sabine kannte über fast jeden einigermaßen namhaften Menschen bei der lokalen Polizei eine Geschichte, in der es um Schrullen, Geheimnisse oder sexuelle Vorlieben ging. Die wenigsten stimmten.
Melanie winkte Bozetti und forderte ihn auf, sich der Gruppe anzuschließen. Der Assistent blieb im Wagen.
Der Beamte von der Spurensicherung ging voraus, und Melanie und Sabine folgten. Auch Attila machte sich auf den Weg, doch Melanie gebot ihm mit einem Handzeichen, zurückzubleiben. Sabine hatte eigentlich erwartet, ebenfalls ausgeschlossen zu werden. Das war ein Fall für die Kripo, nicht für sie. Die Dorfsheriffs durften bestenfalls Kaffee holen, wenn er gewünscht wurde. Wollte Melanie sie nun dabeihaben?
Auf dem Weg zu der Toten gab der Beamte noch ein paar Erkenntnisse preis. »Es spricht vieles dafür, dass die Tote in einem Auto bis hierher transportiert wurde, aber nach Reifenspuren brauchen wir gar nicht zu suchen – zu nass und zu viele andere Fahrzeuge.« Er deutete auf den Streifenwagen, mit dem Attila gekommen war. Sollte das wieder ein stiller Vorwurf an die Dorfdeppenkollegen sein, fragte sich Sabine. Wenn der Streifenwagen dort nicht gestanden hätte, hätte der Spusi-Transporter doch da gehalten. Also alles Deppen. Aber da Melanie die Bemerkung nicht kommentierte, schwieg Sabine ebenfalls.
Sie traten hinter den Paravent und dort lag, zur Hälfte vom Gebüsch verdeckt, die Tote. Unspektakulär, wie Sabine fand. Kein Blut, kein Tierfraß, keine Verwesung. Sie hatte schon Schlimmeres gesehen, viel Schlimmeres.
Dr. Bozetti, der keinen Schutzanzug trug, hockte sich neben den Körper. An den Sohlen seiner blank polierten schwarzen Halbschuhe klebte reichlich Waldboden. Er hatte Latexhandschuhe übergezogen und befühlte Arm, Gesicht und Nacken der Toten.
»Ausgeprägte Leichenstarre«, murmelte er in sein Handy.
»Also?«, fragte Melanie.
»Mindestens acht Stunden tot, höchstens zwei Tage. Genauer gebe ich es Ihnen jetzt nicht.« Bozetti wandte sich an die Männer der Spurensicherung: »Dann drehen wir sie mal um.«
Die Beamten hoben den Körper an Schultern und Beinen ohne große Anstrengung an.
»Oh, was ist das?«, fragte Melanie, als der leblose Körper einen halben Meter über dem Boden schwebte. »Legt sie auf die Seite.«
Unter der Leiche war der Waldboden aufgewühlt, eher aufgegraben. Ein Rechteck, etwas größer als die Tote.
Die Männer ließen die Frau neben diesem Rechteck auf den Boden sinken und drehten sie dabei um. Das blaugraue Gesicht der Toten war verklebt von Erde. Die Augen waren geschlossen, der Mund halb geöffnet, die Zunge trat blau und dick heraus. Um den Hals war eine dünne blaue Schnur gewickelt. Bei genauerem Hinsehen erkannte Sabine, dass es ein Kabel war, ein USB-Kabel, ein Ladekabel für ein Handy oder Ähnliches.
»Da hat wohl jemand angefangen, ein Grab zu schaufeln«, sagte Melanie und hockte sich über die nur wenige Zentimeter tiefe Öffnung.
»Er ist aber nicht weit gekommen«, sagte Bozetti.
»Vielleicht, weil er nur diesen Spaten hatte«, rief einer der Beamten aus zehn Meter Entfernung und reckte eine vermoderte Sperrholzplatte, 50 mal 50 Zentimeter groß, in die Luft. Er kam näher und hielt die Platte Melanie unter die Nase.
»Da«, sagte er und deutete mit dem Finger auf eine Kante der Platte, »da sind Stücke herausgebrochen, denn darunter ist das Holz hell. Das Brett modert vermutlich seit Monaten im Wald, aber diese Abbrüche sind ganz frisch. Und wenn du mal hier schaust«, er zeigte auf Riefen in der Erde, »dann passen diese Spuren bestens zu dem unpraktischen Grabwerkzeug.«
Melanie nickte anerkennend. »Er hat wohl auf die Schnelle nichts Besseres gefunden und die Lust verloren«, sagte sie.
»Also war er schlecht vorbereitet«, mischte sich Sabine ein, denn sie wollte ja nicht völlig blöd danebenstehen, »sonst hätte er einen Spaten dabeigehabt. Die Tat war nicht geplant.« Sabine war unsicher, wie Melanie ihren Vorstoß beantworten würde. Sie hatte die Kollegin als unberechenbar in Erinnerung.
»Entweder das«, sagte Melanie und sah Sabine an, ganz normal, nicht geringschätzig oder von oben herab, »oder er hatte zwar die Tat geplant, musste aber bei der Beseitigung der Leiche improvisieren.«
Dr. Bozetti hockte neben dem Kopf der Toten und fingerte an dem Kabel um ihren Hals herum. »Die Tatwaffe sieht nicht nach minutiöser Planung aus«, sagte er. »So was ergreift man spontan und wundert sich, dass es nicht reißt. Und dass das Tatwerkzeug noch am Opfer hängt, spricht ebenfalls gegen ein bedachtes Vorgehen. Hier hat jemand ganz schön chaotisch agiert, würde ich sagen.«
»Nun denn«, sagte Melanie und erhob sich erstaunlich mühelos aus der Hocke, »dann ist es wohl mal wieder Zeit für ein paar nette Tage im schönen Gartow. Sind Schulferien?« Sie lächelte Sabine an.
Bei den letzten Mordermittlungen, die Melanie Gierke in Gartow mal mehr, mal weniger geleitet hatte, hatte sie fast zwei Wochen im Hotel am See gewohnt. Die Turnhalle der Grundschule hatte dem Kripo-Team damals als Lagezentrum gedient.
»Nein, Melanie, die Kinder brauchen ihre Turnhalle. Aber wir finden ein Plätzchen für euch«, sagte Sabine.
»Ich kann also wieder auf dich zählen?«, fragte Melanie, als sie zurück zu den Fahrzeugen gingen, und Sabine musste sich zusammenreißen, dass sie ihr nicht begeistert um den Hals fiel.
»Klar, ist ja mein Job«, murmelte sie nur.
Eine Stunde später standen Melanie und Sabine im Festsaal der Wendland-Schänke, einem Gasthof mit wenigen Zimmern im Zentrum von Gartow, und sahen sich um. Der Raum lag im hinteren Teil des Gebäudes und bot, je nach Bestuhlung, Platz für 200 Personen. Es gab einen Tresen und an einer Wand befand sich sogar eine kleine Bühne. Auf dem glänzenden Parkettboden standen wie hingewürfelt gut 20 Stühle. Weitere stapelten sich neben Tischen an einer fensterlosen Wand.
»Und du kannst echt noch nicht genau sagen, wie lange ihr den Raum braucht?«, fragte Daniel Faßbender, der Sohn der Wirtsleute, Sabine. »Wir haben in drei Wochen eine Hochzeit, der älteste Sohn vom Schmölder …«
»Da machen Sie sich mal keine Sorgen, junger Mann«, unterbrach ihn Melanie. »In ein paar Tagen sind wir wieder raus. Wenn Sie uns vielleicht vier, fünf Tische hinstellen, wir brauchen Steckdosen. Was ist mit WLAN …?« Melanie wurde vom Klingeln ihres Handys unterbrochen. Sie nahm ab.
»Verstehe«, sagte sie, »gut, schicken Sie es.« Sie beendete das Gespräch. Das Handy brummte, Melanie sah aufs Display und hielt es Daniel Faßbender unter die Nase. Der schreckte zurück.
»Schon mal gesehen?«, fragte sie den jungen Mann. Sabine sah nun, was Daniel so verschreckt hatte. Ein Foto vom Gesicht der Toten, nur notdürftig gesäubert, rund um den Kopf Waldboden, um den Hals das dunkle Kabel.
»Äh, nein«, stammelte Daniel. Es fiel ihm schwer, das Bild länger zu betrachten.
»Keine Papiere?«, fragte Sabine Melanie. Die schüttelte den Kopf. »Schick mir das Bild. Ich lasse Attila mal durchs Dorf laufen, ob jemand die Lady gesehen hat.«
»Okay«, sagte Melanie und zeigte das Foto erneut Daniel. »Schauen Sie bitte noch mal. Wirklich nicht gesehen?«
»Nein«, sagte Daniel und sah Sabine hilfesuchend an.
»Sag mal, habt ihr vielleicht ein Zimmer frei für die Kollegin?«, fragte Sabine den Wirtssohn und lenkte geschickt vom Mordopfer ab.
»Ja«, sagte Daniel und lächelte, »wir haben sogar sechs Zimmer frei, also alle. Ich gebe Ihnen das schönste und ruhigste«, sagte er zu Melanie.
Die beiden Frauen setzten sich in den Gastraum und bestellten Essen. Daniel empfahl einen Rinderbraten, den er frisch gemacht hatte. Der gutaussehende blonde junge Mann, Typ kalifornischer Surfer, arbeitete erst seit einem knappen halben Jahr wieder im elterlichen Betrieb. Vorher war er ein Jahr als Koch auf einem Kreuzfahrtschiff mitgefahren. Es schien ihm an Land zu gefallen, und seine Mutter war froh, ihn bei sich zu haben.
Attila rief an.
»Ja, mein Junge?«, säuselte Sabine ins Telefon, wobei sie Melanie verschwörerisch angrinste.
»Nenn mich bitte nicht ›mein Junge‹. Was soll ich mit dem hübschen Foto, das du mir geschickt hast?«
»Das sollst du bitte im Ort rumzeigen. Tankstellen, Cafés, Geschäfte, du weißt schon. Vielleicht hat sie jemand in den letzten Tagen gesehen. Und wenn du schon durch den Ort fährst, kannst du auch schauen, ob dir irgendwo ein verdächtiges einsames Auto auffällt.«
»Was für ein Auto?«, fragte Attila, und es klang etwas hilflos.
»Keine Ahnung. Ein Auto halt, ich weiß weder Farbe noch Marke, ich …«, sagte Sabine.
»Hatte sie denn ein Auto? Oder waren da Papiere, ein Schlüssel bei der Toten?«, fragte Attila.
»Kein Schlüssel, keine Papiere. Aber wenn die Frau nicht von hier ist, muss sie ja irgendwie hergekommen sein …«
»Sie kann doch bei jemandem im Auto mitgefahren sein. Vielleicht bei ihrem Mörder.«
»Ja, Attila«, sagte Sabine genervt von diesem Gespräch. »Halt einfach die Augen offen.«
Sabine legte auf und nahm einen tiefen Schluck von dem Bier, das Wirtin Irene ihr in der Zwischenzeit serviert hatte. Melanie trank eine Cola. Die trockene Alkoholikerin war offenbar inzwischen wirklich trocken. Oder Sabine sollte das denken. Zu gerne hätte sie sich nach Melanies Gesundheitszustand erkundigt, traute sich aber nicht.
»Ist was?«, fragte Melanie, als sie ihr Glas abstellte.
»Nö«, sagte Sabine. »Was soll sein?«
Kapitel 3
Sabine blickte auf ihr Handy. 1 Uhr. Und jemand klingelte Sturm. Vermutlich war Papa, der sein Schlafzimmer im Erdgeschoss hatte, längst wach und auf dem Weg zur Tür, um die Nervensäge zu beschimpfen. Nein, Unsinn, Papa war ja noch im Krankenhaus. Also musste Sabine wohl oder übel selbst nachsehen.
Schon auf der Treppe sah sie durch die Milchglasscheibe, wer ihr mitten in der Nacht die Aufwartung machte. Mittelgroß, breite Schultern. Polizeimütze.
»Attila«, sagte Sabine, während sie die Tür öffnete, »was soll das? Warum rufst du nicht an?«
»Habe ich«, sagte er und grinste selbstbewusst. »Aber du gehst ja nicht dran. Dein Handy steht bestimmt wieder auf ›Bitte nicht stören‹.«
Da hatte er recht. Sabine nutzte diese Einstellung seit längerer Zeit, weil sie nicht von jeder unwichtigen WhatsApp-Nachricht gestört werden wollte.
»Was gibt’s?«
»Ich habe das Auto gefunden, also glaube ich jedenfalls.«
»Was? Wieso? Woher weißt du …?« Sabine war noch nicht ganz wach.
»Lass uns hinfahren«, sagte Attila und trippelte aufgeregt von einem Bein aufs andere. »Unterwegs erzähle ich dir alles.«
»Darf ich mir vorher was anziehen?«, fragte Sabine und ging die Treppe hoch. Attila wartete im Hausflur.
»Hast du Melanie schon angerufen?«, rief sie nach unten, während sie in ihre Uniform schlüpfte.
»Geht auch nicht dran. Sie ist wohl gestern Abend noch mal weggefahren«, sagte Attila.
»Woher weißt du das denn, Sherlock?«, fragte sie, als sie die Treppe herunterkam.
»Hat Daniel mir erzählt. Der hat sie zufällig gesehen.«
Sie stiegen in den Streifenwagen und Attila raste in westlicher Richtung aus Gartow heraus.
»Sag mal«, fragte Sabine Attila, »wo fährst du eigentlich hin? Hast du den Wagen in der Nähe der Toten gefunden?«
»Nein, nicht so richtig. Eigentlich weit weg. Ich schätze, fünf Kilometer Luftlinie.«
Sie bogen von der Hauptstraße in eine schmale Nebenstraße ein, die Attila mit unverminderter Geschwindigkeit nahm.
»Saß jemand drin in dem Auto?«, fragte Sabine.
»Nee.« Attila sah sie verwundert an. »Wieso?«
»Weil du so bretterst. Das Auto fährt uns nicht weg.«
Er wurde langsamer, viel langsamer, bog in einen Waldweg ein und blieb stehen.
»Da isser«, sagte er und lächelte stolz.
Im Scheinwerferlicht des Streifenwagens, keine zehn Meter entfernt, stand ein weißer Kleinwagen, ein Škoda.
»Äh«, Sabine konnte ihre Verwunderung nicht verbergen, »wie kamst du darauf, hier zu suchen, am Arsch der Welt, mitten im Wald?«
»Ich habe nicht gesucht. Ich habe gefunden. Ich war auf dem Weg nach Trebel, um dort im Birkenkrug zu fragen, ob jemand die Frau gesehen hat. Da ist um die Zeit oft noch was los. Und wie ich da über die Landstraße fahre, sehe ich zufällig was Rotes im Wald aufblitzen. Da habe ich wohl kurz das Rücklicht dieses Wagens angeleuchtet. Ich bin also zurück und habe mir das näher angeschaut. Bingo.«
Sabine nickte ihm anerkennend zu. Attila ließ den Streifenwagen ein Stück näher an den Škoda rollen.
»Stopp«, sagte Sabine. »Denk an die Spuren. – SAW«, las sie vom Kennzeichen ab. »Salzwedel. Das ist nur eine halbe Stunde entfernt.«
»Martina Breesen«, sagte Attila.
»Was?« Sabine sollte in dieser Nacht aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen.
»Halterabfrage geht ja schnell. Martina Breesen aus Salzwedel.«
»Und? Was weißt du über sie?«, fragte Sabine und war auf alles gefasst.
»Na, nichts«, sagte er und grinste. »So schnell bin ich dann doch nicht. Vielleicht ist sie unser Opfer, vielleicht hat sie den Wagen verliehen. Vielleicht hat der Wagen auch gar nichts mit unserer Toten zu tun. Als gestohlen gemeldet ist er nicht.«
Während sie im kalten, nächtlichen Wald auf das Eintreffen der Spurensicherung warteten, konnte Sabine noch herausfinden, dass diese Martina Breesen nicht als vermisst gemeldet war. Eine Festnetz- oder Handynummer der Frau war allerdings nicht so einfach zu ermitteln.
»Das dauert mindestens eine Stunde, bis die Spusi hier ist«, sagte Sabine, während sie vorsichtig und mit großem Abstand um den Škoda herumging. Vor allem war die Frage zu klären: Wer hatte den Wagen dort abgestellt? Seine Besitzerin, die dann gut fünf Kilometer Luftlinie von diesem Ort entfernt, tot aufgefunden worden war? Oder ihr Mörder, der sich nach der Tat mit dem Fahrzeug vom Tatort entfernt hat? Eine weitere Möglichkeit war, dass der Fundort nicht der Tatort war und der Täter die Tote mit diesem oder mit einem anderen Fahrzeug an den Fundort gebracht hat. Dort hat er offensichtlich versucht, die Leiche zu vergraben, was er aber, aus welchen Gründen auch immer, abgebrochen hatte.
Viele dieser Fragen würde der alte Škoda beantworten, wenn man ihn nach allen Regeln moderner Forensik befragte.
Mit der Spurensicherung traf auch Melanie Gierke ein, erstaunlich gut gestylt und in quietschgelben Gummistiefeln.
»Du hast dich unseren Bedingungen ja bestens angepasst«, sagte Sabine und deutete auf die Stiefel. Melanie lächelte nur.
Sabine berichtete der Kollegin knapp, was sie über Fahrzeug und Halterin wusste. Währenddessen sicherten die Beamten in ihren weißen Overalls Reifenspuren sowie Verschmutzungen am Fahrzeug und machten sich anschließend daran, das Auto zu öffnen. Es dauerte nur wenige Sekunden.
»Was ist hier in der Nähe?«, fragte Melanie. »Ist da hinten nicht irgendwo dieser Hof, auf dem wir so eine schöne Zeit hatten?« Sabine staunte über das gute Orientierungsvermögen der Kollegin.
»Schöne Zeit, klar«, sagte Sabine. Sie hatte den Fall rund um diesen Hof und die Sekte als ziemlich grauenhaft in Erinnerung.
»Ja«, sagte Attila, während er Google Maps auf seinem Handy studierte. »Etwas über einen Kilometer Luftlinie ist es bis zu dem Hof. Aber mit dem Auto muss man einen Riesenbogen fahren und dann ist das auch gar nicht so leicht zu finden. Zu Fuß durch den Wald geht man vielleicht eine Viertelstunde.«
»Was ist da jetzt auf diesem Hof?«, fragte Melanie.
»Da zieht ein alter Bekannter von uns ein«, sagte Sabine.
»Hä?« Melanie sah sie verwirrt an. »Haben wir gemeinsame alte Bekannte?«
»Naturbelassen e. V.«, sagte Sabine und war gespannt, ob es bei Melanie klingelte.
»Ach«, rief Melanie. »War das nicht dieser ominöse Verein aus Lüneburg? Andreas …«
»Schmidt«, half Sabine, »genau dieser Club. Die werden jetzt unsere Nachbarn. Halleluja.«
Mit dem Verein Naturbelassen e. V. hatten Melanie und Sabine bei ihrem letzten gemeinsamen Fall zu tun gehabt. Einer der Männer, die in den 80er-Jahren in dem alten Wendland Hof in einer obskuren Sekten-Kommune gelebt hatte, hatte später diesen Verein gegründet und ihm zu einiger Bedeutung verholfen. Naturbelassen e. V. hat sich die Reinhaltung der Natur zum Ziel gesetzt. Die Mitglieder nehmen Artenschutz wörtlich und halten es für ökologisch bahnbrechend, wenn nur Pflanzen und Tiere in Mitteleuropa kultiviert und gezüchtet werden, die es auch vor Jahrhunderten schon hier gegeben hat. Die ständige Vermischung der heimischen Arten mit exotischen Varianten ist nach Meinung des Vereins ebenso von Übel wie Gentechnik. Man spricht auf Informationsveranstaltungen und in Broschüren offen von Naturschutz als Heimatschutz und hinter vorgehaltener Hand auch von »völkischer Landwirtschaft«. Und so werden alte Getreidesorten und Schweinerassen rückgezüchtet, Wälder renaturiert, und es wird viel Forschung betrieben. Der Verein kauft große Flächen, um sie im Sinne von Naturbelassen e. V. zu bewirtschaften oder eben verwildern zu lassen – je nachdem. Das Geld dafür stammt maßgeblich von privaten Großspendern. Die Bio-Bauernverbände und Öko-Label diskutieren bereits Abwehrstrategien gegen die Unterstützung von ganz Rechts.
Melanie und Sabine hatten im Gespräch mit dem sehr smarten und charismatischen Andreas Schmidt damals den Eindruck gewonnen, dass es dem Verein bei Weitem nicht nur um die Reinheit von Pflanzen und Tieren ging, sondern vor allem um die »Reinheit der Bevölkerung«, was auch immer man sich darunter vorstellen möchte. Das Einwandern sogenannter »fremder Gene« empfanden Mitglieder des Vereins auch bei Menschen als schädlich. Naturbelassen e. V. war gut darin, diesen Anspruch so zu verbrämen, dass er nicht offen rassistisch klang.