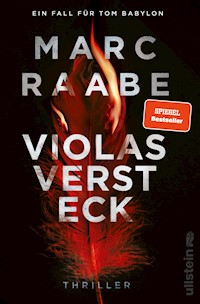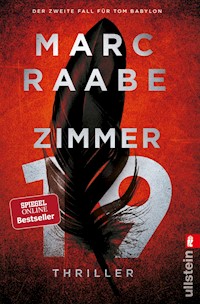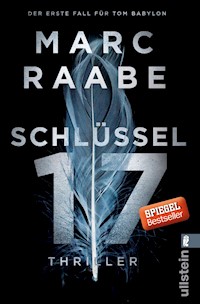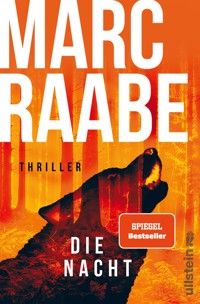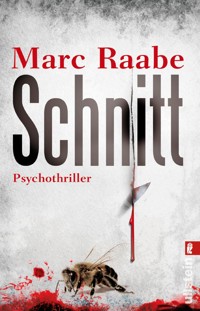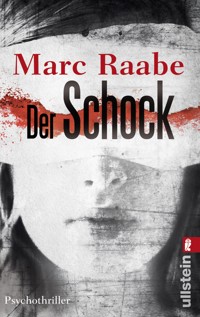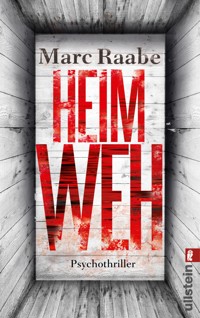10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ich habe mit dem Leben bezahlt. Mit deinem. Im Königswald wird eine bizarr arrangierte Leiche gefunden, halb Mensch, halb Tier. Art Mayer und Nele Tschaikowski identifizieren die Tote als Charlotte Tempel – eine gefeierte Wohltäterin, bei allen beliebt und für den wichtigsten Medienpreis des Landes nominiert. Schnell gerät Tempels 21-jährige Tochter unter Verdacht: Leo ist rebellisch, unberechenbar und zeichnet ein ganz anderes Bild ihrer Mutter. Doch Art Mayer zweifelt an ihrer Schuld. Bis eine zweite Frau aus dem Kreis der Nominierten stirbt. Zunächst deutet nichts auf Leo, doch dann taucht ein mysteriöses Tonband mit belastendem Inhalt auf. Wer ist Leo – ein Opfer der Umstände? Oder die jüngste Serientäterin von Berlin, unterwegs zu ihrem dritten Opfer? »Marc Raabe hat wieder einen spannenden, nervenzehrenden Krimi geschrieben! Kaum ist die erste Seite gelesen, gerät man in einen unbändigen Strudel, dem man nicht mehr entkommt. Eine schlaflose Nacht ist garantiert.« Andreas Wallentin, WDR
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Dämmerung
Marc Raabe hat eine TV- und Medienproduktion aufgebaut, bevor er sich 2021 für ein Leben als Autor entschied. Zu diesem Zeitpunkt begann er mit der Art-Mayer-Serie. Raabes Bestseller erscheinen in mehr als zehn Sprachen. Sein Handwerkszeug sind filmisches Erzählen, Schnitttechniken, Cliffhanger und Psychologie. Das Ergebnis: ein rasantes Kopfkino mit Tiefe. So wie seine Ermittlerfiguren bricht auch Marc Raabe hin und wieder Regeln.
Ich habe mit dem Leben bezahlt. Mit deinem.Im Königswald wird eine bizarr arrangierte Leiche gefunden, halb Mensch, halb Tier. Art Mayer und Nele Tschaikowski identifizieren die Tote als Charlotte Tempel – eine gefeierte Wohltäterin, bei allen beliebt und für den wichtigsten Medienpreis des Landes nominiert.
Schnell gerät Tempels 21-jährige Tochter unter Verdacht: Leo ist rebellisch, unberechenbar und zeichnet ein ganz anderes Bild ihrer Mutter. Doch Art Mayer zweifelt an ihrer Schuld.
Bis eine zweite Frau aus dem Kreis der Nominierten stirbt. Zunächst deutet nichts auf Leo, doch dann taucht ein mysteriöses Tonband mit belastendem Inhalt auf. Wer ist Leo – ein Opfer der Umstände? Oder die jüngste Serientäterin von Berlin, unterwegs zu ihrem dritten Opfer?
Marc Raabe
Die Dämmerung
Thriller
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024
Alle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotive: imageBROKER.com GmbH & Co. KG / Alamy Stock Foto, FinePic®, München
Autorenfoto: © Hans Scherhaufer
E-Book-Erstellung powered by pepyrus
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Bell & Bo
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
LEO
Kapitel 4
LEO
Kapitel 5
Kapitel 6
Bell & Bo
Kapitel 7
Bell & Bo
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Bell & Bo
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Bell & Bo
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Bell & Bo
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Bell & Bo
Kapitel 22
Kapitel 23
Bell & Bo
Kapitel 24
Kapitel 25
Bell & Bo
Kapitel 26
Bell & Bo
Kapitel 27
Kapitel 28
Bell & Bo
Kapitel 29
Bell & Bo
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Bell & Bo
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Epilog
Dank
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Bell & Bo
Widmung
Für alle, die Gerechtigkeit wollen.
Bell & Bo
Gerechtigkeit? Ha! Schön wär’s. Aber – was ist schon gerecht, wenn’s ums Überleben geht?
Zum ersten Mal in meinem Leben hätte ich am liebsten die ›Ich bin doch nur ein Mädchen‹-Karte gezogen und gefragt, ob das hier nicht bitte jemand anders machen kann.
Aber es hörte ja sowieso niemand zu.
Ich war mutterseelenallein in einem fremden Land, in einer Klosterkirche irgendwo südlich der Sierra de Gredos. Die Zikaden lärmten da draußen in der Dämmerung, als wollten sie mich jetzt schon anklagen. Dabei lag das Schlimmste noch vor mir. Ich konnte nicht zurück, und kneifen ging auch nicht.
Meine Mutter kam immer, wenn’s mal eng bei mir wurde, mit irgendwelchen schlauen Sprüchen um die Ecke. Aber meine Mutter war nicht hier. Überhaupt, meine Mutter hatte mich erst so richtig in die Scheiße reingeritten – entschuldige, aber anders kann ich’s echt nicht nennen. Vermutlich würde sie jetzt so was raushauen wie: »Tja, Schätzchen. Wer A sagt, muss auch B sagen …«
Und ich hatte vorhin verdammt noch mal A gesagt.
O Gott. Musste ich das wirklich tun?
Ich starrte auf das letzte Streichholz. Es lag lose in dem schwarzen Metallkästchen. Die Reibefläche war an dem schmiedeeisernen Kerzenständer mit seinen vielen leeren Halterungen festgeklebt. Meistens brannten hier ein paar Kerzen. Aber an diesem Tag nicht eine einzige.
Ich zögerte.
Die vorletzte rote Linie.
In der Kirche war es so trügerisch still. Nicht so wie draußen, wie gerade eben noch, mit all diesen hässlichen Geräuschen. Hier drinnen war kein Laut, kein Luftzug! – nur mein Atem war zu hören, der sich einfach nicht beruhigen wollte.
Wer A sagt, muss auch B sagen.
Das klingt so leicht. So schön logisch, oder? Als könnte ich all meine Ängste und mein rasendes Herz aus der Gleichung streichen. Aber was, wenn A schon ein Albtraum ist und ich für B in die Hölle komme? Oder ins Gefängnis.
Verurteil mich nicht, ich bitte dich. Nicht, bevor du dir alles angehört hast, die ganze Kassette.
Hätte ich etwas anders machen können? Ich meine, noch vor dem A?
Dumme Frage. Na klar, hätte ich. Es hatte ja schon mit dem Sex angefangen. Und jetzt stand ich da, mit meinem Bauch und dir darin.
Auf A folgt B.
Ich riss das Streichholz an.
Mein Atem ging stoßweise und kam als Echo von der hohen Decke der Kirche zu mir zurück, als würde Gott flüstern: Hör auf. Hör auf!
Aber wenn’s um Gott ging, wollte ich nicht zuhören. Ich fand, ER war erst mal an der Reihe mit Zuhören. Oder besser: mit ein wenig Hilfe für mich.
Dann zündete ich eine Kerze an und schüttelte das Streichholz aus. Der trockene Docht knisterte leise. Ich starrte in die kleine Flamme. Das Blut rauschte in meinen Ohren, und meine nackten Füße brannten von all den spitzen Steinchen draußen, weil ich gerannt war, ohne jede Rücksicht. Mein Babybauch wölbte sich unter dem Nachthemd und tat weh.
Du warst so merkwürdig still. Als wolltest du es mir nicht noch schwerer machen. Als wüsstest du, dass ich eigentlich selbst noch ein halbes Kind war, viel zu jung für all das hier.
Die Uhr tickte, doch ich zögerte immer noch, sah nach oben ins Kreuzgewölbe, wo sich das letzte fahle Licht verlor. Das Monasterio de la Vera verschwand in der Dunkelheit. Die Kronleuchter waren aus, die gespenstisch ruhig brennende Kerze der einzig helle Fleck. Vela de sacrificio, Opferkerze, stand von Hand geschrieben auf dem Karton, aus dem ich sie genommen hatte. Wenn das hier der Moment für ein letztes Gebet war, dann eins für dich.
Dafür, dass du überlebst.
Darf man auf Hilfe hoffen, wenn man so viel falsch gemacht hat?
Ich hastete die Stufen zum Altar hinauf, stellte das goldene Kreuz beiseite, riss die bestickte Tischdecke herunter. Staub wirbelte auf. Sie war knochentrocken. Gut so.
Ich drehte aus der Tischdecke ein Seil. Dann nahm ich die brennende Kerze aus dem Ständer, eilte zum Ausgang und schützte die Flamme mit meiner hohlen Hand, damit sie auf gar keinen Fall ausging.
Was ich vorhatte?
Ich würde ein Auto anzünden.
Ein Mofa stehlen.
Einen Mann sterben lassen.
Und beten, dass du lebst.
Prolog
Dunkelgraues Nichts.
Sophie Bauer ließ das Gewehr sinken. Kaum ein Laut war in der Dämmerung zu hören. Ein dünner Ast knackte unter ihrem Fuß. Ein leiser Flügelschlag, viele Meter über ihr. Dann ein hastiges Rascheln am Boden, eine Maus auf der Flucht, als fürchtete sie die junge Frau mit dem Gewehr. Sophie fand, dass es an ihr eigentlich nichts gab, was zum Fürchten war. Und wohl auch nichts, das sich zu lieben lohnte, dachte sie bitter. Zweiundzwanzig, wieder Single und an einem Freitagabend allein im Wald. Sie verbiss sich die Tränen. Das dichte Bett aus Moos und Kiefernnadeln ließ ihre Schritte federn. Wenigstens etwas, das sich ein wenig leicht anfühlte. Die Nacht zog herauf, es war überraschend kalt für Anfang September. Nebelschwaden strichen zwischen den dunklen Stämmen hindurch.
Von wegen Büchsenlicht, dachte Sophie. Ja, sie könnte noch den Dreck unter ihren Fingernägeln sehen, bei ausgestrecktem Arm – wenn da Dreck wäre. Oder einen roten von einem grünen Faden unterscheiden. Doch der Nebel machte die Faustregeln für ausreichendes Büchsenlicht nutzlos. Überhaupt: Büchsenlicht. Dass das immer noch so hieß. Sie hatte von Anfang an mit diesem Jägerkram gefremdelt. Eigentlich hatte sie den Jagdschein nur wegen Kai gemacht.
»Schatz, stell dir vor, wir ziehen in der Dämmerung los, allein, mitten im Wald, nur wir beide«, hatte er geschwärmt. »Du wirst sehen, diese Stille, das ist magisch.« Kai war neunundzwanzig, fast acht Jahre älter als sie. Kennengelernt hatten sie sich auf einem Grillabend, sowohl ihr Vater als auch Kais Vater waren Jäger, und sie hatte sich Hals über Kopf verliebt. Und jetzt, wo sie endlich den Jagdschein hatte, war Kai Geschichte.
Sie starrte in den Nebel. Das hier war nicht magisch, es war beängstigend. Eigentlich hatte sie heute mit ihrem Vater herkommen wollen, aber der hatte kurz vorher abgesagt, er sei krank und müsse ins Bett.
Warum war sie überhaupt hier?
Was wollte sie damit beweisen?
Dass sie auch allein jagen konnte? Dass es ihr nichts ausmachte, dass Kai sich vom Acker gemacht hatte? Doch, verdammt! Es machte ihr etwas aus. Auf dem Weg hierher hatte sie für einen kurzen, wütenden, dummen Moment gedacht, es würde ihr guttun, im Wald zu sein. Auf etwas zu feuern. Ihre Wut loszuwerden, indem sie etwas tötete. Und nun stand sie hier, umgeben vom Nebel. Als hätte Gott nicht gewollt, dass sie etwas schießt. Sie kam sich plötzlich so erbärmlich vor.
Seit sie denken konnte, hatte sie den Wald geliebt, diese tiefe Stille, diesen Frieden, das Licht in den Blätterkronen, die Farben im Herbst und die Gerüche. Zum Teufel mit Kai. Wie hatte sie nur auf die Idee kommen können, es wäre romantisch, mit ihm zusammen Tiere zu schießen? Sie schaute auf das Gewehr, und ihr kamen die Tränen. Das verfluchte Ding war ein Geschenk von ihm, und sie war auch noch so dumm, dieses Teil weiter mit sich herumzuschleppen. Wütend entlud sie es. Die Patrone sprang ins Moos, und sie warf die Waffe weit von sich. Sie wusste, sie würde sie wieder aufheben müssen, sie konnte ja schlecht eine Schusswaffe einfach im Wald liegen lassen. Doch allein dieser kurze Moment ohne das Scheißding fühlte sich an wie ein kleiner Sieg.
Sie lehnte sich mit dem Rücken an einen Baum. Ihr warmer Atem dampfte in der kühlen Luft.
Dann raschelte es hinter ihr. Irgendetwas kam näher, schnell, laut und vermutlich groß. Sie fuhr herum, und das Rascheln verstummte plötzlich. Kaum sechs Meter entfernt von ihr stand ein Wildschwein im Halbdunkel, umgeben von Nebelschwaden, ein ausgewachsener großer Keiler. Seine borstigen Ohren waren steil aufgestellt, seine kleinen Augen wie schwarze Murmeln.
Sophie starrte auf die kräftigen, aufwärts gerichteten Eckzähne, die aus dem Maul ragten. Wenn der Keiler angriff, waren sie ein tödliches Werkzeug. Wildschweine hatten die Eigenart, beim Sturm auf ihren Gegner den Kopf hin und her zu werfen, sodass die Hauer wie Säbel in alle Richtungen keilten. Oft genug wurden dabei Menschen an den Beinen schwer verletzt, erst kürzlich hatte sie in der Morgenpost einen Bericht über einen jungen Mann gelesen, der nach einem Keilerangriff im Wald verblutet und danach auch noch von der Rotte angefressen worden war.
Sophie sah rasch zu ihrem Gewehr, das etwa zwei Meter hinter ihr lag. Selbst wenn sie es erreichen konnte, zum Laden würde ihr keine Zeit bleiben. Hinter dem Keiler zeichneten sich die Umrisse von kleineren Wildschweinen ab. Waren das etwa Frischlinge? Die Furcht kroch ihr bis in die Haarspitzen.
Der Keiler grunzte, die Borsten auf seinem Rücken sträubten sich. Dann stürmte er unvermittelt auf Sophie zu. Verzweifelt sprang sie am nächstgelegenen Baum hoch, griff nach dem untersten Ast, schlang ihre Beine um den Stamm und zog sich hoch. Im nächsten Augenblick rammte der Keiler den Baumstamm, quiekte vor Schmerzen und rannte ein Stück weiter, drehte sich um und lief erneut auf Sophie zu. Hastig hangelte sie sich weiter empor, bekam auch mit der zweiten Hand einen Ast zu fassen und hing nun, die Beine um den Stamm geschlungen, mit ihrem Po etwa zwei Meter über dem Boden. Unter ihr lief der Keiler wütend grunzend hin und her. Keuchend vor Anstrengung zog Sophie sich weiter nach oben, bis sie schließlich ein Bein über den Ast bekam und sich darauf setzen konnte. Es war höllisch unbequem, aber immerhin war sie sicher. Vorläufig.
Der Keiler lief grunzend um den Baum herum. Nach einer Weile schien er das Interesse zu verlieren, und sein Radius wurde immer größer, bis er im Nebel verschwand.
Sophie atmete auf, wagte es jedoch nicht herunterzuklettern. Die Dämmerung schritt immer weiter fort, und die Bäume wurden zu schwarzen, undeutlichen Schatten. Über den Kronen schien ein Dreiviertelmond und goss bleiches Licht in den Bodennebel. Sie lauschte in die Stille hinein. Plötzlich erklang ein markerschütternder Schrei. Die Stimme der Frau ging ihr durch und durch.
Was um Himmels willen …?
Der Schrei verebbte, und es wurde still.
Jedes einzelne Härchen an ihrem Körper hatte sich aufgerichtet.
Wie weit entfernt war das wohl gewesen? Hundert Meter? Zweihundert? Hatte der Keiler etwa jemand anderen angegriffen? Dann brauchte die Frau dringend Hilfe. Sophie kletterte hastig vom Baum herunter, angelte sich ihr Gewehr und lud es mit zittrigen Fingern.
Die Waffe in ihren Händen fühlte sich plötzlich gut an.
Sie hielt sie schussbereit vor sich und lief in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war. Ihre Füße sanken im weichen Moos ein, die Sicht betrug vielleicht sechs, sieben Meter. Das Mondlicht brach in Streifen durch die Wipfel.
Zweiundvierzig, dreiundvierzig … Sophie zählte ihre Schritte.
»Hallo?«, rief sie zaghaft. »Geht es Ihnen gut?«
Keine Antwort. Nur wieder ein Flügelschlagen über ihrem Kopf und das Knacken von Zweigen unter ihren Sohlen.
Vierundneunzig, fünfundneunzig …
»Hallo?« Sophies Stimme verhallte im Nichts.
Wo war die Frau? Und wo der verdammte Keiler?
Nach hundertsiebenunddreißig Schritten blieb sie stehen. Hob das Gewehr. War da nicht was? Der Baumstamm nicht weit vor ihr sah irgendwie anders aus als die anderen. Unförmiger. Lag es daran, dass der Nebel alles verwischte? Mit dem Gewehr im Anschlag ging sie mit tastenden Schritten auf den Baum zu. Aus dem Stamm schien ihr ein Wesen entgegenzutreten, schwarz und schrundig wie der Baum selbst, ein böser Geist, halb Mensch, halb Tier.
Ihr Zeigefinger klammerte sich um den Abzug, zitterte. Ihre Knie wurden weich. Die Kreatur öffnete den Mund. Sophie machte einen Schritt nach vorn, trat auf eine Wurzel, strauchelte, stolperte vorwärts. Ein Schuss löste sich und zerriss die Stille. Als sie wieder aufstehen wollte, jagte ein scharfer Schmerz in ihren rechten Knöchel. Ein helles, scharfes Fauchen drang durch den Nebel. Sophie rang nach Luft, wollte schreien, doch es kam nur ein Ächzen über ihre Lippen.
Kapitel 1
Das hier konnte nicht gut gehen. Jedenfalls nicht mehr lange.
Aber war das ein Grund aufzuhören?
Er hätte die Antwort auf jede Mauer der Stadt geschrieben.
Von ihrer dunkelblauen Regenjacke, die über dem Stuhl hing, perlten letzte Tropfen. Ihre Füße ragten blass und leblos über die Bettkante.
Er betrachtete ihre Tom-Ford-Sonnenbrille mit den übergroßen Gläsern und ihre Schirmmütze, die beide auf dem billigen Holztisch lagen. Eine gute Tarnung sah anders aus. Aber noch wichtiger war das Handy, wenn es darum ging, nicht gefunden zu werden. Die verdammten Mistdinger waren einfach zu gut zu orten.
Er verspürte den Drang, aus dem Fenster zu sehen, sicherheitshalber die Straße zu checken. Das Gebäude gegenüber. Die Hauseingänge in der Abenddämmerung. Aber – wenn sie jemand beobachtet hatte, dann war es ohnehin zu spät.
Er sah auf sie herab. Flach auf dem Rücken lag sie da, den Körper kaum zu einem Drittel unter der Decke, ein kleines Dreieck ihrer Scham lugte hervor. Ihr Gesicht war unter einem großen weißen Kissen begraben.
Ein dumpfes, lang gezogenes Seufzen drang unter dem Stoff hervor. In ihre Arme kam Leben, sie packte das Kissen an einem Zipfel, zog es von ihrem Kopf und pfefferte es ihm vor die Brust.
»Art Mayer«, stöhnte sie, »du bist mein Untergang.«
Leise lachend schob er das Kissen beiseite.
Sie drehte sich auf den Bauch, schmiegte sich an ihn und legte den Kopf auf den Oberschenkel seines vernarbten Beins. Art saß neben ihr im Bett mit dem Rücken zur Wand und strich ihr durch die Haare. »Retter wäre mir lieber«, sagte er.
»Art Mayer«, sagte sie mit einem Hauch Dramatik, »du bist mein Retter.«
»Schamlose Lügnerin.«
»Okay. Du bist mein Retter und mein Untergang.«
»Schon besser«, meinte Art. Ihr Verhältnis zueinander hatte sich in den letzten Monaten verändert, als hätte sich ein Gewicht zwischen ihnen verschoben. Vielleicht hatte es aber auch einfach damit zu tun, dass er ihr tatsächlich das Leben gerettet hatte.
»Wie lange noch?«, fragte sie.
Art sah zum Fenster. »Ist bald dunkel, also etwa eine Stunde noch, bis neun. Hast du ans Handy gedacht?«
»Liegt bei Jeanette, wie immer.« Sie rekelte sich. »Sollen sie doch triangulieren, bis sie schwarz werden.«
»Das war politisch ziemlich inkorrekt«, entgegnete er.
»Wo ist der Art, dem das immer egal war?«
»Sitzt neben Nele Tschaikowski im Wagen und hört sich von ihr etwas über People of Color und die negativ konnotierte Verwendung des Wortes ›schwarz‹ an.«
Sie nickte. Politische Korrektheit war ihr allzu vertraut, alleine schon wegen ihres Mannes. Aus demselben Grund war sie ihr vermutlich manchmal auch etwas zu viel. »Scheint ja ziemlichen Einfluss auf dich zu haben, deine Kollegin.« Sie kniff ihm ins Bein. »Muss ich eifersüchtig sein?«
Art wusste, dass sie nur mit der Eifersucht kokettierte, auch wenn er sich das vielleicht anders gewünscht hätte. »Sie ist schwanger. Ende siebter Monat. Oder achter.«
»Das war keine Antwort.«
»Na ja, sie ist jünger als du. Das wäre vielleicht ein Grund.«
»Mistkerl.« Sie lachte und hob den Kopf. »Hey, was ist das denn?« Sie fasste mit der rechten Hand zwischen seine Beine. »Noch mal?«
Er schwieg. Ihre Leichtigkeit gefiel ihm, hatte ihm schon immer gefallen. Schwere brachte er selbst genug mit; sie ebenfalls, aber sie schaffte es trotzdem in manchen Augenblicken fast sorglos zu wirken und nur den Moment zu genießen. Fast als wären sie noch Teenager, wie damals, als sie sich kennengelernt hatten.
Aber war er bereit, sich mit dem hier zufriedenzugeben? Oder machte er sich etwas vor?
»Du scheinst immer noch einiges aufholen zu müssen.« Ihre Finger schlossen sich um ihn und drückten zu.
»Fünfundzwanzig Jahre«, sagte er heiser.
»Also bitte! Du warst doch verheiratet …«
»Nicht mit dir.«
»Tut mir leid, Herr Kommissar, damit kann ich leider nicht dienen. Damals nicht und heute auch nicht.«
»Wenn wir das so weitermachen«, sagte Art, »kann sich das schneller ändern, als du denkst.«
»Klingt fast, als machtest du dir mehr Sorgen als ich. Oder ist das etwa Hoffnung?«
»Sorge«, erwiderte er, war sich aber nicht ganz sicher.
»O Gott«, stöhnte sie. »Genau deshalb bist du mein Untergang.«
»Weil ich mir Sorgen mache?«
»Weil’s dir egal sein könnte. Der BKA-Ermittler und die Frau des Bundeskanzlers. Wenn sich hier jemand Sorgen machen muss, dann ja wohl ich, aber du tust es trotzdem. Du warst schon immer so …«
Er schwieg, während sie nach Worten suchte.
»… keine Ahnung. So ein Dazwischenwerfer.«
»Aha.«
»Der Dazwischenwerfer, der ist mein Untergang.« Sie richtete sich auf, biss ihm sanft in die Brust und arbeitete sich nach oben. Art ergab sich, nahm mit, was er kriegen konnte. Juli hatte nie Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie mit Henrik Westphal, dem amtierenden Bundeskanzler, verheiratet war und es auch bleiben würde. Ausgerechnet Henrik, mit dem ihn selbst ein kompliziertes Verhältnis verband. Sie schuldeten sich etwas, gegenseitig. Art hatte eine Zeit lang gedacht, dass sich das auflösen, irgendwann weggehen würde. Aber seine Abneigung gegenüber Henrik wuchs genauso wie das Gefühl einer seltsamen Verbundenheit. Es war keine Hassliebe, die sie verband, aber etwas, das dem nahekam.
Auf dem Nachttisch vibrierte sein Handy.
Juli erstarrte in der Bewegung und ließ von ihm ab. »Ist nicht dein Ernst, oder?«
Art stöhnte und griff nach dem Telefon. »Mayer«, knurrte er.
»Artur Mayer?«, schnarrte eine fremde Männerstimme.
»Ja. Und wer sind Sie?«
»Simonek. Ich hab vor gut einer Stunde Ihre Tochter verhaftet.«
»Bitte, was?«, stieß Art verblüfft hervor.
»Tja, ist immer ein Schock, wenn’s zum ersten Mal passiert. Geht allen so. Aber Ihre Göre hat’s faustdick hinter den Ohren, das kann ich Ihnen sagen. Sie sollten sich jetzt schleunigst auf den Weg hierher machen, damit Sie das wieder in Ordnung bringen.«
»Das müssen Sie wohl selbst in Ordnung bringen – ich habe nämlich keine Tochter«, entgegnete Art.
Am Ende der Leitung herrschte für einen Moment Stille. »Aber, Sie sind doch Artur Mayer, richtig?«
»Ja, richtig. Aber wie gesagt, ich hab keine Tochter. Ich habe überhaupt keine Kinder. Muss ’ne Verwechslung sein.«
»Die kleine Göre hier sagt was anderes.«
Kleine Göre. Was auch immer das Mädchen angestellt hatte, sie begann Art irgendwie leidzutun. Simonek schien ein ziemlich fieser Typ zu sein. Aber trotzdem – das hier war nicht seine Sache. »Was auch immer sie behauptet, es ist Unsinn.«
Der Mann stieß einen genervten Seufzer aus. »Na, die kann was erleben«, murmelte er. »Nichts für ungut, Herr Mayer. Guten Tag noch.«
»Warten Sie, einen Moment noch«, sagte Art, bevor der andere auflegen konnte. Plötzlich war ihm ein Verdacht gekommen, nein, kein Verdacht, eher eine Ahnung. »Wie alt ist das Mädchen denn?«
»Sieben, behauptet sie. Aber das ändert nichts.«
»Sie verhaften eine Siebenjährige? Wie heißt sie denn?«
»Will sie nicht sagen.«
»Geben Sie ihr bitte mal das Telefon.«
»Ist doch Zeitverschwendung, wenn’s eh nicht Ihre Tochter ist.«
»Art? Hallo?«, krähte eine helle Stimme im Hintergrund. »Bist du das? Der will mich nicht gehen lassen.«
»Halt die Klappe, es reicht jetzt«, blaffte Simonek.
Art stutzte. Er hatte die Stimme des Mädchens sofort erkannt.
»Okay«, seufzte er. »Wo finde ich Sie?«
»Was?«, fragte der Mann verwirrt. »Ich dachte …«
»Sie ist meine Tochter«, log Art. »Wohin muss ich kommen?«
Kurz nachdem Art das Hotelzimmer verlassen hatte, stand Juli Westphal auf. Es war kurz nach zwanzig Uhr. Sie musste duschen, doch sie hatte das Gefühl, Art noch auf ihrer Haut zu spüren, und dieses Gefühl wollte sie noch ein klein wenig länger behalten. Er musste jetzt gerade unten an der Tür angekommen sein und trat vermutlich auf die Straße, in den Regen. Sie seufzte und widerstand dem Impuls, ans Fenster zu gehen und ihm nachzusehen. Gott, dieser Kerl hatte es schon vor fünfundzwanzig Jahren geschafft, dass sie Dinge tat, die …
Es knallte laut, und sie zuckte zusammen. Hastig trat sie nun doch ans Fenster, schob die Gardine etwas beiseite und sah hinab auf die drei Stockwerke tiefer liegende Straße. Inzwischen war die Beleuchtung angesprungen. Eine graue Limousine bremste vor einem älteren weißen Kleinwagen, der umständlich rückwärts einparkte. Aber was bitte hatte da gerade so laut geknallt? Eine Fehlzündung? Ihr Blick fiel auf Art, der in diesem Moment auf die Straße kam und eilig nach links lief, in Richtung der nächsten U-Bahn-Station.
Tochter, dachte Juli, während sie ihm nachsah. Und dann auch noch eine Siebenjährige? Als sie ihn gefragt hatte, was das zu bedeuten habe, hatte er nur abgewinkt.
Gut, sie hatten beide ihre Geheimnisse.
Ein kurzer, heller Blitz auf der anderen Straßenseite ließ sie aufschrecken. Sie blickte zu dem gegenüberliegenden Haus, im selben Moment blitzte es ein zweites Mal hell auf, genau auf ihrer Höhe im dritten Stock hinter einem der Fenster. Erschrocken wich sie hinter die Gardine zurück. O Gott, war das ein Blitzlicht? Hatte da etwa jemand fotografiert? Jetzt wünschte sie sich, sie wäre direkt unter die Dusche gegangen oder hätte sich zumindest irgendetwas angezogen.
Kapitel 2
»Das gefällt mir nicht«, unkte Roman Hoff. »Du solltest dich schonen.«
»Mir geht’s gut. Ich bin schwanger und nicht krank«, erwiderte Nele Tschaikowski gereizt.
»Andere Frauen lassen sich schon im vierten Monat krankschreiben. Du bist im achten. Und du willst da jetzt ernsthaft hin?«
Nele schürzte die Lippen und zog es vor, nicht zu antworten. Mit einem der Schlüssel an ihrem Bund öffnete sie den kleinen Waffenschrank im Flur und entnahm ihm die SIG-Sauer-Pistole und ihr Schulterholster. Der Gürtel mit dem Hüftholster passte ihr schon seit zwei Monaten nicht mehr. »Eine Woche noch«, sagte sie und schloss den Schrank wieder. »Dann ist Ruhe, ich versprech’s.«
»Und warum nicht jetzt?« Er wies auf die noch zusammengefalteten Umzugskartons, die an der Wand lehnten. »Du könntest schon die Sachen packen, ganz in Ruhe. Lass dich vertreten. Dein Onkel ist der Polizeipräsident, das kann doch nicht so schwer sein …«
»Komm mir bloß nicht mit meinem Onkel!«, sagte Nele.
Roman seufzte genervt.
Was sollte das? Er wusste doch nur zu gut, dass Vitamin B wirklich das Letzte war, was sie nutzen wollte, ganz egal, worum es ging. Sie war doch kein Nepo-Baby. Und trotzdem spielte er immer wieder diese Karte. Nun stand er im Flur, sah sie von Kopf bis Fuß an und schaltete sein Lächeln ein, vermutlich weil er ihre gereizte Miene sah.
»Was?«, fragte sie und zog ihre Jacke über. Verdammt, sie mochte dieses Lächeln. »Schau mich nicht so an.«
»Wie schau ich denn?«
»Mit diesem Sexiest-Man-Alive-Lächeln.«
»Wirkt es?«
»Du bist eingebildet. Und ich hab zu tun.«
»Sag mir wenigstens, wohin du fährst.«
»Darf ich nicht. Weißt du doch.«
»Musst du das Ding da benutzen?« Roman deutete mit dem Kinn auf ihre Pistole.
»Quatsch«, murmelte sie. »Mach dir keine Sorgen.« Sie sah ihn einen Moment schweigend an und versuchte, sich in seine Lage zu versetzen. Auch wenn es sie nervte, er meinte es nur gut. Umgekehrt wäre es ihr vielleicht genauso gegangen. »Okay«, sagte sie. »Nur so viel. Der Tatort ist etwas außerhalb von Berlin in einem Wald.«
»Moment. Geht es etwa um diese Geschichte im Königswald? Mit dieser überspannten Frau?«
Mist. Sie hätte nichts sagen sollen. Natürlich hatte Roman das mitbekommen. Seit gestern geisterte die Sache durch die Medien. Eine Frau hatte behauptet, einem unheimlichen Wesen im Wald begegnet zu sein, halb Mensch, halb Tier. Doch beim Notruf war sie angeblich abgewiesen worden. Kein Wunder eigentlich. Die Personaldecke in der Notruf-Leitstelle war dünn, und die Zahl der täglichen Notrufe lag bei über 3000, sodass die Nerven der Mitarbeiter blank lagen. Die Zeit reichte schon kaum, die ernst zu nehmenden Notrufe zu bearbeiten. UFO-Sichtungen, Zombies oder paranormale Begegnungen wurden da schnell aussortiert, weil sie nur die Leitungen verstopften. Die Sache war hochgekocht, weil sich die Frau über die Ignoranz der Notrufzentrale bei Twitter und Instagram empört und detailliert von ihrem Erlebnis im Wald erzählt hatte. Dummerweise hatte sie über 6000 Follower, und die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und am Morgen war auch noch die Presse darauf angesprungen. In den sozialen Medien reichten die Reaktionen von besorgt bis hin zur üblichen Häme: eine betrunkene Schisserin, hieß es in einem spöttischen Post, die sich beim Anblick eines Schweins glaubte, auf einen Baum retten zu müssen. Dass das Schwein wohl ein angriffslustiger und gefährlicher Keiler gewesen war, das ließ der Post unerwähnt.
»Ja, genau die Geschichte«, seufzte Nele.
Roman betrachtete sie nachdenklich. »Gut, dass das alles bald vorbei ist«, brummte er.
Nele schwieg. Sie wusste, was er mit ›vorbei‹ meinte. Roman ging davon aus, dass sie ihren Job aufgab, mit ihm nach Lübbenau im Spreewald zog, in ein Haus auf dem Gelände des Sägewerks, das Roman von seinem Vater übernehmen würde.
Es war nicht ihr Plan gewesen, ein Kind zu bekommen. Nicht jetzt, nicht so früh. Es hatte ihr eine Heidenangst eingejagt. Aber wo es nun schon mal in ihrem Bauch war, sah sie keine Alternative. Eine Abtreibung war für sie nicht infrage gekommen. Und Roman hatte begonnen, begeistert Versprechungen zu machen. Er malte ihr das gemeinsame Familienleben in den schönsten Farben aus, brachte ihr Blumen mit, sagte ständig, dass es den richtigen Zeitpunkt doch sowieso nie gäbe. Man könne es eben nur nehmen, wie es kommt. Und wenn sie später doch irgendwann wieder arbeiten wolle, könne sie das doch ohne Probleme tun. Sie hatte sich irgendwie anstecken lassen, hatte alles richtig machen wollen. So, wie sie immer eine gute Polizistin sein wollte, wollte sie auch eine gute Mutter sein. Nicht wie ihre eigene Mutter, für die sich alles im Leben immer nur um ihre Drogerie und das kleine Kosmetikstudio im Hinterzimmer gedreht hatte. Nele war mit einem Schlüssel um den Hals aufgewachsen. Vielleicht hatte sie deshalb am Ende Roman zugestimmt. Sie würde das Kind bekommen und mit ihm auf den Hof ziehen. Sie würde es versuchen. Doch mit dem Bauch wuchsen die Zweifel, von Woche zu Woche. Was hatte sie nur geritten? Sie hatte dafür gekämpft, genau da zu sein, wo sie war – beim BKA –, und sie spürte mit jeder Faser ihres Körpers, dass sie diesen Job nicht aufgeben wollte. Doch Roman ging immer noch davon aus, dass sie es tat, und sie hatte keine Ahnung, wie sie ihm erklären sollte, dass das nicht infrage kam. Schatz, ich hab mich geirrt? Ich hab meine Meinung geändert? Ich kann das nicht, wir müssen eine andere Lösung finden? Für ein paar Monate, okay – aber dann will ich wieder arbeiten! Sie hatte die Sätze leise vor dem Spiegel geübt, und jedes Mal blieben ihr die Worte im Hals stecken. Sie fühlte sich mies, wie die schlechteste Mutter der Welt.
»Und du bist sicher, dass ich mir keine Sorgen machen muss?«, fragte Roman.
Für einen kurzen Moment dachte Nele, er habe ihr angesehen, dass sie ausscheren könnte aus seinem hübsch zurechtgelegten Lebensplan, und erschrak. Aber das war wohl gerade gar nicht die Frage. »Nein, musst du nicht«, sagte sie. »Am Tatort wird ein kleines Heer von Kolleginnen und Kollegen sein, Kriminaltechnik, Streifenpolizei und so weiter und so fort. Vermutlich gibt es heute Abend keinen Ort in Berlin mit größerem Polizeiaufgebot – bis auf das Kanzleramt vielleicht.«
»Okay. Und was ist mit deinen Albträumen?«
Nele zuckte mit den Achseln. Sie stand doch schon in der Tür, warum fing er ausgerechnet jetzt wieder davon an. »Was soll damit sein? Ich hab’s im Griff.«
»Und was war das letzte Nacht? Glaubst du, ich krieg nicht mit, wenn du schlecht träumst?«
»Ich war beim Psychologen – und gut ist.«
»Was heißt hier gut? Glaubst du im Ernst, deine drei Pflichtbesuche beim Polizeipsychologen reichen? Jemand hat dich in einen Schrank gesperrt, gefesselt, mit einer Schlinge um den Hals. Du wärst beinah erstickt.«
»Danke für die Erinnerung«, murmelte Nele.
Roman seufzte und sah sie an. »Okay. Pass auf. Ich will dir nichts Böses. Ich will nur das Beste für dich und unser Kind. Wenn du in Ruhe gelassen werden willst, in Ordnung. Ich versuch’s. Aber nur unter einer Bedingung: Du gehst weiter zum Psychologen. Und wenn du’s schon nicht für dich machst, dann mach’s für unser Kind. Das will nämlich garantiert keine Mutter, die unter Angstzuständen leidet. Okay?«
Sie presste die Lippen zusammen und nickte. »Okay.«
»Versprochen?«
»Versprochen. Ja.« Sie nahm ihre Mütze vom Haken, schnappte sich ihre Stiefel, ging auf Socken hinaus in den Hausflur und warf die Tür hinter sich zu. Erst ein Stockwerk tiefer begann sie, die Stiefel anzuziehen. Roman hatte recht, sie litt tatsächlich immer noch unter Albträumen. Was er nicht wusste, war, dass sie seit einigen Wochen wieder einen Psychologen aufsuchte. Privat, damit bei der Polizei keine Zweifel über ihre Dienstfähigkeit aufkamen. Aber das hatte sie Roman nicht sagen wollen, weil sie fürchtete, dass er sie dann nur noch mehr bedrängte. Seine Besorgnis war wie ein Käfig. Dabei hatte sie eigentlich alles im Griff – oder war zumindest auf dem Weg dahin.
Ihr Handy summte, noch bevor sie den zweiten Stiefel anziehen konnte, und sie rollte mit den Augen. Roman. Natürlich. Eine WhatsApp mit Smiley und fliegenden Herzen. Sie wischte die Nachricht beiseite und rief Art an, doch der ging nicht ans Telefon. Eilig wurstelte sie ihren von der Schwangerschaft geschwollenen Fuß in den zweiten Stiefel, schnürte ihn locker, dann lief sie aus dem Haus zum Wagen. Die Luft war nasskalt. Nele textete Art, wohin sie unterwegs war und dass er sich dringend melden solle. Wahrscheinlich hatte Martin Buchwald, ihr gemeinsamer Vorgesetzter, ihn längst informiert. Aber bei Art hieß das noch nichts.
Als sie die Wagentür zuzog, hatte sie einen kurzen Flashback und saß im Schrank. Verfluchte Erinnerung. Sie schaltete den Scheibenwischer ein, folgte den Blättern mit dem Blick und atmete konzentriert ein, während sie bis vier zählte. Dann atmete sie wieder aus, während sie langsam bis sechs zählte, wie es ihr Dr. Seefeld in der Therapie geraten hatte. Sie wiederholte die Atemzüge und verlängerte sie, spürte, wie ihr Pulsschlag ruhiger wurde, und startete schließlich den Wagen.
Wie gesagt, sie hatte es im Griff.
Und war auf dem Weg zu einem Tatort.
Nur das zählte gerade.
Art Mayer war gerade aus einem der U-Bahn-Aufgänge auf den Hermannplatz gekommen und schaltete das klingelnde Telefon stumm. Beim Blick auf das Display sah er Buchwalds Nachrichten. Es poppte eine weitere von Nele auf. Er beschloss, die Nachrichten zu ignorieren. Was auch immer da los war – es musste warten.
Das sanierungsbedürftige Karstadt-Kaufhaus ragte vor ihm auf. Überall rotierten Blaulichter. Mehrere Einsatzwagen der Polizei standen an unterschiedlichen Ecken des Platzes, der Verkehr staute sich in alle Richtungen. Auf den Kreuzungen hatten sich Klimaaktivisten festgeklebt und blockierten jedes Weiterkommen. Einige Autofahrer waren ausgestiegen und beschimpften die Aktivisten, während die Polizei versuchte, die Hände der Demonstranten von der Straße zu lösen und sie fortzutragen. Eine junge Frau mit grün gefärbten Haaren wehrte sich aus Leibeskräften und trat einem der Beamten dabei gegen das Knie. Fluchend ließ er sie los, fasste sich ans Bein und setzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Straßenrand. Plötzlich gab es einen lauten Knall, und die Windschutzscheibe eines Streifenwagens ging zu Bruch. Ein Typ am Straßenrand johlte. Er trug ein Tuch vor dem Mund, holte aus und warf noch einen Stein auf den Wagen.
Art wandte sich nach links, ging an der Seite des Kaufhauses entlang bis zu der Durchfahrt für Lieferanten. Schnell fand er den Hintereingang, den ihm der Mann namens Simonek beschrieben hatte. Nach zweimaligem Klingeln öffnete ein bulliger Mann um die vierzig. Die Knöpfe seines Hemdes spannten am Bauch. Der dunkle Kinnbart ließ ihn grimmig wirken, seine schlechte Laune tat ein Übriges. »Sie sind Mayer?«
Art nickte nur.
»Das hat ja gedauert. Mir reicht’s langsam.« Er drehte sich um und machte Art ein Zeichen mitzukommen. Sie gingen durch einen Flur mit Bürotüren und verkratzten Plexiglasschildern.
»Was ist passiert?«, fragte Art.
»Sie hat ’ne Bratpfanne mitgehen lassen.«
»Eine Bratpfanne?«
»Mhm, ’ne Bratpfanne. Hat sie sich in ihren Rucksack gesteckt. Dachte wohl, es fällt nicht auf.«
Art seufzte innerlich. »Hören Sie, sie hat’s nicht leicht. Ihre Mutter ist seit Monaten verschwunden, sie lebt bei ihrer dementen Großmutter, und der Vater ist schon vor langer Zeit abgehauen.«
»Ich dachte, Sie sind der Vater?« Simonek blieb vor einer Tür stehen und sah ihn fragend an.
Art zuckte mit den Schultern. »Sie wohnt in der Etage unter mir. Manchmal klopft sie bei mir an die Tür.«
Simonek hob die Brauen. Er hatte gerade den Schlüssel ins Türschloss stecken wollen, schien es sich jetzt aber anders zu überlegen. »Dann sind Sie gar nicht erziehungsberechtigt?« Er verschränkte die Arme. Oberhalb seines rechten Handgelenks waren rot geränderte Zahnabdrücke.
»Wollen Sie lieber mit der dementen Großmutter reden?«, fragte Art und sah auf die Uhr. »Könnte ’ne lange Nacht werden.«
Simonek grunzte, schloss die Tür auf und ließ Art hinein.
Der Raum hatte keine Fenster, auf der rechten Seite stand ein Pult mit einem Dutzend Monitoren, auf denen wechselnde Bilder der Überwachungskameras das inzwischen leere Kaufhaus zeigten. Es war kurz vor halb neun. Linker Hand stand ein abgewetzter Schreibtisch, davor ein Bürostuhl mit Rollen, auf dem Milla wie ein Häufchen Elend saß. Ihr Gesicht war verweint, und sie hatte Ringe unter den Augen. »Hallo, Art«, sagte sie kleinlaut.
»Hallo, Milla.« Sein Blick fiel auf ihre Hände, die mit Handschellen an die Armlehnen des Stuhls fixiert waren. An ihrem rechten Handgelenk waren rote Flecken, die vermutlich von einer Quetschung herrührten.
»Sie ist sieben«, knurrte er in Richtung Simonek. »Machen Sie sie los.«
»Das Miststück hat mich gebissen«, verteidigte sich Simonek.
Milla warf trotzig ihre zerzausten dunklen Locken zurück. »Weil der mir wehgetan hat.«
»Hören Sie, ich bezahle Ihnen den Schaden, Hauptsache, Sie machen sie jetzt los.«
Simonek ließ sich auf den Bürostuhl hinter seinem Schreibtisch fallen, lehnte sich zurück und wies auf einen freien Stuhl vor dem Pult, dann faltete er die Hände vor seinem Bauch.
Art setzte sich. »Was kostet die Pfanne?«
»Fünfhundert.«
Art sah Simonek einen Moment lang schweigend an. »Keine Pfanne kostet fünfhundert.«
»Die schon.«
»Da stand neunundfünfzig auf dem Schild«, warf Milla empört ein.
»Du hältst dich raus«, knurrte Art. Er zog sein Portemonnaie hervor und legte zwei Fünfziger auf den Tisch. »Für die Umstände.«
Simonek lächelte spöttisch. »Fünfhundert. Sonst ruf ich beim Jugendamt an, sie kriegt ’ne Anzeige, und die Sache mit der dementen Oma dürfte dafür sorgen, dass sie recht schnell einen hübschen Platz im Heim bekommt.«
Art starrte den Mann ausdruckslos an. »So viel hab ich nicht dabei.«
Simonek zuckte mit den Achseln. »Um die Ecke ist ein EC-Automat, die Kleine kann so lange hier warten.«
»Alles klar«, sagte Art und stand auf.
Simonek beobachtete ihn argwöhnisch, seine Rechte ging zum Gürtel. Art wandte sich zum Gehen, packte dann den Stuhl und schleuderte ihn über den Schreibtisch hinweg auf Simonek. Der Kaufhausdetektiv hob hastig die Hände, aber es half nichts. Der Stuhl warf ihn um, und er landete krachend auf dem Fußboden. Sofort war Art bei ihm, doch Simonek hatte einen Schlagstock aus dem Gürtel gezogen, versuchte, Art zu treffen, brachte allerdings nicht genug Kraft auf, sodass Art den Stock mit der linken Hand abfing und ihm mit der rechten einen Fausthieb auf die Nase gab. Simonek brüllte auf, ließ den Schlagstock los und hielt sich mit beiden Händen das Gesicht.
Art zerrte ihn aus der Ecke hinter dem Schreibtisch, durchwühlte seine Hosentaschen und fand einen kleinen Schlüssel.
Milla starrte Simonek zornig an, während Art die Handschellen aufschloss.
»Nimm die Pfanne«, sagte Art.
Milla stand auf, rieb sich die Handgelenke, nahm die Bratpfanne, stapfte auf Simonek zu, holte mit ihren dünnen Ärmchen aus und schlug ihm die Pfanne aufs Knie. Simonek brüllte laut auf.
»Doch nicht so!«, rief Art.
Milla ließ die Pfanne sinken. »Du hast das auch so gemacht.«
»Er hat bezahlt, du hast bezahlt. Das war’s«, sagte Art. »Wir gehen.«
»Das wird dir noch leidtun«, jammerte Simonek. Art drehte sich noch einmal zu ihm um. Der Kaufhausdetektiv hielt sich immer noch die Nase. Zwischen seinen Fingern sickerte Blut hervor.
»Bete, dass niemals das Jugendamt bei ihr auftaucht«, sagte Art, »falls doch, komme ich wieder, klar?«
Simonek starrte ihn feindselig an. Art drückte Milla ihren Rucksack in die Hand, und sie verstaute die Pfanne darin.
»Komm.«
Milla warf einen letzten Blick auf Simonek, dann waren sie aus der Tür und liefen den Gang hinunter.
»Danke«, sagte sie leise.
»Warum ausgerechnet eine Pfanne?«, wollte Art wissen.
Milla wischte sich trotzig mit dem Ärmel über das tränenverschmierte Gesicht. »Die alte ist kaputt. Oma will keine neue kaufen. Das ist blöd, wie soll ich denn da was kochen?«
Art seufzte und fasste mit seiner großen Hand nach ihrer kleinen.
Wäre er nicht selbst im Heim gewesen, hätte er jetzt wohl darüber nachgedacht, das Jugendamt zu informieren. Einmal mehr nahm er sich vor, bei der Suche nach Millas Mutter Dana nicht nachzulassen – soweit es seine Arbeit zuließ. Dana war Nachtklub-Tänzerin und vor über sieben Monaten spurlos verschwunden. Seitdem hatte er immer wieder zwischendurch Zeit damit verbracht, nach Spuren zu suchen, und bis heute nicht aufgegeben – im Gegensatz zur Vermisstenabteilung. Menschen, die so lange verschwunden waren, blieben es auch, hieß es dort. Jedenfalls wenn man der Statistik glaubte. Und bisher schien die Statistik leider recht zu behalten.
Mit Milla an der Hand lief Art quer über den Hermannplatz. Der Verkehr stand immer noch still. Die letzten Demonstranten wurden fortgetragen. Aus dem Polizeiwagen mit der zerschlagenen Scheibe schlugen Flammen. Eine schwarze Rauchsäule stieg in den Himmel. Martinshörner heulten in einiger Entfernung, kamen jedoch nicht näher. Der Löschzug steckte fest.
Kapitel 3
Nele Tschaikowski versuchte angestrengt, durch den Nebel zu sehen, der über der B 2 Richtung Potsdam lag. Sie konnte sich nicht erinnern, wann es zuletzt hier so schlechte Sichtverhältnisse gegeben hatte. Zehn Meter, und schon prallten die Scheinwerfer des Audis auf eine milchige Wand, umgeben von Finsternis. Für September hatte es zuletzt ungewöhnlich viel geregnet; der Boden war noch feucht und warm von den hohen Temperaturen, und nachts kühlte die Luft seit ein paar Tagen schlagartig ab.
Wie aus dem Nichts tauchte die Kolonne der Polizeifahrzeuge auf, abgestellt am rechten Straßenrand, orange Warnblinker, dazu ein Streifenpolizist mit einer beleuchteten Warnkelle als einsamer Wächter.
Nele parkte zwischen dem Transporter der Kriminaltechnik und dem Leichenwagen. Ob Art schon da war? Sie warf einen Blick auf ihr Handy. Viertel nach neun. Keine Antwort auf ihre Nachricht. Typisch. Sie hatte aufgehört, Arts Verhalten zu hinterfragen. Die einzige Gewissheit bei ihm war, dass man keine Antwort bekam, wenn man gerade eine wollte.
Der Streifenpolizist mit der Warnkelle beäugte sie misstrauisch, als sie ausstieg. Zu jung, zu schwanger. Nele zückte ihren BKA-Ausweis. Sein Blick streifte skeptisch ihren Bauch. »Zu den Kollegen geht’s da runter«, wies er ihr den Weg, »immer am Band entlang. Geben Sie gut acht, wo Sie hintreten. Ist holprig.« Männliche Fürsorge, gepaart mit diesem speziellen Unterton. Schätzchen, du hier? In diesem Zustand? Hast du dir das auch gut überlegt?
»Danke. Mach ich«, lächelte Nele bemüht. Das Absperrband führte wie eine Spur in den Wald und verlor sich im Nebel. Weit entfernt leuchtete etwas diffus zwischen den Stämmen. Über ihr hing der Mond wie eine blasse Lampe. Sie fröstelte; ein Kaffee wäre jetzt gut. Oder besser ein Tee. Das Adrenalin kam gerade schon von allein. Vom Tatort drangen leise Stimmen herüber. Unter ihren Schritten brachen Zweige. Schließlich endete das Band an einem Baum neben einem Klapptisch, auf dem mehrere Thermoskannen und beschriftete Pappbecher standen. Direkt daneben versperrte ihr ein weiteres Band den Weg, aller Wahrscheinlichkeit nach war es in einem weiten Kreis um den Tatort herum gespannt. Auf Stativen montierte LED-Scheinwerfer streuten Licht in den Nebel, sodass es in mystisch anmutenden Streifen durch die Äste brach. Die Szenerie glich einem Filmset. Ein paar gebückte Gestalten in weißen KT-Overalls suchten zwischen den Bäumen nach Spuren. Gelbe Schilder mit Zahlen markierten Punkte am Boden. Der Tatort selbst entzog sich ihrem Blick.
Egon Brunner, der Leiter der KT, kam zu ihr an die Absperrung, groß, hager, mit einem leichten Buckel, wie ihn große Menschen manchmal haben, weil sie sich ein Leben lang herabbeugen. Seine Gestalt, seine blasse Haut und die beiden etwas zu langen Schneidezähne hatten ihm den Spitznamen Nosferatu eingebracht.
»Nele«, brummte er. »Du hier. Ich dachte, du bist schon im Mutterschutz.«
»Klingt, als wollt ihr mich alle loswerden«, rutschte es ihr heraus.
Brunner zuckte mit den Achseln. »Da kriegst du was in den falschen Hals.«
Sie seufzte. »Eine Woche hab ich noch.«
Brunner nickte. Vermutlich dachte er, sie würde den Moment herbeisehnen. »Solltest nicht hier sein«, murmelte er. »Ist nichts für …«, er deutete auf ihren Bauch. »Du weißt schon.«
»Aber jetzt, wo ich schon mal hier bin …« Sie hob das Absperrband, um darunter hindurchzuschlüpfen.
»Moment, Moment«, bremste Brunner. »Gib meinen Jungs noch etwas Zeit. Ist schwer genug hier bei dem Boden.«
Nele ließ das Band wieder sinken. Sie wusste, er hatte seine Gründe. Und sie war noch nicht lange genug dabei, um ihm zu widersprechen.
Egon Brunner schenkte Tee aus einer der Thermoskannen in einen frischen Pappbecher ein und reichte ihn ihr. Sein hageres Gesicht wirkte angespannt und noch ernster als sonst. Dabei war Nosferatu einer, den so schnell nichts anfasste.
»Schlimm?«, fragte sie.
Er verzog den Mund. »So was hab ich in meinen ganzen dreißig Dienstjahren noch nicht gesehen.«
Nele nickte beklommen und versuchte, sich zu wappnen. Brunners Schutzpanzer war drei Jahrzehnte dick, ihrer nur sieben Monate. Sie spähte zum Tatort, doch der Nebel lag wie ein Mantel über allem. »Hatte die Zeugin also recht?«, fragte sie.
»Du meinst Sophie Bauer, diese Jägerbraut? Pff.« Er zuckte mit den Achseln. »Konnte man ja nicht wissen. Ich versteh nicht, warum jetzt alle auf dem Notruf und der Polizei rumhacken. Hast du die Aufzeichnung gehört?«
»Noch nicht.«
»Solltest du«, knurrte Brunner. »Ich hätte auch nicht reagiert, glaube ich. Wenn wir bei jedem Irren gleich ’ne Streife losschicken, so viele Polizisten gibt’s in Berlin gar nicht.«
»War sie wirklich so unglaubwürdig?«
»Pff«, machte Brunner. »Sie war halt geschockt und wirr, keine Ahnung. Hätte auch sein können, dass sie was …« Er hob eine imaginäre Flasche an die Lippen und machte ein Knick-Knack-Geräusch. »Hat vor lauter, lauter sogar einen Schuss abgegeben und das Opfer am Bein getroffen. Also postum.«
»Bitte? Einen Schuss?«
»Sophie Bauer ist Jägerin«, meinte Brunner. »Sagte ich das nicht gerade? Deshalb war sie doch im Wald.«
Nele stieß Luft aus. »Und stimmt es, mit dem …?« Sie deutete mit dem Zeigefinger über ihren Kopf und malte in die Luft, was Martin Buchwald ihr am Telefon beschrieben hatte.
Brunner nickte nur, dann schaute er in Richtung Straße. »Ich glaube, da kommt unser Spezi.«
Nele drehte sich um. Eine große Gestalt kam mit wuchtigen Schritten zwischen den Stämmen auf sie zu. Der nachtblaue Marinemantel schälte sich aus dem Dunkel, dazu die wild wuchernden schwarzen Locken und ein paar grobe Stiefel. Artur Mayers Handy klingelte, er blieb stehen und holte sein Telefon hervor. »Was denn?«, brummte er.
Ein kurzer Moment Stille.
»Wie, das Ei brennt darin an?«
Wieder Stille.
Dann seufzte er. »Mein Gott, dann schau halt demnächst besser hin, dass du die richtige Pfanne klaust.«
Art legte auf und blickte zu Nele und Brunner hinüber. Nosferatu wandte sich ab und meinte halblaut: »Hätte nicht gedacht, dass der noch mal eine abkriegt.« Hinter den Kollegen leuchtete der Tatort wie eine grelle Insel im Wald. Art wollte gerade sein Handy wieder in die Manteltasche stecken, überlegte es sich dann aber anders.
»Jaaa?« Millas Stimme klang hoffnungsvoll.
»Vergiss, was ich gesagt habe«, meinte Art. »Ich kauf dir morgen eine andere Pfanne, eine, in der die Eier nicht anbrennen, okay?«
»Aber morgen ist Sonntag.«
»Sonntag? Nein. Dienstag.«
»Oh.« Stille. Milla schien zu überlegen. »Stimmt.«
»Du musst doch zur Schule. Merkst du dir das nicht?«
»Oma hat gesagt, dass morgen Sonntag ist.«
Art seufzte. »Ich muss jetzt arbeiten. Versprich mir, dass du morgen zur Schule gehst.«
»Okee.«
Er legte auf und ging zu seinen beiden Kollegen. »Hey«, brummte er Nele zu. Sein Blick streifte ihren Bauch.
»Hallo, Art. War das Milla?«
»Hätte ihr besser nicht meine Nummer gegeben«, knurrte er und tauchte an Brunner vorbei unter dem Absperrband durch.
»He! Moment«, protestierte Nosferatu. »Wir sind noch nicht durch.«
»Bist du doch nie«, erwiderte Art und sah Nele an. »Kommst du?« Sie lächelte, dann schlüpfte sie etwas ungelenk unter der Absperrung hindurch.
»Alles okay?«, fragte Art.
»Du bist der Erste, der mich heute halbwegs normal behandelt, also versau’s jetzt bitte nicht mit übertriebener Fürsorge, ja?«
Art nickte. Er schaute sich um, versuchte das Zentrum des Tatorts auszumachen, dann ging er langsam voran. Lichtstrahlen schnitten durch den Dunst. Ein mächtiger Baum nahm Konturen an. Sein Geäst wuchs seltsam tief und zu beiden Seiten ungewöhnlich gleichmäßig aus dem Stamm. Ein helles Oval schien aus dem Holz hervorzutreten, genau auf Augenhöhe.
»O Gott«, stöhnte Nele.
Das Oval wurde zu einem bleichen Gesicht mit schwarzen Augenhöhlen, aus denen dunkle Rinnsale gelaufen waren. Im Nebel sah es aus, als wäre jemand – oder etwas – im Baum eingewachsen.
Unwillkürlich wurde Art langsamer. Es war, als liefe er auf einen bösen Geist zu. Er hörte Neles Atem neben sich, wie sie die Luft einsog, sie anhielt. Irgendwo schrie eine Eule.
Auf dem dunklen Stamm zeichneten sich die Konturen eines menschlichen Körpers ab, eine Frau, aufrecht stehend, scheinbar unbekleidet. Die Haut war von einer schrundigen dunkelbraunen Schmiere bedeckt. Ein intensiver, seltsamer Geruch stieg Art in die Nase. Sein Blick glitt zu dem, was er für Geäst gehalten hatte. Er blieb stehen und erfasste die ganze Gestalt am Baum. Aus dem Kopf der Frau wuchs ein Hirschgeweih.
Im selben Moment ertönte ein durchdringendes elektronisches Warnsignal.
LEO
Zwei Wochen zuvor
Leo saß im Bikini auf dem Rand des Indoor-Pools im Obergeschoss, wartete angespannt auf ihre Mutter und schaute durch das geöffnete Panorama-Dach der Villa in den Himmel. Wolken, zerrissen wie sie. Die Sonne ging gerade unter, und ein flammendes Orange loderte vom Horizont ins blauweiße Paradies. Die Bude anzünden, auch das wäre eine Lösung, dachte sie. Nur dass der Pool nicht mitbrennen würde. Sie fragte sich, ob wohl alle Töchter in Bezug auf ihre Mutter schon mal an Mord gedacht hatten.
Natürlich nur theoretisch!
Sie konnte ja keiner Fliege etwas zuleide tun.
Wobei ihre Mutter ja auch keine Fliege war; eher eine Mischung aus Hornisse und Löwin, weshalb Leo jetzt auch so angespannt war. Was sie vorhatte, war gewagt, vor allem, wenn man bedachte, wie wichtig es ihrer Mutter zu sein schien, dass niemand im Haus von ihrem hübschen kleinen, viereckigen Geheimnis erfuhr. Aber damit war heute Schluss.
Aus dem Augenwinkel sah Leo plötzlich eine Bewegung, eine Art Flattern, und spürte dann ein Kribbeln auf ihrer rechten Hand, mit der sie sich am Beckenrand abstützte. Sie sah vorsichtig hin und hielt den Atem an. Auf ihrem tätowierten Handrücken saß ein großer Schmetterling, sieben, acht Zentimeter breit, samtschwarz, mit einem Schuss Dunkelrot, einem Saum aus weißen Punkten und einem hellen Rand. Leo wagte nicht, sich zu bewegen. Um nichts in der Welt wollte sie diesen Moment zerstören. Sie hatte schon lange nicht mehr etwas so Schönes gesehen. Bis auf Oles nackten Hintern vielleicht. Aber das war Schönheit einer anderen Art.
Warum hatte sich der Schmetterling ausgerechnet auf ihrer Hand niedergelassen? Etwa wegen des Tattoos? Dann hätte er sich auch auf allen möglichen anderen Stellen ihres Körpers niederlassen können. Schließlich hatte sie einiges zu bieten, einen Totenschädel, einen Drachen, ein Herz im Feuer, darüber der Schriftzug YOLO, einen Rosenbusch, und sie überlegte, was als Nächstes kommen sollte.
Angefangen hatte sie mit den Tattoos, um die Wunden von den Rasierklingen zu kaschieren. Ironischerweise war das Brennen der Nadel fast noch intensiver als das Ritzen. Überhaupt, sie mochte das Tattoostudio. Den bärbeißigen Schlaks von Tätowierer, dessen Ohrlöcher so groß waren, dass ein Delfin hätte hindurchspringen können. Seine zarte Hand. Das leise Rattern. Die morbiden Zeichnungen an der Wand. Sie mochte den Schmutz in den Winkeln und dass es nach Desinfektionsmitteln roch, einfach weil es so anders war als zu Hause. Aber was sie wirklich süchtig gemacht hatte, das war die Art, wie sich ihre Mutter über die Tattoos aufgeregt hatte. Es war der perfekte Trigger-Button. Das Ritzen dagegen hatte ihrer Mutter Sorgen bereitet; was zu einem epischen Aktionismus geführt hatte. Schatz hier, Schatz da. Leo war sich fast schäbig vorgekommen, und doch war sie erleichtert gewesen, so etwas wie Zuwendung zu kriegen. Aufmerksamkeit. Auch wenn es diese typische Pseudoaufmerksamkeit war, Empathie-Gelaber. Schönreden, nichts tun. Die Sorge war nicht echt, weil bei ihrer Mutter nie was echt war.
Mit den Tattoos dagegen war das anders. Ihre Mutter war nicht besorgt gewesen, sie war wütend geworden, also wirklich wütend.
Danach hatte sie sich ein Tattoo nach dem anderen stechen lassen.
Und ihre Mutter ritt eine Attacke nach der nächsten. Ob sie denn überhaupt nicht nachdenken würde? Was das für ihre Zukunft bedeute! La-la-la.
Zukunft. Ha! Welche denn?
Die mit dem Wassermangel? Den Überflutungen? Hitze und Extremwetter? Chat-GPT? Na, danke. Warum hatten die sogenannten Erwachsenen nur alle eine so verdammt lange Leitung?
Es kribbelte auf ihrer Haut. Der Falter bewegte sanft die Flügel, als wollte er abheben, doch dann schien er sich anders zu entscheiden. Das Muster auf seinen Flügeln kam ihr schöner vor als jedes ihrer Tattoos. Leos Blick wanderte zum Grund des Pools, wo sich etwas bewegte. Durch den Glasboden des Schwimmbades konnte sie ihre Mutter sehen, wie sie – verzerrt von den sanften Wellen – das Wohnzimmer durchquerte, im Bademantel, unterwegs nach oben zum Schwimmen.
»Tut mir leid, mein Schöner«, flüsterte Leo. »Ich muss los. Besuch mich wieder, wenn du kannst.« Sie hob die Hand, pustete dem Schmetterling sanft unter die Flügel und sah ihm nach, wie er lautlos aufflatterte und durch das geöffnete Dach über dem Pool im Zickzack in den Abendhimmel schwirrte.
Bevor sie aufstand, schob sie ihre Bikinihose zwischen den Beinen beiseite, pinkelte in den Pool, bis ihre Blase leer war, schob den Bikini wieder zurecht und schlenderte dann am Beckenrand entlang zur Tür. Ihre Mutter kam ihr entgegen und nickte kaum merklich. »Hallo, Leo, schön, dich zu sehen.«
Warum klang alles, was sie sagte, als würde sie genau das Gegenteil meinen? Und trotzdem würde sie später am Abend wieder Everybody’s Darling sein. Souverän. Charmant. Geliebt. Von sich selbst besoffen.
»Hey, Mum. Viel Spaß beim Schwimmen«, erwiderte sie lakonisch und gab ihr ein Side-Eye.
Ihre Mutter wurde langsamer, erwiderte den Seitenblick mit einer gehobenen Augenbraue. »So freundlich heute?«
»Muss wohl an meiner guten Erziehung liegen.«
»Wenn ich’s nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast ins Becken gepinkelt.«
»Du musst ja nur drin schwimmen. Brauchst es doch nicht gleich trinken.«
»Du bist eklig, wirklich.« Der Blick ihrer Mutter streifte abschätzig ihre Tattoos.
»Das wiederum müssen die Gene sein«, lächelte Leo, ging an ihr vorbei und hob die Hand zu einem letzten ironischen Winken, bevor sie durch die Tür des Wellnessbereichs entschwand. Für einen Augenblick überlegte sie, ob sie gerade ihrer Mutter das Schwimmen verleidet hatte. Falls ja, wäre das ungünstig für ihr Vorhaben. Typisch, sie hatte mal wieder nicht nachgedacht.
Sie blieb einen Moment stehen und horchte. Nach einer guten Minute hörte sie das für einen Kopfsprung typische Geräusch. Ha! Everybody’s Darling zog seine Bahnen. Für die nächste halbe Stunde hatte sie Ruhe. Und die würde sie nutzen. Denn gestern hatte sie zufällig entdeckt, dass es im Haus einen Safe gab. In einem Moment, in dem ihre Mutter sich unbeobachtet glaubte, hatte sie den großen Spiegel in ihrem Ankleidezimmer beiseitegeschoben, eine Nummernkombination in ein Tastaturfeld eingegeben, und danach hatte sich eine mehrere Zentimeter dicke Metalltür in der Größe von zwei Schuhkartons geöffnet. Rasch hatte ihre Mutter einen Umschlag hineingelegt und dann die Tür wieder verschlossen.
Leo hatte die ganze Nacht über vor Aufregung kein Auge zugetan. In dem Augenblick, als ihre Mutter den Spiegel wieder zurückgeschoben hatte, wusste sie, dass sie herausfinden musste, was in diesem Tresor lag. Im besten Fall würde sie hinter der Tür doch noch einen Weg finden, das Haus anzuzünden. Nur theoretisch natürlich.
Kapitel 4
Art zuckte bei dem scharfen elektronischen Ton in seiner Manteltasche zusammen, ebenso wie Nele, die mit ihm etwa fünf Schritte entfernt von der Frau mit dem Hirschgeweih stand.
»Was um Himmels willen ist das?«, fragte Nele und sah ihn an.
»Nichts«, knurrte Art. Er zog sein Handy aus der Manteltasche und warf einen Blick darauf. Blutzucker zu hoch, stand neben einem gelben Warnzeichen. Er öffnete die Diabetes-App, und der Alarm verstummte. Der Wert lag bei 189, Tendenz steigend. Art verzog den Mund, steckte das Handy wieder ein und betrachtete die Tote am Baum. Er spürte Neles Blick auf sich, die offenbar das Display gesehen hatte, ignorierte sie aber ebenso wie seinen zu hohen Blutzucker. Das hier war wichtiger.
»Dein Diabetes?«, fragte Nele.
»Wenn ich meine Klappe halte«, meinte Art und wies auf ihren Bauch, »dann tu du’s bei mir auch.« Er ließ Nele stehen und ging die letzten Schritte zum Baum. Der seltsame würzige Geruch wurde intensiver.
Ein Wesen, halb Mensch, halb Tier, dachte er. Das war die Beschreibung in den sozialen Medien gewesen. Erst jetzt, aus nächster Nähe, erkannte er, was er wirklich vor sich hatte. Die Frau stand aufrecht an den Baum gefesselt, ihre Arme waren nach hinten um den Stamm geschlungen und dort zusammengebunden, die Augen dunkle Höhlen, aus denen Blut über die Wangen hinabgelaufen und geronnen war. Ihr Hals schien mit einer Art Riemen am Stamm fixiert zu sein. Ihre Haare waren eigentlich rot, wirkten aber nun stumpf und schmutzig. Das Hirschgeweih war direkt hinter ihrem Kopf am Baum befestigt, sodass es auf die Entfernung und durch die schlechten Sichtverhältnisse so gewirkt hatte, als wäre das Gehörn aus ihrem Kopf gewachsen.
»Himmel«, stöhnte Nele, die neben ihn getreten war. »Schau mal, ihre Beine.«
Arts Blick wanderte hinab. Er wusste, dass Sophie Bauer vor Schreck einen Schuss abgegeben hatte. Die Folgen waren an der linken Hüfte der Frau zu erkennen, doch das, was mit ihren Füßen und Unterschenkeln geschehen war, ließ sich nicht durch den Schuss erklären.
»Wildfraß«, sagte eine Frauenstimme hinter ihnen. Art und Nele drehten sich um. Dr. Veronika Perlau kam im weißen Overall heran. Sie blieb neben ihnen stehen und zupfte sich die Latexhandschuhe an den Fingern zurecht. Ihr gebräunter Teint wirkte seltsam unpassend hier im Nebel. Art mochte die fünfundfünfzigjährige Leiterin der Rechtsmedizin. Veronika war resolut und eine Autorität in Berlin, seit sie vor sieben Jahren von Wien hierhergewechselt hatte.
»Wer auch immer ihr das angetan hat, er wollte noch einen draufsetzen«, meinte Veronika Perlau. »Riecht ihr das?«
Art und Nele nickten.
»Die braune Paste auf ihrem Körper ist ein Lockmittel für Wild, ich würde mal vermuten für Schwarzwild. Hätte sie auf dem Boden gelegen, wäre vermutlich noch weniger von ihr übrig.«
Nele war blass geworden und wandte sich angewidert ab. »Gott, wer macht denn so was?«