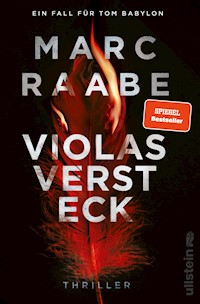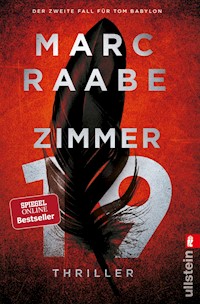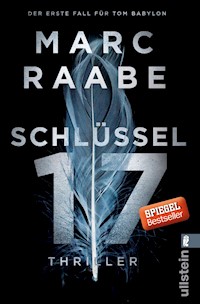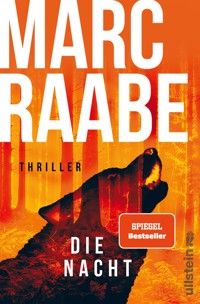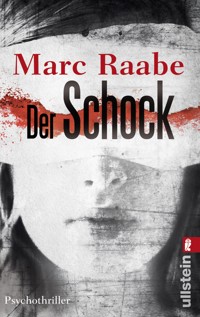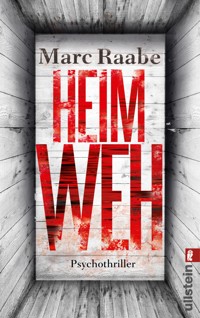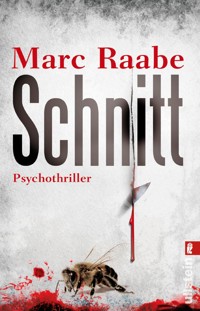
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Thriller-Bestseller von Marc Raabe! Er jagt Dich. Er kennt Dich. Er findet Dich. Bald. Ein kleiner Junge beobachtet einen grausamen Mord. Und er vergisst. Dreißig Jahre lang. Bis seine Freundin in die Hände eines gefährlichen Psychopathen gerät. Nur wenn er sich erinnert, kann er sie retten. Doch das bringt ihn in tödliche Gefahr. »Eine hochspannende Entdeckung.« Sebastian Fitzek *** Für Fans von Freida McFadden und Sebastian Fitzek ein Muss. Bestseller-Autor Marc Raabe garantiert schlaflose Nächte! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage April 2012 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Titelabbildung: © Messer: gettyimages/science photo library; Biene: shutterstock, SimonG
Für Meike
»Jeder von uns ist sein eigener Teufel,und wir machen uns diese Welt zur Hölle.«
oscar wilde
1979
Prolog
Westberlin – 13. Oktober, 23:09 Uhr
Gabriel stand an der Türschwelle und starrte hinab. Das Licht aus dem Hausflur fiel die Kellertreppe hinunter und wurde von den Ziegelwänden verschluckt.
Er hasste den Keller, besonders nachts. Nicht etwa, dass es einen Unterschied gemacht hätte, ob es draußen hell oder dunkel war. Im Keller war es immer Nacht. Doch tagsüber konnte man nach oben flüchten, raus in den Garten, raus ins Licht. Nachts dagegen war es überall finster, auch draußen, und in jeder Ecke hockten Gespenster. Gespenster, die kein Erwachsener sehen konnte. Gespenster, die nur darauf warteten, einem elfjährigen Jungen die Klauen in den Nacken zu schlagen.
Trotzdem konnte er nicht anders, als gebannt nach unten zu starren, in den hinteren Teil des Kellers, wo das Licht verebbte.
Die Tür!
Sie war offen!
Ein schwarzer Spalt klaffte zwischen der dunkelgrauen Wand und der Tür. Dahinter lag das Labor, dunkel wie Darth Vaders Todesstern.
Sein Herz schlug bis zum Hals. Fahrig wischte Gabriel sich die feuchten Hände am Schlafanzug ab, seinem Lieblingsschlafanzug, dem mit Luke Skywalker von Star Wars auf der Brust.
Der schwarze hohe Türspalt zog ihn magisch an. Langsam setzte er seinen nackten Fuß auf die erste Stufe. Das Holz der Kellertreppe fühlte sich rau an und knarrte verräterisch. Doch er wusste, dass sie ihn nicht hören würden. Nicht solange sie stritten, hinter der verschlossenen Küchentür. Es war ein schlimmer Streit. Schlimmer als sonst. Und es jagte ihm Angst ein. Gut, dass David nicht dabei war, dachte er. Gut, dass er ihn in Sicherheit gebracht hatte. Sein kleiner Bruder hätte geweint.
Und trotzdem wäre es jetzt gut, nicht allein zu sein, in diesem Keller, mit den Gespenstern. Gabriel schluckte. Der Spalt starrte ihn an wie ein Höllenschlund.
Sieh nach! Luke würde es auch tun.
Vater würde toben, wenn er ihn jetzt sehen könnte. Das Labor war Vaters Geheimnis, und es war gesichert wie eine Festung, mit einer Tür aus Metall und einem schwarz glänzenden Türspion. Niemand sonst hatte das Labor jemals gesehen. Selbst Mutter nicht.
Gabriels Fußsohlen berührten den nackten Betonboden des Kellers, und er schauderte. Erst die warmen Holzstufen und nun der kalte Stein.
Jetzt oder nie!
Plötzlich drang ein helles Knurren durch die Kellerdecke. Gabriel zuckte zusammen. Das Geräusch kam aus der Küche über ihm. Es klang, als wäre der Tisch über die Fliesen geschrammt. Für einen Moment überlegte er, ob er besser nach oben gehen sollte. Mutter war dort ganz alleine mit ihm, und Gabriel wusste, wie wütend er werden konnte.
Sein Blick flog zurück, zu der im Dunkeln schimmernden Tür. Eine solche Gelegenheit würde es vielleicht nie wieder geben.
Er hatte schon einmal hier gestanden, etwa zwei Jahre war das her. Damals hatte Vater vergessen, die obere Kellertür zu verriegeln. Gabriel war neun gewesen. Er hatte eine Weile im Hausflur gestanden und hinuntergespäht. Am Ende hatte die Neugier gesiegt. Auch damals war er die Treppe in den Keller hinuntergeschlichen, voller Angst wegen der Gespenster und trotzdem in völliger Dunkelheit, weil er es nicht wagte, das Licht einzuschalten.
Der Türspion hatte rot geglüht, wie das Auge eines Monsters.
Hals über Kopf war er wieder nach oben geflüchtet, zurück zu David ins Kinderzimmer, und in sein Bett gekrochen.
Jetzt war er elf. Jetzt stand er wieder hier unten, und das Monsterauge glühte nicht. Dennoch, der Türspion starrte ihn an, kalt und schwarz, wie ein totes Auge. Nur das bisschen Licht auf der Kellertreppe und er selbst spiegelten sich darin. Je näher er kam, desto größer wurde sein Gesicht.
Aber warum roch es hier eigentlich so widerlich?
Seine nackten Füße tasteten sich vor, und er trat in etwas Nasses, Breiiges. Kotze. Das war Kotze! Deshalb roch es hier so widerlich. Aber warum war ausgerechnet hier Kotze?
Er würgte den Ekel herunter und scheuerte sich den Fuß an einer trockenen Stelle des Betonbodens sauber. Trotzdem blieb etwas zwischen seinen Zehen kleben. Er hätte jetzt gerne ein Handtuch gehabt oder einen nassen Lappen, aber das Labor war wichtiger. Er streckte seine Hand vor, legte sie auf die Klinke, zog die schwere Metalltür ein wenig weiter auf und schob sich in die Dunkelheit. Eine unnatürliche Stille hüllte ihn ein.
Grabesstille.
In seine Nase stieg ein scharfer chemischer Geruch, wie im Filmkopierwerk, in das Vater ihn einmal nach einem seiner Drehtage mitgenommen hatte.
Sein Herz galoppierte. Viel zu schnell, viel zu laut. Er wünschte, er wäre woanders, bei David vielleicht, unter der Bettdecke.
Luke Skywalker würde sich niemals unter der Bettdecke verkriechen.
Die Finger seiner linken Hand suchten zitternd nach dem Lichtschalter, ständig darauf gefasst, etwas ganz anderes zu finden. Was, wenn sie hier waren, die Gespenster? Wenn sie seinen Arm packten? Wenn er ihnen aus Versehen ins Maul fasste und sie ihre Zähne zusammenschlugen?
Da! Kühles Plastik.
Er drückte den Schalter. Drei rote Lampen flammten auf und tauchten den Raum vor ihm in eine eigentümliche dunkelrote Glut.
Rot, wie im Bauch eines Monsters.
Ein Kribbeln stieg seinen Rücken empor, bis zu den Haarwurzeln. Er blieb an der Schwelle zum Labor stehen, irgendwie war da so etwas wie eine unsichtbare Grenze, die er nicht übertreten wollte. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, Einzelheiten zu erkennen.
Das Labor war größer, als er gedacht hatte, ein Schlauch, etwa drei Meter breit und sieben Meter tief. Direkt neben ihm hing ein schwerer Vorhang aus schwarzem Molton. Jemand hatte ihn hastig beiseitegerafft.
Unter der Betondecke waren Wäscheleinen gespannt, an denen Fotos hingen. Einige waren heruntergerissen worden und lagen auf dem Boden.
Auf der linken Seite stand ein Vergrößerer für Fotos. Rechts erstreckte sich ein Regal über die gesamte Wand, vollgepackt mit Geräten. Gabriels Augen weiteten sich. Die meisten der Geräte erkannte er sofort: Arri, Beaulieu, Leicina, und dazwischen noch andere, kleinere Kameras. Die Fachzeitschriften, die sich in Vaters Arbeitszimmer im ersten Geschoss stapelten, waren voll davon. Immer, wenn eine dieser Zeitschriften in den Müll gewandert war, hatte Gabriel sie herausgefischt, unter seinem Kopfkissen deponiert und abends unter der Decke im Taschenlampenschein gelesen, bis ihm die Augen zufielen.
Neben den Kameras lagen ein Dutzend Objektive, einige so lang wie Gewehrläufe; daneben kleinkalibrige Fotoapparate, Hüllen zum Dämpfen der Laufgeräusche der Kameras, 8- und 16-mm-Filmpatronen, ein Stapel aus drei VHS-Videorecordern mit vier Monitoren und zuletzt: zwei nagelneue Videocamcorder. Plastikbomber schimpfte Vater die Dinger immer. In einer der Zeitschriften hatte er gelesen, man könne mit der neuen Videotechnik fast zwei Stunden filmen, ohne die Kassette zu wechseln – einfach unglaublich! Dazu kam, dass die Plastikbomber nicht so ratterten wie Filmkameras, sondern geräuschlos liefen.
Gabriels Blick wanderte über die Schätze, seine Augen glänzten. Er wünschte, er könnte das alles hier David zeigen. Sofort bekam er ein schlechtes Gewissen. Schließlich war das hier gefährlich. Da durfte er David nicht mit hineinziehen. Außerdem hatte sein Bruder schon geschlafen. Es war richtig gewesen, die Tür vom Kinderzimmer abzuschließen.
Plötzlich polterte es laut. Erschrocken fuhr er herum. Doch da war niemand. Keine Eltern, kein Gespenst. Sie stritten wohl immer noch, oben in der Küche.
Er blickte zurück ins Labor, auf all die Schätze. Komm näher, schienen sie zu flüstern. Aber er stand immer noch an der Schwelle, neben dem Vorhang. Furcht kroch in ihm empor. Noch konnte er zurück. Er hatte das Labor ja jetzt gesehen, er musste es nicht auch noch betreten.
Elf! Du bist elf! Komm schon, sei kein Feigling.
Wie alt war eigentlich Luke?
Zögernd tat Gabriel zwei Schritte in den Raum.
Was waren das für Fotos? Er bückte sich, hob eins vom Boden auf und starrte auf das verwaschene grobkörnige Bild. Ein jähes Gefühl von Ekel und eine seltsame Erregung breiteten sich in seinem Unterleib aus. Er sah nach oben, auf die Fotos, die an der Wäscheleine hingen. Das Bild direkt über ihm zog seinen Blick an wie ein Magnet. Sein Kopf wurde heiß und rot, wie alles um ihn herum auch. Zugleich wurde ihm ein wenig übel. Es sah so echt aus, so … oder waren das Schauspieler? Es sah aus wie im Film! Diese Säulen, die Mauern, wie im Mittelalter, und die schwarzen Kleider …
Er riss sich los, und sein Blick sprang über die zerwühlte Ablage, das Regal und blieb schließlich an den modernen Videorecordern hängen, auf denen kleine JVC-Logos glitzerten. Der unterste davon war eingeschaltet. In seiner spiegelblanken Anzeige leuchteten Zahlen und Zeichen. Wie bei Star Wars, im Cockpit eines Raumschiffs, dachte er.
Gabriels Zeigefinger näherte sich wie von selbst den Tasten und drückte eine davon. Er zuckte zusammen, als es im Inneren des Gerätes laut klackte. Zweimal, dreimal, dann das Surren eines Motors. Eine Kassette! In dem Gerät steckte eine Kassette! Seine Stirn brannte. Fiebrig drückte er einen weiteren Knopf. Der JVC antwortete ratternd. Störstreifen zuckten über den Monitor neben den Videorecordern. Das Bild zappelte noch einen Moment, dann war es da. Diffus, mit flimmernden Farben, unwirklich, wie ein Fenster zu einer anderen Welt.
Unwillkürlich hatte Gabriel sich vorgebeugt – und zuckte jetzt zurück. Sein Mund wurde ganz trocken. Das gleiche Bild wie auf dem Foto! Der gleiche Ort, die gleichen Säulen, die gleichen Menschen, nur dass sie sich bewegten. Er wollte den Blick abwenden, aber es war unmöglich. Er sog die stickige Luft durch den offenstehenden Mund ein und hielt dann den Atem an, ohne es zu bemerken.
Wie ein Blitzlichtgewitter hämmerten die Bilder auf ihn ein, und er konnte nicht anders, als gebannt zuzusehen.
Der Schnitt durch den schwarzen Stoff des Kleides.
Das helle Dreieck auf der noch helleren Haut.
Die wirren langen blonden Haare.
Das Chaos.
Und dann noch ein Schnitt – eine wütende und scharfe Bewegung, die sich förmlich in Gabriels Eingeweide übertrug. Schlagartig war ihm übel, und alles drehte sich. Der Fernseher starrte ihn bösartig an. Zitternd fand er den Knopf.
Aus! Weg!
Mit einem dumpfen Fump stürzte das Bild in sich zusammen, als gäbe es im Monitor eins von diesen schwarzen Löchern, wie im Weltraum. Das Geräusch war schrecklich und zugleich beruhigend. Er starrte auf die dunkle Mattscheibe, in die Spiegelung seines eigenen, rot leuchtenden Gesichts. Ein Gespenst mit schreckgeweiteten Augen starrte zurück.
Nicht dran denken! Nur nicht dran denken … Er starrte auf die Fotos, auf das ganze Durcheinander, nur ja nicht auf den Monitor.
Was du nicht siehst, ist nicht da!
Aber es war da. Irgendwo im Monitor, tief drinnen im schwarzen Loch. Aus dem Videorecorder drang ein leises schleifendes Geräusch. Er wollte die Augen zukneifen und an einem anderen Ort wieder aufwachen. Egal wo. Nur nicht hier. Immer noch hockte er vor seinem gespenstischen Spiegelbild in den Monitoren.
Plötzlich überkam Gabriel der verzweifelte Wunsch, etwas Schönes zu sehen oder einfach nur etwas anderes. Als hätten sie einen eigenen Willen, steuerten seine Finger auf die anderen Monitore zu.
Fump. Fump. Die beiden oberen Monitore blitzten auf. Zwei flaue Videobilder kristallisierten sich und warfen einen stahlblauen Schimmer in das rote Laborlicht. Das eine Bild zeigte den Hausflur und die geöffnete Kellertür; die Treppe wurde von der Dunkelheit verschluckt. Das zweite Bild zeigte die Küche. Die Küche und – seine Eltern. Aus dem Lautsprecher schnarrte die Stimme seines Vaters.
Gabriel riss die Augen auf.
Nein! Bitte, nein!
Sein Vater stieß gegen den Küchentisch. Die Tischbeine schrammten hart über den Boden. Das Geräusch übertrug sich durch die Decke, und Gabriel zuckte zusammen. Sein Vater riss eine Schublade auf, griff hinein, und seine Hand kam wieder hervor.
Gabriel starrte entsetzt auf den Monitor. Er blinzelte und wünschte sich, er wäre blind! Blind und taub.
War er aber nicht.
Tränen schossen ihm in die Augen. Der chemische Geruch des Labors, vermischt mit dem Erbrochenen vor der Tür, ließ ihn würgen. Er wünschte sich, dass jemand kommt, ihn in den Arm nimmt, alles wegredet.
Aber niemand würde kommen. Er war alleine.
Die Erkenntnis traf ihn wie ein Keulenschlag. Jemand musste etwas tun. Und er war der Einzige, der jetzt noch etwas tun konnte.
Was würde Luke tun?
Leise, mit nackten Füßen, die den kalten Boden nicht mehr spürten, schlich er die Kellertreppe hinauf. Das rote Zimmer in seinem Rücken glühte wie die Hölle.
Hätte er nur ein Laserschwert! Und dann, ganz plötzlich, fiel ihm etwas viel, viel Besseres ein als ein Schwert.
29 Jahre später
Kapitel 1
Berlin – 1. September, 23:04 Uhr
Das Foto schwebt wie ein böses Versprechen in dem fensterlosen Keller. Draußen tobt der Regen. Das alte Dach der Villa ächzt unter den Wassermassen, und an der Fachwerkfassade, direkt über der Haustür, rotiert ein dunkelrotes Licht und lässt die Villa im Sekundentakt aufglühen.
Die Taschenlampe zuckt durch die Dunkelheit des Kellerflurs, wie ein Finger aus Licht, der das schwarz glitzernde Kleid streift, das an einem Bügel hängt wie eine aufgeschlitzte Puppe. Das Foto, das mit einer Nadel am Kleid festgesteckt ist, sieht aus der Entfernung aus wie ein Stück Tapete. Es ist blass, und die Tinte des Druckers hat sich in das einfache Papier gesaugt, so dass die Farben stumpf sind, wie abgestorben.
Das Kleid mit dem Foto daran schaukelt noch, der Bügel ist eben erst aufgehängt worden, und durch das Schaukeln wirkt es wie ein Windspiel. Lebendig und dennoch tot.
Das Foto zeigt eine junge, sehr dünne und herzzerreißend schöne Frau. Ihre Figur ist schmal und fast knabenhaft, ihre Brüste sind klein und flach, und ihr Gesicht ist in Ausdruckslosigkeit erstarrt.
Ihre sehr langen und sehr blonden Haare sind wie ein zerknittertes gelbes Laken unter ihrem Kopf. Das Kleid, das sie trägt, ist dasselbe, an dem nun dieses Foto mit einer Nadel befestigt ist. Es ist ihr wie auf den Leib geschneidert, es ist wie sie: fließend, extravagant, nutzlos und teuer. Und es ist auf der Vorderseite geöffnet, mit einem durchgehenden Schnitt, als hätte es einen offenen Reißverschluss.
Ihre Haut unter dem Kleid ist ebenfalls geöffnet, mit einem scharfen Schnitt, ausgehend vom Schoß, übers Schambein bis hin zur Brust. Die Bauchdecke klafft auseinander, das fleischige Rot der Innereien ist in gnädige Dunkelheit gehüllt. Das schwarze Kleid umfließt den Körper wie der Tod. Ein perfektes Sinnbild, so wie der Ort, an dem das schwarze Kleid jetzt hängt und darauf wartet, von ihm gefunden zu werden: im Kadettenweg 107.
Der Strahl der Taschenlampe richtet sich noch mal auf den klobigen grauen Kasten an der Wand und das angelaufene Schloss. Der Schlüssel hatte gepasst, ließ sich aber nur schwerfällig drehen, als müsste er sich erst erinnern, was seine Aufgabe ist. Eine unregelmäßige Reihe kleiner roter Birnen glimmt darin, drei sind kaputt. Zerfressene Wolframfädchen im Laufe der Jahre. Aber das macht nichts. Die Birne, auf die es ankommt, leuchtet.
Eilig tastet sich der Strahl der Taschenlampe zurück zur Kellertreppe und die Stufen empor. Im Lichtkegel sind Fußspuren, und das ist gut so. Sie werden ihn leiten, wenn er hierherkommt, ihn die Kellertreppe hinabführen bis zum schwarzen Kleid. Und bis zum Foto.
Er wird sich schlagartig erinnern. Seine Nackenhaare werden sich aufrichten, und er wird sich sagen: Das ist unmöglich.
Und dennoch: Es ist so. Er wird es wissen. Schon alleine wegen des Kellers, auch wenn es nicht dieser Keller war. Es war ja auch nicht diese Frau. Und natürlich wird es auch eine andere Frau werden. Seine Frau.
Und das an ihrem Geburtstag. Ein hübsches Detail!
Doch das Beste ist, wie sich der Kreis schließt. Denn in einem Keller hat alles angefangen, und in einem Keller wird alles enden.
Keller sind die Vorhöfe der Hölle. Und wer sollte das besser wissen als jemand, der seit einer Ewigkeit in der Hölle brennt.
Kapitel 2
Berlin – 1. September, 23:11 Uhr
Der Alarm ist inzwischen bereits neun Minuten alt. Jeder andere hätte auf dem Weg zum Wagen nach seiner Waffe gegriffen, wenigstens kurz, nur um zu fühlen, ob sie da steckt, wo sie für alle Fälle sein sollte: im Holster, direkt an der Hüfte.
Gabriel greift nicht danach; er trägt keine Waffe. Seit er denken kann, bereiten Pistolen ihm ein tiefsitzendes Unbehagen. Ganz abgesehen davon, dass ihm wohl keine deutsche Behörde einen Waffenschein ausstellen würde.
Das Wasser rinnt ihm bereits in den Kragen, als er den Wagen erreicht. Gabriel drückt den Fernauslöser für die Zentralverriegelung, und die Lichter flammen orange in der Dunkelheit auf. Er wirft sich in den Sitz und donnert die Fahrertür zu. Wasser spritzt von der nassen Gummifalz der Tür in sein Gesicht. Es gießt, als müsste der Himmel einen Flächenbrand löschen. Gabriel starrt in den Rückspiegel, wo seine Augenpartie wie ausgestanzt vor der Windschutzscheibe hängt.
Er weiß, dass er sofort den Motor starten sollte, aber ein innerer Widerstand hindert ihn daran; unter seiner Haut fließt ein warnendes Kribbeln, wie ein elektrischer Strom. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und das ausgerechnet heute. Ausgerechnet jetzt.
Scheiß der Hund drauf, Luke. Was wartest du noch? Doch nicht etwa wegen ihr?, flüstert eine drängende Stimme in seinem Kopf.
Ich hab ihr versprochen, dass ich um kurz nach zwölf da bin, denkt Gabriel.
Das hast du ihr nicht versprochen. Sie hat es nur so verstanden. Nicht dein Problem, wenn sie so zickig reagiert.
Scheiße, murmelt er.
Scheiße? Warum? Siehst du nicht, was sie mit dir macht? Kaum lässt du dich auf jemanden ein, wirst du zum Schwächling. Als wüsstest du nicht, wie gefährlich das ist! Kümmere dich lieber um den Alarm.
Gabriel presst die Zähne aufeinander. Verdammter Alarm. Seit zwanzig Jahren ist er jetzt bei Python, und mit Abstand die meiste Zeit hat er mit Alarmanlagen zugebracht oder mit Personenschutz. Bis vor einigen Monaten hat er sogar auf dem umzäunten Gelände der Sicherheitsfirma gewohnt, in zwei spartanisch eingerichteten Zimmern, kurz vor dem Gittertor zur Straße. Yuri, sein Chef, hatte ihn unter seine Fittiche genommen und ihm Halt gegeben. Morgens Kampfsport-Training, ab 18:00 Uhr das Abendgymnasium und in jeder freien Minute dazwischen Python. Das Problem waren die Wochenenden. Wenn es zu wenig zu tun gab, war die Erinnerung über ihm zusammengeschlagen. Bis er den Unfallwagen in Yuris Garage entdeckte, einen alten Mercedes SL. Yuri überließ ihm das ramponierte Cabrio, und Gabriel, der noch nie etwas mit Autos zu tun gehabt hatte, stürzte sich in die Reparatur, als gelte es, seine Seele zu restaurieren.
Als der Mercedes fertig war, verschaffte Yuri ihm einen Jaguar E-Type und danach immer andere Klassiker aus den 70ern, so dass die Garage nie leer blieb.
Das Einzige, was Yuri dafür verlangte, war, dass er seinen Job machte. Und dafür brauchte Gabriel nun wirklich keine Aufforderung, denn wenn es für ihn überhaupt so etwas gibt wie ein Zuhause, dann ist es sein Job.
Regungslos starrt Gabriel in den Rückspiegel. Der Regen tobt auf der Motorhaube im Schein der Hofbeleuchtung. Seine Augen glänzen farblos in der Dunkelheit, und die drei kurzen, steil aufragenden Falten zwischen seinen Brauen gleichen tiefen Gräben.
Gabriel dreht den Zündschlüssel. Das Starten des Motors geht im Prasseln des Regens auf dem Wagendach unter. Er wirft den Scheibenwischer an, dann gibt er Gas, und der anthrazitfarbene VW Golf mit dem gelben Schriftzug Python Security prescht über den Hof, an den anderen Wagen des Fuhrparks vorbei, durch das offene Gittertor hinaus auf die Straße, wo der dunkelgraue Wagen in der dunkelgrauen Regennacht verschwimmt.
Kadettenweg 107.
Bis vor wenigen Minuten hatten sie noch nicht einmal gewusst, dass diese Adresse bei Python aufgeschaltet war. Der Alarm kam förmlich aus dem Nichts. Bert Cogan hatte mit seinen stets geröteten Augen auf den Monitor in der Zentrale gestiert, als hätte sich dort soeben ein Geisterhaus materialisiert. Cogan arbeitete seit über neun Jahren für Python, die Monitore waren sein persönliches Paralleluniversum, im Villenviertel Lichterfelde kannte er jeden Pixel und jedes Haus, das von Python gesichert wurde. »He, sieh dir das mal an«, hatte er konsterniert gemurmelt.
»Was denn?«, fragte Gabriel.
»Na, das hier!«, raunzte Cogan. Mit seinem bleichen, rissigen Zeigefinger deutete er auf einen rot blinkenden Punkt auf dem Screen. »Kannst du mir erklären, was das für ein Haus ist?«
Gabriel zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Wenn du’s nicht weißt, ich weiß es erst recht nicht.«
»Ich dachte ja nur«, sagte Cogan und nestelte an den Bartstoppeln, die sein fliehendes Kinn überzogen.
»Was dachtest du?«
»Na ja«, murmelte er, »weil du doch schon ’ne halbe Ewigkeit dabei bist …«
»Dass ich schon ewig für Yuri arbeite, ist eins.« Gabriel deutete auf die Monitore. »Das da ist etwas ganz anderes. Hast du mal im Verzeichnis nachgesehen?«
Cogan grunzte. »Muss ich nicht. Ich kenn das Verzeichnis Lichterfelde. Da ist nichts. Überhaupt nichts.«
Gabriel runzelte die Stirn und sah auf den stumm pulsierenden roten Punkt mit der 107, direkt neben der dünnen weißen Linie mit der Aufschrift Kadettenweg. Ein seltsames Ziehen kroch von seinem Nacken die Wirbelsäule abwärts.
Was ist los, Luke?, flüsterte die Stimme in seinem Kopf. Das ist nur ein roter Punkt, wie alle anderen auch. Das hattest du schon tausendmal. Also stell dich nicht an!
»Schon gut. Schon gut«, murmelte er leise, ohne es zu merken.
»Was hast du gesagt?«, fragte Cogan.
»Hm? Ach, nichts«, sagte Gabriel rasch. Schweigend fischte er das Handy aus der Innentasche seiner schwarzen Lederjacke und wählte die Mobilnummer von Yuri Sarkov.
Es klingelte eine Weile, dann hob Yuri ab. »Hallo Gabriel«, schnarrte er. Seine Stimme klang hellwach, obwohl es in Moskau bereits deutlich nach ein Uhr war. »Was gibt’s?«
»Hallo«, murmelte Gabriel und fragte sich einmal mehr, ob Yuri jemals in seinem Leben schlief oder das Telefon abstellte. »Wir haben hier was Merkwürdiges. Ein stiller Alarm in Lichterfelde-West, mitten im Villenviertel. Aber das Haus gehört gar nicht zu unseren Kunden.«
»Hm. Wie ist denn die Adresse?«
»Kadettenweg 107«, sagte Gabriel und hielt das Handy so, dass Cogan mithören konnte.
Stille. Nur ein leises Rauschen in der Leitung.
»Yuri? Bist du noch dran?«
»107? Kadettenweg? Bist du sicher?«, fragte Yuri.
»Steht hier auf dem Monitor«, brummte Gabriel. »Sagt dir das was?«
»Bljad«, murmelte Yuri, so leise, dass Gabriel es kaum verstehen konnte. Yuri war Halbrusse, und immer wenn es etwas zu fluchen gab, wechselte er automatisch ins Russische.
»Ist das ein Kunde von uns?«
»Eigentlich schon.«
Eigentlich? Gabriel hob die Brauen. Entweder jemand war Kunde oder eben nicht. »Wer ist denn der Besitzer? Wenn du ’ne Telefonnummer hast, kümmere ich mich drum.«
»Das Haus ist nicht bewohnt«, entgegnete Yuri.
Gabriel schwieg einen langen Moment. »Und jetzt?«
Aus dem Telefon quoll Stille. Gabriel sah Yuri Sarkov förmlich vor sich, irgendwo in Moskau, bei einem lästigen Verwandtenbesuch, sah, wie er überlegte, das Telefon ans Ohr gepresst, die schmalen Lippen ausdruckslos und immer etwas blau, das schüttere Haar, die randlose Buchhalterbrille, dahinter die grauen Augen, die für einen Sechzigjährigen von derart wenig Falten umgeben waren, dass man vermuten musste, dass er weder lachte noch wütend wurde und die Haut in seinem Gesicht gar nicht wusste, in welche Richtung sie die Falten werfen sollte.
Schließlich seufzte Yuri. »Schick jemanden vorbei. Wer ist denn noch da?«
»Nur noch Cogan und ich. Sollen wir’s bei der Polizei melden?«
»Nein, nein. Ist unsere Sache. Hört sich nicht nach was Großem an. Schick Cogan, das reicht.«
Cogan schüttelte vehement den Kopf und deutete auf seine Beine. Gabriel signalisierte ihm, den Mund zu halten. »Warum Cogan? Der macht doch sonst keinen Außendienst.«
»Ich sagte: Schick Cogan«, knurrte Yuri gereizt. »Sonst klebt der noch an seinem Monitor fest. Der weiß schon gar nicht mehr, wie das draußen ist.«
»Okay. Cogan fährt«, sagte Gabriel. »Und wer ist der Besitzer? Muss ich da nicht anrufen, bevor jemand von uns aufkreuzt?«
»Lass das mal meine Sorge sein«, sagte Yuri. »Du übernimmst die Zentrale, solange Cogan weg ist.«
Cogan rollte mit den Augen, breitete in demonstrativer Verzweiflung die Arme aus und deutete wieder auf seine Beine.
»Und die Schlüssel?«, fragte Gabriel.
»Gib mir einfach Cogan, ja?«
Wortlos reichte Gabriel den Hörer an seinen Kollegen weiter. Cogan drückte das Telefon mit einem gequälten Gesichtsausdruck an sein Ohr. »Chef?«
»Hör zu«, schnarrte Sarkovs Stimme leise aus dem Hörer, »ich will, dass du da vorbeischaust. Aber mach nichts auf eigene Faust, klar? Nur die übliche Routine, mehr nicht! Ich will erst mal wissen, was da eigentlich los ist.«
»Chef, könnte nicht … Ich meine … eigentlich hab ich gar keinen Außendienst und –«
»Halt einfach die Klappe und mach, was ich sage«, bellte Sarkovs Stimme aus dem Hörer.
»Alles klar, Chef«, sagte Cogan rasch. Auf seinen Wangen traten rote Flecken hervor.
»Die Schlüssel sind im kleinen Schlüsselsafe bei mir im Büro. Es steht K107 drauf. Die Kombination ist auf 3722 eingestellt. Meld dich, wenn du weißt, was da los ist, klar?«
»Klar«, antwortete Cogan beklommen, aber Sarkov hatte bereits aufgelegt. Cogan ließ den Hörer sinken und sah Gabriel an. »Scheiße, Mann«, stöhnte er leise und rieb sich die Stirn. »Der ahnt was.«
Gabriel verzog den Mund. Cogan war Diabetiker, und sein Zucker war seit Jahren miserabel eingestellt. Inzwischen bekam er regelmäßig Wadenkrämpfe, hatte Schmerzen in den Beinen, und das Laufen fiel ihm zunehmend schwer. Dennoch gab er sich die größte Mühe, das vor Sarkov zu verbergen. Er wusste, dass seine Chancen, bei Python mit einer Behinderung arbeiten zu können, gleich null waren. Mit leerem Blick starrte er jetzt auf den rot pulsierenden Punkt auf seinem Monitor. »Ich pack das nicht. Nicht mit den Schmerzen.«
Gabriel biss sich auf die Lippen. Er wusste, dass Cogan nicht in der Lage war, nach Lichterfelde zu fahren. Andererseits wartete Liz auf ihn, und wenn er den Innendienst übernahm, dann konnte er um zwölf an Jegorow übergeben und würde pünktlich hier verschwinden.
»Verflucht«, stöhnte Cogan, »was mach ich denn, wenn da wirklich einer ist? Ich kann ja noch nicht mal wegrennen.«
»Du sollst ja auch nicht wegrennen. Immerhin hast du ’ne Waffe.«
Cogan zog eine Grimasse. Es sollte wütend aussehen, aber im Grunde war es die reine Verzweiflung.
»Ist schon gut«, sagte Gabriel. »Ich fahre. Ich hab ja schließlich Außendienst.«
Cogan seufzte erleichtert auf. »Sicher?«
Gabriel nickte halbherzig. Er dachte daran, dass er frühestens in zwei Stunden zurück sein würde, und fragte sich, wie er Liz das beibringen sollte, ohne dass sie bitter enttäuscht war.
»Und Sarkov?«, fragte Cogan. »Was sagen wir dem?«
»Yuri muss es ja nicht wissen. Ich ruf dich an und erzähl dir, was los ist. Dann kannst du mit ihm telefonieren.«
»Okay.« Cogans trübe Augen nahmen einen schwachen Glanz an. »Danke, Mann. Das rettet mir den Arsch.«
Gabriel lächelte schief. »Und du bist sicher, dass im Verzeichnis nichts über den Kunden steht?«
Cogan zuckte mit den Schultern. »Auch wenn ich lahme Beine hab, hier oben«, er tippte sich gegen die Stirn, »da läuft’s noch.«
Gabriel nickte und warf einen raschen Blick auf die Uhr. »Scheiße«, murmelte er. Nur eine halbe Stunde später, und seine Schicht wäre beendet gewesen. Er stand auf, wählte Liz’ Nummer und hastete die Treppe empor, zu Yuris Büro, um den Schlüssel zu holen.
Als sie abhob, hatte er Mühe, ihre Stimme aus dem Kneipenlärm herauszufiltern, der sie umgab.
»Liz? Ich bin’s.«
»Hey.« Ihre Stimme klang aufgekratzt. »Ich bin noch im Linus, hab bis eben mit Vanessa gequatscht, aber die ist jetzt nach Hause. Kommst du her? Wir stoßen noch an und machen einen Mitternachtsspaziergang im Park.«
Linus. Auch das noch. Plötzlich war er froh, eine Ausrede zu haben. Ins Linus würden ihn keine zehn Pferde bekommen. »Ehrlich gesagt«, brummte Gabriel und betrat Sarkovs Büro, »hab ich ein Problem hier. Ich muss noch mal raus.«
»O nein. Bitte nicht«, sagte Liz. »Nicht heute.«
Gabriel tippte die Kombination auf das Tastenfeld des Schlüsselsafes, und die Tür entriegelte sich. Vor ihm hingen drei Dutzend Schlüssel von Pythons VIP-Kunden.
»Liegt’s an der Kneipe?«, fragte Liz. »Wenn du keine Lust auf das ganze Medienvolk hast – du musst ja nicht reinkommen. Hol mich einfach nur ab.«
»Darum geht’s nicht.«
»Geht’s um David? Komm schon, du kannst nicht ewig vor ihm davonlaufen. Außerdem ist er sowieso nicht hier.«
»Liz, darum geht’s nicht. Wie gesagt, ich muss noch mal raus.«
Sie schwieg einen Moment. »Kann das nicht jemand anders machen?«
»Keine Chance«, sagte Gabriel, »leider.« Die Sache mit Cogan verschwieg er lieber. Sie hätte es ohnehin nur falsch aufgefasst.
»Du hast echt einen Scheißjob«, sagte Liz.
»Du doch auch«, schoss Gabriel zurück. Mit spitzen Fingern nahm er einen Bund mit zwei angelaufenen Sicherheitsschlüsseln vom Haken, an dem ein blassroter Plastikanhänger mit der Aufschrift K107 baumelte. »Und bisher hat’s dich nicht gestört.«
Sie seufzte, sagte aber nichts. Auf irgendetwas schien sie zu warten. Der Kneipenlärm hörte sich an wie eine Markthalle im Blecheimer.
»Okay«, seufzte sie erneut. »Dann wohl wie immer.«
»Liz, hör zu, ich –«
»Erspar es mir, ja? Außerdem muss ich auf Toilette.« Sie legte auf, und der Kneipenlärm verstummte abrupt.
Gabriel fluchte leise, schloss den Schlüsselsafe und hastete die Treppe hinunter. Dann wohl wie immer. Irgendwann heute Nacht würde er zu ihr ins Bett steigen, Liz würde sich ein- oder zweimal unruhig hin und her werfen, und es würde genau das passieren, was er immer noch nicht fassen konnte.
Er würde einschlafen.
Kein An-die-Decke-Starren, keine losen Erinnerungsfetzen, die ihn wie Blitzlichter wach hielten. Nur seine Träume waren nicht verschwunden, auch wenn sie öfter in ihrer dunklen Höhle blieben, wie in Lauerstellung, um ihn nur noch manchmal zu überfallen, mit toten Augen, mit Elektroschocks oder dem Gefühl, bei lebendigem Leib zu verbrennen. Doch anders als früher gab es jetzt etwas, das ihn beruhigte, wenn er mit rasendem Herz hochschreckte, aus einem wirren Traum, der so real war, dass die Realität ihm dagegen vorkam wie eine Sinnestäuschung.
Kaum zwei Minuten später steuerte Gabriel den Golf über den Hof von Python, an seiner alten Wohnung und der Garage mit seinen zwei Motorrädern vorbei, durch das offene Gittertor hinaus auf die Straße, wo er nach links abbog und dem Navi in Richtung Kadettenweg folgte.
Er vermisst seine alte Wohnung nicht, im Gegenteil. Er hat das Gefühl, etwas Lästiges abgestreift zu haben, wie einen alten verkrusteten Teil seiner Seele. Als er damals, vor einem Jahr, zu Yuri ging, hatten ihn Schuldgefühle gedrückt. Yuri hatte ihm ein neues Leben verschafft. Aber dennoch wusste Gabriel, dass er nicht länger auf dem Gelände von Python leben konnte. Zwanzig Jahre lang hatte er das getan, und erst durch Liz war ihm bewusst geworden, dass er etwas ändern musste, wenn er nicht endgültig zu einem Pflasterstein auf dem Hof von Python Security werden wollte.
Yuri hatte die dünnen Brauen gehoben und ihn lange angesehen. Seine grauen Augen suchten nach dem wirklichen Grund. »Was ist los mit dir? Ist dir die Wohnung nicht mehr groß genug?«
Gabriel schüttelte den Kopf. »Meine neue Wohnung ist auch nicht größer. Das ist es nicht. Aber … ich muss hier mal raus. Die andere Wohnung ist im Dachgeschoss und hat eine kleine Terrasse.«
»Terrasse«, schnaubte Yuri. »Der ganze Hof ist deine Terrasse. Und was machst du mit deiner Werkstatt?«
»Ich wäre froh, wenn ich die Garage erst mal weiter benutzen kann.«
Sarkov nickte bedächtig, aber ihm war anzusehen, dass es ihm nicht gefiel.
»Yuri«, sagte Gabriel. »Ich bin vierzig. Ich will auch mal vor die Tür gehen, in irgendeine Kneipe oder ein Café. Nichts Wildes, einfach nur einen kleinen Laden vor der Haustür, wo mich die Bedienung kennt und mir ’nen vernünftigen Kaffee bringt, ohne dass ich groß was sagen muss, oder wo ich ein paar frische Brötchen beim Bäcker holen kann. Das hier«, sein Finger malte einen weiten Kreis in die Luft, »ist ein Industriegebiet.«
»Ein Industriegebiet mit einem hübschen Puff um die Ecke«, ergänzte Sarkov. »Oder hast du jemanden kennengelernt?«
Gabriel schüttelte den Kopf. »Da, wo ich hinziehe, gibt es auch einen, und die Mädchen sind hübsch«, log Gabriel und sah Sarkov geradewegs in die Augen. Genau genommen lag Yuri richtig. Er hatte ja jemanden kennengelernt. Tatsächlich war Liz der wahre Grund für seinen Auszug, aber Yuri sollte unter keinen Umständen davon erfahren.
»Vögeln kann man, so oft man will. Nur nicht immer dieselbe«, hatte Yuri stets betont, »das macht dich schwach und abhängig.«
Gabriel hatte das umgesetzt, indem er so gut wie gar nicht vögelte, und wenn, dann in anderen Städten, wenn er dort mit einem Python-Team als Personenschutz gebucht war. Im Tross von Prominenten gab es immer Frauen, denen es ähnlich ging wie ihm. Sex ja. Nähe bloß nicht.
Bis der Anruf von Liz kam, etwa zwei Monate nach ihrem zufälligen Kennenlernen auf der Berlinale.
Seitdem ist alles anders.
Gabriels Blick wandert hinab auf das Navigationsgerät. Der kleine Pfeil zeigt nach rechts, in den Kadettenweg.
Gabriel schlägt das Lenkrad ein. Der Scheibenwischer schrammt stotternd über die Windschutzscheibe. Der Regen hat aufgehört, wie abgeschnitten. Er stellt den Scheibenwischer aus und beugt sich etwas nach vorne, um im Dunkeln die vorbeigleitenden Hausnummern besser zu erkennen. Links und rechts von der schmalen Straße stehen in unregelmäßigen Abständen Bäume, viele davon sogar älter als die Villen dahinter. Lichterfelde ist voll von altehrwürdigen und oft kauzigen Häusern: kleine Palazzi, Schweizerhäuschen, Jugendstilvillen und burgähnliche Ziegelbauten mit angeschmiegten Türmchen. Über einer bogenförmigen Toreinfahrt prangt eine schmiedeeiserne 31.
Als sein Handy schrillt, zuckt er zusammen, und der Wagen macht einen Schlenker.
Liz, schießt es ihm sofort in den Kopf.
Gottverdammt, kannst du noch an was anderes denken, Luke?
Schon im selben Moment weiß er, dass sie es nicht sein kann. Nicht nach dem Telefonat von vorhin. Wenn sie ihr Handy nicht sogar ausgemacht hat, dann ist es zumindest stumm geschaltet und in einer ihrer Manteltaschen verschwunden.
Er nimmt den Fuß vom Gas und drückt die grüne Taste.
»Hallo?«
»Ich bin’s, Cogan. Ich hab nachgesehen.«
»Nachgesehen? Was nachgesehen?«
»Na, die Adresse, Kadettenweg 107.«
»Also ist es doch im Verzeichnis?«
»Wie man’s nimmt. Nicht im aktuellen. Ich bin runter ins Archiv.«
Gabriel muss grinsen. Cogan hasst das Archiv ebenso wie den Außendienst. Aber noch mehr hasst er es, wenn ihm irgendetwas in seinem Universum unbekannt ist. »Und?«
»Na ja. Die Akte zu dem Haus ist nicht mehr da. Komisch eigentlich.«
»Also, was jetzt? Hast du was gefunden oder nicht?«, fragt Gabriel, kneift die Augen zusammen und überlegt, ob das eine 45 oder 49 ist, die da zwischen zwei Bäumen hervorlugt.
»Ashton«, sagt Cogan. »Der Besitzer hieß Ashton. Es gab noch ein altes tabellarisches Verzeichnis, da stand der Name drin.«
»Ashton. Aha. Mehr hast du nicht?«
»Na ja, da ist noch was. ’ne Kleinigkeit, aber ulkig.«
»Mensch, jetzt mach kein Quiz draus. Spuck’s einfach aus.«
»Der Name Ashton ist am 17. September 1975 eingetragen worden. Vermutlich die erste Scharfschaltung der Anlage. Aber direkt dahinter steht noch ein zweites, handschriftliches Datum. Und ein kleines Kreuz. Und der Name ist durchgestrichen.« Cogan legt eine bedeutungsschwangere Pause ein. »Sieht so aus, als ob der Besitzer genau zwei Tage nachdem er in die Hütte eingezogen ist gestorben wäre.«
»Seltsam«, murmelt Gabriel. Rechts von ihm gleitet ein Haus mit mehreren mächtigen Säulen vorbei. Hausnummer 67.
»Der Knaller kommt noch«, raunt Cogan. »Seitdem steht das Haus offenbar leer.«
»Was?«, entfährt es Gabriel. »Seit 1975? Das ist jetzt fast 35 Jahre her!«
»Du sagst es.«
»Welcher Irre lässt denn in diesem Viertel eine Villa 33 Jahre lang leer stehen? Gibt’s da keine Erben?«
»Keine Ahnung. Stand nichts davon da.«
»Und die Alarmanlage? Welche Alarmanlage funktioniert denn nach so vielen Jahren noch?«
»Keine Ahnung«, sagt Cogan, »ich kenn das Ding ja nicht. Weiß nicht mal, welches Fabrikat. Bis heute war die nie in meinem System aktiv.«
»Nur noch mal, damit ich das richtig verstehe«, sagt Gabriel gedehnt. »Die Alarmanlage war 33 Jahre lang tot, und ausgerechnet heute wird sie scharf geschaltet und gibt sofort einen Alarm von sich?«
»Ich weiß ja nicht genau, wann die Anlage damals abgeschaltet wurde. Nach Sarkovs Reaktion zu urteilen, sind die oder der Besitzer ja offenbar immer noch Kunde bei uns. Aber seit ich hier bin, und das sind immerhin neun Jahre, da gab’s definitiv keine einzige Scharfschaltung. Geschweige denn einen Alarm.«
»Und wer soll das jetzt gewesen sein? Ein Gespenst?«
»Vielleicht auch ein Defekt …«
»Hm«, brummt Gabriel und reckt den Hals. Rechts schält sich eine offene Toreinfahrt aus der Dunkelheit. An einem der Ziegelpfosten ist eine verwitterte 107 angebracht. »Ich bin da. Lass uns Schluss machen. Ich meld mich später.«
»Alles klar. Grüß mir den ollen Ashton, wenn du ihn beim Spuken triffst«, sagt Cogan und lacht meckernd.
Gabriel steckt das Handy weg und rollt zwischen den Ziegelpfosten des geöffneten Tors auf einen Kiesweg, aus dem kniehohes Unkraut sprießt.
Eine seit fast 35 Jahren unbewohnte Villa, und das Tor ist sperrangelweit geöffnet?
Der Kies knirscht unter den Reifen. Wildwuchernde Büsche wechseln sich mit dunklen Tannen ab. Hinter deren Wipfeln erhebt sich eine große Fachwerkvilla, mit verzierten Erkern und zwei Türmchen, die sich ans Haus drängen. Die Villa sieht aus wie ein zu groß geratenes Hexenhaus. Feuchte Luft steigt vom Boden auf, und es dampft. Über dem Eingang rotiert das rote Licht der Alarmanlage wie ein Feuermelder und lässt den Dunst glühen.
Verdammtes Geisterhaus, denkt Gabriel.
Wie immer, wenn er vor einem Gebäude steht, das er betreten will, muss er an den Keller denken und daran, wie wohl die Treppe aussieht, die dort hinabführt. Seine Nackenhaare richten sich auf, und er schielt empor zum Dach.
Dieses Haus ist alt, und in alten Häusern sind die Alarmanlagen meistens im Keller.
Kapitel 3
Berlin – 1. September, 23:22 Uhr
Liz drängelt sich mühsam durch die brechend volle Kneipe, auf den Ausgang zu. Dr. Robert Bug, der Nachrichtendirektor von TV2, steht an der Theke und weicht nicht einen Zentimeter zurück, so dass Liz ihn streifen muss, um an ihm vorbeizukommen. Bug grinst, schiebt sich mit seiner ganzen Körperfülle Liz entgegen und streift ihre Brüste. »Sieh an, sieh an. Unsere Frau Top-Journalistin«, tönt er und starrt ungeniert auf sie herab. »Wolltest du mir nicht das Exposé für deine neue Doku schicken?«
Dir schick ich nur noch was, wenn’s die anderen Sender nicht nehmen, denkt Liz. »Ich recherchier noch«, sagt sie mit einem schalen Lächeln. Dass sie vor wenigen Minuten einer von Bugs Intrigen lauschen musste, macht alles nur noch ekliger.
Sie stößt die Tür auf und tritt ins Freie. Die nasse Straße dampft, aus dem Rinnstein strömt Regenwasser in die Gullys. Hinter ihr fällt die Tür zu, und der Lärm aus dem Linus verebbt. Die Leuchtschrift über dem Eingang der Kneipe taucht Liz in glühendes Orange, die gelben Strahler an den Säulen neben der Tür tun ein Übriges. Fegefeuer.
Für einen Moment schließt Liz die Augen und saugt gierig die feuchte Luft in ihre Lungen. Ein Windstoß fährt durch ihre halblangen roten Haare, die widerspenstig, in einer Art geordnetem Chaos, von ihrem Kopf abstehen, etwa so, als hätte sie unmittelbar nach dem Aufstehen eine Dose Haarspray hineingesprüht. Der kühle Wind tut gut. Drinnen war die Luft heiß und ranzig, regelrecht stinkig. Neuerdings riecht sie Dinge, die ihr früher so nie aufgefallen wären: Achselschweiß, billige Deos, Reste von Zigarettenrauch oder die säuerliche Note von Kaffee im Atem. Der Geruch fremder Menschen dringt in sie ein, ohne dass sie etwas dagegen tun kann.
Unwillkürlich muss sie an Gabriel denken, daran, wie gut seine Haut riecht, obwohl er das Parfüm, das sie ihm geschenkt hat, konsequent verweigert – so wie jedes Parfüm. Sie spürt, dass ihr warm wird zwischen den Beinen, und beeilt sich, die Gedanken zu verdrängen, vor allem um die Enttäuschung über das Telefonat mit ihm nicht spüren zu müssen.
Liz wirft einen Blick zurück auf die Kneipe. Durch die hohen Glasfenster kann man ins Innere sehen, und an der Theke meint sie, Bugs fleischiges Gesicht und seinen dichten braunen Haarschopf zu erkennen. Mr News. Sofort ist sie wieder im Job. Die kuriosesten Storys überfallen einen immer da, wo man sie am wenigsten erwartet, denkt sie. Zum Beispiel spätabends auf dem Männerklo.
Die Herrentoilette hatte ekelerregend nach Urin gestunken, aber im Gegensatz zur überfüllten Damentoilette war sie frei. Ekel ist relativ. Und ihr Bedürfnis war absolut – nicht zuletzt wegen ihres Zustands. Als sie die Tür der Herrentoilette aufstieß, glotzte ihr eine dieser Etepetete-Zicken aus der Warteschlange hinterher, als hätte sie die Krätze. Sie kannte diesen Blick, und sie hasste ihn. Es war der gleiche Blick, mit dem ihre Mutter und ihre jüngere, bildhübsche Schwester Charlotte sie immer angesehen hatten. Für ihre Mutter war alles an Liz falsch, so wie alles an Charlotte richtig war. Dass ihre Schwester auch noch in den britischen Adel eingeheiratet hatte und nun mondäne Hüte beim Pferderennen in Ascot zur Schau trug, machte alles nur noch schlimmer.
Liz betrat also die Herrentoilette und wünschte Mrs Etepetete die Pest an den Hals oder zumindest eine ebenso unerträglich drückende Blase wie die ihre. Es war unglaublich, aber der Platz in ihrem Bauch schien jetzt schon zu schrumpfen.
Die Toilettentür schwang hinter ihr zu und verwandelte den Kneipenlärm in ein leises dumpfes Wummern. Sie suchte sich die sauberste der drei Kabinen aus und schloss ab.
Nur einen kurzen Moment später schwappte erneut eine Lärmwelle herein, und jemand anders betrat das schmutzig gelb geflieste WC. Sie erkannte Bug sofort an der Stimme, die wie eine Schaumkrone auf dem gedämpften Kneipenlärm schwamm. Offenbar brauchte er einen ruhigen Platz, um zu telefonieren.
»Ich verstehe das nicht«, sagte Bug, »das war anders abgemacht, Vico.«
Vico? Liz spitzte die Ohren und hielt den Atem an. Mit Vico war vermutlich Victor von Braunsfeld gemeint, der Eigentümer der BMC Mediengruppe, zu der auch TV2 gehörte.
»Nein, nein. Ich will mich ja gar nicht beschweren«, sagte Bug hastig, »natürlich, das ist ein Fortschritt, das ist mir klar, aber als Geschäftsführer könnte ich den Sender ganz anders nach vorne bringen.«
Liz’ Augen wurden groß. Bug und Geschäftsführer?
»Über was für einen Zeitraum reden wir denn?«, fragte Bug.
Einen kurzen Moment blieb es still.
»Damit kann ich leben, wenn Sie mir … Was?« – »Nein, es ist nur laut hier.« – »Ins Gespräch bringen?« Bug lachte schmutzig. »Verlassen Sie sich drauf, ich hab da schon was im Visier. Das wird der perfekte Aufreger. Die Zeitungsfritzen werden sich die Finger wund schreiben, die Pharisäer schreien ach und weh, und das Volk klebt geschlossen vor der Glotze.«
Aufreger?, dachte Liz. Damit konnte nur ein neues Fernsehformat gemeint sein, irgendein niveauloser Mist.
»Was?«, fragte Bug. »Ach so, die. Ja, ja, ich weiß. Die Doku war toll. Ich bin dran, sie hat mir schon die Nächste angeboten.«
Ein spöttisches Lächeln huschte über Liz’ Gesicht. Offenbar sprach Bug gerade von ihr. Vor knapp einem Jahr war ihr ein kleines Wunder geglückt: Sie hatte eine dreiteilige Dokumentation über Victor von Braunsfeld gemacht, einen der reichsten Männer des Landes, der sich in den letzten Jahrzehnten konsequent jede Berichterstattung verbeten hatte.
»Nein, da muss ich Sie enttäuschen«, sagte Bug. »Festanstellung ist nicht ihr Ding, will sie einfach nicht. Sie arbeitet lieber frei.«
Kein Wunder, du Arsch, dachte Liz. Bei so einem Chef …
»Ja, ja. Ich weiß, dass sie gut ist, keine Sorge, ich versuch, sie anders zu binden.«
Liz hob die Brauen.
»Alles klar. Dann sehen wir uns morgen wegen der Formalitäten. Gute Nacht.« Bug legte auf, dann stieß er laut den Atem aus. »Verdammte Bitch. Demnächst lädt er sie noch zum Carpe Noctem ein … die hat dem Alten ja wohl den Verstand weggelutscht.«
Liz verzog keine Miene. Es war nichts Neues, dass Bug unter die Gürtellinie drosch. Aber was meinte er mit Carpe Noctem?
Als es laut im Pissoir zu plätschern begann, stellte sie sich vor, was Bug wohl für ein Gesicht machen würde, wenn sie jetzt freundlich grüßend aus der Kabine trat.
Selbst jetzt, hier draußen auf der Straße, muss sie noch bei der Vorstellung grinsen. Liz atmet tief durch und spult noch einmal Bugs Telefonat im Kopf ab. Sie ertappt sich dabei, bereits eine Story daraus zu konstruieren. Nicht weil sie ernsthaft daran glaubt, daraus einen Bericht machen zu können, sondern vielmehr aus reiner Gewohnheit – und Neugierde.
Diese Neugierde hatte sie schon als kleines Kind angetrieben. In den Augen ihrer Mutter war Neugierde zwar eine zutiefst weibliche Eigenschaft, nur dass Liz’ Interesse sich immer auf die falschen Dinge richtete. Liz war wie ihre Haare. Rot und widerspenstig. Sie war nicht hübsch genug für ein Model, nicht elegant genug für eine Tänzerin und nicht häuslich genug, um eine gute Partie zu machen.
Mit neun Jahren wurde Liz von ihrem Vater, Dr. Walter Anders, Oberstaatsanwalt in Berlin, dabei ertappt, wie sie in seinem Arbeitszimmer in den Akten seiner Kriminalfälle stöberte – aus Neugierde.
Beim Essen fielen ihr dauernd Fragen dazu ein, aber über die meisten wurde nur gelacht. Noch nicht einmal weil sie neun war, sondern vielmehr weil sie ein Mädchen war. Liz hasste es, ein Mädchen zu sein. Und wenn ihr Vater einmal eine ihrer Fragen doch beantwortete, sah er dabei meistens ihren vier Jahre älteren Bruder Ralf an, als gäbe es einen verdammten Spot, der ständig auf ihn gerichtet war.
Ralf war es auch, der zum Abitur einen Zwei-Wochen-Trip nach New York geschenkt bekam – und einen fabrikneuen VW Golf. Er hatte einen Durchschnitt von 1,9 geschafft, und das wurde gebührend gefeiert.
Liz machte drei Jahre später Abitur, mit einem Schnitt von 1,4.
Sie bekam einen Schminkkoffer geschenkt, und ihre Mutter bestand darauf, mit ihr gemeinsam das Kleid für den Abi-Ball auszusuchen. Liz fühlte sich schon beim Betreten der Boutique deplaciert. Das schulterfreie Kleid, das ihre Mutter für sie kaufte, kostete 4299 Mark und schrie nach einer Operndiva. Liz hasste es von der ersten Sekunde an. Sie kam sich darin vor wie eine Vogelscheuche und wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, aber ihre Mutter ließ es dennoch einpacken.
Am Morgen vor dem Abi-Ball stand sie mit Magenschmerzen auf. Ihre Mutter kam ins Zimmer, mit dem Kleid in der Hand.
»Ich zieh das Ding nicht an«, platzte es aus Liz heraus. »Das kannst du vergessen.«
»O doch«, entgegnete ihre Mutter, »ob du willst oder nicht. Ist mir völlig egal. Du wirst dieses Kleid tragen.«
»Nein!«
»Mir reicht’s«, rief ihre Mutter. »Entweder du ziehst das Kleid an, oder du gehst da nicht hin.«
»Dann geh ich da eben nicht hin«, sagte Liz wie aus der Pistole geschossen.
Ihre Mutter starrte sie an. »Schön«, sagte sie und lächelte schließlich. »Dann wirst du mir das Kleid bezahlen. Und zwar jede Mark.«
Liz blieb der Mund offen stehen. 4299 Mark? »Ich wollte es doch gar nicht. Du hast es mir geschenkt.«
»Überleg’s dir. Entweder du ziehst es an, oder ich hol mir das Geld von deinem Sparbuch.«
Liz sah ihre Mutter fassungslos an. Auf ihr Sparbuch hatte sie jahrelang jede Mark eingezahlt, um sich nach dem Abitur eine Reise oder ein Auto zu leisten. Sie hatte geahnt, dass ihre Geschenke zum Abitur nicht so opulent ausfallen würden wie bei Ralf. Aber das hier schlug dem Fass den Boden aus.
Wutentbrannt stürzte sie aus dem Haus, lief ziellos durch die Stadt, bis sie plötzlich vor einer schmuddeligen Ladeneingangstür stand. Der Inhaber des Ladens war ein Fass von einem Mann und stank abartig nach Nikotin und Schweiß.
Vier Stunden später war sie wieder zu Hause, blass, aber mit einem Lächeln in den Mundwinkeln. Am Abend zog sie dann freiwillig das verhasste Kleid an.
Die erste Reaktion ihrer Mutter war ein triumphierendes Lächeln. Bis ihr Blick auf Liz’ wundes Dekolleté fiel. Über dem Rand des Kleides starrte sie ein zwei mal zwei Zentimeter großes und frisch gestochenes Totenkopf-Tattoo an, mit gekreuzten Säbeln unter dem Schädel und einem Messer zwischen den grinsenden Zähnen.
Ihrer Mutter stockte der Atem. Sie geriet außer sich und gab ihrer Tochter eine schallende Ohrfeige, wobei sie sich die Hand verstauchte.
Auf den Abi-Ball ging Liz in einem einfachen hochgeschlossenen schwarzen Kleid.
Am nächsten Morgen räumte sie ihr Sparbuch, dann stapelte sie einige Scheite Kaminholz auf dem frisch gemähten Rasen im elterlichen Garten. Darauf legte sie das verhasste Kleid sowie alle übrigen Röcke und Kleider aus ihrem Schrank. Es war vollkommen windstill, als sie den Haufen anzündete. Schwarzer Rauch und ein beißender Gestank hüllten sie ein.
Mit einer Lederjacke, ein paar Jeans und Pullovern im Koffer zog sie aus, jobbte, schrieb sich an der Uni für Journalistik ein, hängte ein Volontariat an der Von-Braunsfeld-Akademie für Journalismus dran, mit einem Einser-Abschluss.
Von ihrem Vater hörte sie dazu das, was immer von ihm kam. Nichts. Dazu kam, dass Journalisten auf seiner Werteskala recht weit unten rangierten.
Ein paar Jahre später stand Liz auf einer Redaktionsparty mit ihrem damaligen Chefredakteur an einem Stehtisch und erzählte von ihrem Vater. »Glückwunsch«, lachte er, »im Grunde genommen bist du in seine Fußstapfen getreten. Staatsanwalt oder Journalist – ist eigentlich dasselbe, nur eine andere Ebene. Auf jeden Fall hast du die gleiche investigative Ader wie er und die gleiche Unerbittlichkeit, wenn’s drum geht, die bösen Jungs dranzukriegen.«
Liz hatte dagesessen wie vom Donner gerührt.
Und als vor drei Jahren eine ihrer Dokumentationen für den Grimme-Preis nominiert worden war, der Preis aber dann an jemand anderen ging, meldete sich ganz unerwartet ihre Mutter. »Und, Elisabeth?«, fragte sie spitz. »War es das wert?«
Noch heute wünscht sie sich, sie hätte den Preis damals bekommen. Dann hätte ihre Mutter wenigstens nicht angerufen.
Liz seufzt und geht im Geiste durch, wen sie fragen könnte, was hinter dem kuriosen Telefonat von Bug steckte. Normalerweise ist ihr Kopf ein wandelndes Adressbuch, aber im Moment ist er seltsam leer.
Schwangerschafts-Alzheimer? Jetzt schon?
»Ach, was soll’s«, murmelt sie. »Ab nach Hause.« Ihre Armbanduhr zeigt fünf vor halb zwölf. Diese Nacht hat sie sich anders vorgestellt. Und, verdammt noch mal, Gabriel hatte es ihr auch anders versprochen.
Sie spürt, wie sehr sie sich ärgert, dass Gabriel nicht da ist – und genau das ärgert sie am meisten. Es ist noch nicht lange her, dass sie einfach nur mit den Schultern gezuckt und sich in ihrer Arbeit vergraben hätte.
Sie geht an den Taxis vorbei und steigt in die Bahn. Sie hasst es, von Taxifahrern in Gespräche verwickelt zu werden. Dann doch lieber die Anonymität der Bahn, wo sie schweigend in die Nacht hinaussehen oder die Menschen um sich herum beobachten kann, als wäre sie auf einer weit entfernten Insel. Nachts Bahn fahren, das ist einer der wenigen stillen Momente, die sie hat.
Erst eine Station bis Alexanderplatz, dann die U8 Richtung Wittenau. Als sie am Bahnhof Gesundbrunnen in die Ringbahn S41 umsteigt, überfällt sie Müdigkeit, und sie sinkt auf den Plastiksitz. »Zurückbleiben bitte«, scheppert es aus den Lautsprechern. Die viereckigen Warnlampen über den Türen glühen rot auf, dann rumpelt es, und die Bahn fährt mit einem Ruck an.
Liz’ Blick gleitet abwesend durch den fast leeren Waggon. Eine Sitzreihe weiter, auf der gegenüberliegenden Seite, sehen sich zwei junge Typen in schmutzigen Jeansklamotten nach ihr um und stecken die Köpfe zusammen. Sie sind mit ihr eingestiegen. Der eine sieht aus wie ein Streuselkuchen.
An der Schönhauser Allee steigt eine blutjunge Mutter mit einem schreienden Baby auf dem Arm in die Bahn. Der Streuselkuchen verdreht die Augen. Als der Zug mit einem Ruck anfährt, stolpert das Mädchen auf die Sitzbank, direkt neben Liz. Der Winzling schreit noch lauter, und das Mädchen beginnt, fahrig in ihrer Umhängetasche zu kramen.
»Mach, dass die Missgeburt die Schnauze hält, das nervt«, sagt der Streuselkuchen.
Das Mädchen duckt sich. Dann zieht sie mit einer Hand verstohlen ihr T-Shirt hoch und drückt das kleine Bündel an ihre Brust. Das Geschrei wird zu einem dumpfen Brüllen, als der kleine Mund gegen die Brust gepresst wird.
Mitleid regt sich bei Liz, gleichzeitig rumort ihr Magen, als hätte sie zu scharf gebrannten Kaffee getrunken. Die Typen sind widerwärtig.
Das Gesicht des Mädchens verzieht sich vor Schmerzen, während das Baby ungestüm auf ihre Brustwarze beißt. Angeekelt sehen die beiden Typen zu. »Mann, bei den vertrockneten Titten würde ich auch brüllen«, stellt der zweite Typ fest und wischt sich mit dem Ärmel einen Schleimfaden unter der Nase weg. Der Pickelige grinst.
Liz starrt das Mädchen an, dann wieder die beiden Typen. Am liebsten würde sie aufspringen und den beiden die Meinung sagen. Ihr Herz beginnt, heftig zu schlagen. Alles in ihr schreit, tu es nicht!
Mit kreischenden Bremsen hält die Bahn an der Prenzlauer Allee. Der Pickelige lehnt sich vor und zischt das Mädchen an: »Na los, verschwinde! Schwing deinen Arsch zur Tür raus.«
Liz steht auf. Ihre grünen Augen funkeln. »Wie wär’s, wenn du verschwindest.« Ihre Stimme könnte fester sein, und sie versucht, ihren rebellierenden Magen zu ignorieren. »Oder aber du hältst die Klappe und lässt sie in Ruhe.«
Verblüfft starrt der Pickelige sie an. Er ist höchstens zwanzig. Alkoholgeruch weht aus seinem Mund. Der andere Typ sieht weg, aus dem Fenster, durch sein Spiegelbild in die Nacht dahinter. »Na ja …«, sagt der Pickelige gedehnt, »schätze, das hast du nicht zu bestimmen, Pussy. Aber wenn du ’n bisschen nett zu mir bist, vielleicht lass ich die Schnepfe dann weiterfahren.« Sein Blick hängt an Liz’ Brüsten. Ein Stück des Totenkopf-Tattoos lugt aus ihrem Ausschnitt hervor. Der Typ mit der triefenden Nase grinst dümmlich. In der linken Hand hält er eine offene Schnapsflasche, eingewickelt in eine braune Papiertüte.
»Wenn ihr Scheißkerle hier irgendjemanden anrührt, dann mache ich ein Heidenspektakel.« Sie zeigt nach oben, auf eine kleine bauchige Überwachungskamera, die unter der beige lackierten Decke hängt. »Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ich wette, ihr hattet schon jede Menge Ärger mit der Polizei. Schon ’ne Jugendstrafe kassiert? Oder Sozialstunden?«
Das Grinsen des Pickeligen verpufft. Er öffnet den Mund, will etwas entgegnen, aber der andere Typ stößt ihm den Ellenbogen in die Seite. Der Mund des Streuselkuchens klappt wieder zu.
Fühlt sich gut an, denkt Liz. Sehr gut sogar. Nur dass ihre Knie immer noch zittern. Sie fängt einen dankbaren Blick des Mädchens auf und lächelt zurück. Das Baby saugt immer noch gierig, aber ruhiger.
Unwillkürlich legt Liz ihre Hand auf den Sommermantel und ihren leicht gewölbten Bauch darunter. Trotz aller Unsicherheit wird ihr warm dabei. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft hatte sie das Gefühl, in ein tiefes schwarzes Wasser gestoßen worden zu sein. Aber inzwischen fühlt es sich gut an, so als wäre sie all die Jahre zuvor in der Tiefe gewesen und würde jetzt die Wasseroberfläche durchstoßen, die Hände ausgestreckt, in die klare Luft.
Als sie am Bahnhof Landsberger Allee aussteigt, in der Nähe des Volksparks Friedrichshain, verlassen auch die beiden jungen Männer die Bahn. Mist. Sie geht schneller und biegt von der Landsberger Allee in die Cotheniusstraße ein. Die Schritte hinter ihr sind verstummt. Die Kerle scheinen weg zu sein, wohin auch immer. Dennoch beschleunigt sie noch einmal ihre Schritte, bis sie vor der Haustür steht.
Den großen olivenfarbenen Lieferwagen mit den geschwärzten Scheiben auf der anderen Straßenseite bemerkt sie nicht, ebenso wenig wie den Mann hinter dem Steuer, der in ihre Richtung späht. Und auch wenn sie den Mann nicht kennt, ein einziger Blick in seine Augen hätte vermutlich alles geändert, ihr ganzes Verhalten in den nächsten Minuten. Sie hätte ein leichtes Zittern gespürt, bis in die Beine hinunter. Dieses Zittern, das immer dann einsetzt, wenn der Körper Adrenalin ausstößt. Ihre Instinkte hätten ihr unmissverständlich signalisiert: Bleib zu Hause. Schließ die Tür. Hol Hilfe!
Um genau das zu vermeiden, hält sich der Mann im Dunkeln. Er weiß, dass Liz alleine ist, und er weiß, dass Gabriel vermutlich genau jetzt in eine Einfahrt biegt und unter seinen Füßen der leuchtend rote Kies knirscht.
Kapitel 4
Berlin – 1. September, 23:41 Uhr
Liz steckt den Schlüssel ins Schloss, tritt in den Hausflur und lässt die Tür hinter sich zuschlagen. Im ersten Stock wird eine Tür aufgerissen. »Geht’s noch?«, ruft eine Frauenstimme. »Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist?«
»’tschuldigung, Frau Jentschke, die Haustür ist kaputt«, erwidert Liz und rollt mit den Augen. Nicht auch noch die jetzt, denkt sie und lehnt sich an die Wand gegenüber von den Briefkästen, um abzuwarten, bis die Jentschke wieder in ihrer Wohnung verschwindet. Die Hauswand mit den wunderschönen alten Jugendstilfliesen kühlt ihren Rücken, und das tut gut. Wieder streicht sie mit der Hand über ihren Unterleib. Zwölf Wochen! Oder sind es schon dreizehn? Mit Gabriel würde sie jetzt noch eine Runde durch den Park gehen. Aber alleine? Sie denkt an den Spaziergang zurück, als sie ihm von dem kleinen blassrosa Pluszeichen auf dem Test erzählt hat.
Schwanger.
Die Frauenärztin hatte ihr jahrelang erzählt, sie könne keine Kinder kriegen, jedenfalls nicht auf natürlichem Wege, ihre Eileiter seien nicht intakt. Ihre Antwort war jedes Mal, dass sie keine wolle, warum auch? Der Job war ihr Baby. Und echte Babys, das war ein Job für Frauen wie Charlotte, ihre Schwester. Allein die quälenden Regelschmerzen waren Liz ein Gräuel. Am liebsten hätte sie ihre Periode abgeschafft, sie war ja ohnehin zu nichts gut.
Bis sie plötzlich den positiven Test in den Händen hielt.
Die Frauenärztin schaffte es auch noch, ihr ganz selbstverständlich zur Schwangerschaft zu gratulieren. »Sehen Sie, je lockerer man ist, desto eher klappt es. Oder wollen Sie das Kind etwa nicht?«
Nicht wollen?
Liz stand unter Schock. Sie hatte Kinder schon seit einer Ewigkeit aus ihrem Leben gestrichen, aber aus irgendeinem verrückten Grund hatte das Schicksal jetzt neue Karten verteilt.
Und das ausgerechnet mit jemandem wie Gabriel. Er kam ihr vor wie ein schwarzer Ritter, ein stiller Anakin oder Batman, gefangen in seinem Leben, aus dem er immer dann ausscherte, wenn ihm etwas ungerecht vorkam. Dann brach seine Wut aus ihm heraus, wie damals, als sie sich kennengelernt hatten. Manchmal, im Angesicht all der Ungerechtigkeiten, die ihr Tag für Tag begegneten, und ihrer Ohnmacht, wünschte sie sich nichts sehnlicher, als so zu sein wie er. Aber das einzige Mittel, das ihr zur Verfügung stand, um zu kämpfen, waren ihre Dokumentationen und Reportagen.
Was ihre Schwangerschaft anging, setzte zwischen ihr und Gabriel ein unausgesprochener Wettbewerb ein, wen sie am meisten verstörte.
Inzwischen weiß sie, dass er eindeutig der Sieger dieses Wettbewerbs ist. In seinem Leben ist kein Platz für Kinder vorgesehen. Eigentlich ist in seinem Leben noch nicht einmal ein Platz für sie vorgesehen. Dass sie dennoch einen hat, grenzt an ein Wunder.
Die Berlinale. Sie muss lächeln, als sie daran denkt, wie sie Gabriel vor eineinhalb Jahren dort kennengelernt hat. Einmal mehr hatte sie mit ihrem Talent geglänzt, sich unvermutet in Schwierigkeiten zu bringen. Zuerst das heißumkämpfte Interview mit David Naumann, danach der abgehalfterte Schwergewichtler Zabriski. Er ging langsam aus dem Leim, weil er nicht mehr boxte, und gegen ihn lief eine Klage wegen Körperverletzung – er hatte ein paar Tage zuvor einen Paparazzo verprügelt. Trotzdem gehörte er immer noch zu den Haus-und-Hof-Promis des Senders. Seine Kämpfe hatten stets gute Quoten garantiert, und in jeder dritten Show von TV2 war er mit von der Partie. Dass er neuerdings kokste und sein Leben aus den Fugen geriet, war so offensichtlich, dass es weh tat.
Wieder einmal hatte sie es nicht geschafft, ihre Zunge zu zügeln. Wieder einmal hatte sie eine Frage gestellt, die eine Zündschnur in Brand setzte. Zabriski rastete aus. Als der erste Schlag auf ihren Wangenknochen klatschte, war sie viel zu verblüfft, um rechtzeitig die Flucht zu ergreifen. Als er sie am Kragen packte und schüttelte, bekam sie es mit der Angst zu tun. Die versammelte Partymeute von TV2 stand drum herum, doch keiner unternahm etwas. Auch Neo, ihr Kameramann, der direkt hinter ihr war, tat nichts, das heißt, er tat das Einzige, was er konnte: die Kamera laufen lassen und draufhalten.
Dann stand Gabriel plötzlich da. Die blauen Augen kalt, kurzgeschorene schwarze Haare, schwarze Lederjacke, vielleicht einen halben Kopf kleiner als Zabriski und deutlich schmaler. »Lass sie los«, sagte er. Mehr nicht. Für Liz klang es wie das verhaltene Knurren einer Raubkatze.
Zabriski ließ tatsächlich los. Allerdings nur, um sich anschließend auf Gabriel zu stürzen. Was dann kam, ging unglaublich schnell. Hinterher hätte niemand beschreiben können, was genau passiert war, auch Liz nicht, hätte sie nicht das Band aus Neos Kamera gehabt, das sie sich immer wieder ansah, vorwärts, rückwärts, in Slow Motion.