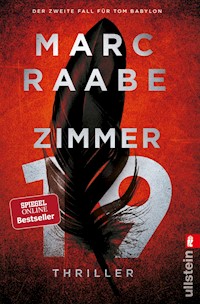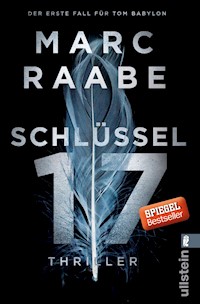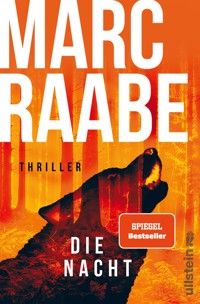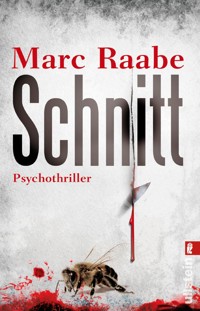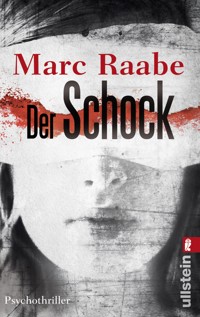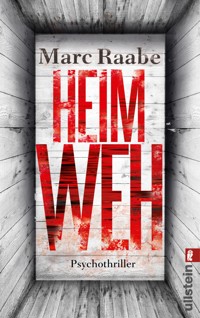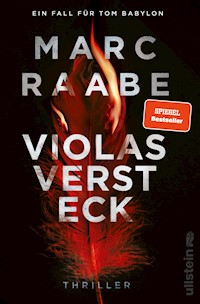
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist besser, du findest mich nie LKA-Ermittler Tom Babylon ist auf der Suche nach seiner kleinen Schwester Vi, die 1998 spurlos verschwand. Jetzt gibt es endlich einen Hinweis: Ein aktuelles Foto von Viola, versteckt im Keller seines Vaters. Bei einem mysteriösen Überfall in der Berliner U-Bahn wenig später kommt sein Vater ums Leben. Babylon ist sich sicher, auch der Täter ist auf der Suche nach Viola. Und er glaubt zu wissen, wer dahintersteckt: sein früherer Mentor Dr. Walter Bruckmann, der geschworen hat, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Doch wie kann ein Mann, der seit seiner Verurteilung in einer Psychiatrischen Anstalt in den Alpen einsitzt, in Berlin einen Mord verüben? "Grandioses Kopfkino" KRIMIcouch.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Violas Versteck
MARC RAABE, 1968 geboren, arbeitete viele Jahre lang als Geschäftsführer und Gesellschafter einer TV- und Medienproduktion. Heute widmet er sich ausschließlich dem Schreiben. Seine Thriller mit Kommissar Tom Babylon, zuletzt erschien DIE HORNISSE, sind regelmäßig auf der LITERATUR SPIEGEL-Paperback-Bestsellerliste zu finden. Raabes Romane sind in über zehn Sprachen übersetzt. Er lebt mit seiner Familie in Köln.
LKA-Ermittler Tom Babylon ist wie elektrisiert. Seit vielen Jahren sucht er nach seiner kleinen Schwester Vi. Und plötzlich gibt es einen Hinweis: Ein Foto von Viola als erwachsene Frau, das er im Keller seines Elternhauses findet. Wenig später kommt Toms Vater bei einem mysteriösen Überfall in der Berliner U-Bahn ums Leben. Tom fürchtet, auch der Täter ist auf der Suche nach Viola. Und er hat einen Verdacht, wer es sein könnte: sein früherer Mentor Dr. Walter Bruckmann, der geschworen hat, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Doch wie kann ein Mann, der seit seiner Verurteilung in einer psychiatrischen Anstalt in den Alpen einsitzt, in Berlin einen Mord verüben?
Marc Raabe
Violas Versteck
Thriller
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Paperback© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022© 2022 by Marc RaabeAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: zero-media.net, München Umschlagabbildung: FinePic®, München Autorenfoto: © Gerald von Foris E-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. ISBN 978-3-8437-2716-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Sechs Wochen später
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
28 Tage vorher
Kapitel 6
28 Tage später
Kapitel 7
Kapitel 8
***
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
27 Tage vorher
***
Kapitel 15
27 Tage später
Kapitel 16
Kapitel 17
12 Tage vorher
***
Kapitel 18
Kapitel 19
11 Tage später
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
***
Kapitel 26
Kapitel 27
10 Tage vorher
Kapitel 28
Kapitel 29
8 Tage vorher
***
Kapitel 30
8 Tage später
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
7 Tage vorher
Kapitel 35
Kapitel 36
5 Tage vorher
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Wenige Stunden später
Kapitel 42
5 Tage später
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
1989
Kapitel 46
2021
Kapitel 47
4 Tage später
Kapitel 48
3 Tage vorher
Kapitel 49
Kapitel 50
2 Tage vorher
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 55
2 Tage vorher
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
3 Stunden vorher
Kapitel 60
Kapitel 61
2 Tage später
***
Kapitel 62
Kapitel 63
Epilog
Anhang
Danke
Leseprobe: Der Morgen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Da stimmt was nicht! Lotte Wißmann sieht zu den beiden Männern am Gleis der U-Bahn-Station. Sofort kommt ihr die Stimme ihres Vaters in den Sinn, sonor und halblaut: »Unsinn, das bildest du dir ein, Lotte.« Dazu seine Hand, die wedelt, als könnte man Gedanken wie Fliegen verscheuchen.
Nur nicht diesen Gedanken. Oder besser: dieses Gefühl. Als wären die zwei Männer am Gleis von einer dunklen Wolke umgeben. »Jetzt komm mir bitte nicht mit Schwingungen, Schatz«, wäre die Antwort ihres Vaters.
Lotte versucht, die beiden Männer am Gleis zu ignorieren, wegzusehen.
Schwingungen. Tss. Aber vielleicht hat er ja wirklich recht. Gegen ihn ist ohnehin kein Kraut gewachsen, ihm haben schon immer alle zugestimmt. Papa der Macher, Papa der Chef, Papa der Realist.
Sie schaut erneut zu den beiden Typen. Sie stehen ganz am Rand des Bahnsteigs, abseits von den anderen, auffällig nah am Gleis. Der eine hat sich von hinten an den anderen gedrängt, es wirkt irgendwie seltsam, fast schon aggressiv.
Da ist was, flüstert ihr sechster Sinn.
Lotte stupst Christian mit dem Ellenbogen an und fasst nach seiner Hand. Seine kräftigen warmen Finger umschließen ihre, und sofort fühlt sie sich geborgen. »Hast du die beiden Typen da drüben gesehen?«, fragt sie halblaut.
»Hm?« Christian runzelt die Stirn. Sein Blick irrt durch die Berliner U-Bahn-Station Hermannplatz, springt zwischen den Fahrgästen hin und her, die sich vor den gelb glänzenden Wandfliesen abheben. Es ist kurz vor fünf am Nachmittag, Hauptverkehrszeit. Trotz Corona ist viel los. Aber nicht so viel, dass Chris die beiden nicht bemerken könnte. Typisch, dass er es nicht direkt sieht. Frauen haben für Gefahrensituationen einfach einen anderen Blick, notgedrungen, denkt Lotte. Sie ist jetzt dreiundzwanzig, und den ersten Übergriff hat sie mit zwölf erlebt, ein Geschäftsfreund ihres Vaters, der mit seinen wulstigen Fingern durch ihre seidigen blonden Haare kämmte und dann in ihre Brustwarze kniff. Ganz schön frühreif, flüsterte er und zwinkerte ihr zu. Ihr Vater bekam nichts davon mit, und sie erzählte ihm auch nichts davon. Wahrscheinlich hätte er ihr auch nicht geglaubt oder die Sache heruntergespielt. Es war ja auch nicht viel passiert, dachte sie damals. Drei Jahre später dann der zweite Übergriff. Der Typ, der sie auf dem Nachhauseweg ins Gebüsch zerrte und … Sie verscheucht den Gedanken. Sie will sich nicht schmutzig fühlen und auch nicht jammern, schließlich hätte es noch schlimmer enden können. Sie lebt ja noch.
»Was genau meinst du?«, fragt Christian.
»Na, die beiden da«, sagt Lotte, »direkt am Tunnelausgang.«
Christians Blick folgt ihrem. Jetzt sieht er, was sie meint. Neben der lindgrün gefliesten Säule, die den Aufgang zum Hermannplatz vom U-Bahn-Tunnel der Linie 7 trennt, stehen zwei Männer, der eine auffällig dicht hinter dem anderen.
»Was soll das, was machen die da?«, fragt Lotte.
»Na ja«, murmelt Christian. »Könnte alles sein, oder?«
Die beiden Männer stehen mit dem Gesicht zum Gleis, der vordere hat graues, schütteres Haar, der hintere ist kräftiger und größer, trägt einen weiten dunkelblauen Anorak und eine schwarze Schildmütze mit Ohrenklappen. Irgendwie wirkt es, als bedrängte er den Grauhaarigen, der jetzt sein Portemonnaie herausgeholt hat. Der Kerl mit der Schildmütze nimmt es und steckt es ein.
»Hast du das gesehen?«, flüstert Lotte.
»Gibt’s ja nicht«, sagt Christian, »der beklaut den.«
Statt von dem Grauhaarigen abzulassen, bedrängt der Mann mit der Mütze ihn weiter. Er zischt dem Älteren etwas ins Ohr, sie kann die Worte nicht verstehen, aber seine Gestik jagt ihr einen Schauer über den Rücken.
»Du, der schiebt den näher ans Gleis«, sagt Christian alarmiert und macht einen Schritt nach vorn.
»Chris, wart mal.« Lotte drückt warnend seine Hand, doch Christian ignoriert sie, geht weiter und zieht sie mit, immer näher an die beiden heran. Die Füße des Grauhaarigen überschreiten jetzt die weiße geriffelte Sicherheitslinie am Boden. Bis zur Bahnsteigkante sind es höchstens noch dreißig Zentimeter.
»Ich sag doch, ich hab’s nicht mehr«, stöhnt er. Lotte und Christian sind jetzt so nah herangekommen, dass sie jedes Wort verstehen.
»Dann eben ’ne Kopie«, zischt der Mann mit der Mütze und drängt den anderen noch näher ans Gleis.
»Shit, das gibt’s doch nicht«, knurrt Christian. Er hat so eine Art Polizisten-Gen. Wenn es Ärger gibt, will er einschreiten, schlichten, helfen. Lotte liebt das an ihm, aber gerade wünscht sie sich etwas anderes – und schämt sich zugleich dafür. »Chri-his«, bettelt sie und zerrt mit beiden Händen an seinem Arm, um ihn aufzuhalten. »Vorsicht.«
»Ich hab keine Kopie«, beteuert der Alte.
»Kopien gibt’s immer.«
Es sind nur noch zehn Zentimeter bis zur Bahnsteigkante.
»Siehst du nicht, was da läuft?« Chris versucht, sie abzuschütteln. Sie kommt sich vor wie ein Klammeraffe, aber sie will ihn um jeden Preis aufhalten. Wenn Chris nur nicht so stark wäre.
»Ich schwör’s, ich hab keine Kopie, bitte!«
»Dann sag mir, wo sie ist.«
»Ich weiß es doch nicht!« Die Schuhspitzen des Grauhaarigen ragen jetzt bereits über die Bahnsteigkante hinaus.
»He, Sie«, ruft Christian. Er ist nur noch drei Schritte von den beiden entfernt. »Lassen Sie den Mann los.«
Einen Moment lang ist es, als hätte jemand die Zeit angehalten. Die gelben Kacheln leuchten matt, die Tunnelöffnung ist ein schwarzer Schlund. Der Mann mit der Mütze zieht mit irritierender Ruhe eine medizinische Schutzmaske über Mund und Nase, erst dann dreht er sich um. Nur die Augenpartie seines Gesichts ist zu sehen, ein schmaler Schlitz, mit einem kalten, wütenden Blick.
»Chris!«, sagt Lotte voller Unbehagen.
»Halt dich raus, Junge.« Die Stimme klingt dumpf durch das blaue Vlies der Maske.
»Erst lassen Sie den Mann los!«, erwidert Chris entschlossen. Er hat sich zu seiner vollen Größe aufgerichtet, sein Kreuz, seine Schultern, seine Oberarme, er weiß nur zu gut, dass die meisten bei diesem Anblick klein beigeben. Doch der Typ mit der komischen Mütze ist nicht wie die meisten, das spürt Lotte überdeutlich. Sie möchte weglaufen, Christian von dem Mann wegziehen, selbst wenn es bedeutet, den netten alten Herrn im Stich zu lassen. »Chris, bitte!« Sie zieht noch einmal an seinem Arm.
»Hör auf deine Freundin«, knurrt der Mann. Die Maske über seinem Mund bewegt sich im Rhythmus der Worte.
Ein dumpfes Grollen dringt aus dem Tunnel. Weit hinten leuchten die Scheinwerfer der U7.
»Verdammt noch mal!« Christian reißt sich von Lotte los und stürzt sich auf den Mann mit der Mütze. Der alte Herr strauchelt am Bahnsteigrand, und plötzlich blitzt ein Messer in der Hand des anderen Mannes. Lotte schreit laut auf. Christian wehrt das Messer mit dem linken Unterarm ab, packt den Arm des Angreifers mit eisernem Griff. Der alte Herr kommt Christian zu Hilfe, greift dem Mann von hinten an den Hals und würgt ihn ungeschickt.
»Chris!«, schreit Lotte. »Vorsicht!«
Das Grollen im Tunnel wird rasch lauter, die Scheinwerfer fliegen heran. Der Mann mit der Mütze tritt Chris die Beine weg. Mit einer kräftigen Körperdrehung zieht er seinen Arm zurück, sodass Chris – der ihn immer noch festhält – in einer Pirouette an ihm vorbei- und über die Bahnsteigkante hinauswirbelt. Lotte versucht noch, Chris beizustehen und sich auf den Angreifer zu stürzen, doch es ist zu spät. Für einen Augenblick scheint Chris über dem Gleis zu schweben. Aus dem Tunnel drückt ein Stoß kalter Luft, dem die U-Bahn folgt wie ein Geschoss. Die gelbe Schnauze der U7 rammt Christian frontal und reißt ihn mit. Der Aufprall seines Körpers geht im Brausen des in die Station einschießenden Zuges unter.
Ungläubig starrt Lotte dahin, wo gerade noch Chris war. Scheiben, Holme, Türen, Gesichter, Spiegelungen – die Bahn verwischt zu Strichen ohne Anfang und Ende. Der Mann packt sie an ihren langen Haaren, zieht sie daran hoch und schlägt ihr in den Bauch. Stöhnend lässt sie von ihm ab, torkelt rückwärts, sieht noch aus dem Augenwinkel, wie der Mann mit der Mütze dem Grauhaarigen den Ellenbogen vor die Brust rammt. Der Alte knallt mit dem Rücken an die vorbeifahrende Bahn, wird über den Bahnsteig geschleudert und landet hart auf dem Steinboden.
Das Kreischen der Bremsen ist ohrenbetäubend.
O Gott, Chris!
Lotte liegt auf dem Bahnsteig und krümmt sich vor Schmerzen. Die Bahn steht. Die Türen springen auf. Der Mann mit der Mütze lässt das Messer in der Anoraktasche verschwinden. Lotte wundert sich, woher das Blut an der Klinge kommt. Eine Frau tritt aus der U-Bahn, sieht Lotte mit großen Augen an undbeginnt zu schreien. Im selben Moment hat der Mann sich umgedreht und geht zügig zur Treppe, die zum Hermannplatz führt. Die Menge verschluckt ihn. Sekunden später ist es, als wäre er nie da gewesen. Lotte zittert plötzlich wie Espenlaub und schlingt die Arme um sich. Erst jetzt bemerkt sie, wie feucht es an ihrem Bauch ist. Die Welt um sie herum wird enger und enger.
Ein Mann beugt sich zu ihr herab und tätschelt hektisch ihre Wange. »Hallo? Können Sie mich hören?«
»Papa?«, flüstert sie. Tränen laufen ihr über die Wangen. »Er hat Chris umgebracht!«
»Ssssch. Nicht anstrengen! Bleiben Sie ruhig. Wir holen Hilfe.«
»Papa, du musst ihn kriegen. Bitte. Ich will, dass du ihn …«, ihre Stimme versagt, und sie nimmt alle Kraft für die letzten Worte zusammen, »… dass du ihn … fertigmachst.«
Sechs Wochen später
Kapitel 1
Tom öffnet die Augen mit dem diffusen Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Es ist dunkel, und seine Kehle ist wie ausgedörrt. Er versucht, sich aufzusetzen, will ins Bad, ein Glas Wasser wäre jetzt gut, schön kalt, um wieder klar zu werden – doch ein plötzliches unangenehmes Stechen in seinem Kopf lässt ihn ins Kissen zurücksinken. Das Bett kommt ihm auf einmal seltsam schmal vor, als wäre es geschrumpft, und das Kopfkissen ist merkwürdig dick.
Wo ist Anne?
Was ist das für ein Bett?
Von irgendwoher kommt ein monotones Atmen.
Sein Blick tastet das Zimmer ab, die Wände. Die Proportionen stimmen nicht. Das Fenster fehlt. Und da ist ein Fenster, wo keins sein sollte. In der Ferne leuchtet ein Gebäude gelblich in der Nacht. Ein großes Gebäude. So etwas wie ein Schloss, mit einem hohen schlanken Turm.
Einen langen stillen Moment ruht sein Blick auf dem Gebäude mit dem Turm. Er blinzelt. Der helle Fleck da oben, ist das etwa eine Uhr?
Natürlich ist das eine Uhr!, flüstert Viola in seinem Kopf. An Kirchtürmen ist doch immer eine Uhr.
Tom will ihr widersprechen: Meistens! An Kirchtürmen ist meistens eine Uhr – nicht immer. Außerdem gibt es keinen Kirchturm vor meinem Fenster!
Viola übertreibt manchmal gerne. Aber gut, welche Zehnjährige tut das nicht?
Du bist so ein Blödmann, wispert sie.
Tom unterdrückt ein Seufzen. Schon gut, Vi. Hab’s nicht so gemeint.
Viola kann es nicht ausstehen, wenn er den großen Bruder raushängen lässt. Vor seinem inneren Auge sitzt sie auf der Bettkante, in ihrem gestreiften, viel zu großen Schlafanzug, und schaut aus dem Fenster, das nicht da ist, wo es sein sollte. Er kann ihr Gesicht nicht sehen, nur ihre Nasenspitze. Ihre widerspenstigen blonden Locken geraten in Bewegung, sie fummelt gedankenverloren an etwas herum, das an einer Schnur um ihren Hals hängt.
Der verdammte Schlüssel, natürlich.
Tom will sie nicht schon wieder danach fragen, er hat es schon viel zu oft getan, und eine Antwort hat er nie bekommen. Es ist und bleibt seine Schuld, dass Viola damals spurlos verschwunden ist. Hätte er ihr nicht von dem Schlüssel erzählt, den er damals gefunden hatte, dann wäre sie vielleicht noch da.
Er will ihre Hand nehmen, in der verrückten Hoffnung, dass sie aus Fleisch und Blut ist, fasst aber ins Leere. Erneut schaut Tom aus dem Fenster in die Nacht, sucht in seiner Erinnerung nach einem Match für das gelb leuchtende Gebäude mit dem Turm und der Uhr, aber so ein Gebäude gibt es nicht am Heckmannufer, da, wo er wohnt. Ihm fällt kein Gebäude in Kreuzberg ein, das so aussieht. Noch nicht einmal eins in Berlin.
Wenn er es nicht besser wüsste, dann würde er sagen, es ist das britische Parlament mit Big Ben.
Der Gedanke verhallt in seinem Kopf.
Er blinzelt, schaut noch einmal hin. Der Turm, die Uhr, die Umrisse des Gebäudes daneben mit den neugotischen Spitzen, die sich hell vor dem Nachthimmel abzeichnen. Das ist Big Ben. Und daneben liegt das britische Parlament.
Mit einem Ruck setzt er sich auf und starrt aus dem Fenster auf das nächtliche London.
Hinter ihm ertönt ein durchdringendes Alarmsignal.
Kapitel 2
Es beginnt fast immer gleich: Violas Zunge malt einen Kreis auf ihren Lippen. Konzentriert zieht sie an dem losen Stein, der in der Wand sitzt. Der Ziegel macht ein schleifendes Geräusch in der Stille des Kellers, das ihr durch Mark und Bein geht. Plötzlich überkommt sie wieder dieses Gefühl, nicht allein zu sein, und sie blickt sich hastig um.
Nichts.
Der Kellerraum hinter ihr scheint zu atmen. Die Regale links und rechts werfen schwankende Schatten, von der Decke baumelt die eklige Spinnenlampe mit ihrem müden Licht und den flockigen Netzen rundherum.
Viola fasst den Stein mit den Fingerspitzen an den Kanten und zieht erneut daran, doch der Ziegel klemmt. Als wollte er sich wehren.
Ihr Gewissen meldet sich und zupft an ihrem Ohr.
Geh weg. Lass mich in Ruhe!
Für einen Augenblick ist es, als würde sie schweben und sich selbst von oben sehen, wie sie vor der Wand steht und zögert. Ist das nicht gemein, was sie hier tut?
Sie hat Tom lieb, wirklich! Auch wenn er manchmal echt blöd ist. Großer Bruder halt. Vierzehn! Sie ist nur vier Jahre jünger. Doch Tom tut so, als müsste er sie vor allem beschützen. Ein Wunder, dass er ihr das mit dem Schlüssel überhaupt gesagt hat. Und das mit dem Toten im Wasser hat er bestimmt nur erfunden. So was macht er manchmal, wenn er sie von etwas fernhalten will.
Als wenn sie darauf noch reinfallen würde.
Also noch mal, mit Gefühl.
Da! Wer sagt’s denn?!
Mit einem fiesen Kratzen löst sich der Ziegel aus der Wand. Die Spinnenlampe malt ihren Schatten auf die Mauer, da, wo jetzt das Loch ist. Sie streicht sich die Haare aus dem Gesicht, und ihr Schatten tut es ihr gleich; ihre Locken sehen plötzlich aus wie dunkle Flammen auf der Mauer. Aus dem schwarzen Loch kommt ein leises Flüstern, als wenn er sie rufen würde.
Ja? Oder nein?
Sie beißt sich auf die Lippen. Der Schlüssel ist Toms Geheimnis. Er liegt in Toms Versteck.
Also nein.
Doch Tom weiß nicht, dass es noch ein anderes Geheimnis gibt. Ihr Geheimnis. Denn sie weiß, wem der Schlüssel wirklich gehört. Und wenn sie den Schlüssel nicht zurückgibt, dann wird es nichts mit der versprochenen Überraschung.
Also ja!
Wieder schwebt sie über allem, sieht sich von oben, wie sie mit spitzen Fingern in dem Loch nach dem Schlüssel angelt, ihn zu fassen bekommt, ihn hastig einsteckt und dann den kleinen Zettel in die Öffnung legt.
Tschuldigung. Vi, hat sie darauf geschrieben.
Die Luft draußen ist frisch und nass.
Ihr rotes Fahrrad wartet im Schuppen auf sie. Früher hat sie sich immer vorgestellt, es sei ein Pferd, das leise zur Begrüßung schnaubt. Als sie sich in den Sattel schwingt, quietscht es leise. Der Dynamo jault, und das Licht flackert gelb. Noch nie war sie so spät allein draußen. Sie tritt fest in die Pedale, hoch über ihr fliegen Straßenlaternen vorbei.
Das Haus der Pastorin liegt am Ende der Straße. Sie klappt den Ständer aus. »Bin gleich wieder da«, flüstert sie und streicht über den Sattel. Die Klingel ist laut und schrill, wie ein Alarm. Hinter der erleuchteten Scheibe in der Tür taucht jetzt ein Schatten auf. Die Wellen im Glas zerren an der Gestalt, die bedrohlich in die Höhe wächst. Dann geht die Tür auf, und Viola stockt der Atem. Vor ihr steht ein dicker, unförmiger Mann mit einem schrecklich bleichen, aufgedunsenen Gesicht, Zahnlücken und milchigen Augen, als wäre er tot und hätte tagelang im Wasser gelegen.
Kapitel 3
Kurz nachdem das durchdringende Piepsen eingesetzt hat, schwingt die Tür auf, und das Deckenlicht geht an. Tom kneift die Augen zusammen. Eine blasse rothaarige Frau im Arztkittel steht plötzlich im Zimmer, sie trägt einen weißen Mund-Nasen-Schutz und sagt etwas zu ihm, doch er versteht kein Wort. Tom braucht einen Moment, bis er begreift, dass sie ihn auf Englisch anspricht – er solle sich doch bitte wieder hinlegen.
Ihm ist schwindelig, er hat das Gefühl, nicht zu funktionieren.
Alles um ihn herum ist falsch.
Die Ärztin bittet ihn noch einmal, sich wieder hinzulegen, und tritt zu ihm ans Bett. Ihr Blick ist besorgt, hellblaue, kühle Augen schauen ihn an. Sie ist jung, zumindest für eine Ärztin, höchstens Ende zwanzig. Die Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden, aus dem sich Strähnen gelöst haben, die ihr ins Gesicht fallen. Sie wischt sie beiseite. Ihr Blick geht zu einem der Monitore hinter Tom. Von dort kommt auch das Piepsen. Zu seiner Linken versperrt ihm eine spanische Wand die Sicht.
»Wo bin ich?«, fragt Tom. »Ist das ein Krankenhaus?« Er merkt, dass er schleppend spricht, seine Stimme klingt verwaschen.
Sie runzelt die Stirn.
Er versucht es auf Englisch.
Jetzt lächeln die Augen über der Maske. »Glückwunsch«, sagt sie auf Englisch. »Den zweiten Test haben Sie also auch bestanden.«
»Test«, nuschelt Tom. »Was war denn der erste … Test?«
»Das Aufwachen.«
Tom weiß nicht, ob das ein Scherz sein soll oder ob sie es ernst meint. Sein Blick fällt auf ihr Revers, an dem ein glänzendes weißes Schild angebracht ist. Dr. Jillian Harris.
Dr. Harris hat schlanke Finger, die jetzt ein paar Knöpfe drücken. Das Piepsen verstummt. Hinter der spanischen Wand meint er das Geräusch einer Beatmungsmaschine zu hören.
»Legen Sie sich bitte wieder hin«, sagt Dr. Harris noch einmal.
»Ich will mich nicht hinlegen«, murmelt Tom. »Ich will wissen, wo ich bin.«
Sie quittiert seinen Trotz mit gehobenen Augenbrauen und leuchtet ihm im nächsten Moment mit einer kleinen Taschenlampe in die Augen. »Im St Thomas’ Hospital in London«, sagt sie beiläufig. Ihre Stimme klingt gedämpft durch die Maske. Ihr Gesicht ist jetzt ganz nah, und er kann violette Ringe unter ihren Augen schimmern sehen. »Folgen Sie bitte mit den Augen meinem Finger, ohne dabei den Kopf zu bewegen.«
»Warum?«, fragt Tom.
Ihr Blick verrät, dass sie seine Fragen störrisch findet oder zumindest irritierend. »Ich muss einen Blickrichtungstest –«
»Nein, warum ich hier bin, in London.«
Dr. Harris lässt den Finger sinken. »Sie wissen nicht, weshalb Sie hier sind?«
»Ich weiß nicht mal, wie ich überhaupt nach England gekommen bin.«
Sie schweigt einen Moment. »Welchen Tag haben wir heute?«
»Ich, äh … Montag?« Er hätte genauso gut Samstag sagen können.
»Hm. Freitag. Wie heißen Sie?«
»Tom. Tom Babylon.«
Sie nickt. »Dr. Jillian Harris.« Ein flüchtiges Lächeln streift ihre Augenpartie.
»Ich weiß«, brummt Tom.
»Sieh an, und lesen können Sie auch. Was sind Sie von Beruf, Mr Babylon?«
»Polizist. Ich arbeite bei der Mordkommission in Berlin.«
»Mordkommission Berlin. Deutschland also. Mmh.« Sie nimmt den Test mit dem Finger wieder auf. »Und Sie haben keine Ahnung, warum Sie hier sind? Können Sie sich an irgendetwas erinnern?«
Tom versucht, sich zu konzentrieren, dabei meldet sich in seinem Kopf ein stechender Schmerz, aber keine Erinnerung. Jedenfalls keine, die erklärt, warum er in London ist. Er zuckt mit den Achseln und fasst sich an die pochende Stirn. Seine Finger ertasten ein großes Pflaster, die leichte Berührung lässt ihn vor Schmerzen zusammenzucken.
»Sie haben vermutlich einen Schlag auf den Kopf bekommen«, stellt Dr. Harris fest. »Wahrscheinlich hat Ihr Gedächtnis dabei etwas gelitten.«
»Wie bin ich hierhergekommen?«
»Mit einer Ambulanz. Sie sind in einem Hinterhof in Clerkenwell von einem der Anwohner gefunden worden, in einem Müllcontainer.«
»In einem was?«
»Ein Sammelcontainer für Hausmüll. Sie waren bewusstlos.«
»Ich … okay.« Tom ist immer noch etwas schwindelig, sein Blick geht zum Fenster, und er versucht, sich auf das Parlament zu konzentrieren, aber alles ist seltsam unscharf.
Plötzlich spürt er Dr. Harris’ warme Hände, eine auf seiner Schulter, eine auf seiner Brust. Mit sanftem Druck zwingt sie ihn, sich hinzulegen. Das Kissen gibt leise raschelnd unter seinem Kopf nach. Es fühlt sich gut an zu liegen. »Haben Sie meine Frau schon informiert?«
»Ihre Frau?« Dr. Harris sieht ihn bedauernd an. »Das war leider nicht möglich. Ich wusste bis gerade ja noch nicht einmal Ihren Namen …«
»In meiner Jacke ist mein Portemonnaie und mein Telefon …«
»Sie hatten nichts bei sich«, sagt Dr. Harris.
»Was heißt das, ich hatte nichts bei mir?«
»Na ja, keine Papiere, kein Geld, keine Kleidung …«
»Keine Tasche oder einen Koffer?«
In ihren Augen ist wieder dieses Lächeln, und sie schüttelt erneut bedauernd den Kopf. Sie kann das wirklich gut, das mit dem Bedauern. »Nein, gar nichts. Wie gesagt, noch nicht einmal Kleidung. Man hat Sie nackt aus diesem Container herausgeholt.«
Nackt. In einem Müllcontainer. Einen absurden Moment lang überlegt Tom, was von beidem ihm schlimmer erscheint.
Dr. Harris mustert ihn schweigend. Das Hellblau in ihren Augen strahlt über der weißen Maske. Um das Vlies herum bemerkt er ein paar Sommersprossen und muss an Viola denken.
Sie runzelt die Stirn, als hätte sie Vi in seinen Augen vorüberhuschen sehen. »Haben Sie sich gerade an etwas erinnert?«
»Nur an meine Schwester«, sagt Tom.
»Eine Erinnerung, die länger her ist? Oder aus den letzten Tagen?«
»Was macht das für einen Unterschied?«
»Sie haben offensichtlich eine retrograde Amnesie. Rückwärtsgewandt sozusagen«, erklärt Dr. Harris. Sie deutet auf das Pflaster an seinem Kopf. »Sie wurden niedergeschlagen. Alles, was vor dem Schlag war, haben Sie vergessen. Die Frage ist nur, wie lang der Zeitraum ist, an den Sie sich nicht erinnern können. Es würde helfen, wenn Sie sich an irgendetwas aus der letzten Zeit erinnern. Dann könnten wir eingrenzen, wie viel Ihnen entfallen ist.«
»Wie viel ist es denn üblicherweise?«
»Ein ›Üblich‹ gibt es bei einer Amnesie nicht. Es ist immer anders. Manchmal sind es nur Stunden. Manchmal Tage. Es gibt Menschen, die haben ihr ganzes Leben vergessen.«
Tom starrt sie an. Ihr ganzes Leben. Immerhin weiß er noch, wie er heißt und wo er arbeitet.
»Und?«, fragt sie.
»Was und?«
»Ihre Schwester. Von wann ist die Erinnerung?«
»Ist lange her«, sagt er. »Von ihrer Beerdigung.« Sie muss nicht wissen, dass Viola gerade erst hier im Krankenzimmer bei ihm war. Die neurologischen Untersuchungen, die sie dann mit ihm anstellen würde, wären vermutlich endlos.
»Oh. Das … das tut mir leid. Wie alt war sie denn, als sie …?«
»Zehn.« Er räuspert sich. »Zehn Jahre alt …« Seine Stimme leiert jetzt nicht mehr, dafür klingt er heiser.
Für einen Moment herrscht Stille.
»Soll ich jemanden für Sie anrufen?«, wechselt Dr. Harris das Thema. »Ihre Frau? Oder Ihre Eltern?«
»Ich, äh … Was glauben Sie, wann ich hier rauskann?«
Sie zuckt mit den Achseln. »Mit etwas Glück in ein paar Tagen. Wir müssen einige Tests machen.«
Tom nickt.
»Wenn Ihnen die Telefonnummern Ihrer Angehörigen nicht einfallen, sagen Sie mir einfach die Namen und wo sie wohnen. Den Rest bekommen wir dann schon hin.«
»Wie spät ist es?«, fragt Tom.
»Kurz vor Mitternacht.«
So spät? Er überlegt, wie viel Sinn ein Anruf um diese Uhrzeit macht. Anne würde nur verrückt vor Sorge werden, und ändern könnte sie gerade ohnehin nichts. Und sein Vater? Ein Schatten wischt durch seine Erinnerung, ein Streit, das trotzige, wächserne Gesicht seines Vaters und das Gefühl, dass sie nicht mehr miteinander sprechen. Aber warum?
»Vielleicht besser morgen«, murmelt Tom erschöpft. »Die Nummer meiner Frau ist …«, er stockt. Tatsächlich will ihm Annes Telefonnummer nicht einfallen. Das kommt davon, wenn man sich nur noch auf den Rufnummernspeicher seines Handys verlässt. »Sie heißt Anne. Anne Babylon. Wir wohnen in Kreuzberg … oder Sie rufen beim Landeskriminalamt Berlin an, im Dezernat.« Er stockt erneut. Auch die Nummer des Dezernats ist ihm entfallen. »Bei der Mordkommission … die kennen mich … meine Frau auch.«
»Mordkommission, Landeskriminalamt Berlin. Und Ihre Frau heißt Anne. Ich kümmere mich darum. Direkt morgen früh rufe ich dort an.« Dr. Harris nickt ihm zu. »Ich lasse Sie jetzt allein. Sie brauchen Ruhe.«
»Danke«, flüstert Tom schläfrig.
Sie ist schon beim Lichtschalter und knipst die Deckenbeleuchtung aus. Die Notbeleuchtung übernimmt. Krankenhausdämmerung. Diffuse Schatten. Das Atemgeräusch des anderen Patienten hinter der spanischen Wand. Das in der Nacht leuchtende Parlament am Themseufer, wie ein altes Schlachtschiff, mit einem zu weit rechts gesetzten Mast, der für Schlagseite sorgt. Wie zum Teufel bin ich nach London gekommen? Und warum?
»Ich sehe nachher noch mal nach Ihnen«, sagt Dr. Harris leise. Sie klingt irgendwie mütterlich. Wie Anne, wenn sie Phil sagt, dass sie später noch einmal nach ihm schaut. Ihr gemeinsamer Sohn ist drei, das weiß Tom, und auf einmal überkommt ihn das merkwürdige Gefühl, Phil lange nicht mehr gesehen zu haben. Tom vermisst ihn, und der Schmerz ist beinah körperlich. Hinter der spanischen Wand hört er Dr. Harris leise mit dem anderen Patienten sprechen, dann schläft er ein und fällt in einen wirren Traum, in dem er von der Tower Bridge springt und auf dem Grund der Themse nach Viola sucht, doch da ist nur ein aufgeblähter bleicher Mann, eingewickelt in Kaninchendraht.
Kapitel 4
Viola starrt die fiese Gestalt an, die ihr die Tür geöffnet hat.
»Mein Gott, Kind. Was suchst du denn hier? Weißt du, wie spät es ist?« Aus der schrecklichen Erscheinung ist plötzlich die Pastorin geworden. »Du bist doch Viola, oder? Die Kleine von Werner.«
Viola nickt, bringt aber kein Wort heraus.
»Weiß dein Papa, dass du hier bist?«
Viola nickt. Was natürlich gelogen ist.
»Willst du hereinkommen?«
»Ich, äh, Entschuldigung … ist Ihr Mann zu Hause?«
Die Pastorin schaut sie überrascht an. »Nein. Er ist für eine Weile weggefahren …«
Viola schluckt. Sie tastet nach dem Schlüssel in ihrer Tasche.
Tu’s nicht, flüstert Tom in ihrem Kopf.
Geh weg!, denkt sie. Das ist mein Schlüssel.
Ist er nicht!
Die Pastorin schaut sie an, als hätte sie das gehört. »Was willst du denn von meinem Mann?«
»Ich … ich hab da was gefunden, was ihm gehört, glaube ich.« Viola holt den Schlüssel aus der Tasche. Er liegt ganz unschuldig in ihrer Hand.
Die Pastorin nimmt ihn und blickt mit gerunzelter Stirn auf die Zahl, die in die graue Schlüsselkappe eingeritzt ist. »Danke, das ist lieb von dir«, sagt sie leise. »Jetzt aber schnell nach Hause, ja? Ich ruf eben deinen Papa an, dass du unterwegs bist.« Sie scheint darauf zu warten, dass Viola geht, doch Viola bleibt stehen wie angewachsen.
Die Pastorin hebt fragend die Augenbrauen.
»Er … ähm …«, stottert Viola.
»Ja?«
»Also … Ihr Mann … er hat gesagt, er hat eine Überraschung für mich«, sprudelt es aus ihr heraus. »Ich dachte, wenn ich ihm den Schlüssel bringe, es ist ja seiner …« Viola hält inne, hofft, dass die Pastorin irgendwie reagiert, bis ihr plötzlich klar wird: Die Pastorin weiß von nichts. Ihr Mann hat die Sache mit der Überraschung vor ihr geheim gehalten.
Viola beißt sich auf die Zunge. Hätte sie doch bloß nichts gesagt. Es ist wie das Spiel mit diesem kippeligen Turm aus vielen Hölzern. Gerade hat sie das Gefühl, das unterste Holz herausgezogen zu haben, sie kann sehen, wie der ganze Turm fällt.
»Ich glaube, du gehst jetzt besser schnell heim«, sagt die Pastorin. Ihre Stimme klingt belegt. »Geh heim, Schätzchen, ja? Geh bitte.« Dann schließt sie die Tür.
Viola geht zurück zu ihrem Fahrrad, radelt ein Stück, bis zur nächsten Straßenecke, dort bleibt sie stehen und schaut zurück zum Haus der Pastorin.
Fahr!, flüstert Tom ihr zu. Noch kannst du abhauen.
Sie weiß genau, sie sollte besser auf Tom hören, doch jetzt verlässt die Pastorin das Haus, und sie schaut sich dabei um wie jemand, der etwas macht, bei dem er nicht beobachtet werden will. Bei manchen Erwachsenen kann man Geheimnisse schon von ewig weit weg riechen – und irgendetwas sagt Viola, das hier hat etwas mit dem Schlüssel zu tun. Sie folgt der Pastorin durch Stahnsdorf, eine Straße, dann die nächste und wieder die nächste, sie hält Abstand, bis die Pastorin in den Waldweg abbiegt. Hier gibt es keine Straßenlaternen mehr. Die Bäume neigen ihre Wipfel, wachsen über ihr zusammen. Ein bleicher scharfer Sichelmond zittert zwischen den Blättern.
Viola überlegt umzukehren.
Gute Entscheidung!, raunt Tom. Fahr. Fahr schnell!
Aus der Dunkelheit schält sich ein allein stehendes einstöckiges Haus. Viola geht den Weg entlang, ein kleines Stück darauf zu.
Es sieht alt aus, heruntergekommen, mit dicken rissigen Wänden und Gittern vor den Fenstern.
Die Pastorin fischt einen Schlüssel aus ihrem Mantel und öffnet vorsichtig die Tür. Ist das Toms Schlüssel?
»Hallo?«, ruft sie ins Haus.
Viola schleicht heran, legt ihr Fahrrad hinter einem Gebüsch ab und linst durch das Geäst.
Die Pastorin hat ein Feuerzeug. Die kleine Flamme tanzt wie ein Glühwürmchen auf ihrer Faust. Mit unsicheren Schritten betritt sie das finstere Gebäude.
Viola hält den Atem an.
Hin und wieder huscht ein gespenstisches Licht hinter den zugezogenen Vorhängen vorbei. Nach einer ganzen Weile kommt die Pastorin wieder heraus, in Begleitung einer jungen Frau. Ihre beiden Gesichter flackern im Licht des Feuerzeugs. Die fremde Frau ist mager. Wie ein Gespenst kommt sie Viola vor in ihrem hellen Nachthemd. Ständig fliegen ihre Augen hin und her. Die Arme vor der Brust verschränkt, hält sie ein Buch, rot mit einem goldenen Kreuz drauf. Viola schaudert, sie muss an Lucy und Mina denken, aus Dracula. Hätte sie den blöden Film doch bloß nie gesehen. Aber Tom hatte es unbedingt gewollt, also hatte sie die Zähne zusammengebissen. Schließlich war sie ja kein Baby mehr.
Letzte Chance, flüstert Tom. Hau ab, Schwesterherz.
Es riecht plötzlich unangenehm. So wie das Mathebuch auf dem Herd, als die Platte noch an war. Das ganze Haus hatte gestunken.
Irgendwo splittert Glas, Rauch dringt aus der Tür, und der Gestank wird immer stärker. Die Pastorin muss es doch auch riechen, warum tut sie nichts? Sie steht nur da und schaut, und Lucy – oder Mina oder wie auch immer sie heißt – hält sich an ihrer Bibel fest. Jetzt schlagen Flammen aus dem Haus, immer höher, die beiden weichen zurück, und dann, ganz plötzlich, taucht wie aus dem Nichts ein Mann auf, eine große schwarze Gestalt. Viola bekommt eine Gänsehaut am ganzen Körper. O Gott, bitte nein, ist das etwa?
Nein, ist er nicht.
Diesen Mann hat sie schon ein paarmal gesehen, im Dorf. Aber könnte er nicht trotzdem …?
Das war ein Film, Vi, flüstert Tom. Dracula gibt es nicht.
Tom hat gut reden. Irgendwie hat der Blödarsch nie Angst.
Du musst jetzt weg hier, kleine Schwester!
Nenn mich nicht KLEINE Schwester!!
Der Mann fängt an zu schimpfen, zeigt auf das brennende Haus. Im Schein des Feuers kann Viola jetzt etwas am Wegesrand erkennen, ganz in ihrer Nähe. Eine schwarze Kutsche ohne Pferde.
Nein, ein Auto! Vielleicht gehört es dem Mann.
Die Erwachsenen streiten miteinander, dann brüllt der Mann plötzlich Lucy an, sie soll endlich aufhören, dummes Zeug zu quatschen und sich an ihrer Scheißbibel festzuhalten, sonst passiert was. Zornig reißt er ihr das Buch aus der Hand und pfeffert es davon. Viola duckt sich schnell, und das Buch schlägt raschelnd ins Gebüsch ein, direkt neben ihr bleibt es in den Zweigen hängen und rutscht zu Boden.
Lucy weicht vor dem Mann zurück. Beißender Rauch weht herüber, Viola blinzelt und bückt sich nach dem Buch. Es ist groß, etwas abgestoßen an den Kanten, aber wunderschön mit dem goldenen Kreuz darauf und einer kleinen Schnalle, die es verschließt. Sie streicht mit der Hand darüber und nimmt sich vor, es Lucy zurückzugeben. In diesem Moment explodiert eine helle Flammenwolke. Feuer züngelt am ganzen Haus empor und schlägt hoch in den Nachthimmel. Der Mann lässt von Lucy ab. Aus dem Haus kommen plötzlich Schreie, laut und durchdringend.
Die Pastorin rennt zum Haus, muss aber vor dem Feuer zurückweichen. Die Schreie wollen und wollen nicht aufhören und gehen Viola durch Mark und Bein. Die Hitze glüht auf ihrer Haut. Es knistert und kracht, die Flammen erleuchten alles taghell, sogar das Gebüsch. Lucy schaut in die Richtung, wohin der Mann ihre Bibel geworfen hat, und ihre Augen weiten sich, als sie Viola sieht. Der Mann bemerkt ihren Blick, und dann schaut auch der Mann zu ihr. Er starrt sie förmlich an. Seine Augen sind glühende Kohlenstücke, sein Mund öffnet sich, als wollte er sie verschlingen. Dann rennt er los.
Viola springt hinter dem Busch hervor, schwingt sich auf ihr Fahrrad, strauchelt, tritt neben die Pedale. Der Mann hat sie schon fast erreicht, streckt seine grobe fleischige Hand nach ihrem Gepäckträger aus. Ihre Füße finden die Pedale, und sie tritt wie verrückt. Ihr Fahrrad wiehert ängstlich und fliegt mit ihr den Waldweg hinunter. Hinter ihr brüllt der Mann, kommt näher, immer näher, hat sie gleich, dann plötzlich ein schriller Klingelton.
Einmal.
Noch einmal, und sehr lange.
Der Waldweg und die Dunkelheit verschwinden. Der Traum zerreißt.
Viola öffnet die Augen.
Gott sei Dank. Wenigstens der Teil im Loch ist ihr erspart geblieben.
Sie liegt auf dem Chesterfield-Sofa in ihrem Arbeitszimmer in London. Ihre Wange klebt schweißnass am Leder, ihr Nacken ist verspannt. Der Sichelmond steht über dem Park. Das Fenster ist eine Handbreit geöffnet, feuchtkalte Londoner Luft stiehlt sich ins Zimmer und atmet gegen die bullernde Heizung an.
Hat es etwa gerade an der Tür geklingelt?
Der kleine Digitalwecker auf der Kommode zeigt 23 : 37 Uhr.
Sie schüttelt den Traum ab. Sie weiß, dass er wiederkommen wird, mit all seinen Details, und er ist nie willkommen. Sie richtet sich auf, stellt die Füße auf den Boden. Ihr ist schwummerig und ein wenig übel. Sie starrt auf die Wand, auf ihre Schwarz-Weiß-Fotos im Licht der Stehlampe. Männer mit Gewehren starren zurück.
Wofür man heutzutage Preise bekommt, denkt sie. Und dass sie gerne den Preis persönlich entgegengenommen hätte. Was das angeht, wird sie wohl nie frei sein.
Sie steht auf und geht durch den dunklen Flur zur Wohnungstür. »Mama? Wer ist das?«, fragt Finja verschlafen aus ihrem Zimmer. Die Tür ist einen Spaltbreit geöffnet. Sie hat sich in ihrem Bett aufgesetzt.
»Alles gut, Schatz. Schlaf weiter.« Viola zieht die Tür zu ihrem Zimmer zu. Eigentlich ist Finja längst zu alt für diesen Alles-gut-Quatsch. Draußen im Hausflur ist Licht, ein heller Streifen quillt unter der Tür hindurch. War da ein Schatten? Sie hat das Gefühl, eine kalte Hand würde nach ihrem Herzen fassen. Die drittletzte Diele vor der Tür knarzt. Der Spion, den sie extra in die Tür hat einbauen lassen, glimmt wie das Auge eines Raubtieres, das sich in die Nähe eines Lagerfeuers geschlichen hat.
Sie schaut durch den Spion.
Niemand da.
Der kleine in weißes Plastik gefasste Monitor der Sprechanlage neben der Tür zeigt ebenfalls nur einen leeren Flur. Sie schaltet die Videoeingänge durch. Alle drei WLAN-Kameras zeigen das Gleiche: Niemand ist im Hausflur. Noch einmal schalten. Auch draußen vor dem Haus ist niemand.
Sie löst den Panzerriegel und dann die Sicherungskette, schließt die Wohnungstür auf. Kühle Luft aus dem Flur kommt ihr entgegen und der typische muffige Geruch, der aus dem Keller aufsteigt. Wer klingelt um diese Zeit an ihrer Tür? Ein Nachbar? Vielleicht hat jemand ein Paket für sie angenommen? Oder einen Brief? Sie würde gerne eine alltägliche Erklärung finden und sich selbst beruhigen, meistens hilft das. Aber da liegt nichts. Sie hebt die Fußmatte an und schaut darunter. Auch nichts.
Mit einem leisen Schnalzen fällt die Matte zurück an ihren Platz. Unten im Erdgeschoss, zwei Etagen tiefer, schlägt eine Tür hallend zu, und sie zuckt zusammen. Ihr Blick fällt auf den Fußboden, etwa einen Meter neben der Matte. Erst jetzt sieht sie den kleinen roten Fleck. Sie bückt sich, berührt ihn vorsichtig mit der Fingerspitze und zieht erschrocken die Hand wieder zurück. Der Fleck ist noch feucht, und an ihrem Finger haftet Blut.
Kapitel 5
Als Tom wieder aufwacht, ist es hell um ihn herum. Tageslicht füllt das Zimmer. Für einen Augenblick glaubt er, das nächtliche Krankenhaus und Dr. Jillian Harris seien nur ein Traum gewesen. Er blinzelt, stellt den Blick scharf und sieht aus dem Fenster. Das Themseufer, das Parlament und Big Ben sind immer noch da.
Verwirrt schließt er die Augen.
Er versucht, die bleierne Müdigkeit und den Nebel in seinem Kopf zu durchdringen, um irgendetwas zu finden, das ihm erklärt, wie er nach England gekommen sein könnte, und vor allem warum. Doch das Einzige, woran er sich erinnert, ist Dr. Harris, die ihm sagt, er sei in einem Müllcontainer in einem Viertel namens Clerkenwell gefunden worden. Dabei weiß er weder, wo Clerkenwell liegt, noch, wie es dort aussieht.
Als er die Augen wieder öffnet, kommen ihm das Fenster und der Ausschnitt von London vollkommen unwirklich vor, wie eine Inszenierung, ein Hologramm in der Wand, das ihm weismachen soll, er wäre in England.
Wie eine stimmige Fortsetzung der Inszenierung betritt eine Krankenschwester mit Mundschutz das Zimmer, begrüßt ihn auf Englisch als Mr Babylon; ihren eigenen Namen nennt sie nicht. Sie ist um die fünfzig, hat kurze blondierte Haare, ein aufgedunsenes Gesicht und ist offenkundig schlecht gelaunt. Tom fragt sie nach Dr. Harris, und sie zuckt mit den Schultern. Dr. Harris habe Nachtschicht, soweit sie wisse. Wie spät es denn sei? Halb zwölf, antwortet sie. Tom fragt, ob schon jemand seine Frau Anne informiert habe. Auch daraufhin zuckt sie mit den Schultern, verweist auf Covid und knurrt, dass sie weiß Gott gerade andere Sorgen hätten. Tom bleibt höflich, und immerhin fragt sie ihn jetzt nach Annes Telefonnummer. Dass er sie nicht weiß, scheint sie geradezu anstößig zu finden.
Wie schon in der Nacht erklärt Tom, dass seine Kollegen bei der Mordkommission beim LKA Berlin weiterhelfen könnten.
Die Schwester nickt, macht aber aus ihrem Unwillen keinen Hehl und lässt Tom mit dem Gefühl zurück, vollkommen ohnmächtig zu sein. Er würde jetzt gerne Annes Stimme und Phils fröhliches Geplapper hören.
Zehn Minuten vergehen.
Die Schwester wird niemanden anrufen, so viel ist sicher. Und was die verständnisvolle und besorgte Dr. Harris am Ende für ihn tun wird, ist unklar. Tom weiß, er ist einer unter vielen Patienten, warum sollte sie Zeit haben, sich mit seinen Telefonaten herumzuschlagen.
Tom betrachtet eine Weile seinen Puls und seine Herzkurve. Die Kopfschmerzen haben nachgelassen. Er beschließt, aufzustehen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Einatmen, Decke beiseiteschieben, aufrichten, ausatmen. Einen Moment lang sitzt er im Bett, wartet auf den Schwindel, der aber ausbleibt.
So weit, so gut. Jetzt die Beine.
Tom hebt die Beine über die Bettkante, lässt sie baumeln und schaut auf seine nackten Füße, die unter dem Krankenhausleibchen hervorgucken. Ihm fällt ein, dass er keine Kleidung hat – und auch keine Schuhe. Zumindest wenn das stimmt, was Dr. Harris gestern Nacht gesagt hat.
Er rutscht mit dem Po näher an die Bettkante heran, bis seine Füße den Boden berühren. Linoleum oder PVC. Krankenhaus eben. Er fröstelt. Ganz langsam steht er auf, stützt sich dabei mit den Händen am Bett ab.
Und jetzt? Müsste nicht irgendwo hier im Zimmer ein Telefon sein?
Aber da sind nur ein paar leere Buchsen in der Wand.
Vielleicht in dem Schrank auf der anderen Seite? In vielen Krankenhäusern wurden die Telefone erst eingestöpselt, wenn die Patienten registriert waren und unterschrieben hatten, dass sie für die Kosten aufkamen.
Er lässt das Bett los und macht einen Schritt auf den Schrank zu, schwankt, und genau in diesem Moment geht die Tür auf.
»Was um Himmels willen machen Sie da?«
Dr. Harris steht in der Tür und starrt Tom an.
Tom verzieht das Gesicht, hat das Gefühl, nach vorne zu fallen, hält sich an dem Gestell mit dem Vitalfunktionsmonitor fest, doch das Gestell rollt zur Seite, und er verliert das Gleichgewicht.
Dr. Harris ist plötzlich neben ihm, ohne dass er versteht, wie sie so schnell dahin gekommen ist, und versucht, ihn aufzufangen. Sie ächzt und geht unter seinem Gewicht in die Knie. Mühsam bugsiert sie ihn zurück in Richtung Bett, dabei verrutscht ihr Mundschutz. Ein Metallgestänge mit einer Infusion stürzt klappernd um. Tom fällt rücklings auf die Matratze.
»Oh, mein Gott! Wie schwer sind Sie?«, stöhnt Dr. Harris. Sie richtet sich auf und sieht Tom vorwurfsvoll an. Ihr Gesicht ist rosarot von der Anstrengung.
»Keine Ahnung«, schnauft Tom. »Danke.« Erst jetzt fällt ihm auf, wie klein sie ist. Dass sie gerade einen Mann von fast zwei Metern aufgefangen hat, grenzt an ein Wunder.
»Was sollte das? Wo wollten Sie hin?« Rasch rückt sie ihren Mundschutz wieder zurecht.
»Meine Frau anrufen.« Tom hebt seine Beine zurück ins Bett. Das Krankenhausleibchen ist verrutscht, und er liegt halb frei da. Dr. Harris’ Blick gleitet für einen Moment nach unten. Sie fasst in aller Ruhe nach der Decke und legt sie über Tom.
Er räuspert sich. »Sie haben keinen Arztkittel an.«
»Ich bin nicht im Dienst.«
»Warum sind Sie dann hier?«
Sie hebt die Brauen. »Soll ich wieder gehen?«
»Nein, nein. Bitte … ich dachte nur, ich hab mich nur gewundert.«
Dr. Harris nickt. Dann seufzt sie. »Schon okay. Es ist so: Bei mir in der Familie gibt es einen Fall von Demenz. Also nicht, dass Sie dement wären, aber … na ja. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn er … so wie Sie …« Es entsteht eine lange Pause. »Also, ich hatte Ihnen ja versprochen, Ihre Frau anzurufen«, fährt sie fort. »Deshalb bin ich hier.« Ihr Blick wandert zu dem Monitor mit den Vitalfunktionen, der jetzt etwas abseits steht, zieht ihn wieder ans Bett heran und drückt ein paar Knöpfe.
»Und, haben Sie sie erreicht?«, fragt Tom.
Dr. Harris lässt von den Monitoren ab und zögert einen Moment. »Heute früh habe ich beim LKA in Berlin angerufen, wie Sie mir gesagt hatten. Sie haben im Dezernat 11 gearbeitet, oder?«
Elf. Tom nickt. Die Zahl wäre ihm nicht eingefallen, aber jetzt, wo er sie hört, klingt sie richtig.
»Ich habe mit dem Dezernatsleiter gesprochen«, sie holt ihr Handy hervor und sucht nach einer Notiz, »Joseph Morten.«
»Mein Chef, ja«, sagt Tom. Langsam kommt seine Erinnerung in Schwung.
Dr. Harris sieht ihn einen Moment an, mit diesem Blick, den Menschen haben, wenn sie eine unangenehme Wahrheit aussprechen müssen. »Mr Morten hat mir gesagt, dass Sie nicht mehr bei der Polizei arbeiten.«
Tom starrt sie verblüfft an. »Bitte, was?«
Sie hebt bedauernd die Schultern. »Sie arbeiten nicht mehr dort. Offenbar wurde Ihnen gekündigt.«
Der Schwindel, von dem er glaubte, ihn überwunden zu haben, kehrt zurück. »Ich … ähm …« Das ist unmöglich, will er sagen. Aber natürlich ist alles möglich, so wie es möglich ist, plötzlich in einem anderen Land aufzuwachen. »Wissen Sie, wann das gewesen sein soll?«
»Mr Morten meinte, vor vier Wochen. Sie können sich wirklich an nichts erinnern?«
Tom schüttelt den Kopf.
»Dann wissen wir immerhin, dass sich Ihre Erinnerungslücke über mindestens vier Wochen erstreckt.«
Ein schwacher Trost. Warum hat man ihn bloß bei der Polizei vor die Tür gesetzt? »Konnte Morten Ihnen wenigstens die Telefonnummer meiner Frau geben?«
»Hat er, ja, nur …« Dr. Harris zögert. »Da gibt es ein Problem.«
»Was denn für ein Problem?«
»Unter der Nummer meldet sich jemand anders, ein Mr Kirsch oder Kursch oder so ähnlich. Er hat die Nummer seit etwa einer Woche. Ihre Frau hat sie wohl gekündigt.«
»Äh, vielleicht hatten Sie die falsche Nummer«, sagt Tom überrascht. »Haben Sie es noch mal probiert?«
»Dreimal. Außerdem habe ich auch die Festnetznummer probiert. Auch die ist gekündigt.«
»Das glaube ich nicht«, sagt Tom. »Die Nummern müssen falsch sein.
»Familie Babylon, Heckmannufer Nr. 9 in Berlin-Kreuzberg. Das ist doch Ihre Adresse, oder?«
Tom zögert, bekommt etwas in der Dunkelheit zu fassen. »Ja … schon. Die Adresse stimmt.« In seinem Kopf formt sich ein Bild. Kreuzberg, der Landwehrkanal, die Maisonettewohnung mit der großen Wohnküche im Souterrain. Zum ersten Mal, seit er in London aufgewacht ist, hat er das beruhigende Gefühl, Herr seiner Erinnerung zu sein. Die Wohnung kommt ihm wie ein Anker vor, der ihn verlässlich mit seinem bisherigen Leben verbindet. »Da wohne ich«, sagt er, »gemeinsam mit Anne und meinem Sohn Phil.«
Dr. Harris fasst sanft nach seiner Hand, und im selben Moment ahnt er, dass diese Geste nichts Gutes bedeutet. Ihr Blick ist ruhig und fest, und da ist wieder dieses Bedauern, dieses stumme Es tut mir leid … »Tom, ich habe mir wirklich Mühe gegeben …«
Er zieht seine Hand weg. »Jetzt reden Sie nicht drum herum, sagen Sie, was los ist. Bitte.«
»Ihre Frau und Ihr Sohn wohnen dort nicht mehr.«
Tom starrt Dr. Harris mit offenem Mund an. »Das kann nicht sein.«
»Ich fürchte, doch. Die Wohnung wird im Internet zur Vermietung angeboten. In der Anzeige sind Fotos eingestellt.«
»Das muss ein Irrtum sein. Das ist ausgeschlossen. Sie haben die falsche Wohnung.«
»Es ist die Wohnung im Erdgeschoss, mit der großen Küche im Souterrain und der zusätzlichen kleinen Eingangstür, richtig?«
»Woher wissen Sie das?«, fragt Tom verblüfft.
»Ich habe mit dem Makler telefoniert, Tom. Er sprach recht gut Englisch, jedenfalls besser als Ihr Chef. Er konnte sich auch noch an Sie und Ihre Familie erinnern.« Sie hält inne, als wollte sie abwarten, ob er protestiert.
»Wann … wann sind wir dort ausgezogen?«
»Vor vier Wochen.«
28 Tage vorher
Kapitel 6
Dr. Sita Johanns zwingt ihren alten Saab 900 in eine scharfe Rechtskurve und biegt auf die schmale Allgäuer Bergstraße in Richtung Hochplateau ein. Forensische Klinik Burg Tauenstein – 6 Kilometer, verspricht ein Straßenschild. Die Kurve ist enger, als sie gedacht hat, und aus ihrem Kaffeebecher schwappt etwas auf die Tageszeitung, die auf dem Beifahrersitz liegt. Die Ausgabe der Berliner Morgenpost ist zwölf Tage alt. Der Aufmacher ist ein Foto der U-Bahn-Station Hermannplatz:
»Zivilcourage nimmt tödliches Ende«
Die Seiten der Zeitung flattern auf. Der Wind am Berghang drückt durch die halb offene Scheibe.
Sita fröstelt und schließt das Seitenfenster. Mit jedem Höhenmeter wird es kälter. Aus den betagten Lautsprechern dringt Massive Attack, eine ihrer All-Time-Favorite-Bands, cool, schleppend und melancholisch. Irgendwie passend beim Blick auf die Alpen.
»The hunter gets captured by the game«, singt Tracey Thorn.
Sita muss an Tom denken, und ihr schwirrt der Kopf. In den vier Jahren, die sie sich jetzt kennen, gibt es niemanden, der ihr so nah gekommen ist, ohne dass sie mit ihm geschlafen hätte. Die Arbeit in den Sonderkommissionen des LKA Berlin ist ihr manchmal wie ein Rausch vorgekommen. Grenzüberschreitend, lebensgefährlich und voller persönlicher Verstrickungen. All das, was Polizeiarbeit eigentlich nicht sein sollte – und manchmal trotzdem ist. Hat Tom zu oft die Grenzen überschritten? Ja, hat er.
Hat Tom die Kontrolle verloren? Auch das.
Und trotzdem ist sie auf seiner Seite. Ja, vielleicht ist es ein Fehler, zu Bruckmann zu fahren. Sie weiß noch nicht einmal, ob sie sagen wird, was Tom ihr aufgetragen hat. Sie weiß nur, dass sie Bruckmann sehen muss, um herauszufinden, ob Tom recht hat. Zuletzt haben sie alle Kollegen eindringlich gewarnt, Grauwein, Frohloff, Pfeiffer, sie alle haben ihr geraten, nicht auf Tom zu hören. Und Jo Morten, ihr direkter Vorgesetzter, hat sie dafür extra in sein Büro zitiert.
»Du bist doch Psychologin, und eine gute dazu.« Das waren seine einleitenden Worte gewesen. Chapeau, dachte Sita. Er lernt! Mit Komplimenten beginnen und dann gemeinsam das Unausweichliche betrachten. Sie ahnte, worauf das hinauslief. Doch in letzter Zeit hatte Morten ihr gegenüber gelegentlich eine andere Seite gezeigt, geduldiger und zugewandter. Vielleicht konnte sie ihn doch überzeugen.
»Siehst du nicht, was hier mit Tom passiert?«, fragte Morten.
»Doch, sehe ich«, erwiderte Sita. »Aber er könnte trotzdem recht haben.«
»Sita, bitte! Das, was Toms Vater zugestoßen ist, ist schrecklich. Keine Frage. Und von dem, was damals Toms Mutter zugestoßen ist, will ich gar nicht erst reden. Oder vielleicht doch … denn offiziell ist ihr Tod in den Archiven der NVA als Unfall vermerkt. Und falls sie tatsächlich erschossen wurde: Sie hat sich eine Grenzverletzung zuschulden kommen lassen. Die Grenzsoldaten hatten damals nun mal einen Schießbefehl, und ja, das war verbrecherisch, aber eine Tatsache. Dass Bruckmann behauptet hat, irgendetwas mit der Sache zu tun zu haben, das hat ausschließlich Tom gehört. Niemand sonst. Bruckmann hat das später nie bestätigt, in keiner der Vernehmungen. Und wir hatten einige! Tom jagt einem Hirngespinst nach, Sita. Ich meine, ich versteh ja, warum. Ich bin schließlich kein Unmensch. Aber hier«, Morten tippte mit den sehnigen, vom Nikotin verfärbten Fingern auf das Bild der U-Bahn-Station in der Zeitung, »hier geht es um etwas ganz anderes. Das war nicht Bruckmann. Und ich erwarte, dass du deine profunden Kenntnisse hier bei uns einsetzt – und nicht für die privaten Belange eines Kollegen.«
»Und was ist mit dem verschwundenen Beweismaterial?«
»Sita, bitte! Der Vermisstenfall Viola Babylon ist dreiundzwanzig Jahre alt und längst abgeschlossen. Toms Schwester ist tot und beerdigt, so leid es mir tut. Das Material hätte schon vor dreiundzwanzig Jahren vernichtet werden sollen.«
»Wurde es aber nicht. Es lag bis vor einem Jahr im Archiv. Und jetzt ist es plötzlich weg? Wie kann das sein?«
»Das Archiv platzt aus allen Nähten, das weißt du doch. Irgendjemandem wird der Karton bei einer Revision aufgefallen sein, und dann hat man ihn endlich entsorgt.«
»Ohne ihn in der Liste auszutragen?«
»Wahrscheinlich wurde er schon vor dreiundzwanzig Jahren ausgetragen. Der Fehler ist doch, dass wir den Karton überhaupt so lange aufgehoben haben.« Morten atmete tief durch, so wie ein Lehrer, der eine schier übermenschliche Geduld für seine aufsässige Schülerin aufbringen musste.
»Und dass Bruckmann versucht hat, Toms Sohn zu töten, das zählt für dich nicht?«
»Was heißt denn bitte, das zählt für mich nicht?«, brauste Morten auf. Sein Geduldsfaden schien nun zu reißen. Der neue, ruhige Morten war nur Fassade. »Was glaubst du, was ich bin? Ein Monster? Ich hab selbst Kinder. Das war abscheulich. Aber Bruckmann sitzt seit einem Jahr hinter Schloss und Riegel, achthundert Kilometer von hier entfernt, ohne jeden Kontakt zur Außenwelt.«
»Jo, aber was, wenn Tom doch recht hat? Du kennst doch Bruckmann. Willst du das wirklich riskieren? Warum lässt du mich nicht einfach ein paar Tage in die Richtung ermitteln? Unterschreib mir die Genehmigung für Tauenstein. Gib mir Frohloff oder meinetwegen auch Nicole Weihertal zur Seite. Vier, fünf Tage.«
»Nein«, sagte Morten schmallippig.
»Aber warum nicht?«
»Weil es nichts bringt, Sita!« Morten beugte sich vor und legte die rechte Hand auf die Zeitung. »Und weil wir unter Druck stehen. Der Vater von Charlotte Wißmann ist schließlich nicht irgendwer.«
»Ach, darum geht’s, ja?« Sita funkelte ihren Vorgesetzten wütend an. »Politik?«
»Ach komm schon, Sita. Du weißt, wie das läuft. Das ist wie Domino. Rolf Wißmann ist mit Ahlgrimm befreundet, Ahlgrimm wird vermutlich bald neuer Innenminister, und der ruft natürlich bei der Polizeipräsidentin an.«
»Ach, und was, wenn doch Otto Keller neuer Innenminister wird? Keller ist nach seinem Rücktritt damals wieder obenauf. Was, wenn er sich durchsetzt? Dann ist Charlotte nicht mehr so wichtig?«
»Mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass Keller das Rennen macht«, sagte Morten, »Charlottes Tod ist ausgesprochen tragisch. Junge hübsche Frau, prominenter Vater, Zivilcourage … für die Medien die perfekte Story. In den Social-Media-Kanälen läuft das Thema heiß. Die Welt ist nun mal, wie sie ist. Und der Polizeipräsident ist gut beraten, darauf zu reagieren.«
»Das ist mir ehrlich gesagt egal, das ist alles am Ende nicht wichtig. Es gab DREI Tote, und einer davon ist der Vater deines Kollegen. Wir sind es Tom einfach schuldig.«
»Und deswegen ermitteln wir ja auch mit Hochdruck, aber nicht in die Richtung, die sich Tom zusammenfantasiert. Ich kann dir nur dringend raten, nicht weiter mit ihm den Hang hinunterzurodeln.«
»Ich bleibe dabei: Was ist, wenn Tom recht hat?«
Morten holte tief Luft, setzte eine besorgte Miene auf und beugte sich vor. »Sita, ich höre immer nur Tom, Tom und noch mal Tom.«
»Was soll das heißen?«
»Sagen wir mal so«, begann Morten. »Wärst du ein Mann, würde ich dir jetzt dringend empfehlen, mit einem anderen Körperteil zu denken.«
Sita nahm wütend die Zeitung vom Tisch. »Du bist ein sexistisches Arschloch.«
»Ach ja? Und warum? Hab ich mich nicht gewählt genug ausgedrückt?«
»Sagen wir mal so«, ahmte Sita Mortens Tonlage nach. »Deine Scheißvorurteile sind jedenfalls nicht weniger scheiße, nur weil du rhetorische Schleifchen drumbindest.«
Mortens Miene wurde zu Eis. »Wir sehen uns morgen um halb neun. Lagebesprechung.«
Sita schnaubte verächtlich, stand auf und verließ ohne ein weiteres Wort sein Büro.
»Und lass dir bloß nicht einfallen, Urlaub einzureichen«, rief Morten ihr nach.
Am nächsten Morgen meldete Sita sich krank, verschaffte sich ein Attest und reichte es per Mail bei Mortens Assistentin ein.
Sita schreckt aus ihren Gedanken auf. Ein weißer Lieferwagen kommt ihr in halsbrecherischem Tempo entgegen, und die Straße ist so schmal, dass sie bis an den äußersten rechten Rand ausweichen muss. Die Leitplanke ist alt und brüchig, dahinter geht es steil bergab. Links von ihr brettert der Lieferwagen haarscharf an ihr vorbei und touchiert dabei ihren Außenspiegel. Erschrocken tritt sie auf die Bremse. Kaffee schwappt aus dem Becher auf ihre Hose, die Zeitung rutscht vom Sitz. Das rechte Vorderrad gerät auf den Schotterstreifen am Abgrund, und sie lenkt hastig zur Straßenmitte, wo der Saab zum Stehen kommt.
Ihr Herz schlägt rasend schnell. Im Rückspiegel sieht sie das Heck des Lieferwagens hinter der nächsten Biegung verschwinden. Ihr rechtes Hosenbein ist nass vom Kaffee. Sie atmet einmal tief durch und trinkt den im Becher verbliebenen Kaffee.
Wer zum Teufel fährt auf so einer Straße derart schnell?
Sie gibt vorsichtig Gas und nimmt die Fahrt wieder auf. Immerhin, jetzt ist sie wenigstens wach. Die acht Stunden am Steuer von Berlin bis hierher haben sie müde gemacht – und sie darf nicht müde sein, wenn sie die Höhle des Löwen betritt. Obwohl Sita sich im Grunde ihres Herzens weigert, jemanden wie Bruckmann als Löwen zu bezeichnen.
Löwen jagen, um zu überleben.
Dr. Walter Bruckmann hatte gejagt, um seine psychopathologischen sadistischen Triebe zu befriedigen. Über drei Jahrzehnte lang hatte er Verbrechen verübt, immer unter dem Deckmantel seiner Positionen. Vor 89 im Auftrag der Stasi unter dem Namen Benno Kreisler. Viele Jahre nach der Wende dann als Leiter des Berliner LKA 1 für Delikte am Menschen, mit einer großbürgerlichen Fassade als Familienvater von drei Kindern. Bruckmann ist kein wildes Tier, er ist ein hochintelligenter Narzisst, und darüber hinaus ist er ein gedemütigter Narzisst; er ist verletzt, getrennt von seiner Familie und eingesperrt, was ihn, wie Tom sagte, nur noch gefährlicher macht. Doch auf Tom hat niemand hören wollen.
Die Straße wird jetzt noch steiler, und Sita schaltet einen Gang zurück. Die Sonne steht tief und streift den Kamm des Gebirges. Die letzten Strahlen flirren zwischen den Bäumen. Nach einer weiteren Serpentine verläuft die Straße im Schatten. Es ist Ende September, früher Abend, und das Wetter ist freundlich. Bei Schneefall und Temperaturen unter null ist die lange schmale Straße am Hang sicher kein Vergnügen.
Sita fragt sich, warum Bruckmann seit fast neun Monaten ausgerechnet hier eingesperrt ist, siebenhundertdreißig Kilometer von Berlin entfernt, mitten in der Einöde, in den nördlichen Kalkalpen, an der Grenze zu Österreich. Er hätte eigentlich nach Moabit in die JVA gehört.
Eine letzte Biegung, dann erreicht sie das Hochplateau. Burg Tauenstein, steht auf einem braunen, verwitterten Schild. Forensische Klinik und Psychiatrie. Sita hält vor einem hohen grünen Gittertor. Links und rechts verliert sich ein Zaun mit einer Krone aus NATO-Stacheldraht zwischen haushohen Tannen. Vom Torpfosten aus wird sie durch eine Kamera beobachtet.
Sie klingelt, nennt ihren Namen und erklärt, dass sie einen Termin mit Professor Dr. Forsberg vereinbart hat. Nach einer Weile fährt das Tor beiseite; auf seiner Spitze rotiert eine gelbe Warnlampe. Aus einem kleinen Häuschen in der Einfahrt nickt ihr ein Mann in dunkelgrüner Kleidung zu. Er trägt eine Schirmmütze, hat sich von seinem Stuhl erhoben und mustert ihren Saab, während sie an ihm vorbeifährt. An seiner Hüfte trägt er eine Schusswaffe im Holster und einen Schlagstock. Als sie im Rückspiegel sieht, wie sich das Tor hinter ihr wieder schließt, beschleicht sie ein mulmiges Gefühl.
Bevor Sita aus dem Wagen steigt, fischt sie die Zeitung aus dem Fußraum der Beifahrerseite und reißt den oberen Teil der ersten Seite mit Schlagzeile und Titelstory ab, faltet das Papier zusammen und steckt es in den Bund ihrer schwarzen Jeans. Sie überlegt, ob sie Tom noch einmal anrufen soll, entscheidet sich aber dagegen. Dann holt sie ihre Reisetasche aus dem Kofferraum und atmet tief durch. Gegenüber Tom hat sie sich wegen der bevorstehenden Begegnung mit Bruckmann unerschrocken gezeigt, doch jetzt sitzt ihr die Anspannung von Minute zu Minute mehr im Nacken.
Die Burg Tauenstein ragt finster wie ein aus dem Fels gewachsener Bunker mit zwei Türmen und einem verschachtelten roten Ziegeldach in den Himmel. Allein das Fundament ist drei Stockwerke hoch und wächst konisch aus dem Berg. Kleine vergitterte Fenster, kaum breiter als Schießscharten, lassen die ehemalige Wehranlage erkennen. Der obere Teil der Festung ist wie ein hellgrauer freudloser Aufsatz. Hier sind die Fenster zahlreicher und größer. Die Türme und das rote verwinkelte Dach wirken fremd auf dem kargen Gebäude, als hätte der Bauherr zum Schluss dem düsteren Gemäuer etwas Freundliches mitgeben wollen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: