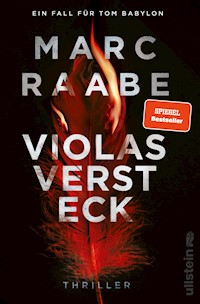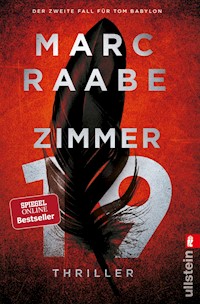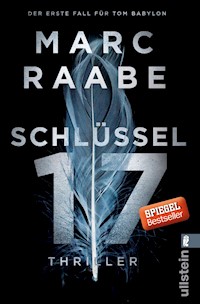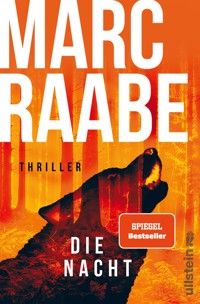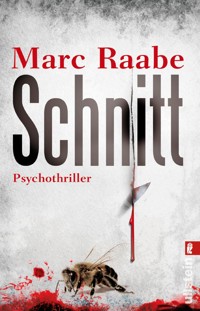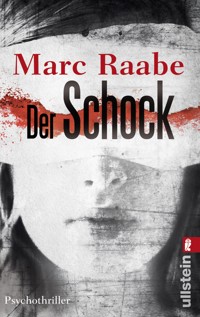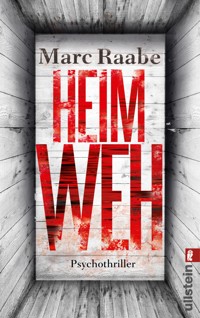
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Thriller-Bestseller von Marc Raabe! Sie gehört Dir nicht. Du musst sie vergessen. Jesse Berg ist ein erfolgreicher Kinderarzt. Frisch geschieden, kümmert er sich liebevoll um seine kleine Tochter Isa. Über seine Vergangenheit spricht er nicht. Bis plötzlich seine Exfrau ermordet und seine Tochter entführt wird. Der Täter hinterlässt für Berg eine Nachricht: Sie gehört dir nicht. Du musst sie vergessen. Berg ist klar, dass er selbst das Ziel des Anschlags ist. Eine langvergessene Schuld drängt ans Licht. Um Isa zu finden, muss er das tun, was er nie wollte: zurück in seine Vergangenheit. Zurück ins Heim. Dort hat er gelernt, sich zu wehren, und dort wäre er beinahe getötet worden. Berg nimmt die Kampfansage an. Denn für Isa würde er alles tun. Auch ein zweites Mal durch die Hölle gehen. »Süchtig machendes Kopfkino.« Kölner-Stadt-Anzeiger *** Für Fans von Freida McFadden und Sebastian Fitzek ein Muss. Bestseller-Autor Marc Raabe garantiert schlaflose Nächte! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Jesse Berg ist ein erfolgreicher Kinderarzt. Frisch geschieden, kümmert er sich liebevoll um seine kleine Tochter Isa. Über seine Vergangenheit spricht er nicht. Bis plötzlich seine Exfrau ermordet und seine Tochter entführt wird. Der Täter hinterlässt für Berg eine Nachricht: Sie gehört dir nicht. Du musst sie vergessen. Berg ist klar, dass er selbst das Ziel des Anschlags ist. Eine langvergessene Schuld drängt ans Licht. Um Isa zu finden, muss er das tun, was er nie wollte: zurück in seine Vergangenheit. Zurück ins Heim. Dort hat er gelernt, sich zu wehren, und dort wäre er beinahe getötet worden. Berg nimmt die Kampfansage an. Denn für Isa würde er alles tun. Auch ein zweites Mal durch die Hölle gehen.
Der Autor
Marc Raabe, 1968 geboren, ist Geschäftsführer und Gesellschafter einer Fernsehproduktion. Seine beiden Romane »Schnitt« und »Schock« waren viele Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Marc Raabe ist mit einer Psychologin verheiratet und lebt mit seiner Familie in Köln.
www.marcraabe.de
www.facebook.com/marcraabe.autor
Marc Raabe
HEIMWEH
Psychothriller
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1112-8
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015Umschlaggestaltung: Büro für Gestaltung – Cornelia Niere, MünchenTitelabbildung: Artwork Cornelia Niereunter Verwendung eines Bildes von Mika Shysh/shutterstock
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Für meine Raaben
Ich ist ein anderer.
Arthur Rimbaud
Prolog
September 1981
Noch war reichlich Luft zum Atmen da.
»Der schwarze Jaguar« lag aufgeschlagen neben seinem Bett, darüber ein abgegriffenes Batman-Heft. Was man mit dreizehn eben so las. Das Licht war längst aus. Im Schlaf hob und senkte sich die Bettdecke wie eine sanfte Dünung.
Die Luft zum Atmen blieb ihm von einer Sekunde auf die andere weg.
Im letzten Augenblick, bevor er wach wurde, träumte er zu ertrinken. Es war ein Traum, den er oft hatte.
Als kleines Kind war er in der Dämmerung am Rand des nahen Sees in das noch dünne Eis eingebrochen. Puderweißer Neuschnee hatte alles bedeckt, unschuldig und trügerisch. Die Berge standen scharf und klar vor einem leergefegten Himmel. Das Eis brach plötzlich. Schwarzes Wasser umschloss ihn wie eine Faust, schlug über seinem Kopf zusammen. Seine dicke Jacke sog sich voll und wurde schwer wie eine Weste aus Blei. Starr vor Schock war er dem nahen finsteren Grund entgegengesunken.
Gerettet hatte ihn damals seine Mutter, buchstäblich in letzter Sekunde, doch in manchen Träumen wurde aus ihrer Hand eine kräftige Männerhand, mit einer sichelförmigen Narbe auf dem Handrücken, die ihn packte wie ein kleines Kätzchen.
Seitdem mied er Wasser, sofern es tiefer war als bis zur Hüfte.
Aber hier in seinem Zimmer war kein Wasser.
Er lag in seinem Bett.
Jemand drückte ihm ein Kissen ins Gesicht.
Verzweifelt rang er um Luft, bekam jedoch nur den Baumwollstoff in den Mund. Der Holm einer Feder bohrte sich durch die Kissenfüllung und stach ihm in die Lippe, seine Nase wurde eingedrückt, und sein Körper schrie nach Sauerstoff. In heller Panik versuchte er, sich unter dem Kissen herauszuwinden, ruderte wild mit den Armen und spürte, wie sich jemand rittlings mit seinem ganzen Gewicht auf ihn setzte. Seine Lungen schienen zu platzen, er ballte die Fäuste und schlug um sich.
Jäh ließ der Druck nach.
Er riss sich das Kissen vom Gesicht. Schnappte nach Luft, dass die Lungen brannten. Im fahlen Mondlicht erkannte er kaum mehr als einen Schattenriss vor der kalt schimmernden Tapete: Eine Gestalt mit einem insektenartigen, unförmigen Kopf, die auf ihm saß und sich krümmte. Vor Schreck vergaß er für einen Moment, sich zu wehren. Die Gestalt richtete sich auf, atmete zischend. Ein Schatten wie aus Batmans Gotham City. Ihr Kopf war seltsam glatt und anstelle von Augen starrten ihn zwei faustgroße runde Glasscheiben an, in denen sich sein eigenes bleiches Gesicht spiegelte. Da wo Mund und Nase hätten sein müssen, ragte ein schwarzes Oval heraus.
Er wollte schreien, doch die Gestalt kam ihm zuvor. Von links hieb ihm eine Faust gegen die Schläfe. Helle Sterne flirrten, dann kam ein zweiter Schlag. Sein Bewusstsein verlosch mit einem Funken, als wäre eine Sicherung herausgesprungen.
Eine Weile war nichts.
Schwarzfilm.
Er wachte auf, weil der Boden bebte. Nein, zitterte. Er lag gekrümmt wie ein Embryo. Sein Kopf dröhnte und seine Rippen schmerzten. Hin und wieder gab es ein, zwei harte Erschütterungen. Er versuchte, Hände und Füße zu bewegen, aber ohne Erfolg, sie waren gefesselt. Über ihm war eine Plane gespannt, und wenn er versuchte, sich zu strecken, stieß er gegen Begrenzungen. Er jetzt merkte er, dass er fror; er war nackt bis auf die Unterhose. Fahrtwind zog durch die Ritzen, und es roch nach Auspuffgasen – dem Motorgeräusch nach von einem Mofa, hoch und sirrend wie eine Kreissäge.
Er kniff die Augen zu, flüchtete sich kurz in die Phantasie, das alles sei nur ein Alptraum.
Eben noch hatte er doch friedlich in seinem Bett geschlafen!
»Wach auf, bitte wach auf«, flehte er leise.
Seine eigene Stimme holte ihn zurück in die Realität.
Es war kein Traum.
Es gab kein Aufwachen.
Seine Kehle wurde eng. Er atmete gegen die Furcht an. Er war dreizehn! Da ergab man sich nicht einfach. Damals, unter dem Eis, da hatte er aufgegeben, ja.
Aber das würde ihm nie wieder passieren.
Obwohl seine Handgelenke vor dem Bauch verschnürt waren, tastete er, so gut es ging, an den Planken um sich entlang. Offenbar lag er in einem niedrigen Anhänger. Die Plane über ihm war straff, vermutlich hatte sie Ösen und war außen mit einem Seil festgezurrt. Aus der Planke vor ihm ragte ein Haken, vielleicht um Ladung anzugurten.
Er sah nach dem Knoten zwischen seinen Handgelenken, konnte aber in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Doch wenn er die Hände gegeneinander verdrehte, spürte er den Knubbel, dick und wulstig, wie mehrere Knoten übereinander. Früher, erinnerte er sich, hatte er seine Schuhe mit einem Doppelknoten geschnürt und, wenn er ihn am Abend nicht mehr aufbekam, den Knoten mit einer Gabel aufgestochen.
Er hob die Hände zum Haken und drückte den Knoten in das spitze Ende. Vorsichtig rüttelte er mit den Händen, löste den Knoten wieder vom Haken und drückte ihn erneut hinein. Er begann zu schwitzen, trotz der Zugluft bedeckte ein feuchter Film seine Haut. Der Knoten lockerte sich mehr und mehr.
Plötzlich begann der Anhänger zu holpern, wie auf einem Feldweg mit Buckeln und Schlaglöchern. Die Ladefläche stieß hart gegen seinen Körper. Aus dem Sirren der Kreissäge wurde ein dunkleres Knattern, das schließlich ganz verstummte.
Ein Ständer klappte herunter.
Es roch nach feuchter Erde, Harz und Tannen.
Das Seil schnurrte aus den Ösen der Plane, dann wurde die Abdeckung beiseitegeworfen. Bäume zeichneten sich vor einem zerrissenen Himmel ab. Der Insektenkopf beugte sich über ihn.
»Raus da.« Die Stimme klang seltsam hohl und blechern. Und sie war jung, ein Teenager wie er. Ein Junge.
»Ich kann nicht«, antwortete er und deutete mit dem Kinn auf seine zusammengebundenen Füße.
Wortlos löste der Junge die Fußfesseln, band jedoch seine Beine so, dass er zwar laufen können würde, aber nur mit kleinen Schritten. Dann trat er zurück und sah ihm dabei zu, wie er sich aus dem Anhänger quälte und dabei stürzt. Keuchend richtete er sich auf.
Der Mond trat für einen Augenblick zwischen den Wolkenfetzen hervor. Unvollständig, aber scharf geschnitten. Der Junge hielt ein Messer in der Faust, die Klinge schimmerte im Mondlicht.
»Da lang«, sagte der Junge.
»Was … was hast du mit mir vor?«
»Sie!«
»Was?«
»Du musst ›Sie‹ sagen.«
Er schluckte. »Was haben Sie mit mir vor?«
»Halt den Mund und geh.«
Er stieß ihn vor sich her. Laub raschelte unter seinen nack-ten Füßen; Steinchen und harte Zweige stachen in seine Sohlen. Der Atem des Jungen zischte leise durch die Maske. Es gab keinen Weg, nur einen kurzen Zickzackkurs zwischen den Bäumen. In der Ferne meinte er, einen Wasserfall rauschen zu hören. Er verdrehte die Hände, kehrte die Fingerspitzen nach innen und zerrte an dem Knoten. Nur noch ein kleines Stück, dann würde sich das Seil lösen. Sein Herz schlug wild. Wenn nur das Messer nicht gewesen wäre!
Dann sah er die Grube. Sie war plötzlich direkt vor ihm, ein gähnendes schwarzes Loch im Waldboden, rechteckig wie ein Grab.
Er blieb wie angewurzelt stehen.
»Rein da«, sagte der Junge.
»Sie wollen mich umbringen.«
»Für mich bist du schon lange tot.«
»Wie meinst … wie meinen Sie das?«
Der Junge hinter ihm schwieg.
Verzweifelt ruckte er mit den Armen. Die Fesseln schnitten ihm ins Fleisch, und der Knoten zog sich wieder zu. Das konnte doch nicht wahr sein! Aber saß das Seil nicht trotzdem lockerer? »Bitte … lassen Sie mich gehen«, flüsterte er.
»Nein«, sagte der Junge schroff.
Für einen letzten Versuch machte er seine rechte Hand ganz dünn, zerrte sie mit Gewalt durch die Schlinge. Es brannte wie Feuer, als ihm das Seil die Haut abrieb. Dann war seine Hand plötzlich frei. Er wirbelte herum, mit geballter Faust, und traf den anderen in den Bauch. Keuchend taumelte der Junge rückwärts, das Messer fiel zu Boden. Hastig bückte er sich, hob es auf. Der Griff war heiß von der Hand des anderen. Oder war das seine eigene Hand, die so brannte?
»Bleib wo du bist«, zischte er.
Der Junge stand gebückt am Stamm des nächsten Baumes, keine drei Schritte entfernt, die Insektenaugen lauernd auf ihn gerichtet.
Er bückte sich, schnitt mit zitternden Fingern das Seil zwischen seinen Füßen durch.
In diesem Moment stürzte sich der Junge auf ihn. Sie gingen beide zu Boden und rangen um das Messer. Der Mond beleuchtete ihre Hände – und plötzlich erstarrte er. Diese Hände, die kannte er! Das waren doch –
Im nächsten Augenblick entwand ihm der Junge das Messer. Instinktiv drehte er sich weg, wollte aufspringen, davonlaufen, da traf ihn ein heißer, überwältigender Schmerz im Rücken. Er schrie. Alle Kraft wich aus seinem Körper. Bäuchlings fiel er auf die Erde, direkt neben der Grube. Er spürte einen Stiefel an seinem Becken, wurde beiseitegeschoben wie ein nutzloser Sack. Wehrlos rollte er über die Kante der Grube und fiel hinunter. Sein Kopf schlug hart auf einen Stein. Regungslos blieb er liegen.
Eine Weile war es still. Es kam ihm vor, als wäre er taub, eingesperrt, getrennt von seinem Körper, in dem der Schmerz wütete. Die Bäume über ihm waren Wolken aus schwarzen Blättern. Eine Stimme schien vom Himmel direkt in seinen Kopf zu flüstern.
»Ma?«, wisperte er.
Doch sie gab keine Antwort.
»Maaa!«
Verschwommen sah er die Gestalt am Rand der Grube auftauchen. Ein riesiges schwarzes Insekt mit einer Schaufel in der Hand. Schon prasselte die erste Schippe Erde auf sein Gesicht, begrub den Himmel und das letzte Stück Hoffnung.
32 Jahre später
Kapitel 1
Berlin – Samstag, 5. Januar 2013, 03:18 Uhr
Jesse fuhr aus dem Traum empor und saß kerzengerade in seinem Bett.
Dunkelheit umgab ihn. Er schwitzte.
Es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass er kein Junge mehr war, sondern fünfundvierzig Jahre alt. Noch immer meinte er die Erde zu schmecken. Gott, es war wieder so verdammt nah, so real gewesen. Die alte Narbe auf seinem Rücken juckte, als hätte jemand daran gekratzt. Nur der Schrei, den er gehört hatte, passte nicht in seinen Traum. Es war der Schrei eines Mädchens gewesen.
Mit einem unguten Gefühl warf er die Decke beiseite, stellte die Füße auf den Boden und stand auf.
Kaltes Laminat. Frische Luft an seiner feuchten Stirn. Der Boden war trocken, fest und hell. Immer und immer wieder hatte er diesen Traum. Er begann damit, dass der Insektenmann Erde auf ihn schaufelte, und er endete, kurz bevor er in seinem Grab erstickte. Mehr nicht. Es gab kein Wo und Wann, nichts davor und nichts danach. Nur eine Variante, einen Traum, in dem er in einem eisigen See ertrank.
Der Schrei des Mädchens ließ ihm keine Ruhe.
Er drückte die Klinke seiner Schlafzimmertür herunter, eilte durch den Flur, vorbei an den letzten Umzugskartons, die er immer noch nicht ausgepackt hatte, und stolperte über seine Arzttasche, die stets gepackt bei der Garderobe stand. Fluchend schob er sie mit dem Fuß beiseite. Auf dem Boden sah er den farbigen Lichtschein, der durch den Türspalt fiel. Mit drei langen Schritten war er beim Kinderzimmer.
»Isa?«, flüsterte er.
Sie saß kerzengerade aufgerichtet im Bett, den Blick starr geradeaus auf das gegenüberliegende Fenster gerichtet, die blonden Haare wild verstrubbelt.
»Isa!«
»Pssst«, flüsterte sie, ohne sich zu rühren. »Papa, da ist jemand.«
Jesse sah zum Fenster hinüber. »Da drüben?«
»Wo denn sonst«, flüsterte Isabelle, mit so viel Empörung in ihrer Stimme, wie sie nur konnte. Erwachsene waren manchmal schrecklich begriffsstutzig.
Jesse seufzte leise und ging zum Fenster. »Wie sah er denn aus?«
»Er hatte eine dunkle Mähne und wilde Augen.«
»Wilde Augen?«
Isa nickte. »Er hat mich angesehen.«
Jesse öffnete das Fenster. Frische Luft drang ihm entgegen. Er lehnte sich über das Fensterbrett nach draußen und sah die Straße nach links und rechts hinunter. »Kein Monster weit und breit. Magst du herkommen und selbst nachschauen?«
Isa schüttelte den Kopf. Ihre blonden Haare flogen hin und her. »Das war kein Monster.«
Jesse lächelte. »Was war es denn?«
»Weiß nicht. So was Ähnliches wie ein Monster«, flüsterte sie.
Jesse nickte, verschloss sorgfältig das Fenster, ging zu ihr hinüber und setzte sich auf die Bettkante.
Isabelle rutschte etwas beiseite und gab ein Stück des verknitterten Lakens frei. Jesse schmunzelte, hob die Beine ins Bett und legte sich neben seine achtjährige Tochter.
Wortlos rollte Isa sich ein, drückte ihren Kopf in seine Achselhöhle und atmete seufzend ein und aus, als hätte sie eine Weile nicht Luft holen dürfen. Jesse spürte ihren jagenden Herzschlag unter den dünnen Rippen.
»Papa?«
»Hmm.«
»Nicht gehen, wenn ich einschlafe, ja?«
»Hmm«, brummte Jesse müde. Das warme Bett und die Gegenwart seiner Tochter ließen auch den Nachhall seines eigenen Alptraums verklingen. Seit er denken konnte, jagte ihn dieser Traum vor sich her, und er hasste es, aufzuwachen und sich vergewissern zu müssen, dass er weder ertrank noch unter einer Schicht aus Erde begraben lag. Mitunter, wenn der Traum länger war und anders begann, konnte er sich selbst beobachten, als würde er neben sich stehen und sein Spiegelbild betrachten: einen kleinen Jungen, der am Ufer eines gefrorenen Sees spielte. Manchmal sprachen sie sogar miteinander. Von Jesse zu Jesse.
Was davon eine echte Erinnerung war und was Hirngespinst, das wusste er nicht. Seit seinem Unfall im Alter von dreizehn Jahren war seine Erinnerung abgeschnitten. In seinem Leben gab es, in Bezug auf den Unfall, ein Davor und ein Danach. Das Davor war in Dunkelheit gehüllt, bis auf die Dinge, die ihm die anderen im Heim erzählt hatten. Nach und nach hatte er sich Teile seines Lebens notdürftig aus Versatzstücken rekonstruiert, soweit es eben möglich war. Sein Vater sei Kapitän gewesen, hatten sie ihm erzählt. Von seiner Mutter dagegen wusste niemand etwas. Und längst nicht alles, was er über sich erzählt bekam, gefiel ihm. Manches beschämte ihn sogar.
Für einen Moment fragte er sich, wer hier eigentlich wen brauchte. Isa ihn – oder er Isa? Ihre Haarspitzen kitzelten an seiner Wange und rochen nach Tannennadeln und feuchter Erde, eben nach allem, was der Tagesausflug hergegeben hatte. Nur gut, dass Sandra jetzt nicht hier war. Wenn es nach Isas Mutter ging, hatten Kinderhaare nach Shampoo und nicht nach Wald zu riechen. Wald war für Sandra seit ihrer gemeinsamen Jugend im Heim Adlershof ein Synonym für Gefängnis. Städte dagegen bedeuteten für sie Freiheit. Für Jesse war es genau andersherum.
»Hast du eigentlich die Zähne geputzt?«
Isa gab keine Antwort. Sie atmete verdächtig gleichmäßig, so wie sie es immer tat, wenn sie sich schlafend stellte.
»He«, raunte er ihr ins Ohr und kitzelte sie behutsam an der Hüfte. Seine Tochter kicherte und wand sich. »Ich mach ja viel mit, junge Dame, aber das läuft nicht. Ab ins Bad. Zähne putzen.«
»Och Papa! Ich bin soo müde.«
»Klar. Ich auch«, gähnte Jesse.
»Ich kann die Zähne auch morgen putzen.«
»Oder nächste Woche, hm?«
»Da bin ich bei Mama. Da muss ich sowieso immer tausendmal putzen.«
»Dann kommst du ja bei mir mit dreimal ganz gut weg. Also los jetzt!«
Wütend warf Isa die Decke zurück und kletterte über Jesse aus dem Bett, nicht ohne ihm einen kräftigen Knuff zu verpassen. Rasch wich er aus, um die alte Narbe auf seinem Rücken zu schützen, so dass Isa ihn zwischen die Rippen traf. »Au!« Jesse grinste. »Soll ich mitkommen?«
»Nö«, stieß Isa hervor. Trotzig patschten ihre nackten Füße auf dem Boden Richtung Bad. Einen Moment später flog die Badezimmertür krachend zu.
Jesse seufzte schläfrig. Sein Blick glitt über die Wände des Kinderzimmers, des bisher einzigen Zimmers in der Wohnung, das er fertig eingerichtet hatte. Die kleine Lampe mit rotierendem Schirm warf bunte leuchtende Fische auf die Tapete, die langsam durch den Raum schwebten. Er hatte sie Isa vor sechs Monaten geschenkt, kurz nach der Trennung von Sandra, als sie zum ersten Mal bei ihm in seiner neuen Wohnung übernachtet hatte. Einmal hatte Isa ihn mitten in der Nacht geweckt. Die Fische wären tot. Er hatte ihnen wieder Leben eingehaucht, indem er die Glühbirne wechselte.
Jesse fielen die Augen zu.
Als er sie wieder aufschlug, war ihm kühl. Das Bett neben ihm war leer. Die Wohnung still.
»Isa?«
Keine Antwort.
Er schwang die Beine aus dem Bett und fröstelte. Mit raschen Schritten ging er zum Badezimmer. Kein Lichtstreifen unter der Tür. Kein Geräusch.
Als er die Tür öffnete, strich ihm kalte Luft entgegen. Das Bad war dunkel und leer, nur die Hofbeleuchtung warf einen fahlen Lichtschimmer durch das Milchglasfenster. Er strich mit dem Daumen über Isas Zahnbürste. Trocken.
Ein leises Schlagen, wie von Holz auf Holz, ließ ihn herumfahren. Das Fenster klapperte im Rahmen, der Hebelgriff stand quer. Hatte er das Fenster offen gelassen? Isa doch wohl kaum, besonders nach der Sache mit dem Monster – oder was auch immer sie zu sehen gemeint hatte.
Jesse versuchte ruhig zu bleiben, zog das Fenster auf und sah hinaus. Die Nacht war klar und wolkenlos, der Hof grau und verlassen. »Isa?«
Stille.
Warum, verdammt, war das Fenster offen? Ein eisernes Band schien seine Brust einzuschnüren. Jesse drehte sich um, eilte in den Flur, riss die Tür zum Wohnzimmer auf, drückte den Lichtschalter und blinzelte.
Keine Isa.
Er versuchte die Panik zu unterdrücken, doch sein Herz hämmerte.
Weiter zur Küche. Tür auf, Licht an.
Er blieb im Türrahmen stehen und stieß die Luft aus. Die Spannung wich mit einem Seufzer aus seinem Körper, und ihm wurde schwindelig vor Erleichterung.
Da war sie.
Auf dem Boden neben dem Tisch, mit dem Rücken an den Heizkörper gelehnt, das Kinn auf die Brust gesunken. Ihre Mundwinkel waren braun verschmiert. Neben Isa auf dem Fußboden stand ein offenes, restentleertes Nutella-Glas, aus dem ein Löffel ragte. Ihr kleiner Brustkorb hob und senkte sich friedlich im Rhythmus ihres Atems.
Jesse setzte sich behutsam ganz dicht neben sie an die warme Heizung. Ihr schmaler Schulterknochen lag spitz an seinem Oberarm. In der Glasscheibe der Küchentür spiegelten sich ihre Gestalten wie miteinander verwachsen. Er selbst mit seinen raspelkurzen blonden Haaren, inzwischen mit leichten Geheimratsecken, braunen Augen, schwarzem T-Shirt und nackten Beinen, und Isa, die Haare ebenso blond wie er, mit dem gleichen charakteristischen Wirbel wie er. Einmal mehr fragte sich Jesse, womit er sie verdient hatte. Dass Sandra ihm vieles nicht verzieh, allem voran seine Abwesenheit, das In-sich-gefangen-Sein, seine Unruhe und seine einsamen Entscheidungen, das war eins. Doch er hatte immer befürchtet, dass es Isa genauso ging. Dass sie Sandras Sicht übernehmen würde. Von all seinen Ängsten, die er mit sich herumschleppte, war das inzwischen seine größte: Vielleicht hatte er sie wirklich nicht verdient.
Jesse seufzte.
So sehr er Großstädte hasste, für Isa wäre er sogar nach New York gezogen. So gesehen war Sandras Entscheidung, nach der Trennung nach Berlin zu gehen, wohl nur die zweitschlimmste Wahl.
Kapitel 2
Garmisch-Partenkirchen – Samstag, 5. Januar 2013, 16:21 Uhr
Zornig pfiff der Wind um den Westflügel. Als stemmte er sich gegen die hässlichen Geschichten, die sich hinter diesen Mauern abgespielt haben, dachte Artur Messner. Ja, er hasste dieses Gemäuer. Und ja, er brauchte es. Würde ihn jemand nach seiner Definition von Heimat fragen, er würde mit diesen beiden Sätzen antworten. Aber ihn fragte ja niemand mehr.
Irgendwann würden sie ihn hier raustragen müssen, in seinem samtroten Ohrensessel. Im Sitzen ruckelte und drehte er das schwere Möbel noch etwas näher ans Gaubenfenster und blickte hinaus, nur um ja nicht nach links hinter sich ins dämmrige Zimmer sehen zu müssen. Nicht etwa, weil er die Einrichtung scheußlich fand. Auf seine alten Tage arrangierte man sich. Ein zerschlissener Orientteppich, wellige Tapete, eine improvisierte Küchenzeile aus den Siebzigern und auf dem Kühlschrank ein zu kleiner Fernseher.
Nein, es lag an dem Paket, das auf seinem Esstisch lag. Das Paket wollte er nicht sehen. Am liebsten hätte er es aus dem Fenster geworfen.
Ein Kranz aus Frostblumen rahmte den Blick über die wogenden Baumwipfel bis zum gefrorenen Rissersee. Gedämpfte Rufe schallten in regelmäßigen Abständen herauf und durch die langen Flure des Gebäudes. Charly war bereits zum dritten Mal ausgerissen, und sie suchten immer noch fieberhaft nach ihr. Früher oder später würden sie die Polizei informieren müssen, und Artur wusste nur zu gut, wie unangenehm das jedes Mal war.
Artur Messner war vierundsiebzig, und er bereute vieles in seinem Leben, unter anderem seine Ehe. Sechs Jahre nach der Hochzeit hatte seine Frau Hannelore beim traditionellen Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch eine Affäre mit einem kanadischen Skispringer gehabt. Nicht die erste Affäre. Hannelore war nicht zurechtgekommen mit dem, wie sie sagte, ›schwermütigen Leben‹, das Artur ihr bot. Zwei Monate später war sie Hals über Kopf nach Kanada gereist und nicht zurückgekehrt. Ihren gemeinsamen Sohn hatte sie bei Artur gelassen, mit den Worten, Richard sei ohnehin wie er.
Doch nichts schmerzte Artur mehr, als dass er vor sieben Jahren die Internats- und Heimleitung von Adlershof an seinen Sohn Richard übertragen hatte. Wenn nur das verfluchte Rheuma nicht gewesen wäre. Die fast dreißig Jahre mit Schmerzen und hochdosiertem Kortison forderten ihren Tribut; sein Körper war abgeschliffen und mürbe.
Und jetzt lag da dieses Paket.
Gott! Selbst ohne sich umzudrehen hatte er es vor Augen, wie es auf dem Tisch thronte, ihn anstarrte. Seine lieblose Ehe, sein bitteres Ende als Direktor, seine ständigen quälenden Schmerzen, das alles war nichts gegen dieses Paket.
Er schaute stur zum See. Die hinter den Gipfeln des Wettersteingebirges verschwindende Sonne warf einen wachsenden kalten Schatten. Der Schnee färbte sich blau, alles andere schwarz. Artur fragte sich, warum er das Paket nicht einfach wegwarf, oder es vergrub, irgendwo da unten am Hang, so weit ihn seine alten Füße trugen. Doch wie sollte er es vergraben, wenn er noch nicht einmal wagte, es anzufassen? Dieses verdammte Paket machte etwas aus ihm, was er auf keinen Fall sein wollte: ein Feigling.
Es war mittags mit der Post gekommen. Philippa hatte es ihm hochgebracht, mit seinem Essen – sofern man diesen spartanischen Diät-Mist auf dem Teller überhaupt Essen nennen konnte.
Das Paket war in Packpapier gewickelt, glatt, braun und in etwa so groß wie ein halber Schuhkarton. Philippa hatte gelächelt, als sie es ihm auf den Tisch in der Zimmermitte gelegt hatte, auf ihre schmallippige Art, als wollte sie eine Freundlichkeit ausdrücken, die ihr im Laufe ihrer neununddreißig Lebensjahre eigentlich abhandengekommen war. Obwohl Artur Philippa nicht besonders mochte, war ihre Einstellung eine der wenigen Entscheidungen seines Sohnes, die er nachvollziehen konnte. Gutes Personal für ein Heim zu finden, war schwierig genug. Gutes Personal, das nicht zerbrach, noch schwieriger.
Als Philippa das Zimmer verließ, hatte er die Wahl: zuerst das Paket oder zuerst das Essen. Wäre es nach der Neugierde gegangen, hätte er sich für das Paket entschieden. Pakete kamen selten für ihn. Dennoch entschied er sich zunächst für das Essen.
Später, beim Öffnen des Pakets, zitterten seine Finger regelrecht. Er schob es auf den Tremor, wollte sich nicht eingestehen, wie aufgeregt er war. Zum einen vor Freude, zum anderen, weil ihn das Paket irgendwie beunruhigte. Schließlich erwartete er ja keine Post und auch keine Geschenke. Bei den ehemaligen Heim- und Internatskindern war er nicht unbedingt gut gelitten. In einem Anflug von Wehmut dachte er an Weihnachten und die Geburtstage seiner Kindheit. Gott, wie lange war es her, dass ihm jemand etwas geschenkt hatte?
Das Papier raschelte, als er es löste. Es stand kein Absender darauf, nur sein Name, Artur Messner, geschrieben in eckigen Druckbuchstaben, und seine Postadresse. Unter dem Papier kam ein Karton zum Vorschein. Als er den Pappdeckel öffnete, fand er eine weiße Tupperdose darin, unscheinbar und blickdicht. Vielleicht etwas zu essen, dachte Artur.
Mit dem Daumen lupfte er den Deckel und fuhr erschrocken zurück. Was für ein widerwärtiger Gestank! Für einen Moment überlegte er, die Dose einfach in den Müll zu werfen. Doch seine Neugier war stärker.
Also öffnete er den Deckel.
Im Innern lag eine abgetrennte Männerhand, aufgedunsen und blassgrün.
Ihm wurde übel.
Dennoch konnte er den Blick nicht abwenden. Auf dem großen, vom Alter gezeichneten Handrücken war deutlich eine markante sichelförmige Verbrennung zu erkennen. Artur stiegen Tränen in die Augen, er versuchte sie wegzublinzeln, doch die Bilder kamen wie von selbst und kreisten ihn ein. Es mochte ja sein, dass er inzwischen alles Mögliche vergaß, doch was die Vergangenheit betraf, hatte er ein Gedächtnis wie ein Elefant. Die letzte Begegnung mit dem Mann, dem diese Hand gehörte, war keine, an die er sich gerne erinnerte. Er hatte Wilbert eiskalt abgewiesen. Aus Vorsicht, hätte er damals gesagt. Aus Angst, wusste er heute. Wäre Wilbert nur ein Schulkamerad gewesen, hätte er es vielleicht verdrängen können. Aber wenn man nachts zusammen die gesperrte Olympiabobbahn am See hinunterraste und gemeinsam Motorräder stahl, dann war das mehr als Kameradschaft.
Hastig schloss er die Dose.
Wer um Gottes willen tat so etwas? Und warum?
Den Rest des Tages verbrachte er zwischen Erinnern und Grübeln in seinem roten Ohrensessel. Ein Schrillen ließ ihn schließlich hochschrecken. Mit steifen Fingern griff er neben sich und hob den schweren Bakelithörer seines Telefons ans Ohr. Er war froh, das alte Ding noch zu haben. Die neueren Telefone wogen nichts mehr und hatten viel zu kleine Tasten. »Messner«, meldete er sich.
»Artur Messner?« Die Stimme war männlich und klang dumpf, als ob jemand durch ein Taschentuch sprach. Das Alter des Anrufers war schwer zu schätzen. Vielleicht dreißig. Vielleicht auch fünfzig.
»Ja. Wer ist denn da?«
»Haben Sie das Paket bekommen?«
Arturs Hand begann zu zittern. Er presste den Bakelithörer fester ans Ohr. »Wer sind Sie? Haben Sie das Paket geschickt?« Gott! Wie hilflos er klang. Früher einmal Direktor. Jetzt alter Tattergreis! Seine Souveränität zu verlieren war ein schleichender Prozess; sie verloren zu haben eine plötzliche und schmerzhafte Erkenntnis.
»Also haben Sie es bekommen«, stellte der Mann fest. »Und wohl auch geöffnet.«
»Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?«
»Im Moment will ich nur wissen, wo Jesse ist.«
»Jesse?« Und was um Himmels willen sollte dieses im Moment heißen? »Was wollen Sie von Jesse?«
»Sagen Sie mir einfach, wo ich ihn finde.« Irgendetwas an der Stimme des Mannes kam Artur entfernt bekannt vor, aber er konnte es nicht greifen. Seine Tonlage war ruhig und stand in einem irritierenden Kontrast zu dem grausigen Inhalt des Pakets, was die Sache nur noch unwirklicher machte. Der Mann schien es gar nicht für nötig zu halten, ihm zu drohen, und das war ein schlechtes Zeichen, denn so verhielt sich nach Arturs Erfahrung nur jemand, der noch längst nicht am Ende seiner Mittel war. »Ich hab doch keine Ahnung«, meinte Artur. »Ich weiß nicht, wo Jesse ist.« Kruzifix! Früher hatte er wirklich besser gelogen.
»Darf ich das als Einladung verstehen?«
»Ich … äh, Einladung?«
»Zu einem persönlichen Gespräch. Manchmal spricht es sich leichter, wenn man sich dabei in die Augen schaut«, er hielt kurz inne, »und sich die Hand gegeben hat.«
Arturs Magen krampfte sich zusammen. Die Hand gegeben? Hatte er das wirklich gesagt? Artur hatte nie zu den Menschen gehört, die ihre rechte Hand für einen anderen hergeben würden. Auch nicht für Jesse. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, Artur war noch ein kleiner Junge gewesen, hatte er zusehen müssen, wie sein Vater und sein älterer Bruder Werner von einem Sturmbannführer der Waffen-SS erschossen worden waren. Seine Mutter hatte dem SS-Mann schließlich verraten, was er wissen wollte – und damit Arturs und ihr Leben gerettet.
»Ich … äh, bin nicht sicher, ob die Adresse noch stimmt, es ist einige Zeit –«
»Geben Sie mir einfach die Adresse.«
Kapitel 3
Berlin – Montag, 7. Januar 2013, 6:56 Uhr
»Auf geht’s, Prinzessin.« Jesse hielt die Tür des Volvos auf, zauberte – von woher auch immer – ein müdes Lächeln auf seine Lippen und deutete eine Verbeugung an. »Die Königinmutter wartet.«
Isa blinzelte und quittierte seine Bemerkung mit einer Schnute. Was ihre Brummigkeit am frühen Morgen anging, war sie laut Sandra ›ganz der Papa‹. Zudem war dieser Morgen in mehrfacher Hinsicht ein fieser Kaltstart. Es reichte schon, dass Montag war. Erschwerend kamen die Faktoren ›keine Nuss-Nougat-Creme mehr‹, ›Zwischenstopp bei Mama‹ und ›Englischtest‹hinzu. Isas Laune war nahe der Außentemperatur, und die lag bei elf Grad minus. Adrian, ein sibirisches Tiefdruckgebiet, überzog Deutschland mit einer Schneedecke von der Ostsee bis zu den Alpen.
Müde stieg Isa vom Rücksitz, den steifen Kragen ihrer dunkelblauen Marinejacke hochgeschlagen bis zu den Ohren. Einzelne Schneeflocken trudelten vom farblosen Himmel und verfingen sich in ihrem seidigen blonden Haar. Sie hatte darauf bestanden, ihren Rock mit dem roten Schottenkaro anzuziehen. Jesses Hinweis, es sei Winter, hatte sie beantwortet, indem sie eine dunkelblaue Strumpfhose darunterzog, von der sie die Fußspitzen abgeschnitten hatte. Hauptsache, sie konnte mit den Zehen das Lammfell in den Ugg-Stiefeln spüren.
Ihre Schritte knirschten im frischen Schnee, und eine Wolke Colgate-Duft streifte Jesse, als sie an ihm vorbeistapfte. Hatte sie die Zahnpasta etwa gegessen, statt sich die Zähne zu putzen? Er verkniff sich eine entsprechende Bemerkung. In dreißig Minuten begann sein Dienst in der Kinderambulanz des St.-Joseph-Krankenhauses, und er wollte keinen Streit zum Abschied.
Er griff nach Isas Tasche und folgte ihr zur Haustür. Auf dem mit Ziegeln gemauerten Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses thronten fünf Etagen aus grau angelaufenem Stein, mit Altbaufenstern und eleganten Schmuckelementen. Das schwarze viktorianische Gitter vor der Eingangstür aus Eiche versprühte den Charme eines Londoner Upper-class-Viertels, auch wenn Berlin-Wilmersdorf beileibe nicht mit Chelsea oder Mayfair mithalten konnte. Dennoch hatte Leon Stein, Sandras neuer Freund, wohl genau das im Sinn gehabt, als er die Wohnung in der Hildegardstraße gemietet hatte. Leon war einige Jahre Choreograph im Londoner West End gewesen, besaß die athletisch-blasierte Mimik einer Tanzdiva, ein nahezu aufgebrauchtes Vermögen – und er war fast nie da.
Isa hatte bereits geklingelt und stand in der offenen Tür des Mehrfamilienhauses.
Im dritten Stock wartete Sandra, ihre blonden Haare zum Pferdeschwanz gebunden, das feine, etwas spitze Gesicht erhitzt von ihren ersten morgendlichen Tanz- und Dehnübungen. Ihre früher strahlend blauen Augen wirkten angestrengt und wie immer etwas traurig. Ein Blick, den Jesse von den meisten Heimkindern kannte. Auch von sich selbst.
Isa umarmte Jesse zum Abschied mit aller Kraft, die in ihren Armen steckte. »Tschüs, Blaumann«, murmelte sie. Er lächelte. Wie so oft trug er, bis auf seine Boots, Blau. Die winterfeste Jacke mit Kapuze und Fellkragen war dunkelblau, Schal und Jeans etwas heller. Zum ersten Mal hatte Isa seine Vorliebe für Blau mit vier festgestellt. Seitdem hieß er bei jeder Begrüßung und bei jedem Abschied Blaumann.
Mit einem leisen »Morgen, Mum« huschte Isa in die Wohnung, stellte ihre schmuddeligen Uggs demonstrativ ordentlich unter die Garderobe und flitzte über das geweißte Parkett in ihr Zimmer.
»Morgen, junge Dame.« Sandra blickte ihr nach, hob die Brauen und warf Jesse einen scharfen Blick zu. Natürlich. Nackte Zehen und keine Mütze! Und er war sicher, das mit der Zahnpasta hatte Sandra ebenfalls gerochen.
»Sag mal«, begann Sandra, »hast du meine Nachricht bekommen?«
»Welche Nachricht?«
»Ach, schon gut.« In ihrer Stimme war ein seltsamer Unterton. War sie gereizt? Oder nervös?
»Was wolltest du denn?«
»Gehst du überhaupt noch an dein Festnetz?«
Jesse zuckte mit den Achseln. Tatsächlich war sein Festnetztelefon meist auf lautlos gestellt, und den Anrufbeantworter benutzte er eigentlich nur als eine Art elektronischen Pförtner. Er entschied erst, ob er abhob, wenn er die Stimme des anderen hörte. Das pflichtschuldige Beantworten von Nachrichten lag ihm nicht, wofür Sandra jedes Verständnis fehlte. »Warum rufst du nicht auf dem Handy an?«, fragte er.
»Du hast keine Mailbox …«
… und ich habe keine Lust, dir so lange hinterherzutelefonieren, bis du dich bequemst ranzugehen, setzte Jesse den Satz in Gedanken fort. »Sag mir doch einfach, was du wolltest.«
»Wie gesagt: Ist schon in Ordnung. Hat sich erledigt.«
Es gab eine kleine Pause. Das Spiel aus schlechtem Gewissen und Zurückweisung entfaltete die übliche Wirkung bei ihm, und er begann sich zu ärgern.
Hinter Sandra tauchte Isas Kopf im Türspalt des Kinderzimmers auf. »Kommst du heute Abend nicht, Papa?«
»Heute Abend?« Jesse sah verwirrt von Isa zu Sandra.
Seine Noch-Frau rieb ihren rechten Zeigefinger mit der linken Hand. Das tat sie immer, wenn sie verlegen war.
»Ich hab die Nachricht gehört«, grinste Isa und goss, ohne es zu ahnen, Öl ins Feuer. Ihre Mutter warf ihr einen entsprechenden Blick über die Schulter zu, worauf Isas Kopf postwendend verschwand.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte Jesse.
»Hilfe? Wie wär’s mit Unterstützung?«
»Wenn du jemanden brauchst, der auf Isa aufpasst …«
Sie zögerte. Schwankte zwischen Ärger und – ja, was eigentlich? »Ab wann bist du denn weg?«, fragte Jesse.
»18 Uhr.«
»Spricht was dagegen, dass ich meine Tochter sehe? Ist Leon da?«
»Nö«, kam es gut gelaunt aus dem Kinderzimmer. »Der ist in Chicago.«
»Ich sehe mir ein kleines Tanzstudio an, vielleicht kann ich es mieten und Unterricht geben«, sagte Sandra widerstrebend.
Ein Tanzstudio. Das war es also. »Und Leon tourt durch die Weltgeschichte und schafft das Geld ran?«
»Lass das«, meinte Sandra tonlos.
»Na, so oft, wie er nicht da ist …«
»Sagt wer?«, fragte Sandra. »Mister Ärzte-ohne-Grenzen?«
»Mister Tanzen-ohne-Grenzen scheinst du seine Abwesenheit jedenfalls viel weniger übelzunehmen.«
Sandra wollte etwas entgegnen, hielt jedoch inne und schloss kurz die Lider. Als sie ihn wieder ansah, lächelte sie. Ein meilenweit entferntes Lächeln. Unecht, auf Sicherheit bedacht. »Lass Leon bitte aus dem Spiel. Ich will mir keine Sorgen um ihn machen müssen.«
»Sorgen? Um Leon?«
Sie sah ihn stumm an. Rieb wieder ihren Finger.
»Ich bitte dich!«, meinte Jesse. »Das ist nicht dein Ernst, oder?«
Ihr Blick war Antwort genug. Himmel, woher nahm sie das nur plötzlich? »Das mit Markus damals«, sagte Jesse, »das war etwas anderes. Und das weißt du ganz genau.«
»Da sagt er etwas anderes.«
Jesse war das Präsens nicht entgangen: sagt statt sagte. »Hast du mit ihm gesprochen?«
Sandra schwieg.
Er seufzte und schluckte seine Verärgerung hinunter. »Und Jule hast du vermutlich auch schon gefragt, ob sie Zeit hat.«
»Jule kann nicht. Sie arbeitet. Aber nicht schlimm, wie gesagt: Isa kommt auch alleine klar.«
Jesse sah auf die Uhr. 18 Uhr war eigentlich zu früh, aber er wollte Isa gerne sehen. Andererseits war die Kombination ›Sandra auf heißen Kohlen‹ und ›Jesse zu spät‹ heikel. »Ich bin gegen 18 Uhr da, plus/minus zehn Minuten«, sagte er.
Sandra schaute alles andere als glücklich drein.
»Bestimmt«, sagte er.
»Okay«, seufzte sie. »Ach, sag mal, warst du eigentlich in letzter Zeit mal in Adlershof?«
Jesse sah sie überrascht an. »Nein. Wie kommst du darauf?«
»Schon gut.«
»Also, bis heute Abend«, sagte er.
»Ja. Bis nachher.« Ihre Stimme war jetzt weicher. Einer der wenigen Vorteile der Trennung. Der Ärger verflog schneller. Die Triggerpunkte waren allesamt noch da, aber sie waren bemühter miteinander.
Der Volvo S60 sprang mit einem spröden elektronischen Geräusch an. Den alten Volvo-Kombi hatte Jesse bei der Trennung Sandra überlassen. Und den S60, den er überstürzt am nächsten Tag bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft hatte, hasste er schon wenige Wochen später. Zu viel Elektronik, zu sportlich, zu was-auch-immer. Nur das Soundsystem mochte er, besonders weil Isa immer diesen begeisterten Gesichtsausdruck bekam, wenn er aufdrehte.
Er schob den Regler hoch, ließ das Beifahrerfenster herab. Eisige Luft strömte in den Wagen. Billy Idols White Wedding dröhnte in seinen Ohren. There is nothing fair in this world, baby. There is nothing safe in this world.
Sorgen. Um Leon. Was für ein Blödsinn.
Einzelne Schneeflocken tanzten in sein Gesichtsfeld. Für einen Moment meinte er, Markus wie eine Projektion auf der Windschutzscheibe zu sehen. Die untersetzte Gestalt, den viereckigen Schädel mit den dunklen, messerscharf gescheitelten Haaren, die so wenig zu ihm passten wie seine aufgesetzte Kultiviertheit und seine angebliche Vorliebe fürs Tanzen. Er hatte sich immer bewegt wie ein Besen, der einen Knick in der Mitte hatte.
Die alte Narbe auf Jesses Rücken juckte wieder, wie meistens, wenn er an Markus und den Unfall dachte. Wenn es denn überhaupt ein Unfall gewesen war. Nach wie vor fiel es ihm schwer, daran zu glauben.
It’s a nice day – to start again … Billy Idols Stimme brach zu einem Schrei. Irgendwie zynisch, dachte er. Für einen Neustart war es weiß Gott zu spät. Das Einzige, was ihm blieb, war jeden Tag aufs Neue im Job aufzugehen. Seit der Trennung fühlte er sich heimatloser denn je.
Neustart.
Ja, den hatte er gehabt, damals, nach dem Unfall. Fokale retrograde Amnesie. Einmal den Stecker ziehen, alles vergessen und wieder neu hochfahren. Wenn ein Mensch aus seinen Erfahrungen und Erinnerungen bestand, dann war er im Alter von dreizehn Jahren gelöscht worden. Bis auf die Gene und so grundlegende Dinge wie Sprechen, Laufen, Rechnen, Fahrradfahren, aber auch das Unvermögen, richtig schwimmen zu können. Andere hatten ihm erzählen müssen, wer er war. Er hatte sich selbst aus Einzelteilen wieder zusammengesetzt. Und bis heute hatte er das schale Gefühl, nicht genau zu wissen, wer ich ist.
Er ließ das Fenster hochsurren. Setzte den Blinker. Der beste Ort, um all das zu vergessen, war die Ambulanz des St. Joseph. Oder ein Tag im Wald mit Isa.
Kapitel 4
Berlin – Montag, 7. Januar 2013, 15:52 Uhr
Irgendetwas stimmte nicht mit diesem Mädchen, so viel stand fest. Wie eine Wachsfigur saß die zwölfjährige Marta neben Jule im Wartezimmer der Ambulanz des St.-Joseph-Krankenhauses. Martas Stirn war von Jule mit einem provisorischen Verband umwickelt worden, der ihre dunklen Haare in einen enganliegenden Helm und strähnige lange Enden trennte. Die eiskalten Hände des Mädchens lagen unruhig in ihrem Schoß.
Jule hatte es satt. Sie begriff selbst nicht mehr, warum sie sich das alles antat. Nicht etwa, dass sie die Kinder leid war. Es lag an den Eltern. Obwohl sie die Mütter und Väter meistens nicht zu Gesicht bekam, wusste sie, wie sie waren. Der Blick auf die Kinder genügte. Schon allein ihre Mienen, wenn sie die Tür der Jugendeinrichtung aufstießen; und dann die Gesichter, wenn sie am Abend wieder nach Hause gingen.
Eltern, fand Jule, sollten sich gefälligst ihre Kinder verdienen – und die wenigsten Kinder verdienten solche Eltern. Immer öfter dachte sie, dass für manche die Unterbringung in einem Heim die bessere Lösung wäre.
»Glaub mir, das sagst du nur, weil du selbst nicht in einem gelebt hast«, hatte Sandra dagegengehalten. Und sicher recht gehabt, irgendwie. Was konnte Jule schon darüber sagen? Anders als Sandra stammte sie aus einer Heile-Welt-Familie. Zumindest von außen betrachtet. Papa Zahnarzt, Mama Hausfrau. Ihre große Schwester Angela hatte sich, ganz und gar angepasst, ebenfalls einen Zahnarzt geangelt, und Benedikt, ihr großer Bruder, war bei der Kripo in Hamburg – höhere Beamtenlaufbahn. Für Jule hatte es nicht an Angeboten gemangelt, den Weg ihrer Schwester einzuschlagen. Sie hatte es nur stinklangweilig gefunden.
Sie erlebte sich selbst als mittelgroß, vielleicht etwas mehr als mittelhübsch, mit mittelblonden, mittellangen Haaren und mittlerer Intelligenz. Irgendwie schien alles an ihr mittel zu sein. Bis auf ihre intensiven grünen Augen vielleicht und ihre dunkle Stimme, die nicht so recht zu ihrem grazilen Körper passen wollte.
Also hatte sie sich nach Kräften bemüht, aus der Rolle zu fallen. Auf ihr Einser-Abi folgte ein Musikstudium, das sie abbrach und gegen die Karriere als Sängerin einer – mittelmäßigen – Band eintauschte, die zwei Jahre lang über Land tingelte. Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll. Mit zweiundzwanzig hatte das verheißungsvoll geklungen, irgendwie nach Rebellion. Zwei Jahre später hatte es den faden Geschmack einer Dauerflucht. Längst zogen sie alle am Fuß eine Kette hinter sich her, mit einer Eisenkugel und ganz persönlicher Gravur. Gespenster. Auftritt, wenn es dunkel wurde.
»Irgendwann ist die Sache gekippt«, antwortete sie vorsichtig, wenn sie gefragt wurde, warum sie ausgestiegen sei. Den wahren Grund behielt sie für sich. Selbst Sandra kannte nur die eine Hälfte der Geschichte.
Danach hatte sie sich ins Studium gestürzt, zur Freude ihrer Eltern. Rückkehr in die heile Welt. Gut, es war zwar Psychologie und nicht Zahnmedizin – aber immerhin. Weniger immerhin fanden ihre Eltern dagegen ihren Job. Sozialarbeiterin in einer Jugendeinrichtung. Erst vor zwei Wochen, an Heiligabend, hatte es wieder Streit darüber gegeben.
Jule hatte dünnhäutig reagiert. Sie zweifelte ja selbst an ihrem Job. Wenn auch aus anderen Gründen als ihre Mutter, die keine Vorstellung davon hatte, was es hieß, Kinder zu erleben, die zum Teil täglich Kot in der Unterwäsche hatten, die oft nichts zu essen bekamen, da ›Dringenderes‹ gekauft werden musste, oder die, teils versteckt, teils offen, geschlagen wurden.
Am schlimmsten war, dass Jule nicht wusste, wohin mit ihrer Wut. Die Löcher in diesen Kindern waren so groß, dass sie die Hoffnung verlor. Sie waren nicht zu stopfen. Man konnte ja auch nicht die Flut aufhalten. Aber man konnte sehr wohl in ihr ertrinken.
Sie seufzte, richtete sich ein wenig auf. Versuchte, den härter werdenden Zug um ihren Mund wegzulächeln. Verdammt, sie lächelte viel zu oft, wenn es ihr schlechtging. Zu Hause hatte sie gelächelt, in der Schule, auf der Uni, auf der Bühne. Die Lachfalten um ihren Mund würden tiefer werden als die um ihre Augen.
Der einzige Mensch, bei dem sie nicht das Gefühl hatte, lächeln zu müssen, war Sandra. Sie hatte sich gefreut, als Sandra sie gestern noch spät am Abend angerufen hatte, trotz der Uhrzeit. Auch auf die Verabredung mit ihr freute sie sich. »Morgen, 18 Uhr, im Einstein, okay?« Sandras Stimme war plötzlich ernst geworden und leise, als fürchtete sie, jemand könnte zuhören. »Es gibt etwas über Jesse und Garmisch, das ich dir erzählen muss. Aber bitte kein Wort zu ihm!«, hatte Sandra gesagt. Als wenn sie Jesse ständig über den Weg laufen würde.
Es war nichts Neues, dass es um Jesse ging. Bei Sandra ging es schon seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten um Jesse. Jule hatte immer wieder eine geradezu übermenschliche Geduld bei diesem Thema aufbringen müssen. Aber diesmal war es anders, nicht das übliche Jesse hier, Jesse da. Es ging offenbar um eine der alten Heimgeschichten, und Sandra hatte beunruhigt geklungen – wirklich beunruhigt.
Manchmal beneidete Jule Sandra geradezu um ihre Heimvergangenheit. Sandra durfte sich verloren fühlen. Sie selbst dagegen durfte es nicht. Man hatte sich gefälligst nicht verloren zu fühlen, wenn alles nur mittelschlimm war.
Jule schielte nach der Uhrzeit. Noch zwei Stunden bis 18 Uhr. Wenn das hier so weiterging, würde sie zu spät kommen. Der Plastikstuhl in ihrem Rücken knackte. Die funktionale Flurbeleuchtung des St.-Joseph-Krankenhauses radierte alle Schatten aus, auch die im Gesicht von Marta.
Jule konnte sich inzwischen sogar vorstellen, dass das Mädchen auf der Straße lebte. Sie kam erst seit wenigen Tagen in die Einrichtung. Heute war ihre Wange stark geschwollen gewesen, und sie hatte ein durchgeblutetes Taschentuch über ihrer linken Augenbraue an die Stirn gepresst. Darunter war eine Platzwunde.
Als Jule Martas Eltern informieren wollte, stellte sich heraus, dass Martas Adresse samt Telefonnummer nicht existierte. Vielleicht hieß Marta ja noch nicht einmal Marta. Dennoch hatte Jule bei der Anmeldung im St. Joseph Martas Namen und die Adresse angegeben. Alles andere hätte nur unnötige Schwierigkeiten bereitet.
Nun saßen sie ausgerechnet in der Ambulanz, in der Jesse arbeitete. Jesse zu begegnen war das Letzte, was sie wollte, doch das St. Joseph war nun mal das nächstgelegene Krankenhaus, und das gab bei den aktuellen Schnee- und Verkehrsverhältnissen den Ausschlag. Vielleicht hatte sie ja auch Glück und geriet an einen anderen Arzt.
Sie musste wieder an Sandra denken und an Isa. Ein stilles Lächeln huschte über ihre Lippen. Sie hatte einen Narren an der Kleinen gefressen und wäre gerne ihre Patentante geworden. Bis heute hatte sie Jesse im Verdacht, das verhindert zu haben.
Einmal mehr ertappte sie sich bei dem Gedanken, ob sie die Arbeit in der Jugendeinrichtung auch angenommen hätte, wenn sie selbst Mutter geworden wäre. Der Job war anstrengend und für eine Psychologin wie sie finanziell unattraktiv. Aber sie hatte eben keine Kinder. Und daran hatte niemand anders Schuld als sie selbst.
Sie straffte den Rücken erneut, streckte den Hals und versuchte, ihre drückende Blase zu ignorieren. Aufmunternd lächelte sie Marta zu, die es nicht einmal bemerkte.
»Marta? Alles klar?«
»Hm.«
Eine Schwester lief eiligen Schrittes an ihnen vorüber, und Jule nutzte die Gelegenheit. »Entschuldigung, wissen Sie ungefähr, wie lange es noch –«
»Viertelstunde«, rief die Schwester, ohne sich auch nur umzudrehen.
Genug Zeit, um rasch noch einmal auf die Toilette zu gehen, beschloss Jule. Da Marta sich partout weigerte mitzukommen, stand Jule allein auf. Sie warf noch einen besorgten Blick auf Marta – oder wie auch immer sie hieß – in ihrem viel zu dünnen roten Anorak. Auf dem Weg zum WC kam ihr ein Arzt entgegen, der es genauso eilig zu haben schien wie die Schwester. Er trug einen Mundschutz und eine OP-Haube, dazwischen lag seine Augenpartie wie im Visier eines Helms. Ihre Blicke trafen sich kurz. Seine Iris hatte einen dunklen Bernsteinton. Sie war sich nicht sicher, ob es Jesse war oder nicht. In seinem Blick spiegelte sich kein Erkennen, was auch immer das heißen mochte.
Sollte Jesse Dienst haben und in irgendeinen OP-Saal gerufen worden sein, hatte sie entweder gute Karten, einer Begegnung aus dem Weg gehen zu können, oder sie musste schlicht noch länger warten. Schließlich hatten Notfälle immer Vorrang.
Kapitel 5
Berlin – Montag, 7. Januar 2013, 16:19 Uhr
Jesse ließ die zwei weißen Knochen mit einem Mausklick vom Screen verschwinden. Nächster bitte. Der Takt in der Ambulanz war hoch, aber anders als die meisten Kollegen stresste es ihn nicht. Er mochte den Wechsel und die Konzentration auf die Patienten – jeder hier war auf seine ganz eigene Art ein Notfall. Sich als Kinderarzt niederzulassen oder gar eine Oberarztstelle anzustreben wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. In einer Praxis musste man Arzthelferinnen einstellen und sich mit den Abrechnungsmodalitäten der Krankenkassen herumschlagen, für den Job des Oberarztes war er zu unstet. Er hielt es selten lange irgendwo aus. Schon gar nicht, wenn die Akten mehr Zeit in Anspruch zu nehmen drohten als die Menschen.
»Jesse?«
Dr. Rahul Taneja, sein indischer Kollege, stand in der Tür zwischen den beiden Behandlungsräumen. Unter seinen dunkelbraunen Augen schimmerten ähnlich dunkle Ringe. »Ich muss schallen und brauche die Zwei, können wir wechseln?«
»Klar.« Jesse meldete sich am Rechner ab, nahm seinen Schlüsselbund und die Patientenkarten und zog seine Arzttasche so rasch unter dem Tisch hervor, dass das Leder am Metallkreuz des Rollhockers entlangratschte. Eine weitere Narbe. Doch Jesse mochte jede einzelne von ihnen. Er nahm die Tasche selbst dann mit, wenn er sie nicht brauchte, wie hier in der Klinik. Sie gab ihm das Gefühl von Halt, jede Schramme war wie ein Tagebucheintrag. Es war gut, wenn Erinnerungen etwas Unverrückbares hatten. Nicht gelöscht werden konnten.
Fliegender Wechsel. Dr. Rahul Taneja schob einen etwa sechsjährigen Jungen mit wächsernem Gesicht ins Behandlungszimmer, die Mutter im Schlepptau, mit unsicheren, rastlosen Augen. Jesse nickte beiden freundlich zu, als er an ihnen vorbei in die Eins ging. Klappernd ließ er den Schlüsselbund neben die Computertastatur auf dem plastikbeschichteten Schreibtisch fallen. Der Schlüsselanhänger, ein kleiner Stofflöwe, den Isa ihm geschenkt hatte, kam auf dem Rücken zum Liegen. Seine Arzttasche landete auf dem angestammten Platz rechts unter dem Tisch. Aus Jesses Magen drang ein Geräusch, als hätte der Löwe geknurrt.
Er ignorierte den Hunger, klappte die oberste Patientenkarte auf, überflog Name und Anamnese, dann trat er durch die Schiebetür in den Flur und von dort in den Wartebereich. Vierzehn Augenpaare richteten sich auf ihn, das von Jule eingeschlossen. Er hatte sie schon bei einem der letzten Aufrufe bemerkt, sein knappes Nicken hatte sie aber kaum erwidert. Ihre blonden Haare trug sie hochgesteckt. Ihr Gesicht, früher wie mit einem weichen Bleistift gezeichnet, weiblich, mit rund geschwungenen Augenbrauen, wirkte angespannt.
»Marta Wilhelm?«, fragte Jesse in die Runde.
Jule erhob sich zögernd. In ihrem Gesicht las er den gleichen Unwillen, den er selbst empfand. Ausgerechnet. Warum zum Henker kam sie überhaupt hierher? Sie wusste doch, dass er hier arbeitete. Er musterte das Mädchen, das mit Jule aufstand, und automatisch übernahm der Arzt in ihm die Kontrolle. Beginnende Pubertät, schmale, hungrige Gestalt, ungepflegte, winterblasse Haut, ein frisches Hämatom am linken Wangenknochen, über dem Auge ein Verband, darunter wohl die im Anamnesefragebogen beschriebene Platzwunde. Es war offensichtlich, dass jemand sie geschlagen hatte. Ihr Blick war derart fest auf den Boden geheftet, als berge die Welt oberhalb des Krankenhauslinoleums ein unkalkulierbares Risiko.
Jesse seufzte innerlich.
Wegen solcher Fälle tat er seinen Dienst. Und wegen solcher Fälle hasste er manchmal seinen Dienst. Oder vielmehr: Er hasste die Hilflosigkeit. Immer wieder überkam ihn das Gefühl, etwas tun zu müssen. Etwas mehr, als nur eine Platzwunde zu nähen. Aber meistens blieb ihm nur, das Jugendamt zu informieren, wenn er einen Verdacht hatte. Im Stillen dankte er Sandra, dass Isa nicht so verloren war wie dieses Mädchen.
»Hallo, Jesse«, sagte Jule kühl, als sie an ihm vorbei in den Behandlungsraum trat.
»Hallo, Jule«, brummte Jesse, trat rasch ans Waschbecken und drückte mit dem Ellenbogen den mechanischen Bügel. Desinfektionsmittel spritzte aus dem Spender in seine offene Hand. Er verrieb es, als könnte er seine Aversion damit abwaschen, und wandte sich an das Mädchen. »Hallo, Marta. Ich bin Jesse. Jesse Berg.« Er wies auf den Behandlungstisch in der Mitte des Zimmers. »Setz dich doch.«
Obwohl Jesse leise und ruhig gesprochen hatte, war das Mädchen zusammengezuckt. Sie wirkte seltsam überrascht, Gedanken schienen durch ihren Kopf zu flattern. Wie ferngesteuert ging sie zum Behandlungstisch.
»Kennen wir uns?«, fragte Jesse.
Sie hatte sich offenbar wieder im Griff und deutete rasch ein Kopfschütteln an.
»Okay. Erzähl mal, was ist passiert?«
Martas Mund blieb ein Strich.
»Sie hatte einen Unfall«, erklärte Jule. »Jemand muss sich die Wunde ansehen.«
»Was für einen Unfall?«, fragte Jesse. »In der Einrichtung, in der du arbeitest?«
Jule zögerte, schien abzuwägen. »Nein.«
»Okay. Und wie ist es passiert?« Er sah von Jule zu Marta und wieder zurück.
Stille. Nur die kaltweißen Deckenlampen sirrten.
»Na, dann zeig mal her.« Sanft begann er, den Verband abzuwickeln, während das Mädchen stocksteif auf der Liege saß, die Beine wie zwei Stahlwinkel. Nur ihr Blick flog im Zimmer umher, als suche sie nach einem Fluchtweg. Die Wunde oberhalb der Braue war relativ frisch, vielleicht vom Morgen, etwa zwei Zentimeter lang, und die Wundränder standen auseinander.
»Keine Sorge, Marta. Das kriegen wir wieder hin«, murmelte er und lächelte aufmunternd. »Ich sorge erst mal dafür, dass es nicht mehr so weh tut.« Er ging hinüber zum Regal, wo er zwei Milliliter Mepivacain in einer Spritze aufzog, mit dem Rücken zu Marta, so dass sie die Spritze nicht sah.
»Kannst du die Wunde kleben oder …?« Jule stand plötzlich neben ihm. Ihre Stimme war leise, und sie vermied es, das Wort nähen auszusprechen.
»Ich denke, kleben reicht.«
Jules Blick fiel auf die Injektionsnadel. Rasch sah sie beiseite. Schweigend nahm Jesse die Nadel von der Spritze ab. Die stumpfe Plastikkanüle würde reichen, um das Lokalanästhetikum in die Wunde zu träufeln. »Keine Sorge, Marta«, sagte er, drehte sich um und verstummte. Marta stand mitten im Zimmer und starrte ihn an.
»Marta. Alles in Ordnung?«
Sie nickte, eigenartig hektisch.
»Wenn du dich hinlegst, dann träufele ich dir ein Betäubungsmittel in die Wunde, dann tut es nicht mehr so weh. Okay?«
Marta rührte sich nicht. Ihr Blick ging zur Tür, dann wieder zu Jesse. Ihr Körper war gespannt wie eine Bogensehne. Ihre Hände steckten tief in den Anoraktaschen.
Jesse, bemüht um eine defensive, beruhigende Körpersprache, ließ die Arme hängen, lächelte und blieb, wo er war. »Es tut nicht weh. Versprochen. Ein paar Minuten und –«
Plötzlich schien Marta regelrecht zu explodieren. Sie riss die Hände aus den Taschen, stürzte zur Schiebetür und war im nächsten Augenblick im Gang verschwunden.
»Marta!«, rief Jule.
Aus dem Flur drang das Quietschen von Gummisohlen im Laufschritt, dann ein überraschter Schrei und das Scheppern von Metallinstrumenten, die zu Boden regnen. Jesse erreichte die Tür noch vor Jule, rannte den Flur hinunter, an Schwester Irina vorbei, die mit offenem Mund im Gang stand und sich den Arm hielt. Zu ihren Füßen lagen silberne Instrumente verstreut. »Wo ist sie hin?«, rief Jesse.
»Äh – Wartebereich.«
Jesse hastete durch die offene Tür. Keine Marta weit und breit. Sein Arztkittel schlackerte um seine Beine. Patienten sahen ihm erstaunt nach. Im Glaskasten der Anmeldung beugte sich Frank Reutlein neugierig vor.
»Hast du ein Mädchen gesehen?«, rief Jesse im Vorbeilaufen. »Dunkle Haare, Wunde auf der Stirn?«
»Ich … Die ist raus, glaube ich«, rief Reutlein ihm hinterher.
Vor der Tür empfing ihn schneidend kalte Luft. Es war bereits dunkel. Vom schiefergrauen Himmel taumelten Schneeflocken ins Licht der Straßenbeleuchtung, und auf dem Gehweg teilten Trampelpfade die Schneedecke. Von Marta war nichts zu sehen.
»Wo ist sie?« Jule tauchte neben ihm auf, aus ihrem Mund stieg eine Atemwolke auf.
Jesse hob ratlos die Hände.
Hastig stapfte Jule an ihm vorbei über einen Schneebuckel zwischen zwei Autos auf die schmale, einspurige Wüsthoffstraße, sah in alle Richtungen und kam dann zurück zu Jesse. »Großartig«, schimpfte sie. »Wirklich großartig. Hättest du nicht wenigstens eine Pipette statt einer Spritze nehmen können?«
»Du meinst, sie ist wegen der Spritze abgehauen?«
Jule strich sich ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht. Ihre Hochsteckfrisur war in Auflösung begriffen. »Keine Ahnung«, stieß sie hervor.
»Es war noch nicht einmal eine Nadel auf der Spritze«, meinte Jesse.
»Vielleicht hättest du besser eine Kollegin gerufen.«
Jesse wusste, was sie meinte. Typischerweise entstanden Verletzungen wie die von Marta durch Schläge – durch Schläge von Männern. »Die Kollegin ist krank. Sonst hätte ich sie geholt.«
»Was auch immer in ihr vorgegangen ist, du hast ihr Angst gemacht.«
Der Vorwurf stieß Jesse bitter auf.
»Du hörst dich schon an wie Sandra. Wer von euch beiden ist eigentlich die Henne und wer das Ei?«
»Bitte?«
»Erzählt Sandra dir immer noch die alten Jesse-Schauergeschichten, oder redest du ihr ein, dass man vor mir Angst haben muss? Heute Morgen kam es mir sogar vor, als machte sie sich Sorgen um Leon. Wegen mir!? Was ein Quatsch.«
Die Resignation in Jules Gesicht wich einem starren, harten Ausdruck. »Wie passend. Offenbar läuft da eine Verschwörung gegen dich«, sagte sie. »Weißt du, was der Fachbegriff dafür ist, wenn man die eigenen Probleme auf andere projiziert? Übertragung.«