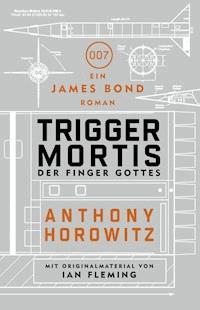8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alex Rider
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Der Bestseller ALEX RIDER – die Vorlage zur actiongeladenen TV-Serie! Nach seiner letzten Mission liegt Superagent Alex Rider mit einer Schussverletzung in einem Elitekrankenhaus. Sein Zimmernachbar: Paul Drevin, dessen milliardenschwerer Vater im Weltraum das sagenhafte Hotel Ark Angel bauen lässt. Als bewaffnete Männer die Station stürmen, begreift Alex, dass Paul in größter Gefahr schwebt, und gibt sich todesmutig als Paul aus … Band 6 der actionreichen Agenten-Reihe von Bestseller-Autor Anthony Horowitz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2018Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH©2018 Ravensburger Verlag GmbHDie englische Originalausgabe erschien 2005unter dem Titel Ark Angelby Walker Books Ltd., 87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ.Published by arrangement with Anthony HorowitzText © 2005 Stormbreaker Productions Ltd.Cover © Digital Art by Larry RostantVerwendet mit freundlicher Genehmigung von Penguin Books USA.Übersetzt aus dem Englischen von Werner SchmitzAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN978-3-473-38391-7www.ravensburger.de
Der Zünder der Bombe war auf exakt halb vier eingestellt.
Welch Ironie des Schicksals, dass der Mann, den sie töten sollte, wahrscheinlich mehr über Bomben und Terrorismus wusste als jeder andere auf der Welt. Er hatte sogar ein Buch darüber geschrieben. Jeder ist sich selbst der Nächste: Fünfzig SicherheitstippsfürzuHauseundunterwegsmochtekeinbesonders origineller Titel sein, aber von dem Buch waren in Amerika zwanzigtausend Stück verkauft worden, und angeblich hatte es sogar der Präsident auf seinem Nachttisch liegen. Der Autor selbst betrachtete sich zwar nicht als mögliches Opfer, war aber trotzdem immer auf der Hut. Es wäre schlecht fürs Geschäft, pflegte er zu witzeln, wenn er mitten auf der Straße in die Luft gesprengt würde.
Der Mann hieß Max Webber; er war klein und dick, trug eine Schildpattbrille und hatte pechschwarzes Haar. Er erzählteüberallherum,erseifrüherbeimSASgewesen,unddas stimmte auch. Nur erzählte er nicht, dass man ihn dort bereits nachseinemerstenEinsatzrausgeworfenhatte.InseinenVierzigern hatte er in London ein Ausbildungszentrum eröffnet, wo reiche Geschäftsleute sich in Sachen Selbstschutz schulen lassen konnten. Nebenbei hatte er sich als Autor einen Namen gemachtundtrathäufigimFernsehenauf,wennüberinternationale Sicherheit diskutiert wurde.
Heute war er als Gastredner zur vierten Internationalen Sicherheitskonferenzgeladen,dieinderQueenElizabethHall am Südufer der Themse in London stattfand. Das Gebäude war ringsum abgesperrt. Hubschrauber waren den ganzen Vormittag darüber gekreist, Polizisten hatten mit Spürhunden das Foyer abgesucht. Es war untersagt, Aktentaschen, Kameras und elektronische Geräte in den Hauptsaal mitzunehmen, und alle Konferenzteilnehmer mussten sich strengste Durchsuchungengefallenlassen,bevorsiedurchgelassenwurden. Mehr als achthundert Männer und Frauen aus siebzehn Staaten drängten sich in dem riesigen Konferenzsaal: Diplomaten,Geschäftsleute,Spitzenpolitiker,JournalistenundMitarbeiter verschiedener Sicherheitsdienste. Sie konnten sich sicher fühlen.
Auch Alan Blunt und Mrs Jones saßen im Publikum. Als LeiterundstellvertretendeLeiterinderSpezialeinheitdesMI6 waren sie verpflichtet, sich über die jüngsten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, auch wenn Blunt das Ganze für reine Zeitverschwendung hielt. In allen möglichen Städten fanden ständig irgendwelche Sicherheitskonferenzen statt, und nie kam etwas dabei heraus. Die Experten redeten. Die Politiker logen. Die Presse schrieb alles mit. Und dann gingen alle wieder nach Hause, und nichts änderte sich. Alan Blunt langweilte sich. Er hatte sichtlich Mühe, die Augen offen zu halten.
Um Punkt Viertel nach zwei trat Max Webber ans Rednerpult. Er trug einen teuren Anzug mit Krawatte und sprach mit bedächtiger, Autorität ausstrahlender Stimme. Er hatte Notizen vor sich liegen, schaute aber nur gelegentlich hinein, denn meist hielt er den Blick auf seine Zuhörer gerichtet, als spreche er jeden Einzelnen von ihnen direkt an. Hinter der Glasfront des Projektionsraums über der Bühne übersetzten neun Dolmetscher mit einer Verzögerung von höchstens zwei Sekunden leise in ihre Mikrofone, was der Redner sagte.
Webber drehte ein Blatt um. »Ich werde oft gefragt, welche terroristische Gruppierung weltweit die gefährlichste sei. Die AntwortwirdSievermutlichüberraschen.Eshandeltsich um eine Gruppe, von der Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Aber ich kann Ihnen nur nahelegen, dass Sie allen Grund haben sich vor diesen Leuten wirklich zu fürchten. Mein kurzer Bericht wird Ihnen verdeutlichen, warum.«
Er drückte auf einen Knopf am Rednerpult, und auf die riesige Leinwand hinter ihm wurden zwei Wörter projiziert.
FORCE THREE
In der fünften Reihe machte Blunt die Augen auf und drehte sich zu Mrs Jones um. Er sah verwirrt aus. Mrs Jones schüttelte knapp den Kopf. Beide waren plötzlich sehr aufmerksam.
»Die Vereinigung nennt sich Force Three«, fuhr Webber fort. »Der Name bezieht sich auf die Tatsache, dass die Erde der dritte Planet des Sonnensystems ist. Diese Leute würden sich selbst vermutlich nicht als Terroristen bezeichnen. Sie sehen sich eher als Öko-Krieger, deren Kampf dem Schutz derErdevordenschlimmenAuswirkungenderUmweltverschmutzunggilt.SieprotestierengegendieKlimaveränderung, die Vernichtung der Regenwälder, die Verwendung von Atomenergie, den Einsatz von Gentechnik und die Ausbreitung multinationaler Konzerne. Alles recht lobenswert, mögen Sie denken. Greenpeace tut schließlich auch nichts anderes. Der Unterschied ist nur, dass diese Leute Fanatiker sind. Sie sind bereit, jeden zu töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Nicht wenige Menschen fielen ihrer Sache bereits zum Opfer. Sie behaupten, Respekt vor dem Planeten zu haben – vor menschlichem Leben haben sie jedenfalls keinen Respekt.«
Webber klickte noch einmal, und auf der Leinwand erschien ein Foto. Jetzt wurde es unruhig im Publikum. Auf den ersten Blick glaubten die Konferenzteilnehmer, einen Globus zu sehen. Dann sahen sie, dass es ein Globus war, der auf breiten Schultern ruhte. Und schließlich erkannten sie, dass das Bild einen Mann zeigte. Er hatte einen kugelrunden, völlig kahl rasierten Kopf – sogar die Augenbrauen waren abrasiert. Und auf die Haut war eine Weltkarte tätowiert. England und FrankreichbedecktenseinlinkesAuge,Neufundlandwarüber dem rechten zu sehen. Argentinien schmiegte sich um seinen Hals. Empörtes Gemurmel erhob sich im Saal. Der Mann musste verrückt sein.
»Das ist der Kommandant von Force Three«, erklärte Webber. »Wie Sie sehen, liegt ihm der Planet sehr am Herzen, so sehr, dass er ihm irgendwann zu Kopf gestiegen ist. Sein Name – jedenfalls der Name, unter dem er auftritt – ist Kas-par.Manweißnursehrwenigüberihn.Möglicherweiseist er Franzose, aber es ist nicht ganz klar, wo er geboren wurde. Wir wissen auch nicht, wo er sich dieses Tattoo hat machen lassen. Fest steht, dass er in den letzten sechs Monaten sehr aktiv gewesen ist. Er steckt hinter dem Attentat auf Marjorie Schultz, eine Journalistin, die im Juni in Berlin ermordet wurde; ihr einziges Verbrechen war, dass sie einen kritischen Artikel über Force Three geschrieben hatte. Kaspar steckt hinter der Entführung und Ermordung zweier Mitglieder der Atomenergiekommission in Toronto. Er hat Sprengstoffanschläge in sechs Ländern organisiert, unter anderem in Japan und Neuseeland. Er hat eine Autofabrik in Dakota zerstört. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, seine Arbeit macht ihm Spaß. Wann immer es möglich ist, drückt Kaspar gern selbst auf den Knopf.
Für mich ist Kaspar derzeit der gefährlichste Mann der Welt, und zwar aus dem simplen Grund, weil er glaubt, dass die ganze Welt hinter ihm steht. Und in gewisser Weise hat er da sogar recht. Bestimmt gibt es auch in diesem Saal viele Leute, die davon überzeugt sind, dass man die Umwelt schützen muss. Das Dumme ist nur, Kaspar würde keinen Augenblick zögern, jeden Einzelnen von Ihnen zu töten, wenn er davon überzeugt wäre, seinen Zielen damit näher zu kommen. Und aus diesem Grund kann ich Sie nur warnen.
Finden Sie Kaspar. Finden Sie Force Three, bevor diese OrganisationnochmehrSchadenanrichtenkann.Dietödliche Bedrohung, die von ihr ausgeht, wird mit jedem Tag größer.«
Webber unterbrach sich und blätterte in seinen Notizen. Dann sprach er zu einem anderen Thema weiter. Zwanzig Minuten später, um Punkt drei, war er fertig. Es gab höflichen Applaus.
In der anschließenden Pause wurden im Foyer Kaffee und Kekse gereicht, aber Webber blieb nicht. Er grüßte flüchtig einen Diplomaten, den er kannte, wechselte ein paar Worte mit Journalisten und eilte davon. Auf dem Weg zum Ausgang traten ihm ein Mann und eine Frau entgegen.
»Alan Blunt!« Webber begrüßte den Leiter des MI6 mit einem Lächeln. »Mrs Jones!«
Nur sehr wenige Menschen auf der Welt hätten die beiden erkannt, aber Webber hatte ein ungewöhnlich ausgeprägtes Gedächtnis für Gesichter.
»Ihr Vortrag hat uns gefallen, Mr Webber«, sagte Blunt ohne allzu große Begeisterung in der Stimme.
»Ich danke Ihnen.«
»Besonders Ihre Ausführungen zu Force Three haben uns interessiert.«
»Sie kennen diese Gruppe natürlich?«
Die Frage war an Blunt gerichtet, aber die Antwort kam von Mrs Jones. »Wir haben von ihr gehört, gewiss«, sagte sie. »Aber offen gesagt, wissen wir nur wenig über sie. Soweit wir das überblicken, hat es Force Three vor sechs Monaten noch gar nicht gegeben.«
»Richtig. Diese Formation hat sich erst in jüngster Zeit zusammengeschlossen.«
»Sie scheinen gut darüber informiert zu sein, Mr Webber. Wir würden gern erfahren, woher Ihre Informationen stammen.«
Wieder lächelte Webber. »Sie wissen, dass ich Ihnen meine Quellenunmöglichnennenkann,MrsJones«,sagteermiteinem Augenzwinkern. Dann wurde er plötzlich ernst. »Aber ich finde es sehr beunruhigend, dass die Sicherheitsdienste unseres Landes so ahnungslos sind. Ich denke, Sie sind dazu da, uns zu beschützen.«
»Genau aus diesem Grund suchen wir das Gespräch mit Ihnen«, gab Mrs Jones zurück. »Wenn Sie etwas wissen, sollten Sie es uns sagen …«
Webber unterbrach sie. »Ich denke, ich habe Ihnen schon genug gesagt. Wenn Sie mehr wissen wollen, schlage ich vor, Sie kommen zu meinem nächsten Vortrag. Heute in zwei Wochen spreche ich auf einer Konferenz in Stockholm, und es ist gut möglich, dass ich bis dahin weitere Informationen über Force Three besitze. Falls ja, werde ich sie Ihnen bestimmt nicht vorenthalten. Und jetzt, wenn Sie gestatten, möchte ich mich von Ihnen verabschieden.«
Webber schob sich zwischen ihnen hindurch und eilte zur Garderobe. Er musste lächeln. Die Sache war perfekt gelaufen – und die Begegnung mit Alan Blunt und Mrs Jones war eineunerwarteteZugabegewesen.ErfischteeinenPlastikchip aus seiner Tasche und gab ihn der Garderobenfrau, die ihm sogleichseinenMantelundseinHandyreichte.Manhatteihm beides am Eingang abgenommen – genau wie er es in seinem Buch empfahl.
NeunzigSekundenspätertrateraufdiebreiteFlusspromenade hinaus. Es war Anfang Oktober, aber noch ziemlich warm; das Wasser lag dunkelblau unter der Nachmittagssonne. Nur wenige Leute waren unterwegs – hauptsächlich Jugendliche, die auf ihren Skateboards herumratterten – aber Webber musterte sie trotzdem kritisch, nur um ganz sicherzugehen, dass niemand von ihnen sich für ihn interessierte. Wie immer ging er zu Fuß nach Hause, auf Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel verzichtete er nach Möglichkeit. Auch das hatte er in seinem Buch geschrieben: »In größeren Städten ist man im Freien grundsätzlich sicherer.«
Er war kaum losgegangen, als das Handy in seiner Jackentasche klingelte und vibrierte. Er zog es hervor. Irgendwo im Hinterkopf glaubte er sich zu erinnern, dass das Handy ausgeschaltet gewesen war, als er es an der Garderobe entgegengenommen hatte. Aber er war noch immer so sehr mit seinem gelungenen Auftritt beschäftigt, dass er diesen Gedanken beiseiteschob.
Es war neunundzwanzig Minuten nach drei.
»Hallo?«
»Mr Webber. Ich rufe an, um Ihnen zu gratulieren. Das war sehr gut.«
Die Stimme klang künstlich gedämpft. Ein Engländer war das nicht, der da sprach. Sondern jemand, der die Sprache sehr gewissenhaft gelernt hatte. Die Aussprache war zu bedächtig, zu präzise. Und völlig emotionslos.
»Sie haben meinen Vortrag gehört?« Max Webber ging weiter, während er sprach.
»O ja. Ich war im Publikum. Hat mich sehr gefreut.«
»Wussten Sie, dass der MI6 da war?«
»Nein.«
»Ich habe hinterher mit ihnen gesprochen. Die waren sehr interessiert an dem, was ich zu sagen hatte.« Webber kicherte leise. »Vielleicht sollte ich meinen Preis erhöhen.«
»Ichdenke,wirbleibenbeiderursprünglichenVereinbarung«, antwortete die Stimme.
Max Webber zuckte mit den Achseln. Zweihundertfünfzigtausend Pfund waren immer noch eine ganze Menge. Auf ein geheimes Bankkonto überwiesen, blieb das Geld steuerfrei, und kein Mensch stellte irgendwelche Fragen. Und die Sache war so einfach gewesen. Eine Viertelmillion für zehn Minuten Arbeit!
Der Mann am anderen Ende klang plötzlich traurig. »Aber eine Sache beunruhigt mich, Mr Webber.«
»Was denn?« Webber hörte ein Geräusch im Hintergrund. Ein Knistern. Er drückte das Handy fester an sein Ohr.
»Mit Ihrer heutigen Rede haben Sie sich Force Three zum Feind gemacht. Und wie Sie selbst ausgeführt haben, sind diese Leute vollkommen rücksichtslos.«
»Ich glaube nicht, dass wir uns wegen Force Three Sorgen machen müssen.«
Webber sah sich um, ob ihm auch niemand zuhörte. »Und Sie, mein Freund, sollten nicht vergessen, dass ich mal beim SAS war. Ich kann schon auf mich aufpassen.«
»Ach ja?«
Verhöhnte ihn die Stimme? Webber verstand selbst nicht ganz warum, aber langsam wurde ihm mulmig. Und das Knistern in seinem Handy wurde immer lauter. Hörte sich an wie ein Ticken.
»Ich habe keine Angst vor Force Three«, prahlte er. »Ich habevorniemandemAngst.SorgenSienurdafür,dassmirdas Geld überwiesen wird.«
»Leben Sie wohl, Mr Webber«, sagte die Stimme.
Es klickte.
Eine Sekunde herrschte Stille.
Dann explodierte das Handy.
Max Webber hatte es fest an sein Ohr gepresst. Falls er den Knall noch gehört hatte, war er tot, ehe er begreifen konnte, wasdapassiertwar.ZweiJogger,dieihmentgegenliefen,kreischtenauf,alsdasDing,dasebennocheinMenschgewesen war, vor ihnen aufs Pflaster klatschte.
Die Explosion war erstaunlich laut. Man hörte sie noch im Konferenzzentrum, wo die Delegierten sich beim Kaffee zu ihren Beiträgen gratulierten. Sie hörten auch das Heulen der Sirenen, als kurz darauf Krankenwagen und Polizei angerast kamen.
Wenig später rief Force Three bei der Presse an und übernahm die Verantwortung für den Mord. Max Webber habe ihnen den Krieg erklärt, und deswegen habe er sterben müssen.
Mit demselben Anruf erließen sie eine nüchterne Warnung.
Sie hätten ihr nächstes Ziel bereits ausgewählt.
Siehättenetwasvor,dasdieWeltniemalsvergessen würde.
Die Krankenschwester war dreiundzwanzig Jahre alt, blond und nervös. Das war erst ihre zweite Woche am Klinikum St. Dominic,einederexklusivstenPrivatklinikenvonLondon. BekannteRockmusikerundFernsehstarskamenhierhin,hatte sie gehört. Und VIPs aus dem Ausland. VIP hieß hier Very Important Patients. Auch berühmte Leute werden krank, und werbeiseinerGenesungnichtaufFünf-Sterne-Luxusverzichtenwollte,ginginsSt. Dominic.DieChirurgenundTherapeuten waren Weltklasse. Das Essen war so gut, dass sich immer wieder Patienten extra krank stellten, um die Küche noch etwas länger genießen zu können.
An diesem Abend trug die junge Schwester ein Tablett mit Medikamenten durch einen breiten, hell erleuchteten Korridor. Sie hatte einen frisch gewaschenen weißen Kittel an. Ihr Name –D.MEACHER –standaufeinemAufnäherunterdem Kragen. Mehrere Jungärzte hatten bereits Wetten abgeschlossen,wervonihnenesalsErsterschaffenwürde,mitihrauszugehen.
Vor einer offenen Tür blieb sie stehen. Zimmer neun.
»Hallo«, sagte sie. »Ich bin Diana Meacher.«
»Schön, Sie kennenzulernen«, antwortete der Junge in Zimmer neun.
Alex Rider saß im Bett und las ein Kapitel in einem Französischlehrbuch, das seine Mitschüler gerade im Unterricht durchnahmen.SeinePyjamajackewaroffen,sodassDianaden Verband um seine Brust sehen konnte. Was für ein hübscher Junge, dachte sie. Sie wusste, er war erst vierzehn, auch wenn erälterwirkte.DaskamsicherlichvondenSchmerzen.Seinen ernstenbraunenAugensahmanan,dasssieschonzuvielgesehen hatten. Schwester Meacher hatte seine Krankenakte gelesen und verstand, was er durchgemacht hatte.
Eigentlich müsste er tot sein. Alex Rider war von einer Gewehrkugel vom Kaliber 22 getroffen worden, die aus fünfundsiebzigMeternEntfernungaufihnabgefeuertwordenwar. Der Schütze hatte auf sein Herz gezielt – und wenn die Kugel ihr Ziel gefunden hätte, hätte Alex keine Chance gehabt zu überleben. Aber nichts ist sicher – nicht einmal Mord. Eine winzige Bewegung hatte ihm das Leben gerettet. Er war aus dem MI6-Hauptquartier auf die Liverpool Street getreten und setzte gerade den rechten Fuß von der Bordsteinkante auf die Straße, als die Kugel ihn traf; doch statt in sein Herz zu schlagen, drang sie einen halben Zentimeter darüber in seinen Körper ein, prallte von einer Rippe ab und trat waagerecht unter seinem linken Arm wieder aus.
DieKugelhattezwarseinHerzverfehlt,abertrotzdemeine Menge Schaden angerichtet: Sie hatte die Arterie unter dem Schlüsselbein zerrissen, die das Blut oberhalb der Lunge in den Arm transportiert. Als das Blut aus der zerfetzten Arterie schoss und den Raum zwischen Lunge und Brustkasten füllte, hatte er kaum noch Luft bekommen. Ein erwachsener Mann wäre an einer solchen Verletzung höchstwahrscheinlich gestorben. Aber Kinder sind anders gebaut als Erwachsene. Bei jungenMenschenschließtsicheinedurchtrennteArterieautomatisch –dieÄrztehabenkeineErklärungdafür –,sodasssich der Blutverlust in Grenzen hält. Alex war bewusstlos, atmete aber noch, als vier Minuten später der Krankenwagen eintraf.
Man brachte ihn mit Blaulicht ins St. Dominic, wo die ChirurgendieKnochensplitterausderWundeholten.DieOperation hatte zweieinhalb Stunden gedauert.
Und jetzt sah Alex beinahe wieder aus, als sei gar nichts passiert. Als die Schwester ins Zimmer kam, klappte er das BuchzuundließsichindieKissenzurücksinken.DianaMeacher wusste, dass dies seine letzte Nacht im Krankenhaus war. Er war zehn Tage da gewesen, und morgen konnte er nach Hause gehen. Sie wusste auch, dass sie ihm nicht allzu vieleFragenstellendurfte.Dasstandgroßgedrucktaufseiner Akte:
PATIENT 9/75958 RIDER/ALEX: SONDERSTATUS (MISO). KEINE UNBEFUGTEN BESUCHER. KEINE PRESSE. ANFRAGEN SIND AUSNAHMSLOS AN DR. HAYWARD ZU VERWEISEN.
Das war schon sehr seltsam. Man hatte ihr gesagt, dass sie im St. Dominic einige interessante Leute kennenlernen würde, und sie hatte, bevor sie die Stelle antrat, eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben müssen. Aber mit so etwas hatte sie nundochnichtgerechnet.MISObedeuteteMilitaryIntelligence Special Operations. Was hatte der militärische Geheimdienst bloß mit einem vierzehnjährigen Jungen zu tun? Wieso hatte jemand auf ihn geschossen? Und warum hatten während der ersten vier Tage seines Aufenthalts zwei bewaffnete Polizisten vor seiner Tür Wache gehalten? Diana versuchte diese Gedanken beiseitezuschieben, als sie das Tablett abstellte. Vielleicht hätte sie doch besser in einem normalen Krankenhaus bleiben sollen.
»Wie geht’s dir?«, fragte sie.
»Gut, danke.«
»Freust du dich auf zu Hause?«
»Ja.«
Plötzlich merkte Diana, wie sie Alex anstarrte, und wandte ihreAufmerksamkeitdenMedikamentenzu.»Hastduirgendwelche Schmerzen?«, fragte sie. »Soll ich dir etwas geben, damit du besser schlafen kannst?«
»Nein, mir geht’s gut.« Alex schüttelte den Kopf, aber in seinenAugenflackerteeskurz.DieSchmerzeninseinerBrust hatten sich nach und nach verzogen, dennoch wusste er, dass ersievermutlichniemehrganzloswerdenwürde.Sielauerten in ihm, wie eine schlechte Erinnerung.
»Möchtest du, dass ich später noch einmal komme?«
»Nein, alles in Ordnung, danke.« Er lächelte. »Ich brauche niemanden, der mich vor dem Einschlafen zudeckt.«
Diana wurde rot. »So habe ich das nicht gemeint«, sagte sie. »Aber falls du mich brauchst: Ich bin gleich nebenan. Du kannst jederzeit nach mir rufen.«
»In Ordnung.«
Die Schwester nahm das Tablett und ging aus dem Zim-mer.NurderDuftihresParfüms –HeidekrautundFrühlingsblumen – blieb zurück. Alex schnüffelte. Er hatte das Gefühl,dassseineSinneseitseinerVerletzungschärfergeworden waren.
Lustlos griff er nach dem Französischbuch, überlegte es sich dann aber anders. Zum Teufel damit, dachte er. Die unregelmäßigen Verben konnten warten. Seine eigene Zukunft war ihm jetzt wichtiger.
Er blickte sich in dem matt beleuchteten Raum um, der sichalleMühegab,wieeinkostspieligesHotelzimmerauszusehen.AufeinemTischinderEckestandeinFernseher, die Fernbedienung lag neben ihm auf dem Nachttisch. Das Fenster bot Aussicht auf eine breite, von Bäumen gesäumte Straße im Norden von London. Alex’ Zimmer lag in der zweiten Etage und war eins von etwa einem Dutzend, die im Kreis umdenmodernenEmpfangsbereichangeordnetwaren.Inden ersten Tagen nach seiner Operation war das ganze Zimmer voller Blumen gewesen, aber Alex hatte darum gebeten, sie zu entfernen. Sie erinnerten ihn an Beerdigungen, und er zog es eindeutig vor, unter den Lebenden zu bleiben.
Aber die vielen Karten mit Genesungswünschen waren noch da. Es hatte Alex schon überrascht, wie viele Leute von seiner Verwundung erfahren hatten – und wie viele ihm eine Karte geschickt hatten. Natürlich waren viele aus der Schule gekommen: eine vom Direktor, eine von Miss Bedfordshire, der Schulsekretärin, und mehrere von seinen Freunden. Tom Harris hatte ihm ein paar Fotos von ihrer Fahrt nach Venedig und eine kurze Nachricht geschickt:
Diehabenunserzählt,duhättesteineBlinddarmentzündung, aber das glaub ich niemals. Werd trotzdem bald gesund.
Tom war der Einzige in der Brookland-Schule, der die Wahrheit über Alex wusste.
Sabina Pleasure war irgendwie dahintergekommen, dass er im Krankenhaus lag, und hatte ihm aus San Francisco eine Karte geschickt. Das Leben in Amerika gefalle ihr, trotzdem vermissesieEngland,schriebsie.Siehoffe,überWeihnachten kommen zu können. Jack Starbright hatte ihm die größte Karte von allen geschickt; sie kam ihn auch zweimal täglich besuchen und brachte ihm Schokolade, Zeitschriften und Energydrinks mit. Auch aus dem Büro des Premierministers war eine Karte gekommen – allerdings war der Premierminister anscheinend zu beschäftigt gewesen, um sie selbst zu unterschreiben.
Und schließlich bekam Alex auch einige Karten vom MI6. Eine von Mrs Jones, eine von Alan Blunt (eine Botschaft, die nurauseinemWortbestand –BLUNT –,geschriebenmitgrüner Tinte wie eine Aktennotiz); und zu Alex’ Überraschung auch eine von Wolf, dem Soldaten, den er im Trainingscamp des SAS kennengelernt hatte. Dem Poststempel nach war die Karte in Bagdad aufgegeben worden. Die beste Karte jedoch war immer noch die von Smithers gewesen. Vorne drauf war einTeddybär.AlexklapptedieKarteaufundsuchtevergeblich nach etwas zu lesen, aber plötzlich zwinkerte der Teddy mit den Augen und begann zu sprechen.
»Alex – tut mir sehr leid, dass es dich erwischt hat.« Der Bär sprach mit Smithers’ Stimme. »Hoffentlich bist du bald wieder auf dem Damm. Bleib locker – ruh dich einfach mal aus, das hast du dir verdient. Oh, übrigens, diese Karte wird sich in fünf Sekunden selbst vernichten.«
Und tatsächlich war die Karte zum Entsetzen der Krankenschwestern plötzlich in Flammen aufgegangen.
Manche Leute hatten ihn auch persönlich besucht. Als ErsteskamMrsJones.AlexwargeradeausderNarkoseaufgewacht.ErhattediestellvertretendeLeiterinderSpezialeinheit nochniesounsichergesehen.SietrugeinenschwarzenRegenmantel, darunter ein dunkles Kostüm. Ihre Haare waren nass und auf ihren Schultern glitzerten Regentropfen.
»Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Alex«, fing sie an. Sie fragte nicht, wie es ihm ging. Wahrscheinlich wusste sie das schon von den Ärzten. »Was dir auf der Liverpool Street passiert ist … daran sind wir schuld, das war eine unverzeihlicheSicherheitslücke.ZuvieleLeutewissen,wounserHauptquartierist.WirwerdendenVordereingangnichtmehrbenutzen. Das ist zu gefährlich.«
Alex rutschte unbehaglich im Bett hin und her, sagte aber nichts.
»Dein Zustand ist stabil. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich das erleichtert. Als ich hörte, dass man auf dich geschossenhat …«Sieunterbrachsich.IhreschwarzenAugen folgtendenSchläuchenundKabeln,dievonArm,Nase,Mund und Magen des Jungen zu allen möglichen Apparaten führten. »Ichweiß,dukannstjetztnichtsprechen«,fuhrsiefort.»Also willichmichkurzfassen.DubisthierinSicherheit.Wirhaben St. Dominic schon oft benutzt, und wir sorgen dafür, dass dir nichts passieren kann. Vor deinem Zimmer sind Wachposten stationiert.Solangeesnötigist,wirdvierundzwanzigStunden am Tag jemand für dich da sein. Die Presse hat von dem Attentat auf der Liverpool Street berichtet, aber dein Name wurde nicht erwähnt. Auch nicht dein Alter. Der Mann, der auf dich geschossen hat, hatte sich auf dem Dach gegenüber postiert. Wir untersuchen noch, wie er es geschafft hat, unentdeckt da hinaufzukommen – aber ich fürchte, wir werden ihnnichtfinden.AberfürsErstedenkenwirnurandeine Sicherheit. Wir können mit Scorpia reden. Wie du weißt, haben wir auch früher schon mit denen zu tun gehabt. Ich kann sie bestimmt dazu überreden, dich in Ruhe zu lassen. Du hast ihren Plan vereitelt, Alex, und sie haben dich dafür bestraft. Aber jetzt reicht es auch.«
Sie hielt inne. Alex’ Herzmonitor pulsierte leise in dem sanft beleuchteten Zimmer.
»Versuch bitte, nicht allzu schlecht von uns zu denken«, sagte sie dann. »Nach allem, was du durchgemacht hast – Scorpia, die Sache mit deinem Vater … Ich werde mir das niemals verzeihen. Manchmal denke ich, es war nicht richtig von uns, dich überhaupt in das alles hineinzuziehen. Aber darüber können wir ein andermal reden.«
Alex fühlte sich zu schwach, um etwas zu entgegnen. Er sahMrsJonesaufstehenundausdemZimmergehen,und ein paar Tage später, als die Wachen vor seinem Zimmer abgezogen wurden, kam er zu dem Schluss, dass sich Scorpia wohl tatsächlich dazu entschieden hatte, ihn in Ruhe zu lassen.
Und nun würde er in gut zwölf Stunden endlich nach Hause gehen können. Jack hatte bereits Pläne für die nächsten Wochen gemacht. Sie wollte mit ihm in Urlaub fahren, nach Florida oder vielleicht in die Karibik. Es war Oktober, der Sommer hatte sich endgültig verabschiedet. Das Laub fiel von den Bäumen und nachts wurde es empfindlich kalt. Jack wollte, dass Alex sich ausruhte und in warmem Klima wieder zu Kräften kam – aber Alex war sich nicht so sicher, ob er selbst das auch wollte. Er griff wieder nach dem Französischbuch. Nie hätte er geglaubt, dass er so etwas einmal denken würde,aberdieWahrheitwar:Eigentlichwollteernichtsanderes,alswiederzurSchulezugehen.Wiedereinganznormaler Junge sein. Scorpia hatte ihm eine schlichte, unmissverständliche Botschaft geschickt. Die lautete: Als Spion stehst du mit einem Bein im Grab. Unregelmäßige Verben dagegen waren deutlich ungefährlicher.
Die Tür ging auf und ein Junge schaute herein.
»Hi, Alex.«
Der Junge sprach mit einem merkwürdigen Akzent – osteuropäisch, vielleicht russisch. Er war vierzehn, hatte kurze blonde Haare und hellblaue Augen. Sein Gesicht war schmal undblass.ÜberseinemSchlafanzugtrugereinenweitenMorgenmantel, in dem er noch dünner aussah, als er sowieso schonwar.ErlagimZimmernebenAlexundhatteeineBlinddarmoperation hinter sich, bei der es Komplikationen gegeben hatte. Der Junge hieß Paul Drevin – ein Nachname, der Alex irgendwie bekannt vorkam –, aber mehr wusste Alex nicht von ihm. Die beiden hatten ein paarmal kurz miteinander gesprochen. Schließlich waren sie die einzigen Teenager auf der Station.
Alex hob eine Hand zum Gruß. »Hi.«
»Hab gehört, du kommst morgen raus«, sagte Paul.
»Stimmt. Und du?«
»Leider noch einen Tag länger.« Paul blieb in der Tür stehen. Er schien eintreten zu wollen, aber irgendetwas hielt ihn zurück. »Bin froh, wenn ich hier rauskomme«, sagte er. »Ich will nach Hause.«
»Wo ist dein Zuhause?«, fragte Alex.
»Kann man nicht so genau sagen«, antwortete Paul. Seine Stimmt klang ernst und sehr erwachsen. »Oft leben wir in London. Aber mein Vater zieht dauernd um. Moskau, New York, Südfrankreich … er war in letzter Zeit so beschäftigt, dass er mich nicht mal hier besuchen konnte. Und wir haben so viele Häuser, dass ich manchmal gar nicht weiß, welches eigentlich mein Zuhause ist.«
»Wo gehst du denn zur Schule?« Alex vermutete, dass Paul Russe war, weil er etwas von Moskau gesagt hatte.
»Ich gehe nicht zur Schule. Ich habe Privatlehrer.« Paul zucktedieAchseln.»Diesindziemlichanstrengend.Seltsames Leben, und alles bloß, weil mein Vater … Aber egal. Ich beneide dich, weil du vor mir hier rauskommst. Viel Glück.«
»Danke.«
Paul zögerte noch eine Sekunde, dann ging er. Alex blickte ihm nachdenklich nach. Vielleicht war Pauls Vater ja Politiker oderirgendeinhohesTierbeieinerBank.Jedenfallswirkteder Junge ziemlich einsam – Freunde hatte er anscheinend keine. Alex fragte sich, wie viele Kinder in dieses Krankenhaus kamen, deren Väter bereit waren, Zigtausende auszugeben, damit sie wieder gesund wurden, aber keine Zeit hatten, sie hier zu besuchen.
Inzwischen war es neun Uhr. Alex zappte durch die Fernsehkanäle, aber irgendwie interessierte ihn das alles nicht. Hätte er doch bloß die Schlaftablette genommen, die die Schwester ihm angeboten hatte. Ein kleiner Schluck Wasser, und er hätte von der Nacht nichts mitbekommen. Und am nächsten Tag das Krankenhaus verlassen. Darauf freute sich Alex mehr als auf alles andere. Er sehnte sich danach, wieder mit dem Leben anzufangen.
EinehalbeStundelangsahersicheineKomödiean,dieihn nichtzumLachenbrachte.DannmachteerdenFernseherund das Licht aus und legte sich zum letzten Mal in diesem Bett schlafen.Schade,dassDianaMeachernichtnocheinmalnach ihm gesehen hatte. Er erinnerte sich kurz an den Geruch ihres Parfüms. Und dann schlief er auch schon.
Aber nicht lange.
Halb eins. Und er war schon wieder wach. Alex starrte auf die Uhr neben seinem Bett, deren Ziffern im Dunkeln rot leuchteten. Wie sollte man auch schlafen, wenn man nichts getan hatte, wovon man müde wurde? Den ganzen Tag hatte er nur herumgelegen und das sterile klimatisierte Zeug eingeatmet, das in dieser Klinik als Luft bezeichnet wurde.
Er blieb einige Minuten im Halbdunkel liegen, unschlüssig, was er tun sollte. Dann stand er auf und schlüpfte in seinen Morgenmantel. Das Schlimmste am Krankenhaus war, dass man nicht nach draußen gehen konnte. Daran konnte Alex sich absolut nicht gewöhnen. Seit einer Woche war er jede Nacht um dieselbe Zeit aufgewacht, und jetzt reichte es ihm, jetzt würde er gegen die Vorschriften verstoßen und diese sterilen vier Wände verlassen. Er wollte nur noch weg. Er sehnte sich nach dem Geruch von London, dem Lärm des Verkehrs, dem Gefühl, dass er noch zur wirklichen Welt gehörte.
Er stieg in seine Pantoffeln und ging hinaus. Das gedämpfte Licht aus seinem Zimmer drang kaum auf den Flur. In der Schwesternstation flimmerte ein Computerbildschirm, aber von Diana Meacher oder sonst wem war nichts zu sehen. Zögerlich machte Alex einen Schritt den Flur hinunter. Es gibt wenige Orte, die stiller sind als ein Krankenhaus mitten in der Nacht, und fast hatte Alex Angst, sich zu bewegen, als ob er damitirgendeinungeschriebenesGesetzzwischendenGesundenunddenKrankenbrechenwürde.AberAlexwusste,wenn er im Bett bliebe, würde er stundenlang nicht einschlafen können. Und außerdem musste er sich keine Sorgen machen. Mrs Jones war überzeugt davon, dass Scorpia keine Gefahr mehr darstellte. Am liebsten wäre er einfach mit dem Nachtbus nach Hause gefahren.
Natürlich kam das nicht infrage. So weit durfte er es nicht treiben. Aber er wollte zum Empfang gehen und durch die Glastür eine echte Straße mit Menschen und Autos und Lärm und Schmutz beobachten. Tagsüber waren an der Pforte drei Leute beschäftigt, die hauptsächlich am Telefon irgendwelche Anfragenbeantworteten.NachachtUhrkameinMannfürdie Nachtschicht. Alex kannte ihn schon – ein freundlicher Ire, der Conor Hackett hieß. Die beiden hatten sich vor ein paar Tagen angefreundet.
ConorwarfünfundsechzigundhattedengrößtenTeilseines Lebens in Dublin verbracht. Den Job hier hatte er angenommen, um seine neun Enkelkinder zu unterstützen. Nachdem Conor eines Nachts eine Weile mit Alex geplaudert hatte, ließ er sich schließlich dazu überreden, Alex vor die Tür zu las-sen. Eine wunderbare Viertelstunde lang hatte Alex vor dem Haupteingang gestanden, den vorbeirauschenden Verkehr beobachtet und die kühle Nachtluft geatmet. Jetzt wollte er das noch einmal machen. Conor würde zunächst jammern; vielleicht würde er sogar drohen, die Schwester zu rufen. Aber Alex war sicher, dass er ihm den Gefallen tun würde.
Er nahm die Treppe, weil er befürchtete, das Klingeln des Aufzugskönneihnverraten.IndererstenEtageangekommen, trat er in einen langen Flur und sah auf den spiegelblanken Boden des Empfangsraums und die Glastüren des Haupteingangshinunter.ConorsaßhinterdemSchalterundlasineiner Zeitschrift. Auch hier unten war das Licht gedämpft, als wolltedasKrankenhausBesucherschonbeimEintretendaran erinnern, wo sie sich befanden.
Conor schlug eine Seite um. Alex wollte gerade die letzten Stufen zu ihm hinuntergehen, als plötzlich die Eingangstür aufglitt.
Alex erschrak und war gleichzeitig ein wenig verlegen. Er wolltenichtinSchlafanzugundMorgenmantelhieruntenerwischt werden. Dennoch interessierte es ihn natürlich brennend, wer so spät in der Nacht noch in die Klinik kam. Er trat einen Schritt zurück in den Schatten. So konnte er unbemerkt alles beobachten, was sich da unten abspielte.
Vier Männer traten ein. Sie waren Ende zwanzig und sahen ziemlich kräftig aus. Der Anführer trug eine Militärjacke und ein Che-Guevara-T-Shirt. Die anderen trugen Jeans, Kapuzenshirts und Turnschuhe. Von seinem Versteck aus konnte Alex ihre Gesichter nicht sehr deutlich erkennen, aber ihm war sofort klar, dass irgendetwas nicht mit ihnen stimmte. Sie bewegtensichzuschnell,zuenergischfürKrankenhausbesucher.
»Hey – wie läuft’s denn so?«, fragte der Erste. Seine Stimme, drang scharf durch den halbdunklen Raum.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte der Pförtner.
»Wir möchten einen Ihrer Patienten besuchen«, erklärte der Mann. »Vielleicht können Sie uns sagen, wo er ist.«
»Tut mir sehr leid.« Alex konnte Conors Gesicht nicht sehen, hörte aber an seiner Stimme, dass er lächelte. »Sie können jetzt niemanden besuchen. Es ist kurz vor eins! Kommen Sie bitte morgen wieder.«
»Sie haben mich wohl nicht verstanden.«
Alex wurde nervös. Die Stimme des Mannes klang plötzlichbedrohlich.Undwiedieanderendreisichaufgebauthatten, verhieß auch nichts Gutes. Sie hatten sich zwischen Empfang und Eingang verteilt. Als wollten sie verhindern, dass Conor weglief. Oder jemand hereinkam.
»Wir wollen zu Paul Drevin.«
Alex erschauderte ungläubig, als er den Namen hörte. Paul Drevin. Der Junge aus dem Zimmer neben seinem! Was konnten diese Männer mitten in der Nacht von ihm wollen?
»In welchem Zimmer liegt er?«, fragte der Mann in der Militärjacke.
Conor schüttelte den Kopf. »Das darf ich Ihnen nicht sagen«, entgegnete er schwach. »Kommen Sie morgen wieder, dann wird man Ihnen gern weiterhelfen.«
»Wir wollen es aber jetzt wissen«, verlangte der Mann und griff in seine Jacke. Der Boden unter Alex schien plötzlich zu schwanken, als er sah, wie der Mann eine Pistole hervorzog. Sie war mit einem Schalldämpfer ausgerüstet. Und wurde auf Conors Kopf gerichtet.
»Was …?« Conor war erstarrt; seine Stimme überschlug sich. »Ich darf Ihnen das nicht sagen!«, rief er. »Was machen Sie hier? Was wollen Sie?«
»Wir wollen die Zimmernummer von Paul Drevin. Wenn Sie mir die nicht in den nächsten drei Sekunden nennen, drückeichab,unddannwerdenSievondiesemKrankenhausnur noch den Leichenraum brauchen.«
»Warten Sie!«
»Eins …«
»Ich weiß nicht, wo er ist!«
»Zwei …«
AlexspürteeinenStichinderBrustundmerkte,dasserdie ganze Zeit die Luft angehalten hatte.
»Naschön!Naschön!IchsucheIhnendieNummerheraus.«
Der Pförtner tippte hektisch auf der Tastatur herum, die vor ihm auf dem Empfangsschalter stand.
»Er ist auf der zweiten Etage! Zimmer acht.«
»Danke«, sagte der Mann und drückte ab.
Alex hörte das wütende Husten, mit dem die Kugel aus demSchalldämpferkam.ErsahetwasSchwarzesausderStirn desPförtnersspritzen.AlsConornachhintenfiel,hobernoch einmal kurz die Hände.
Keiner bewegte sich.
»Zimmer acht. Zweite Etage«, flüsterte einer der Männer.
»Ich hab’s euch ja gesagt, er ist in Zimmer acht«, sagte der erste Mann.
»Warum hast du dann gefragt?«
»Um ganz sicherzugehen.«
Einer kicherte.
»Holen wir ihn uns«, sagte ein anderer.
Alex war wie betäubt. Seine Wunde pochte heftig. Das war dochnichtmöglich!Abereswarmöglich.Erhatteesmiteigenen Augen gesehen.
Die vier Männer setzten sich in Bewegung.
Alex drehte sich um und rannte los.
Hundert Gedanken jagten ihm gleichzeitig durch den Kopf, als er, immer zwei Stufen auf einmal, die Treppe hinaufrannte. Wer waren diese vier Männer, und was wollten sie von Paul? Der Name Drevin sagte ihm etwas, aber jetzt war nicht die Zeit, genauer darüber nachzudenken. Was konnte er tun, um Conors Mörder aufzuhalten?
Vor einem Feuermelder blieb er stehen. Einige kostbare Sekunden lang schwebte seine Faust vor der Glasscheibe des roten Kastens. Aber dann erkannte er, dass es nichts nützen würde, den Alarm auszulösen. Noch hatte er das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Ein Feueralarm würde den Männern aber verraten, dass jemand sie gesehen hatte, und dann würden sie nur umso schneller machen. Bis Polizei und Feuerwehr schließlich einträfen, hätten sie den Jungen längst getötet oder entführt.
Alex wollte sich den vier Männern nicht allein entgegenstellen. Er wünschte verzweifelt, er könnte um Hilfe rufen. Aber die käme natürlich auch zu spät.
Von einem winzigen Hoffnungsschimmer getrieben, lief er weiter die Treppe hinauf. Die Männer waren sehr zielstrebig und rücksichtslos aufgetreten. Aber einen Fehler hatten sie schon gemacht.
SiewarenzumFahrstuhlgegangen,undAlexwussteetwas, das sie nicht wussten. Als St. Dominic vor zwanzig Jahren gebaut worden war, hatte man die Aufzüge speziell für den Transport von Patienten aus den unten gelegenen Operationssälen angelegt, das heißt, sie mussten vollkommen erschütterungsfrei anhalten können. Somit waren sie sehr langsam. Alex brauchte keine zwanzig Sekunden in die zweite Etage; die Männer würden fast zwei Minuten brauchen. Das gab ihm eine Minute und vierzig Sekunden, um etwas zu unternehmen. Aber was?
Er rannte durch die Tür in die Schwesternstation vor seinemZimmer.Seltsam,dawarimmernochniemand.Vielleicht hatten die vier Männer irgendwie für Ablenkung gesorgt. Das würde einiges erklären. Womöglich hatten sie die Schwester mit einem Anruf weggelockt, und jetzt lief sie irgendwo im Krankenhaus herum. Alex stand keuchend in dem dämmerigen Licht und versuchte sein Gehirn in Gang zu bringen. Und versuchte vor allem, nicht daran zu denken, wie der Aufzug Zentimeter um Zentimeter höher kam.
Ihm war schmerzlich bewusst, wie ungleich die Kräfte in diesemKampfverteiltwaren.DieseMännerwarenProfikiller. DashätteAlexaucherkannt,wennernichtgesehenhätte,wie sie den Nachtpförtner ermordet hatten. Das merkte man schon an ihrer Körpersprache, an ihrem Lächeln, an der Art, wie sie miteinander sprachen. Das Töten war zu ihrer zweiten Natur geworden. Alex konnte es unmöglich mit ihnen aufnehmen. Er war unbewaffnet. Schlimmer noch, er lief in Schlafanzug und Pantoffeln herum und hatte eine Wunde in der Brust, die von Nähten und Verbänden zusammengehalten wurde. Noch nie war er so hilflos gewesen. Wenn sie ihn zu sehen bekamen, war er erledigt. Er hatte keine Chance.
Abertrotzdemmussteeretwastun.Erdachteandenmerkwürdigen einsamen Jungen. Paul Drevin war vierzehn – acht Monate jünger als Alex. Diese Männer waren hinter ihm her. Alex konnte nicht zulassen, dass sie ihn erwischten.
Er sah nach der offenen Tür seines eigenen Zimmers – Nummer neun. Die Tür lag genau gegenüber dem Aufzug und wardasErste,wasdieMännersehenwürden,wennsieherauskamen.PaulDrevinschliefimZimmernebenan.SeineTür war zu. Die Namen der Jungen konnte man auch bei schlechtem Licht erkennen: ALEX RIDER und PAUL DREVIN. Sie standenaufPlastikstreifen,dieineineHalterungandenTüren geschoben waren. Darunter, ebenfalls auf solchen Streifen, standen die Zimmernummern.
UndplötzlichhatteAlexeinenPlan.Erschnapptesicheinen Teelöffel von einer Untertasse, die eine Schwester auf dem Schreibtisch hatte stehen lassen. Mit dem Stiel stemmte er die Plastikstreifen an seiner Tür aus den Halterungen, dann tat er dasselbe an der anderen Tür. Einige Sekunden später hatteerdieStreifenausgetauscht.JetztschliefinZimmerneun jemand, der Alex Rider hieß. Die Tür zu Zimmer acht stand offen, und Paul Drevin war nicht da.
Alex lief in sein Zimmer, riss den Schrank auf und griff nachHemdundJeans.Erwusste,esreichtenicht,wasergetan hatte.WenndieMännersichdieTürenetwasgenaueransahen, würden sie den Trick durchschauen, weil die Reihenfolgejetztnichtmehrstimmte:sechs,sieben,neun,acht,zehn. Alex musste dafür sorgen, dass ihnen für solche Untersuchungen keine Zeit blieb.
Er musste sie weglocken.
Alex wagte es nicht, sich in Sichtweite des Aufzugs umzuziehen,sonderneiltemitdenKleidernanderSchwesternstation vorbei, weg von den beiden Zimmern, bis er zu einem Flur gelangte, der rechtwinklig von dem Korridor abzweigte. Nach zwanzig Metern kam er zu einer Pendeltür, hinter der einezweiteTreppewar.AneinerSeitedesFlursstandeinoffenerVorratsschrankunddanebeneinRollwagenmiteinem medizinischen Apparat: ein flacher Kasten mit vielen Knöp-fen und einem schmalen rechteckigen Monitor, der wie zerquetscht aussah. Alex erkannte den Apparat wieder. Daneben standen zwei Sauerstoffflaschen. Sein Herz hämmerte unter dem Brustverband. Die Stille im Krankenhaus machte ihn fertig. Wie viel Zeit wohl seit dem Mord an Conor vergangen war?
Hastig zog er den Schlafanzug aus und stieg in seine Sachen. Gutes Gefühl, nach zehn langen Tagen und Nächten wieder richtig angezogen zu sein. Jetzt war er kein Patient mehr. Allmählich holte er sich sein Leben zurück.
Die Aufzugstür glitt auf und störte mit ihrem metallischen Rasseln die Stille der Nacht. Die vier Männer kamen heraus. Zwei Schwarze, zwei Weiße. Ihre koordinierten Bewegungen ließen erkennen, dass sie ein eingespieltes Team waren. Alex taxierte sie und ordnete ihnen in Gedanken Namen nach ihrer äußeren Erscheinung zu. Der Mann in der Militärjacke, der Conor erschossen hatte, war der Anführer. Er hatte eine gebrochene Nase, die sein Gesicht irgendwie schief wirken ließ, als betrachte man es in einem gesprungenen Spiegel. Alex nannte ihn »Boxer«. Der nächste war sehr dünn, hatte zerfurchte Wangen und eine orange getönte Sonnenbrille. Ihn taufte er einfach »Brille«. Der dritte hieß für Alex »Pitbull«, denn er war klein und bullig und verbrachte offenbar viel Zeit beim Krafttraining. Der letzte war unrasiert und hatte struppige schwarze Haare. Er musste mal bei einem schlechten Zahnarztgewesensein,derihmeinsichtbaresAndenkenhinterlassen hatte. Den nannte er »Silberzahn«.
Ungeduldig nach der langen Warterei im Fahrstuhl, bewegten die vier sich sehr schnell. Jetzt war die Stunde der Wahrheit gekommen.
Boxer bemerkte die offene Tür und das leere Bett dahinter. Er las den Namen. In diesem Augenblick trat Alex auf den Flur, als komme er von der Toilette auf sein Zimmer zurück. Er blieb stehen und erschrak hörbar. Die Männer starrten ihn an. Und kamen sofort zu dem Schluss, zu dem Alex sie hatte verleiten wollen. Es war egal, ob sie wussten, wie ihr Opfer aussah – bei der schummrigen Beleuchtung konnten sie sein Gesicht sowieso nicht sehen. Er war Paul Drevin. Wer denn sonst?
»Paul?« Boxer sagte nur dieses eine Wort.
Alex nickte.
»Wir tun dir nichts. Aber du musst mit uns kommen.«
Alex machte einen Schritt zurück.
Boxer zog die Pistole. Dieselbe, mit der er den Nachtpförtner erschossen hatte.
Alex drehte sich um und rannte los.
Als seine nackten Füße über den Teppichboden jagten, fürchtete er, er sei zu spät losgelaufen, und gleich würde ihm eine Kugel zwischen die Schulterblätter fahren. Aber schon hatte er den Nebengang erreicht und bog um die Ecke. Jetzt war er wenigstens außer Sicht.
Die Männer reagierten ziemlich langsam. Damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet. Paul Drevin hätte im Bett liegen und schlafen sollen. Aber er hatte sie gesehen. Er war weggelaufen. Und dann stürmten sie plötzlich los. Sie bogen in den Gang und sahen die Pendeltür, die gerade zuschwang. OffenbarwarderJungedahindurchentwischt.Boxerliefvoran,die anderen hinterher. Keiner achtete auf den Vorratsschrank zu ihrer Linken.
Boxer stieß die Tür auf; Pitbull und Brille folgten. Silberzahn blieb zurück – und jetzt trat Alex in Aktion.
Er war ans Ende des Flurs gelaufen, hatte die Pendeltür aufgestoßen und sich dann in dem Vorratsschrank versteckt. JetztkamerdortherausundschlichsichaufZehenspitzenvon hinten an Silberzahn heran. In jeder Hand hielt er eine kreisrunde gepolsterte Scheibe, von der jeweils ein Stromkabel zu dem Apparat auf dem Rollwagen führte.
Dieser Apparat war ein Lifepak-300-Defibrillator, der zur Standardausrüstung der meisten britischen Krankenhäuser gehörte. Alex kannte diese Defibrillatoren aus den Krankenhausserien im Fernsehen und wusste daher, wozu man sie brauchte und wie sie funktionierten. Wenn einem Patienten dasHerzstehenblieb,drückteihmderArztdieseScheiben,die sogenannten Pads, auf die Brust und versuchte ihn mit einem Stromschlag wieder ins Leben zurückzuholen. Alex hatte den Defibrillator noch schnell angeschlossen, bevor der Aufzug angekommenwar.SoeinGerätmusseinfachzubedienenund aufderStelleeinsatzbereitsein;dieBatteriensindimmervollgeladen. Er biss die Zähne zusammen, presste dem Mann vor ihm die Pads an den Hals und drückte auf die Knöpfe.
Silberzahn schrie auf und sprang hoch in die Luft, als der Strom durch seinen Körper fuhr. Er war bewusstlos, noch ehe er auf dem Boden aufschlug.
WiederschwangdieTürauf:BrillehattedenSchreigehört. Halb geduckt, ein Messer in der Hand, stürzte er in den Gang. Sein Gesicht war wutverzerrt. Irgendetwas war schiefgelaufen. Wie konnte das sein? Warum hatte der Junge nicht geschlafen?
Erkamnichtweit.EinezehnKilogrammschwereSauerstoffflasche krachte ihm mit voller Wucht zwischen die Beine. Sein Gesicht wurde aschgrau und er ließ das Messer fallen. Er rang nach Luft, aber Sauerstoff war für ihn momentannichtzuhaben.MitvorquellendenAugenbracherzusammen.
Alex hatte seine ganze Kraft aufwenden müssen, um dem Mann die Flasche in den Leib zu rammen. Vorsichtig betastete er seine Brust – anscheinend hatten die Nähte gehalten.
Er ließ die beiden bewusstlosen Männer liegen und lief zur Haupttreppe zurück. Hinter sich hörte er die Pendeltür an die Wand krachen, als die beiden anderen ihm nachsetzten. Immerhin hatte er die Zahl seiner Gegner halbiert, trotzdem würdeesabjetztnochschwierigerwerden.Seinezwei





![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
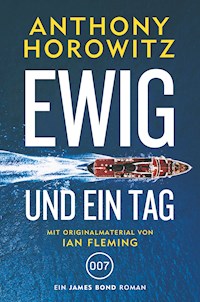

![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)
![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Snakehead [Band 7] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18daaba796e373f6fd5944e2f667ed7b/w200_u90.jpg)