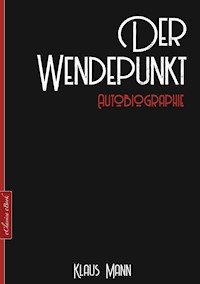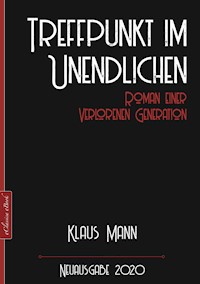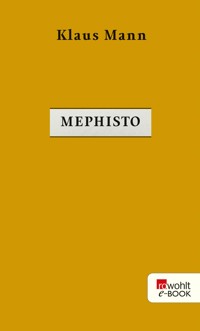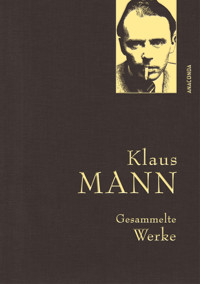4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Klaus Manns "Roman der Utopie" - ein frühes Meisterwerk aus dem Jahr 1929. "Der Mazedonier wollte die Welt nicht nur erobern: Ihm ging es darum, sie zu einen und unter seinem Zepter glücklich zu machen. War es nicht das Goldene Zeitalter, ja das Paradies, was er zu bringen dachte? Welch kindlich kühne, welch göttlich inspirierte Utopie!" So Klaus Mann in seiner Autobiographie "Der Wendepunkt".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus Mann
Alexander
Roman der Utopie
Über dieses Buch
Klaus Manns «Roman der Utopie» – ein frühes Meisterwerk aus dem Jahr 1929. «Der Mazedonier wollte die Welt nicht nur erobern: Ihm ging es darum, sie zu einen und unter seinem Zepter glücklich zu machen. War es nicht das Goldene Zeitalter, ja das Paradies, was er zu bringen dachte? Welch kindlich kühne, welch göttlich inspirierte Utopie!» So Klaus Mann in seiner Autobiographie «Der Wendepunkt».
Impressum
Die Textfassung der Neuausgabe folgt der Erstausgabe des Romans von 1929
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2019
Copyright © 1983, 2006 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke
Umschlagabbildung Kopf Alexanders des Großen aus dem Mosaik «Die Schlacht von Issos». Pompeji, 2. Hälfte des 2. Jh.v.Chr./Neapel, Museo Nazionale
ISBN 978-3-644-00447-4
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Wie schwierig, etwas zu sein und danach auszusehen. Ich war immer skeptisch gegenüber dem Schönen, das schön aussah, dem Edlen, das edel aussah, dem Großen, das groß aussah, und so fort. Wie die körperliche Anmut, so besteht auch die sittliche in einer gewissen Art, sich unsichtbar zu machen. Man kann sich also denken, mit welchem Bangen ich einen Alexander – einen Alexander den Großen zur Hand nahm. Der Gerechtigkeit halber muß gesagt werden, daß dieser Alexander mit Selbstbewußtsein auftrat; in unserer Zeit der knappgefaßten Bücher war es ein beachtlicher Band. Zudem kam er von Klaus Mann, einem jungen Dichter, dem Begnadung und ein heller Verstand zur Seite gehen, insbesondere aber eine der rühmlichsten Eigenschaften, die auch Thomas Mann, seinen Vater, auszeichnet: zu wissen, daß in den großen Dingen nicht immer Größe wohnt. Ein kleiner Junge, der auf einem kleinen Gitter schaukelt, kann uns stärker bewegen als der Aufzug des Parsifal.
Die Größe Thomas Manns als Vater und Berühmtheit umstrahlt Klaus Mann mit einem sehr milden Heiligenschein (einem Kinderreifen aus Licht sozusagen) und bewahrt ihn vor den Fallstricken des Bösen.
Alexander! In der höheren Schule war das ein Modell in der Zeichenstunde, ein Gipsprofil, ein gipsernes Auge, Lokken aus Gips, und diese Nasenflügel, diese Lippen – kalte Vexierbilder, in die der Schüler flugs ein sich bäumendes Pferd hineinsah. Dieses Profil hatte für mich Leben gewonnen, hatte sich mir schon zu drei Vierteln zugewandt, als ich durch das Handbuch – so stellte es sich äußerlich dar – der Princesse Bibesco mit «Alexander dem Asiaten» Bekanntschaft geschlossen hatte. Es erschien mir wirklich als eine Art Handbuch, und zwar wegen seines Formats, seines biegsamen Ledereinbands, seines Signets und der Firma Larousse. Dieser orientalische Alexander verwirrte mich, legte mir die Sage wie eine Perle vor, lenkte meinen Geist ins Übermenschliche ab.
Ich verliere die Lust, sobald ich nicht mehr jenes Wahre anwesend fühle, das weder auf Recht noch Gesetz fußt, sondern auf einem geheimen Maßsystem. Bei der Princesse Bibesco schärften sich die Züge der großen unbestimmten Form und wurden schließlich zu einer kleinen wohlausgeprägten und betörenden Angelegenheit, nicht von der Prägung einer Münze, wohl aber vom Umriß einer Blume: ein strammer Heros, gekräuselt wie die Hyazinthe und einen unermeßlichen Duft um sich verbreitend.
Der Alexander aus Gips räumte vor dieser Gestalt von ungeheuerlicher Schönheit das Feld: vor einer wahren Rätselfigur von der Art, wie es die Meisterwerke des Jugendstils sind, deren Ektoplasma dem Mund einer schlummernden Frau zu entströmen scheint.
Hier nun sehen wir, vorgestellt von einem jungen Dichter, der sich, um es noch einmal zu betonen, mit Zeilen und Ziffern und erhabenen Umrissen, nicht aber mit jenem kolossalischen Urnebel der deutschen Sagen vollgesogen hat, das Profil zum erstenmal ganz von vorne. Das Modell en face zu zeichnen: darin besteht die Kühnheit des Künstlers.
Sehen wir nun, wie Klaus Mann die Schatten des Mythos verrückt, wie er ihn uns nahebringt und ihm Fleisch und Blut gibt. Alexander hat zwei Studiengefährten. Einen Gefährten, der auf ihn blickt und den er beherrscht, und einen anderen, auf den er blickt und der ihn beherrscht.
Es gibt Dichter, die sich ihre Kindheit bewahren; andere finden sie wieder. Alle bleiben mitleidlos, hart, verschlossen, erschreckend wie sie. Aber es tut mir leid um Menschen, die auf dieses Paradies der Schulzeit geringschätzig herabsehen, auf diese Schlachten, bei denen ein Schneeball uns für immer zeichnen und für immer die Quellen des Herzens zum Versiegen bringen kann.
Kurzum: Alexander will diesen Gefährten, den nichts in Erstaunen versetzt, überrumpeln, will dieses allzu wache Auge, das ihn beobachtet, einschläfern; und dies wird zum eigentlichen Motiv seines aufreibenden Eroberungszugs, einem Sieg entgegen, der den Sieger immer tiefer in die Einsamkeit hineintreibt. Eine Einsamkeit, die ein klein wenig Fortschritt mit Touristen und Butterbrotpapier überdecken wird.
Was kann ich noch besitzen? fragt sich Alexander, als er am Ende der Welt zu sein wähnt. Man fühlt sich versucht, ihm zu antworten: ein Telefon, eine Armbanduhr, ein Funkgerät. Aber ohne Scheitern gibt es keinen dauerhaften Ruhm. Durch sein Scheitern setzt Christus sich durch. Ihm hilft ein Verräter, die Schlacht zu gewinnen; Napoleon muß sie durch einen Verräter verlieren.
Wie könnte uns dieser Alexander traurig stimmen, da er mit Erfolg so bis obenhin vollgestopft war wie sein Leichnam mit dem Honig der Weiber, die ihn einbalsamierten; dieser Alexander, dem alles zum besten diente, selbst das Schlechteste (sein Urin roch nach Veilchen) – wenn uns nicht Klaus Mann offenbart hätte, daß er schwach war, gefallsüchtig, daß er falsche Wege einschlug, seinen Freund, seinen Zeugen, seinen geliebten Widersacher umbrachte und von diesem Augenblick an die einzige Entschuldigung für seinen Hochmut verlor.
Endlich sehen wir ihn bestraft für das, was ihn verfälscht, bestraft für seine Heirat mit der Königin der Amazonen, bestraft für seine Raubzüge und den Haß, den er erregt, bestraft für den Aufstand der Pagen, bestraft für diese Hetzjagd ins Leere, wo am Ende abermals seine Liebe in der Gestalt eines staunenerregenden und übernatürlichen Wesens vor ihn hintritt und seinen letzten Seufzer belauert, um ihm besser als die Sphinx und mit einem Lachen über seine Verblüffung das Lösungswort des Menschenrätsels und das Ziel des Lebens zu entdecken; ein Wort, das zu schlicht ist, um vom Ohr eines Herrschers vernommen zu werden, ein Ziel, das zu nahe ist, um seine Hand zu locken.
Sehr gern stelle ich dieses Zeugnis einer Freundschaft – ein Zeugnis, wie bloße Bewunderung es niemals zeitigt – diesem Buch voran. Der es schrieb, ist einer meiner Landsleute, will sagen: ein junger Mann, der auf dieser Erde schlecht behaust ist und der geradewegs die Sprache des Herzens spricht.
Jean Cocteau
Dem Andenken von H.S.
dem Engel mit den verbundenen Händen
Aufbruch
I
Es gab die Sonne, verzauberte Tiere und geschwind fließendes Wasser. Von den Tieren wußte Alexander, daß in ihnen die Seelen der Verstorbenen wohnten, man faßte dieses Hündchen, jenen kleinen Esel lieber zärtlich an, vielleicht waren sie der verwandelte Großvater. Auch in den Wellen der Bäche und Gebirgsflüsse wohnten Wesen, die geheimnisvoll waren, dabei so liebenswert, daß man ihnen stundenlang zuhörte, wenn sie scherzten, tanzten, plätscherten. Ähnliche Wesen hausten in den Bäumen und Gebüschen, besonders reizende und kleine in den Blumen, die man deshalb nicht pflücken durfte.
Das Leben war vollkommen schön, solange der Vater sich im Hintergrund hielt. Das tat er meistens, nur bei festlichen Gelegenheiten unterhielt er sich mit dem Kinde, wobei er es auf eine rauhe Art zu necken liebte. Das Kind weinte nicht, es sah den dröhnend lachenden, bärtigen Herrn durchdringend an, aber der merkte nicht, wie haßerfüllt und wie böse.
Alles schien gut, sogar die Schlangen der Mutter, nur der Vater blieb abzulehnen. Warum lachte der Vater so unangenehm, und wenn man nicht mitlachte, wurde er mürrisch? In seiner Nähe roch es nach Schweiß und Alkohol, in der Nähe der Mutter aber nach Kräutern und schönem Haar.
Gut war Leonidas, der sich einen Pädagogen nennen ließ, obwohl er, bestenfalls, ein Wärter war, wenn er sich auch noch so räusperte und blähte; gut auch Landike, die beleibte und asthmatische Amme. Wie sie schwankend einherging, mit herzlichem, erhitztem Gesicht! Bei ihr war es wohnlich, ihr Busen, der sich freundlich hob und senkte, war die Zuflucht, auf die man bauen konnte. Ihre Geschichten waren nicht so wunderbar, wie die der Mutter, aber sie gingen ans Herz. Landike erzählte vom Rebstock aus Gold mit den smaragdenen Trauben, vom goldenen Strom und vom Sonnenquell, von allerlei Abenteuern, Streichen und Narreteien der kleinen und mittleren Götter, an die großen wagte sie sich nicht heran, denn sie war ehrfürchtigen Sinnes.
Aber wenn die Mutter erzählte, versank alle übrige Welt, es blieb nur ihre tiefe, gleichsam grollende Stimme.
Daß Olympias sprach, geschah eigentlich selten, meistens schwieg sie, schaute nur unergründlich unter einer störrisch gesenkten Stirn. Diesem Blick, der unter langen, zugespitzten Wimpern spöttische Tiefe hatte, war eine unheimlich saugende Kraft eigen, er war zugleich schwärmerisch und eiskalt. Sehr beunruhigend war auch ihr Mund, ein großer Mund mit schmalen, stark geschwungenen Lippen, an das Maul eines ruhenden Löwen erinnernd. Das Haar, welches sie halblang trug, war zottig und lockig, auch ihre ungepflegten, schlanken, knochigen Hände hatten etwas Wildes und Raubtierhaftes. Viele hielten die Königin für sehr dumm, andere wieder für geistig gestört. Sie war logischen Erwägungen völlig unzugängig, von einer bis zur Blindheit hartnäckigen Rechthaberei. Da man sie als jähzornig, sogar als brutal kannte, wagte keiner ihr zu widersprechen; mancher, der es trotzdem riskierte, hatte schon ihre feste Hand im Gesicht gespürt, daß es brannte; sogar Philipp kannte diese gutsitzenden Ohrfeigen.
Meistens schwieg sie, saß und grübelte, höchstens murmelte sie düster, daß sie müde sei. Der ganze Hof beriet, mit welchen Mächten sie ihren mitternächtigen Umgang halte. Warum war sie tags so erschöpft? Weil sie nächtens die schlimmsten Geister beschwor und mit ihnen verkehrte. Das war unanständiger, als habe sie mit einem Sterblichen den Philipp betrogen. Ägyptische Priester, babylonische Magier hatten sie in die anrüchigsten Geheimkulte eingeweiht, auch von Orpheus und Dionysos wußte sie entschieden mehr, als schicklich war. Was trieb sie mit den vielen Schlangen, die in Körbchen bei ihrem Bett wohnten? – Darüber war des Gemunkels kein Ende.
Wenn sie gegen Abend guter Laune wurde, ließ sie sich den jungen Prinzen Alexander kommen. Sie küßte und preßte ihn wild, ihm wurde schwindlig, wenn er den bitter betäubenden Geruch ihres Haars atmete. Sie schaute ihn von unten schwärmerisch und spöttisch an, begann dann unvermittelt zu erzählen, wobei sie sich mit kleinen, schreckhaften Gelächtern unterbrach und dazu mit der knochigen Hand planlos zur Stirn fuhr.
Immer wieder mußte sie die Geschichte von Orpheus erzählen, den die Mänaden zerrissen. Sie zerfetzten ihn zu kleinen Stückchen, weil sie ihn liebten und betrunken waren, er aber, seit dem Verluste seiner Eurydike, keine Frauen mehr mochte. Die neun Musen waren es, die seine blutigen Teilchen klagend sammelten und sie auf einem schönen Berg begruben. – Olympias sang mit ihrer grollenden Stimme die Lieder, welche von Orpheus waren, dann wurde ihrem Kinde feierlicher als beim Beten zumut. Sie summte und brummte, wiegte den Kopf mit dem widerspenstigen Haar; wenn Alexander schon weinte, summte und brummte sie immer noch. «Es ist die Harmonie, die dich weinen macht», sagte sie träumerisch-lehrhaft. «So habe ich als Kind über die kreisenden Figuren der Sterne geweint – –.»
Der Geschichte vom Orpheus irgendwie verwandt, aber in seiner Art noch geheimnisvoller, war das ägyptische Märchen vom göttlichen König Osiris, den sein ebenso listiger wie böser Bruder Typhon tötete.Wie er es anstellte, war grausig und kompliziert. Denn er ließ eigens einen Kasten anfertigen, der genau die edlen Maße des Osiris hatte. Daraufhin tat er, als wolle er mit seinen Freunden, unter denen auch der arglose Bruder war, ein Spiel probieren, dessen Sinnlosigkeit hätte auffallen dürfen: jeder der Gesellen nämlich sollte sich in den Kasten legen, bis der sich fand, der am genauesten hineinpasse. Natürlich paßte keiner hinein, nur Osiris, da schlugen sie den Deckel über ihm zu. Sie warfen ihn in den Fluß, die Greulichen, damit seine Leiche in den Ozean fahre. Wo er festgeschwemmt war, am bewaldeten Ufer, fand ihn Isis, seine Geliebte, Schwester und Mutter, die ihn mit aller Innigkeit suchte. Sie pflegte, schmückte, liebkoste den armen Körper ihres süßen Gatten; aber kaum, daß sie ihn allein ließ, um ihr Söhnlein Horus zu sehen, bemächtigte sich der königlichen Leiche Typhon und zerstückelte sie in vierzehn Teile.
Mit der Geschichte des königlichen Gottes Osiris war geheimnisvoll verquickt die des Tammuz, der in Babylon herrlich gewesen war; auch die des schöngewachsenen Adonis, welchen man in Kleinasien kannte. Alle diese vergossen ihr Blut, um alle diese klagte die Mutter-Geliebte, die Isis, Ischtar, Astarte oder Kybele hieß.
«Man soll Gott schlachten», schloß die Königin ihre Märchen mit wollüstiger Grausamkeit, wobei sie schreckhaft lachte und mit der Hand sinnlos zur Stirn fuhr.
Alexander lauschte ihr mit angstvollem Interesse; er träumte schon von den zerstückelten Leibern. Mit tiefer List und Berechnung erweckte die Olympias sein Grauen, seine zähneklappernde Furcht; um so wunderbarer wirkte, was nachkommen sollte. Denn das Zerstückeltwerden des Gottes war die Voraussetzung für das Wunder seiner Auferstehung; der Jammer mußte groß gewesen sein, damit der Jubel unendlich sein durfte.
Hatten die Weiber auch lange um ihren Tammuz Adonis geweint und sich die Brüste geschlagen, er kam wieder, er offenbarte sich ihnen in der zweiten und eigentlichen Lebendigkeit. – Die Handgelenke ihres angstzitternden Sohnes packte Olympias, so starrten sie gemeinsam auf die blutigen Teile des zerfetzten Körpers, die noch etwas zu zucken schienen. Nun begannen sie auch zu weinen, mit den sich wiegenden Klageweibern, sie hatten einen lautlosen, aber inständigen Jammergesang. Mit schon von Tränen erblindeten Augen starrten sie hin, wo in seinem gebenedeiten Blute der Tote lag, sangen, schluchzten, wiegten sich im Tanze. Erst da sie lange geweint und sich geschlagen hatten, wurden sie des Glückes teilhaftig; endlich kam der Verlorene wieder; in großer Glorie stand der Zerstückelte, sein war die Pracht, die Macht und alle Herrlichkeit.
So freute sich alljährlich Demeter, wenn die verlorene Tochter blühend wiederkam. Auch ihre Geschichte erzählte Olympias dem verzauberten Sohn. «Ich bin ihre Priesterin», raunte sie, die Hand verhüllend am Mund, «auf Samothrake habe ich ihr gedient und habe alles erfahren – –»
Sie enthüllte ihrem Kinde, nur ihm, was sie wußte: es war das Mysterium der blutigen Opferung und der Auferstehung im Lichte.
Von welchem Tage an verschwand die graue, schaukelnde Landike in einer zärtlich schattenhaften Dämmerung? Wann wurde es plötzlich klar, daß der stöckelige Herr Leonidas nicht ernst zu nehmen war, daß man lachen durfte, wenn er hüstelte und sich spreizte? – Das Erwachen kam, ohne daß man es merkte, allmählich.
Ein äußerer Einschnitt war die Übersiedelung ins Männerhaus. Das Kind wurde dem erregenden Einfluß der Olympias entzogen, nur noch bei festlichen Gelegenheiten durfte die Mutter es sehen und liebkosen. Allerdings hielt auch Philipp sich vorläufig zurück, er war in politischen Angelegenheiten stark beschäftigt. Zudem interessierten Kinder ihn nicht, er hatte beschlossen, persönlich sich erst dann mit Alexander abzugeben, wenn der Junge fünfzehn Jahre alt sein würde. – Um diese Zeit war er noch nicht ganz dreizehn.
Philipp vertraute seinen griechischen Pädagogen. Es waren wohlgepflegte und gewandte Herren, denen ein geziemendes Lächeln stets zur Verfügung stand. Da er sie hoch bezahlte, dachte der König, sie müßten auch tüchtig sein. Sie versprachen, den Prinzen in die Grundlagen der Mathematik einzuführen, ihm auch etwas Rhetorik und Geschichtskunde beizubringen; sogar das Leierspielen sollte er lernen.
Seine Hoheit wären so begabt, behaupteten die Gutbezahlten schmeichlerisch beim König, daß es selbstverständlich an nichts fehlen könne. Unter sich spöttelten sie über den barbarischen Philipp, der so parvenühaft ihre Kultur anbete; aber diesen, das war nicht zu leugnen, hatten die Götter nun einmal mit einem fatalen, politisch-intriganten Talent gesegnet; davon ließ sich beim Kronprinzen noch nichts spüren, und die griechischen Pädagogen bezweifelten gerne, daß es jemals zum Vorschein käme.
Denn dieser Knabe war entschieden unter seinen Jahren; so viel Zurückhaltung gab es nicht, der mußte unbegabt sein. Zugegeben, daß er nicht ganz ohne Anmut war, aber von einer linkischen Anmut, einer behinderten, die nichts Männliches, nichts Energisches hatte. – Nur seine Augen machten selbst die Pädagogen stutzig. Diese Augen hatten unter hochgewölbten, schwarzen Brauenbögen, die ständig wie emporgezogen wirkten – sogar die Stirn schien leicht in Falten zu liegen –, einen unheimlich erweiterten, hellen, saugenden Blick. Es war der zauberisch eindringliche Blick seiner Mutter, nur gar nicht weich, nächtig, verschwommen, auch eigentlich gar nicht spöttisch; vielmehr scharf, prüfend und von einem stählernen Grau. Leider hatte dieses Grau die beunruhigende Eigenschaft, manchmal ins Schwärzliche und sogar ins Schwärzlich-Violette zu spielen, und zwar so, daß die Farbe des einen Auges sich noch intensiver als die des anderen verdüsterte. Dann bekam das Gesicht dieses fröhlichen und sanften Jungen, der noch stundenlang, freundlich und einsam, mit Blumen oder kleinen Tieren spielte, etwas beinah Furchterweckendes; um den weichen, unfertig süßen Mund spielten Muskeln, die für später das Gefährlichste ahnen ließen. –
Als Freunde und nächster Umgang waren für den Prinzen einige Knaben aus der Hocharistokratie Mazedoniens ausgewählt. Zu diesen gehörten Kleitos und Hephaistion.
Alexander, Kleitos und Hephaistion waren meistens von den übrigen gesondert, nur bei den Mahlzeiten, beim Unterricht, bei den obligatorischen Spielen trafen sie mit ihnen zusammen.
Dabei stand es kompliziert zwischen den dreien oder, genauer gesagt, zwischen Alexander und Kleitos, der sanfte Hephaistion war es, der darunter zu leiden hatte. Während Alexander und Kleitos stumme Kämpfe miteinander auszufechten schienen, verhielt Hephaistion sich neutral vermittelnd, sanft, gefällig und gegen beide mit der gleichen Zärtlichkeit. Sein schönes dunkles Gesicht war etwas zu groß und etwas zu ernst für sein Alter, mit wundervoll gezeichnetem Mund, edler Stirn und einem feierlich guten Blick. Nur die Wangenpartie schien ein wenig zu flächig, nicht ganz ausgefüllt, nicht bis in jeden Muskel belebt. Hephaistion hatte eine rührende und liebenswürdig umständliche Art, sich zu verneigen, er tat es ausführlich, nicht ohne schelmische Grandezza, wobei er ein Lächeln andeutete. Wenn er die Lippen voneinander trennte, schimmerten mit bläulichem Schmelze die Zähne.
Kleitos hingegen schien von beunruhigender Kindlichkeit. In seinen weichen Backen saß fast immer ein Lachen. Seine kleine und gerade Nase, an der Wurzel sehr schmal, verdickte sich babyhaft an der Spitze. In eine niedrige und helle Stirn fiel Haar; unter ebenmäßig schwarz gezogenen, langen Brauen hatten lustige Augen eine lebhafte und irritierend schillernde Sprache.
In den Spielen seiner Phantasie begaben sich die unerhörtesten Dinge. Die Unsterblichen kamen zu ihm, Kleitos feierte Hochzeit mit allen Göttinnen des Olymps. Zwischen Witzen und Lügengeschichten zitierte er Philosophen. Obwohl es nicht zu ihm paßte, wußte er ziemlich viel.
Er haßte es, berührt zu werden, scheute und verachtete Zärtlichkeiten. Als wäre seine Haut überempfindlich, schauerte er zusammen, streichelte einer ihm über das lockere Haar. Er hielt nicht viel von der Wollust, spottete über Alexander und Hephaistion, wenn sie sich ihr ergaben. Die Luft, in der er lebte, war reiner als die, in welcher andere gedeihen. Er war eitel auf seine Schönheit, liebte und bewunderte schwärmerisch sein Bild, wo es ihm aus Spiegeln oder Gewässern entgegentrat; aber er höhnte und mißhandelte die, welche ihn um seiner Schönheit willen liebten.
Glänzend und hart wie ein Edelstein schien sein Selbstvertrauen. Er leistete es sich, über sein Genie und seine begnadete Hübschheit kleine Scherze zu machen, er renommierte, log, fabulierte; er lachte und hatte ungeschickte, planlose kleine Handbewegungen. Dabei spottete er derer, die es wirklich zu etwas gebracht hatten: Antipatros, Parmenion, alle ergrauten Würdenträger und Generale waren Gegenstand seiner unverschämten und geschwinden Redensarten. Ohne nach Anerkennung das Bedürfnis zu haben, freute er sich ganz alleine seiner traumverlorenen Unternehmungslust, die nie etwas tat, immer nur plante und sich lustig machte.
Alexander meinte, daß, mit Kleitos verglichen, er selber problematisch und plump würde. Was sich hinter der eigenen Stirne vorbereitete, war trübe, verschlungen und fragwürdig; aber in Kleitos schien alles zauberhaft geordnet. Wenn Alexander sich die Gedanken des Kleitos vorstellte, wurde ihm eine unvergleichlich liebliche und neiderweckende Vision von geometrisch tänzerischen Figuren, die sich mit spielerischer Klarheit ineinander verschränkten. In ihm aber, in Alexander, rang und kämpfte es finster.
Wenngleich Kleitos, wie Sitte und Taktgefühl es geboten, sehr höflich, sogar demütig gegen den Prinzen tat, glaubte dieser doch immer seinen halb lustigen, halb unerklärlich ernsten Angriff zu spüren. Diesen Angriff zu überwinden, zu gewinnen dies Kind, das in seiner Abgeschlossenheit unerreichbar blieb, wurde der ausschließliche und brennende Ehrgeiz des Alexander. Es kam so weit, daß er sich dabei ertappte, diesem Knaben gegenüber der Werbende zu sein. Hier zu siegen! – Zwei Jahre lang kannte er kein anderes Ziel mehr. Er hatte in seinem Herzen unabänderlich beschlossen: wenn einer mein Lebensgefährte sein kann, so dieser. Ich will nur einen Freund: diesen. Er ist mir vorbestimmt, dachte mit blinder und pathetischer Hartnäckigkeit Alexander. Ich will ihn haben, ich muß ihn haben, es soll mein erster, wichtigster Sieg sein. – Aber Kleitos wich aus.
Melancholisch abseits stand Hephaistion. Er durchschaute mit wehmütiger Deutlichkeit die Situation, begnügte sich schweigend damit, der Dritte zu sein, der vermitteln, ausgleichen konnte. Oft, wenn Alexander nicht mehr weiterwußte, holte er sich bei der immer gleich bereiten Innigkeit des treuen Hephaistion Trost. Der verzichtete, ohne je besessen zu haben. Er wußte, daß es in seinem Leben keinen Menschen außer Alexander geben würde. Aber mit traurigem, geheimem Stolze wußte er auch, daß Alexander ihn brauche, daß er ihm notwendig und unersetzlich sei. –
Alexander trieb es, eine Entscheidung herauszufordern, von der ihm zuinnerst klar war, wie sie ausfallen mußte. So stand er eines Nachts in dem zellenartig engen und kahlen Raum, der des Kleitos Schlafzimmer war. Es war Winter und eisig kalt. Alexander hatte nur ein leichtes Tuch übergeworfen; so stand er an der Türe und zitterte. Kleitos schaute kaum zu ihm hin; er lag ruhig auf dem Rücken, den Blick unverwandt nach der Decke gerichtet.
Dieses Gesicht kannte man beinah nur lachend, um so wunderbarer, es plötzlich todernst zu finden. Vor allem die lustigen Augen hatten sich verändert, die Pupillen schienen weiter und schwärzer geworden. – Alexander, wie gelähmt von Schüchternheit, setzte sich zu ihm an den Rand des Lagers. Kleitos blieb regungslos. «Ich sehe auf einen Punkt», sagte er rauh. «Bis der sich bewegt, warte ich.» «Willst du denn, daß er sich bewegt?» fragte Alexander ihn leise; ihm war, als schaute er, sehr unerlaubterweise, einem tiefgeheimen und verbotenen Spiele zu. «Ich will es nicht», antwortete, ebenso leise, aber viel deutlicher Kleitos. «Ein anderer will es. Einer in mir. Aber ich kenne ihn nicht.» Er schwieg grausam. – Alexander kauerte an seinem Lager, ihm schlugen die Zähne gegeneinander vor Frost. Trotzdem verschlang sein Blick mit einer Zärtlichkeit ohnegleichen dieses steinerne und leere Gemach; das dürftige Lager und auf dem Lager das Kind, dessen Körperumrisse sich unter der dünnen Decke abzeichneten. Da er kein Schweigen ertrug, fragte er schließlich noch einmal: «Bewegt er sich nun?» Er legte sein Gesicht auf das Kissen des Kleitos, so daß sein Haar neben Kleitos’ Wange zu liegen kam. «Du störst mich sehr», sagte Kleitos, ohne ihn anzuschauen.
Unter dieser unbarmherzigen Antwort fuhr Alexander wie unter einem Richtspruch zusammen. Er wußte, daß in diesem Augenblick eine Entscheidung für sein Leben gesprochen worden war. Er glaubte weinen zu dürfen, aber er zitterte nur. Nun wagte er es nicht einmal mehr, den anderen um einen Zipfel seiner Decke zu bitten.
Plötzlich, die Stimme voll Jubel, rief Kleitos: «Sie bewegen sich – oh!» Er erzählte hastig, mit glückstrahlenden Augen: «Ich habe nämlich inzwischen zweie aufs Korn genommen! Wenn sie zusammenstoßen, wird es eine Katastrophe geben! Ich freue mich schon – bums!! Jetzt hat es aber gekracht – –» Er verstummte erschüttert. Wie nach großer Anstrengung schloß er die Augen.
Alexander blieb, wenngleich das natürlichste Würdegefühl forderte, daß er ginge. Sich zu rühren, wagte er nicht mehr, aus Angst, den unerbittlich Schweigenden in seinen Abenteuern zu stören. Er fühlte sich von diesem strengen Träumenden weiter als von einem anderen Stern getrennt. Trotzdem blieb er, er fand die Kraft zum Gehen nicht mehr. Daß jetzt schon alles gleich sei, war sein letzter Gedanke. Freilich wagte er es nicht noch einmal, dem Blick des Kleitos zu begegnen. So begrub er sein Gesicht in den Händen. –
Von dieser Nacht an, in der Kleitos das entscheidende und nicht mehr gutzumachende Wort gesprochen hatte, war es mit dem schwierigen Freundschaftsbund der drei zu Ende. Es war Kleitos, der ausschied.
Alexander veränderte sich schnell. Es war, als holte er sich Kraft aus seiner schmerzlichsten Niederlage. Er wurde selbstbewußter, schöner, härter und elastischer. Nur Hephaistion sah ihn noch weich. Der verstand alles, ohne daß Alexander erzählt hätte. Er war der einzige, in dessen Armen dem Prinzen Alexander das Glück zuteil wurde, weinen zu dürfen.
Ein paar Wochen später war Alexander mit einem Schlage der gefeierte Liebling des Hofes und Mazedoniens. Er hatte seine erste Heldentat vollbracht, indem er, der eben Dreizehnjährige, den jungen und gefährlichen Hengst Bukephalos bezwang.
Da ein allgemeines Gemunkel und Gerede über die schreckliche Wildheit des thessalischen Rosses war, welches, vor seinem eigenen Schatten scheuend, bisher jeden abgeworfen hatte, und sich auch der Kühnste weigerte, es einzureiten, sprang der Knabe auf seinen ungesattelten Rücken.Der Druck seiner Schenkel war so unvergleichlich stark, seine Faust packte so liebevoll und siegesgewiß zu, daß das junge Tier, nachdem es sich kurz aufgebäumt hatte, lustig zu tänzeln, schließlich ruhig zu traben begann.
Das erstemal flatterten Blumen und Bänder um das junge Gesicht des Alexander; das erstemal huldigten ihm die Soldaten. Sie schrien: «Rossebezwinger! Männerbeherrscher!» Er lachte selig verwirrt im Vorüberreiten. Die ganze Hauptstadt redete seinen Namen. Plötzlich fand man auch, wie schön er sei. «Er hat den Bukephalos, den Wilden, bezwungen und ist dreizehn Jahre, der Schöne!» riefen die Weiber sich zu; und die Männer dachten an Mazedoniens Zukunft. Man erzählte sich, daß König Philipp vor Glück geweint haben sollte.
Unter den Winkenden stand Hephaistion, mit verklärten Augen. Aber abseits, im Hintergrund, Kleitos, ihn entdeckte Alexander gleich in der wogenden Menge. Er stand nachlässig da, den Bauch etwas vorgestreckt, mit hängenden Armen. Es schien, daß er lächelte, aber man wußte nicht, wie.
Auf seinem Bukephalos Alexander, dem die Menge um seiner Anmut willen zujubelte, empfand sich plötzlich als unschön und plump, inmitten seines Triumphes.
II
Dem Aristoteles, der als Pädagoge nach Pella kam, ging ein großer Ruf aus Griechenland voraus. Um so angenehmer berührte es, in ihm einen vollendeten Hofmann zu finden, er hatte immer das passende Lächeln und das verbindliche Wort. Man wußte, daß er schon an verschiedenen Fürstenhöfen tätig gewesen war; sein Vater, Nikomachos aus Stagiros, sogar schon am Hofe zu Pella, und zwar als Leibarzt des mazedonischen Königs Amyntas.
Philipp selber machte ihn mit seinem Sohne bekannt. Er tat es auf eine umständliche, sogar etwas verlegene Art: «Dein neuer Mentor, mein Kind», wobei er unangebracht lachte. Dem Aristoteles gegenüber erwähnte er sofort die Fresken des Zeuxis, auch einen gewissen Euphraios aus Orea, einen tiefgelehrten Schüler des Plato, von dem er noch nie gesprochen hatte, jetzt aber plötzlich behauptete, er sei jahrelang sein innigster Freund gewesen.
Das dröhnend unsichere Benehmen des Königs übersah mit feinem Mienenspiel Aristoteles, unter mehreren leichten Verneigungen erwähnte er seinerseits etwas von der hochberühmten Kultur Mazedoniens. Nur Alexander im Hintergrund litt. Er hielt den Kopf schräg, kaute an seinen Lippen und bekam finstere Augen. Nun schlug sein Vater dem fremden Gelehrten sogar auf die Schulter, wozu dieser nachsichtig lächelte.
Der Unterricht fand in einem Nymphenhaine bei Myeza, etwa eine Stunde vor Pella, statt; Aristoteles hatte den Garten selbst ausgewählt, er fand ihn passend und hübsch, entfernt vom Trubel der Großstadt und doch bequem zu erreichen. Philipp, dem er dies in eleganter Rede auseinandersetzte, sagte nachher, daß er einsichtig und ein Lebenskünstler sei. Den Vorträgen und Diskussionen wohnten manchmal ausgewählte Kameraden des Prinzen bei – Hephaistion und der brünette Philotas, des Parmenion Sohn, Krateros, Meleagros und Koinos –; manchmal spazierten Lehrer und Schüler allein. Die intimen Unterhaltungen pflegten die ergiebigeren zu werden.
Trafen sie sich morgens auf der schattigen Promenade, verneigte der Prinz sich mit erlesenster Höflichkeit; zwischen ihm und dem Philosophen wurde stets der sorgfältigste Anstand gewahrt, Schüler und Meister überboten einander an gewählter Korrektheit.
Wenn Aristoteles scherzte, lachte Alexander bezaubert, den Kopf leicht im Nacken, mit einem Blick auf den Witzigen, der vor Wärme feucht schimmerte. Sehr artig war es auch, wie Alexander im Lustwandeln ahnte, wenn der Dozierende stehenbleiben wollte; denn diese Angewohnheit hatte Aristoteles, wie viele lehrhafte Menschen: während des Gehens mit erhobenem Zeigefinger und gefalteter Stirn stehenzubleiben, um etwas besonders Wichtiges eindrucksvoll darzulegen. Der feinnervige Schüler kannte seinen Meister schon so genau, daß er immer einige Sekunden früher als dieser selbst seinen Wunsch vorausfühlte und den Schritt verlangsamte, so daß Aristoteles glauben durfte, er bleibe dem launenhaften Prinzen zu Gefallen stehen, nicht etwa aus eigener Schrullenhaftigkeit.
Weniger höflich war der Blick, mit dem der aufmerksame junge Zuhörer den Vortragenden zuweilen ganz kurz, doch um so konzentrierter von der Seite musterte und prüfte. Er studierte mit strenger Genauigkeit das Faltenwerk, das kompliziert die Augen seines Erziehers umspielte, von den Augensäcken abwärts Rinnen und feine Furchen in die mager-braunen fleischlos hautigen Wangen grub, den schlaffen, aber erregten Mund mit den bläulichen Lippen neckisch-unberechenbar umspielte. Alexander kannte dieses immer wieder belauerte Gesicht nun schon unanständig genau, er schämte sich oft selber, wie genau er es kannte: dieses dunkle, faltige Gesicht mit dem weißen Barte, in dem sich der ausgeleierte, immer noch angespannte Mund bläulich bewegte, die scharfen, hellgrauen Augen mit reizbaren Lidern, kurzsichtig oder nervös zusammengekniffen, die bedeutend gefurchte, ruhelos arbeitende Stirn; auf dem grauen Gewand die großen, mageren und behaarten Hände, faltig, braun und geistreich, wie das alte Gesicht, mit großen, runden, hellen Fingernägeln, von denen man den Eindruck hatte, daß sie locker saßen, ausfallen konnten, wie die Zähne der Greise. – Alexander kannte viel zu genau diesen runzligen und langen Zeigefinger, der sich lehrhaft hob, müde schwankte, zu frieren schien, eindringlich wackelte, plötzlich niedersank, wie abgestorben.
Alexander fragte, er wollte wissen und bekam niemals genug. «Ihre Neugierde ist unersättlich», sagte der Erzieher sanft tadelnd, doch zärtlich; um Augen und Lippen spielte nachsichtig das Fältchenwerk. Dann noch einmal, verändert, ganz ernst, mit einem stählern gesammelten, eisgrauen Blick, mitten ins wartende Gesicht des Knaben an seiner Seite, in der gedämpften Stimme Angst und Bewunderung: «Ihre Neugierde ist unersättlich, so wahr die Götter mir helfen.»
Alexander, ohne zu zucken, ertrug den Blick, der durchbohrte. Er erkundigte sich unbefangen weiter nach den Dingen, die ihn interessierten, verlangte Auskünfte, bat um Belehrungen, schmeichelte und warb, kokettierte und lockte. Ihn nochmals anzusehen, hütete sich Aristoteles; um so verführerischer kam die Stimme des Knaben, süß verschleiert, matt silbrig; plötzlich klirrend hell, aufleuchtend, wie wenn Licht durch eine schöne Dämmerung dringt. Wandte der Meister sich, durch das Wunder dieser Stimme verleitet, und sah doch wieder hin, so erschrak er über das Gesicht, das sich ihm Antwort heischend, dabei spöttisch, entgegenhielt. Dieses Gesicht wollte wissen, es wollte maßlos viel, unermeßlich viel wissen. Es bestand darauf, hier war nicht zu spaßen.
So trug Aristoteles vor, formulierte, erklärte. Er sprach von der Kunst der Rhetorik, ihren Aufgaben, Möglichkeiten, Gefahren; an Beispielen erklärte und kritisierte er Stil und Manier der großen griechischen Redner, der klassischen sowohl als der modernen; einige tadelte er, auf andere wies er mit erhobenem Zeigefinger lobend hin. Schlecht war alle Rhetorik, welche spielerischer Selbstzweck wurde, von der Sophistik dachte er gering. In Athen hatte sich ein Wortgewandter, aus Freude am Paradox, dazu verleiten lassen, einen Vortrag dem «Lob der Mäuse» zu widmen; derlei Späße fand der Philosoph verächtlich. Als letzten klassischen Rhetor nannte er den Isokrates, der übrigens ein besonderer Verehrer des Philipp war.
Er definierte den Begriff der Poesie, gab, an Hand von Zitaten, die oft zu Deklamationen wurden, ihre wesentlichsten Gesetze. Trug er aus dem Homer oder aus den großen Tragikern vor, fand Alexander, daß ein Schauspieler an ihm verlorengegangen sei. Er bekam hitzige Wangen und erregte Augen, ließ die Stimme dröhnen und säuseln. Ohne daß der Prinz wußte warum, sank der Lehrer während solcher Augenblicke in seiner Achtung.
Er suchte die Anatomie des menschlichen Körpers zu erklären, auch die Gesetze seines Innenlebens, was er Psychologie nannte. Er ging zu den Tieren über, die er in Familien einteilte. Erst behandelte er diese übersichtlich, im großen und ganzen, später ging er unerbittlich auf Details ein, indem er Eigenarten, Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse aller Lebewesen, so ausführlich er’s wußte, beschrieb. Alexander hörte von den Gewohnheiten des Einsiedlerkrebses und des Wüstenlöwen; schließlich versuchte Aristoteles sogar über die Psychologie der Tiere Auskunft zu geben; hierbei versagte er etwas.
Er dozierte über Gesteine, Blumen und Baumsorten; dann hielt er beim Mysterium der Natur im allgemeinen. Er begeisterte sich und blieb häufig im Wandelgang stehen, da er den geheimnisvollen Vorgang der chemikalischen Verbindungen und Auflösungen beschrieb. «Man sollte niemals sagen ‹Entstehen›, stets nur ‹Sich-Zusammensetzen›, verlangte er beinahe ärgerlich. «Auch niemals ‹Vergehen›, immer nur ‹Sich-Auflösen›. Es gibt kein Vergehen: es verändern sich Zustände. – Dieses hat übrigens Anaxagoras schon gelehrt.»
Auf Anaxagoras kam er gerne zurück. «Dieser ist mein Vorläufer», pflegte er gewichtig zu sagen. «Er hat erkannt, daß das Weltall eine Einheit bilde und daß die Stoffe, aus denen es besteht, nicht voneinander getrennt sind oder wie mit dem Beil abgehauen, weder das Warme vom Kalten, noch das Kalte vom Warmen.»
Das waren Stellen, bei denen er im Wandeln stehenblieb, was Alexander feinnervig vorauswußte. «Hören Sie, Prinz? Es gibt keine Möglichkeit, daß etwas für sich gesondert existiert, alles trägt einen Teil von allem in sich.» Und dann, mit einem Pathos, das er selten hatte: «Nur der Geist – der Geist, Alexander, ist etwas Einfaches, sein eigener Herr und mit keinem Dinge vermischt.» Der alte Liebhaber des Geistes, den Kopf seitlich geneigt, erklärte geschmäcklerisch, lüstern: «Denn er, das verstehen Sie wohl, er ist das feinste, reinste und härteste, das unwiderstehlichste, edelste, unersetzbarste von allem.» Er machte eine Pause, ehe er wieder zu promenieren und zu lehren begann.
Er hechelte seine Vorgänger durch, deren erlauchte Reihe er mit Thales von Milet beginnen und mit Plato schließen ließ. Für jeden hatte er, außer der gemessenen Anerkennung, eine trefflich formulierte Bosheit.
Alexander interessierte sich am meisten für den Pythagoras, dessen abenteuerliche und bedeutende Lebensgeschichte er kannte: dieser unruhigste von allen Wahrheitssuchern war über Ägypten, Babylon und Persien bis nach Indien gekommen. Seine Unersättlichkeit erschütterte und faszinierte den Prinzen, er versuchte das auszudrücken.
Aber hier hielt Aristoteles sich die Ohren zu. «Dieser Pythagoras!» jammerte er, dabei ragten seine Ellbogen spitz, gleich zornigen Flügeln, er hatte die Hände an seine großen, innerlich weißbehaarten Ohren gelegt. «Oh, dieser geheimnistuerische alte Schwindler! Sein verabscheuungswürdiger Mangel an Exaktheit, den man leider für Tiefe nahm, hat wahrlich schon zu viele ruiniert. Hüten Sie sich, Prinz Alexander! Wissen Sie nicht, daß Meister Plato gegen Ende, unter dem Einfluß der Zahlenmystik, zugegebenermaßen spleenig war?»
Seine Erregung legte sich lange nicht. Schmerzbewegt, aber grausam verspottete er den Versuch seines großen Lehrers, die Ideenlehre mit den mystisch-orphischen Offenbarungen des verhaßten Pythagoras zu vereinigen. Er nannte diesen den Anti-Griechen und einen unmoralischen Verführer der Geister. Gegen die Lehre von der Seelenwanderung, der Metempsychose, von der Präexistenz und vom Sündenfall, behauptete er, müsse sich jedes intellektuelle Gewissen empören. Seines empörte sich derart, daß er stampfte und schrie.
Darüber lächelte Alexander. Er schwieg höflich, aber er dachte im stillen, daß noch das wenige, was er aus der Geheimlehre des umgetriebenen Pythagoras wußte, ihn mehr verlockte und anzog als das ganze klare und übersichtlich weise System seines schimpfenden Mentors, des Aristoteles.
Der verwahrte sich, immer noch grollend, als habe man ihn persönlich beleidigt, gegen die Vorstellung einer persönlichen Unsterblichkeit. «All das sind unbelegte Faseleien», schloß er gehässig, «was bleibt, ist nichts als das Unteilbare in uns, der Geist, den ich Nous nenne. Dieser aber empfindet nichts mehr, er ist durchaus unpersönlich.»
Schließlich war er bei Speusippos, der als Nachfolger Platos die Akademie leitete und den er den «kleinen Neffen des erhabenen Toten» nannte. «Der hat sich ja nun dieser pseudoägyptischen Dunkelheit endgültig und unrettbar ergeben», konstatierte er bitter, doch triumphierend.
Wenn er auf den armen Speusippos und den jetzigen Zustand der Akademie zu sprechen kam, wurde er gleich besonders giftig; er erwähnte dann gerne die unvergleichlich interessantere Schule, die er selber gründen wolle. Bei solchen Gelegenheiten wandte Alexander, plötzlich gelangweilt, den Blick. Dieser war wieder nur der ehrgeizige Alte, der sich mit dem faden Hofmannslächeln vor König Philipp verneigte. –
Sie saßen, und sie lustwandelten. Es waren auf den schönen Gartenwegen Sonnenfleckchen, die Alexander lustig fand. Sie bewegten sich mit dem im Wind sich bewegenden Laub.