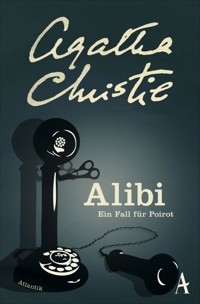
10,99 €
Mehr erfahren.
Roger Ackroyds große Liebe Mrs. Ferrars soll ihren ersten Ehemann ermordet haben. Nun ist sie selber tot, gestorben an einer Überdosis Veronal. War es Selbstmord? Ist sie erpresst worden? In der Zeitung findet Ackroyd einen letzten Hinweis auf die Umstände ihres Todes. Doch bevor er sein Wissen teilen kann, wird er ermordet. Und sein Stiefsohn ist spurlos verschwunden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Agatha Christie
Alibi
Ein Fall für Poirot
Aus dem Englischen von Michael Mundhenk
Atlantik
Für Punkie,
die eine klassische Detektivgeschichte mag, mit Mord und Ermittlungen, bei denen der Verdacht reihum auf jeden fällt!
1Dr. Sheppard am Frühstückstisch
Mrs Ferrars starb in der Nacht vom 16. auf den 17. September, einem Donnerstag. Ich wurde am Freitag, dem 17., um acht Uhr morgens gerufen. Es war nichts mehr zu machen. Sie war bereits seit mehreren Stunden tot.
Kurz nach neun war ich schon wieder zu Hause. Ich schloss die Tür auf und blieb absichtlich ein Weilchen in der Diele, hängte erst einmal meinen Hut und den Mantel auf, den ich mir in weiser Voraussicht gegen die Frische eines frühen Herbstmorgens übergezogen hatte. Ehrlich gesagt war ich ziemlich aufgewühlt und besorgt. Ich will nicht behaupten, dass ich in dem Augenblick schon die Ereignisse der nächsten Wochen voraussah. Das war beileibe nicht der Fall. Allerdings sagte mir mein Instinkt, dass bewegte Zeiten bevorstünden.
Aus dem Esszimmer zu meiner Linken drangen das Klappern von Teetassen sowie das kurze, trockene Husten meiner Schwester Caroline.
»Bist du es, James?«, rief sie.
Eine überflüssige Frage, denn wer sollte es sonst sein? Offen gestanden war einzig und allein meine Schwester Caroline der Grund dafür, dass ich noch einige Augenblicke in der Diele blieb. Das Motto der Mungos, so lehrt uns Mr Kipling, lautet: »Lauf los und find es raus.« Sollte sich Caroline je ein Wappen zulegen, so würde ich definitiv für einen aufgerichteten Mungo plädieren. Den ersten Teil des Mottos könnte man allerdings getrost weglassen. Caroline findet jede Menge heraus, indem sie ganz gemütlich zu Hause sitzt. Ich weiß nicht, wie sie es anstellt, aber sie schafft es. Ich vermute, das Dienstpersonal und die Lieferanten sind ihr privates Nachrichtenkorps. Wenn sie das Haus verlässt, dann nicht, um sich Informationen zu beschaffen, sondern um sie zu verbreiten. Und auch darin ist sie erstaunlich versiert.
Tatsächlich war es der letztgenannte Charakterzug, der zu meinem jähen Zaudern geführt hatte. Was immer ich Caroline jetzt über Mrs Ferrars’ Ableben erzählte, innerhalb von anderthalb Stunden würde es das ganze Dorf wissen. Dabei bin ich von Berufs wegen natürlich auf Diskretion bedacht. Deshalb habe ich mir angewöhnt, meiner Schwester stets sämtliche Informationen so weit wie möglich vorzuenthalten. Meistens findet sie trotzdem alles heraus, doch dann bleibt mir zumindest die moralische Genugtuung zu wissen, dass mich keinerlei Schuld trifft.
Mrs Ferrars’ Gatte ist vor gut einem Jahr gestorben, und seitdem behauptet Caroline ständig, seine Frau habe ihn vergiftet, obwohl diese Behauptung jeder Grundlage entbehrt.
Meine gleichbleibende Antwort, Mr Ferrars sei an akuter Gastritis gestorben, wozu sein notorisch übermäßiger Alkoholgenuss einen Gutteil beigetragen habe, überschüttet sie mit Hohn und Spott. Die Symptome einer Magenschleimhautentzündung und einer Arsenvergiftung sind, das gebe ich zu, nicht unähnlich, doch Carolines Beschuldigung beruht auf gänzlich anderen Überlegungen.
»Man braucht sie sich nur anzusehen«, hörte ich sie des öfteren sagen.
Mrs Ferrars stand zwar nicht mehr in der ersten Jugendblüte, war aber dennoch eine äußerst attraktive Frau, deren zugegebenermaßen schlichte Kleider stets sehr gut saßen, aber schließlich kaufen viele Frauen ihre Kleider in Paris, ohne deshalb zwangsläufig gleich ihre Gatten zu vergiften.
Während mir all diese Dinge durch den Kopf gingen und ich noch immer zögernd in der Diele stand, ertönte Carolines Stimme von neuem, diesmal schon etwas ungehaltener:
»Was in aller Welt machst du eigentlich da draußen, James? Weshalb kommst du nicht rein und frühstückst?«
»Ich komme ja schon, meine Gute«, sagte ich schnell. »Ich habe nur meinen Mantel aufgehängt.«
»In der Zeit hättest du ein halbes Dutzend Mäntel aufhängen können.«
Sie hatte völlig recht. Dafür wäre tatsächlich genügend Zeit gewesen.
Ich betrat das Esszimmer, gab Caroline das übliche Küsschen auf die Wange und widmete mich den Eiern mit Speck. Der Speck war bereits ziemlich kalt.
»Du wurdest heute aber schon früh gerufen«, sagte Caroline.
»Ja«, erwiderte ich. »Nach King’s Paddock. Zu Mrs Ferrars.«
»Ich weiß«, sagte meine Schwester.
»Woher denn?«
»Annie hat’s mir erzählt.«
Annie war unser Hausmädchen. Ein nettes Geschöpf, aber ein unverbesserliches Klatschmaul.
Es entstand eine Pause. Ich beschäftigte mich wieder mit den Eiern und dem Speck. Die Spitze der langen, schmalen Nase meiner Schwester bebte ein wenig, wie immer, wenn sie etwas interessant oder aufregend findet.
»Und?«, fragte sie.
»Eine traurige Angelegenheit. Nichts mehr zu machen. Muss im Schlaf gestorben sein.«
»Ich weiß«, sagte meine Schwester abermals.
Diesmal wurde ich ärgerlich.
»Das kannst du überhaupt nicht wissen«, blaffte ich. »Ich wusste es selbst erst, als ich dort ankam, und ich habe noch keiner Menschenseele davon erzählt. Wenn dieses Mädchen Annie es weiß, muss sie eine Hellseherin sein.«
»Es war nicht Annie, die es mir erzählt hat. Es war der Milchmann. Und der hatte es von der Köchin der Ferrars’.«
Wie gesagt, Caroline hat es nicht nötig, das Haus zu verlassen, um Informationen zu erhalten. Sie sitzt einfach in ihrem Sessel und bekommt sie zugetragen.
Meine Schwester fuhr fort:
»Woran ist sie denn gestorben? An Herzversagen?«
»Das hat dir der Milchmann nicht erzählt?«, fragte ich sarkastisch.
An Caroline ist jedoch jeglicher Sarkasmus verschwendet. Sie nimmt ihn ernst und antwortet dementsprechend.
»Er wusste es nicht«, erklärte sie.
Nun, früher oder später würde Caroline es ohnehin erfahren. Da konnte sie es ebenso gut von mir hören.
»Sie starb an einer Überdosis Veronal. Das nahm sie in letzter Zeit gegen Schlaflosigkeit. Muss wohl zu viel genommen haben.«
»Unsinn«, erwiderte Caroline postwendend. »Das war Absicht. Erzähl mir doch nichts!«
Merkwürdig, wenn jemand ausspricht, was man insgeheim selbst glaubt, aber sich nicht eingestehen möchte, fühlt man sich prompt dazu verleitet, es wütend abzustreiten. Sofort überschüttete ich sie mit einem empörten Wortschwall.
»Jetzt geht das schon wieder los«, sagte ich. »Du quasselst einfach ohne Sinn und Verstand drauflos. Warum in aller Welt sollte Mrs Ferrars Selbstmord verübt haben? Eine relativ junge, wohlhabende und gesunde Witwe, die einfach nur das Leben zu genießen brauchte. Das ist doch absurd.«
»Absolut nicht. Sogar dir dürfte nicht entgangen sein, wie verändert sie in letzter Zeit wirkte. Das fing vor einem halben Jahr an. Sie schien völlig verhärmt. Und du hast selbst gerade zugegeben, dass sie an Schlaflosigkeit litt.«
»Und wie lautet deine Diagnose?«, fragte ich kühl. »Vielleicht eine unglückliche Liebesaffäre?«
Meine Schwester schüttelte den Kopf.
»Reue«, sagte sie mit Verve.
»Reue?«
»Genau. Du wolltest mir ja nie glauben, dass sie ihren Mann vergiftet hat. Jetzt bin ich davon mehr denn je überzeugt.«
»Für mich klingt das nicht sehr logisch«, wandte ich ein. »Wenn eine Frau ein Verbrechen wie einen Mord begangen hat, wäre sie doch wohl sicher auch kaltblütig genug, die Früchte ihrer Tat zu ernten, ohne irgendwelchen sentimentalen Launen wie Reumütigkeit anheimzufallen.«
Caroline schüttelte den Kopf.
»Wahrscheinlich gibt es solche Frauen, aber Mrs Ferrars zählte nicht zu ihnen. Sie war ein einziges Nervenbündel. Ein übermächtiger innerer Drang trieb sie dazu, sich ihres Gatten zu entledigen, denn sie war ein Mensch, der einfach kein Leid ertragen konnte, und es steht außer Frage, dass die Gattin eines Mannes wie Ashley Ferrars einiges zu leiden hatte …«
Ich nickte.
»Und seither ging ihr ihre Tat nicht mehr aus dem Kopf. Ich kann mir nicht helfen, aber sie tut mir wirklich leid.«
Ich glaube nicht, dass Mrs Ferrars Caroline zu Lebzeiten je leidgetan hatte. Doch jetzt, wo sie für immer von uns gegangen ist an einen Ort, wo man Pariser Mode (vermutlich) nicht mehr tragen kann, war Caroline bereit, sanftere Gefühle wie Mitleid und Verständnis zuzulassen.
Ich sagte ihr klipp und klar, dass ihre Hypothese völliger Nonsens sei. Und ich betonte es umso entschiedener, als ich ihr insgeheim zumindest teilweise zustimmte. Aber es geht doch nicht, dass Caroline einfach nur aufgrund irgendwelcher cleveren Vermutungen zur Wahrheit gelangt. So etwas wollte ich nicht noch unterstützen. Dann würde sie nämlich durchs ganze Dorf ziehen und überall ihre Ansichten kundtun, und alle würden denken, sie beruhten auf medizinischen Fakten, die sie von mir hatte. Das Leben ist wirklich anstrengend.
»Unsinn«, gab Caroline auf meine scharfe Kritik zurück. »Du wirst schon sehen. Ich wette zehn zu eins, dass sie einen Brief mit einem umfassenden Geständnis hinterlassen hat.«
»Sie hat überhaupt keinen Brief hinterlassen«, sagte ich schroff, ohne zu merken, in was für eine Situation ich mich mit dieser Bemerkung hineinmanövrierte.
»Oh!«, sagte Caroline. »Du hast dich also tatsächlich danach erkundigt, ja? James, ich glaube, im Grunde deines Herzens denkst du genau dasselbe wie ich. Du alter Gauner.«
»Die Möglichkeit eines Selbstmords muss stets in Erwägung gezogen werden«, erwiderte ich wichtigtuerisch.
»Wird es eine Untersuchung durch den Coroner geben?«
»Kann sein. Kommt darauf an. Wenn ich mich absolut überzeugt davon zeige, dass die Überdosis versehentlich genommen wurde, wird man eventuell auf eine Untersuchung verzichten.«
»Und bist du absolut überzeugt?«, fragte meine Schwester listig.
Ich antwortete nicht, sondern erhob mich vom Tisch.
2Ein Who’s who von King’s Abbot
Bevor ich weiter berichte, was ich zu Caroline sagte und sie zu mir, wäre es vielleicht angebracht, eine Art Ortsbeschreibung zu geben. Unser Dorf King’s Abbot ist vermutlich anderen Dörfern sehr ähnlich. Die nächste Stadt, Cranchester, liegt fünfzehn Kilometer entfernt. Wir haben einen großen Bahnhof, eine kleine Post und zwei miteinander konkurrierende Gemischtwarenläden. Unsere gesunden, arbeitsfähigen Männer neigen dazu, schon in jungen Jahren das Weite zu suchen, aber dafür gibt es hier unzählige ledige Damen und pensionierte Offiziere. Unsere Hobbys und Freizeitbeschäftigungen lassen sich in einem Wort zusammenfassen: Klatsch.
Es gibt in King’s Abbot lediglich zwei bedeutende Anwesen: King’s Paddock, das Mrs Ferrars von ihrem Gatten geerbt hatte, sowie Fernly Park, das Roger Ackroyd gehört. Ackroyd hat mich seit jeher interessiert – so unfassbar es ist, aber er gibt sich noch landjunkerhafter als ein echter Landjunker. Er erinnert mich an einen dieser rotgesichtigen Jäger, die in den mittlerweile angestaubten Singspielen stets zu Beginn des ersten Akts auftraten, der grundsätzlich auf dem Dorfanger spielte. Gewöhnlich sangen sie ein Lied darüber, dass sie nach London fahren würden. Heutzutage gibt es Revuen, und der Landjunker ist musikalisch aus der Mode gekommen.
Natürlich ist Ackroyd kein richtiger Landjunker. Er ist ein ungeheuer erfolgreicher Fabrikant – ich glaube, von Wagenrädern. Er ist fast fünfzig Jahre alt und hat ein rosiges Gesicht und eine joviale Art. Er ist ein Herz und eine Seele mit dem Pfarrer, bedenkt die Gemeindekirche mit großzügigen Spenden (obwohl er Gerüchten zufolge bei persönlichen Ausgaben extrem geizig sein soll), sponsert Kricketspiele, Jungenklubs und Einrichtungen für Kriegsinvaliden. Genau genommen ist er die Seele unseres friedlichen Dörfchens King’s Abbot.
Als Roger Ackroyd ein junger Mann von einundzwanzig Jahren war, verliebte er sich in eine wunderschöne, fünf oder sechs Jahre ältere Frau und heiratete sie. Sie war eine verwitwete Paton und hatte ein Kind. Ihre Ehe war kurz und qualvoll. Um es ganz offen zu sagen, Mrs Ackroyd war eine Quartalssäuferin. Vier Jahre nach ihrer Heirat schaffte sie es, sich mit ihrer Trinkerei unter die Erde zu bringen.
In den darauffolgenden Jahren zeigte Ackroyd keinerlei Neigung, sich auf ein zweites eheliches Abenteuer einzulassen. Der Sohn aus der ersten Ehe seiner Frau war erst sieben Jahre alt, als seine Mutter starb. Jetzt ist er fünfundzwanzig. Ackroyd hat ihn stets als seinen eigenen Sohn betrachtet und ihn entsprechend aufgezogen, aber er war ein Wildfang und bereitete seinem Stiefvater ständig Kummer und Sorgen. Trotzdem mögen wir Ralph Paton hier in King’s Abbot alle sehr. Schon weil er so ein gut aussehender junger Mann ist.
Wie ich bereits erwähnte, gibt es bei uns im Dorf eine ausgeprägte Neigung zum Klatsch. Jeder merkte sofort, dass sich Ackroyd und Mrs Ferrars trefflich verstanden. Nach dem Tod ihres Gatten wurde diese Vertrautheit noch augenfälliger. Man sah sie ständig zusammen, und es wurde offen darüber spekuliert, dass Mrs Ferrars nach Ablauf des Trauerjahrs Mrs Roger Ackroyd werden würde. Eigentlich hielt man das Ganze sogar für eine Art Fügung. Roger Ackroyds Gattin hatte sich bekanntermaßen zu Tode getrunken. Ashley Ferrars war schon Jahre vor seinem Ableben ein Schluckspecht gewesen. Da passte es doch, dass diese beiden Opfer alkoholischer Exzesse jetzt alles, was sie bei ihren ehemaligen Ehepartnern hatten ertragen müssen, aneinander gutmachen könnten.
Die Ferrars’ zogen erst vor gut einem Jahr hierher, doch um Ackroyd hatten sich schon jahrelang Klatschgeschichten gerankt. Während Ralph Paton heranwuchs, stand Ackroyds Haushalt eine Reihe von Haushälterinnen vor, die von Caroline und ihrem Zirkel allesamt mit lebhaftem Argwohn beäugt wurden. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das ganze Dorf seit mindestens fünfzehn Jahren voller Zuversicht erwartete, Ackroyd werde eine seiner Haushälterinnen heiraten. Die derzeitige, die gefürchtete Miss Russell, herrscht dort nun schon seit fünf Jahren unangefochten – doppelt so lange wie alle ihre Vorgängerinnen. Wäre Mrs Ferrars nicht aufgetaucht, so sagt man, hätte sich Ackroyd der Sache diesmal kaum entziehen können. Dazu kam allerdings noch ein weiterer Faktor: die unerwartete Ankunft einer verwitweten Schwägerin samt Tochter aus Kanada. Mrs Cecil Ackroyd, Witwe von Ackroyds nichtsnutzigem jüngeren Bruder, hat sich auf Fernly Park niedergelassen und es Caroline zufolge geschafft, Miss Russell ihren Platz zuzuweisen.
Ich weiß nicht genau, was das für ein »Platz« ist – auf alle Fälle ist er kalt und unangenehm –, aber ich weiß, dass Miss Russell mit zusammengekniffenen Lippen und einem Lächeln umherläuft, das ich nur als verbittert bezeichnen kann, und dass sie mit dem allergrößten Mitgefühl von der »armen Mrs Ackroyd« spricht, »die nun auf die Mildtätigkeit ihres Schwagers angewiesen ist. Das Gnadenbrot schmeckt ja doch bitter, nicht wahr? Ich würde mir jämmerlich vorkommen, wenn ich meinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten könnte.«
Ich habe keine Ahnung, was Mrs Cecil Ackroyd über die Sache mit Ferrars dachte, als sie aufs Tapet kam. Es war eindeutig von Vorteil für sie, wenn Ackroyd unverheiratet blieb. Allerdings war sie stets sehr charmant, um nicht zu sagen überschwänglich, wenn sie Mrs Ferrars begegnete. Caroline meint, das habe weniger als nichts zu bedeuten.
Dies sind die Dinge, die uns hier in King’s Abbot in den letzten Jahren vorrangig beschäftigt haben. Wir haben Ackroyd und seine Angelegenheiten aus allen Perspektiven beleuchtet. Mrs Ferrars hatte ihren festen Platz in diesem Gefüge.
Jetzt war das Kaleidoskop neu geschüttelt worden. Aus zaghaften Gesprächen über mögliche Hochzeitsgeschenke wurden wir mitten in eine Tragödie gerissen.
Diese und diverse andere Dinge gingen mir durch den Kopf, während ich rein mechanisch meine Krankenbesuche absolvierte. Es gab momentan keine besonders schwierigen Fälle, was wohl auch besser so war, denn meine Gedanken kehrten immer wieder zu dem geheimnisvollen Tod von Mrs Ferrars zurück. Hatte sie sich das Leben genommen? Wenn ja, hätte sie doch bestimmt ein paar erklärende Zeilen hinterlassen. Haben Frauen erst einmal den Entschluss zum Selbstmord gefasst, dann wollen sie meiner Erfahrung nach für gewöhnlich auch den Gemütszustand offenlegen, der zu der tödlichen Tat geführt hat. Sie suchen das Rampenlicht.
Wann hatte ich sie das letzte Mal gesehen? Vor mehr als einer Woche. Da war ihr Verhalten so weit ganz normal gewesen, wenn man bedenkt – nun ja, wenn man eben alles andere bedenkt.
Plötzlich fiel mir ein, dass ich sie gestern noch einmal gesehen hatte, ohne allerdings mit ihr gesprochen zu haben. Sie ging mit Ralph Paton spazieren, was mich einigermaßen überrascht hatte, da ich gar nicht wusste, dass er überhaupt noch nach King’s Abbot kam. Ich dachte, er hätte sich schließlich doch mit seinem Stiefvater überworfen. Seit fast einem halben Jahr hatte er sich hier nicht mehr blicken lassen. Die beiden gingen Seite an Seite, die Köpfe zusammengesteckt, und sie redete ausgesprochen ernst auf ihn ein.
Ich glaube mit Sicherheit sagen zu können, dass dies der Augenblick war, wo mich zum ersten Mal eine ungute Vorahnung beschlich. Noch nichts Konkretes, nur eine dunkle Ahnung davon, wie sich die Dinge entwickeln würden. Jetzt stieß mir dieses ernste Tête-à-Tête zwischen Ralph Paton und Mrs Ferrars vom Vortag unangenehm auf.
Während ich noch diesem Gedanken nachhing, stand plötzlich Roger Ackroyd vor mir.
»Sheppard!«, rief er. »Sie kommen wie gerufen. Eine schreckliche Sache.«
»Sie haben es also schon gehört?«
Er nickte. Es war ein harter Schlag für ihn, das sah ich sofort. Seine breiten roten Wangen wirkten eingefallen – dieser für gewöhnlich fröhliche, gesunde Mann war ein einziges Wrack.
»Es ist schlimmer, als Sie denken«, sagte er leise. »Hören Sie, Sheppard, ich muss mit Ihnen reden. Könnten Sie mich nach Hause begleiten?«
»Das ist schlecht. Ich muss noch drei Krankenbesuche machen, und um zwölf habe ich Sprechstunde.«
»Dann am Nachmittag, oder, noch besser, Sie kommen zum Dinner. Um halb acht. Wäre Ihnen das recht?«
»Ja, das lässt sich einrichten. Was ist denn los? Ist irgendetwas mit Ralph?«
Ich wusste gar nicht genau, warum ich das gesagt hatte – vielleicht, weil so oft etwas mit Ralph gewesen war.
Ackroyd starrte mich ausdruckslos, fast verständnislos an. Mir wurde klar, irgendetwas stimmte hier tatsächlich ganz und gar nicht. Ich hatte Ackroyd noch nie so verstört erlebt.
»Mit Ralph?«, sagte er abwesend. »Oh! Nein, mit Ralph ist nichts. Ralph ist in London. Verdammt! Da kommt die alte Miss Gannett. Ich will auf keinen Fall mit ihr über diese grässliche Sache reden müssen. Bis heute Abend, Sheppard. Halb acht.«
Ich nickte und rieb mir, während er davoneilte, verwundert die Augen. Ralph in London? Gestern Nachmittag war er auf jeden Fall in King’s Abbot gewesen. Dann musste er noch am Abend oder heute Morgen in die Stadt zurückgefahren sein, doch Ackroyds Gebaren hatte einen völlig anderen Eindruck hinterlassen. Er hatte geklungen, als wäre Ralph seit Monaten nicht mehr hier gewesen.
Ich hatte nicht länger Zeit, mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Miss Gannett stand vor mir und dürstete nach Informationen. Miss Gannett hat genau die gleichen Eigenschaften wie meine Schwester, ausgenommen die Treffsicherheit, mit der Caroline vorschnelle Schlüsse zieht und die ihren Schachzügen einen Hauch von Größe verleiht. Miss Gannett war außer Atem und voller Wissbegierde.
Sei das nicht traurig mit der armen, teuren Mrs Ferrars? Viele Leute behaupteten ja, sie habe nachweislich jahrelang Drogen genommen. Was für Boshaftigkeiten die Leute so von sich gaben. Das Schlimmste sei jedoch, dass in diesen wilden Behauptungen fast immer irgendwo ein Körnchen Wahrheit stecke. Ohne Feuer kein Rauch! Außerdem heiße es, dass Mr Ackroyd dahintergekommen sei und die Verlobung aufgelöst habe – denn verlobt seien sie auf jeden Fall gewesen. Dafür habe sie, Miss Gannett, eindeutige Beweise. Ich müsse es natürlich eigentlich noch viel genauer wissen – Ärzte wüssten doch immer alles –, aber sie sagten ja nie etwas, nicht?
Und dabei beobachtete sie mich mit Luchsaugen, um zu sehen, wie ich auf diese Andeutungen reagierte. Zum Glück hat mich mein langer Umgang mit Caroline gelehrt, einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren und immer kleine, unverbindliche Bemerkungen parat zu haben.
In diesem Fall beglückwünschte ich Miss Gannett dazu, dass sie sich an diesem boshaften Klatsch nicht beteiligte. Ein ziemlich geschickter Schachzug, fand ich. Er brachte sie in Schwierigkeiten, und ehe sie sich wieder gefangen hatte, war ich bereits auf und davon.
Nachdenklich ging ich nach Hause, wo bereits mehrere Patienten auf mich warteten.
Ich hatte mich gerade, wie ich dachte, von dem letzten verabschiedet und spielte mit dem Gedanken, vor dem Mittagessen noch ein paar Minuten in den Garten zu gehen, als ich noch eine Patientin im Wartezimmer bemerkte. Überrascht sah ich sie an, während sie sich erhob und auf mich zukam.
Ich weiß nicht, woher meine Überraschung rührte, wenn nicht von der Tatsache, dass Miss Russell etwas Eisernes an sich hat, etwas, was sie über körperliche Gebrechen erhaben scheinen lässt.
Ackroyds Haushälterin ist eine hochgewachsene, hübsche Frau, die allerdings unnahbar wirkt. Ihre Augen blicken streng, ihre Lippen sind fest aufeinandergepresst – ich glaube, als Haus- oder Küchenmädchen würde ich, sobald ich sie kommen höre, um mein Leben rennen.
»Guten Morgen, Dr. Sheppard«, sagte Miss Russell. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie einen Blick auf mein Knie werfen würden.«
Ich warf einen Blick darauf, war jedoch hinterher, ehrlich gesagt, nicht sehr viel schlauer als zuvor. Miss Russells Beschreibung eines dumpfen Schmerzes war so unglaubwürdig, dass ich bei einer Frau von weniger Integrität vermutet hätte, sie habe sich die Geschichte ausgedacht. Mir schoss sogar der Gedanke durch den Kopf, dass Miss Russell diese Knieverletzung lediglich erfunden haben könnte, um mich über Mrs Ferrars’ Tod aushorchen zu können, doch merkte ich ziemlich bald, dass ich sie zumindest in der Hinsicht falsch eingeschätzt hatte. Sie erwähnte die Tragödie nur beiläufig, mehr nicht. Allerdings schien sie es ganz offensichtlich darauf abgesehen zu haben, noch eine Weile zu bleiben und zu plaudern.
»Also, vielen Dank für das Fläschchen Franzbranntwein«, sagte sie endlich. »Obwohl ich nicht glaube, dass er mir auch nur im Geringsten helfen wird.«
Ich glaubte es auch nicht, widersprach aber pflichtschuldig. Schließlich konnte er nicht schaden, und man sollte schon mal eine Lanze für seine Arzneimittel brechen.
»Ich halte nicht viel von diesen ganzen Medikamenten«, erklärte Miss Russell und ließ den Blick abschätzig über meine Ansammlung von Fläschchen schweifen. »Drogenstoffe richten eine Menge Unheil an. Nehmen Sie nur die Kokainsucht.«
»Also, was das betrifft …«
»In der höheren Gesellschaft ist sie weit verbreitet.«
Ich bin mir sicher, dass Miss Russell entschieden mehr über die höhere Gesellschaft weiß als ich. Folglich versuchte ich gar nicht erst, ihr zu widersprechen.
»Sagen Sie mir nur eins, Dr. Sheppard«, fuhr Miss Russell fort. »Angenommen, man ist wirklich zum Sklaven einer Droge geworden, kann man dann noch irgendetwas dagegen tun?«
So eine Frage lässt sich nicht auf die Schnelle beantworten. Mithin hielt ich ihr einen kurzen Vortrag zu dem Thema, dem sie aufmerksam folgte. Ich hatte sie immer noch im Verdacht, etwas über Mrs Ferrars in Erfahrung bringen zu wollen.
»Also, Veronal zum Beispiel …«, sagte ich.
Seltsamerweise schien sie Veronal jedoch nicht zu interessieren. Stattdessen wechselte sie das Thema und fragte mich, ob es stimme, dass es Gifte gebe, die so selten seien, dass sie sich nicht nachweisen ließen.
»Aha!«, sagte ich. »Sie haben Detektivgeschichten gelesen.«
Sie räumte es ein.
»Das hervorstechende Merkmal einer Detektivgeschichte ist es«, erklärte ich, »dass ein seltenes Gift darin vorkommt, möglichst eins aus Südamerika, von dem noch nie jemand gehört hat und das ein obskurer wilder Stamm benutzt, um seine Pfeile zu vergiften. Es führt zum sofortigen Tod, und die westliche Wissenschaft kann es nicht nachweisen. Meinen Sie so etwas?«
»Ja. Gibt es so etwas wirklich?«
Bedauernd schüttelte ich den Kopf.
»Leider nicht. Es gibt natürlich Curare.«
Ich erzählte ihr allerlei über Curare, aber sie schien erneut ihr Interesse verloren zu haben. Sie erkundigte sich, ob ich davon etwas in meinem Giftschrank hätte, was ich verneinte, worauf ich vermutlich in ihrer Achtung sank.
Dann meinte sie, sie müsse wieder zurück, und als ich mich an der Tür von ihr verabschiedete, ertönte der Mittagsgong.
Ich hätte nie gedacht, dass Miss Russell eine Schwäche für Detektivgeschichten hat. Die Vorstellung, dass die Haushälterin aus ihrem Zimmer tritt, um ein pflichtvergessenes Dienstmädchen zu rügen, und sich dann wieder in die behagliche Lektüre des Geheimnisvollen siebten Todes oder eines ähnlichen Schmökers vertieft, bereitet mir großes Vergnügen.
3Der Mann, der Kürbisse züchtet
Beim Mittagessen teilte ich Caroline mit, dass ich mein Dinner auf Fernly Park einnehmen würde. Sie hatte nichts dagegen einzuwenden, im Gegenteil.
»Ausgezeichnet«, sagte sie. »Da wirst du ja alles erfahren. Übrigens, was ist eigentlich mit Ralph los?«
»Mit Ralph?«, fragte ich erstaunt. »Gar nichts.«
»Und warum übernachtet er dann in den Three Boars und nicht auf Fernly Park?«
Ich zog Carolines Feststellung, dass Ralph Paton in den Three Boars, dem hiesigen Inn, abgestiegen war, keinen Augenblick in Zweifel. Wenn Caroline es sagte, genügte mir das.
»Ackroyd meinte vorhin, er sei in London«, sagte ich. Ich war in dem Moment so überrascht, dass ich von meinem wertvollen Grundsatz abwich, nie irgendwelche Informationen preiszugeben.
»Oh!«, machte Caroline. Ich sah, wie ihre Nase bebte, während sie das Gehörte verarbeitete.
»Er traf gestern Morgen in den Three Boars ein«, sagte sie. »Und er ist immer noch dort. Gestern Abend war er mit einem Mädchen unterwegs.«
Das überraschte mich nicht im Geringsten. Ich würde sagen, Ralph ist die meisten Abende seines Lebens mit einem Mädchen unterwegs. Allerdings wunderte es mich schon, dass er sich entschieden hatte, diesem Zeitvertreib in King’s Abbot statt in der lebensfrohen Metropole nachzugehen.
»Mit einer der Kellnerinnen?«, fragte ich.
»Nein. Das ist es ja. Er traf sich irgendwo draußen mit ihr. Keine Ahnung, wer das war.«
(Wie bitter für Caroline, so etwas zugeben zu müssen.)
»Aber ich kann es mir denken«, fuhr meine unermüdliche Schwester fort.
Ich wartete geduldig.
»Seine Cousine.«
»Flora Ackroyd?«, rief ich verblüfft aus.
Natürlich ist Flora Ackroyd überhaupt nicht mit Ralph Paton verwandt, aber Ralph gilt schon so lange als Ackroyds richtiger Sohn, dass ihre Verwandtschaft für selbstverständlich gehalten wird.
»Flora Ackroyd«, sagte meine Schwester.
»Aber warum ist er nicht einfach nach Fernly Park gegangen, wenn er sie sehen wollte?«
»Heimlich verlobt«, sagte Caroline voller Genugtuung. »Da der alte Ackroyd nichts davon wissen will, müssen sie sich auf diese Weise treffen.«
Ich sah jede Menge Schwachstellen in Carolines Theorie, verzichtete jedoch darauf, sie ihr aufzuzeigen. Eine unschuldige Bemerkung über unseren neuen Nachbarn bot eine willkommene Ablenkung.
The Larches, das Haus nebenan, wurde vor kurzem von einem Fremden angemietet. Zu Carolines größtem Verdruss hat sie bisher nichts über ihn in Erfahrung bringen können, außer dass er Ausländer ist. Ihr privates Nachrichtenkorps hat sich als unzuverlässig erwiesen. Vermutlich bezieht dieser Mann Milch, Gemüse, Fleisch und einen gelegentlichen Wittling so wie jeder andere auch, doch bisher scheint niemand von denen, deren Aufgabe es ist, diese Dinge auszuliefern, an irgendwelche Informationen gekommen zu sein. Anscheinend lautet sein Name Mr Porrott – ein Name, der ein eigenartiges Gefühl von Unwirklichkeit vermittelt. Das Einzige, was wir über ihn wissen, ist, dass er sich für die Kürbiszucht interessiert.
Allerdings ist das nicht die Art von Information, die Caroline vorschwebt. Sie möchte wissen, woher er kommt, was er beruflich macht, ob er verheiratet ist, was für eine Frau seine Gattin war oder ist, ob er Kinder hat, wie seine Mutter mit Mädchennamen hieß und so weiter und so fort. Ich bin mir sicher, die Fragen nach den Personalien, die ein Reisepass enthält, hat sich ein Seelenverwandter von Caroline ausgedacht.
»Meine liebe Caroline«, sagte ich. »An dem früheren Beruf dieses Herrn besteht überhaupt kein Zweifel. Er ist Friseur im Ruhestand. Sieh dir doch bloß mal seinen Schnurrbart an.«
Caroline widersprach. Sie meinte, wenn dieser Mann Friseur wäre, trüge er gewelltes Haar, kein glattes. Das täten alle Friseure.
Ich nannte ihr mehrere Friseure mit glatten Haaren, die ich persönlich kannte, doch Caroline ließ sich nicht überzeugen.
»Ich werde einfach nicht schlau aus ihm«, sagte sie verstimmt. »Als ich mir neulich ein paar Gartengeräte ausgeliehen habe, war er ausgesprochen höflich, aber ich brachte nichts aus ihm heraus. Schließlich habe ich ihn geradeheraus gefragt, ob er Franzose sei, was er verneinte – und irgendwie wollte ich nicht weiter nachbohren.«
Mein Interesse an unserem mysteriösen Nachbarn stieg zunehmend. Ein Mann, der es schafft, Caroline zum Schweigen zu bringen und sie, wie die Königin von Saba, mit leeren Händen fortzuschicken, muss schon eine ziemlich starke Persönlichkeit sein.
»Ich glaube«, sagte Caroline, »er hat einen von diesen neuen Staubsaugern …«
Der Gedanke, ihn sich auszuleihen und ihm bei der Gelegenheit weitere Fragen zu stellen, ließ ihre Augen aufblitzen. Unversehens bot sich mir die Möglichkeit, in den Garten zu flüchten. Das Gärtnern macht mir Spaß. Gerade war ich damit beschäftigt, den Löwenzahn mit Stumpf und Stiel auszureißen, als ganz in der Nähe ein Warnruf ertönte und ein schwerer Gegenstand an meinem Kopf vorbeisauste und mit einem hässlichen Klatschen vor meinen Füßen landete. Ein Kürbis!
Verärgert blickte ich auf. Über der Mauer zu meiner Linken kam ein Gesicht zum Vorschein. Ein eiförmiger Kopf, teilweise mit verdächtig schwarzem Haar bedeckt, dann zwei enorme Schnurrbärte über zwei wachsamen Augen. Es war unser geheimnisvoller Nachbar, Mr Porrott.
Sofort brach er in wortreiche Entschuldigungen aus.
»Ich frage tausendmal um Pardon, Monsieur. Ich kann nichts zu meiner Verteidigung vorbringen. Seit einigen Monaten züchte ich schon die Kürbisse. Heute Vormittag bringen mich diese Kürbisse plötzlich in Rage. Ich schicke sie auf einen Spaziergang – aber leider nicht nur im Geist, sondern auch in Wirklichkeit. Ich packe den größten. Ich schleudere ihn über die Mauer. Monsieur, ich bin beschämt. Ich werfe mich nieder.«
Angesichts solch überschwänglicher Entschuldigungen schmolz mein Ärger wohl oder übel dahin. Schließlich hatte mich das elende Gemüse ja nicht getroffen. Allerdings hoffte ich von Herzen, es sei kein Hobby von unserem neuen Freund, dickes Gemüse über Mauern zu schleudern. Mit solch einer Angewohnheit würde er sich bei uns als Nachbar kaum beliebt machen.
Der seltsame kleine Mann schien meine Gedanken zu lesen.
»Ah! Nein«, rief er aus. »Beunruhigen Sie sich nicht. Es ist für mich keine Gewohnheit. Aber Sie können sich imaginieren, ja, Monsieur, dass ein Mann unter Umständen auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet, dass er sich müht und plagt, eine bestimmte Art von Freizeit und Beschäftigung zu erreichen, und dann herausfindet, dass er sich am Ende nach dem alten, arbeitsreichen Leben sehnt und nach den alten Tätigkeiten, die er, wie er dachte, freudig hinter sich gelassen hatte?«
»Ja«, antwortete ich langsam. »Ich glaube, das ist ein relativ weit verbreitetes Phänomen. Ich selbst bin vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Vor einem Jahr habe ich eine Erbschaft gemacht – genug, um mir einen Traum erfüllen zu können. Ich wollte schon immer reisen, die Welt sehen. Tja, das war, wie gesagt, vor einem Jahr, und – ich bin immer noch hier.«
Mein kleiner Nachbar nickte.
»Die Fesseln der Gewohnheit. Wir arbeiten, um ein Ziel zu erreichen, und wenn wir das Ziel erreicht haben, merken wir, dass wir die tägliche Schufterei vermissen. Und wohlgemerkt, Monsieur, meine Arbeit war interessante Arbeit. Die interessanteste Arbeit auf der Welt.«
»Ja?«, sagte ich ermunternd. In diesem Augenblick erfüllte mich Carolines wissbegieriger Geist.
»Das Studium der menschlichen Natur, Monsieur!«
»Aha«, erwiderte ich freundlich.
Ganz eindeutig ein Friseur im Ruhestand. Wer kennt die Geheimnisse der menschlichen Natur besser als ein Friseur?
»Außerdem, ich hatte einen Freund – einen Freund, der jahrelang nicht von meiner Seite wich. Manchmal von einer Beschränktheit, die einem Angst machte, aber trotzdem war er mir lieb und teuer. Imaginieren Sie sich, dass ich sogar seine Stupidität vermisse. Seine naïveté, seinen ehrlichen Charakter, das Vergnügen, ihn mit meinem überragenden Talent zu erfreuen und zu überraschen – das alles fehlt mir mehr, als ich sagen kann.«
»Ist er gestorben?«, fragte ich teilnahmsvoll.
»O nein. Er lebt und gedeiht – allerdings am anderen Ende der Welt. Er ist jetzt in Argentinien.«
»In Argentinien«, sagte ich neiderfüllt.
Nach Südamerika wollte ich schon immer einmal. Ich seufzte, und als ich aufblickte, sah ich, dass Mr Porrott mich mitfühlend anblickte. Er schien ein einfühlsamer kleiner Mann zu sein.
»Werden Sie hinfahren, ja?«, fragte er.
Seufzend schüttelte ich den Kopf.
»Ich hätte hinfahren können«, sagte ich. »Vor einem Jahr. Aber ich war töricht, schlimmer als töricht: gierig. Ich riskierte alles, nahm den Schatten für den Körper.«
»Ich verstehe«, sagte Mr Porrott. »Sie haben spekuliert?«
Ich nickte traurig, obwohl ich mich insgeheim unwillkürlich amüsierte. Dieser lächerliche kleine Mann war so unsagbar ernst.
»Doch nicht die Porcupine Oilfields?«, fragte er unvermittelt.
Ich starrte ihn an.
»Die hatte ich tatsächlich in Betracht gezogen, aber zum Schluss entschied ich mich dann doch für eine westaustralische Goldmine.«
Mein Nachbar sah mich mit einem seltsamen Ausdruck an, den ich nicht deuten konnte.
»Das ist eine Fügung des Schicksals«, sagte er schließlich.
»Was ist eine Fügung des Schicksals?«, fragte ich gereizt.
»Dass ich jetzt neben jemand wohne, der ernsthaft die Porcupine Oilfields in Betracht zieht und die West Australian Gold Mines auch. Sagen Sie, haben Sie auch eine Schwäche für rotbraune Haare?«
Ich starrte ihn mit offenem Mund an, und er brach in schallendes Gelächter aus.
»Nein, nein, es ist nicht die Geisteskrankheit, an der ich leide. Machen Sie sich frei von Sorgen. Es war eine dumme Frage, die ich Ihnen da gestellt habe, denn, sehen Sie, mein Freund, von dem ich gesprochen habe, war ein junger Mann, ein Mann, der alle Frauen für gutherzig hielt und die meisten für schön. Aber Sie sind ein Mann in mittleren Jahren, ein Arzt, ein Mann, der die meisten Torheiten und Eitelkeiten dieses unseres Lebens kennt. Soso, wir sind also Nachbarn. Ich bitte Sie, meinen besten Kürbis entgegenzunehmen und Ihrer exzellenten Schwester zu überreichen.«
Er bückte sich und brachte mit einer schwungvollen Bewegung ein enormes Exemplar dieser Gattung zum Vorschein, das ich in gebührender Weise in Empfang nahm.
»In der Tat«, sagte der kleine Mann fröhlich, »das war kein vergeudeter Vormittag. Ich habe die Bekanntschaft eines Mannes gemacht, der auf gewisse Art meinem fernen Freund ähnelt. Übrigens würde ich Sie gern etwas fragen. Sicherlich kennen Sie in diesem winzigen Dorf jeden. Wer ist der junge Mann mit den tiefdunklen Haaren und Augen und dem hübschen Gesicht? Beim Gehen wirft er den Kopf zurück, und auf den Lippen hat er stets ein Lächeln parat.«
Die Beschreibung ließ keinen Zweifel zu.
»Das muss Captain Ralph Paton sein«, sagte ich langsam.
»Ich habe ihn noch nie hier gesehen.«
»Nein, er ist schon eine Weile nicht mehr hier gewesen. Er ist der Sohn, vielmehr der Adoptivsohn, von Mr Ackroyd, dem Herrn von Fernly Park.«
Mein Nachbar machte eine leicht ungeduldige Handbewegung.
»Natürlich, das hätte ich mir denken können. Mr Ackroyd hat oft von ihm gesprochen.«
»Sie kennen Mr Ackroyd?«, fragte ich, ein wenig erstaunt.
»Mr Ackroyd kennt mich aus London, als ich dort gearbeitet habe. Ich habe ihn gebeten, hier nichts über meinen Beruf verlauten zu lassen.«
»Verstehe«, sagte ich und amüsierte mich über seinen, wie ich dachte, unverhohlenen Snobismus.
Doch der kleine Mann fuhr mit einem fast schon großspurigen Grinsen fort:
»Man zieht es vor, inkognito zu bleiben. Ich lege keinen Wert auf Bekanntheit. Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, die hiesige Aussprache meines Namens zu korrigieren.«
»Aha«, sagte ich, weil mir nichts anderes einfiel.
»Captain Ralph Paton«, sinnierte Mr Porrott. »Er ist also mit Mr Ackroyds Nichte, der charmanten Miss Flora, verlobt.«
»Wer hat Ihnen das gesagt?«, fragte ich äußerst überrascht.
»Mr Ackroyd. Vor ungefähr einer Woche. Er freut sich sehr darüber – hat sich so etwas schon lange gewünscht, jedenfalls habe ich ihn so verstanden. Ich glaube sogar, dass er ein wenig Druck auf den jungen Mann ausgeübt hat. Das ist nie gut. Ein junger Mann sollte heiraten, um sich selbst eine Freude zu machen und nicht seinem Stiefvater, von dem er sich etwas erhofft.«
Ich war völlig verwirrt. Mir war nicht klar, wieso Ackroyd einen Friseur ins Vertrauen ziehen und die Hochzeit zwischen seiner Nichte und seinem Stiefsohn mit ihm erörtern sollte. Sicher lässt Ackroyd seine Gunst auch gern den niederen Ständen zukommen, aber deshalb ist er sich trotzdem sehr wohl seiner eigenen Position bewusst. Langsam dämmerte mir, dass Porrott doch kein Friseur sein konnte.
Um meine Verwirrung zu verbergen, sprach ich den ersten Gedanken aus, der mir durch den Kopf schwirrte.
»Wodurch fiel Ralph Paton Ihnen denn auf? Durch sein gutes Aussehen?«
»Nein, nicht nur dadurch, obwohl er für einen Engländer ungewöhnlich gut aussieht – ein griechischer Gott, wie es Ihre Schriftstellerinnen nennen würden. Nein, da war etwas an dem jungen Mann, das ich nicht verstand.«
Den letzten Satz sagte er in einem nachdenklichen Tonfall, der einen rätselhaften Eindruck auf mich machte. Es war, als riefe er sich den Jungen im Licht eines inneren Wissens in Erinnerung, an dem ich nicht teilhatte. Mit diesem Eindruck verließ ich ihn, denn in dem Moment rief mich meine Schwester ins Haus.
Ich ging hinein. Caroline hatte den Hut auf dem Kopf und war offensichtlich gerade aus dem Dorf gekommen. Sie fiel mit der Tür ins Haus.
»Ich bin Mr Ackroyd begegnet.«
»Ja?«, sagte ich.
»Ich sprach ihn natürlich an, aber er schien in großer Eile zu sein und sofort weiterzuwollen.«
Daran hatte ich nicht den geringsten Zweifel. Er hatte Caroline gegenüber sicher das gleiche Gefühl gehegt wie am Vormittag gegenüber Miss Gannett, wenn nicht sogar heftiger. Caroline lässt sich noch schwieriger abschütteln.
»Ich habe ihn sofort nach Ralph gefragt. Er war vollkommen überrascht. Hatte keine Ahnung, dass der Junge hier ist. Er meinte tatsächlich, ich müsse mich getäuscht haben. Ich und mich täuschen!«
»Lächerlich«, sagte ich. »Er sollte dich besser kennen.«
»Dann erzählte er mir, dass Ralph und Flora verlobt seien.«
»Das wusste ich auch schon«, unterbrach ich sie mit leisem Stolz.
»Von wem?«
»Von unserem neuen Nachbarn.«
Einen Moment lang zauderte Caroline sichtlich, so wie sich eine Roulettekugel manchmal nicht zwischen zwei Zahlen entscheiden kann. Dann beschloss sie, nicht anzubeißen.
»Ich teilte Mr Ackroyd mit, dass Ralph in den Three Boars abgestiegen sei.«
»Caroline«, sagte ich, »hast du dir schon einmal überlegt, dass du mit deiner Angewohnheit, alles wahllos weiterzuerzählen, großen Schaden anrichten kannst?«
»Unsinn«, erwiderte meine Schwester. »Die Leute müssen doch wissen, was los ist. Ich halte es für meine Pflicht, es ihnen mitzuteilen. Mr Ackroyd war mir außerordentlich dankbar.«
»Hm«, machte ich, denn das war ganz sicher noch nicht alles.
»Ich glaube, er ging direkt zu den Three Boars, aber dort hätte er Ralph auf keinen Fall angetroffen.«
»Nein?«
»Nein. Denn als ich durch den Wald zurückkam …«
»Durch den Wald?«, unterbrach ich sie.
Zumindest hatte Caroline den Anstand zu erröten.
»Es war so ein wunderschöner Tag«, rief sie aus. »Ich dachte, ich sollte eine kleine Runde drehen. Zu dieser Jahreszeit ist der Wald in seinen Herbsttönen einfach wunderbar.«
Caroline ist der Wald zu sämtlichen Jahreszeiten schnurzegal. Normalerweise ist er für sie ein Ort, wo man nasse Füße bekommt und einem alle möglichen unerquicklichen Dinge auf den Kopf fallen können. Nein, es war der gute alte Mungo-Instinkt, der sie in den hiesigen Wald geführt hatte. Er ist der einzige Ort in der Umgebung von King’s Abbot, wo man sich mit einer jungen Dame unterhalten kann, ohne von sämtlichen Dorfbewohnern gesehen zu werden. Er grenzt an den Park von Fernly.
»Na«, sagte ich, »dann mal weiter im Text.«
»Wie gesagt, ich kam gerade durch den Wald zurück, als ich Stimmen hörte.«
Caroline hielt inne.
»Ja?«
»Eine davon gehörte Ralph Paton, die habe ich sofort erkannt. Die andere gehörte einem Mädchen. Natürlich hatte ich nicht die Absicht zu lauschen …«
»Natürlich nicht«, fuhr ich, deutlich sarkastisch, dazwischen, doch an Caroline ist, wie gesagt, jeglicher Sarkasmus verschwendet.
»Aber es ließ sich einfach nicht verhindern, dass ich alles mithörte. Das Mädchen sagte irgendetwas, was ich nicht genau verstehen konnte, und dann antwortete Ralph. Er klang fürchterlich wütend. ›Meine Liebe‹, sagte er. ›Ist dir nicht klar, dass es durchaus möglich ist, dass der Alte mir keinen müden Shilling vermacht? Seit ein paar Jahren hat er die Faxen dicke mit mir. Die kleinste Kleinigkeit würde das Fass zum Überlaufen bringen. Und wir brauchen die Kröten, Liebling. Wenn der alte Herr abkratzt, werde ich sehr reich sein. Er ist ein absoluter Geizkragen, aber in Wirklichkeit schwimmt er im Geld. Ich habe keine Lust, dass er sein Testament ändert. Überlass das bitte mir, und mach dir keine Sorgen.‹ Das hat er wortwörtlich gesagt. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Leider trat ich in dem Augenblick auf einen trockenen Zweig oder so etwas, und die beiden senkten die Stimmen und verschwanden. Natürlich konnte ich ihnen nicht hinterherrennen, weshalb ich auch nicht gesehen habe, wer das Mädchen war.«
»Das muss ja äußerst ärgerlich gewesen sein«, sagte ich. »Ich vermute allerdings, du bist zu den Three Boars gelaufen, hattest einen Schwächeanfall, gingst auf ein Gläschen Brandy in die Wirtsstube und konntest daher sehen, ob die beiden Kellnerinnen Dienst hatten?«
»Es war keine Kellnerin«, sagte Caroline, ohne zu zögern. »Eigentlich bin ich mir fast sicher, dass es Flora Ackroyd war, nur …«
»Nur ergibt es irgendwie keinen Sinn«, stimmte ich ihr zu.
»Aber wenn es nicht Flora war, wer hätte es dann sein sollen?«
Schnell ging meine Schwester eine Liste von Mädchen aus der Gegend durch, wog detailliert deren Für und Wider ab.
Als sie eine Verschnaufpause einlegte, murmelte ich etwas von einem Patienten und schlüpfte aus dem Zimmer.
Ich hatte die Absicht, zu den Three Boars zu gehen. Es erschien mir wahrscheinlich, dass Ralph Paton inzwischen dorthin zurückgekehrt war.
Ich kannte Ralph sehr gut – vielleicht besser als sonst jemand in King’s Abbot, denn ich hatte schon seine Mutter gekannt und verstand deshalb manches, was die anderen vor ein Rätsel stellte. In gewisser Hinsicht war er ein Opfer seiner Gene. Zwar hatte er nicht den tödlichen Hang seiner Mutter zur Trunksucht geerbt, sehr wohl hingegen eine gewisse Anlage zur Willensschwäche. Ralph war, wie mein neuer Freund von heute Morgen es ausgedrückt hatte, ausgesprochen hübsch. Er war an die eins achtzig groß und wohlproportioniert, besaß die lässige Grazie eines Athleten, hatte dunkle Haare wie seine Mutter und ein hübsches, sonnengebräuntes Gesicht, auf das er jederzeit ein Lächeln zaubern konnte. Ralph Paton war einer jener Menschen, die von Natur aus charmant sind. Er war zügellos und extravagant und ihm war nichts heilig, aber trotzdem war er ein liebenswerter Kerl, und seine Freunde waren ihm alle treu ergeben.
Ob ich aus dem Jungen irgendetwas herausbekommen würde? Ich dachte schon.
Auf meine Nachfrage in den Three Boars erfuhr ich, dass Captain Paton soeben zurückgekommen sei. Ich ging hinauf und trat unangemeldet in sein Zimmer.
Angesichts der Dinge, die ich gehört und gesehen hatte, war ich, was meinen Empfang anging, zunächst skeptisch, doch meine Bedenken waren völlig unnötig.
»Na so was – Sheppard! Freut mich, Sie zu sehen!«
Mit ausgestreckter Hand kam er mir entgegen, während ein sonniges Lächeln sein Gesicht erhellte.
»Der einzige Mensch, den ich in diesem grässlichen Kaff gerne treffe.«
Ich zog die Augenbrauen hoch.
»Was hat dieser Ort Ihnen denn angetan?«
Er lachte gequält auf.
»Das ist eine lange Geschichte. Bei mir läuft es in letzter Zeit nicht so rund, Doctor. Aber wie wär’s erst mal mit einem Schlückchen?«
»Danke«, sagte ich, »gern.«
Er läutete, dann warf er sich in einen Sessel.
»Ich will kein Blatt vor den Mund nehmen«, sagte er trübsinnig. »Ich stecke in einem Mordsschlamassel. Im Prinzip habe ich keinen Schimmer, was ich machen soll.«
»Was ist denn los?«, fragte ich voller Mitgefühl.
»Es hat mit meinem verflixten Stiefvater zu tun.«
»Was hat er denn getan?«
»Es geht nicht darum, was er getan hat, sondern darum, was er aller Wahrscheinlichkeit nach tun wird.«
Der Zimmerkellner erschien, und Ralph bestellte zwei Drinks. Als der Mann wieder gegangen war, sank er in sich zusammen und blickte finster vor sich hin.
»Ist es wirklich – etwas Ernstes?«, fragte ich.
Er nickte.
»Diesmal stecke ich ganz schön tief im Dreck«, sagte er nüchtern.





























