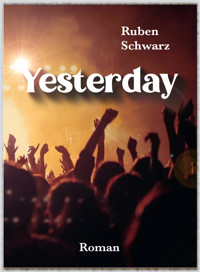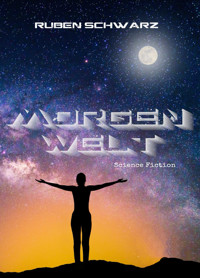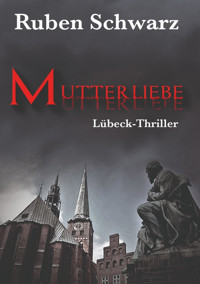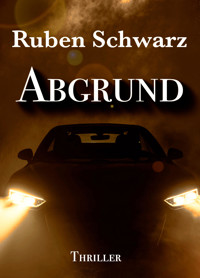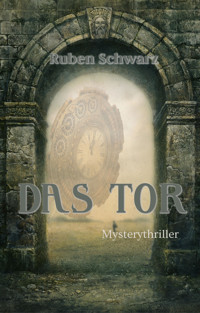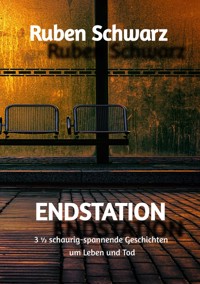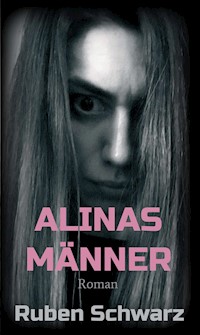
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine mondäne Galeristin, ihr Mann und eine verwöhnte Tochter, ein schwangeres Vergewaltigungsopfer und ihre lesbische Freundin, eine Domina, ihr Haussklave und ihr Enkelsohn, ein Supermarktleiter, der im Nebenberuf seine Frau schlägt, ein Kommissar, der seinen letzten Fall lösen will - Einander völlig fremde Menschen geraten durch das Schicksal in einen unseligen Strudel, der sie gemeinsam in düstere Abgründe zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kaum einer von uns hat es noch nicht erlebt,dass Menschen gegangen sind, die ihm etwas bedeutethaben. Einige davon nach einem langenerfüllten Leben, andere aber auch zu früh.
Diesen Menschen möchte ichdas hier vorliegende Buch widmen.
Captain Picard von der Enterprise hat einmalanlässlich eines solchen Verlustes einen Trinkspruchausgebracht, dem ich mich gerne anschließe:
„Auf fehlende Freunde.“
Ruben Schwarz
ALINAS MÄNNER
Roman
© 2020 Ruben Schwarz
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-03772-4
Hardcover:
978-3-347-03773-1
e-Book:
978-3-347-03774-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
© 2020 Coverfoto Larissa Schwarz
Prolog
„Oh nein!“
„Ja, was denn?“
„Na, der Riesen Hintern, schrecklich.“
„Also, weißt du!“
„Ja, und an den Oberschenkeln, nichts als Zellulitis!“
„Ach komm, Süße, das ist alles natürlich. Und es ist schön so. Wie findest du die Rückenpartie?“
„Ganz toll, diese Rollen. Ich sehe überall Fett!“
„Schau doch mal, die Kurve der Wirbelsäule, die Schatten auf der Haut.“
„Ich weiß ja Liebes, du kannst nur das abbilden, was du siehst. Ich kenne mich ja aus dem Spiegel. DU hast alles richtig gemacht.“
„Süße, du weißt wirklich nicht wie schön du bist, oder? Alles was man da sieht, ist der Inbegriff der Weiblichkeit, wie er seit Jahrhunderten die Künstler inspiriert.“
„Naja, jedenfalls danke ich dir für die schönen langen Haare. Ich hoffe die werden auch in Wirklichkeit wieder so. Wenn ich mir aber den Hängebusen ansehe, und die Speckflügel unter den Oberarmen, ein bisschen netter hättest du da schon sein können.“
„Weißt du, meine Süße, wenn ein Bild wirklich gut werden soll, muss man zunächst ein Auge für Formen und Perspektiven haben. Dann aber muss man versuchen, das abzubilden, was man mit dem Herzen sieht. Ich behaupte nicht, dass ich gut bin. Wahrscheinlich bin ich da ähnlich kritisch mit mir, wie du mit dir. Aber ich finde alle drei Bilder gehören nicht zu meinen Schlechtesten.“
„Aber du bist gut, wirklich gut. Sei nicht böse.“
Das breite, mit grünem Cord bezogene Schlafsofa mit den bunten Wolldecken und Kissen, auf dem die beiden nackten Frauen eng beieinander lagen, stand in einer Ecke des Ateliers, in dem es nach Heu duftete, im Schatten. Das grelle Sonnenlicht fiel fächerartig durch die fast bis zur Decke reichenden Fenster auf drei mittelgroße Gemälde, die in Keilrahmen auf Staffeleien nebeneinanderstanden und deren Farben auf den Leinwänden erst durch die Sonnenstrahlen richtig zur Entfaltung kamen. Alle drei Bilder zeigten dieselbe junge Frau mit langen schwarzen Haaren in unbekleidetem Zustand. Die Frau hatte nicht wirklich rubenssche Körperformen, man musste sie jedoch, gemessen am aktuellen, durch Illustrierte und Fernsehsendungen geprägten Zeitgeschmack, der unablässig auf der Jagd nach den ultimativen Topmodelmaßen war, als mollig bezeichnen.
Die Bilder bestachen durch einen Realismus, der offenbar die Realität zu übertreffen suchte. Das erste Bild von links zeigte die Frau im Porträt. Sie saß vor dem Hintergrund einer altmodischen, mit Grün und Gold gemusterten Tapete, an der ein kleiner ovaler, Bilderrahmen aus Holz hing, welcher in Gold lackiert war und ein Stillleben mit einer Obstschale und einem Steinkrug einfasste. Die langen schwarzen Haare fielen der Frau seitlich von der Stirn auf die Schulter und waren wie ein Schal an einer Seite nach vorne über eine Brust geworfen, die sie fast vollständig verdeckten. Die andere, sichtbare Brust wirkte trotz der jugendlichen Anmutung der Frau mütterlich. Die Haut schimmerte weiß. Ihr Gesicht wirkte auf den aufmerksamen Betrachter ein wenig asiatisch, war ernst und rahmte eine fein geschnittene, schmale Nase ein. Die dunklen Augen blickten verträumt seitlich am Betrachter vorbei und strahlten Ruhe und Zufriedenheit aus.
Das mittlere Bild war ebenfalls ein Akt und zeigte die Frau von Kopf bis Fuß in einem nur von seitlich einfallendem Sonnenlicht beleuchteten Raum. Sie hatte sich leicht vom Betrachter abgewandt und auf die Zehenspitzen gestellt. Beide Arme hatte sie nach oben zu einem Regal ausgestreckt, von dem sie im Begriff war, eine tönerne Vase zu ergreifen. Von ihren Fesseln und Kniekehlen angefangen, bis hinauf zu ihren Achselhöhlen bildete der Körper eine interessante Spielwiese für Licht und Schatten.
Auf dem dritten Bild stand die Frau in einer blaugekachelten Dusche, war vornübergebeugt, und dabei, mit einem Schwamm ihre Beine abzureiben. Die Haare waren nass und fielen lang nach vorne über ihr Gesicht. Jedes Detail, vom Brausekopf am oberen Bildrand, bis zu den perlenden Wassertropfen auf ihrer Haut, war plastisch und klar abgebildet.
Der Kontrast zwischen den beiden Frauen auf dem Sofa hätte kaum größer sein können, aber die Art, wie sie miteinander verschmolzen dalagen, zeigte ein perfekt harmonisches Bild. Britta Röder war sehr schlank, hatte winzige Brüste und trug bis auf wenige Stellen ihres Körpers eine leichte Sommerbräune. Die modische, teilweise lila gefärbte Frisur ließ den Blick frei auf lange Ohrhänger, an deren Enden silberne Nachbildungen von Ginkgoblättern baumelten.
Die andere Frau, Alina Semjonowa, hatte sehr weibliche Rundungen und einen relativ blassen Hauttyp. Die ehemals langen Haare waren annähernd schwarz und kurz geschnitten. Die zierliche Nase entsprach, dank der Kunst der Gesichtschirurgen, exakt dem Porträt, das dort drüben im Sonnenlicht erstrahlte. Sie hatte sich leicht zur Seite gedreht und genoss Brittas Küsse auf ihre Schulter und den Rücken. Britta hatte ein Bein um Alinas Hüfte geschlungen.
„Ich will dich auch malen“, sagte Alina spontan und wandte sich Britta zu. Sie ließ ihre Fingerspitzen langsam über den Hals, die Brust und den Bauch ihrer Freundin gleiten.
„Das muss toll sein, wenn man sowas kann“, fügte sie hinzu, und ihre Augen leuchteten plötzlich vor Begeisterung. „Mit dem Herzen malen…“, schwärmte sie, „wie toll das klingt.“ Sie küsste Brittas Gesicht.
„Klar“, erwiderte die, „ich zeig´s dir. Wir haben doch Zeit, unendlich viel Zeit für uns.“
„Ja“, sagte Alina, drehte sich auf den Rücken und blickte zur Decke, „das haben wir.“
Sie ließ ihre rechte Hand nachdenklich über ihren Bauch gleiten. Das Ergebnis des Schwangerschaftstests hatte sie bisher noch niemandem anvertraut. Auch das hatte Zeit. Aber Britta würde auf jeden Fall die erste sein, mit der sie ihr schönes Geheimnis teilte. Alinas Augen nahmen jenen verträumten Ausdruck an, den ihre Freundin mit dem Herzen eingefangen und dann auf die Leinwand übertragen hatte.
ALINAS MÄNNER
-4 Monate später-
1
Die Art und Weise, mit der die Sache Fahrt aufnahm, war fast schwindelerregend. Offensichtlich hatte sie es jetzt mit echten Profis zu tun. Um Punkt zehn Uhr am Morgen war der dunkelgraue geschlossene Transporter, der auf beiden Seitentüren das gediegene silberne Logo von Severing Wohndesign trug, auf dem Hof vorgefahren.
Britta Röder hatte die beiden Männer in den grauen Overalls eingewiesen, und der Fahrer hatte das Fahrzeug rückwärts bis an den Eingang des Ateliers heranmanövriert. Jetzt waren sie dabei, die bereitgestellten Bilder fachgerecht mit großen Bögen Seidenpapier zu verpacken. Zusätzlich wurden alle Bilder in Luftpolsterfolie gehüllt. Die Männer trugen bei ihrer Arbeit weiße Stoffhandschuhe.
„Na siehst du, die wissen, wie man mit Kunst umgeht“, sagte Phil, der sich zusammen mit seiner Freundin Becky zu Britta gesellt hatte. Der lange dünne Mann mit den imposanten Dreadlocks hatte seinen Arm um die eher kleine mollige Becky mit den lustigen Zöpfen und dem fast bodenlangen, bunten Rock gelegt.
„Ja, voll“, erwiderte Britta.
Noch gestern Nacht hatte sie sich Gedanken darüber gemacht, was während des Verladens mit den Bildern hätte passieren können, wenn es heute Morgen immer noch geregnet hätte. Aber sowohl auf Grund der fachmännischen Verpackung als auch, weil es heute, am Montagmorgen um zehn Uhr bereits über elf Grad warm war und zeitweise die Sonne durch die Wolken lugte, bestand überhaupt keine Gefahr für die empfindliche Leinwand und die Ölfarben.
Es hatte damit begonnen, dass ein paar Tage vor Weihnachten in der Wohnstube des alten Bauernhauses, in dem Britta Röder zusammen mit den anderen Bewohnern der kleinen Landkommune wohnte, der Song Someone like you von Adele ertönt war. Es war die Melodie, die Britta an Ihrem Handy als Klingelton eingespeichert hatte.
Am anderen Ende hatte sich Carla Severing gemeldet und sich als Inhaberin der Galerie Severing vorgestellt. Am Anfang hatte Britta gar nicht verstanden, worauf die Galeristin hinauswollte. Natürlich war ihr die renommierte Gemäldegalerie in der Ernst-Reuter-Allee seit Jahren bekannt, und sie hatte mehr als einmal die ausgestellten Kunstwerke durch die großen Schaufenster bewundert. Bisher hatte sie sich jedoch nicht getraut, das exklusive Ladenlokal zu betreten. Irgendwie hatte sie immer gefunden, dass das ein paar Nummern zu groß für sie war, dass die hier ausgestellten Bilder nicht ihrer Gewichtsklasse entsprachen.
Carla Severing hatte erzählt, sie sei im Frühjahr in Brittas Ausstellung im Foyer der Stadtsparkasse gewesen und habe dort ihren Flyer mitgenommen. Sie würde gerne im Februar des kommenden Jahres, so hatte sie weiter erklärt, mit einer Auswahl von Brittas Werken in ihrer Galerie eine Vernissage veranstalten.
Britta konnte sich gut erinnern, wie sie die Worte von Carla Severing wie durch eine schallschluckende Wand aus Styropor wahrgenommen hatte. Sie hatte ziemlich lange gebraucht, bis sie überhaupt eine Antwort herausgebracht hatte. Zu unglaublich schien ihr, dass das angesehene Kunsthaus, das über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Klang hatte, Interesse an ihren Bildern haben könnte.
Noch zwischen Weihnachten und Neujahr hatte Britta dann die elegante Dame in ihren großen hellen Räumlichkeiten besucht, und sie hatte festgestellt, dass Carla Severing (nennen Sie mich doch Carla) von allen ihren Bildern, die damals in der Stadtsparkasse ausgestellt gewesen waren, Fotos geschossen hatte. Zu jedem einzelnen Bild hatte die Kunsthändlerin sich Notizen gemacht. Die Preise, zu denen die Galeristin Brittas Bilder anbieten wollte, nahmen ihr den Atem. Wenn das klappen sollte, könnte sie der Wohngemeinschaft nicht nur ihren Anteil zur neuen geplanten Pelletheizung beisteuern, sondern diese sogar komplett finanzieren.
Während sie mit Frau Severing sprach, hatte sie sich so leicht gefühlt, als könne sie problemlos vom Boden abheben und zu den LED-Spots an der glänzenden Kunststoffdecke der Galerie emporschweben, wenn sie es nur wirklich wollte.
Am zweiten Januar war Carla Severing dann persönlich auf dem Bauernhof erschienen, um sich weitere Bilder von Britta anzusehen. Gemeinsam hatten sie in der zum Atelier umgebauten ehemaligen Scheune festgelegt, welche Bilder ausgestellt werden sollten, und ein Konzept für zwei unterschiedliche Themenbereiche entworfen. Gleich am kommenden Montag sollten die entsprechenden Gemälde abgeholt werden, die eben in diesem Moment von zwei Männern in grauen Overalls sicher im Wagen verstaut wurden.
Als der Mercedes Sprinter abfuhr und seine Winterreifen knirschend über den mit Kopfsteinen gepflasterten Hof zum Tor rollten, gingen Britta, Becky und Phil ins Haus. Britta wollte gleich nach oben, um nach Alina zu sehen, die sich heute Morgen mit Übelkeit nach dem Frühstück noch einmal ins Bett gelegt hatte.
Als sie die engen, ausgetretenen Holzstiegen erklomm, glühten ihre Wangen vor freudiger Erregung.
2
„Scheiße Mutter, warum nicht?“ Die Stimme von Isabelle Severing klang schrill, und das Wort warum hatte sie unnatürlich gedehnt. Ihre blauen Augen waren zu Schlitzen geschrumpft und versprühten zornige Funken.
„Du weißt es sehr gut, Isa!“ Auch ihre Mutter Carla war in nicht eben deeskalierender Stimmung, und ihre Stimme klang scharf. Mutter nannte Isabelle sie nur, wenn sie ihre Stimmungen hatte. Und die hatte sie leider in letzter Zeit sehr oft.
Isabelle warf ihre lange, weizenblonde Mähne mit einer energischen Kopfbewegung nach hinten und stöckelte wütend in ihr Zimmer. Wer gute Ohren hatte und dazu Isabelle gut kannte, wie zum Beispiel ihre Mutter, dem war das halblaut gezischte „Fick dich“ nicht entgangen, kurz bevor die Mahagonitür mit einem trockenen Knall ins Schloss fiel.
Carla Severing hatte rote Flecke im Gesicht und ihr Busen hob und senkte sich unter schnellen und flachen Atemzügen. Manchmal war ihr danach, diese Tussi zu erwürgen.
Sie lief zur Zimmertür ihrer Tochter, pochte drei Mal heftig dagegen und rief aufgebracht: „Und denk dran, den Stellplatz freizumachen, bevor dein Vater nach Hause kommt!“
Bernd würde zwar erst morgen, am Samstag, aus Köln zurückkommen, aber irgendwie half es ihr ein bisschen herunterzukommen, wenn sie das letzte Wort hatte.
„Lass mich in Ruh!“, kreischte Isabelle durch die Tür, und das letzte Wort ging damit eindeutig an sie.
Carla Severing presste hörbar die Luft aus ihren Lungen und wandte sich ab. Sie ging ins weitläufige Wohnzimmer, nahm die aktuelle Cosmopolitan vom Glastisch und ließ sich wütend auf das weiße Designersofa aus Italien fallen. Sie schlug das Heft auf und schaute sich einen Artikel mit dem Titel „Gleicher Mann – besserer Sex“ an. Mit einer schnellen, fast gewalttätigen Bewegung blätterte sie um, wobei die Seite einriss.
„Coole Sommerkleider für heiße Tage“ wurden auf den beiden Folgeseiten journalistisch aufgearbeitet, und dazu passend wertvolle Tipps für eine „Endlich schöne Haut“ abgegeben.
Sie warf die Illustrierte mit einem Schwung, der heftiger ausfiel als geplant, auf den Glastisch zurück und war froh, dass die teure Tischlampe nur leicht wippte, aber zum Glück nicht umfiel.
Carla Severing war das, was man allgemein als schöne Frau bezeichnet. Die zweiundvierzigjährige Galeristin trug die mittellangen blonden Haare mit einem Seitenscheitel, wobei die längere Seite schräg nach vorn gebürstet war und, wenn sie den Kopf neigte, federnd vor ihre rechte Gesichtshälfte fiel. Das fein geschnittene Gesicht trug in seiner Mitte eine schmale, nicht sehr kleine Nase, und die blauen Augen wirkten zugleich klug und reif. Ihre Figur war schlank, aber fraulich.
Der Ärger über das Verhalten ihrer Tochter nagte noch immer an ihr. Sie stand auf und ging zur Fensterseite, die fast über die ganze Wandbreite und bis zum Boden verglast war. Das riesige Panoramafenster gab den Blick frei über eine weitläufige Dachterrasse hinweg, bis hinunter auf die Stromelbe, den Sülzehafen und den am anderen Ufer gelegenen Rotehorn Park. Letzterer war allerdings wegen der trüben und feuchten Witterung in der Ferne kaum zu erkennen.
Die obere Etage der fünfgeschossigen Stadtvilla hatte ihnen der stellvertretende Leiter der hiesigen Volksbank vermittelt, der Kunde von Severing Wohndesign war. Die drei identischen Häuser in Traumlage, nur durch die schmale Uferstraße vom Fluss getrennt, erlaubten bei besserem Wetter aus den oberen Stockwerken einen unglaublichen Blick weit über den östlichen Teil der Stadt.
Die Luxuswohnung mit ihren über 220 Quadratmetern Wohnfläche hatte dabei sogar nicht einmal vierhunderttausend Euro gekostet. In Hamburg zum Beispiel war solch eine Immobilie nicht unter eineinhalb Millionen zu bekommen.
Carla Severing zuckte zusammen, als im Hausflur wieder eine Tür knallte. Für einen kurzen Moment gab der Rundbogen der offenen Wohnzimmertür den Blick auf eine gertenschlanke und modisch gekleidete Blondine mit langen glatten Haaren frei, deren Oberkörper in eine kurze rote Lederjacke von Valentino gehüllt war und an den Füßen ebenso rote Stöckelschuhe von Manolo Blahnik trug.
Carla holte tief Luft und rief: „Wann warst du eigentlich das letzte Mal bei Horatio im Stall?“ Sie hatte es sich nicht verkneifen können, auf den Trakehner Wallach hinzuweisen, den Isa zu ihrem sechzehnten Geburtstag geschenkt bekommen und ziemlich genau zwei Jahre lang innig geliebt hatte. In letzter Zeit jedoch kümmerte sie sich leider kaum noch um das Pferd, das im Stall des Reitclubs Herrenkrug einquartiert war.
Als Antwort auf Carlas Frage fiel die Wohnungstür, mit kaum weniger Geräuschentwicklung als zuvor die Zimmertür, ins Schloss.
Hoffentlich fährt sie wenigstens den Smart von Bernds Stellplatz, dachte Carla, immer noch mit einem Ruhepuls von deutlich über Hundert.
Den nagelneuen, schneeweißen Smart hatten sie Isabelle zu ihrem bestandenen Abitur geschenkt. Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 hatte sie ohne Probleme den Studienplatz für Medizin bekommen. Umso größer war der Aufruhr im Hause Severing gewesen, als Isabelle den akademischen Pfad von heute auf morgen verlassen, und erklärt hatte, dass sie nun erst einmal ein oder zwei Jahre für sich brauchte, um sich selbst zu finden und ein bisschen zu leben. Chillen war so ein Begriff in dem Zusammenhang, den Carla auf den Tod nicht ausstehen konnte.
Sie hatte den Verdacht, dass Isas Sinneswandel mit diesem Johannes zu tun hatte, mit dem sie in den letzten Monaten viel Zeit in den Clubs verbrachte, und der ebenfalls seinen hauptsächlichen Lebensinhalt darin sah, Sohn wohlhabender Eltern zu sein.
Isabelle Severing war spätestens seit der Oberstufe immer mit reichlich Taschengeld ausgestattet gewesen. Als sie kürzlich jedoch von ihrer Mutter verlangt hatte, ihr einen Zwei-Wochen-Trip auf die Seychellen zu finanzieren, hatte diese entschieden abgelehnt. Nach Carlas Auffassung war Isabelle auf dem besten Wege, eine verwöhnte, nichtsnutzige Faulenzerin zu werden. Und sie hatte Angst davor, dass das Mädchen in ein Milieu aus Kokain- und Designerdrogen konsumierenden Tagedieben abrutschen könnte. Darüber hatte sie erst letzte Woche wieder im Fernsehen eine Reportage gesehen.
Es machte Carla traurig, dass sie im letzten halben Jahr völlig den Zugang zu ihrer Tochter verloren hatte. Davor waren die beiden beinahe so etwas wie beste Freundinnen gewesen, die sogar manchmal ihre Klamotten getauscht hatten.
Auch Carla liebte den Luxus, in dem sie lebte, hatte ein Faible für ausgefallenen Schmuck und teure Designermode. Aber im Gegensatz zu Isa wusste sie, dass man dafür arbeiten musste. In diesem Moment wünschte sie sich, Bernd wäre hier. Sie würde morgen dringend mit ihm über Isa sprechen müssen.
3
Die schlanke junge Frau mit den zum Teil lila gefärbten Haaren hieß Britta Röder. Obwohl sie sich keine sonderliche Mühe gegeben hatte, die zum Atelier umgebaute Scheune leise zu betreten, stellte sie fest, dass Alina ihr Kommen nicht bemerkte. Stattdessen stand diese konzentriert vor der Staffelei und schuf mit einem groben Pinsel und tupfenden Handbewegungen eine düstere und bedrohliche Wolkenformation auf die Leinwand, die im oberen Drittel des Bildes ihren Ursprung genommen hatte, sich nun aber immer weiter in die Bildmitte hinunterarbeitete. Im Vordergrund sah man eine junge Frau in einem sommerlichen Kleid, die auf einem grasbewachsenen Hügel stand und einen bunten Blumenstrauß in der Hand hielt.
Gestern noch hatte die etwa eineinhalb Quadratmeter große Leinwand ein wahres sommerliches Idyll gezeigt. Die dunklen, flächenweise fast schwarzen Gewitterwolken, die inzwischen aufgezogen waren, gaben dem Bild einen völlig anderen Charakter und ließen ahnen, dass die heitere Stimmung in Kürze dramatisch kippen würde.
Britta beobachtete still ihre Freundin und bekam einen traurigen Gesichtsausdruck. Diese Entwicklung nahm in letzter Zeit jedes Bild, das Alina begann. Stets endeten die mit frischem Mut begonnenen, am Anfang freundlichen und nicht untalentierten Malversuche in einer furchteinflößenden, beklemmenden Atmosphäre. Britta war keine Psychologin, aber die Vermutung, dass Alina die Erlebnisse ihrer Vergewaltigung, die gerade mal ein gutes halbes Jahr her war, noch längst nicht überwunden hatte, drängte sich auf. Damals war ein Psychopath in ihre Wohnung eingedrungen und hatte sie über Stunden mit dem Tode bedroht, brutal misshandelt und vergewaltigt.
Die regelmäßige psychologische Betreuung und der Umzug zu Britta und ihren Freunden in die ländliche Wohngemeinschaft hatten ihr damals sehr geholfen. Alina war richtig aufgeblüht, war fröhlich und offen zu jedermann geworden und hatte dann irgendwann die Sitzungen bei ihrer Therapeutin abgebrochen.
Obwohl Alina ihre Probleme oft mit lockeren Sprüchen überspielte, war Britta inzwischen sicher, dass das ein Fehler gewesen war. Außerdem waren in letzter Zeit Alinas Albträume zurückgekommen, die für Monate ganz verschwunden gewesen waren. Mindestens jede dritte Nacht wachte sie stöhnend oder schreiend auf, nachdem sie wieder einmal das Martyrium ihrer Vergewaltigung durchgemacht hatte. Britta nahm sie dann immer in die Arme, bis sie gemeinsam wieder einschlafen konnten.
Zum Malen war Alina durch Britta inspiriert worden, die Kunst studiert, und auf dem Gebiet des Surrealismus und des Fotorealismus schon erste Erfolge erzielt hatte. Seit Kurzem hingen sogar einige Bilder von ihr in der Galerie Severing in der Innenstadt. Darauf war sie besonders stolz. Im Februar würde es dort eine Vernissage geben.
Britta trat von hinten an ihre Freundin heran und umarmte sie. Die nahm den Pinsel von der Leinwand und lehnte ihren Kopf zurück an Brittas Schulter. Britta drückte ihren Mund in Alinas Nacken. „Hallo meine Süße“, flüsterte sie ihr ins Ohr, „das sieht toll aus.“
„Das sagst du nur so“, zweifelte Alina. „Nein wirklich, man hat tatsächlich das Gefühl, man könnte die Windböen vor dem Gewitter spüren. Nur statt dem Blumenstrauß solltest du der Dame lieber einen Schirm in die Hand geben.“
Alina prustete. „Du bist doof!“, schimpfte sie und musste lachen. „Außerdem bist das doch du.“
„Ich weiß doch, Süße“, sagte Britta. Das Gesicht der Frau auf dem Bild war nicht zu erkennen. Dazu stand sie zu weit vom Betrachter entfernt. Aber die Frisur und die Haarfarbe waren ein eindeutiges Indiz.
„Ich liebe dich“, sagte Britta ernst und schlang ihre Arme ganz fest um Alinas Brustkorb. „Ich dich auch“, entgegnete Alina, „aber drück mir bitte nicht die Luft ab.“
„Okay“, stimmte Britta zu und gab Alina noch einen Kuss auf den Hals.
„Huch“, machte die auf einmal, „er strampelt wieder. Fühl mal.“ Britta legte von hinten beide Hände auf Alinas Bauch, der jetzt schon, immerhin im sechsten Monat, eine deutliche Wölbung zeigte. Tatsächlich konnte sie fühlen, wie der Kleine zwei Mal von innen gegen die Begrenzung seines warmen und geschützten Lebensraumes boxte.
„Hast du´s gemerkt?“, fragte Alina begeistert.
„Ja, und ob“, bestätigte Britta, „ganz schön aktiv, das Kerlchen.“
Alina sprach immer von ihm und von dem Kleinen, obwohl die Ultraschallbilder bisher keine eindeutige Auskunft über das Geschlecht des Kindes gegeben hatten. Alina jedoch war so fest davon überzeugt, dass in ihr ein Junge heranwuchs, dass Britta und auch die anderen Mitglieder der Wohngemeinschaft diese Auffassung übernahmen, und inzwischen kaum jemand daran zweifelte, dass es demnächst männlichen Nachwuchs geben würde.
Alina Semjonowa war auch vor ihrer Schwangerschaft schon ein wenig mollig gewesen und hatte jetzt noch ein bisschen zugenommen. Ihre fast pechschwarzen Haare waren schon wieder so lang wie die ihrer Freundin und endeten knapp über den Schultern. Sie stellte den von blauschwarzer Ölfarbe getränkten Pinsel in ein Glas mit Wasser und Farbverdünner, drehte sich zu Britta um und küsste sie lange und intensiv.
Konnte man das Kind eines Vergewaltigers ohne Vorbehalte austragen und lieben? Für Alina Semjonowa, die Tochter russischer Eltern aus Woronesch, war das von Anfang an keine Frage gewesen. Es war schon immer ihr Lebensentwurf gewesen, die große Liebe zu entdecken und mit ihr zusammen mindestens ein Kind großzuziehen. Den einen Teil der Erfüllung hatte sie in Britta gefunden, und der andere Teil war ihr auf ungewöhnliche, wenn auch schmerzhafte Weise, ebenfalls durch das Schicksal zugeführt worden. Für Alina stand außer Zweifel, dass hier ein großer Plan am Werk war, der es am Ende mit ihr gut meinte.
Die Mitbewohner und auch Britta hatten sich am Anfang nicht ganz leicht damit getan, Alinas Entscheidung zu verstehen, das Kind auszutragen. Mittlerweile freuten sich jedoch alle auf den erwarteten Nachwuchs. Schließlich konnte der nichts für die Taten seines Erzeugers.
„Musst du los?“, fragte Alina, nachdem sich die Lippen der beiden Frauen voneinander gelöst hatten. „Ja, ich sollte jetzt wohl. Es hat aufgehört zu regnen. Lenny will auch los.“
„Okay, aber pass auf dich auf, mein Schatz, du weißt, bei den nassen Straßen…“
„Klar, keine Sorge“, unterbrach Britta, „ich bin vorsichtig.“
„Geht das Rücklicht wieder?“, fragte Alina.
„Alles bestens, Phil hat das Kabel repariert.“
Eigentlich war es Alinas und Brittas Plan gewesen, gemeinsam mit dem Auto Brittas Mutter in Magdeburg-Kannenstieg zu besuchen. Allerdings hatte sich herausgestellt, dass Phil sich vom 23. bis 25. Januar für den großen Indoor- Antik- und Trödelmarkt in Halle angemeldet hatte. Er war heute Morgen in aller Frühe mit dem Trabbi abgefahren. In der kalten Jahreszeit gab es ansonsten keine Handwerker- oder Mittelaltermärkte, auf denen er seine Töpferwaren anbieten konnte.
Lenny, der Landmaschinenvertreter, ebenfalls ein Mitbewohner, musste mit dem Corolla, dem anderen der beiden Fahrzeuge der Gemeinschaft, in die Gegend zwischen Neuruppin und Rheinsberg, wo er Termine bei landwirtschaftlichen Großbetrieben ausgemacht hatte. Er hatte angeboten, Britta zusammen mit ihrem Fahrrad in Kannenstieg abzusetzen. Den Rückweg würde sie jedoch dann mit dem Rad bewältigen müssen. Alina hatte wegen ihres Zustandes, was eine Radtour betraf, natürlich passen müssen.
Sie hatte sich daraufhin angeboten, Becky beim Flaschenspülen zu helfen. Die Landkommune in der Nähe von Klein-Wanzleben bestand aus sechs Leuten und betrieb unter anderem Obstanbau. Einen nicht unwesentlichen Teil der Einnahmen bestritten die autodidaktischen Landwirte durch die Herstellung biologischer Säfte.
In einem Schuppen hinter dem Bauernhaus stapelten sich Holzkästen mit leeren Glasflaschen bis unter die Decke, die gespült werden mussten, bevor sie im nächsten Sommer wieder befüllt werden konnten.
„Also mach´s gut meine Schöne“, sagte Britta fröhlich und fasste Alina bei den Händen, „und pass gut auf unseren kleinen Prinzen auf.“
„Mach ich“, versprach Alina und streichelte zärtlich über ihren Bauch. Dann verließ Britta die Scheune. In der Tür drehte sie sich noch einmal um und sagte: „Und male mal ein Bild mit etwas freundlicherem Wetter.“ Dabei lachte sie und spitzte die Lippen zu einem Luftkuss. Dann ging sie hinaus in die kühle Januarluft.
Alina blieb allein in dem provisorischen Atelier zurück. In einer Ecke verbreitete der Heizstrahler mit rötlichem Glühen eine Wärme, die es nie schaffte, jeden Winkel der Scheune zu erreichen. Von der hohen Holzdecke hingen zwei große Lampen in der Form umgedrehter Trichter an langen Ketten herab und beleuchteten mit ihren 100-Watt-Glühbirnen den gepflasterten Steinboden und die Staffelei. Alina wurde von einer unbestimmten Traurigkeit befallen, die sich wie ein dunkles Tuch über sie legte. Dabei konnte sie noch gar nicht ahnen, dass sie vor ein paar Sekunden zum letzten Mal die Stimme ihrer Geliebten gehört hatte. Sie drehte sich um und begann damit, ihre Pinsel auszuspülen. Ihr Bild mochte sie überhaupt nicht mehr.
4
Durch das Kabinenfenster konnte man direkt auf den Parkplatz und den Promenadenweg blicken, der parallel zum Rheinufer verlief. Es war schon dunkel und das Wetter unangenehm nasskalt. Deshalb waren auch kaum Leute unterwegs. Die Bogenlaternen beleuchteten den feinen Nieselregen, der vom Wind gegen das Fenster getrieben wurde.
Bernd Severing war dabei, die vielen Visitenkarten und Prospekte zu ordnen, die sich in den vergangenen drei Tagen angesammelt hatten. Die Möbelmesse in Köln war für den Innenarchitekten seit Jahren Pflichtprogramm. Vor allem die Trends im Bereich der hochwertigen Polstermöbel, die sich variabel den Bedürfnissen ihrer Benutzer anpassten, und bei den modernen Wohn-Schranksysteme waren für ihn in diesem Jahr von Interesse gewesen. Seit Jahren arbeitete Bernd Severing vorwiegend mit festen Herstellern aus Italien und der Schweiz zusammen, die auch in diesem Jahr wieder wertvolle Impulse gegeben hatten. Allerdings hatte er auch mit Ausstellern aus Dänemark und der Türkei interessante neue Kontakte geknüpft. In seinem kleinen, aber feinen Geschäft in der Magdeburger Innenstadt fand man ausschließlich Einrichtungsbeispiele mit einer modernen, schnörkellosen und nahezu puristischen Anmutung. Severing verstand sich nicht als Möbelhändler, sondern sein Arbeitsplatz war das Wohnumfeld des Kunden, wo er unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der individuellen Bedürfnisse ganzheitliche Einrichtungskonzepte entwarf, bei denen von den Farben an den Wänden und der Platzierung der Möbel, über Gardinen und Teppiche bis hin zu Lampen und Bildern alles stimmig ineinander greifen musste. Severings Lieferanten arbeiteten mit Werkstätten zusammen, in denen die Möbel in alter Tradition von Hand gefertigt wurden. Qualität und Langlebigkeit hatten dabei einen hohen Stellenwert. Dies alles hatte natürlich seinen Preis, und somit zählten die Kunden von Severing Wohndesign in aller Regel zu den Besserverdienenden, die allerdings auch dementsprechend hohe Ansprüche stellten.
In diesem Jahr hatte der Inneneinrichter vom 21. bis zum 23. Januar erstmalig eine Kabine auf dem Hotelschiff MS Antonio Bartocelli gebucht, welches für die Dauer der Messe seinen Liegeplatz am Kennedy Ufer, also direkt am Messegelände eingenommen hatte. Das hatte den Vorteil, dass Severing zu Fuß zwischen Messe und Unterkunft pendeln konnte. Mit einem Übernachtungspreis von 175 Euro, inklusive Frühstück, lagen die Kosten zwar in etwa auf dem normalen Level der anderen Messehotels, aber die Kabinen auf dem Schiff waren etwas kleiner als durchschnittliche Hotelzimmer. In Sachen Komfort ließ das Schiff ansonsten jedoch nichts vermissen.
Bernd Severing verstaute die Messeprospekte in der Laptop-Tasche und legte diese neben seinen Koffer aufs Bett. Dann beugte er sich über den kleinen Klapptisch zum Kabinenfenster und sah hinaus. Hinter dem Parkplatz und ein paar dunklen Gebäudeumrissen konnte man von hier aus die gewölbte Dachkonstruktion des Hauptbahnhofs und dahinter die beleuchteten Türme des Kölner Doms erkennen. Wenn man den Kopf an die Scheibe des Kabinenfensters legte, war links die ebenfalls hell erleuchtete Hohenzollernbrücke zu sehen, die 1911 von Kaiser Wilhelm II. eingeweiht worden war, bei dem Namen der Brücke sicherlich ein Pflichttermin für Wilhelm, dessen eigentlicher Fetisch zwar eiserne Schiffe mit möglichst vielen Kanonen gewesen war, der aber auch monumentale Baukunst zum Ruhme des Reiches durchaus zu schätzen gewusst hatte.
Die Beleuchtung beider Gebäude, Dom und Brücke, war erst vor Kurzem als Zeichen gegen eine geplante fremdenfeindliche Demonstration für über zwei Stunden abgeschaltet worden. Dabei hatten sich in Köln eigentlich nur ein paar Hundert Demonstranten der sogenannten PEGIDA-Bewegung zusammengefunden. Viel schlimmer war es in Dresden, fand Bernd Severing, wo am letzten Montag wieder mehr als siebzehntausend Leute auf die Straße gegangen waren, um ihren Unmut und ihre Befürchtungen gegenüber Zuwanderern und Andersgläubigen zu äußern.
Bernd Severing sah auf seine Armbanduhr, es war 19.35 Uhr. Bei der Buchung seiner Kabine war er davon ausgegangen, dass sich möglicherweise für diesen letzten Abend noch ein gemeinsames Essen mit Messeleuten ergeben würde. Das hatte sich aber irgendwie nicht ergeben. Hätte er das vorher gewusst, dann wäre er noch heute abgereist. So hatte er jedoch die Fahrkarte für den ICE erst für den Samstagvormittag gelöst. Das machte aber gar nichts, denn wahrscheinlich würde er heute Abend noch ein paar Bestellungen durchrechnen und Angebote vorbereiten. Aber er entschied sich spontan dafür, sich vorher an der Bar noch einen Absacker zu gönnen. Ein bisschen Leben gehörte schließlich auch zum Geschäft. Wer immer nur rackert, ist nicht kreativ, dachte er und nahm noch einmal seine Jacke vom Garderobenhaken hinter der Kabinentür. Er trat auf den Gang hinaus, der menschenleer war. Über eine Treppe gelangte er auf das nächsthöhere Deck, auf dem sich auch die Bordbar befand. Hier war er schon ein paar Mal vorbeigekommen. Die kleine, aber stylisch eingerichtete Bar mit der indirekten violetten Beleuchtung war, bis auf die weibliche Bedienung, die hinter dem Tresen mit dem Polieren von Gläsern beschäftigt war, ebenfalls menschenleer. Die meisten Hotelgäste, sicher überwiegend Messebesucher und Aussteller, machten zu dieser Zeit offenbar die Kölner Altstadt unsicher.
Aus Lautsprechern in der Decke war leise der Buena Vista Social Club mit Pueblo Nuevo zu hören. Bernd Severing spürte, wie merklich ein Teil der Anspannung des hektischen und lauten Messetages von ihm abfiel. Er nickte der Bedienung freundlich zu, setzte sich aber abseits des Tresens an einen runden Tisch, von wo aus er durch ein großes bullaugenähnliches Fenster einen guten Blick auf den Fluss hatte. Die vorbeiziehende Wasserfläche glänzte schwarz wie ein See aus Öl und reflektierte schillernd die Lichter der Stadt.
Die schlanke Frau, die auf hohen Absätzen an seinen Tisch trat, um die Bestellung entgegenzunehmen, mochte Anfang Dreißig sein und hatte glatte schwarze Haare, die ein schmales, hübsches Gesicht halblang umrahmten. Der Ausschnitt ihrer engen dunklen Kostümjacke bildete ein schmales, langgezogenes V und wirkte im diffusen Halbdunkel der Bar aufreizend, ohne konkret etwas zu zeigen.
„Guten Abend, was darf ich Ihnen bringen“, fragte die Dame höflich mit einer melodischen Altstimme und sah ihn aus dunklen Kajalaugen an.
„Wenig los heute Abend“, antwortete Bernd, „ich weiß noch nicht recht. Was würden sie empfehlen?“
Die Dame lächelte. „Freitagsabends ist es hier meistens ruhig“, antwortete sie, „wir haben exzellente französische Weine. Einen 2011er Jean Dumont Sancerre blanc zum Beispiel, oder einen ausgezeichneten Chateau La Rose Saint Bonnet aus 2010 vielleicht?“
Sie sprach die Namen in einem souveränen Französisch aus, während sie lächelnd auf ihn herabblickte.
„Wenn sie ihn mit mir zusammen trinken, gerne den Roten, Frau…“, sagte der Gast und stellte unterdessen fest, dass er instinktiv flirtete, ohne dass es seine Absicht gewesen war.
„Martha“, sagte die Frau, „und danke. An sich gerne, aber ich muss noch Auto fahren. Also ein Glas Chateau La Rose?“
„Nein, dann bringen sie mir doch einen Whisky“, antwortete Bernd Severing, „einen … haben Sie Scotch?“
„Tobermory“, sagte Martha, „Single Malt.“
„Wunderbar.“
Gast und Bedienung lächelten sich an, bevor Letztere sich mit einem bezaubernden „Sehr gerne“ umdrehte und geschickt auf ihren hochhackigen Pumps in Richtung Bar entschwand.
Bernd Severing machte sich nicht die Mühe seinen Blick von ihrem verlängerten Rücken loszureißen. Als die Bedienung mit einem kleinen Tablett zurückkehrte und dem Gast nach vorn gebeugt das Glas mit dem feinen Produkt von der schottischen Insel Mull auf den Tisch stellte, brachte er jedoch genug Willenskraft auf, um ihr ausschließlich in die braunen Augen zu schauen.
Bernd Severing war kein Fremdgänger. Zum einen liebte er seine Frau, und zum anderen war ihm seine Arbeit zu wichtig, als dass er gern viel Zeit und Energie in amouröse Abenteuer investierte. Außerdem besaß er genügend Menschenkenntnis, um einzuschätzen, ob eine Frau wirkliches Interesse hatte, oder ob ihre Freundlichkeit professioneller Natur war, so wie er die Sache zum Beispiel hier einschätzte.
Das im vergangenen Jahr war etwas anderes gewesen, als sich diese dralle Messehostess aus Tschechien so nachdrücklich an ihn gehängt hatte. Da war er mit ihr am Abend in seinem Zimmer im Madison Hotel gelandet. Wenn es sich, wie in dem Fall damals, kaum vermeiden ließ, dann nahm er die Gelegenheit natürlich mit. Aber das war ja schließlich normal. Auch das war ja irgendwie kreativitätsfördernd. Das hatte nichts mit seiner Frau Carla zu tun. Da brauchte man kein schlechtes Gewissen zu haben.
Severing nahm einen Schluck von dem guten Scotch und bewegte ihn genüsslich in seinem Mund, schmeckte den kräftigen und vollen Geschmack mit leichtem Torfrauch und deutlichem Malz, bevor er ihn schluckte. Der Abgang war lang und weich, bevor die angenehme Wärme den Magen ausfüllte.
Der Buena Vista Social Club brachte nun Dos Gardenias zu Gehör. Das Hotelschiff schwankte ganz leicht in den sich ausdehnenden Wellen des Kielwassers eines Frachtkahns, der kurz zuvor stromabwärts am Hotelschiff vorbeigezogen war.
Bernd Severing freute sich auf zu Hause. Messetage waren anstrengend. Als zwei elegant gekleidete junge Männer die Bar betraten, trank er seinen Whisky aus, zahlte direkt am Tresen bei Martha, die plötzlich auf ihn etwas müde wirkte, und suchte seine Kabine auf, wo er sich noch mit Bestellungen beschäftigte. Es war noch keine elf Uhr am Abend, als er in der Koje lag und das Licht löschte.
5
Nachdem sie sich der mehr als kniehohen schwarzen Lederstiefel mit den hohen stilettartigen Absätzen entledigt hatte, die steife, glänzende Lackcorsage abgelegt und die schwarzen Handschuhe abgestreift hatte, die die Arme bis über die Ellenbogen bedeckt hatten, setzte sie sich an den Schminktisch und wischte sich mit Feuchttüchern das ebenfalls schwarze, dramatisch betonte Augenmakeup aus dem Gesicht. Sie löste den straffen Haarknoten und band die langen, schwarz gefärbten Haare zu einem lockeren Pferdeschwanz. So wurde aus Lady de Winter Schritt für Schritt wieder Doris Mühlhaus.
„Hast du keinen mehr heute, Doro?“
Senay, ihre Kollegin, die eben den Raum betreten hatte, trug, wie meistens, eine enge rote Ledercorsage und Lackschuhe in der gleichen Farbe und mit gefährlich hohen Absätzen. In der Hand hielt sie eine Reitgerte.
Senay Atac war wie Doris Mühlhaus siebenundvierzig Jahre alt und hatte sogar im selben Monat Geburtstag wie sie. Wenn ihre Familie von ihrem Beruf erfahren würde, wäre eine Skandallawine sicher, die bis nach Gebze, einer Stadt unweit von Istanbul am Marmarameer reichen würde.
„Lennart kommt doch heute zu mir. Wir wollen backen“, erklärte Doris der Kollegin, und man konnte sehen, dass ihre Augen einen weicheren Ausdruck bekamen.
Senay, die unter dem Künstlernamen Madame Medusa arbeitete, schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn. „Stimmt, du redest ja seit Tagen von nichts anderem.“ Sie wich geschickt einem Handschuh aus, den Doris nach ihr geworfen hatte.
„Nicht so streng, Lady de Winter“, frotzelte Senay. Sie kannte Doris´ fünfjährigen Enkel Lennart. Der Kleine war wirklich ein Sonnenschein.
„Okay, dann mach, dass du nach Hause kommst“, sagte sie gönnerhaft, „Lisa und ich müssen noch unseren Doktor verarzten. Sie schnürt ihn gerade zu einem handlichen Paket zusammen.“
Lisa Warncke war eine zwanzigjährige Blondine und assistierte je nach Bedarf Doris oder Senay als Zofe Miss Marilyn, in kurzem weißem Röckchen und weißen Strümpfen bei der Behandlung erziehungsbedürftiger Herren. Doktor Seiffert zum Beispiel hatte eine internistische Praxis in der Witzlebenstraße am Pechauer Platz und kam zweimal im Monat. Er liebte es, mit Stricken bis zur Bewegungsunfähigkeit gefesselt an die Decke gehängt, und dabei mit langen Nadeln traktiert zu werden.
Im Studio de Winter gab es mehrere Räumlichkeiten für unterschiedliche Vorlieben, vom Darkroom mit vielerlei Folterinstrumenten bis zum Kliniktrakt für urologische Spielereien.
„Mach´s gut, Süße.“ Senay warf Doris einen Handkuss zu und verschwand auf ihren hohen Absätzen auf dem Flur.
„Du auch“, entgegnete Doris, aber die Tür war schon ins Schloss gefallen.
Sie schlüpfte in ihre zivile Unterwäsche, zog ihre Jeanshose und den schlichten dunkelblauen Rollkragenpullover über und stieg in die bequemen Sneakers. Dann zog sie ihre kurze blaue Daunensteppjacke an, hängte sich die Schultertasche um und verließ das Studio. Die drei Treppen abwärts bis zur Tiefgarage ging sie zu Fuß.
Auf ihren Körper hatte Doris immer geachtet. Natürlich hatte der Zahn der Zeit auch bei ihr ein paar irreversible Problemzonen geschaffen, aber die perfekte Figur spielte in ihrem Zweig der Prostitution eine eher geringe Rolle. Hier kam es mehr auf Auftreten und Ausstrahlung an.
Doris Mühlhaus hatte ein, auf eine etwas herbe Art, schönes Gesicht. Die lange, leicht gebogene Nase, die steilen Falten zu beiden Seiten ihres Mundes und das ausgeprägte Kinn gaben ihr ein aristokratisches Aussehen, und wenn sie eine Augenbraue hob und ihre verächtliche Miene aufsetzte, entsprach sie dem klassischen Bild, dass man sich gemeinhin von einer Domina macht. Jetzt jedoch waren ihre Gesichtszüge entspannt und von Vorfreude auf ihren kleinen Enkelsohn geprägt. Nichts war mehr sichtbar von der Frau, die sich noch vor einer knappen halben Stunde von Berthold Mayer, einem Fachanwalt für Steuerrecht und Seniorpartner einer bekannten Magdeburger Kanzlei, die Stiefel küssen ließ, wobei sie ihm mit einer elastischen Gerte rote Striemen auf seinen weißen Hintern praktizierte.
Im Treppenhaus begegnete ihr niemand. Das mehrstöckige Geschäftshaus im Gewerbegebiet Nord war am Samstagnachmittag so gut wie menschenleer. Die Mitarbeiter der ansässigen Firmen, unter anderem die ausgelagerte Verwaltung einer Spedition, ein Studio für Mediengestaltung und ein Architekturbüro, genossen längst ihr Wochenende. Außer dem Messingschild mit der Aufschrift De Winter deutete von außen nichts darauf hin, welcher Art die Geschäfte in den Räumlichkeiten des Zweiten Stockwerks waren.
In der Tiefgarage entriegelte Doris Mühlhaus die Türen ihres roten Nissan Qashqai und setzte sich ans Steuer. Auf dem Rücksitz war ein dunkelblauer Kindersitz Marke Römer KID installiert. Mit der Zündung schaltete sich auch das CD-Laufwerk ein, und Depeche Mode starteten mit Hole to feed. Doris war seit über dreißig Jahren Fan, und sie fand, dass die Band auch mit ihren neueren Alben nichts von ihrem Charisma eingebüßt hatte. Gute Musik muss man laut hören, fand Doris, und bediente mit einer großzügigen Bewegung den Lautstärkeregler. Das weich schnurrende Geräusch des Motors konnte sie daher nicht hören, als der Qashqai ans Tageslicht strebte. Das Rollgitter senkte sich hinter ihr und verschloss den Zugang zur Tiefgarage.
Tatsächlich wirbelten vereinzelte Schneeflocken in der Luft herum. Jetzt musste das nun wirklich auch nicht mehr sein, fand Doris Mühlhaus, alias Lady de Winter, die eher den Sommer liebte. Über Weihnachten und Neujahr hatte es nur Schmuddelwetter gegeben, und nun, am 24. Januar, brauchte der Winter sich nach ihrem Geschmack auch nicht mehr herbemühen.
Als der rote Nissan auf den Magdeburger Ring Richtung Süden auffuhr, schalteten sich automatisch die Scheibenwischer ein. Die Schneeflocken waren fein, fielen aber jetzt dichter.
Doris Mühlhaus war am 16. Oktober 1967 als die mittlere von drei Töchtern des NVA-Offiziers Horst Mühlhaus und der Straßenbahnfahrerin Charlotte Mühlhaus, die eine geborene Seydlitz gewesen war, zur Welt gekommen. Der Vater hatte den größten Teil seiner Dienstzeit mit der Bewachung des antifaschistischen Schutzwalls an der Grenze zu Niedersachsen verbracht.
"Wollen die denn wirklich alle zu uns rüber?", hatte Doris als Teenager mal ihren Vater provozierend gefragt und einen vernichtenden Blick zur Antwort bekommen.
Die Mutter war früh bei einem Unfall im Straßenbahndepot ums Leben gekommen, und der Vater war mit den drei, in kurzem Abstand hintereinander und zeitweise sich überschneidend pubertierenden Mädchen völlig überfordert gewesen. Doris war im Alter von achtzehn Jahren schwanger geworden und hatte einem gesunden Mädchen das Leben geschenkt, dem sie den Namen ihrer Mutter, Charlotte, gab. Drei Monate vor der Niederkunft war sie von zu Hause abgehauen, weil es absolut nicht mehr ging mit dem Alten. Jedenfalls hatte sie das damals so gesehen.
Es waren harte Jahre gewesen, und Doris war letzten Endes irgendwie in der Prostitution gelandet. Der Kontakt zum Vater war abgerissen, und nur die ältere Schwester Monika hatte sich gelegentlich um Doris und die Kleine gekümmert. Es war ein kleines Wunder gewesen, dass die junge Frau nicht ganz unter die Räder gekommen war. Sie hatte eisern gespart, um sich und die kleine Charlotte durchzubringen. Sie hatte es sogar fertiggebracht, eine Lehre in einer Bäckerei erfolgreich abzuschließen.
Nach der Wende hatte Doris sich mit einer Freundin zusammen selbstständig gemacht und eine Videothek eröffnet. Am Anfang war das Geschäft ganz gut gelaufen, aber als die Steuer ihren Obolus forderte, hatte sich herausgestellt, dass niemand daran gedacht hatte, Rücklagen zu schaffen. Damit war das Unternehmen mit roten Zahlen beendet worden.
Wie man wirklich Geld verdienen konnte, hatte Doris festgestellt, als sie, inzwischen dreißigjährig, in einem Dominastudio in Fermersleben gelandet war. Sie hatte schnell herausgefunden, dass das Spiel mit Macht und Unterwerfung genau ihr Ding war. Ihre Kunden spürten, dass sie ihnen nicht nur eine Rolle vorspielte, sondern dass bei ihr echte Passion im Spiel war. Immer mehr Männer fragten gezielt nach Lady de Winter, und als die Etage im Gewerbegebiet Nord zur Miete ausgeschrieben war, hatte sie bereits genügend Geld angesammelt, um sich die Kaution und den größten Teil des Inventars leisten zu können.
Natürlich war die Tätigkeit als Domina für Doris Mühlhaus kein Hobby, sondern ein Geschäft. Sie hatte inzwischen eine so zahlreiche Stammkundschaft, dass sie es sich leisten konnte, sich die Männer auszusuchen, mit denen Sie sich abgab. Und ihre Kundschaft war ebenso exklusiv wie zahlungskräftig.
Ihre Familie, ihre Tochter und ganz wenige Freundinnen und Freunde wussten um ihren Beruf und akzeptierten ihn inzwischen. In all den Jahren hatte sie häufig gegen das Vorurteil ankämpfen müssen, dass eine Frau, die Männer quält und demütigt, Männer hassen müsse. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Um diesen Beruf gut auszuüben, musste man Männer mögen, verstehen, und sich dafür interessieren, was in ihrem Inneren vorging. Das war jedenfalls ihre Auffassung.
Eine feste Partnerschaft oder gar Ehe hatte sich in all den Jahren nicht ergeben, was nicht einmal in erster Linie daran lag, dass Männer mit ihrer Tätigkeit nicht zurechtkamen, sondern eher daran, dass Doris sich in den harten Jahren ihrer Jugend und im Kampf ums Überleben für ihre Tochter und sich selbst zu einem derart starken Charakter entwickelt hatte, dass es ihr immer schwerer gefallen war, im alltäglichen Leben Kompromisse einzugehen. Ihre Sexualität hatte Doris in früheren Jahren mit lockeren Bekanntschaften ausgelebt. In ihrem Beruf war es heute sogar so, dass sie gelegentlich Lust dabei empfand, während sie einen Kunden dazu brachte, sich ihr im Rollenspiel zu unterwerfen.
Als Doris ihren SUV in die Budenbergstraße im Stadtteil Buckau steuerte, hatten die inzwischen dickeren Schneeflocken, die wie kleine Wattebäusche fast senkrecht vom Himmel schwebten, Straßen, Gehwege und parkende Autos mit einer weißen Schicht überzuckert. Die Räder des Qashqai hinterließen die ersten Spuren auf der jungfräulich weißen Zufahrt zu den Stellplätzen. Mit leichtem Bedauern drehte sie den Zündschlüssel ab und unterbrach damit die markante Stimme von Dave Gahan mitten in einer Liedzeile von Walking in my shoes.
Mit den glatten Sohlen ihrer Sneakers musste Doris vorsichtig über die Schneedecke zum Hauseingang laufen. Der alte Herr Demmrock, der im Erdgeschoss wohnte, grüßte sie freundlich, als er ihr mit einem Besen bewaffnet im Hauseingang begegnete. Er schien über den Schnee erfreut zu sein. Die Wohnungen des viergeschossigen Altbaus waren luxussaniert, und die gutsituierte Eigentümergemeinschaft leistete sich einen professionellen Winterdienst. Bis dieser jedoch auftauchte, hatte der rüstige Siebzigjährige in der Regel bei einsetzendem Schneefall längst den Hauszugang freigefegt.
Doris ignorierte den Aufzug und lief über die Treppen bis in den oberen Stock, wo sich ihr Appartement befand. Schwer atmend kam sie oben an und schloss die Tür auf. Das Appartement war mit seinen 61 Quadratmetern nicht sehr groß, aber dafür luxuriös ausgestattet und eingerichtet.