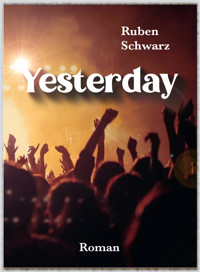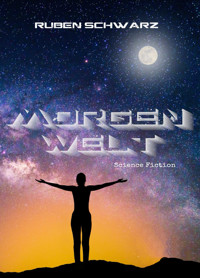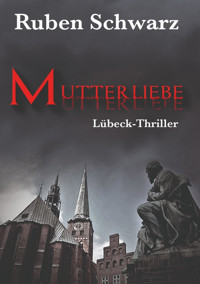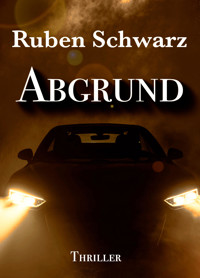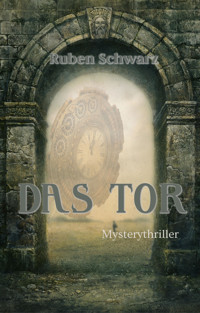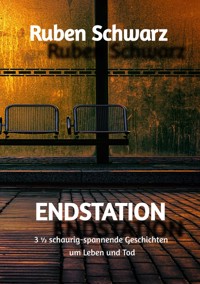Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: audioparadies
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Harter Psychothriller mit expliziten Szenen. Entführung. Prostitution, Mystery. Über Jahre hinweg bleibt das Schicksal der jungen Frauen, die in größeren Zeitabständen spurlos verschwinden und nie wieder auftauchen, für Polizei und Öffentlichkeit ein Rätsel. Weder Michael Dönnhoff, der Sohn eines erfolgreichen Seriendarstellers, noch Jana Cassens, die seit frühester Kindheit durch die postnatale Depression ihrer Mutter traumatisiert ist und ins Rotlichtmilieu abgleitet, sind Teile der Ermittlungen. Und erst recht nicht Helga Rentrop, eine in die Jahre gekommene Ex-Terroristin der Rote-Armee-Fraktion, die unter falschem Namen lebt. Aber sie alle haben mit der Entführungsserie zu tun, ohne zunächst voneinander zu wissen. Und wie grauenhaft das Leid der entführten Frauen tatsächlich ist, die in die Fänge des reichen, kunstbesessenen und von keinerlei Skrupeln gehemmten Täters geraten, kommt erst ans Licht, als DER SAMMLER sich das falsche Opfer aussucht. Ein Thriller, der sich den Grenzen menschlichen Vorstellungsvermögens annähert und gleichzeitig zeigt, wie drastisch die Psyche von uns allen durch unser Umfeld und von einschneidenden Erlebnissen im schlimmsten Fall geprägt werden kann. Für Personen unter 18 Jahren und solche mit empfindsamen Gemütern ist die Geschichte nicht zu empfehlen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2025 Ruben Schwarz
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Der Sammler
Thriller
Ruben Schwarz
Meine Musen neigen nur bedingt dazu, mich zu küssen. Viel häufiger führen sie mich an dunkle Orte und flüstern mir böse Dinge ins Ohr.
Ruben Schwarz
Inhalt
Cover
Urheberrechte
Titelblatt
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Der Sammler
Cover
Urheberrechte
Titelblatt
Kapitel eins
Kapitel vierzig
Der Sammler
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
Der Sammler
Thriller
Ruben Schwarz
Kapitel eins
Mitte Januar 2024
Der Traum war ein bisschen konfus. Es war Laura Diebold die ganze Zeit über in einem winzigen Zipfel ihres Unterbewusstseins klar, dass es ein Traum sein musste. Tobias und sie lagen vollständig bekleidet auf der Schlafcouch in ihrem Zimmer, nur die Schuhe hatten sie abgestreift. Sicher war sie mit ihren fünfzehn Jahren in gewisser Weise eine Spätzünderin - das wusste sie, und damit zogen sie die Mädels aus ihrer Klasse auch gerne auf -, aber Tobias verstand sie, er war bereit auf sie warten. Bis sie so weit war, hatte er gesagt. Bis sie so weit war, den letzten Schritt mit ihm gemeinsam zu tun, mit der ganz großen Liebe ihres Lebens.
Ja, sie liebten sich wirklich, lagen engumschlungen nebeneinander und küssten sich, heiß und innig. Tobi hatte es drauf - Laura war nicht seine erste Freundin, das wusste sie und sie kam damit klar -, und sein Spiel mit der Zunge, einfühlsam, zärtlich und gleichzeitig fordernd und drängend, führte dazu, dass ihr ganz heiß wurde, und das verlangende Flirren in ihrem Unterleib war beglückend, aber auch in gewisser Weise quälend und ein bisschen beunruhigend.
Sie hatte sich nicht getraut, Tobi zu fragen, ob er es mit Celine damals richtig gemacht hatte, dem Mädchen, mit dem er vorher gegangen war. Celine war eine Klasse über Laura, und bei der Art, wie sie sich gab und kleidete, wie sie manchmal auf dem Pausenhof lachte, und dabei ihre Haare zurückwarf, hätte Laura ihr absolut zugetraut, schon mit Jungs intim zu sein.
Es war ein bisschen ärgerlich, dass sie unbedingt jetzt an Celine denken musste, während Tobis Küsse immer fordernder wurden und sich seine Lenden gegen ihre pressten. Seine Erregung konnte sie deutlich durch den Stoff seiner Jeans spüren, aber das machte ihr kein bisschen Angst. Im Gegenteil, es hätte sie schon interessiert, wie es sich anfühlte so ein Ding in die Hand zu nehmen. Hoffentlich würde es nicht zu groß werden, so wie das in dem Video, das Dennis neulich in ihre WhatsApp-Gruppe hochgeladen hatte.
Wenn es nach Lauras Patentante Gisi ginge, dann sollte man sowas besser gar nicht anfassen, denn dann kommt es über sie. So hatte die Tante es mal auf einer Geburtsfeier erklärt. Dann sind sie nicht mehr zu bremsen, die Kerle. Damals war allerdings Alkohol im Spiel gewesen, und Gisi hatte es nicht direkt zu Laura gesagt, natürlich nicht, aber sie hatte es in die feuchtfröhliche Runde geworfen, und es war laut gelacht worden. Laura hatte mit am Tisch gesessen und interessiert zugehört.
„Uah!“, hatte Emma geprustet, „ist das eklig!“ Damals hatte Laura mit Emma und Fadime in der großen Pause bei den Fahrradständern gestanden. Emma war Lauras beste Freundin seit der fünften Klasse. Sie hatte mal das Ding von ihrem älteren Bruder gesehen. Aber damals waren Emma und Laura erst dreizehn gewesen, und seither hatte sich schließlich so einiges geändert. Emma hatte inzwischen einen Busen, und zwar einen, den man deutlich sehen konnte, was bei Laura leider noch auf sich warten ließ. Hoffentlich blieb das nicht für immer so!
Tobias hatte ein richtig rotes Gesicht bekommen, und er versuchte vorsichtig, seine Hand unter ihren Pulli zu schieben. Laura ließ ihn gewähren und fühlte, wie eine Welle der Leidenschaft durch ihren Körper strömte. Was allerdings seltsam war, sie befanden sich zwar in ihrem Zimmer, aber an der Wand, die sich dem Fenster gegenüber befand, stand die elterliche Schrankwand, die normalerweise im Wohnzimmer ihren Platz hatte, und Mama war gerade dabei, sämtliche Gläser aus der Vitrine herauszunehmen und einzeln zu polieren. Und sie kümmerte sich nicht die Bohne um Tobi und sie. An dem kleinen Tischchen neben dem Fenster ihres Zimmers, auf zwei der rosa Stühle, saßen Papa und Onkel Ben und spielten Schach. Dabei tranken sie Bier direkt aus der Flasche. Onkel Ben kam öfter an den Wochenenden zum Schachspielen vorbei, wenn Mama Dienst hatte. Aber sie spielten natürlich nie in Lauras Zimmer. Und schon gar nicht, während sie sich mit ihrem Freund auf der Schlafcouch herumwälzte und an seiner Zunge saugte. Aus dem Radio in der Küche hallte As it was von Harry Styles durch den Flur. Seltsam, dass man das hier so laut hörte. Und der Sound klang so wuchtig, als würde in der Diele eine Liveband spielen.
Das wirklich Verrückte an der ganzen Sache war jedoch, dass dieses absurde Szenario sie nicht im Geringsten störte. Auch nicht, als Onkel Ben, nachdem er einen seiner weißen Springer auf c3 gesetzt hatte, einen Schluck aus seiner Flasche Becks nahm und ihr dabei aufmunternd zunickte.
Das war das ausschlaggebende Moment, welches ihr deutlich machte, dass sie träumte, so real sich Tobis Hand auf ihrem kaum vorhandenen Busen und die Beule in seiner Hose, die sich gegen ihren Unterleib presste, auch anfühlten. Und es war ungewöhnlich warm im Zimmer, richtig heiß sogar. Irgendjemand, Papa oder Onkel Ben, musste am Thermostat herumgespielt haben. Dabei war das Fenster auf Kipp eingestellt. Ein stetiger Luftzug blähte die Gardinen nach innen. Tobias hatte sie an ihren Handgelenken gepackt und hielt sie fest. Sie wollte ihn abschütteln und fragen, was das sollte, aber es kam kein Laut über ihre Lippen. Laura konnte sich nicht befreien. Und das monotone Brummen, das den Raum erfüllte … Den Raum, an dessen hoher Decke dicke Rohleitungen verliefen, die rostig und schadhaft aussahen. Die Mauern bestanden aus schmutzigen Ziegelsteinen. Licht fiel durch ein Quadrat in einer der Mauern, das aus blinden Glasbausteinen bestand. Und Laura wusste, dass der Traum jetzt zu Ende war. Wo sie sich befand, wusste sie nicht, aber ihr war instinktiv klar, dass sie lieber in ihrem Traum geblieben wäre. Dass die Realität, die sich jetzt als Alternative anbot, keine Option war, die ihr gefallen würde.
Sie war nicht in ihrem Zimmer, lag nicht auf ihrer eigenen Schlafcouch. Der Raum sah aus wie eine alte Fabrikhalle oder Werkstatt, und zwar eine, die schon seit langer Zeit nicht mehr genutzt wurde. Die braunen Wände waren fleckig, sahen verwittert aus, und auf dem schmutzigen Boden lagen rostige Eisenteile, Glasscherben und zerbrochene Holzpaletten. Und was das Schlimmste war: Es waren nicht Tobis Hände, die sie festhielten und bewegungsunfähig machten, sondern Bandagen aus einem hellgrauen Kunststoff. Sowohl ihre Handgelenke als auch die Fußgelenke waren damit straff an den vier Ecken eines Tisches aus Aluminium fixiert.
Laura Diebold lag auf dem Rücken, Arme und Beine waren vom Körper abgespreizt. Sie blickte hinauf zur Decke, wo zwischen den rostigen Rohrleitungen Leuchtstoffröhren angebracht waren, die aber nicht in Betrieb waren. Denn es war Tag, und das trübe Licht, welches durch die Glasbausteine in den Innenraum fiel, reichte aus, um den Raum zu überblicken. Laura zerrte aus Leibeskräften an ihren Fesseln, wobei sie Rücken und Gesäß von der Metalloberfläche anhob. Und erst da bemerkte sie, dass sie vollkommen unbekleidet war.
Nackte Angst überwältigte sie und betäubte jedes klare Denken. Obwohl es warm in dem Raum war, fror sie urplötzlich, und sie begann hemmungslos zu schluchzen. Das hier musste ein Traum sein, nicht das, was sie zuvor erlebt hatte, mit Tobi und den beiden Schach spielenden Männern. Wenn das hier kein Traum war, dann setzte es alles außer Kraft, was sie bisher in ihrem Leben gedacht, geträumt und erlebt hatte.
Ein schrilles „Hilfe!“ verließ ihren Mund, kam von ganz unten aus ihrer Lunge, und sie zog den Schrei so sehr in die Länge, bis es vor ihren Augen zu flimmern begann. Ihr Schrei hallte von den Steinwänden zurück, als würde noch eine zweite Person mit ihr im Duett schreien. Dann lag sie still und schwer atmend da. Ich muss aufwachen, jetzt, dachte sie intensiv mit zusammengepressten Augenlidern. Sie lauschte. Da war nur das dumpfe Dröhnen, das den Raum erfüllte. Der Raum, in dem sie gefangen war, mochte vielleicht sieben oder acht Meter lang und um die fünf Meter breit sein. Eine Metalltür stand offen, und dahinter lag eine größere Halle, die vollkommen leer zu sein schien, zumindest legte das der Ausschnitt nahe, den sie aus ihrer Position einsehen konnte.
Eine alte Fabrikhalle. Eine stillgelegte Kokerei, Gießerei oder eine Zementfabrik vielleicht. Von dort drüben kam das Brummen. Dort lief eine Maschine, die Laura aber nicht sehen konnte. Erneut zog sie an ihren Handfesseln und versuchte, ein Bein anzuwinkeln. Es war hoffnungslos. Die Fessel an ihrem linken Handgelenk, oberhalb ihres Kopfes, schien etwas mehr Spiel zu haben als die anderen, und dort entstand ein klackendes Geräusch, wenn sie daran zog, aber befreien konnte sie sich nicht. Ihre gespreizten Beine wiesen genau in die Richtung, in der sich die offene Tür befand. Wenn jetzt tatsächlich Hilfe kam, wenn sie jemand fand, wenn jemand kam, um sie zu befreien, dann würde er sie so liegen sehen. Und sein Blick fiele als Erstes auf ihre …
Laura schloss wieder ihre Augen. Es wäre eine äußerst peinliche Situation, sie würde wahrscheinlich vor Scham sterben. Aber war das wirklich ihr größtes Problem? Sie öffnete die Augen und drückte ihr Kinn auf die Brust. Jemand hatte mit einem schwarzen Stift Linien auf ihren Körper gemalt. Tränen liefen ihr zu beiden Seiten über das Gesicht. Hilfe, dachte sie, Hilfe, bitte machen Sie mich los. Aber sie konnte es nicht laut sagen oder rufen. Etwas in ihrem Kehlkopf schnürte ihr die Luft ab. Eine senkrechte und eine waagerechte Linie verliefen über ihre Brust. Und darunter gab es eine senkrechte Linie, die etwa zehn Zentimeter oberhalb ihres Bauchnabels begann, und über den Nabel hinweg bis dorthin reichte, wo ihr Schamhügel begann.
Laura begann zu zittern. Die Zuckungen breiteten sich über ihren ganzen Körper bis zu den Füßen aus. Das Grauen legte sich wie ein großer toter Hund auf ihren Brustkorb. Was sollte das werden? Wer hatte sie hierhergebracht? Wusste sie das wirklich nicht mehr? Die Angst hinderte sie daran, die Erinnerungsfetzen zusammenzufügen, die ihr geblieben waren.
Sie war mit dem Fahrrad auf dem Weg von der Kunst-AG nach Hause gewesen. Für Mitte Januar war es ungewöhnlich mild, und so fuhr sie schon seit ein paar Tagen mit dem Rad zur Schule, statt mit dem Bus. Jedoch hatte sie ihre lange Steppjacke an und die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Als sie den Parkplatz vor dem Eisentor zur Schrebergarten-Kolonie erreichte, stieg sie ab, um das Rad durch die eng geparkten Autos hindurchzuschieben. Da war ein Lieferwagen, ein weißer geschlossener Kleintransporter mit blauer Beschriftung. Was genau draufstand konnte sie nicht lesen, denn die rechte Seitentür war geöffnet. Und ihre Aufmerksamkeit wurde von dem Mann am Boden angezogen. Er stöhnte und an einem Bein seines grauen Monteur-Overalls war ein Fleck zu sehen, der wie Blut aussah. Er lag neben der geöffneten Seitentür des Transporters und sprach sie an.
„Kannst du mir kurz aufhelfen?“, fragte er. Er lag auf dem Rücken und hob einen Arm. „Ich bin gestürzt.“ Eigentlich war er nicht alt, und er sah nicht aus, als könne er nicht aus eigener Kraft aufstehen. Aber er war offensichtlich verletzt. Laura legte ihr Fahrrad auf dem Kies des Parkplatzes ab und beugte sich über den Mann. Sie war etwas ratlos, wie sie ihn am besten anfassen könnte, um ihm auf die Beine zu helfen. Dann war alles wahnsinnig schnell gegangen. Weitere Details kamen ihr ab diesem Zeitpunkt nicht in den Sinn. Der Kerl hatte sie überwältigt. Er hatte ihr auch wehgetan, das wusste sie. Und sie war so unsagbar dumm gewesen. Sie hatte alle Vorsichtsregeln außer Acht gelassen, die man von Eltern, Lehrern und Verwandten Zeit seines Lebens zu hören bekam. Aber der Mann hatte so leidend ausgesehen, und überhaupt nicht gefährlich, kein bisschen. Eher sympathisch, ein gutaussehender Kerl um die vierzig vielleicht, oder auch jünger. Warum hatte er das gemacht, warum? Und warum war sie so dumm gewesen?
Laura war vollkommen klar, dass der Mann ganz konkrete Absichten hegte. Er hatte sie nicht einfach nur so überwältigt, ihr diesen übelriechenden Lappen aufs Gesicht gedrückt und sie hier gefesselt. Er hatte etwas Bestimmtes mit ihr vor. Und sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das etwas Gutes sein könnte. Warum hatte er Linien auf ihren Körper gemalt? Oh, mein Gott, er hatte neben dem Tisch gestanden, auf dem sie vollkommen nackt lag, hatte sie ausgezogen, sie gesehen, alles von ihr. Wo waren ihre Sachen und der Rucksack? Das Fahrrad? Der Kerl hatte diese Linien vermutlich mit einem Edding auf ihre Haut gemalt. Wohin hatte er dabei geschaut? Was hatte er alles gesehen? Laura schluchzte laut und zog den Rotz in der Nase hoch. Der wird mich umbringen, schoss es ihr durch den Kopf. Der wird mich umbringen. Aber warum? Vielleicht will er mich auch vergewaltigen. Vielleicht kommt er sogar mit mehreren Männern hierher. Noch einmal presste sie ihre Augen zu Schlitzen zusammen und hoffte aufzuwachen. Endlich rauszukommen aus diesem Albtraum. Aber es gelang ihr nicht. Vielleicht ging es auch um Lösegeld. So reich waren ihre Eltern doch nicht. Dann musste es eine Verwechslung sein.
Draußen schien es langsam dunkel zu werden, denn durch die Glasbausteine drang nur noch ein schwaches Schimmern. Auch jenseits der Tür wurde es dunkel. Die Ecke rechts neben der Tür war schon nicht mehr einsehbar. Dann hörte sie draußen ein Auto. Es war eindeutig ein Auto. Hoffnung keimte jäh bei ihr auf. Aber gleichzeitig war die Verzweiflung da, die dieses winzige Fünkchen Hoffnung erdrückte. Es hatte draußen vorher keine Geräusche gegeben, nichts, was das Brummen der Maschine im Nebenraum übertönte und auf die Nähe von Menschen hingewiesen hätte. Wenn jetzt jemand mit dem Auto hier auftauchte, dann war es er. Es war doch relativ unwahrscheinlich, dass ein Dritter zufällig herkam, um sie zu befreien. Er war es, der Triebtäter, der Mörder, der Kidnapper. Aber vielleicht würde er sie gehen lassen. Vielleicht hatte er gemerkt, dass er sich irrte, dass alles eine Verwechslung war. Er würde sich entschuldigen und ihre Fesseln lösen. War das möglich? Kaum. Die Realität war grausamer.
Der Wagen hatte draußen gestoppt. Eine Autotür wurde zugeworfen. Laura setzte alles auf eine Karte. Auch den kleinen Zipfel einer Chance musste man nutzen. Sie schrie aus Leibeskräften: „Hilfe! Hilfe! Ich bin hier drin! Hilfe!“ Der Klang der eigenen Stimme tat ihr in den Ohren weh. Er erzeugte einen seltsamen Hall in den verlassenen Räumen. Dann war das metallische Quietschen einer Tür zu hören. Sie wurde geschlossen, und jetzt ertönten Schritte auf dem Steinboden der Halle jenseits der Tür. Laura merkte, dass sie die Luft angehalten hatte. Sie spürte, wie sie bebte, und in dieser warmen Umgebung erneut fröstelte. Und ihre Beine waren geöffnet, für diesen WerAuchImmer, der sich mit schnellen Schritten der offenen Tür näherte.
„Hilfe“, jammerte sie nur noch ganz leise, so als würde sie nicht wollen, dass es jemand hörte. Der Schattenriss eines Mannes war in der Tür aufgetaucht. An seiner Schulter hing eine Tasche. Er tastete an der Wand neben der Tür nach einem Lichtschalter. Dann flammten die Leuchtstoffröhren an der Decke zögernd auf. Nach mehrmaligem Flackern überfluteten sie den Raum – und leider auch Laura auf dem Metalltisch – mit grellem Licht. Der Mann lächelte beinahe freundlich. Er hatte braune, kurzgeschnittene Haare, ein markantes Gesicht und hellblaue Augen. Seine vollen Lippen lächelten, aber in seinem Blick lag eine beängstigende Kälte. Es war der Mann, dem sie hatte helfen wollen, nur sah er jetzt absolut nicht mehr harmlos aus.
„Bitte“, brachte Laura hervor. Es war nur ein klägliches Krächzen. Angst und unsägliche Scham schienen sie zu würgen. Der Mann stellte seine Tasche neben der Tür ab und bückte sich. Die Plastikplane, die er hervorzog, entpuppte sich als dunkelgrüne Schürze, die, als er sie anlegte, die ganze Vorderseite seines Körpers bis hinunter zu den Knien verdeckte. Dann setzte er sich eine große Brille auf, die die Augen auch seitlich schützte. Eine Brille, wie Handwerker sie bei Arbeiten tragen, bei denen die Gefahr besteht, Splitter oder Funken abzubekommen. Oder Spritzer, dachte Laura, die inzwischen die Kontrolle über ihren Körper verloren hatte. Sie war ganz sicher, dass das warme Gefühl unter ihrem Hintern vom Inhalt ihrer Blase stammte, die sich gerade entleerte. Sein Gesicht, dachte sie. Ein sehr flüchtiger Gedanke. Er trägt keine Maske, wie Entführer es immer tun.
„Keine Angst“, sagte der Mann mit ruhiger, freundlicher Stimme. Er trug In-Ear-Kopfhörer. „Ich werde dir helfen.“ Er zog sich Gummihandschuhe über, die das gleiche Grün trugen wie seine Schürze. Dann ließ er seinen Blick kurz über Laura schweifen und ging langsam zu einem runden Metalltisch, der sich an der Wand mit den Glasbausteinen befand, die inzwischen vollkommen schwarz waren. Laura musste den Kopf ganz zur Seite drehen. Der Tisch war ihr bisher nicht aufgefallen. Und die Gegenstände, die sich auf dem Tisch befanden und das Licht von der Decke reflektierten, Messer in allen Größen, unterschiedlich große Handsägen und Zangen, Nierenschalen aus Edelstahl, wie sie in Operationssälen verwendet wurden, ließen ihr das Blut in den Adern gefrieren. Nur ein Traum, dachte sie angestrengt, nur ein Traum. Er musste enden, er musste jetzt enden, jetzt sofort. Aber er tat es nicht. Laura schloss die Augen, öffnete den Mund und schrie so laut sie konnte.
Kapitel zwei
Anfang Juni 1972 Beinahe 52 Jahre zuvor
Das Motorengeräusch des silbergrauen 280er Mercedes war leiser als das Knirschen der Reifen auf dem feinen Schotter, mit dem die schmale Zufahrt zum Steinbruch bestreut war. Auf dem Weg konnten sich Löwenzahn und Wegerich anscheinend seit Jahren unbehelligt breitmachen. Bis vor nicht langer Zeit waren große Kieslaster und schwere Tieflader mit Kalksteinblöcken mit ihren schweren Reifen über diese Piste gerollt. Jetzt war hier deutlich weniger Betrieb. Und es gab sicher schönere Orte für ein Picknick im Grünen, aber wenigstens schien man hier ungestört zu sein.
Helga Rentrop hatte es sich auf den braunen Ledersitzen im Fond gemütlich gemacht. Neben ihr stand die große Sporttasche, in der man, wenn jemand sie öffnete und nur oberflächlich hineinsah, eine Flasche Rotwein und eine mit Orangensaft vorfinden würde. Ebenso einen Flaschenöffner, ein paar Plastik-Trinkbecher, eine Blechdose mit Butterbroten und Äpfeln und eine rotweiß-karierte Picknickdecke. Hin und wieder fiel ihr Blick auf diese Tasche, während sie an ihrer Zigarette zog.
Am Steuer saß Rolf. Er hatte sich heute Morgen frisch rasiert, trug ein hellblaues Hemd und Jeans, die ziemlich neu aussahen. Neben ihm, auf dem Beifahrersitz saß Petra, oder besser gesagt, sie hatte sich dort hingelümmelt. Den Sitz hatte sie so weit wie möglich nach hinten geschoben und ihre Füße, die in leichten halbhohen Sommer-Boots mit Fransen steckten, auf der Ablage über dem Handschuhfach abgelegt. Von der Seite blickte sie immer wieder zu Rolf hinüber. Ihr T-Shirt war definitiv eine Nummer zu klein für ihre Oberweite, und es sah stark danach aus, als wollte sie Rolf damit beeindrucken. Dabei hatte Petra eigentlich seit ein paar Wochen einen neuen Typen.
Helga konnte das egal sein, sie wollte nichts von Rolf. Obwohl er wirklich nicht übel aussah, und von der Bettkante würde sie ihn nicht schubsen, wenn es sich ergäbe. Nach einer Fete vielleicht, mit ein paar Gläsern Wein oder Bier. Oder Sauren Fritz. Auch Rolf und Petra hielten Zigaretten in ihren Händen. Von hinten konnte man sehen, wie der weiße Rauch durch die halbgeöffneten Seitenfenster nach draußen gesaugt wurde.
Aber Rolf machte stets den Eindruck, als würde er über weibliche Reize hinwegsehen. Nicht, dass er vom anderen Ufer wäre – das glaubte Helga nicht –, aber für ihn war anscheinend nur die Sache wichtig. Er war gebildet und wusste viele Dinge, nicht nur über Politik. Er hatte studiert, das hatte sie irgendwann aufgeschnappt. Was genau, das wusste sie nicht. Schließlich kannte sie Rolf erst seit ein paar Tagen, und viel Privates hatte er nicht von sich preisgegeben. Zum ersten Mal hatte sie ihn an dem Tag gesehen - am Küchentisch der WG -, an dem er mit der schlimmen Nachricht aufgetaucht war, dass die Bullen Holger geschnappt hatten.
„Is ja echt scharf hier“, bemerkte Petra gutgelaunt, zog ihre Füße vom Armaturenbrett und setzte sich aufrecht hin. „Hier ist ja wirklich überhaupt nix los. Und ich dachte, ich kenn mich in der Stadt aus.“ Und sie hatte recht. Tatsächlich hatten sie sich fünf Minuten zuvor noch im dicksten Verkehrsgewühl befunden.
„Der Steinbruch ist schon seit über einem Jahr verlassen“, sagte Rolf. „Hat mir Manni erzählt. Er meint, das wäre der ideale Ort.“
„Und was ist das?“, fragte Helga. Sie tippte neben Rolfs Kopf gegen die linke Wagenscheibe.
„Da hinten? Das ist ne Ziegelei“, antwortete Rolf. „Die stört uns nicht. Die ist weit genug weg vom Steinbruch. Und die machen da selbst so viel Krach, dass sie uns nicht hören.“ Der Mercedes passierte eine Abzweigung, von der eine schmale Straße zu einem Gelände mit mehreren miteinander verbundenen rotbraunen Fabrikgebäuden führte. Aus dem größten Gebäude ragte ein hoher runder Kamin aus Ziegelsteinen, aus dem grauer Rauch quoll. Vor einem der kleineren Nebengebäude standen ein großer Kipplaster und ein paar PKW.
„Jedenfalls hab ich Durst“, bemerkte Petra gutgelaunt, zog ein letztes Mal intensiv an ihrer Kippe und warf sie dann durchs Wagenfenster nach draußen. Sie drehte sich zu Helga um und grinste. Helga und Petra kannten sich schon länger, schon bevor sie sich der Bewegung angeschlossen hatten. Petra war nicht hässlich, aber in ihrem Gesicht fielen jedem zuallererst die ungewöhnlich großen und weit auseinander stehenden Augen auf. In ihrer Jugend war sie häufig wegen ihrer „Kuhaugen“ gehänselt worden. Helga hatte zu Anfang ihrer Bekanntschaft mal beiläufig fallen lassen, dass sie ihre Rehaugen schön fände, womit sie bei Petra einen dicken Punkt gemacht hatte.
„Durst hab ich auch“, sagte Rolf, „aber zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ Wie meistens wirkte er dabei sehr ernst. Auch er warf den Rest seiner Zigarette nach draußen.
Sie ließen das Fabrikgelände hinter sich. Der Wagen erreichte eine Anhöhe, von der man in der Ferne einen großen Teil der Stadt überblicken konnte. Dann bog Rolf rechts ab und folgte einem holprigen Pfad, der von dichtem Unkraut überwuchert war und sich abschüssig der Bruchkante des Steinbruchs näherte. Links von ihnen gähnte ein gelblich weißer Abgrund. Rolf parkte das Auto neben einem rostigen Eisencontainer, den man hier zurückgelassen hatte.
„So, Mädels, Endstation“, sagte er gutgelaunt und öffnete die Fahrertür. Offenbar wirkte sich das schöne Wetter auch auf seine Laune aus; in den vergangenen Tagen hatte es oft und lange geregnet. Dementsprechend hatten sich auf dem steinigen Untergrund zahlreiche Pfützen gebildet.
„Kinder, ist das schön hier“, trällerte Petra, während sie sich aus dem Wagen schwang. „Das ideale Wetter für ein Picknick.“ Sie kicherte.
„Und für Wein“, beeilte sich Helga zu ergänzen. Wie es aussah, war sie die Einzige, die sich nicht ganz wohl in ihrer Haut fühlte. Sie kletterte vom Rücksitz des Mercedes nach draußen, warf ihre Kippe auf den Boden und trat darauf. Dann ging sich um den Kofferraum herum zu Petra. Rolf kam zu ihnen. Seine dunklen Haare hingen ihm in die Stirn und er zwinkerte Helga zu. „Ich nehm die Tasche“, sagte er und griff durch die geöffnete Autotür danach. Ein Hauch seines Rasierwassers stieg Helga in die Nase. Schlecht roch es nicht. Rolf wuchtete sich die schwere bordeauxfarbige Sporttasche über die Schulter. Sie trug ein großes weißes Adidas-Logo. Erst Tage zuvor hatte Helga die Tasche zusammen mit Ulla, einem anderen Mitglied ihrer Gruppe, vom Hauptbahnhof abgeholt. Ein Freund von Holger, dessen Namen sie nicht kannte, hatte ihnen das Gepäckstück auf dem Bahnsteig 8 übergeben und war danach gleich nach Hamburg weitergereist. Zu der Zeit hatte Holger noch nicht in Untersuchungshaft gesessen.
„Hier geht’s lang“, sagte Rolf und trat als erster auf einen etwa fünf oder sechs Meter breiten Pfad, der entlang der Abbruchkante mit einem mäßigen Gefälle nach unten führte. Sicher hatten hier früher Bagger und LKW verkehrt und den Kalkstein aus der Grube nach oben befördert. Man sah noch heute tiefe und breite Reifenspuren, die sich in den damals wohl regennassen Untergrund gegraben hatten und später ausgehärtet waren. Rolf trug schwarze Halbschuhe, Petra ihre halbhohen Boots und Helga hatte die Clogs aus Holz und hellblauem Wildleder an den Füßen, die sie in letzter Zeit fast immer trug. Die etwas zu lange Schlaghose verdeckte sie fast vollständig und setzte beim Laufen hinten auf den Boden auf, weshalb die Säume an diesen Stellen ausgefranst und schmuddelig waren.
Es war gar nicht so lange her, zwei Jahre vielleicht, da hatte sie noch sehr viel mehr Wert auf ihr Äußeres gelegt. Helga war eine hübsche Frau von vierundzwanzig Jahren mit verhältnismäßig langen aschblonden Haaren, die sie aktuell meistens zu einem Pferdeschwanz bündelte. Früher hatte sie Schuhe mit hohen Absätzen getragen, oder Sandalen mit dicken Korksohlen, dazu hübsche, figurbetonte Kleider und im Winter entsprechend enggeschnittene Pullis. Sie hatte als Sekretärin des Chefs in einem Autohaus gearbeitet und mit diesem Chef hatte sie …
Beinahe wäre sie umgeknickt. Die Clogs waren mehr als ungeeignet für eine Wanderung in einem Steinbruch. Dazu hätte Rolf ihr ruhig mal vorher einen Tipp geben können, aber Männer dachten nicht an sowas. Der Weg führte in einem weiten Bogen um den Steinbruch herum und näherte sich dabei immer mehr der Talsohle. Aber dann, noch mindestens zwanzig oder mehr Meter oberhalb des tiefsten Punktes, öffnete sich vor ihnen eine größere ebene Fläche, die man mit Baggern, oder Bulldozern, oder auch mit Dynamit aus dem Felsen gesprengt hatte. Vielleicht hatten hier früher die LKW gewendet, waren beladen worden, oder etwas Ähnliches. Vor ihnen ragte eine verhältnismäßig glatte steile Kalksteinwand empor, während das Gelände hinter ihnen steil abfiel. Am Fuß der aufragenden Felswand lagen ein paar große Findlinge. Sie befanden sich im Schatten der Kalksteinwand, während dort, wo Helga und ihre zwei Genossen standen, die Sonne auf den staubigen Boden brannte. Rolf stellte die Tasche ab, in der es leise klirrte.
„O-oh“, machte Petra und verzog das Gesicht. Auch Helga machte sich ein bisschen Sorgen um den Wein.
„Alles okay.“ Rolf musste grinsen. Er bückte sich, zog den Reißverschluss der Sporttasche auf und griff tief hinein. „Alles heile“, sagte er. Er wühlte kurz in der Tasche herum, und als er sich aufrichtete, hielt er eine der neuen Walther PPKs in der Hand. Diese und andere Schusswaffen hatten Petra und Helga vom Bahnhof abgeholt. Rolf kam auf Helga zu. Die Pistole hatte er am Lauf gepackt und hielt sie Helga hin. „Hier, Helga, damit du ein Gefühl dafür kriegst.“ Helga fasste die Waffe am Griff an und war erstaunt über das Gewicht. Pistolen hatte sie sich leichter vorgestellt. Vielleicht, weil sie früher einmal die Spielzeugpistole des kleinen Nachbarsjungen in Düsseldorf in der Hand gehabt hatte.
„Und, wie ist das?“, fragte Rolf. Inzwischen hatte sich Petra gebückt und zog die Rotweinflasche aus der Tasche.
„Hallo?“, machte Rolf und blinzelte sie missbilligend an.
„Schon gut, schon gut, erst die Arbeit, dann das Vergnügen“, entgegnete sie und schnitt ihm eine Grimasse. Sie sah trotz ihrer Kuhaugen sexy aus mit ihren engen Jeans und dem noch engeren T-Shirt. Und die Weinflasche in der Hand verlieh ihr etwas Verruchtes. Rolf ging zu den Findlingen und hob auf seinem Weg dorthin ein paar größere Felssplitter auf, die er nebeneinander auf einem der großen Brocken platzierte. Es waren vier unregelmäßig geformte Steine, die einen Durchmesser von fünfzehn bis zwanzig Zentimetern haben mochten. Rolf drehte sich zu ihnen um, nickte einmal und kam dann zu den beiden Frauen zurück. Er machte lange Schritte, als würde er die Entfernung messen.
„Sieben oder acht Meter, würde ich schätzen“, sagte er. Helga stand etwas unschlüssig mit der Pistole in der linken Hand da. „Zeig mal her“, sagte Rolf. Helga hob die Hand mit der Waffe. Das schwarzglänzende Metall reflektierte das Sonnenlicht. „Das hier ist der Sicherungshebel“, erklärte er. „Bevor du schießt, musst du den in die waagerechte Position schieben. Mach mal.“ Helga verdrehte ihre linke Hand so, dass sie den Hebel mit der rechten Hand drehen konnte. Ein roter Punkt wurde sichtbar. „Ah“, sagte sie und musste sich räuspern. Irgendwie hatte sie einen Frosch im Hals, und ihre Hand mit der Waffe zitterte leicht.
„Keine Angst“, sagte Rolf und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Das fühlte sich tatsächlich beruhigend an. „Also, pass auf. Du nimmst die Pistole in die rechte Hand.“ Helga tat, was der Genosse sagte. „Du hebst den Arm und zielst auf den linken Stein.“ Mit seiner freien Hand deutete Rolf auf die Brocken, die er auf dem Findling platziert hatte. „So, leg deine linke Hand als Unterstützung unter die rechte. So kannst du deinen Arm stabilisieren und ruhiger halten.“ Helga hatte die Waffe auf das angegebene Ziel gerichtet.
„Ruhig atmen, einatmen, ausatmen, und abdrücken.“
„Los, baller ihn weg!“, jauchzte Petra und lachte. „Stell dir vor, da steht ein Bullenschwein!“ Sie stand ein paar Schritte neben Helga.
„Pscht“, machte Rolf. Helga sah zu ihm auf. Er nickte mit ernstem Gesicht. „Einatmen …“ Helga nickte ebenfalls. Langsam zog sie den Abzug mit dem Zeigefinger zu sich heran. Zuerst ging es ziemlich schwer, aber dann … Der Stoß in ihrer Hand kam so unerwartet, dass sie beinahe losgelassen hätte. Mindestens einen Meter oberhalb des anvisierten Ziels sprengte das Projektil kleine Steinsplitter und eine Staubwolke aus der steil aufragenden Felswand. Der Knall war unerwartet laut und hallte mit doppeltem Echo durch den Talkessel. Helga blickte sich erschrocken um. Aber sie waren nach wie vor allein in dieser verlassenen Einöde. Rolf lachte. Entgegen seiner Gewohnheit zeigte er sogar die Zähne.
„Und, wie wars?“, fragte er gut aufgelegt.
„Irre“, sagte Helga und blies sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
„Eine Fahrkarte zwar, aber immerhin, du hast keinen von uns erschossen.“ Rolf lachte noch immer.
„Huhu!“, rief Petra und tat so, als würde sie Twist tanzen.
„So, gleich noch mal. Und jetzt direkt drei Mal hintereinander auf denselben Stein“, sagte Rolf. „Im Ernstfall musst du sicher sein, dass der Gegner kampfunfähig ist.“
„Tut mir leid“, sagte Helga.
„Du schaffst das“, sagte Rolf. Er schaute jetzt wieder ernst, wie meistens. „Und pass auf, beim zweiten Schuss ist das Abzugsgewicht wesentlich geringer.“ Helga nickte und nahm die PPK jetzt in ihre linke Hand. Sie hob den Arm und peilte ihr Ziel an. Sie hatte zwar nicht verstanden, was Rolf mit dem Abzugsgewicht meinte, wusste es aber kurz danach, als sie den Abzugshebel betätigte, der jetzt kaum Widerstand bot. Das Projektil traf den Findling, kaum zehn Zentimeter unterhalb des Steins, den sie anvisiert hatte. Steinstaub wirbelte auf.
„Weiter, weiter“, forderte Rolf sie auf.
„Mach ihn fertig!“, rief Petra. Helga feuerte und traf jetzt tatsächlich ihr Ziel. Der Stein zerbarst mit einer Staubwolke in zwei große und viele kleine Splitter. Der dritte Schuss ging wieder gegen die Felswand, nur eine Hand breit oberhalb des benachbarten Steins. Als sie den Arm mit der Pistole senkte, war da ein feines Sirren in beiden Ohren. Aber gleichzeitig überwältigte sie für einen Moment ein Gefühl der Macht. Wer so ein Ding in der Hand hielt, war zweifelsfrei Herr über Leben und Tod.
„Wow“, sagte Petra. Sie kam herangetänzelt und streckte die Arme aus.
„Du bist eine Granate, ich hab es immer gewusst“, lobte sie die Freundin und schlang ihre Arme um sie. Helga hielt dabei die linke Hand mit der Waffe weit von sich. Als Petra sich von ihr gelöst hatte, fragte Rolf: „Und, wie viele Patronen sind jetzt noch in der Waffe?“
„Drei?“, antwortete Helga spontan in der Frageform.
„Fast“, sagte Petra.
„Falsch“, sagte Rolf. Natürlich hatten die beiden recht. Das Modell besaß ein Stangenmagazin mit sechs Patronen. Sie hatte zuerst einen Schuss abgegeben und danach weitere drei. Blieben also noch zwei Projektile. Rechnen zweite Klasse. Nein, erste. Setzen, sechs.
„Okay“, sagte sie, „natürlich zwei.“
„Im Ernstfall kann es entscheidend sein, zu wissen, ob man eine geladene oder ungeladene Waffe in der Hand hält.“ Rolf sagte das mit ernster Miene, schien aber kein bisschen sauer zu sein. „Du bist Linkshänderin, stimmts?“
„Jepp.“
„Hat man gesehen, mit der linken Hand wirkst du viel sicherer. Los, mach das Magazin leer. Feuer frei.“ Ohne lange zu zögern, hob Helga die Pistole und drückte im Abstand von zwei oder drei Sekunden zwei Mal ab. Der zweite Stein blieb heil, fiel aber nach hinten von dem Findling herunter. Der zweite Schuss hätte den Stein ebenfalls getroffen, wäre er noch an seinem Platz gewesen.
„Ausgezeichnet“, lobte Rolf. „Wirklich gut.“
„Hossa!“, rief Petra. Sie hatte sich an der Sporttasche zu schaffen gemacht und hielt plötzlich die Tula-Maschinenpistole in beiden Händen. Sie richtete die Waffe auf die zwei verbliebenen Steine auf dem Findling und feuerte eine Salve von mindestens zehn oder zwölf Projektilen in kurzer Folge ab. Die beiden Steine waren verschwunden und an der Felswand dahinter hatte sich eine Staubwolke vor einer Reihe von Einschusslöchern gebildet. Mit der MP in den Händen und der qualmenden Kippe im Mundwinkel wirkte Petra beinahe wie Faye Dunaway als Bonnie Parker in dem Film über Bonnie und Clyde. Man musste sich nur die schwarzen Haare und die Kuhaugen wegdenken.
„He!“, fuhr Rolf sie verärgert an.
„Sorry, Leute, das musste sein. Ich bin jetzt brav. Wenn ich Wein kriege.“
„Wir können es uns nicht leisten, sinnlos Munition zu verpulvern. Steck das verfluchte Ding weg und sichere es, verdammt noch mal.“ Helga hatte Rolf, in der kurzen Zeit, die sie ihn kannte, noch nie so aufgebracht gesehen.
„Schon gut“, sagte Petra kleinlaut und legte die Tula neben der Sporttasche auf den Boden.
„Wie siehts aus, Helga. Willst du es noch mal versuchen? Du hast noch ein Reservemagazin.“ Rolf nickte Helga aufmunternd zu. Die zuckte mit den Schultern.
„Nee, eigentlich nicht. Ist ja tatsächlich nicht so schwer.“ Helga hoffte, es würde nie dazu kommen, dass sie im sogenannten Ernstfall, von dem Rolf immer sprach, einen Schuss abgeben musste. Sie würde drei Kreuze machen, wenn die Aktion vorbei war.
„Okay“, sagte Rolf. Er deutete mit dem Finger auf die Waffe in Helgas Hand. „Drück den Knopf da hinter dem Abzug. Dann kannst du das Magazin rausnehmen.“ Helga tat es. Danach konnte sie das leere Magazin unten aus dem Griff herausziehen. Rolf nahm ihr beides aus den Händen, machte irgendwas am Lauf der Pistole und führte das Magazin wieder ein. Mit dem Fuß kickte er die herumliegenden Patronenhülsen über die Abbruchkante in die Tiefe. Dann bückte er sich und ließ die Waffe in die Sporttasche gleiten.
„Party!“, rief Petra, die verrückte Nudel. Sie wäre beinahe mit ihrem Kopf gegen den von Rolf gestoßen, als sie die Weinflasche aus der Tasche zog, die sie jetzt, wie ein Triumphator nach der Schlacht, in die Höhe reckte. Rolf schüttelte unmerklich den Kopf. „Na, dann“, sagte er nur, und suchte in der Tasche nach dem Korkenzieher.
Wenig später hatten alle drei weiße Plastikbecher in den Händen, die Petra ungeschickt mit Rotwein füllte, wobei ein paar Tropfen auf dem steinigen Untergrund landeten und dort von Blutspritzern nicht zu unterscheiden waren.
Helga jedenfalls war froh, dass Rolf ihr inzwischen zutraute, als vollwertiges Mitglied der Stadtguerilla zu agieren. Als sie sich damals am großen Küchentisch der WG zum ersten Mal begegnet waren, war er skeptisch gewesen, was sie betraf. Dennoch blieb ein Funken Unbehagen bei Helga bestehen, der in ihrer Brust ein nervöses Flattern verursachte. Immerhin hatte sie selbst das Autohaus Sternberg in Rüttenscheid als lohnendes Anschlagsziel ins Gespräch gebracht. Sehr wahrscheinlich würden morgen Menschen sterben, wenn der Glaspalast mit den teuren Porsche- und BMW-Modellen in die Luft flog. Aber der Scheißkerl hatte es verdient. Er war nicht nur ein Vertreter des kapitalistischen Schweinesystems, das es zu bekämpfen galt, sondern Emil Sternberg war auch verantwortlich für den Tod des ungeborenen Babys, das Helga von ihm erwartet hatte, damals vor über zwei Jahren. Um ihre ehemaligen Kollegen im Autohaus tat es Helga ein bisschen leid. Aber inzwischen waren die Ziele der Rote-Armee-Fraktion, der bewaffnete Kampf für eine gerechte und sozialistische Gesellschaft, uneingeschränkt zu ihrem Leitbild geworden, dem sich Einzelschicksale unterzuordnen hatten. Und sie taten es unter anderem auch für Andreas und Ulrike, die jetzt schon seit einiger Zeit im Knast saßen, und sich darauf verlassen würden, dass die Genossen den Kampf in ihrem Sinne weiterführten.
„Hat schon jemand den Wetterbericht für morgen gehört?“, fragte Rolf. Er saß zwischen Petra und Helga auf einem der großen Findlinge, in einer Hand den halbvollen Plastikbecher und in der anderen die glimmende Zigarette.
„Es soll höchstwahrscheinlich wieder Regenschauer geben, bis in den späten Nachmittag“, sagte Petra.
„Das ist gut“, bemerkte Rolf zufrieden. „Es ist gut, wenn so wenig Autokunden wie möglich auf dem Gelände vor der Ausstellunghalle herumlaufen, wenn Helga den Wagen mit dem Sprengstoff hinter der Halle abstellt.“ Helga zog an ihrer Zigarette und blies den Rauch mit vorgeschobener Unterlippe in die Luft. Ein paar weiße Wolken schoben sich langsam vor den blauen Himmel über dem Steinbruch. Sie schwiegen für eine Weile. Nachdenklich blickte Helga sich um und betrachtete die Steinsplitter hinter dem Findling, auf dem sie saßen. Einer war annähernd rund, vielleicht zwölf oder fünfzehn Zentimeter im Durchmesser. Als Helga sich konzentrierte, nahm ihr Gesicht eine maskenhafte Starre an. Ihre Augen blickten leer aber fokussiert auf den Stein hinter dem Findling. Er begann kurz zu vibrieren und erhob sich dann um ein paar Zentimeter vom Boden, wo er frei in der Luft schwebte. Als Helga wieder ins Hier und Jetzt zurückkehrte, fiel der Stein zurück in den Staub. Rolf blickte sich um, konnte sich aber nicht erklären, woher das Geräusch stammte. Zum Glück hatte niemand Helgas mentale Abwesenheit bemerkt.
„Was ist?“, fragte Petra und zog an ihrer Kippe. Ihre großen Augen blitzten schelmisch.
„Nichts“, sagte Rolf.