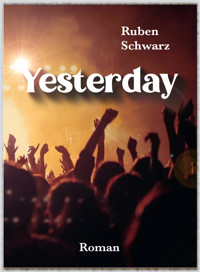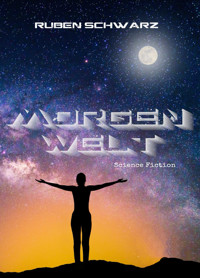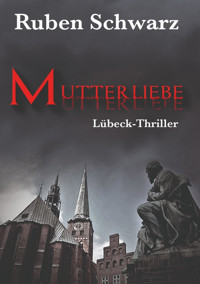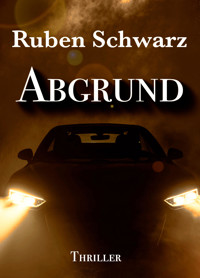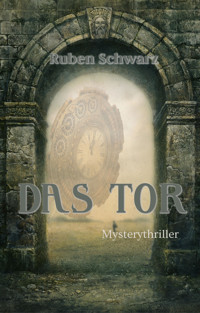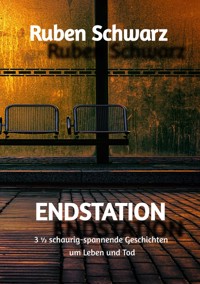4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Aus Handelspartnern werden Gegner. Aus einer freien Gesellschaft wird ein totalitäres Regime. Nach Jahrhunderten des Friedens rüstet das Sol-System auf, um der Bedrohung durch das Kaiserreich Jia zu begegnen. Das Gleichgewicht der Kräfte gerät aus den Fugen und die totale Vernichtung droht. Und dann tritt ein weiterer Gegner auf den Plan, den keine der beiden Parteien auf dem Schirm hatte. Plötzlich liegt nicht weniger als das Schicksal der Menschheit in den Händen einer kleinen Gruppe von Deserteuren, die das scheinbar Unmögliche wagen und durch die Singularität gehen. Eine abenteuerliche Jagd durch Raum und Zeit beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Sylvia und Markus
Ruben Schwarz
DIE CAPELLA-SINGULARITÄT
© 2021 Ruben Schwarz
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-18955-3
Hardcover:
978-3-347-18956-0
e-Book:
978-3-347-18957-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
DIE CAPELLA-SINGULARITÄT
Ruben Schwarz
Prolog
Wenn ich meine Dehnungsübungen mache, mag es für Außenstehende Anlass zur Heiterkeit sein. Es ist eine Kombination aus Hüpfen, Yoga und Sit-ups, und ich merke dabei, dass ich eigentlich noch ganz gut in Form bin. Dieses Herumzappeln, wie Clive es mal genannt hat, ist notwendig, um den Blutkreislauf der alten Dame wieder in Gang zu bringen. Außerdem dient es der Regeneration der Muskulatur, die im Moment geradezu schockiert ist, wenn nach der langen Ruhezeit plötzlich wieder Leistung von ihr erwartet wird.
Nicht, dass der Tiefschlaf für das Herz ein ernsthaftes Problem dargestellt hätte; es ist schließlich schon mein drittes mit einem bionischen Taktgeber. Die gerinnungsfreie Substanz, die über Jahrhunderte anstelle des üblichen Blutplasmas meine Gefäße elastisch gehalten hat, hatte es möglich gemacht, den Körper ohne aktiven Stoffwechsel bei einer Temperatur von minus zweiundachtzig Grad Celsius am Leben zu erhalten.
Warum ich mich vorzeitig habe wecken lassen? Nun, es ist schon allein wegen der Stille an Bord des im freien Fall befindlichen Schiffs lohnend, die ich brauche, um mit der nötigen Konzentration den Aufzeichnungen im Logbuch ein paar persönliche Ergänzungen hinzuzufügen. Während ich schreibe, weiß ich natürlich nicht, ob jemals ein Mensch oder irgendein anderes denkendes Wesen, das fähig ist meine Aufzeichnungen zu entschlüsseln, dies jemals auch tun wird.
Ich weiß auch nicht, wann es geschehen wird, und noch viel weniger wo. Vielleicht findet auch nie jemand meinen Bericht, oder es interessiert sich niemand dafür. Möglicherweise wird auch das Schiff mit allen Menschen und Daten an Bord irgendwann in der langen Zeit des Wartens von einem unbekannten Angreifer zerstört, der zufällig unseren Weg kreuzt.
Ich weiß nur, dass ich nicht mehr am Leben sein werde, wenn meine Mitreisenden programmgemäß aus dem Kälteschlaf erwachen. Denn meine Lebenszeit ist begrenzt. Du, lieber Leser, der du ja nun offensichtlich meine Daten in Händen hältst, oder besser gesagt auf deinem Visor betrachtest, wirst fragen, wessen Lebenszeit ist das nicht? Und damit hast du natürlich recht. Ich werde es anders formulieren - meine Tage sind gezählt.
Aber ich sollte weiter vorn anfangen, sonst verstehst du mich nicht. Du, der oder die jetzt vielleicht gespannt oder stirnrunzelnd (vielleicht ungeduldig mit den Augen rollend) darauf wartest, dass ich endlich konkreter werde, bevor du dich abwendest oder sogar alles löschst, du hast ein Recht darauf. Es ist schließlich in meinem Interesse, dass die Erinnerung an die Geschichte der Menschheit nicht in Vergessenheit gerät. Vielleicht wird mein Bericht von anderen Vertretern meiner Spezies gefunden, die irgendwo in der Unendlichkeit einen unentdeckten und sicheren Winkel gefunden haben, um den Sturm der Vernichtung zu überstehen, die Ergreifung der Macht durch die nächste Evolutionsstufe.
Ich wäre sogar schon froh, wenn überhaupt noch irgendwo organische Lebensformen existierten, völlig egal ob eure Körper nun von Fell, Schuppen oder Gefieder geziert werden. Dann nämlich hätte sich unsere Mission wenigstens ein bisschen gelohnt.
Mein Name ist Chiara. Das sollte fürs Erste reichen. Wir reden uns hier an Bord schon lange nur noch mit den Vornamen an. So lange, dass einige ihren Nachnamen bereits vergessen haben. Ich bin seit … Moment, ich checke die Bordzeit … seit sage und schreibe einhundertfünfundsiebzig Jahren mit diesem Schiff unterwegs.
Das ist allerdings nur bedingt richtig, denn korrekt sind es nur einhundertfünfundsiebzig Jahre, die ich in lebendigem, wachem, bewusstem Zustand auf diesem Schiff verbracht habe. Meine Eltern hätten gesagt einhundertfünfundsiebzig Dekaden, aber im Sol-System wurde für die Zeiteinteilung noch immer traditionell die Spanne zugrunde gelegt, die Terra für einen Sonnenumlauf benötigt.
Wie lange ich mich tatsächlich, die Kryostase eingeschlossen, innerhalb dieser Biosphäre befinde, behalte ich einstweilen für mich. Das schockiert dich sonst nur.
Als Mam und Pap mit mir zusammen die Flucht ins All ergriffen haben, bin ich acht oder neun Jahre alt gewesen, wenn die Aufzeichnungen stimmen.
Meine Organe, Gefäße und Gelenke, die zum größten Teil bioplastisch repliziert wurden, und dazu regelmäßige Zellduschen verleihen mir das äußere Erscheinungsbild einer einigermaßen guterhaltenen Mittfünfzigerin, und eigentlich hätte ich noch locker fünfzig weitere gesunde Jahre dranhängen können, wenn nicht … Ja, wenn nicht dieses verfluchte Taubenei direkt in der Mitte meines Schädels wäre, das sich schon vor Jahren dort eingenistet hat. Laut Medoanalyse sitzt das Drecksding direkt neben dem Hörzentrum, irgendwo am Schnittpunkt zwischen dem sensomotorischen Bereich und der Region, die für die akustische Assoziation verantwortlich zeichnet. Und dummerweise kann man dem Übeltäter weder durch Laserchirurgie noch durch Nanosonden auf den Leib rücken. Das Taubenei wächst exponentiell. Bis daraus ein Hühnerei wird, das aus mir eine mit Drogen vollgepumpte Idiotin macht, werde ich nicht abwarten.
Beschwerden habe ich bisher keine, wenn man von der Tatsache absieht, dass menschliche Stimmen ab einer gewissen Lautstärke in meinen Ohren ein metallisches Klirren erzeugen, als würde jemand eine Handvoll Nägel auf eine Stahlplatte fallen lassen. Aber daran kann man sich gewöhnen. Einigermaßen jedenfalls.
Meine Prognose lag zum Beginn der letzten Kryostase bei sechs bis acht Monaten. Im Kälteschlaf der letzten Jahrhunderte (Ups! Jetzt hätte ich beinahe zu viel verraten) war die Entwicklung des Tumors selbstverständlich im wahrsten Wortsinn auf Eis gelegt, und im gefrorenen Zustand wäre ich vermutlich unsterblich. Nur was bringt mir die schönste Unsterblichkeit, wenn ich nichts davon mitbekomme?
Um das hier klarzustellen, ich will kein Mitleid von dir. Das ist nicht der Grund, warum ich das alles erzähle. Mit dem Gedanken an meinen baldigen Tod habe ich mich längst abgefunden. Vielleicht kann man sogar sagen angefreundet. Denn im Prinzip habe ich alles erlebt, was man so erleben kann. Glaube ich zumindest. Und ehrlich gesagt habe ich auch keine große Lust mehr, ewig so weiterzumachen.
Zur Erde zurück will ich jedenfalls nicht. Niemand hier an Bord hat auch nur die Spur einer Ahnung davon, wie es dort heute aussehen mag. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist unüberschaubar. Und zu weiteren Abenteuern bin ich einfach nicht mehr bereit. Meine Mitreisenden werden es wahrscheinlich erleben. Wenn sie aufwachen, werden sie nach Terra fliegen und sich der Realität stellen, wie immer sie auch aussehen mag. Ich werde nicht dabei sein. Ich habe für jeden von Ihnen eine persönliche Nachricht hinterlegt und hoffe, dass sie mich verstehen.
Geboren bin ich auf einem Planeten, der knapp 28 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Wie es dazu kam, will ich hier gar nicht weiter ausführen. Ich will dich nicht langweilen, und vielleicht komme ich später noch dazu, wenn du meinen Bericht liest. Ich muss an der Stelle einbauen, dass mein Bericht aus Gedächtnisprotokollen besteht. Du weißt selbst, dass heutzutage niemand mehr ein Blatt Papier in die Hand nimmt, um aus einzelnen Schriftzeichen Wörter und Sätze zu bilden. Der Bericht besteht aus akustischen und optischen Signalen, die der Visor in deinem Kopf zu telenotisch generierten Geschichten formt, so als wärst du selbst dabei gewesen und könntest die Geschehnisse mit eigenen Augen und Ohren miterleben. Wenn ich also hier vom Schreiben und vom Lesen spreche, dient das nur der Vereinfachung. Eine begriffliche Vereinbarung zwischen uns beiden, die wir gleichermaßen zu deuten wissen.
Aber was rede ich, du weißt das alles selbst viel besser als ich, denn du lebst in der Zukunft. Du bist jemand, der nach mir folgt, vielleicht in hundert Jahren oder vielleicht in tausend. Und deine technischen Möglichkeiten werden aller Wahrscheinlichkeit nach den meinen um Lichtjahre voraus sein, wenn du mir diesen immer wieder falsch verwendeten Begriff verzeihen willst, denn wir alle wissen, dass ein Lichtjahr eine Entfernungseinheit und keine Zeitspanne ist.
Die Bewohner des Planeten, auf dem ich geboren bin, waren Menschen. Angehörige meiner Spezies, die dort gesiedelt hatten, und die es vermutlich schon lange nicht mehr gibt. Ebenso wenig wie die Menschen auf der Erde. Obwohl ich die Hoffnung habe, dass ich mich irre. Denn dafür haben wir gekämpft. Und dafür verstecken wir uns hier schon so unendlich lange. Die Bewohner selbst nannten ihren Planeten Jia, auf Terra nannte man ihn Virginis c und in den Sternenkarten trug er die Bezeichnung G 1279 c.
Aber ich schweife ab, das alles ist für dich uninteressant. Schreibe es bitte der alten Dame zugute, deren Kopf so voller Erinnerungen steckt, dass sie manchmal Probleme damit hat, Wichtiges von Nebensächlichkeiten zu trennen. Und ich bin ja eigentlich auch nur die Berichterstatterin. Die Chronistin, die selbst an den schicksalhaften Ereignissen nur einen verhältnismäßig geringen Anteil hatte, weil sie noch ein Kind war. Also miss meiner Person keine zu große Bedeutung bei. Ich bin nur eine Nebendarstellerin in dem Stück.
Als wir damals mit dem zum Kriegsschiff umgebauten Silicium-Frachter vom Mond aufgebrochen sind, war ich viel zu jung, um in vollem Umfang zu verstehen, was vor sich geht. Und die Eltern haben mich nach Kräften abgeschirmt. Erst viel später, damals hatte ich schon meinen ersten Sex mit Clive gehabt, mit dem ich danach viele Jahre verpartnert gewesen bin, hatte mir Jo vom schrecklichsten und wohl letzten Kampf in der Geschichte berichtet. Den Krieg hatten wir selbst verschuldet, also wir Menschen. Du hast sicher nichts anderes erwartet. Das war schließlich nicht anders als in allen anderen Kriegen zuvor.
Ich habe in meinen Jahren auf dem Raumschiff, das offiziell keinen Namen trägt, unheimlich viele Aufzeichnungen in den Archiven gefunden. Das Schiff nenne ich für mich CHRONOS. Einige von uns haben den Namen inzwischen von mir übernommen. Früher einmal hatte es wohl PHOBOS FREIGHTER IV geheißen, so steht es noch immer in verwitterten Lettern an der Außenhülle – aber das war in einer anderen Zeit. Die von mir zusammengesetzten Aufzeichnungen sind Fragmente, die teilweise aus anderen Kontexten stammen, von unzähligen Zeitzeugen, lückenhaft, verloren gegangen, gelöscht, rekonstruiert.
Meinen Bericht, den ich hier aus meiner Erinnerung zusammenstelle, baue ich auf den Erzählungen, Tagebucheinträgen und Protokollen von einigen Personen auf, die mir am verlässlichsten zu sein scheinen. Das ist aus meiner Sicht so am sinnvollsten, um eine halbwegs vernünftige Struktur in die Geschichte zu bringen. Allerdings habe ich auch Nachrichten, Funksprüche und Protokolle mir persönlich fremder Zeitzeugen verwendet, um das Bild abzurunden.
Eine der Hauptpersonen ist meine Mutter, die damals seit ihrer Ankunft auf der Erde kontinuierlich Tagebuch geführt hat. Was Jo angeht, so war sie damals mit meinen Eltern eng befreundet, und für mich so etwas wie eine Tante.
Wenn es dich interessiert, wo ich mich heute befinde, muss ich etwas weiter ausholen: Das Capella-System ist etwa 42,5 Lichtjahre von Terra entfernt. Unsere CHRONOS befindet sich in einem stabilen Orbit hundertvierundachtzig Kilometer über dem topografischen Mittel von Melisande 1, einem Planeten, der die ungefähr eineinhalbfache Masse der Erde besitzt, aber eine tote Steinwüste ist. Melisande 1 heißt der Planet deshalb, weil es noch eine Nummer 2 gibt, die uns hier aber nicht weiter beschäftigen muss. Die Umlaufbahn, der Melisande 1 im Capella-System folgt, ist mathematisch so kompliziert, dass ich Mühe hätte, sie dir aufzuzeichnen. Capella ist ein Doppel-Doppelsternsystem. Es besteht aus den Komponenten Aa und Ab sowie H und L. Aber ich sehe, das führt schon wieder viel zu weit.
Wichtig für Melisande 1 ist, dass der Hauptstern Capella (also Aa) ein gelber Riese ist, der in geringem Abstand von einer zweiten Sonne, einem sogenannten roten Zwerg (Ab), umkreist wird. Die beiden Sonnen beeinflussen gegenseitig sowohl ihre Magnetfelder als auch ihre Strahlenspektren. Die Umlaufbahn des Planeten Melisande 1, der dem Doppelstern am nächsten liegt, ähnelt dadurch einer langgezogenen, in sich verdrehten Ellipse. Der Planet „eiert“ sozusagen um seine Sonnen herum.
Um die Sache noch komplizierter zu machen, umkreisen der eben beschriebene Doppelstern und ein weiterer Doppelstern (H und L) sich gegenseitig im Abstand von neunundvierzig Astronomischen Einheiten und in einem Intervall von dreihundert Jahren. Diese also insgesamt vier Gestirne erzeugen gemeinsam mit ihren Planeten und Monden zu bestimmten Zeiten ein solches Chaos an Magnetfeldern, dass massive und ungewöhnliche Verzerrungen der Raumzeit die Folge sind. Es handelt sich dabei um ein Wurmloch der besonderen Art, könnte man sagen. Zumindest war das der Fall, bevor wir dort eingegriffen haben, um Gott zu spielen. Ich erwähne das nur, weil es das Verständnis für die später folgenden Berichte vielleicht etwas erleichtert.
Wenn ich nun aus dem Fenster schaue, sehe ich wie die rotbraune Wölbung von Melisande 1, verbrannt von den todbringenden Strahlen zweier Sonnen, so öde wie gewaltig und schön, nach unten aus dem Blickfeld verschwindet und die Aussicht auf das hellstrahlende Band der Galaxis freigibt, die von den Menschen früher einmal Milchstraße genannt wurde und sich wie ein ewiger silbriger Regenbogen scheinbar durch die Unendlichkeit spannt. Ein Anblick von friedlicher und hoffnungsvoller Schönheit, gebildet aus hunderten Milliarden Sonnen. Die Ahnung von einem Jenseits auf der anderen Seite des Universums, in das ich demnächst frohen Herzens reisen werde.
A.D. 2487
1
Marsorbit
Auch heute noch wurde sie gelegentlich von Albträumen heimgesucht. Sie ist dann allein, steckt in einem Raumanzug, ihr Kopf nur durch die Wölbung des transparenten Helms von der luftleeren Kälte getrennt. Nur wenige Zentimeter vor ihrem Gesicht lauert der Tod. Die weißen Schutzhandschuhe greifen ins Nichts. Sie fällt, treibt haltlos durch den schwarzen Abgrund. Kein Oben, kein Unten. Der Raumgleiter ist schon nicht mehr zu sehen. Selbst die mächtige Hülle der Neuen Welt, ihre langjährige Heimat im Weltall, schrumpft schnell zu einer spielzeuggroßen Röhre. Absolute Stille, die nur durch ihre eigenen hastigen und angstvollen Atemgeräusche durchbrochen wird.
„Du bist verdammt mutig“, hatte Borna damals zu ihr gesagt, bevor sie ihre irrwitzige Idee umgesetzt hatte, auf die Außenhülle des Gleiters zu klettern.
„Oder dumm“, hatte Jo entgegnet und damit wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Mut und Dummheit befruchten sich gegenseitig. Mut ist ohne eine gehörige Dosis Dummheit wahrscheinlich gar nicht möglich. Tapferkeit und Heldenmut sind nämlich gefährlich. Helden sterben meistens früh. Sie war keine Heldin und wunderte sich noch heute manchmal über ihre damalige Spontanität.
Aber es war die richtige Entscheidung gewesen. Sie hatte das Schiff und Tausende seiner Bewohner vor dem Untergang bewahrt. Oberstleutnant Finney, der seit einigen Wochen im Auftrag der Solaren Streitkräfte den Posten eines leitenden Inspektors auf der Station einnahm, hatte das bei seiner Antrittsrede mit salbungsvollen Worten hervorgehoben, was Jo äußerst peinlich gewesen war.
„Mut, Entschlossenheit und die Bereitschaft, im richtigen Moment über sich hinauszuwachsen, und sei das persönliche Risiko noch so groß“, hatte Finney in seiner knappen abgehackten Sprechweise verkündet, „das sind die Eigenschaften, die unsere Heimat vor allen Bedrohungen von außen in Zukunft bewahren werden.“
Dabei hatte er in seiner enganliegenden dunkelblauen Uniform dagestanden, wie sein eigenes Denkmal und die Augen entschlossen in alle Richtungen blitzen lassen.
Als Jo ins Solsystem gekommen war, hatte sie gehofft, nie mehr eine Waffe in die Hand nehmen zu müssen, was sich in Anbetracht der jüngsten politischen Entwicklungen jedoch leider kaum noch würde vermeiden lassen. Jos Desintegrator ruhte in einem verschlossenen Spind in ihrem Quartier. Es war seit Kurzem Vorschrift, dass alle Angehörigen der Solaren Flotte ihre Dienstwaffe in greifbarer Nähe aufbewahren mussten. Und sie war nun Angehörige der Solaren Flotte. Denn sie hatte einen neuen Job. Sie war rekrutiert worden. Es empfahl sich wohl nicht, es laut auszusprechen, aber man hatte ihr dabei keinen großen Entscheidungsspielraum zugestanden.
Der Föderationsrat machte sich Sorgen. Und wer die Nachrichten verfolgte, kam wohl nicht umhin, diese Sorgen als berechtigt zu betrachten. Vielleicht wäre es übertrieben, in dem Zusammenhang von einer allgemeinen Mobilmachung zu sprechen, aber die Werften auf Luna arbeiten immerhin seit Monaten auf Hochtouren. Und es waren keine Vergnügungsschiffe, die dort in den vollautomatischen Anlagen entstanden.
Jo lebte jetzt seit knapp sechs Jahren im Solsystem, von wo ihre Vorfahren vor Jahrhunderten ins All aufgebrochen waren. Ihr Ziel damals, ein Planet der 28 Lichtjahre von Terra entfernt lag, erschien heute nicht besonders ambitioniert, aber zum Zeitpunkt ihres Aufbruchs hatte es noch keinen Überlichtantrieb gegeben, und deshalb war es eine Reise für mehrere Generationen gewesen.
Die Raumstation, in der Jo heute lebte und arbeitete, umrundete noch immer den Mars. Allerdings entwickelten sie in den Laboratorien nicht mehr spezielles Saatgut für den roten Planeten, dessen Terraforming inzwischen so weit gediehen war, dass Menschen dort in vielen Regionen ohne Schutzanzug leben und ihre Plantagen bewirtschaften konnten. Sie konstruierten seit Neuestem intelligente Bullets, eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Photonenbullets, die die Sprengkraft ihrer Vorgänger bei weitem übertreffen sollten.
Nicht wenige fragten sich, wozu das nötig war. Nun, es ging mal wieder um das Gleichgewicht der Kräfte, das sollte wohl jedem ein Begriff sein. Waffengleichheit, Abschreckung, dieses Prinzip war ja in der Vergangenheit schon oft zwischen Völkern und Staaten erfolgreich gewesen. Zumindest so lange, bis eine der abschreckenden Parteien die Abschreckung nicht mehr abschreckend genug fand. Und die Kriegsschiffe des Kaiserreichs Jia hatten nicht nur mächtige Waffen, sondern auch hochwirksame Schutzschirme, die es im Ernstfall zu überwinden galt.
Jo war von Haus aus Biologin, also alles andere als eine Soldatin. Den Großteil ihres Lebens hatte sie auf dem Auswandererschiff Neue Welt verbracht, das vor über vierhundert Dekaden (hier sagte man dazu Jahre) von einer politisch fragilen und durch Umweltgifte verseuchten Erde aufgebrochen war, um eine neue Heimat im All zu finden. Jo gehörte zu der letzten Generation, die auf der Neuen Welt geboren worden war. Sie alle hatten nichts anderes gekannt als das Leben innerhalb einer zugegebenermaßen riesigen, aber dennoch von einer massiven Hülle aus Stahl und Kunststoff begrenzten Welt.
Als sie sich schließlich ihrem vermeintlich unberührten Paradies genähert hatten, mussten sie feststellen, dass es besetzt war. Sie waren schlichtweg von anderen Auswanderern überholt worden. Während der langen Fahrt der Neuen Welt hatte man auf der Erde einen Weg gefunden, schneller als das Licht zu reisen. Während ihre Vorfahren in dem Raumschiff noch geglaubt hatten, ihre Kinder und Enkel würden einen unbewohnten Planeten besiedeln, hatte sich auf Virginis c längst eine fortschrittliche Zivilisation etabliert.
Wie sich herausgestellt hatte, war dies eine martialisch geprägte Gesellschaft, ein Kaiserreich, in dem Disziplin und Askese überdurchschnittlich bedeutende Rollen spielten. Das Kaiserreich Jia pflegte Handelsbeziehungen mit dem Solsystem, hatte aber von Anfang an großen Wert auf Unabhängigkeit und diplomatische Distanz gelegt. Die Auswanderer waren in der „neuen Heimat“ aufgenommen worden. So sparsam jedoch die Bewohner von Jia, wo Geschwätzigkeit als eine Art Todsünde galt, es mit der Kommunikation hielten, so knapp dosierten sie auch ihre Gastfreundschaft. Einem Teil der Auswanderer gelang es, sich erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren, viele jedoch hatte es bald nach Terra gezogen, einer Heimat, die sie nur aus spärlichen Archivaufzeichnungen der Neuen Welt kannten. Vor allem Personen, für die das Kaiserreich aufgrund ihrer Qualifikationen keine konkrete Verwendung hatte, wurde die Ausreise mit mehr oder minder spürbarem Druck nahegelegt.
Jo hatte zu denen gehört, die relativ früh und aus freien Stücken Jia verlassen hatten. Aber bei ihr hatte das andere Gründe gehabt. Es waren Angstzustände gewesen, derer sie nur schwer Herr werden konnte. Der freie Himmel, der endlose Horizont, Wind und Regen und viele andere Einflüsse, die auf der Oberfläche eines Planeten wirkten, waren für sie dauerhaft beunruhigend gewesen. Auch nach Ablauf von zwei Jahren hatte sie sich nicht daran gewöhnen können. Vierunddreißig Dekaden innerhalb eines stählernen Kokons, auch wenn er mehrere Kilometer lang gewesen war, prägten den Menschen wie eine Wohnungskatze, die nach einem Leben innerhalb der beengten vier Wände plötzlich verstört auf der Schwelle der geöffneten Haustür steht.
Irgendwie waren ihr derlei Ängste am Anfang peinlich gewesen. Denn offenbar waren die meisten anderen Auswanderer besser damit klargekommen. Zumindest hatten sie sich nichts Gegenteiliges anmerken lassen. Aber wer weiß. Balta jedenfalls hatte Jo gegenüber in einer schwachen Stunde eingestanden, dass sie mit Schlafstörungen und häufigen Schweißausbrüchen zu kämpfen hatte, seit sie auf Virginis c lebte. Balta war damals noch mal von Keanoo schwanger geworden.
„Weißt du, Jo, ich wünsche mir, dass mein Kind auf der Erde aufwächst“, hatte Balta zu Jo gesagt. Da war sie schon im achten Monat gewesen. Balta hatte sich dafür entschieden, das Kleine selbst auszutragen, trotz der vielen Beschwerden, die sich oft bei intrakorporalen Schwangerschaften einstellten. Längst spielte die Tatsache, dass Jo auf der Neuen Welt über einen längeren Zeitraum mit Keanoo, Baltas Mann, intim gewesen war, keine Rolle mehr zwischen ihnen. Im Gegenteil, Jo und Balta waren beste Freundinnen geworden.
Jo erinnerte sich, wie sie neben Balta auf der Veranda ihres flachen Bungalows gesessen hatte. Leichter Wind hatte die Vorhänge an den großen Fenstern nach innen geweht, und die rote Sonne von Jia hatte die hügelige Landschaft mit Inseln aus Zypressen in ein beinahe goldenes Licht gehüllt. Jo hatte ihre Hand auf Baltas beträchtliche Bauchwölbung gelegt und sie mit den Fingerspitzen gestreichelt. Sie hatte das glückliche Funkeln in Baltas Augen gesehen. Schwangere Frauen liebten es offenbar, wenn ihre Kinder im Mutterleib von nahestehenden Personen liebkost wurden. Es war vielleicht dieser Moment gewesen, der die werdende Mutter und Jo endgültig zusammengeschweißt hatte.
Wenige Tage nach Chiaras zweitem Geburtstag hatten Jo, Balta und Keanoo sich gemeinsam mit dem kleinen Mädchen an Bord des Frachters Kuáilé begeben, der das Solsystem zum Ziel hatte.
„Woran denkst du?“, fragte Stella, stützte sich auf einen Ellenbogen und richtete sich halb auf, wobei das Laken ihre kleinen Brüste freigab. Ihr Lächeln hatte verblüffende Ähnlichkeit mit dem von Keanoo, wie Jo es aus der Zeit an Bord der Neuen Welt kannte, nachdem sie sich in ihrem Quartier geliebt hatten. Die Ähnlichkeiten mit Keanoo in der Mimik, den Augen und in der Art, wie Stella ihre Mundwinkel kräuseln konnte, war nicht nur verblüffend. Beunruhigend wäre vielleicht das passendere Adjektiv gewesen, obwohl Jo natürlich wusste, dass es zur Beunruhigung keinen Anlass gab.
Stella war eine Computersimulation, ein physisches Hologramm. Eine Projektion aus Photonen und Kraftfeldern, die nach Bedarf jede äußere Form annehmen konnte. Stella war ein Bot, einer der Assistenten, wie sie den meisten auf der Station lebenden Technikern und Wissenschaftlern zur Verfügung standen, um ihnen das Leben zu erleichtern. Es gab viele dieser Assistenzprogramme. Manche hießen Stella, andere Ornella, Magnus oder Heros. Nicht wenige von Ihnen arbeiteten in der Entwicklung und in der Fertigung. Alle in Positionen, die ein hohes Maß an komplexen kognitiven Fähigkeiten erforderten.
„Bist du eine Frau oder ein Mann, Stella“, hatte Jo das Hologramm gefragt, an dem Tag, als sie das Programm „Stella“ zum ersten Mal aufgerufen hatte. Diese Frage war ihr so spontan über die Lippen gekommen, dass sie sie sofort danach bereut hatte. Das schmale Gesicht, die kurzen dunklen Haare, die angenehm warme Stimme, das alles hätte ebenso gut zu einer maskulinen Frau wie zu einem femininen Mann oder eben einem Gender passen können. Die Haltung war grazil, die Unterarme wirkten muskulös und trotzdem fein.
„Ich bin was immer du willst, Jo“, hatte Stella mit einem offenen Blick geantwortet, und ihre Augen und der Mund hatten auf einmal sinnlicher gewirkt als zuvor.
Stella hatte gewusst, dass Jo als Gender mit beidem etwas anfangen konnte. Überhaupt wusste Stella viel. Längst war Jo klar geworden, dass sie viel mehr war als ein Computerprogramm. Ihre Entwicklung hatte sich längst über die ursprünglichen Möglichkeiten erhoben, die ihre Schöpfer bei der Programmierung erreichen wollten.
Liebe war ein sehr schwer fassbarer Begriff. Darunter verstand schließlich jeder etwas anderes. Es gab diejenigen, die Liebe als eine Interaktion verschiedener chemische Prozesse betrachteten, und es gab die Romantiker, zu denen sich Jo, bei allem Realismus, eher zählte. Hatte sie Keanoo geliebt? Früher in einem anderen Leben auf der Neuen Welt? Damals war sie davon überzeugt gewesen. Aber verdammt, war es das wirklich gewesen? Irgendwie empfand sie heute Stella gegenüber beinahe dasselbe.
Liebe, was immer man darunter verstand, konnte es doch nur unter organischen Lebensformen geben, die nicht nur eine gewisse Bewusstseinsstufe erreicht hatten, sondern darüber hinaus die Fähigkeit zur Empathie besaßen. Im Prinzip war Stella ein Roboter, wenn auch ein hochentwickelter. Und sie war nicht einmal mechanischer Natur, hatte keine stoffliche Existenz, sondern wurde von ungeheuer komplizierten Algorithmen erschaffen. Algorithmen, die so komplex waren, dass Menschen sie kaum noch würden nachvollziehen können, sollten die die Möglichkeit dazu bekommen. Aber die biopositronischen Rechner, die hinter diesen Vorgängen standen, agierten in einer Cloud, auf die ihre Konstrukteure längst keinen Zugriff mehr hatten. All diesen Assistenzprogrammen, ob sie nun Stella, Ornella, Magnus oder Heros hießen, wohnte jedoch ein Kodex inne, der viele Jahrhunderte alt war. Nämlich der, dass der Schutz und die Unterstützung menschlichen Lebens oberste Priorität besaßen. Früher einmal hätten Roboter im Ernstfall die eigene Zerstörung in Kauf genommen, um einen Menschen zu schützen. Heute war das nicht mehr notwendig, denn ein Hologramm konnte man nicht zerstören. Es konnte jederzeit an jedem Ort neu erzeugt werden.
„Woran denkst du?“, fragte Stella erneut, beugte sich über Jo und streichelte mit den Fingerspitzen sanft über ihre auf dem muskulösen Körper nur rudimentär ausgebildeten weiblichen Formen. „Du bist mit den Gedanken so weit fort.“
„An nichts Besonderes“, erwiderte Jo und merkte, dass ihr Ton ungewollt barsch ausgefallen war. Es gab Momente, in denen sie die intensive Nähe von Stella unglaublich genoss, wie zum Beispiel noch vor ein paar Minuten, als sie sich aus ihrer leidenschaftlichen Umarmung gelöst hatten. Jetzt sah Stella Jo mit einem liebevollen Lächeln ins Gesicht, das sie auf eine unerklärliche Weise beunruhigend fand. Es lag eine Art von Wissen darin, die irgendwie unangenehm war.
„Sei nicht böse“, sagte Jo knapp, „aber ich muss jetzt mal allein sein. Programm Stella beenden.“
Sie merkte, dass Stella leicht zusammenzuckte. Für einen langen Moment sahen sie sich an. Ein Moment, der länger war, als er sein sollte. Jo dachte an einen Systemfehler, blickte in Stellas trauriges Gesicht, glaubte einen bitteren Zug in ihren Mundwinkeln zu erkennen. Dann verblasste das Hologramm und Stella löste sich auf.
Seltsam, dachte Jo. Das war in den letzten Tagen schon mehrmals vorgekommen. Natürlich war es unfreundlich, Stella so abrupt zu deaktivieren. Ein bisschen kam sie sich vor wie jemand, der einen Liebhaber abserviert, nachdem er bekommen hat, was er wollte. Aber man musste sich vor einer Projektion aus Lichtpartikeln und Magnetfeldern nicht rechtfertigen, oder?
Die Gefühle, die Stella ihr vermittelte, waren so echt, wie sie echter von einem geliebten Menschen nicht sein konnten. Liebe war vielleicht auch nur etwas, was man in sein Gegenüber hineinprojizierte. War nicht jedes Gefühl letztlich eine Projektion? Wenn man sich nur tief genug auf ein Gefühl einließ, glaubte man in seinem Gegenüber alle guten Eigenschaften zu entdecken, die man sich an ihm wünschte. Zumindest war das in der ersten Zeit der heftigen Verliebtheit so. Konnte es sein, dass diese Zeit zwischen Stella und ihr sich dem Ende näherte?
Wehmut keimte in Jo auf. Irgendwie ging alles immer wieder zu Ende. Die Zeit auf der Neuen Welt. Ihre Liebe zu Keanoo, Baltas Mann. Die Liebe zu Stella. Der Frieden im Sol-System?
Fehlfunktionen mussten gemeldet werden. Fehlfunktionen in einem System, egal an welcher Stelle, konnten auf einer Raumstation verheerende Auswirkungen haben, weil alles mit allem zusammenhing. Wenn das Programm Stella eine Fehlfunktion hatte, war das nicht ungefährlich. Man stelle sich nur vor, die Steuerung der Kraftfelder wäre schadhaft. Dann konnte eine zärtlich gemeinte Umarmung möglicherweise tödlich enden.
Die Programmierung des Systems war nicht Jos Fachgebiet. Aber vor solchen Pannen musste die oberste Direktive für alle künstlichen Lebensformen greifen, nämlich menschliches Leben um jeden Preis zu schützen.
Das melodische Signal der Komm-Einheit kündigte eine Nachricht an. Incoming message blinkte am unteren Rand einer Projektionsfläche auf, die mitten im Raum entstanden war. An den Piktogrammen erkannte Jo, dass es sich um eine Bildnachricht von der Erde handelte.
Jo richtete sich auf und setzte sich auf den Rand des Bettes. Sie war nackt. Das machte aber nichts. Der Anrufer würde sie nicht live sehen können, denn eine Übertragung von der Erde zur Marsstation benötigte aktuell etwa vierzehn Minuten. Jo zog die Knie an und stemmte die Füße auf den Rand des Bettes.
„Nachricht anzeigen“, befahl sie, und das Bild einer etwa vierzigjährigen Frau mit dunklen halblangen Haaren, die an den Seiten von grauen Strähnen durchwirkt waren, entstand vor ihr, als befände sie sich mit ihr im gleichen Raum. Es war Balta.
2
Terra, Nordhalbkugel
Nervös stoben die heraneilenden Regentropfen vor der Frontscheibe des kleinen Personengleiters auseinander. Das Fahrzeug bewegte sich flink oberhalb der bis in die tiefhängenden Wolken ragenden Gebäude Lutetias. Die Wohntürme ragten wie Nadelspitzen empor und wurden von kaum überschaubaren Scharen unterschiedlicher Flugkörper umschwirrt. Vereinzelt zuckten Blitze über den grauen Himmel.
Als der Gleiter seine Flughöhe etwas reduzierte, konnte Balta rechts unter sich zwischen dem Place de la Concorde und dem Musée de Louvre einen kurzen Abschnitt der Seine erkennen, der nicht von Straßen und Gebäuden überbaut worden war, deren geschwungene Architektur der Schwerkraft zu trotzen schienen. Der Tour Eiffel wirkte beinahe unscheinbar zwischen mehreren wuchtigen Türmen mit Balkonen und Plattformen, die dem äußeren Eindruck nach nur aus Glas zu bestehen schienen. Baltas Gleiter tauchte jetzt in eine tiefere Ebene der Straßenschluchten ab und überflog bald die weniger dicht besiedelten Außengebiete, in denen sich flachere Gebäude mit Grünanlagen abwechselten. Dort, wo der Einfluss der Tempesta-Injektoren endete, war die Landschaft von Eis und Schnee bedeckt. Kollegen, die auf Terra geboren waren, hatten Balta erzählt, dass es in dieser Region vor Jahrhunderten Wälder aus riesigen Agaven und Kakteen gegeben hatte. Die tropische Gluthitze hatte damals sogar den Anbau von Olivenbäumen und Dattelpalmen beinahe unmöglich gemacht. Als jedoch dann gegen Ende des 22. Jahrhunderts der Golfstrom versiegt war, hatten arktische Temperaturen in Nord- und Mitteleuropa Einzug gehalten.
Die ausgedehnten Anlagen des Zentrums für Versorgungswirtschaft befanden sich nahe der Küste. Die früheren Städte Le Havre, Dieppe und Rouen waren zu einer Supermetropole zusammengewachsen, die den so klangvollen wie unangemessenen Namen Arcadia trug. Ein großer Küstenabschnitt ein paar Kilometer nördlich davon war bis weit ins Hinterland mit flachen Kuppelbauten und langgezogen, quaderförmigen Konstruktionen übersät, unter denen sich Labore, Büros und Produktionsstätten des Versorgungszentrums verbargen. Bei den aktuellen Wetterbedingungen wirkten die Kuppeln grau und düster wie zähe Tropfen schmutzigen Quecksilbers. Balta wusste, dass sie bei Sonnenschein silbern und freundlich schimmerten. Zwischen den Kuppeln schlängelten sich unzählige beheizte Wege und Transportbänder durch die ewige Schneelandschaft.
Der Gleiter senkte sich auf eine der Kuppeln nieder, an deren Hülle sich für kurze Zeit eine beleuchtete rechteckige Öffnung bildete, die verschwand, sobald Balta mit ihrem Fluggerät hindurchgeschwebt war.
„Probier das“, sagte Konal Preysser, ein stämmiger Kollege mit kleinen, immer lustig blitzenden Augen und hielt Balta einen weißen Becher mit einer gelben Flüssigkeit hin, sobald sie das Labor betreten hatte.
„Hallo, Ko“, sagte Balta, „Probe neunzehn?“ Sie nahm den Becher, der aussah wie eine Urinprobe, entgegen und nippte an der Flüssigkeit. Sie bewegte die Flüssigkeit einen Moment am Gaumen hin und her und schluckte dann. „Ziemlich nah dran, oder? Was meinst du?“, fragte sie.
Konal ließ seinen runden, fast haarlosen Kopf ein paar Mal hin und her pendeln und blinzelte freundlich. „Wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das Original schmeckt. Aber ich find`s lecker.“
„Geben wir es in die Endkontrolle?“
„Lass uns das morgen machen, okay? Dann will ich noch ein paar Justierungen versuchen. Aber ich hab` s jetzt eilig. Justine und ich haben doch das Alpin-Abo. Das wollten wir heute Abend mal versuchen.“
„Haha, aber fall mir nicht in eine Schlucht“, lachte Balta.
„Zum Glück sind virtuelle Schluchten nicht so tödlich“, entgegnete Konal und zwinkerte mit einem Auge.
„Hauptsache wir können den Apfelsinensaft noch diese Woche ins System einspeisen. Es kommen jeden Tag mehr Anfragen und Beschwerden“, sagte Balta. „Dann wünsch ich dir einen schönen Feierabend. Und euch beiden ein fröhliches Klettern. Schick mir ein Bild vom Gipfelkreuz als Beweis, ja?“
„Geht klar.“ Baltas Kollege verließ das kleine Labor. Balta hatte allein die Spätschicht übernommen. Es würde vermutlich ruhig sein heute Nacht. Es wäre gut, wenn die Rezeptur für den künstlichen Apfelsinensaft endlich online gehen konnte. Seit vielen Jahren waren Säfte von Zitrusfrüchten in den Programmen der Replikatoren Europas und großer Teile des asiatischen Kontinents nicht mehr enthalten, weil Terra durch Lieferungen natürlicher Säfte vom Kaiserreich Jia über lange Zeit förmlich überschwemmt worden war. In der äquatorialen Zone Jias wuchsen Apfelsinen- und Zitronenbäume praktisch wie Unkraut.
Das hatte so lange funktioniert, bis die Solare Föderation eine ganze Latte von Produkten aus dem Virginis-System mit empfindlichen Strafzöllen belegt hatte. Das war, wenn man es genau nahm, ein eklatanter Verstoß gegen das bestehende Freihandelsabkommen gewesen, aber wer nahm solche Dinge heute noch genau? Niemand scherte sich anscheinend noch um getroffene Vereinbarungen.
Die Kaiserin von Jia hatte daraufhin jedenfalls den Export der mit Strafzöllen belegten Produkte komplett unterbunden und ihrerseits Zölle auf Exporte von Terra erhoben. Hauptsächlich betraf das die Bereiche Feinmechanik, Quantentechnologie und Robotik. Dass beide Seiten sich dadurch nur selbst schadeten, schien keine Rolle zu spielen. Auch darum scherte sich heutzutage niemand mehr.
Dabei war der Umgang mit dem Kaiserreich bei allem martialischen Gehabe immer mehr oder weniger freundschaftlich gewesen. Mit Sorge beäugte der Föderationsrat seit Monaten den kränklichen Zustand der alten Kaiserin, die inzwischen über hundertachtzig Jahre alt sein musste. Genau wusste man das auf Terra nicht. Nach ihrem Tod würden mit einiger Sicherheit die beiden Söhne die Macht übernehmen. Und denen traute man hierzulande so einiges zu, was nicht allzu bekömmlich für eine friedliche Koexistenz war.
Alles in Allem war das Leben auf Terra nicht mehr so, wie Balta es noch bei ihrer Ankunft vorgefunden hatte. Vor allem für Chiara wünschte sie sich eine sichere Umgebung, in der sie unbeschwert und mit allen Möglichkeiten aufwachsen konnte. Und dabei waren seit ihrer Ankunft nicht einmal sechs Jahre vergangen.
Ein Hauptgrund, Virginis mit ihrer kleinen Familie zu verlassen, war die strenge und asketische Lebensweise der Menschen in Jia gewesen. An die absolute Unterwerfung an die Obrigkeit und die militärische Art zu reden, die sich auch weit in zivile Bereiche ausdehnte, hatte sie sich nie gewöhnen können. Nun musste Balta feststellen, dass sich auch in der terranischen Gesellschaft mehr und mehr ähnliche Tendenzen abzeichneten. Mit ihrem Kollegen Konal hatte sie darüber diskutiert, aber der war der Auffassung, dass das politische Säbelrasseln mit dem Bellen eines Hundes gleichzusetzen sei, der nicht beißt.
Beide Parteien, sowohl Jia als auch Terra, verfügten immerhin über genügend Massenvernichtungswaffen, um sich gegenseitig auszulöschen. Und gerade deshalb würde am Ende immer die Vernunft siegen, meinte Konal. Experten, die man in den Nachrichten hören konnte, vertraten die gleiche Auffassung. In der Vergangenheit hätte das Gleichgewicht der Kräfte noch immer für dauerhaften Frieden gesorgt, hieß es dort. Dabei würde es auch kaum eine Rolle spielen, dass das Kaiserreich über erheblich mehr Kriegsschiffe verfügte als die Solare Flotte. Man habe lediglich zu lange darauf vertraut, dass der Frieden für alle Zeiten gesichert war. Aber die Föderation war dabei, dieses Ungleichgewicht auszugleichen.
Balta setzte sich in einen der bequemen Schalensessel des Labors und aktivierte ihr individuelles Holodisplay. Die Laborpositronik verband sich mit ihrem Kortikalimplantat, und vor ihren Augen erschienen Versuchsanordnungen, Entwicklungsprotokolle und Diagramme chemischer Verbindungen. Ebenso gut hätte sie diese Arbeit von zu Hause aus erledigen können, aber sie liebte die nächtliche Ruhe im Labor. Hier fühlte sie sich ungestört.
Auch wenn Chiara um diese Zeit schlief, war Balta dennoch in ihrer komfortablen Wohnung im zweiunddreißigsten Stockwerk einer Wohnanlage im Norden von Choisy-le-Roi weniger konzentriert bei der Arbeit, als hier im abgeschiedenen Labor, ohne Sicht nach draußen auf die Millionen Lichter der großen Stadt, in der es niemals eine richtige Nacht gab.
Außerdem konnte sie von hier aus (und wenn man ehrlich sein wollte, war das der eigentliche Grund, warum sie heute hier war) über die Komm-Anlage des Labors die Marsstation erreichen. Von zu Hause aus war dies seit Wochen schon nicht mehr möglich. Angeblich konnten die Service-Bots keinen Grund für die Störung finden. Am Anfang hatte es geheißen, ein Relaismodul auf Deimos sei ausgefallen, aber das müsste inzwischen längst ersetzt worden sein. Keanoo, der vor zwei Wochen wieder zu seinem Dienst im Capella-System aufgebrochen war, hatte seinen „pickeligen Arsch“ darauf verwettet (Zitat Ende), dass die Föderation (wer auch immer da im Moment das Sagen hatte – der Außensenator, der Verteidigungsrat oder der Geheimdienst) im Moment keinen besonderen Wert auf private Komm-Verbindungen von Terra zu Außenposten wie Luna, Mars oder dem Asteroidengürtel legte. Angeblich gab es eine terroristische Vereinigung, die durch Aktionen aus dem Untergrund versuchte, die neuen Sicherheitsmaßnahmen der Raumflotte zu behindern.
Die vor einigen Tagen explodierte Fusions-Kraftzentrale auf Luna wurde mutmaßlich dieser Terrorzelle zugeschrieben. Vier Menschen waren ums Leben gekommen, als die Anlage in die (auf dem Mond bekanntermaßen nicht vorhandene) Luft geflogen war. Andere Meinungen hielten es für wahrscheinlicher, dass der Anschlag von Agenten des Kaiserreichs Jia verübt worden war. Noch fantasiebegabtere Zeitgenossen waren davon überzeugt, dass die Föderation selbst sich auf diese Weise einen Anlass für weitere Aufrüstungen der Flotte verschaffen wollte. Aus Baltas Sicht waren das aber Verschwörungstheoretiker. Wahrscheinlicher war, dass ganz einfach auf Luna die Wartungsbots versagt hatten. Immerhin gab es nicht wenige Stimmen in der Bevölkerung, vor allem der Marskolonien, die sich über die immensen Kosten mokierten, die von den Werften verursacht wurden.
Mit einer Handbewegung ließ Balta die Projektion des Periodensystems vor ihrem Gesicht verschwinden.
„Komm-Video. Mars-Orbiter 3“, sagte sie zu dem leeren Laboratorium, „Ebene 8, Quartier Betha 0702. Aufzeichnung.“
Mitten im Labor manifestierte sich eine Art Fenster. Der Hintergrund der rechteckigen Fläche schimmerte türkis. In der unteren linken Ecke entstand das Schema des Solsystems. Die Planeten kreisten in unterschiedlichen Bahnen um die Sonne.
Keanoo hatte ihr schon vor seiner Abreise nahegelegt, sich mit Jo in Verbindung zu setzen und zu fragen, was sie von der Sache hielt. Keanoo war der Skeptiker in der Familie.
„Ich traue denen nicht über den Weg“, hatte er gesagt, „die führen was im Schilde, was Großes.“
Balta glaubte nicht, dass die Föderation der Bevölkerung ernsthaft wichtige Informationen vorenthielt, aber etwas beunruhigt war sie auch. Nicht umsonst wurden immer mehr zivile Produktionsstätten auf die Herstellung von militärischem Equipment umgestellt. Und auch das Zentrum für Versorgungswirtschaft verfügte seit Neuestem über einen Berater der Solaren Flotte, der dem eigentlichen Institutsleiter zur Seite stand. Genau genommen war das eine Verniedlichung, denn Doktor Dupreux musste neuerdings jede einzelne Entscheidung von Colonel Koroljow absegnen lassen.
„Würde mich nicht wundern, wenn ihr statt Zuckerhefe demnächst Ammoniumnitrat herstellt“, hatte Keanoo gesagt und seine dunkle Stirn dabei in Falten gelegt. Er hatte es sicher nicht ganz ernst gemeint, und Balta hatte ihm einen Kuss gegeben und dabei das Kraushaar auf seinem Kopf zerwühlt, das inzwischen fast vollständig grau war. Balta konnte sich gut an die Zeit erinnern, als sie auf der Neuen Welt alle mit kahlen Köpfen herumgelaufen waren. Sie hatten es nicht anders gekannt damals, und Kopfhaare hatten als ungepflegt gegolten.
Manchmal, wenn Keanoo konzentriert mit etwas beschäftigt war, beobachtete sie noch heute fasziniert, wie seine Floatattoos vom Hals an aufwärts wanderten und unter seinem Haarschopf verschwanden. Sie wettete dann im Stillen mit sich selbst, an welcher Stelle sie erneut auftauchen würden. Das war auch so eine Modeerscheinung, die damals auf der Neuen Welt aufgekommen war: Floatattoos, die in der Form von Pflanzen, Tieren oder Fantasiemustern unter der Haut umhermäanderten als würden sie von einem Zufallsgenerator gesteuert, was auch in etwa zutraf.
Balta war damals diesem Trend nicht gefolgt, mochte die Dinger aber an ihrem Mann. Jo hatte auch ein paar Schmetterlinge und kleine Schlangen, die auf ihr herumwanderten. Manchmal war es witzig zu beobachten, an welchen Stellen sie auftauchten. Vor allem wenn man wenig anhatte, und intensiv Zeit miteinander verbrachte.
Beinahe hatten Keanoo und sie sich damals auseinandergelebt, nachdem ihr einziger Sohn Seth ums Leben gekommen war. Aber sie hatten es geschafft, die schwere Zeit durchzustehen. Und wenn sie der kleinen Chiara heute in die Augen sah, glaubte sie manchmal Seth vor sich zu haben.
Auf dem virtuellen Fenster im Labor war jetzt eine Abbildung der Marsstation zu sehen, die sich langsam um die eigene Achse drehte. Dann machte sie dem Standbild eines Genders mit langen blonden Haaren Platz. Jo sah immer noch verdammt gut aus. Das Bild mochte ein paar Jahre alt sein, aber Balta konnte ihren Mann heute noch gut verstehen. Die markanten Züge strahlten Optimismus und eine Spur freundlichen Spotts aus, vereinigten weibliche und männliche Elemente gleichermaßen in einer perfekten Symbiose. Balta hatte viel zu lange nicht mit der Freundin gesprochen.
„Aufzeichnung starten“, sagte sie.
3
Capella-System
„Sonde 06, da ist sie!“, rief Rena und reckte ihren rechten Arm mit ausgestrecktem Zeigefinger einem der Bildschirme entgegen. Der Arm war mit einem dünnen Flaum aus rötlichen Härchen bedeckt, aber der Anblick der kleinen orangen Kugel, die wie aus dem Nichts in einem Abstand von einhundertneun Kilometern vor der Clarion aufgetaucht war, schlug für Keanoo einen Moment lang die Attraktivität seiner jungen Kollegin um Längen.
Mit fiebrigen Augen starrte er auf die Live-Übertragung aus dem Weltall. Sonde 06 – das Objekt, das sich jetzt langsam der Clarion näherte, hatte einen Durchmesser von weniger als drei Metern und verfügte neben einer Vielzahl an Messinstrumenten lediglich über einen herkömmlichen Impulsantrieb. Das Spektakuläre an der Sonde war, dass sie fünfzehn Minuten vor dem Zeitpunkt aufgetaucht war, zu dem sie programmgemäß in die Singularität eintauchen sollte. Anders ausgedrückt, exakt dieselbe Sonde schwebte noch immer, durch ein Magnetfeld gebunden, dicht neben der Clarion und wartete auf ihren Start, während sie sich gleichzeitig dem Forschungsschiff näherte.
„Zwölf Minuten bis zum Start“, sagte Rena und schenkte Keanoo ein strahlendes Lächeln. Die roten Locken umrahmten ihr helles Gesicht, und die grünlichen Augen schimmerten im gedämpften Licht der Observationskuppel wie zwei Smaragde.
Verdammt, dachte Keanoo und fragte: „Wie war jetzt die Eintauchgeschwindigkeit?“
„Zweihundertsiebzig Kilometer pro Stunde“, antwortete Rena und sah ihn auf diese Art an, die er hasste. Oder liebte. Naja, Liebe war das falsche Wort, aber diese Abgeschiedenheit hier draußen, mehr als zweiundvierzig Lichtjahre von zu Hause entfernt, von Balta entfernt, konnte einem schon zu schaffen machen. Rena und er waren die einzigen Astrophysiker an Bord der Clarion.
Außer ihnen gab es nur noch eine dreiköpfige Crew, die jedoch ausschließlich für die Navigation des kleinen Schiffes verantwortlich war, ziemlich raue und wortkarge Typen. Ein ehemaliger Frachterkapitän und zwei Kerle, die früher mal als Maate auf Zerstörern oder Kreuzern der Raumflotte gedient hatten. Keanoo hatte auf der ganzen Fahrt hierher kaum mehr als vier oder fünf Sätze mit ihnen gewechselt, wusste aber, dass sie sich schon darauf freuten, bald wieder in den aktiven Dienst eingezogen zu werden.