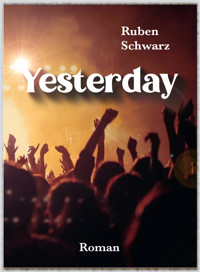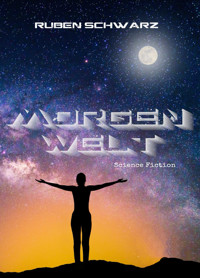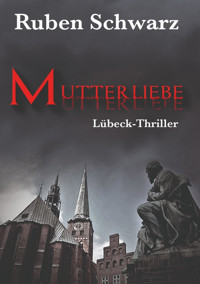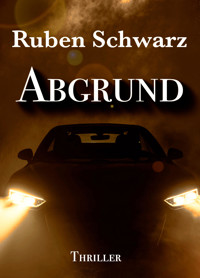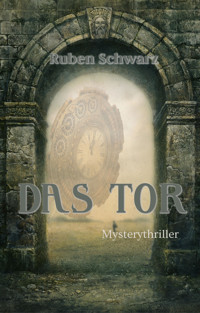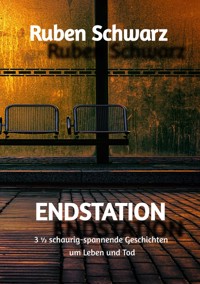3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die schöne und modebewusste Valerie Bensheim führt ein privilegiertes Leben. Die selbstbewusste Eventmanagerin ist nicht nur beliebter Stammgast in vielen Bars und Clubs ihrer Heimatstadt Hamburg, sondern sie kann auch jeden Mann haben, der ihr gefällt. Nur mit langfristigen Bindungen hat sie ein Problem. Und mit den düsteren Geheimnissen, die sie verbirgt. Als Valerie bei einem beruflichen Termin in Essen auf die bodenständige, etwas naive Gärtnerin Leonie stößt, stellt sich heraus, dass es viel mehr düstere Geheimnisse gibt, als sie dachte. Der glücklose Banküberfall von Angelique und Manuel, den Oberkommissar Lücke aufzuklären hat, ist dabei das mit Abstand harmloseste Verbrechen. Dieser etwas andere Krimi pendelt gekonnt zwischen prickelnder Erotik, gefühlvoller Nachdenklichkeit, schwarzem Humor und temporeicher Spannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ruben Schwarz
Astern und Designermode
Mord ist der Normalfall
© 2019 Ruben Schwarz
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7497-6372-6
Hardcover:
978-3-7497-6373-3
e-Book:
978-3-7497-6374-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
ASTERN UND DESIGNERMODE
1
„Bleib unten, verdammt!“
Das geht schief, dachte Manuel verzagt und übergab die Pistole nervös von der rechten in seine linke Hand. Ihm war viel zu heiß unter der kratzigen, roten Wollmütze. Als er zusammen mit Angel vorgestern mit der stumpfen Nagelschere die Sehschlitze in ihre beiden Mützen geschnitten hatte, eine günstige Anschaffung vom Wühltisch im Kaufhof, war er noch davon ausgegangen, damit später ein bisschen wie Spiderman auszusehen. Leider lagen die Löcher nicht auf gleicher Höhe und waren auch unterschiedlich groß geraten, so dass er ständig an den Maschen zupfen musste, um überhaupt hindurchschauen zu können. Die losen, fransigen Wollfäden des zerstörten Materials perfektionierten zusätzlich den Eindruck der Maskierung eines schon vor langer Zeit verstorbenen Bankräubers, der keinen Frieden findet und als Zombie umherirrt.
Trotzdem, oder gerade deshalb, war die Dame mittleren Alters im blauen Kostüm, die bäuchlings in der Schalterhalle der Sparkasse lag, eingeschüchtert und senkte ihr Gesicht so tief auf den Boden, dass ihre Nase fast die anthrazitfarbigen Fliesen berührte.
„Jetzt machen sie schon!“, rief Angelique, neben der Drehtür stehend, dem Kassierer hinter der Glasscheibe zu. Sie hatte sich ebenfalls eine rote Mütze über das Gesicht gezogen. Ihre Stimme wirkte schrill, fast hysterisch. Manuel bewegte sich mit schnellen Schritten auf den Kassierer zu und drückte den Lauf der Pistole gegen die Scheibe. „Mach schon, Arschloch, alles da rein! Wieviel hast du überhaupt hier?“
„Etwas über Neuntausend“, antwortete der Kassierer ruhig und legte ein Päckchen Fünfziger und eins mit Zwanzigern sorgfältig und bedächtig in die graue Sporttasche, die der Räuber ihm über die Glasscheibe geworfen hatte.
„Was? Mehr nicht!“, rief der junge Mann mit der Maske schockiert, „das ist doch hier ne Bank, oder nich? Ihr müsst doch Kohle ohne Ende hier haben. Doch wohl mehr als lumpige Neuntausend!“
„Na, klar, aber unten im Tresorraum natürlich. Hier oben brauchen wir normalerweise nicht so viel.“
Der ältere Mann, der nicht weit von der Frau im blauen Kostüm entfernt auf dem Boden lag und auf Grund seiner Korpulenz Probleme gehabt hatte, überhaupt in diese Position zu kommen, stemmte sich stöhnend mit den Händen hoch und schlug vor: „Das hat doch hier keinen Sinn, lassen sie das doch. Bestimmt kommt jeden Moment die Polizei. Wer überfällt denn heutzutage noch eine Sparkasse?“
„Wer hat dich denn gefragt, Fettsack!“, keifte der junge Mann und kratzte sich durch die Maske hindurch im Gesicht. Warum muss das bloß so scheißeheiß sein, hier drin, dachte er. Er ging auf den am Boden Liegenden zu und zielte mit der Waffe auf ihn. „Halt´s Maul und runter mit dir, klar? Oder es kracht!“
„Schon gut, schon gut“, beschwichtigte der Ältere. Irgendwie schien er nur mäßig beunruhigt.
„Mensch, Manu, lass den Alten, kümmer dich um das Geld und mach hinne!“, rief Angelique vom Eingang her. Nervös blickte sie durch die Glasfassade nach draußen, wo sich zum Glück weder neue Bankkunden noch die Polizei näherte.
„Verdammt, Angel, du sollst keine Namen nennen!“, herrschte Manuel sie an. „Los, Arschloch, komm da raus und bring mich zum Tresorraum!“, wandte er sich dann wieder an den Kassierer. Der kramte in seiner Anzugtasche umständlich nach einem Schlüsselbund.
„Wir haben keine Zeit mehr!“, schrie Angelique, „los, her mit der Tasche!“
„Genau, her damit, wirf sie oben drüber!“, ergänzte der Bankräuber. Er spürte, dass ihm der Schweiß vom Kinn abtropfte. Und er bereute plötzlich, dass er auf Angel gehört hatte. Einfach abhauen mit den Taschen voller Geld und auf Ibiza ein neues Leben anfangen, das war ihre Idee gewesen.
Der Kassierer zog den Reißverschluss der Sporttasche zu und brachte sich in Position. Beim ersten Versuch prallte die Tasche am oberen Rand der Glasbarriere ab und fiel nach innen zurück auf den Tresen des Kassenraums.
„Bist du lebensmüde?“, brüllte Manuel. Der Kassierer holte mit einer annähernd kreisrunden Armbewegung Schwung und die kaum gefüllte Tasche schwebte wie gewünscht über den Glasrand. Manuel fing sie mit einer Hand auf. Sie war federleicht. Draußen ertönte das Signalhorn eines Polizeiwagens. Zwei Signalhörner. Oder drei.
„Manu, komm schnell!“, kreischte Angelique panisch.
„Nenn mich nicht … Ach, fick dich doch!“ Er rannte, die Tasche in der linken, die Knarre in der rechten Hand, zu seiner Freundin. Hektisch schob er diese vor sich her in die gläserne Drehtür und stolperte dabei über ihre Füße. Mit der rechten Hand stieß er gegen den Rand der Drehtür und verlor die Pistole. Als er sich bückte, um sie aufzuheben, stieß die nachfolgende Glaswand gegen sein Hinterteil. Strauchelnd taumelte er nach draußen. „Komm schon“, fauchte er seine Freundin an, „hier entlang!“ Beide wandten sich nach links, wo sie hinter einem Kiosk in eine Nebenstraße abbogen, die mehr eine Art Hinterhofdurchgang war. Passanten auf der Hauptstraße waren stehengeblieben und starrten ihnen hinterher. Was glotzen die so blöd, dachte Manuel. Dann fielen ihm die Mützen ein, die sie beide noch über ihren Gesichtern trugen. Er steckte die Pistole, eine Jaguarmatic, hinten in seinen Hosenbund und riss die Mütze vom Gesicht. Er warf sie achtlos auf den Boden und herrschte Angelique an: „Angel, die Mütze!“ Die Polizeisirenen klangen plötzlich beängstigend nah.
Die Giebelwände der hohen Backsteinhäuser, die nur einen engen Durchgang von nicht einmal drei Metern gewährten, hatten im Untergeschoss keine Fenster. Hier reihten sich diverse Mülltonnen, flankiert von zerdrückten Pappkartons, Müllsäcken und verschiedenen, offensichtlich seit längerer Zeit vor sich hingammelnden Sperrmüllexponaten und Autoreifen, in lockerer Folge aneinander. Die Vespa ET lehnte an einer Hauswand, und der Zweitakter knattere noch immer unregelmäßig im Leerlauf. Manuel war das Risiko eingegangen, weil die Mühle in letzter Zeit immer dann nicht anspringen wollte, wenn er es eilig hatte. Und dass sie es heute eilig haben würden, davon war er einfach mal kühn ausgegangen.
„Au, verdammt!“, jammerte Angelique hinter ihm. Sie war anscheinend umgeknickt und hüpfte auf einem Bein. Die pinkfarbenen Stiefeletten mit den Strasssteinen fand Manuel ohnehin unpassend für eine Bankräuberin.
„Komm, Schatzi, stell dich nicht so an, wir haben´s ja gleich!“, rief er tröstend hinter sich. Er klemmte die Tasche unter den Spannbügel des Gepäckträgers, ergriff den Lenker der Vespa und schwang sein rechtes Bein über den Sitz. Angelique humpelte fluchend heran und setzte sich hinter ihn. Als er spürte, wie ihre Arme sich um seinen Bauch schlangen, gab er Gas und kuppelte ein. Mit einem hellen Jauchzen machte die Vespa einen Satz nach vorn. Eine weiße Wolke verließ den rostigen Auspuff. Manuel lenkte das Gefährt aus der Gasse heraus in den fließenden Verkehr auf der Altendorfer Straße. Die Wumme in seinem Hosenbund drückte gegen seinen Hüftknochen. Die Waffe war uralt, und Manuel hatte sie mal in einer Kiste auf dem Dachboden zusammen mit anderen Spielsachen gefunden. Die schwarze Pistole mit dem braunen Plastikgriff sah täuschend echt aus, wenn man nicht zu genau hinsah, und Manuel bezweifelte, dass er mit den Zündplättchen ernsthaft jemanden hätte verletzen können. Es war für Angel und ihn von Anfang an klar gewesen, dass eine echte Schusswaffe nicht in Frage kam. Sie hätten auch nicht gewusst, wie man an sowas herankommt. Manuel hatte zwar mal gehört, dass man sowas ohne Probleme am Hauptbahnhof kaufen konnte. Aber wie hätte man das anstellen sollen? Schließlich konnte man nicht einen xbeliebigen Typen vorm Bahnhofsklo ansprechen und fragen, ob er nicht vielleicht eine Knarre zu verkaufen hätte.
Der kühle Fahrtwind trocknete die verschwitzten Haare. Angel hatte die ihren zweckmäßigerweise zu einem Knoten gebunden, damit sie unter der Mütze Platz fanden. Der Knoten hatte sich allerdings gelöst, und das Gebilde, welches sie nun auf und an ihrem Kopf trug, hatte mit einer Frisur nur sehr wenig gemeinsam.
Es erforderte einiges an Geschick, die Vespa zwischen Straßenbahnschienen und geparkten Autos hindurch zu manövrieren, ohne von vorbeidrängelnden Autos erfasst zu werden. Auf mehr als vierzig Sachen brachte es die alte Mühle ohnehin nicht mehr, aber für das Tempo entwickelte sie immerhin einen Höllenlärm. Der Fahrtwind drückte die dünnen Blousons, die beide trugen, gegen die verschwitzten Körper. Manuel spürte, wie seine Freundin sich von hinten eng an ihn presste, und seltsamerweise vermittelte ihm diese Nähe trotz der Ausnahmesituation, in der sie sich befanden, ein Gefühl der Geborgenheit.
2
Heute gab es Erbseneintopf. Das war schon immer eine von Gerds Lieblingsspeisen gewesen. Eigentlich musste es bei ihm ja immer Fleisch sein. Beilagen wie Kartoffeln und Gemüse waren bestenfalls notwendige Dekoration, aber Fleisch und Wurst waren die dominierenden Bestandteile von Gerds Ernährung. Bei Erbseneintopf machte er jedoch eine Ausnahme, obwohl auch darin Mettwurst oder Schweineschwarte schwimmen musste. Am besten beides. Leonie rührte mit dem hölzernen Kochlöffel die dicke, sämige Suppe im Topf um. Man musste aufpassen, dass am Topfboden nichts anbrannte. Manchmal war ihr das passiert, und fast immer hatte es Prügel gegeben, wenn Gerd eins der angebrannten Kartoffelstücke in seinem Teller gefunden hatte. Eigentlich konnte Gerd nichts dafür. Er war immer schon leicht erregbar gewesen. Das lag in seiner Natur. Konnte auch sein, dass er die Impulsivität von seinem Vater geerbt hatte. Mehr als einmal hatte er sie derart zugerichtet, dass sie für Tage nicht ins Geschäft konnte. Dann hatte sie ausschließlich hinten in den Gewächshäusern gearbeitet, die Pflanzen gewässert, umgetopft, und für den Verkauf vorbereitet.
Den direkt an die Gärtnerei angrenzenden Friedhof hatten sie früher auch betreut, aber dann hatte die Friedhofsverwaltung sich einen anderen Gärtner gesucht. Das lag nicht zuletzt daran, dass Gerd manchmal tagelang nicht arbeiten konnte. Nämlich in den Phasen, in denen Johnny Walker kam, sobald der Tag ging. Für Gerd war die Tageszeit dabei allerdings kein entscheidendes Kriterium. Beim Saufen war er flexibel. Allerdings nicht so sehr, wenn im Alltag, sei es im Geschäft, im Gewächshaus oder in der Wohnung, etwas nicht nach seinem Kopf ging. Dann konnte er manchmal blitzschnell mit seinen schwieligen Händen zuschlagen. Da war er auch treffsicher, selbst wenn Johnny Walker ihm die Hand führte.
Zu Anfang, damals in den 1990er Jahren, den ersten Jahren nach ihrer Heirat, hatte er noch darauf geachtet, dass Außenstehende ihr nichts ansehen konnten. Dieses Prinzip hatte sich im Laufe der Jahre aber aufgeweicht, und Gerd hatte blaue Augen, aufgeplatzte Lippen und verstauchte Handgelenke gelegentlich billigend in Kauf genommen, wenn es die Situation erforderte. Als Grund dafür reichte es manchmal schon aus, wenn Leonie ein Klümpchen feuchter Erde an der Außenseite eines Geranientopfes übersah, der in den Verkaufsraum gelangte. Oder wenn er an einem Alpenknöterich einen abgebrochenen Trieb entdeckte. Oder wenn eins der Stiefmütterchen nicht richtig angewachsen war, weil Leonie die Erde nicht fachgerecht angedrückt hatte. Manchmal reichte es aber auch schon aus, wenn Gladbach ein Heimspiel verlor. Klar, für Letzteres konnte Leonie wirklich nichts, aber ihre anderen Fehler fand sie ja selbst ärgerlich. Und irgendwie war es ja dann auch kein Wunder, wenn Gerd ausrastete. Wie auch immer, früher waren solche Prügelstrafen fast an der Tagesordnung gewesen, aber zum Glück hatte das nachgelassen. Präziser ausgedrückt hatte es sogar ganz aufgehört. Darüber war Leonie auch heilfroh, denn seitdem sie immer häufiger diese Kreislaufprobleme hatte, war ihr manchmal Angst und bange geworden, wenn sie nach einem Schlag in die Magengrube oder einem wohlgesetzten Nierenhaken unter Schmerzen aus einer Bewusstlosigkeit aufgewacht war.
Sie hatte Gerd an einem Abend, das musste an einem Adventsonntag 2016 gewesen sein (der zweite oder dritte, das wusste sie nicht mehr genau), in einer stillen Stunde während eines Tatorts dringend darum gebeten, sie nicht mehr so hart zu schlagen, weil sie Angst um ihr Leben hatte. Er hatte ihr das sogar fest versprochen. Überhaupt sei er ja eigentlich keiner, der Frauen schlägt. Er sei nur manchmal ein bisschen impulsiv, und sie solle nur mehr aufpassen, dass sie nicht so viel Mist baue.
In die Gärtnerei Breuning verirrte sich zu dem Zeitpunkt ohnehin kaum noch ein Kunde, und sie hatten große Mühe, einigermaßen über die Runden zu kommen, was sie zum Teil mit der Hilfe von Rücklagen aus besseren Zeiten und einer Hypothek auf das Wohnhaus und die Gewächshäuser bestritten. Gerd hatte leider eine robuste Art, mit Leuten umzugehen.
Mehrfach hatte er Kunden, für die sie anscheinend nicht das Richtige im Sortiment hatten, mit Hinweisen wie „Wenn sie nicht mit dem zufrieden sind, was sie hier sehen, dann verpissen sie sich doch dahin, wo der Pfeffer wächst!“ zum Ausgang begleitet. Heute wusste Leonie, dass auch in diesen Fällen Johnny Walker Gerds Verkaufstrainer gewesen war.
Jedenfalls war das Leben im Hause Breuning viel harmonischer geworden, seit Gerd sich von seinen Prügelattacken verabschiedet hatte. Das ging jetzt schon seit über einem Jahr gut.
Leonie stellte die Herdplatte aus und nahm zwei Suppenteller aus einem der Hängeschränke. Vorsichtig füllte sie die Teller mit dem dampfenden Eintopf, darauf bedacht, dass keine Kleckse auf das Ceranfeld fielen. In dieser Hinsicht ging sie immer noch auf Nummer sicher. Sie nahm die Schürze ab, legte sie auf den Heizkörper unter dem Küchenfenster und ging dann mit den beiden Tellern hinüber zur Essecke. Einen Teller stellte sie vor Gerds Stammplatz auf die Wachstuchdecke, den anderen gegenüber.
„Ach, du trinkst doch sicher ein Bier.“ Das fiel ihr spontan ein. Es war immerhin Freitag, und da tranken sie immer zum Mittagessen ein Bier. In der Küche holte sie noch eine Flasche Stauder und zwei Pilsgläser. Sie setzte sich gegenüber von Gerds Platz auf einen Küchenstuhl und goss beide Gläser voll, bis der Schaum an den Rand stieg. „Prost, Gerd“, sagte sie und nickte dem leeren Platz auf der Eckbank zu. Dass außer ihr niemand am Tisch saß, fand Leonie nicht weiter ungewöhnlich. Gerd war mittags am Tisch fast immer ein großer Schweiger vor dem Herrn gewesen. Langsam führte sie Löffel um Löffel zum Mund und leerte ihren Teller Suppe mit Wursteinlage. Danach räumte sie den Tisch ab und leerte Gerds noch unberührtes Glas in der Spüle. Die ebenfalls verschmähte Suppe aus seinem Teller goss sie ins Klo und spülte gründlich nach. Nachdem alles unter fließendem Wasser abgespült war, räumte sie Teller und Besteck in den Geschirrspüler. Für eine Weile hatte Gerd ihr noch beim Essen gegenübergesessen, etwa für die Dauer von vier Wochen. Dann war es beim besten Willen nicht mehr gegangen. Er hatte umziehen müssen.
Es war jetzt kurz nach zwei, da hatte sie noch eine knappe Stunde, bis sie den Laden wieder öffnen musste. Dass tatsächlich Kunden kamen, darüber musste sie sich keine Gedanken machen. Das lag nicht zuletzt daran, wie abgelegen die Gärtnerei an der wenig befahrenen Landstraße lag. Früher, als die Buslinie noch hier entlanggeführt hatte, und das Zementwerk noch in Betrieb gewesen war, hatte es hier mehr Verkehr gegeben. Aber seit der Eröffnung des neuen Autobahnzubringers herrschte in dieser Gegend Totentanz. Aber das machte nichts, Gerd und sie brauchten nicht viel. Sie würde sich um die Beet- und Balkonpflanzen kümmern, um Stauden und Sträucher, würde dort gießen, wo es nötig war, und evtl. vertrocknete Blüten entfernen. Draußen war es immer noch heiß und trocken. Wie schon seit Mai fast durchgehend. Wenn es endlich regnen würde, wäre es schon gut. Für die Sträucher und Obstbäume im Außenbereich. Und für die jungen Koniferen, die auf der anderen Straßenseite in einer eigenen kleinen Schonung standen. Leonie entschloss sich dazu, mit dem Wassertank, den Gerd auf einen kleinen Karren montiert hatte, dort ein bisschen zu wässern. Gerd hatte das Teil früher bei Trockenperioden immer mit auf den Friedhof genommen. Der transparente Kunststoffzylinder fasste fünfhundert Liter. Vollgetankt konnte Leonie ihn kaum ziehen, deshalb füllte sie ihn immer nur zu etwa zwei Dritteln. Eine oder zwei Reihen der Bäumchen würde sie vielleicht noch schaffen, bevor es drei Uhr wurde.
3
Das war genau ihr Wetter. Valerie Bensheim liebte die Sonne. Auch wenn dunkle Sonnenbräune schon lange nicht mehr in war, sie achtete sehr auf die Pflege ihres Teints und trug große Sonnenbrillen, war es das optimale Wetter dafür, mit offenem Verdeck zu fahren. Der Z4 schnurrte wie ein Raubkätzchen, als sie an der Ausfahrt Kettwig die A52 verließ und auf der Verzögerungsspur verlangsamte. Das Navi hatte vorgeschlagen, die Autobahn hier zu verlassen, weil es Richtung Essen-Süd einen Stau gab. Kurz hinter der Ausfahrt musste sie sich rechts halten und gelangte auf eine zweispurige Landstraße, die keinen Mittelstreifen besaß und ungewöhnlich schmal war. Die Strecke war kurvenreich, und Valerie kam kurz in den Sinn, dass sie vielleicht besser auf der Autobahn geblieben wäre, aber die kleine energische Dame im Navigationsgerät beharrte weiter auf der Route und war sich damit offenbar sehr sicher.
Seit sie den neuen Extrajob hatte, diente der alte ihr zunehmend nur noch als Alibibeschäftigung. Harry Lehnert, ein drittklassiger Stimmungs- und Schlagersänger, der früher mal im Bierkönig auf Mallorca seine musikalischen Plattitüden zum Besten gegeben hatte, war für den Sonntag in der Essener Grugahalle gebucht. Valerie Bensheim war eine One-Woman-Künstleragentur. Sie machte Termine für ihre „Stars“, buchte deren Hotelzimmer, sorgte für punktgenaues Catering und nahm ihren Schäfchen bei Bedarf auch die Beichte ab, sprich: Sie hörte zu, wenn einer seinen Melancholischen hatte, einer großen Karriere hinterher weinte, die nicht richtig Fahrt aufnehmen wollte, oder weil ihn die große Liebe verlassen hatte, obwohl ihm auf der Bühne doch alle zujubelten. Nach ein paar Hundert Metern entdeckte Valerie tatsächlich am Straßenrand ein Plakat, auf dem, zusammen mit anderen mehr oder weniger bekannten Künstlern, Harry Lehnert abgebildet war. Die weißen Zähne strahlten im prallen Sonnenlicht. Warum die Idioten ausgerechnet dort plakatierten, wo es garantiert niemand sah, blieb wohl deren Geheimnis. Da würde sie gleich noch mit der Druckerei sprechen. Die organisierten nämlich auch die Außenwerbung. Das sollten sie ihr mal erklären.
Valeries neuer, zweiter Job, den sie noch nicht so lange machte, gehörte zu einer ganz anderen Branche, zu einer, über die man nicht gerne spricht. Öffentlich schon gar nicht.
Das Hamburger Kennzeichen auf ihrem dunkelblauen BMW-Cabrio rührte daher, dass ihr eigentlicher Wohnsitz Hamburg war. Meistens legte sie die Reisen zu den weiter entfernten Eventlocations in München, Berlin, Stuttgart oder Dresden mit dem Flieger zurück. Aber in den nächsten Tagen brauchte sie das Auto vor Ort. Sie musste ein bisschen flexibel sein. Sich bewegen können, ohne Spuren zu hinterlassen. Woher sie ihr Talent für diesen Zweitjob hatte, wer wusste das schon. Aber er lag ihr irgendwie. Wahrscheinlich schon immer. Da war sie wohl ein Naturtalent. Vielleicht hatte auch alles mit ihrem Vater angefangen. Oder erst mit Jürgen. Das Café Mozart in Hamburg kam ihr in den Sinn. Mit Jürgen war sie dort oft gewesen. Das war jetzt mindestens zwei Jahre her. Und das Wetter war an dem Tag nicht ganz so toll gewesen, wie jetzt.
4
Aber es war ein Sonntag, damals in ihrer Heimatstadt an der Elbe, daran erinnerte sie sich genau.
Irgendwie war es schade, dass man ausgerechnet jetzt mit geschlossenem Verdeck fahren musste, denn sie liebte es, sonntagnachmittags die Marktstraße hinunter zu cruisen. Der Vormittag dieses Frühlingstages hatte sich schon vor Sonnenaufgang mit hochfliegenden Versprechungen, das zu erwartende Wetter betreffend, verausgabt. Nicht dass Valerie Bensheim den Sonnenaufgang bewusst erlebt hätte, denn sonntags schlug sie ihre schönen braunen Augen, die im Moment des Erwachens noch nicht ganz so strahlend wirkten wie später am Tage, selten vor elf Uhr auf. Das lag zum Teil daran, dass die Samstagnacht oft den Bars und Clubs im Schanzenviertel gehörte, wo sie unzählige Freunde hatte und nur selten ihre Dirty Bananas oder White Ladys selbst bezahlen durfte. An den meisten Wochenenden war sie jedoch mit dem Zug oder dem Flieger unterwegs, um ihre Künstler, die manchmal quengeliger und trotziger als Kinder sein konnten, vor und nach deren Auftritt zu pampern und ihnen möglichst jeden noch so kleinen Stein aus dem Weg zu räumen.
Beim Duschen war ihr in den Sinn gekommen, dass sie schon lange nicht mehr von ihren Alpträumen geplagt wurde. Gleichzeitig wusste sie, dass gerade dieser Gedanke mit Sicherheit ein Fehler war, was ihre kommenden Nächte betraf.
Als Valerie Bensheim am Nachmittag ihr nachtblaues Z4-Cabrio aus der Tiefgarage der exklusiven Wohnanlage in einer ruhigen Gegend von Bergedorf lenkte, zeigte der Himmel sich noch in fast fleckenfreiem Blau. Auf dem kleinen Stückchen der A25 fuhr sie wegen des offenen Verdecks nicht schneller als Achtzig. Je mehr sie sich dem Stadtzentrum näherte, zogen dichtere Wolken auf und ballten sich mit diebischem Vergnügen, so erschien es ihr jedenfalls, direkt über ihr zusammen.
Valerie trug ein dunkelblaues Kopftuch mit kleinen weißen Segelschiffen darauf, wenn sie offen fuhr, denn ihre dunklen, fast schwarzen Haare, die ihr lang und glatt über die Schultern fielen, wären sonst vom Fahrtwind zu sehr verwüstet worden. Von weitem betrachtet, wirkte sie mit dem Tuch ein bisschen wie Audrey Hepburn, und man hätte sie sich gut hinter Gregory Peck auf dem Sozius einer Vespa vorstellen können. Sah man Valerie Bensheim aus der Nähe, so hatte ihr Gesicht wenig von dem kindlichen, naiven Charme der Schauspielerin. Valerie war eine junge Frau, die man vielleicht als klassische Schönheit bezeichnen konnte. Die dunklen, leicht schräg gestellten Augen und die hohen Wangenknochen verdankte sie ihrer Oma Miroslawa, die schon lange tot war und aus Kasachstan stammte. Die Nase war schmal und klein, ebenso wie ihr Mund, dessen Winkel oft ein wenig nach unten zeigten, was ihrem Ausdruck eine moderat spöttische, vielleicht aristokratische Überheblichkeit verlieh. Die dunklen Augen, die stets klug und aufmerksam ihre Umgebung musterten, milderten diesen Eindruck ab und nahmen jeden von sich ein, der mit ihr in Kontakt kam.
An einer roten Ampel nahe der Innenstadt musste sie schließlich ihr Verdeck schließen, als erste winzige Regentropfen auf Frontscheibe und Armaturenverkleidung tupften. Kurz darauf setzte ein kurzer, aber heftiger Regenschauer ein.
Für Freizeitaktivitäten waren normalerweise das Schanzenviertel und die Hafencity ihre bevorzugten Reviere, aber an Sonntagnachmittagen, sofern sie keine Termine hatte, führte Valeries Weg sie häufig in das nicht weit entfernte Karolinenviertel mit seinen schicken Boutiquen und Cafés. Das Café Mozart hatte ihr Jürgen vor einem (war das echt schon so lange her?) knappen Jahr gezeigt. Wahrscheinlich war er aber auch nur deshalb mit ihr hierhergekommen, weil er hier mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen konnte, keine Bekannten oder gar seine Frau zu treffen. Der Gedanke an Jürgen dämpfte Valeries ansonsten gute Laune spontan.
„Fuck“, stieß sie kaum hörbar hervor, als sie sah, dass entlang der gesamten Marktstraße nirgendwo ein freier Parkplatz auszumachen war. Der Regen hörte auf, so schnell wie er begonnen hatte. Auf der linken Straßenseite sah sie gleich neben dem Frozen-Yogurt-Shop die großen Fenster des Mozart an sich vorbeigleiten. Das Café war, obwohl es schon lange an diesem Platz existierte, noch immer weitestgehend ein Geheimtipp geblieben, zwar gut besucht, aber niemals überlaufen.
Valerie setzte den Blinker und bog nach links in die Turnerstraße ein, die, ebenfalls wie die Marktstraße, nur in einer Richtung befahrbar war. Gleich hinter der Einmündung war eine der markierten Parkflächen frei, in der man den Wagen parallel zur Fahrbahn mit zwei Rädern auf dem Gehweg abstellen konnte. Das gequälte Ächzen des rechten Vorderreifens drang bis in den geschlossenen Innenraum des Wagens. Valerie behandelte ihr Auto wie jemand, für den Geldmangel nie ein Thema gewesen war. Vorsichtig nahm sie das Tuch vom Kopf und richtete ihre Haare mit schnellen geübten Handgriffen. Einige Grimassen vor dem heruntergeklappten Spiegel in der Sonnenblende bestätigten ihr, dass Augenmakeup und die makellosen Zähne, von denen zwei überkront waren, sich in einem korrekten Zustand befanden. Kurz mokierte sie sich innerlich über die inzwischen doch deutlich sichtbaren Lachfältchen in den Augenwinkeln, die sie durch mehrfaches wechselseitiges Wenden des Kopfes von allen Seiten betrachtete. Mit sechsunddreißig Jahren bekam frau halt auch nichts mehr geschenkt. Von nichts kommt nichts, und auch ihre noch immer vorzeigbare Figur wäre ohne die mindestens zwei Besuche pro Woche im Fitnessstudio nicht die, die sie war.
Valerie schürzte die Lippen und grinste dann übertrieben den Spiegel an. Auch der Lippenstift war okay. Sie klappte entschlossen die Sonnenblende hoch und warf mit Schwung die langen Beine aus der geöffneten Autotür. Vom Rücksitz klaubte sie die blaue Lederjacke von Louis Vuitton, die fast der Farbe des Wagens entsprach, und die gleichfarbige, kleine Handtasche. Es war nicht sehr kühl, und man hätte vielleicht auf die Jacke verzichten können, aber der Kontrast zu dem leichten, ärmellosen Kleid, das in seinem sanften Fliederfarbton verliebt die Knie umschmeichelte, war unschlagbar und durfte der Welt nicht vorenthalten werden.
Valerie schlug die Fahrertür zu. Der Autoschlüssel in ihrer Hand, der ein kurzes Aufleuchten der vier Blinker und ein hohles Zwitschern auslöste, verschwand danach in der Handtasche.
Bis zur Straßenecke waren es nur ein paar Schritte. Die beiden jungen Männer, die ihr entgegenkamen, unterbrachen bei ihrem Anblick spontan eine angeregte Unterhaltung. Valerie war es gewohnt, die interessierten Blicke, die auf ihr ruhten, wahrzunehmen, aufzunehmen und zu speichern wie die Kerben am Gewehrkolben eines Kopfgeldjägers, ohne die Männer dabei ihrerseits eines Blickes zu würdigen.
Zwischen den Wolken zeigten sich wieder erste blaue Stellen, und ein angenehmer Wind wehte die Marktstraße entlang. Die schmalen, hohen Fenster des Café Mozart reichten fast bis zum Boden und waren im unteren Drittel zwar lichtdurchlässig, aber durch ihren Schliff trotzdem nicht durchsichtig. Dennoch waren Sie geeignet für einen letzten optischen Check im Profil. Die Pumps von Manolo Blahnik streckten die Figur und verliehen Beinen und Po perfekte Linien. Die kurze, offene Lederjacke verbarg nicht gänzlich den positiven Effekt, den der Push Up-BH unter dem leichten Sommerkleid bei Valeries Brüsten erzeugte. Zwei wundervolle Hände voll, wie Jürgen immer gesagt hatte. Wenn sie sich recht erinnerte, hatte Basti sich oft so ähnlich geäußert. Noch so ein Arsch!
Einige Tische im Café schienen schon besetzt zu sein. Valerie mochte es, beim Eintreten die Blicke auf sich zu ziehen wie ein Magnet die Eisenspäne. Dabei war es ihr egal, ob es sich um bewundernde Blicke von Männern handelte, oder neidische Blicke von Frauen. Fast am besten waren die Blicke, die Frauen auf ihre Männer warfen, wenn diese zuvor Valerie bewundernd angeschaut hatten.
Die Eingangstür war ebenfalls voll verglast und bestand im unteren Bereich aus Milchglas. Etwa in Augenhöhe prangte der weiße Schriftzug Café Mozart in einer altmodischen Schreibschrift. Valerie strich mit den Händen die langen Haare über den Ohren nach hinten und warf dabei leicht den Kopf zurück. Dann drückte sie mit dem polierten Messinggriff die Tür nach innen.
Es war kurz nach 15.30 Uhr, als Valerie Bensheim das Café Mozart betrat. Böse Zungen würden vielleicht sagen, als sie ihren Auftritt hatte, denn das war es, was die junge Frau gern mochte. Das Café war nicht sehr groß, und die meisten Tische waren bereits besetzt. Während sie mit nicht zu schnellen, selbstsicheren Schritten den Eingangsbereich durchmaß, scannte sie, ohne irgendein Detail direkt ins Auge zu fassen, den Raum. Sie spürte Blicke sich ihr zuwenden, Unterhaltungen für einen Moment ins Stocken geraten, bevor sie dann fortgesetzt wurden. Ihr Blick streifte kurz die gläserne Kuchenvitrine, in der einige Torten präsentiert wurden, von denen sie wusste, dass sie von Alina, der Frau des Inhabers, einer gelernten Konditorin, mit viel Hingabe selbst gefertigt wurden. Erfreut bemerkte Valerie aus den Augenwinkeln, dass einer der Tische am Fenster, sogar der schönste und hellste Platz im Mozart, frei war. Ihre Freude ließ sie sich nicht anmerken, sondern marschierte wie selbstverständlich darauf zu, als sei der Tisch für sie reserviert. Wer weiß, vielleicht war er es sogar, auch wenn kein entsprechendes Hinweiskärtchen zu sehen war.
Noch bevor sie den Tisch erreichte, eilte Aljoscha, der Inhaber des Cafés und vollendeter Gentleman der alten Schule, herbei, griff nach ihrer Hand, und deutete mit schwungvoller Verbeugung einen Handkuss an. Seine dunklen Augen funkelten sie von unten herauf an wie die eines ungarischen Operettenhelden.
„Habe die Ehre, gnädige Frau“, sagte er in einem angenehm warmen Tonfall, aus dem man einen leichten Wiener Dialekt heraushören konnte. Valerie lächelte nur und nickte ihm freundlich zu.
„Hi, Joschi“, sagte sie. Sie mochte Aljoscha, den sie nun schon seit einem Jahr kannte. Ohne es genau zu wissen, schätzte sie den Mann auf Mitte bis Ende Vierzig. Er trug dichte, leicht gelockte Haare, die so schwarz waren wie sein buschiger, aber gepflegter Schnauzbart. Obwohl er sie häufig aus der Stirn strich, fiel ihm immer wieder eine eigenwillige Haarlocke nach vorne über die Brauen, die dem Mann zusammen mit seinem verschmitzten Lächeln ein jugendlich draufgängerisches Aussehen verlieh. Aljoscha passte trotz seines sympathischen Äußeren nicht in Valeries Beuteschema. Dafür waren seine Bewegungen zu fließend, zu angepasst und seine Verbeugungen zu devot. Zumindest äußerlich war er für sie kein Mann, der seinen geraden Weg ging, sondern der Probleme geschmeidig umschiffte, der durch sein Café gleiten konnte, ohne aufzufallen, ohne Spuren zu hinterlassen. Außerdem mochte Valerie Aljoschas Angetraute Alina, eine kleine, etwas pummelige Frau, die aber mit einem auffallend hübschen Gesicht und einem herzlichen Lächeln gesegnet war. Schon allein wegen Alina käme für sie ein Flirt mit dem Caféhausinhaber nicht in Betracht. Zumindest keiner, der über den Austausch der normalen Freundlichkeiten hinausging. Da gab es schließlich Grenzen. Natürlich wäre es für sie kein Problem gewesen Aljoscha rumzukriegen, wenn sie es denn darauf anlegen würde. Dessen war sie sich sehr sicher. Er liebte zwar seine Frau, aber Männer waren nun mal Männer. Da waren Valeries Erfahrungen eindeutig. Schließlich hatte sie bisher noch jeden Mann gekriegt, den sie haben wollte. Einen Mann langfristig an sich zu binden, das stand allerdings auf einem anderen Blatt.
Aljoscha schwebte elegant zu dem freien, runden Jugendstiltisch am Fenster mit blütenweißer Tischdecke und zog einen der beiden Stühle hervor.
„Darf ich?", fragte er, und Valerie ließ sich bereitwillig von ihm die Jacke von den Schultern nehmen. Dann rückte er ihr den Stuhl zurecht. Valerie setzte sich, legte gewohnheitsmäßig ihr iPhone vor sich auf den Tisch, und ihr Blick traf den einer Frau um die Fünfzig an einem der Tische in der Raummitte, die sich daraufhin erschrocken wieder ihrer Kaffeetasse zuwandte, als fühle sie sich bei einem Blick durch das Schlüsselloch der Herrendusche ertappt. Valerie musste schmunzeln, fast unmerklich. Die Frau wirkte mütterlich auf sie, ein wenig altbacken vielleicht, in ihrer graukarierten Kostümjacke, die ganz sicher nicht aus dieser Saison, wahrscheinlich aber auch nicht aus einer Kollektion der letzten drei Jahre stammte. Sie saß einem etwa gleichaltrigen Mann mit ausgeprägter Stirnglatze und geröteten Wangen gegenüber, der mit seiner Kuchengabel gerade einen nicht unbeträchtlichen Teil von der Sahnetorte auf seinem Teller abtrennte, als sei er in einem früheren Leben Torfstecher gewesen. Ganz anders als ein Torfstecher jedoch schob sich der Mann das Ergebnis seiner Bemühung mit einer ausgefeilten Technik in den weit geöffneten Mund, ohne dabei die Lippen zu berühren. Die durch die aufgekrempelten weißen Hemdsärmel freigelegten Unterarme waren dicht behaart. Das Gesicht des Mannes ähnelte auf unliebsame Weise dem ihres Vaters, der schon lange tot war. Zum Glück! musste man sagen.
Die Frau hatte die eben unterbrochene Unterhaltung mit dem Mann wieder aufgenommen, bei der sie eindeutig die Wortführung und die stimmliche Dominanz innehatte und nur selten durch ein zustimmendes Nicken oder Brummen des Mannes bestätigt wurde.
Valerie ließ ihren Blick durch den Raum schweifen wie ein Plantagenbesitzer, der vom Rücken seines Pferdes aus, seine Ländereien und die fleißigen Landarbeiter überwacht. Eine junge Frau und ein Mann, beide etwa in den Zwanzigern, waren eindeutig ein Liebespaar, denn sie hielten sich über den kleinen Tisch hinweg zwischen Getränkekartenständer und Zuckerstreuer bei den Händen. Vor Ihnen standen zwei fast leere Latte-Macchiato-Gläser.
Am Tisch in einer der hinteren Ecken saßen drei Frauen, alle drei nach vorne über den Tisch gebeugt, und tuschelten und zischelten auffällig miteinander. Würden sie normal miteinander reden, sie hätten weitaus weniger Aufmerksamkeit erregt. Ihre Kleidung schien teuer zu sein. Aber teure Klamotten und Geschmack sind zweierlei, ihr Hühner, dachte Valerie verächtlich. Desperate Housewives, die amerikanische Fernsehserie kam ihr in den Sinn. Die Typen sorgen für Haus, Autos und gefüllte Bankkonten, und die Tussis müssen ihre Tage irgendwie mit Shopping, Yogakursen und Vormittagsficks mit dem Personal Trainer rumkriegen.
Weiter links, etwa in der Mitte der rückwärtigen Wand des Cafés stand die schmale Anrichte mit der verspielten Jugendstiluhr aus Messing, auf die Joschi so stolz war. Was sich am Tisch davor in einen stummen Dialog mit seiner Kaffeetasse vertieft hatte, war jedoch aus Valeries Sicht das weitaus interessantere Schmuckstück. Den Mann schätzte sie, dafür hatte sie einen Blick, auf ziemlich genau vierzig Jahre, und das markante Gesicht unter dunkler, kurz geschnittener Haarpracht, irgendwo zwischen Clooney und Brad Pitt, war von faszinierender Symmetrie.
„So, was darf es denn sein, gnädige Frau?" Die warme, einschmeichelnde Stimme des Caféhaus- Besitzers unterbrach ihre Milieustudien.
„Mensch Joschi, du sollst nich gnädige Frau zu mir sagen, ich fühl mich direkt mindestens zehn Jahre älter." Valerie sah zu Aljoscha auf und lachte ihm ins Gesicht. Schon vor Monaten, damals war sie noch mit Jürgen hier gewesen, waren sie übereingekommen einander zu duzen.
„Sehr wohl, gnädige Frau“, erwiderte der Mann mit einem spitzbübischen Lächeln, und der Wiener Schmäh trat dabei überdeutlich in den Vordergrund. Valerie streckte ihm ganz kurz und für andere kaum erkennbar die Zunge heraus.
„Na was schon“, sagte sie mit gespielter Arroganz, „eine Melange natürlich, wie immer."
„Sehr wohl, vielleicht an Stückerl Torte dazu? Wir hätten eine Malakoff-Schokolade, eine Esterházytorte, oder vielleicht darf es an Topfenpalatschinken sein, oder natürlich …"
„Joschi, Joschi, stopp!" Valerie lachte und klopfte sich mit den Fingerspitzen seitlich an ihre Hüfte, „was glaubst du, was Alinas Leckereien hier für einen Schaden anrichten können?"
„Aber ich bitt` sie, gnädige Frau. Damit haben doch sie kan Problem."
Aljoscha wurde ernst und fügte hinzu: „Ist in Ordnung, Valerie, dann überlegst es dir halt noch a mal, okay?"
Valerie nickte. „Wie geht´s eurer Mona eigentlich?", fragte sie, bevor der Chef des Hauses verschwinden konnte.
„Ach die Mona“, sagte Aljoscha. Sein Blick wanderte zu einem der Fenster und nahm einen schwärmerischen Glanz an. „Die Mona ist so an fleißiges Mädel. Der geht´s gut. Im Herbst macht sie ihren Master."
„Das ist schön“, sagte Valerie. Sie hatte die Frage nach der vierundzwanzigjährigen Tochter von Joschi und Alina absichtlich gestellt, weil sie wusste, wie stolz die beiden auf das Mädchen waren.
„Na dann“, sagte Aljoscha, „einmal Melange also. Kommt sofort." Er deutete eine leichte Verbeugung an und verschwand.
Der kann nicht anders, dachte Valerie, das steckt in seinen Genen.
Der schöne, einsame Mann am Tisch vor der Jugendstiluhr hob ganz kurz seinen Blick von der Kaffeetasse und schaute zu Valerie herüber. Nur für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie seine Augen sehen können. Sie waren dunkel, und sie glaubte, eine Spur von Hilflosigkeit oder Trauer darin entdeckt zu haben. Jetzt schien seine Aufmerksamkeit wieder ausschließlich der weißen Kaffeetasse zu gelten, die neben einem kleinen Wasserglas vor ihm stand.
Was machst du hier so alleine, mein Großer, dachte Valerie und erschrak für einen Moment, weil sie fürchtete, den Gedanken laut ausgesprochen zu haben. Dann fiel ihr Blick auf einen schlichten, weißgoldenen Ring an seiner rechten Hand.
Tja, dachte sie weiter, wahrscheinlich geht´s dir nicht anders als mir. Vor Unglück in der Liebe schützte schließlich auch so ein rundes Stück Metall nicht. Wir sollten zusammen Lotto spielen, oder Roulette, dachte sie. Glück im Spiel!
Durch eine Schwingtür aus Mahagoni erschien Alina im Gastraum. Sie ging zum Tisch des schönen Mannes und stellte ihm einen Teller mit einem dunkelbraunen Stück Torte hin. Der Mann blickte erst auf, als er das leise Klappern des Tellers auf der Tischplatte vernahm.
„Bitte sehr“, hörte Valerie Alinas helle Stimme. Der Blick des Mannes wirkte überrascht, so als müsse er sich erst darüber klar werden, wo er sich befand. Seine Lippen bewegten sich kurz, ohne dass ein hörbares Wort bis zu Valeries Tisch drang. Als Alina sich umdrehte, sah sie Valerie und nickte ihr freundlich zu. Valerie hob grüßend die Hand.
Sie war es auf jeden Fall nicht wert, mein Großer, dachte sie, vergiss sie einfach ganz schnell.
Sie ertappte sich bei dem Gedanken daran, wie es wäre, neben diesem Mann auf der Promenade am Jungfernstieg zu bummeln. Sie würden keine Worte brauchen. Sie kannte ja nicht einmal seine Stimme. Vielleicht war es eine hohe Fistelstimme. Irgendeinen Makel musste er ja haben. Vollkommene Perfektion gab es nicht auf der Welt. Zumindest nicht bei den Menschen.
Die Vögel zwitscherten. Über die Binnenalster zog ein weißes Ausflugsboot seine Bahn. Dann griff der fremde Mann nach ihrer Hand. Er schaute sie an. Und dann war es das Gesicht von Jürgen, mit seinem blonden Vollbart, den er sich zuletzt hatte wachsen lassen. Irgendetwas in ihrem Bauch zog sich zusammen, und sie konnte gerade eben noch unterdrücken, dass ihr Gesicht sich zu einer Grimasse des Weinens verkrampfte.
„So, die Dame, eine Melange, bitte sehr." Aljoschas aufgeräumte Stimme brachte sie in die Realität zurück. Von einem kleinen, ovalen Tablett stellte er geschickt die Tasse mit der Wiener Spezialität aus Kaffee mit Honig und einer cremigen Haube aus geschäumter Milch vor sie hin. Daneben platzierte er ein kleines Glas mit Wasser. Valerie sah ihn dankbar an und unterdrückte die vage Befürchtung, ihre Augen könnten doch etwas feucht geworden sein.
„Und, Valerie, hast du es dir überlegt? Darf´s noch etwas Süßes sein?"
Ohne zu überlegen erwiderte sie: „Ja, ich… ich hätte auch gerne so eine Torte, bitte." Dabei hatte sie den Teller auf dem Tisch des jungen Mannes fixiert, der seinen Kuchen bisher noch unbehelligt gelassen hatte. Aljoscha folgte ihrem Blick.
„Ah, an Stückerl Sachertorte, ich verstehe“, sagte er, „kommt sofort, Gnädigste." In seinem Blick lag etwas Wissendes, als er sie ansah und danach noch einmal zu dem jungen Mann hinüberblickte. Aljoscha verschwand. Am Tisch in der Ecke brach bei den drei Frauen gackerndes Gelächter aus. Bestimmt hate eine von ihnen einen schlüpfrigen Witz zum Besten gegeben. Valerie versuchte, sich auf ihren Kaffee zu konzentrieren, griff nach dem zierlichen Löffel und begann versonnen damit, den Milchschaum zu verrühren.