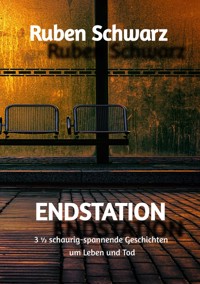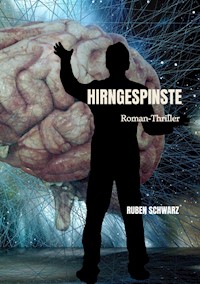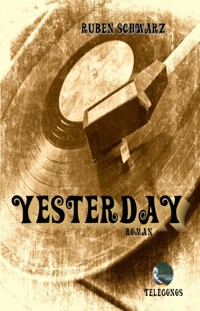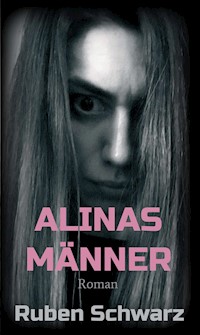3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zu ihrer besonderen Gabe kam Elisabeth Stihler bereits zum Zeitpunkt ihrer Geburt, als ihre Mutter sie in der verheerenden Bombennacht im März 1943 während der Flucht zum Luftschutzbunker zur Welt brachte.
Als kleines Mädchen entdeckt sie durch Zufall am Ende des großen Gartens ihres Elternhauses das Tor, das offenbar nur auf sie gewartet hatte, und das, wie es scheint, außer ihr niemand sehen kann. Dass sie eine Zwillingsschwester auf der anderen Seite hat, die in einer anderen Zeitebene lebt, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch nicht, was ihre Fähigkeit mit der grünen Lichterscheinung zu tun hat, die während ihrer Geburt am Himmel aufgetaucht war, während alliierte Bomben ihre Stadt verwüsteten.
Als sie jedoch als junge Frau erneut das Tor benutzt, erfährt sie, dass drüben noch eine andere Person mit ihrer Gabe existiert. Hans Gehrke war in jener Märznacht 1943 zehn Jahre alt. In seinem Umfeld kommt es bereits in den 1950er Jahren zu rätselhaften Unfällen und Suiziden. Als die Gefahr auch für Elisabeths Schwester immer bedrohlichere Formen annimmt, stemmt sie sich mit ihrer Gabe dagegen. Aber der Widersacher ist stärker als gedacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Tor
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEinführung
Über dieses Buch:
Zu ihrer besonderen Gabe kam Elisabeth Stihler bereits zum Zeitpunkt ihrer Geburt, als ihre Mutter sie in der verheerenden Bombennacht im März 1943 während der Flucht zum Luftschutzbunker zur Welt brachte.
Als kleines Mädchen entdeckt sie durch Zufall am Ende des großen Gartens ihres Elternhauses das Tor, das offenbar nur auf sie gewartet hatte, und das, wie es scheint, außer ihr niemand sehen kann. Dass sie eine Zwillingsschwester auf der anderen Seite hat, die in einer anderen Zeitebene lebt, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch nicht, was ihre Fähigkeit mit der grünen Lichterscheinung zu tun hat, die während ihrer Geburt am Himmel aufgetaucht war, während alliierte Bomben ihre Stadt verwüsteten.
Als sie jedoch als junge Frau erneut das Tor benutzt, erfährt sie, dass drüben noch eine andere Person mit ihrer Gabe existiert. Hans Gehrke war in jener Märznacht 1943 zehn Jahre alt. In seinem Umfeld kommt es bereits in den 1950er Jahren zu rätselhaften Unfällen und Suiziden. Als die Gefahr auch für Elisabeths Schwester immer bedrohlichere Formen annimmt, stemmt sie sich mit ihrer Gabe dagegen. Aber der Widersacher ist stärker als gedacht.
Copyright © 2021 Ruben Schwarz – publiziert von telegonos-publishing
www.telegonos.de
(Haftungsausschluss und Verlagsadresse auf der website)
Cover: Kutscherdesign
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN der Printversion: 978-3-946762-53-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
„Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen, ist nicht so wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben. Denn letztlich sind wir alle nur sterblich.“
Jean-Luc Picard
März 1943
Von dem grünen, abgeschabten Sofa aus konnte Eleonore das Zifferblatt noch ganz gut ablesen. Dafür streute der trapezförmige Fleck, den das gelbliche Licht der Straßenlaterne an die gekälkte Decke warf, gerade noch genügend Helligkeit in jenen Teil des Zimmers, an dessen Wand die alte Keramikuhr hing. Zwischen den letzten beiden Wehen waren ziemlich genau sieben Minuten vergangen. Sie traute sich nicht, aufzustehen, bevor Heinrich mit Ilse zurück war. Hoffentlich ging es nicht jetzt schon los, während sie allein in der Wohnung war.
„So viel Geschiss macht man nur beim ersten Blag“, hatte die Mutter am vorletzten Sonntag noch gesagt, wohl um sie zu beruhigen, „danach geht dat Kinderkriegen wie am Schnürchen.“
Mutter Bertha selbst hatte ihrem Karl fünf Kinder geschenkt, vier Buben und ein Mädel, Eleonore. Heinz-Gerd und Wilfried waren jetzt irgendwo in Frankreich. Rudolf war erst vor zwei Monaten gefallen. Das war in Russland passiert, wo ein Haufen dieser verdreckten Untermenschen, so hatte die Mutter das ausgedrückt, Rudolf und seine Einheit in einen feigen Hinterhalt gelockt hatte.
Die Mutter, Bertha Steding, war, solange Eleonore denken konnte, immer eine robuste, zupackende Frau gewesen, die wenig Sinn für Mitgefühl oder gar Romantik hatte. Zumindest hatte sie sich immer diesen Anschein gegeben. So hatte sie sich auch die Trauer um den gefallenen Sohn äußerlich kaum anmerken lassen.
„Stolz kannst du sein auf deinen Bruder, Elli“, hatte die Mutter am Tag vor der Beisetzung zu ihr gesagt. „Rudi hat sein Leben für sein Vaterland gelassen. Auch für dich, für uns alle.“
Rudi hatte postum das Eiserne Kreuz zweiter Klasse verliehen bekommen. Der Brief des Oberkommandos der Wehrmacht hing, in schwarz lackiertem Holz gerahmt, in Bertha Stedings Schlafzimmer, direkt neben einer Schwarzweißfotografie des Führers.
Eleonores Vater war bereits vor zwölf Jahren an der Schwindsucht gestorben. Zwei Wochen nach der Beerdigung war der jüngste Bruder Willi als Nachkömmling auf die Welt gekommen, das Nesthäkchen der Familie, das jetzt als einziges ihrer Kinder noch bei der Mutter lebte.
Eine weitere Wehe, die in ihren Unterleib fuhr, als würden dort Eingeweide zerrissen, trieb Eleonore die Tränen in die Augen. Als draußen die Straßenlaternen erloschen, verschwand auch die Wanduhr in dunkler Zeitlosigkeit. Es war finster im Zimmer. Nur langsam schälten sich die Konturen des alten Ohrensessels und des schweren Nussbaum-Buffets aus der Schwärze heraus. „Wenn die Wehen alle drei Minuten kommen, Kind, dann isset früh genuch, die Hebamme zu rufen“, hatte die Mutter gesagt.
Sie mussten wieder verdunkeln. Das hatten sie heute Nachmittag schon im Rundfunk angekündigt. Obwohl Erich in seiner letzten Feldpost noch geschrieben hatte: Pass auf Dich auf, Elli, und auf den Kleinen. Aber macht Euch nicht zu viele Sorgen. Der Tommy macht sich in die Hosen vor unseren Jungs an der Flak, waren im Februar mehrmals englische Bomber durchgekommen, die aber zum Glück ihre Bombenlast in Holsterhausen und Frohnhausen abgeworfen hatten.
Erich schrieb von dem Kleinen und ging anscheinend felsenfest davon aus, dass sein erstes Kind ein Junge sein würde, und er schrieb von ihm, als sei er schon auf der Welt. Der gute Erich. Er war erst nach dem vorübergehenden Rückzug der Soldaten aus Stalingrad nach Russland verlegt worden. Während seines Heimaturlaubs von der Westfront hatte er seinen neuen Stellungsbefehl erhalten. „Wir werden dem Iwan jetzt mal ordentlich die Hucke vollhauen“, hatte Erich beim Abschied zwischen zwei Küssen zu ihr gesagt. „Der Führer lässt sich jetzt nicht mehr auf der Nase rumtanzen von diesem Bolschewistenpack.“
Zusammen mit Heinrich, dem Sohn des Kartoffelhändlers Weise aus dem dritten Stock, hatte sie im Februar am Rundfunkempfänger die Rede des Propagandaministers angehört.
„Wir Deutschen sind gewappnet gegen Schwäche und Anfälligkeit“, hatte er gesagt. Nein, er hatte es gerufen, mit bebender Ergriffenheit und Überzeugung in der Stimme. „Und Schläge und Unglücksfälle des Krieges verleihen uns nur zusätzliche Kraft.“ Und er, der Minister, erfuhr schließlich immer alles aus erster Hand, vom Führer und direkt von der Front. Wenn einer Bescheid wusste, dann war es ja wohl der Minister. Alle Schwierigkeiten und Hindernisse würden sie mit revolutionärem Elan überwinden, hatte er im Sportpalast der Menge zugerufen. Heinrich war ein guter Junge. Zusammen mit seiner Mutter wohnte er seit zwei Jahren in der Wohnung über ihnen. Davor hatte die alte Frau Goldstein dort mit ihrer Tochter Lea gewohnt. Die waren aber im November 41 ganz plötzlich ausgezogen. Praktisch über Nacht waren die beiden Frauen verschwunden, ohne ein Wort. Eleonore hatte sie allerdings auch nicht besonders gut gekannt. Schließlich waren Erich und sie erst kurz vorher, gleich nach der Hochzeit, in die Teichstraße gezogen.
„Die ham´ se abgeholt, mitten inne Nacht,“ hatte Herr Munz aus dem Erdgeschoss mal zu Erich gesagt. Mehr hatte er aber nicht sagen wollen. Na ja, es waren wohl Juden gewesen. Eigentlich waren die beiden Frauen Eleonore ganz nett vorgekommen, aber „man kann den Leuten immer nur vor den Kopp kucken“, wie Erich zu sagen pflegte.
Draußen gingen die Sirenen los, und Eleonore vergaß vor Schreck beinahe die Schmerzen in ihrem Unterleib. Licht flackerte auf, flutete durch die Fenster. Die Schatten der Möbel zuckten hin und her, als wären sie lebendig. Gleichzeitig schwoll ein dumpfes Brummen stetig an, zuerst kaum wahrnehmbar, aber bald beängstigend nah. Ein greller Blitz, hell wie die Sonne, erleuchtete für Sekunden das Wohnzimmer, als hätte man draußen riesenhafte Scheinwerfer eingeschaltet, bevor er langsam erstarb und einem weniger hellen, aber nicht minder beängstigen Lodern wich. Dann kam der Knall, der so gewaltig war, dass das Sofa erbebte, auf dem Eleonore mit angewinkelten Knien lag, und die gläsernen Schalen der Deckenlampe klirrten. Es war mehr ein Donner gewesen, der jedoch so kurz und abgehackt war, als hätte Gott auf seine himmlische Kesselpauke eingeschlagen. Eleonore bemerkte, dass ihr Tränen über die Wangen liefen. Beleuchtet vom Feuerschein, den die Decke reflektierte, wurde plötzlich die Wohnzimmertür aufgestoßen.
„Frau Stihler, wir müssen raus!“, rief der Junge Heinrich, schwer atmend im Türrahmen stehend. Hinter ihm tauchte Ilse auf. Ilse Klusmann, die Hebamme, die kaum älter war als Eleonore selbst, hatte weiche rosige Wangen und trug, gemessen an ihrer Jugend, eine enorme Leibesfülle mit sich herum. Ihr hatten die zwei Etagen offensichtlich zugesetzt.
„Ja, schnell, Frau Stihler“, japste sie kurzatmig hinter dem Siebzehnjährigen, „der Himmel is voller Tommys!“ Eleonore stemmte sich auf dem Sofa hoch. Das an- und abschwellende Dröhnen, das die Fensterscheiben erbeben ließ, übertönte fast jedes andere Geräusch.
„Schnell, in den Bunker!“, rief Ilse Klusmann.
„Ich renn nach oben und hol meine Feuerwehrausrüstung!“, rief Heinrich Weise. Der Junge verschwand, und man hörte das dumpfe Poltern seiner Schuhe auf den Holzstiegen. „Mutter! Mutter!“, rief er noch im Treppenhaus.
Als Eleonore mühsam vom Sofa aufstand und dabei mit einer Hand ihren Bauch hielt, ertönte ein weiterer Donnerknall, jetzt etwas weniger laut und offenbar weiter entfernt. Sie spürte eine warme Feuchte an den Innenseiten ihrer Schenkel abwärts rinnen. Erschrocken blickte sie an sich herab. Ilse Klusmann folgte ihrem Blick und sagte nur knapp: „Die Fruchtblase, nich so schlimm. Schnell jetzt.“ In ihren Augen schimmerte die Angst. Eleonore empfand plötzlich ein Gefühl der Dankbarkeit, dass die Hebamme trotz der Gefahr gekommen war und sie nicht im Stich ließ. Mühsam zwängte sie ihre Füße in die Schuhe, die neben einem Schränkchen im Flur standen.
„Komm schnell, Kindchen“, sagte die Frau, die kaum die Mitte der Zwanziger erreicht hatte, und legte Eleonore den grauen Mantel mit dem Fischgrätmuster um die Schultern, den sie von der Garderobe genommen hatte. Schwer auf die Hebamme gestützt, verließ Eleonore die Wohnung. Eine weitere, schwere Detonation erschütterte das ganze Haus. Das Dröhnen der Flugzeuge klang wie die Vorstufe der Apokalypse. Während die beiden Frauen so eilig wie möglich die Treppenstufen abwärts liefen, erfolgte jetzt ein Einschlag nach dem anderen. Ilse drückte die Haustür auf und bugsierte ihren Schützling nach draußen. Es war ungewöhnlich warm für Anfang März, und Eleonore realisierte, dass die Wärme nichts mit dem Wetter zu tun hatte. Die Straße war hell erleuchtet von unzähligen Feuern, die den Himmel über den Häusern in gelbrotes Licht tauchten. Die dunklen Silhouetten unzähliger Flugzeuge zeichneten sich darüber ab. Infernalisches Krachen und Heulen erfüllte die Luft. Von irgendwoher hörte man die gellenden Schreie einer Frau. Menschen hasteten mit Rucksäcken und Taschen um Häuserecken, für Sekunden durch grelle Blitze der Dunkelheit entrissen. Ilse und Eleonore zogen und schoben sich gegenseitig, dicht an den Häuserfronten der Teichstraße entlang.
„Hier rum!“, kommandierte Ilse entschlossen und zerrte Eleonore um eine Ecke herum in die Erste Dellbrügge. Sie mussten das Burggymnasium erreichen. Das wusste Eleonore. Dort gab es einen Luftschutzkeller, den sie schon mehrfach aufgesucht hatten. Allerdings war der Luftalarm dieses Mal reichlich spät gekommen. Viel zu spät.
Fast gleichzeitig gab es hinter und vor ihnen zwei schwere Detonationen, beide nur wenige hundert Meter entfernt. Eleonore sah, wie sich die Fassade eines der mehrstöckigen Wohnhäuser vor ihnen nach außen neigte und, wie in Zeitlupe, mit ohrenbetäubendem Krach auf die Straße fiel. Das brennende Dach stürzte in sich zusammen. Hinter den beiden Frauen staken Stabbrandbomben wie Fackeln im Straßenpflaster. Ilse zerrte Eleonore, die sich willenlos führen ließ, in einen Durchgang zwischen zwei Häusern.
„Hier geht’s lang! Diese verfluchten Engländer!“, brüllte sie aus Leibeskräften gegen das Donnern und Heulen an. Eleonores Unterleib fühlte sich an, wie eine große, pulsierende Wunde. Das hier ist der Burgplatz, erkannte sie. Und als ihr schwindelig wurde, dachte sie: Ich sterbe jetzt. Der Gedanke war völlig emotionslos und ohne Angst. Wie durch einen verwehenden, grauen Schleier hindurch sah sie eine schwarze Opel-Limousine, die unter einem Haufen aus Ziegelsteinen begraben war. Daneben hatte sich ein riesiges Loch mitten auf der Fahrbahn aufgetan. Rauch quoll daraus hervor.
Das ist ein Bein, dachte Eleonore ruhig, während sie teilnahmslos hinter Ilse her trabte. Wie beiläufig blickte sie im Vorbeilaufen auf jenes Körperteil, das bekleidet mit einem staubigen Herrenschuh und einem verbrannten Hosenbein, völlig losgelöst und entmenschlicht zwischen herumliegenden Steinen im flackernden Feuerschein sichtbar wurde. Der Himmel war jetzt permanent taghell vom Feuer und immer neuen Blitzen. In all dem Lärm drangen die Rufe von Männern und das Weinen eines Kindes nur fragmentarisch an ihre Ohren. Rauch machte das Atmen und die Orientierung fast unmöglich. Das Gesicht Ilses verschwamm vor ihren Augen. Das Schemen einer Frau kniete vor einem brennenden Kinderwagen, und Eleonore stolperte über etwas Weiches. Ihre Hände griffen ins Leere und sie stürzte aufs Pflaster. Der Schmerz im Ellbogen wurde um das Vielfache überlagert von einem Stich im Unterleib, der sich bis hinauf in die Lungenflügel zu bohren schien. Mühsam drehte Eleonore sich auf den Rücken und sah am Himmel etwas Sonderbares. Ein grünliches, gezacktes Band, wie ein nicht enden wollender Blitz zog sich hell flimmernd über den Teil des Burgplatzes, den sie einsehen konnte. Das Band wanderte unendlich langsam, aber stetig, von links nach rechts über den gesamten Himmel und durchbrach ohne Probleme mit seiner Leuchtkraft die rauchgeschwängerte Luft. Die Leuchtspuren, die von einer entfernten Flak-Stellung aufstiegen, schienen von dem Band verdrängt zu werden. Das pulsierende Licht gab der Umgebung eine gespenstische und dennoch beruhigende Anmutung.
So sieht er also aus, dachte Eleonore ergeben, und war davon überzeugt, dass der Tod sie jeden Moment ereilen würde. Das Band schien tiefer zu sinken. Fast konnte man das Gefühl haben, es sei nur für sie gekommen, wollte sich auf sie senken, sie durchdringen. Bald war die junge Frau umgeben von grünem Leuchten, sie selbst schien das Licht zu sein, schien von innen heraus zu strahlen, bis sich das Band nach einigen Sekunden wieder von ihr löste, sich erhob und dem Himmel entgegenstrebte. Das Band wurde schmaler, je höher es stieg, und es wanderte langsam in südlicher Richtung davon, dort wo sich der Hauptbahnhof befand, der sich noch in dieser Nacht in eine Ruine verwandeln würde.
Eleonore sah sich selbst auf die Beine kommen, sich langsam und stöhnend erheben, den Bauch mit beiden Händen umfassend. Sie sah sich selbst unsichere Schritte machen, in ihrem von Ruß und Staub beschmutzten Mantel. Eine merkwürdige Erfahrung, sich selbst von außen zu beobachten, lag sie doch schließlich noch immer rücklings auf den harten Pflastersteinen. Dann versuchte sie, sich selbst aufzurichten. Es klappte, wenn auch dabei ihr ganzer Körper schmerzte. Sie sah, wie ihr zweites Ich sich, von Ilse gestützt, Richtung Burggymnasium auf den Weg machte.
„Da sind sie ja, Frau Stihler!“ Der junge Heinrich stand neben ihr und umfasste mit einer Hand ihren Arm. „Stehen Sie auf, kommen Sie mit mir. Im Moment scheint der Tommy eine Pause einzulegen.“ Ohne nachzudenken ging Eleonore mit dem jungen Mann.
In der Nacht vom 5. auf den 6. März 1943 hatten alliierte Bomber mit 122.000 Stabbrandbomben, 1.000 Sprengbomben und 17.000 Phosphorkanistern über der Stadt Essen ein Inferno entfacht. Über 1.300 große und mittlere Brände hatten gewütet, und mehr als 2.300 Häuser waren zerstört worden.
Gleichzeitig hatte es jedoch ein kosmisches Ereignis gegeben, das, ungeachtet aller Kriege und Katastrophen auf der Erde, ungeachtet der Hungersnöte und der politischen Krisen in der Welt, bestenfalls alle Hundert Millionen Jahre eintritt, wahrscheinlich viel seltener. Der Riss im Raum-Zeit-Kontinuum war so alt wie das Universum selbst, und er wanderte durch den Kosmos hindurch, wie er den Kosmos mit all seinen Sonnen und Galaxien durch sich hindurchwandern ließ. Dass der Riss direkt auf einen Planeten traf, kam angesichts der für Menschen unfassbaren Dimensionen und Zeitspannen, in denen das Universum rechnet, so gut wie nie vor. Aber manchmal passierte es eben doch.
März 2018
75 Jahre danach
Elisabeth zog die weißen Gardinen am großen Wohnzimmerfenster wieder in Form und achtete darauf, dass die Falten in etwa den gleichen Abstand zueinander hatten. Sie hatte erst aufgehört zu winken, als der große, weiße Toyota zwischen den Platanen, welche die ruhige Wohnstraße in Essen-Heidhausen säumten, nicht mehr zu sehen war. Hannah und Lilly, die eine zwölf und die andere zehn Jahre alt, hatten ganz wild mit den Händen hinter den Autofenstern gestikuliert und dabei gelacht.
Es kam nicht oft vor, dass Hans-Werner und Bärbel mit den Mädchen zu Besuch kamen. Seit Hans-Werner von seiner Firma nach Oldenburg versetzt worden war, kamen sie nicht einmal mehr zu jedem Weihnachtsfest. Der Sohn hatte als Niederlassungsleiter einer Spedition leider immer sehr viel Arbeit. Eigentlich war es ja positiv in der heutigen Zeit, wenn man einen festen Beruf und sein Auskommen hatte. Aber nachdem Elisabeths Nichte Martina, die Tochter ihres ältesten Bruders Wilfried, vorletzten Sommer gestorben war, meldete sich auch von dieser Familie kaum noch jemand. Wahrscheinlich waren Hans-Werner und seine Familie auch heute nur deshalb hier gewesen, weil dies ihr Fünfundsiebzigster war. Man wusste ja, was man zu solchen Anlässen denkt: Wer weiß, ob es vielleicht ihr Letzter ist, und so weiter.
Elisabeth ging langsam hinüber zum Sofa, das neben der großen Terrassentür stand, die zum Wintergarten hinausführte. Draußen im Garten war auch noch alles im Wintermodus. Lediglich erste Krokusse hatten die Grasnarbe durchstoßen, aber in früheren Jahren war der Garten hinter dem Haus durchaus gepflegter gewesen.
Elisabeth setzte sich zwischen zwei opulente Kissen. Berthold hatte sich früher immer um den Garten gekümmert. Nicht selten hatte er auch den Gärtner Siebert aus der Nachbarschaft für gröbere Arbeiten engagiert.
Elisabeth war froh, dass sie nun saß. Da war die Kurzatmigkeit, die in letzter Zeit schlimmer geworden war.
„Das wird das Herz sein, Frau Dahlke“, hatte Doktor Liebstöckel gesagt, „ich schreib Ihnen dafür noch mal zusätzlich was auf. Das nehmen Sie jeweils am Morgen zusammen mit den anderen Tabletten.“ Die anderen Tabletten, das waren die Blutdrucksenker, der Betablocker, eine Tablette zum Entwässern und diverse andere Mittelchen für die Nieren und für den Magen. Elisabeth orientierte sich inzwischen nur noch an den Farben und Größen der einzelnen Medikamente.
Einerseits freute sie sich sehr, wenn die Kinder zu Besuch kamen, andererseits war es aber gut, wenn sie dann wieder aus dem Haus waren. Wenn man die meiste Zeit allein lebt, ist so ein Besuch doch immer mit viel Aufregung verbunden.
„Mach dir doch nicht so viel Arbeit, Mutti“, pflegte die Schwiegertochter dann vor einem Besuch am Telefon zu sagen, „wir können doch von unterwegs Kuchen mitbringen, und wir wollen dich doch einfach nur mal wiedersehen, und nicht großartig verköstigt werden.“ Aber letztendlich legte Elisabeth doch Wert darauf, dass der Kuchen gelang, dass das gute Meißener Geschirr auf dem Tisch stand, dass sie die passenden Servietten hatte und dazu einen guten Wein. Dabei tranken weder Bärbel noch Hans-Werner Alkohol, sondern Wasser, oder bestenfalls eine Tasse Kaffee. Hans-Werner musste schließlich noch fahren, und Bärbel war stets sehr auf ihre Linie bedacht.
„Keine Widerrede“, hatte Bärbel gesagt und darauf bestanden, zusammen mit den Mädchen den Tisch abzuräumen und die Teller und Tassen in den Geschirrspüler zu stellen. Hannah und Lilly waren zwei ganz zauberhafte Gören, und wohlerzogen, aber nach einer Stunde Stillsitzen wurden sie doch unruhig. Gerne wären sie in den Garten gegangen, aber das Wetter war „usselig“, wie man hier sagte, was bedeutet, dass ein kühler Wind wehte und feinen Nieselregen gegen die Fenster trieb. Wiese und Wege waren von mehreren Tagen Regen aufgeweicht, und die Kinder sollten sich nicht ihre guten Schuhe verderben. Außerdem lebten Bärbel und Hans-Werner ständig in der Angst, die Mädchen könnten irgendwas kaputt machen. In der Tat war das Haus An der Braut mit teuren Möbeln und Vasen auf Marmorsäulen und in Vitrinen vollgestellt. Berthold hatte darauf Wert gelegt, als er nach der Hochzeit 1970 zu Elisabeth und ihrer Mutter in das freistehende Haus gezogen war.
Es war Elisabeths Elternhaus. Seit ihrem fünften Lebensjahr wohnte sie ununterbrochen hier. Der Vater war ein leitender Krupp-Beamter gewesen, einer von den Direktoren, die direkt an den Firmenchef berichteten, und er hatte das Haus 1950 gebaut, während Alfried Krupp noch in Landsberg inhaftiert gewesen war. Elisabeth hatte ihn Vater nennen dürfen, obwohl ihr richtiger Vater im Krieg gefallen war. Er hatte dort eine Festung bewachen müssen, war ein heldenhafter Wehrmachtssoldat gewesen und von den Russen umgebracht worden. So hatte die Mutter es ihr als kleinem Mädchen erzählt und sie hatte dabei immer einen bitteren Zug um die Lippen bekommen. Es war die sogenannte „Festung“ Königsberg gewesen, das heutige Kaliningrad, das gegen Kriegsende von der Roten Armee erobert worden war.
Die Mutter Eleonore war eine herzensgute Frau gewesen, aber dennoch selbst viele Jahre nach Kriegsende irgendwie nicht von der Nazi-Ideologie losgekommen. Noch bis in die Sechzigerjahre hinein hatte sie von „dem Russen“ oder „dem Engländer“ gesprochen, wie von einem vergessenen Stück Käse im Kühlschrank, dem schon grünliche Haare gewachsen waren.
Berthold war zuletzt Betriebsführer auf Zollverein gewesen, und den fast militärisch anmutenden Befehlston, den Vorgesetzte unter Tage oft gegenüber den Kumpels anschlugen, hatte er zeitweise in die Ehe mit eingebracht. Als Witwe eines Betriebsführers kam Elisabeth in den Genuss einer sehr komfortablen Rente, die die Knappschaft monatlich an sie auszahlte. Eine stattliche Unfallrente, die Berthold einer unglückseligen Begegnung mit einer Wettertür in jungen Jahren und zwei verlorenen Fingern der linken Hand verdankte, machte das Ganze noch auskömmlicher.
Elisabeth stand vom Sofa auf und blickte durch die geöffnete Tür zum Wintergarten hinaus, über die große, nasse Rasenfläche. Weiter hinten, zwischen alten Rhododendren und anderem Buschwerk gab es ein hölzernes Gartenhäuschen und daneben einen Geräteschuppen. Beide hatten schon bessere Tage gesehen.
Dahinter, durch den Nieselregen nur noch schemenhaft zu erkennen, war eine grüne Wand aus hohen, alten Fichten, Ginstersträuchern, Efeu und Knöterich, die sich ineinander verflochten hatten. Sicher brauchte man heute ein Buschmesser, um dort hindurch zu dringen. Irgendwo dahinter kam dann ein Maschendrahtzaun, der von Efeu durchwirkt und sicher schon halb verfallen war.
Elisabeth war lange Zeit nicht so weit dort hinten im Garten gewesen. Zuletzt vielleicht vor Weihnachten, um ein paar Fichtenzweige für die große Bodenvase abzuschneiden. Sie war sich noch nicht einmal sicher, ob es diese andere Welt dort hinten noch gab, falls sie überhaupt je existiert hatte. Es hatte Zeiten gegeben, in denen sie fürchtete, verrückt zu werden oder es bereits zu sein. Oft in ihren Träumen hatte sie das Tor durchschritten und war drüben gewesen. Komischerweise immer dann, wenn es ihr nicht besonders gut ging. Wenn zum Beispiel Berthold zu viel Bier getrunken hatte und dann aus irgendeinem nichtigen Grund einen Streit begann. Berthold wusste manchmal allein durch Missachtung und Blicke zu bewirken, dass sie sich schlecht fühlte.
Oder als Kind, wenn sie nicht in die Schule gehen konnte, weil sie krank war und mit Grippe im Bett lag, dann hatte sie manchmal, wenn sie zur Toilette musste, das große Bild im Flur zwischen dem hohen Treppenhaus und dem elterlichen Schlafzimmer angeschaut. Und dort hatte sie zwischen ernst und würdig dreinschauenden Ahnen das Mädchen entdeckt, das die meiste Zeit auf dem Bild nicht zu sehen war, und das fast so aussah wie sie selbst. Dabei war das Bild, das hatte Vati gesagt, schon über hundert Jahre alt.
Vielleicht würde sie bald mal wieder in den Garten gehen. Wenn es mit ihrem Gesundheitszustand so weiter bergab ging, das Herz Probleme machte, die Schmerzen in der Hüfte schlimmer wurden, dann würde sie vielleicht noch einmal den Übergang wagen, zumindest versuchen, ob es überhaupt noch funktionierte. Und bei etwas besserem Wetter.
Elisabeth Dahlke ging hinüber in die Küche, bückte sich mühsam zum Schrank unter der Spüle und brachte einen der Portionsbeutel mit Geschirrreiniger hervor. Mit leisem Stöhnen (sie merkte selbst gar nicht mehr, dass sie das bei vielen Bewegungen tat) bückte sie sich erneut und legte das Plastikteil ins dafür vorgesehene Fach in der Fronttür des Gerätes. Dann richtete sie sich mit einem erneuten Stöhnen auf und drückte die Starttaste. Während der Geschirrspüler seine typischen Arbeitsgeräusche erzeugte, stieg sie die Treppe hinauf, bedächtig eine Stufe nach der anderen, und ließ sich schweratmend in den Ohrensessel auf der Empore fallen. Von hier aus konnte sie gegenüber im Flur das großformatige Ölgemälde betrachten. Draußen begann es zu dämmern, und das Licht, das auf die Leinwand mit dem goldlackierten Holzrahmen fiel, war nur spärlich. Auf einem kühn geschwungenen, grünen Sofa saßen dort ein älterer Herr und eine ebenso alte Dame mit weißen Haaren, die Kleidung hochgeschlossen, düster mit weißen Rüschen, der Herr mit riesigem Schnauzbart. Die alte Dame trug auf den Knien ein dickes, rotbackiges Baby, in weiße Wäsche gehüllt. Neben und hinter dem Sofa standen, steif wie Zinnsoldaten, mehrere Damen und Herren, ebenfalls gekleidet nach der Mode des ausgehenden 19. Jahrhunderts, zwei der jungen Männer in den Uniformen der Preußischen Armee. Alle trugen einen Gesichtsausdruck zur Schau, dem Fröhlichkeit ein unbekannter Zustand zu sein schien. Ein schmaler Platz neben der alten Dame auf dem Sofa war leer. Zumindest jetzt.
Elisabeth tastete mit den Fingerspitzen über die lange Narbe auf ihrem rechten Unterarm, die man durch den Stoff der weißen Bluse hindurch fühlen konnte. Woher sie stammte, wusste sie nicht mehr. Doktor Liebstöckel hatte sie erzählt, dass sie sich die Wunde, die von der Handwurzel fast bis zum Ellenbogen reichte, bei einem Unfall in der Küche zugezogen hatte. Aber das stimmte nicht. Da hatte sie gelogen.
März 1943
75 Jahre zuvor
„Hans Gehrke, vortreten!“ Das Kommando von Lehrer Degenhardt hallte, trotz der relativ hohen Stimmlage des Pädagogen, messerscharf wie die Detonation eines Schrapnells, in den Ohren des Schülers. Wie benommen starrte Hans auf die vernarbte Holzplatte vor sich, um dann aber blitzschnell, wie zu einem militärischen Appell, seitlich aus der Schulbank herauszugleiten und für einen Moment strammzustehen. Dann trugen ihn seine Füße, scheinbar ohne sein Zutun, in Richtung des Pults. Lehrer Degenhardt hatte nur einen Arm. Den anderen hatte er in Frankreich gelassen. Diese Terminologie hatte bei den Jungen der Klasse in den ersten beiden Jahren ihrer schulischen Laufbahn zu abenteuerlichem Rätselraten geführt und dabei die Frage aufgeworfen, wie man denn irgendwohin gehen konnte, ohne seinen Arm mitzunehmen. Bis der Lehrer den Schülern irgendwann von seiner Verwundung erzählt hatte, die ihm „der Franzmann“ mit zwei MG-Kugeln in den Ellenbogen beigebracht hatte, während er in heldenhafter Opferbereitschaft einem verletzten Kameraden im Schützengraben beigesprungen war.
„Die rechte Hand vor!“, kommandierte Lehrer Degenhardt und blickte dabei streng über seine runden Brillengläser hinweg, deren Messinggestell bedrohlich weit vorn auf seinem Nasenrücken ruhte. Sein Blick verriet eiserne Entschlossenheit und ließ noch jetzt den Heldenmut früherer Jahre erkennen. Voller Angst, aber ohne zu zögern, folgte der Zehnjährige dem Befehl und streckte den rechten Arm mit geöffneter Handfläche aus. Kaum eine Sekunde später sauste der hölzerne Zeigestock des Lehrers, ein feines Pfeifen verursachend, nieder und traf zielsicher die Hand. Hans Gehrke ließ ein kurzes, unterdrücktes Wimmern hören. Tränen quollen aus seinen Augen, so sehr er auch dagegen ankämpfte.
„Die andere Hand!“, befahl Degenhardt. Dieses Mal zögerte Hans, aber ein barsches „Wird’s bald?!“ machte ihn willenlos. Ein weiterer Hieb auf die Fläche der linken Hand brachte den Jungen dazu, leise zu schluchzen.
„Schau an, da heult der Täter wie ein Mädel“, herrschte der Lehrer ihn an. „Herrgott, Gehrke, jetzt reiß dich mal zusammen! Ein deutscher Knabe weint nicht!“ Degenhardt legte den Zeigestock auf dem Pult ab, und Hans fiel eine wahre Gesteinslawine vom Herzen.
„Auf deinen Platz, Junge, und nach dem Unterricht denkst du darüber nach, wie du deine überschüssige Kraft anders einsetzen kannst, als deine jüngeren Kameraden damit zu quälen.“
Die Stimme des Lehrers war nach der Züchtigung milder geworden. Er schlug seine Jungs nicht gern, aber wie sollten aus ihnen aufrechte und vaterlandstreue Soldaten werden, wenn er ihnen nicht ein Mindestmaß an Disziplin einbläute? Er sagte es ja immer, Sport und Ertüchtigung waren besonders wichtig für diese Bengels. Ihre erwachende Männlichkeit musste kanalisiert werden. Und vor allem mussten sie sich abreagieren. Ein gesunder Volkskörper braucht gesunde junge Männer, gesund an Körper und Gesinnung. Das Vaterland stand vor immensen Herausforderungen, und in den kommenden Jahren würden ganze Armeen arischer Männer gebraucht werden, um die eroberten Ostgebiete zu verwalten und den minderwertigen Völkern dort ein Mindestmaß an Zivilisation beizubringen. Die Eroberung war das eine, aber dann mussten die neuen Länder dauerhaft gehalten und deren Bevölkerung diszipliniert werden. Dazu trug er seinen Teil bei, hier an der Heimatfront, dafür erzog er Knaben zu ehrenhaften und wehrfähigen jungen Männern.
Degenhardt drehte sich um zur Schiefertafel an der Wand, neben der eine Deutschlandkarte hing, die im Osten mit Böhmen und Mähren, Oberschlesien und Ostpreußen endete. Allein diese Gebiete waren schon auf Dauer eine Herausforderung. Aber wenn der Russe erst besiegt war, endgültig besiegt … Der Russe wehrte sich bisher noch verbissen. In Stalingrad hatte der Führer sogar klugerweise die Truppen vorübergehend zurückgezogen, um den Gegner in Sicherheit zu wiegen. Er würde bald erwachen, der Russe, aber dann würde es für ihn zu spät sein.
Das Bild des Führers hing neben der Tür in einem braunen Holzrahmen. Degenhardt brauchte nur immer mal wieder in die entschlossene Miene des Mannes auf der Schwarzweißfotografie zu schauen, um seinen eigenen Glauben an den Endsieg aufs Neue zu festigen.
Hans ging zügig mit gesenktem Kopf zurück und glitt lautlos wieder an seinen Platz in die Bank neben Walter. Der sah ihn mitfühlend von der Seite an, aber Hans reagierte nicht darauf. Hans mochte Walter nicht, denn der war ein Weichling, ein Muttersöhnchen. Er hätte ihm am liebsten einen Faustschlag versetzt, für diesen mitfühlenden Seitenblick. Außerdem hatte Walter ihn weinen sehen, auch wenn Hans versucht hatte, das zu unterdrücken. Dafür würde Walter noch büßen müssen. Und ein paar andere auch. Mehr Spaß machte es allerdings, sich einen aus der ersten oder zweiten Klasse vorzunehmen. Die heulten immer wie die Kleinkinder. Und wenn er ihnen hinterher intensiv genug einschärfte, niemandem von dem Vorfall zu erzählen, konnte er das auch ungestraft tun. Verschämt besah er sich seine beiden Handflächen, über die sich rote Striemen zogen. Die Schmerzen in den ersten Sekunden nach dem Schlag waren höllisch gewesen. Jetzt erinnerte nur noch ein schwaches Brennen an die Züchtigung.
Es war ein ärgerlicher Zufall gewesen, dass der alte Rossmann ihn in der großen Pause dabei erwischt hatte, wie er den kleinen schwarzhaarigen Erstklässler mit dem Gesicht in den Matsch neben den Fahrradständern gedrückt hatte. Dass der alte Knacker den Vorfall dann an Degenhardt gepetzt hatte, würde er ihm auch noch irgendwie heimzahlen. Bei dem Alten konnten sie normalerweise im Biologieunterricht machen, was sie wollten. Eine Memme war das, wahrscheinlich so ein heimlicher Sozialdemokrat, auf die der Vater manchmal schimpfte. Die waren gegen den Krieg und überhaupt gegen das ganze deutsche Volk. Feiglinge und Vaterlandsverräter waren das. Man musste es ihnen nur nachweisen.
„Hans Gehrke, was kannst du uns dazu sagen?“ Die Stimme des Lehrers riss den Schüler aus seinen Gedanken. Ihm wurde bewusst, dass er durch das blinde Fensterglas hinaus in den trüben Märztag gestarrt hatte. Seine Wangen wurden heiß. Hans wusste nur vage, dass es um die alte, die undeutsche Regierung ging, die in der dunklen Zeit nach dem Kriege die Bauernschaft im Reich fast zu Grunde gerichtet hatte, bevor die nationalsozialistische Bewegung die Geschicke des deutschen Volkes und des Bauernstandes in die Hand nahm. Das waren damals auch Sozialdemokraten gewesen, dieselben Verräter, die für die Schmach von Versailles verantwortlich gewesen waren. Hans hatte keine Ahnung, wo sich dieses Versailles befand, aber die Geschichte vom Verrat an der deutschen Reichswehr hatte der Lehrer ihnen schon im ersten Schuljahr eingebläut. Was jedoch akut viel schwerer wog, war die Tatsache, dass Hans nicht die geringste Vorstellung davon hatte, was der Lehrer nun von ihm wissen wollte. Er hatte geträumt. Ein fataler Fehler. Degenhardt stand jetzt direkt neben seiner Bank. Den losen Ärmel seiner Jacke hatte er sich in den Hosenbund gesteckt. Die runden Brillengläser spiegelten das Licht der Deckenlampe. Er hatte seinen Zeigestock nicht dabei.
„SS-Obergruppenführer Reichsminister Herbert Backe!“ Die schneidende Stimme des Pädagogen klirrte in Hans´ Ohren. „Steh auf!“, kommandierte Degenhardt und reckte dabei sein Gesicht zur Decke, so dass Hans sich unwillkürlich auf zwei dunkle, haarige Nasenlöcher fokussierte. Gehorsam stand er auf und nahm Haltung an. Leider zu spät. Den Namen des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft hatte der Lehrer von ihm hören wollen. Dabei hätte er die Antwort gewusst. Die Lebensmittelkarten bekamen sie von ihm. Das wusste er von der Mutter.
Die mit Links ausgeführte Ohrfeige ließ seinen Kopf zur Seite schnellen, und Hans taumelte für einen Moment, wobei er Gefahr lief, kopfüber auf seinen Banknachbarn Walter zu stürzen. Der Schmerz blitzte so jäh auf, dass es ihm Tränen in die Augen trieb. Er nahm wieder Haltung an. Auf der Wange loderte ein Flächenbrand. Hans riss sich zusammen und blickte starr geradeaus, Richtung Tafel.
„Gehrke, du Träumer“, sagte Degenhardt in gemäßigtem Ton, „wenn man es nicht besser wüsste, man könnte meinen, du wärst eine Judensau. Individuen wie du zersetzen die Moral.“
Das saß. Das war schlimm. Der Lehrer hätte ihn nicht besser demütigen können. Judensau, und dazu die Ohrfeige. Und die ganze Klasse hatte es gesehen und gehört. Er hätte aufheulen können vor Wut.
„Ab mit dir in die Ecke“, befahl Degenhardt und deutete mit dem Zeigefinger der linken Hand, seiner einzigen, zur Ecke links neben dem Pult, gegenüber der Klassentür.
Die Richthofen-Volksschule in Essen-Schonnebeck unterrichtete seit 1928 ausschließlich Jungen. An diesem 5. März schien es gar nicht richtig hell zu werden. Grauer Dunst hing über den Dächern der Bergmannssiedlung. Hans Gehrke verließ das dunkelbraune Backsteingebäude, dessen Westflügel seit fünf Wochen nur noch eine Ruine war, allein. Den Tragriemen seiner Tasche hatte er lässig über nur eine Schulter geworfen. Das Johlen seiner Mitschüler, die im Laufschritt, beschwingt durch die frisch gewonnene Freiheit, zu beiden Seiten an ihm vorbeieilten, nahm er nur unterbewusst wahr.
„Heil Hitler, Jungens!“, hatte der Lehrer den Schülern zum Schulschluss wie gewohnt zugerufen.
„Heil Hitler, Herr Degenhardt!“, war die Antwort im Gleichklang fünfunddreißig Kehlen entwichen. Fünfunddreißig rechte Arme waren emporgeflogen, eine eingeübte, eine eingebläute Balletteinlage. Nur der Lehrer hatte mit links gegrüßt.