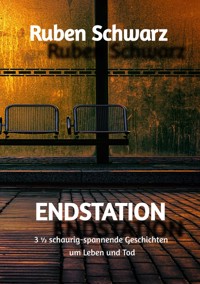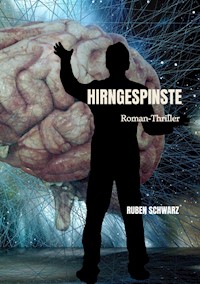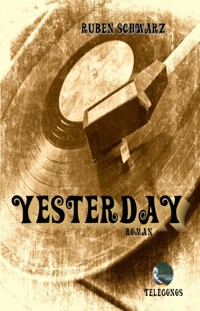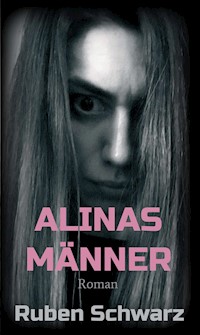4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nicht nur für Hannah ist Zeit relativ. Ganz besonders in ihrem zweiten faszinierenden Zeitreise-Abenteuer. Drei Frauen begegnen sich in drei spannenden Geschichten, durch die Jahrzehnte getrennt, auf wundersame Weise. Für Hannah ist es nicht der erste Ausflug in die Vergangenheit, aber mit der RAF hatte sie es bisher noch nicht zu tun. „Gras“ hat sie auch noch nie geraucht, und sie kommt aus dem Staunen nicht heraus.
Eine geheimnisvolle alte Dame macht sie darauf aufmerksam, dass sie im Jahr 1972 ihre beste Freundin retten muss. Und sie erlebt, dass die Zeit kein Hindernis für die Liebe ist, wohl aber die gesellschaftlichen Konventionen.
Hannah und die Frage der Zeit ist ein außergewöhnlicher und turbulenter Cocktail aus neuerer Geschichte, Spannung, Drama, Mystery, Liebe und Hass.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hannah und die Frage der Zeit
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenÜber dieses Buch:
Nicht nur für Hannah ist Zeit relativ. Ganz besonders in ihrem zweiten faszinierenden Zeitreise-Abenteuer. Drei Frauen begegnen sich in drei spannenden Geschichten, durch die Jahrzehnte getrennt, auf wundersame Weise. Für Hannah ist es nicht der erste Ausflug in die Vergangenheit, aber mit der RAF hatte sie es bisher noch nicht zu tun. „Gras“ hat sie auch noch nie geraucht, und sie kommt aus dem Staunen nicht heraus.
Eine geheimnisvolle alte Dame macht sie darauf aufmerksam, dass sie im Jahr 1972 ihre beste Freundin retten muss. Und sie erlebt, dass die Zeit kein Hindernis für die Liebe ist, wohl aber die gesellschaftlichen Konventionen.
Hannah und die Frage der Zeit ist ein außergewöhnlicher und turbulenter Cocktail aus neuerer Geschichte, Spannung, Drama, Mystery, Liebe und Hass.
Copyright © 2023 Ruben Schwarz – publiziert von telegonos-publishing
www.telegonos.de
(Haftungsausschluss und Verlagsadresse auf der website)
Cover: Kutscherdesign unter Verwendung von Adobe Stock Fotos
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN der Printversion: 978-3-946762-80-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Hannah
und die Frage der Zeit
Ruben Schwarz
Roman
telegonos-publishing
„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ Albert Einstein
„Reisen in die Vergangenheit müssen möglich sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.“ Steven Hawking
…gering, aber nicht ausgeschlossen.
Achtung:
Das Buch enthält explizite Gewaltszenen gegen Frauen
Once upon a time …
In der Paulinenstraße musste Norbert Wehmhöfer zusammen mit anderen Autofahrern rechts ranfahren, damit zwei Löschzüge der Essener Feuerwehr, und dicht dahinter ein grünweißer Käfer der Polizei mit eingeschalteten Blaulichtern, schrillen Sirenen und hohem Tempo überholen konnten. Die lauten Alarmtöne erzeugten in ihrem Zusammenspiel schmerzhafte Dissonanzen, und Norbert kurbelte eilig das Seitenfenster hoch. Er zog an seiner Zigarette und wollte eben den Blinker setzen, um vom Straßenrand anzufahren, als weitere Signalhörner ertönten. Ein VW-Bully der Polizei und ein kleineres Feuerwehr-Fahrzeug rasten heran, verzögerten kurz an der Ampelanlage, da wo die Girardetstraße einmündete, und verschwanden dann hinter einer leichten Linkskurve in der Veronikastraße.
Zu diesem Zeitpunkt machte Norbert sich noch keine ernsthaften Sorgen, sondern dachte lediglich kurz darüber nach, wie sehr er sich noch zusätzlich verspäten würde, falls es irgendwo auf seinem Weg einen Unfall gegeben hatte. Als er jedoch ebenfalls nach links in die Veronikastraße abbog, sah er die schwarzen Rauchschwaden, die sich träge zum Himmel hinaufwälzten und die Obergeschosse von ein paar der mehrstöckigen Altbauten links und rechts der Straße fast vollständig einhüllten.
Mehrere Polizeifahrzeuge standen in beiden Fahrtrichtungen quer auf der Straße. Ein paar Beamte hatten sich auf dem nassen Kopfsteinpflaster postiert und gaben den Autofahrern gebieterische Zeichen zu stoppen und zu wenden.
Wegen der starken Rauchentwicklung konnte Norbert durch die Windschutzscheibe seines 1800er BMWs – einem Firmenwagen – kaum weiter blicken als hundert oder hundertfünfzig Meter. Und dahinter, auf der linken Seite, irgendwo zwischen Rauch, nervös aufblitzenden Blaulichtern und Flammen, die gelegentlich emporloderten, war das Autohaus, das erst seit einem knappen halben Jahr sein Arbeitsplatz war. Und dort wartete möglicherweise Gisela auf ihn. Sehr wahrscheinlich tat sie das, wenn sie sich nicht ebenfalls verspätet hatte. Sie verspätete sich oft, wenn sie verabredet waren, und Norbert schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass es dieses Mal auch so sein möge.
Sie hatten heute Nachmittag einen gemeinsamen Wohnungs-Besichtigungstermin. Weil sie endlich rauswollten aus der engen Mansardenwohnung in Katernberg. Vor allem wollte Norbert das, denn wenn er Gisela mehr bieten konnte, wenn sie endlich ein großzügiges, komfortables Zuhause hatten, würde sicher alles ins Lot kommen zwischen ihnen. Vielleicht würde Gisela sich dann besinnen, wieder normal werden, lernen ihn richtig zu lieben, wie es zwischen Ehegatten üblich war.
Deshalb hatte er sie gebeten, ihn auf der Arbeit abzuholen, damit sie von dort aus gemeinsam zu ihrem Termin aufbrechen konnten. Jetzt aber war es seine einzige Hoffnung, sie könnte sich verspätet haben und nicht irgendwo inmitten der Flammenhölle umgekommen sein. Dass sich sein Lebenstraum nicht endgültig in schwarzen Rauch auflöste. Vielleicht war ja ihr Bus nicht pünktlich gekommen. Einmal musste das doch für etwas gut sein.
Ein jäher Schmerz an den Fingerspitzen ließ ihn zusammenfahren, und er ließ die heruntergebrannte Zigarettenkippe in seinen Schoß fallen. Hektisch fegte er die Glut mit dem Handrücken von seiner Hose in den Fußraum. Hinter ihm hupte jemand. Ein Polizist gab ihm mit grimmiger Miene Handzeichen. Norbert kümmerte sich nicht darum. Viel zu rabiat steuerte er den Wagen mit zwei Rädern auf den Gehweg – nicht gut für die Reifen – und stieß die Fahrertür auf.
„He, Sie da!“, rief der Polizist ihn herrisch an. Eine Windbö hatte die Rauchwolken zerrissen, und Norbert konnte sehen, dass die Neuwagenhalle in Vollbrand stand. Die Mauer aus Flammen züngelte mindestens acht oder zehn Meter in die Höhe. Mehrere Feuerwehrschläuche sprühten ihre Fontänen schräg in den Himmel und beregneten das schreckliche Szenario.
„Gisela“, keuchte Norbert und rannte los. Der Polizist bekam ihn mit einer Hand am Jackett zu fassen und geriet ins Taumeln, als Norbert sich losriss und in den Rauch hineinstolperte. Es war 14.10 Uhr, und selbst wenn Gisela einen Bus verpasst haben sollte, müsste sie längst im Autohaus angekommen sein.
Er lief um das Heck eines Löschzugs herum, an dem ein paar Feuerwehrleute mit Helmen und Atemmasken herumhantierten. Direkt vor der Ausstellungshalle schlugen Flammen aus dem nagelneuen 911 T Carrera, den der Chef heute Vormittag, noch vor Norberts Kundentermin, dort abgestellt hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte das Fahrzeug noch eine leuchtend gelbe Lackierung besessen, während es jetzt nur noch ein schwarzes Wrack war.
Mitten in dem Geräuschinferno aus gebrüllten Kommandos, dem Dröhnen der Wasserpumpen und dem Krachen und Pfeifen, das die Flammen verursachten, wurde Norbert von einem Feuerwehrmann und einem Polizeibeamten gepackt. Sie hielten ihn mit eisernen Griffen fest und der Polizist herrschte ihn an. „Sind Sie wahnsinnig, Mann? Verschwinden Sie hier!“
„Meine Frau“, schrie Norbert ihm verzweifelt ins Gesicht. In diesem Moment glaubte er, verrückt zu werden. Seine Augen brannten und er musste husten. Gisela, dachte er mit aller Inbrunst, zu der er fähig war. Es fehlte nicht viel, und er hätte dem Polizeibeamten einen Schlag ins Gesicht verpasst. „Meine Frau ist da drin!“
„Beruhigen Sie sich!“, rief der Feuerwehrmann. Er musste schreien, weil der Krach um sie herum ohrenbetäubend war. „Sie können hier nichts machen! Wir kümmern uns drum!“ Norbert riss sich los und stieß ihn zur Seite. Der Polizist drehte ihm den Arm auf den Rücken und schob ihn zurück, weg aus der Gefahrenzone. „Schluss damit, Kerl. Sie behindern die Rettungskräfte bei der Arbeit. Warten Sie von mir aus da hinten.“ Er deutete dorthin, von wo Norbert gekommen war, und gab ihm einen Stoß, der ihn in die besagte Richtung taumeln ließ. Aus der Paulinenstraße näherten sich jetzt noch mehr Polizeiwagen und zwei Krankenwagen mit heulenden Martinshörnern.
Teil 1 – Helga
1948
1
Helga war von Anfang an ein sehr liebes Kind gewesen. Die wenigen Haare, die ihr Köpfchen bei der Geburt im Jahr 1944 geziert hatten, waren hellblond gewesen, beinahe silbern. Sie hatte leuchtend blaue Augen, und ihr Mund unter der süßen Stubsnase lächelte viel, blieb aber ansonsten meistens stumm. Hatte sie Hunger oder war ihre Windel voll, so bildete sich auf ihrer Stirn eine feine steile Falte und ihre Augen schauten besorgt, während sie ihre Unterlippe anklagend vorschob und still vor sich hin seufzte. Richtiges Weinen oder sogar Schreien, wie man es von anderen Säuglingen kannte, kamen bei Helga nur sehr selten vor. Vater Kurt und Mutter Therese liebten das Kind, welches ihr einziges war, abgöttisch. Erst als die Patentante Eva, eine von Kurts Schwestern, bei einem Sonntagsbesuch darauf hinwies, dass es vielleicht nicht ganz normal sei, wenn ein Kind nie schrie, begannen Kurt und Therese sich Sorgen zu machen. Aber Helga gedieh ausgezeichnet, sie aß, was man ihr anbot, schaute verständig aus ihren großen Augen, wenn man mit ihr sprach, lachte manchmal und sie begann früh zu krabbeln. Nur mit dem Sprechen tat sie sich schwer, obwohl Mama und Papa ihr bei jeder Gelegenheit eindringlich und mit aufwendiger pantomimischer Unterstützung Worte wie Mama, Papa, Heia-Bett, Kacka, Ball und Wauwau zur Nachahmung empfahlen.
Kurt Rentrop arbeitete damals als Hilfsarbeiter bei Thyssen im Auftrag des Heereswaffenamts in der Herstellung von Geschosshülsen vom Kaliber 7,92 mal 57 Millimeter für das Maschinengewehr M42 und seinen Vorgänger MG 34. Trotzdem verdiente er für einen Kriegs-Invaliden nicht schlecht, weil er außerdem die Verantwortung für dreiundzwanzig Zwangsarbeiter trug, die überwiegend aus Moldawien und dem südlichen Teil der Ukraine stammten. Nachdem der Betrieb aufgrund massiver Luftwaffenangriffe beinahe zwei Wochen stillgestanden hatte, konnte die Produktion mit halber Kraft wieder aufgenommen werden.
Eine Salve aus einem sowjetischen Infanterie-MG DP 1928 hatte ihm in Stalingrad das rechte Knie zerfetzt. Das Bein hatte gerettet werden können, war aber steif geblieben, und Therese Rentrops größter Wunsch an den lieben Gott, dass ihr Kurt nicht mehr an die Front müsse, hatte sich dadurch erfüllt.
Als Helga Rentrop zwei Jahre alt wurde, war ihr Haar inzwischen viel dichter und auch dunkler geworden. Patentante Eva meinte, es sei aschblond, während Onkel Heinz es für braun hielt. Gertrud, Thereses Mutter, bestimmte, dass das Kind straßenköterblond sei und setzte sich mit dieser Definition durch. Auch die ursprünglich blauen Augen waren dunkler geworden und blickten nun, keineswegs weniger freundlich, mit einem leuchtenden Graublau in die Welt. Vater Kurt, der für einige Zeit befürchtet hatte, sein einziges Kind sei vielleicht „nicht ganz normal“ – was er selbstverständlich niemals gegenüber seiner Frau oder Bekannten auch nur angedeutet hatte – , rückte von dieser Befürchtung ab, als Helga, zwar spät aber immerhin, damit anfing, Worte und Halbsätze nachzuplappern. Und wenn die Mama sich darüber freute und ihr Kind lobte, lachte es so liebreizend, dass Kurt sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel wischen musste.
„Wat soll sisch dat Mädsche denn de Muul fusselich schwaade, wenn all in Oodnung is?“, hatte Onkel Heinz noch am zweiten Weihnachtstag in die Runde geworfen. „Dat Helgachen wird sich schon melde, wenn wat nit stimmt.“ Heinz redete konsequent in seinem typisch rheinischen Dialekt, und schlug sich dabei mit der flachen Hand auf den Schenkel, als warte er auf einen Tusch, obwohl er der Einzige war, der die Bemerkung damals lustig fand.
Wie viele andere Familien, so hatten es auch die Rentrops nicht leicht. Der Krieg war mittlerweile zu Ende und große Teile Düsseldorfs lagen in Schutt und Asche. Wirtschaft und Industrie fanden schlichtweg nicht mehr statt, und Grundnahrungsmittel galten als Luxusgüter. Außerdem hatten Kurt und Therese schon im November 44 das ältere Ehepaar Kreuder in ihrer Altbauwohnung in Derendorf aufgenommen und lebten daher sehr beengt. Die Kreuders hatten schräg gegenüber gewohnt und waren seit der Nacht auf den 3. November ausgebombt.
Wie sich herausstellte, war die kleine Helga sehr ungeschickt. Sie musste nur mit ihren kleinen Trippelschritten einmal einen Raum durchqueren, und schon fiel entweder ein Aschenbecher vom Tisch, eine Blumenvase von der Kommode oder ein Glas mit eingemachter Brombeermarmelade aus dem Regal, was auf dem gefliesten Küchenboden eine Riesensauerei anrichtete.
„Ich möchte bloß wissen, wie das Kind das immer wieder macht“, sagte Therese Rentrop mehr als einmal entnervt zu ihrem Mann. „Ich pass doch schon so auf, und stell alles ganz nach oben, was umkippen könnte.“ Helgas Mutter schwor jeden Eid, dass die Stehlampe neben dem Schränkchen mit dem Volksempfänger darauf umgekippt war, obwohl Helga mindestens zwei oder drei Meter davon entfernt gestanden hatte, und deshalb die schmale hohe Lampe mit dem beigen Stoffschirm mit ihren kurzen Ärmchen unmöglich hatte erreichen können. Angeblich war das an einem Samstagnachmittag geschehen, während Kurt am Burgplatz versucht hatte, ein paar Zigaretten gegen Brot und Schmalz einzutauschen.
„Ach, Frau, du bis bekloppt“, war Kurts Reaktion darauf, was er jedoch nicht böse meinte und Therese kurz darauf einen versöhnlichen Kuss gab. Therese war manchmal ein bisschen hysterisch. Seit der Bombennacht 43 war das schlimmer geworden. Die Frau sah eben manchmal Gespenster. Jedenfalls war das zu dem Zeitpunkt seine Erklärung für das vermeintliche Wunder mit der Stehlampe. An dieser Einstellung änderte sich so bald nichts, denn es gab nicht viele von diesen Vorfällen. Auch er wunderte sich manchmal, wenn in Helgas Umgebung Löffel vom Tisch fielen oder Gläser umkippten. Wohlgemerkt in Helgas Umgebung. Beide Elternteile hatten im entscheidenden Moment nicht hingesehen, und es drängte sich nicht selten die Frage auf, ob Helga die Gegenstände wirklich berührt haben konnte. Manchmal sah es so aus, als wäre das nicht der Fall, oder das Mädchen hatte sehr gute Reflexe und konnte sich so schnell für ein paar Schritte vom Ort des Geschehens zurückziehen, dass der Verdacht nicht auf sie fiel.
Meistens schimpfte nur die Mutter. Kurt Rentrop hielt sich mit Tadel eher zurück. Helga war einfach ein zu süßer Engel, als dass er ihr ernsthaft böse sein konnte. Die herabfallenden Teller waren ohnehin nicht sehr wertvoll, und um die verschüttete Milch war es zwar schade, aber dafür wollte er sein Kind nicht weinen sehen, was bei Helga allerdings ohnehin so gut wie nie vorkam. Wenn die Mutter schimpfte, schaute das Kind sie mit großen Augen an und wirkte ganz ernst, beinahe erwachsen. Manchmal schob sie die Unterlippe vor und bildete ein „Schüppchen“ und dabei wurden ihre Augen feucht. Zu so etwas wie herzzerreißendem Weinen war sie anscheinend nicht in der Lage. Bestenfalls dann, wenn sie in der kleinen Zinkwanne saß, die man für sie zum Baden in der Küche auf zwei Stühle gestellt hatte, und aus der sie sich nur sehr widerwillig wieder herausheben und abtrocknen ließ.
Kurt Rentrop änderte seine Einstellung wenige Tage nach Helgas viertem Geburtstag, es muss also im Juni 1948 gewesen sein. Was er bisher nur befürchtet, aber mehr oder weniger erfolgreich verdrängt hatte, wurde zur Gewissheit. Mit seinem Kind war tatsächlich etwas nicht in Ordnung. Rentrop hatte sich nach einer Zeit mit diversen Aushilfsjobs beruflich neu orientiert und verdingte sich aktuell als sogenannter „Einreißer.“ Die Kriegsschäden in der Stadt würden ihm und seinen Kollegen noch jahrelange Arbeit verschaffen, es sei denn, er würde in absehbarer Zeit eine feste Stelle als Elektriker finden, was sein erlernter Beruf war. Das hoffte er inständig, denn Einreißer war ein Knochenjob im wahrsten Wortsinn. Das hatte er gleich in der zweiten Woche seiner Tätigkeit schmerzlich zur Kenntnis nehmen müssen, denn beim unkontrollierten Einsturz einer Fabrikmauer waren ihm Ziegelsteine auf die linke Hand gefallen. Dabei hatte er sich mehrere Finger gebrochen. Allerdings meldete Kurt sich schon zwei Wochen später trotz eines Gipsverbandes wieder zur Arbeit, denn sie brauchten dringend das Geld.
Die Mitbewohner der Rentrops, das Ehepaar Kreuder hatten inzwischen in der Nachbarschaft ihrer Tochter und deren Mann in Niederkassel eine neue Bleibe gefunden. Daher hatten die Rentrops, was Kurt als wahren Segen empfand, ihre Wohnung endlich wieder für sich allein.
Während Therese sich in der Küche um den Abwasch kümmerte, hatte Kurt sich eben auf dem verschlissenen grünen Sofa im Wohnzimmer niedergelassen. Er nahm die NEUE ILLUSTRIERTE vom hölzernen Wohnzimmertisch, der mit seinen unzähligen Narben und Brandflecken schon sehr viel bessere Tage gesehen hatte. Das Titelblatt zierte die Schwarzweißaufnahme des Schauspielers Hans Söhnker mit einer hübschen blonden Frau. Die beiden wirkten sehr vertraut, vermutlich handelte es sich um eine Filmszene. In dem kleinen Kästchen, dass die Hersteller des Magazins in das Titelfoto eingebaut hatten, konnte man lesen, dass Herr Söhnker mit seiner jungen Kollegin Hildegard Knef den ersten Film in diesem Jahr vollendet hatte. Der Titel des Films war seltsamerweise Film ohne Titel.
Kurt riss ein Streichholz in Brand und zündete sich genüsslich – er tat es tatsächlich beinahe wie ein heiliges Ritual - eine Zigarette an. Jeden Tag leistete er sich einen einzigen Glimmstängel, denn Zigaretten waren immer noch eine heiß begehrte Tauschware auf dem Schwarzmarkt. Aber wenigstens diese eine Kippe sollte sich ein hart arbeitender Mann in diesen Zeiten leisten können.
Während er den ersehnten ersten Zug tief inhalierte und die Illustrierte noch auf seinen Knien lag, dachte er darüber nach, wann es wohl möglich sein würde, mal wieder mit Therese ins Kino zu gehen, und was man während dieser Zeit mit Helga anstellen sollte. Nachdenklich blies er den Rauch zur Decke, als Helga mit schnellen Schritten ins Wohnzimmer gelaufen kam, wie kleine Kinder es zu tun pflegten. Anscheinend hatte Therese das Mädchen geschickt.
„Papa, komm Ball spielen“, piepte sie mit ihrer hellen Stimme.
„Komm mal her“, sagte Kurt und winkte Helga zu sich heran. Er parkte die Zigarette im Mundwinkel, warf die Zeitschrift zurück auf den Tisch, fasste dem kleinen Mädchen mit seinen kräftigen und schwieligen Händen, deren kurze Fingernägel schwarze Trauerränder trugen, unter die Achseln und setzte es mit einem Schwung auf seine Oberschenkel. Als ihn die graublauen Augen freundlich und voller Vertrauen musterten, empfand er ein warmes Glücksgefühl, und er musste daran denken, was ihm verwehrt gewesen wäre, hätte der Russe in Stalingrad mit seinem MG einen oder auch nur einen halben Meter höher gezielt.
„Papa, ich will Ball spielen“, sagte das Mädchen.
„Später, Helga“, antwortete Kurt. „Und es heißt Ich möchte Ball spielen.“
„Möchte Ball spielen“, wiederholte Helga.
„Lass den Papa noch ein bisschen in seiner Zeitung lesen. Ballspielen geht in der Wohnung nicht. Male doch noch ein bisschen.“ Kurt deutete auf einen Stapel von ungefähr gleich großen, annähernd quadratischen Papierbögen auf einer Ecke des Wohnzimmertisches, die er aus dem Rest einer Rolle Küchentapete zurechtgeschnitten hatte, damit Helga auf den Rückseiten malen konnte. Auf dem Stapel lagen ein paar Buntstifte, die Kurt bei Bedarf mit seinem Taschenmesser anzuspitzen pflegte.
„Gleich Ball spielen“, stellte Helga fest und ließ sich von Papas Schoß herunterrutschen. Sie ging um den Tisch herum und ließ sich dort, wo der Papierstapel lag, auf ihre Knie nieder. Sie griff nach dem roten Malstift.
„Aber nur auf dem Papier malen, Helgachen, ja?“, mahnte Kurt. „Nicht auf dem Tisch.“ Während die Kleine begann, mit dem Stift in der linken Hand rote Formen auf das grobe Papier zu zeichnen, die vermutlich Kreise sein sollten, stützte sie sich mit dem rechten Unterarm auf dem Tisch ab und beugte sich so tief nach unten, dass ihr Gesicht beinahe das Papier berührte. Amüsiert beobachtete Kurt, wie Helgas Zungenspitze in ihrem Mundwinkel sichtbar wurde und sie hoch konzentriert und mit ernster Miene ihr Werk aus allernächster Nähe ins Auge fasste.
Kurt nahm die Illustrierte wieder auf. Sie war nicht ganz neu. Therese bekam sie immer von ihrer Nachbarin, Frau Kluge, wenn diese sie ausgelesen hatte. Nur noch aus den Augenwinkeln sah Kurt, wie seine Tochter den roten Stift zur Seite legte, und kurz darauf begann, die roten Ovale, Kreise und Trapeze blau auszumalen. Er fragte sich, warum sie nie etwas Richtiges malte, etwas, unter dem man sich was vorstellen konnte.
Therese betrat in ihrer blaugemusterten Kittelschürze den Raum. Sie hielt ein rot-weiß kariertes Küchentuch in der Hand. Sie war hager und ihre braune Dauerwellenfrisur wies schon ein paar grau durchwirkte Stellen auf. Therese hatte sich verändert seit Helgas Geburt. Wahrscheinlich war es aber doch eher die Sorge um den Mann an der Ostfront und die Entbehrungen der letzten Kriegsjahre gewesen, die aus der quirligen und lebenslustigen jungen Frau einen ernsten und oft beinahe melancholischen Menschen gemacht hatten.
„Na, spielst du schön mit Papa?“, fragte sie lächelnd. Dann verfinsterte sich ihre Miene ein wenig. „Helga“, begann sie und schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. „Du sollst doch immer das schöne Händchen nehmen. Wie oft habe ich dir das schon gesagt?“ Die Angesprochene sah von ihrem Werk auf und übergab den Stift folgsam von der linken in die rechte Hand.
„Du musst auch ein bisschen darauf achten, Kurt“, maßregelte Frau Rentrop ihren Mann. „Was soll denn sonst werden, wenn sie mal in die Schule kommt?“
„Hm, hm“, brummte Kurt und nickte. Von seiner Mutter wusste er, dass auch er als kleiner Junge vieles mit Links erledigt hatte und man es ihm mühsam hatte austreiben müssen. Eine Zeit lang hatte man ihm sogar jedes Mal auf die Finger gehauen, wenn er ein Spielzeug, einen Stift oder einen Löffel ins „falsche Händchen“ genommen hatte. Therese verschwand wieder aus der Tür, und er schlug die Zeitschrift auf. Trotzdem nahm er wahr, wie Helga ihn lange ansah. Sie legte den blauen Stift zur Seite und griff mit der linken Hand nach dem grünen. Sie begann damit, ihn auf dem Papier hin und her zu bewegen und so eine grüne Fläche zu erzeugen, ohne jedoch hinzuschauen. Stattdessen beobachtete sie ihren Vater, und erst, als dieser von seiner Lektüre aufsah, übergab sie den Stift in die richtige Hand. Kleiner Frechdachs, dachte er, schüttelte missbilligend und gleichzeitig lächelnd den Kopf und begann zu lesen. Vielleicht würde Helga ja irgendwann anfangen, Personen, Häuser und Tiere zu malen. Mit dem Sprechen hatte sie sich schließlich auch Zeit gelassen.
Kurt Rentrop blätterte mit mäßigem Interesse die Zeitschrift durch. Die NEUE ILLUSTRIERTE enthielt tatsächlich in der Hauptsache nur „Frauenkram.“ Vor Kurzem hatten sie darüber gesprochen, die Neue Rheinische Zeitung zu abonnieren, es dann aber aus Kostengründen doch unterlassen. Es standen zu viele Anschaffungen an, wie zum Beispiel ein Waschautomat mit integrierter Mangel, den Therese sich schon lange wünschte, und ein neuer Wintermantel und Schuhe für Helga. Spätestens im Herbst würde das nötig sein. Dieses Mal würden sie Mantel und Schuhe mindestens eine Nummer größer kaufen, denn Helga wuchs immer so schnell aus allem heraus.
„Papa, Ball spielen?“, fragte das Mädchen erneut. Dieses Mal hatte sie es höflich als Frage formuliert. Kurt ließ die Zeitschrift sinken und sah zum Fenster. Wenigstens hatte der Regen aufgehört. Manchmal spürte er den Wetterwechsel in den schlecht verheilten Fingerknochen der linken Hand. Immerhin könnte er mit der Kleinen noch für eine halbe Stunde runter in den Hof gehen.
Doch dann passierte etwas, was Kurt Rentrop bis in die weitverzweigten Verästelungen seines Nervensystems erschütterte: Der weiße Plastikball mit den roten, teilweise schon abgeschabten Punkten, der neben Helgas Teddybär auf dem verschlissenen Ohrensessel lag, bewegte sich. Ohne, dass irgendjemand ihn berührte, ohne irgendeinen nachvollziehbaren Grund löste er sich aus seiner Position in einer Ecke des Sessels und rollte nach vorn. Er kippte über die vordere Kante der Sitzfläche, fiel mit einem leisen dumpfen Geräusch auf den braunen Teppich, hüpfte noch einmal ein paar Zentimeter in die Höhe und blieb liegen. Dann begann er zu rollen, verließ den Teppich, erreichte die alten Holzdielen, die Kurt selbst mit roter Farbe lackiert hatte und näherte sich Helga. Noch mehr als dieser unerklärliche Vorgang erschreckte Kurt der Gesichtsausdruck seines Kindes. Helga starrte unentwegt und ohne zu blinzeln auf den Ball, der dicht neben ihr zur Ruhe kam. Ihre Miene drückte eine Form von Konzentration aus, als blicke sie in eine andere Welt. Das faltenlose, weiße Kindergesicht wirkte wie eine Maske aus Wachs.
Dann kehrte das Leben in das Mädchen zurück. Ihr Gesicht entspannte sich, sie blickte lächelnd, beinahe ein bisschen stolz ihren Vater an. Der bemerkte, dass sein Mund offenstand und seine Finger sich in das Papier der NEUEN ILLUSTRIERTEN gekrallt hatten.
„Helga“, keuchte er heiser.
„Ball spielen“, antwortete das Kind.
„Komm mal sofort hier her.“ Das Mädchen stand auf und blickte ein wenig besorgt in das Gesicht ihres Vaters. Kurt rang noch immer um Fassung. Als Helga vor ihm stand und ihn aus ihren ernsten tiefgründigen Augen ansah, packte er sie an beiden Oberarmen und schüttelte sie. „Was machst du da?“, herrschte er sie halblaut an. „Mach das nie wieder, hörst du? Nie wieder!“ In den Mundwinkeln des Mädchens zuckte es, und ihre Augen wurden langsam feucht, aber sie weinte nicht.
„Ball spielen“, piepste sie kleinlaut und wandte das Gesicht sehnsuchtsvoll ihrem Ball zu.
„Nie wieder, ist das klar?“ Kurt schüttelte das Kind ein weiteres Mal. Sie starrte ihn mit offenem Mund an. Erst jetzt bemerkte er, dass er die dünnen Ärmchen viel zu fest umklammert hatte und sein erschrockenes Gesicht dem Kind Angst machen musste. Er ließ sie los. „Pass auf, Helga“, sagte er etwas ruhiger. „Wenn wir etwas haben wollen, holen wir es uns, klar? Wir gehen hin und heben es mit den Händen auf.“ Helga nickte artig. Sie sah erneut den Ball an, und Kurt hätte schwören können, dass er fast unmerklich vibrierte.
„Heben es auf“, sagte Helga. Sie ging zum Ball, bückte sich und nahm ihn in beide Hände. Nachdenklich besah sich Kurt die kostbare Zigarette, die er auf dem Rand des Aschenbechers abgelegt hatte und die, ganz ohne sein Zutun, vollständig abgebrannt war und nur noch eine Schlange aus weißer Asche bildete. Als er die zerknüllte Illustrierte auf den Tisch legte und aufstand, bemerkte er, dass ihm schwindelig war. Vielleicht hatte er für eine Weile vergessen zu atmen, oder sein Herzschlag hatte für einen Moment ausgesetzt. Sein Blick streifte das kleine braune Holzkästchen mit den blank polierten Messingbeschlägen, das auf dem Rundfunkempfänger stand.
„Ich geh mit der Kleinen noch mal nach draußen“, erklärte er in der Diele seiner Frau. Während er seine Füße in die festen Schnürschuhe schob, mit denen er auch zur Arbeit ging, half Therese Helga beim Binden ihrer Schuhbänder.
„Aber sie soll sich heute nicht mehr dreckig machen.“ Therese hielt ihrer Tochter die grobe Strickjacke so hin, dass das Kind seine Ärmchen problemlos in die Ärmel schieben konnte. Kurt Rentrop ging mit seiner Tochter durch den Hausflur hinunter in den Hof. Zwischen der rotbraunen Ziegelsteinmauer und einem Schuppen waren Wäscheleinen gespannt. Weil es heute jedoch schon mehrfach Regenschauer gegeben hatte, waren keine Wäschestücke zu sehen. Neben der Toreinfahrt, die nach draußen auf die Straße führte, lehnte das alte Moped von Heinrich Krull, dem Maurer aus dem zweiten Stock, mit dem Kurt sich gelegentlich an wärmeren Sommertagen eine Flasche Bier teilte. Dahinter lag das Fahrrad der Witwe Wallmeyer am Boden. Ihr Mann Friedrich war in Frankreich geblieben. Geblieben bedeutete in diesem Fall nicht, dass er eine nette Französin kennengelernt und mit ihr eine neue Familie gegründet hatte, sondern umschrieb freundlich die Tatsache, dass ein Schrapnell-Splitter in seinem Unterleib alles zerfetzt hatte, was im weitesten Sinn mit der Verdauung zu tun hatte. Kurt richtete das Fahrrad auf und lehnte es an die Hauswand.
Als Kurt seiner Frau am späten Abend im Schlafzimmer die Geschichte mit dem Ball erzählte, glaubte sie zuerst, er wolle sie auf den Arm nehmen, obwohl sie selbst doch von ein paar Vorkommnissen mit herabfallenden Tellern und verschütteter Milch berichten konnte. Als Kurts Miene jedoch bis zum Ende seines Berichts ernst blieb und er beteuerte, dass es sich so und nicht anders zugetragen hatte, teilte sie seine Sorge, im Kopf ihres einzigen Kindes könne etwas nicht ganz richtig sein. Die Angst, dass Helga nicht ganz normal sein könnte, dass sie vielleicht so etwas wie ein Monstrum oder eine Missgeburt war, begleitete die beiden noch für eine ganze Weile, zumal sich kaum vier Wochen danach ein weiterer unerklärlicher Vorfall ereignete:
Die Familie war zu Tante Hermines vierundsechzigsten Geburtstag in die Spichernstraße eingeladen. Unter anderem war auch Berthold, Tante Hermines sechsjähriger Neffe zu Besuch, ein unruhiger junger Mann, der nicht stillsitzen konnte und vorlaute Bemerkungen machte, während sich die Erwachsenen unterhielten, wofür er von seinem Vater Otto, der Schreinergeselle war und mindestens hundertfünfzig Kilo wog, insgesamt mindestens drei schallende Ohrfeigen kassierte. Der Junge heulte dann zwar, vergaß die Züchtigung aber jedes Mal sehr bald und untermauerte so Ottos oft zitierte Theorie, dass eine ordentliche Tracht Prügel noch keinem geschadet hatte.
Nach dem gemeinsamen Abendessen hatten beide Kinder, Helga und Berthold, jeweils eine halbe Tafel Schokolade erhalten.
„Losst et üch schmecke, Pänz“, sagte Tante Hermine und rieb schmunzelnd, an die anwesenden Erwachsenen gewandt, Daumen und Zeigefinger aneinander. „Wozu hammer schläßlich jetz die D-Mark?“ Während Therese Rentrop bei einem Gläschen Kirschlikör mit Isolde, Ottos Ehefrau und Mutter von Berthold übereinkam, dass beide den neuen Rühmann-Film Der Herr vom anderen Stern, der gerade in Berlin uraufgeführt wurde, unbedingt anschauen wollten, sobald er im Kinosaal an der Roßstraße gezeigt würde, befand sich Bertholds Vater Otto mit Heinrich Lübbe, einem Nachbarn von Tante Hermine, in einer hitzigen Debatte über die Berlin-Blockade durch die UdSSR. Die Westmächte und die Russen schoben sich die Verantwortung für die Sperrung der Zugangswege in die Stadt gegenseitig zu.
Kurt Rentrop hingegen beobachtete verzückt, wie vorsichtig seine kleine Tochter das Herausschälen der Schokolade aus dem Silberpapier zelebrierte und die einzelnen Stückchen auf ihrem Kuchenteller drapierte, bevor sie andächtig eins davon in den Mund schob. Der sechsjährige Berthold auf der anderen Seite des Tisches riss die Verpackung brutal auf und biss sogleich ein großes Stück von seiner Schokolade ab.
„Noch en Tass Kaffe, Kucht?“, sagte Hermine. Kurt Rentrop blickte auf und nickte. „Ja, gerne, Tante Minchen. Wenn et schon mal so ne leckere Bohnenkaffee gibt.“ Er nahm seine Untertasse mit Daumen und Zeigefinger auf. Tante Hermine beugte sich mit der Kaffeekanne über den Tisch und goss Kurt die Tasse beinahe randvoll. In diesem Moment erscholl ein helles klagendes Geheul direkt unter ihr, das sie zusammenfahren ließ. Es hätte nicht viel gefehlt, und die gute Porzellankanne wäre Hermine aus der Hand gefallen.
„Herrgott, wat is dann loss?“, entfuhr es ihr. „Do kritt mer jo e Hääzschlach.“ Aller Augen richteten sich auf Berthold, während sämtliche Gespräche verstummten. Sein Vater Otto, der neben ihm saß, hatte schon die flache Hand erhoben. Der Junge starrte mit großen feuchten Augen auf seinen Teller. „Meine Schokolade …“, keuchte er entsetzt. In der Tat lagen nur noch ein paar braune Krümel auf seinem Teller. „Herrgott, du Nichtsnutz, was schlingst du denn alles so gierig runter!“, grollte sein Vater. Die flache Hand ging wie das Schwert des Damokles über Bertholds Hinterhaupt in der Luft.
„Kannst du dich nicht ein einziges Mal benehmen?“, klagte seine Mutter mit einem Blick nach oben, als erwarte sie himmlischen Beistand.
„Ach komm, loss der Jung“, beschwichtigte Tante Hermine, die sich wieder gesetzt, und die Kanne auf der weißen Tischdecke abgestellt hatte. „Wenn et ihm doch schmeckt.“
„Aber meine Schokolade ist weg“, jammerte Berthold. Sein Gesicht drückte Fassungslosigkeit aus.
„Selber schuld“, entschied Otto.
„Aber die hat …“ Berthold deutete mit dem Zeigefinger über den Tisch auf Helgas Teller. Sein Satz brach ab, weil die Handfläche seines Vaters seinen sauber ausrasierten Hinterkopf mit einem klatschenden Geräusch traf. Der Junge heulte auf, vermutlich weniger vor Schmerz als vor Wut über die schreiende Ungerechtigkeit, während Helga genüsslich ein weiteres Stückchen Schokolade zwischen ihre niedlichen Lippen schob. Im weiteren Verlauf des Nachmittags verhielt sich Berthold still. Ernst saß er auf seinem Stuhl, brütete vor sich hin und hielt die Hände unter dem Tisch ineinander verschränkt, während er immer wieder verstohlen, wütend, aber auch manchmal ein bisschen ängstlich zu Helga hinüberblickte.
Die Gespräche der Gesellschaft waren längst wieder aufgenommen worden, und Kurt Rentrop war vermutlich der Einzige, dem es überhaupt aufgefallen war, dass seine Tochter eine Zeit lang eindeutig mehr Schokoladenstücke auf dem Teller gehabt hatte, als eine halbe Tafel normalerweise hergab. Und es war ziemlich ausgeschlossen, dass das kleine Mädchen mit seinen kurzen Ärmchen über den Tisch hinweg Schokolade von Bertholds Teller hätte nehmen können, abgesehen davon, dass ihm selbst dieser Versuch aufgefallen wäre. Kurt Rentrop behielt es wieder einmal für sich. Auch später am Abend erzählte er nichts seiner Frau.
Da war sie wieder, die quälende Sorge, sein niedliches kleines Mädchen könne nicht ganz richtig im Kopf sein. Ein Monstrum, das im Leben Schwierigkeiten haben, keinen Mann finden und vielleicht sogar irgendwann in der Irrenanstalt enden würde.
1970
2
Verschwinde!, zischte Helga leise und scharf. Sie sagte es stumm, dachte es sogar nur, während ihre Lippen für Außenstehende kaum merklich zuckten. Der Impuls war sehr plötzlich in ihrem Kopf entstanden, und es gelang ihr, ihn rechtzeitig wieder in den Hintergrund zu drängen. Oft passierte ihr das zum Glück nicht mehr.
Sie stand neben dem breiten gläsernen Portal des Autohauses und beobachtete seit ein paar Minuten, wie der Mann im blauen Monteur-Overall ein hellgrünes glänzendes Coupé rückwärts vom Transporter manövrierte, den er draußen an der Straße geparkt hatte. Es war ein 2800er GTS, ein schnittiges Modell, das auch Helga gefiel.
Henner, einer der älteren Verkäufer, war eben dabei, den blütenweißen und nagelneuen 02er BMW innerhalb des Verkaufsraums neben dem roten Modell gleicher Bauart zu parken. Diese Fahrzeuge hatte der Fahrer zuvor bereits vom Transporter abgeladen. Der frische Lack und die silbernen Zierleisten blitzten im Sonnenlicht und unter den hellen Deckenflutern der Halle.
Lotte war in ihrem Kopf. Immer. Aber seit Jahren schlief sie meistens, beziehungsweise hatte Helga sie sediert. Für den Bruchteil einer Sekunde war der Drang in ihr stark gewesen, den 2800er GTS mit seinem Fahrer am Steuer vom Transporter abstürzen zu lassen. Das Fahrzeug befand sich in der schiefen Ebene der Verladeschienen noch etwa zwei Meter oberhalb des Straßenasphalts, als Lotte sich gemeldet hatte. Der Impuls war von einer jähen Lust begleitet gewesen, den Wagen abstürzen zu sehen, zu beobachten, wie sich die Räder über den Rand der Verladeschienen bewegten, wie das Coupé in Schieflage geriet und mit lautem Krachen auf den Gehweg knallte, wie der Lack abplatzte, Glas splitterte, sich die Türen verzogen und die Motorhaube aufsprang. Lotte war eine unangenehme Person, aber Helga hatte sie zum Glück im Griff. Meistens hatte sie den Riegel aus Messing an dem braunen Kästchen unter Verschluss, in dem Lotte steckte.
Das war lange Zeit nicht so gewesen. In ihrer Kindheit, in der Grund- und später in der Realschule waren manchmal seltsame Dinge passiert, für die sich Helga später geschämt hatte.
Heute wusste sie, dass es Lotte nicht wirklich gab. Lotte war ein Teil von ihr, der Teil, den ihr Vater manchmal als nicht ganz richtig im Kopf bezeichnet hatte. Wegen dem er sie oft beiseitegenommen und ihr eingeschärft hatte, dass man manche Dinge einfach nicht tat. Wenn man etwas haben möchte, dann geht man hin und nimmt es mit seinen Händen auf, hatte er gesagt. Man lässt es nicht einfach auf sich zukommen, ohne die Hände zu gebrauchen. Helgalein, das darf niemals jemand erfahren, hatte er ihr klargemacht, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war. Er hatte ihr erklärt, dass sie große Probleme im Leben bekommen würde, wenn die anderen Leute jemals davon erfuhren, was sie tun konnte. Mit ihrem Kopf.
Papa hatte sie beiseitegenommen, während die Mama in der Waschküche mit dem Mangeln beschäftigt war. Er nahm das kleine braune Holzkästchen vom Radiogerät, das dort stand, solange Helga zurückdenken konnte. Papa hatte es von seiner Mutter geschenkt bekommen, und es war sein einziges Andenken an sie. Er setzte sich mit dem Kästchen neben Helga aufs Sofa, klappte den filigranen Riegel aus Messing hoch und hob den Deckel an. Das Kästchen, kaum größer als eine von Papas Händen, war leer. Früher hatte er, so hatte er seinem Kind erzählt, seine Glasmurmeln darin aufgehoben. Sechs Stück in verschiedenen Größen und in schillernden Farben. Seine größten Schätze.
„Darin kannst du es einschließen“, sagte er mit leiser, verschwörerischer Stimme. „Sag nichts der Mama, aber so ein Kästchen hast du hier in deinem Kopf.“ Er berührte Helgas Stirn mit den Fingerspitzen, und Helga blickte ihn andächtig mit großen Augen an. „Wir alle haben schlimme Dinge, die wir in unser Kästchen einsperren müssen. Bei den meisten Menschen passiert das erst später im Leben, wenn sie erwachsen sind. Aber du musst es jetzt schon tun. Das, was nicht ganz richtig ist in deinem Kopf, musst du in dein Kästchen sperren. Und achte darauf, dass der Riegel immer fest verschlossen ist.“ Helga war damals noch klein gewesen und verstand bestenfalls die Hälfte von dem, was der Papa ihr klarzumachen versuchte, eher noch sehr viel weniger. Ein Kästchen in ihrem Kopf, das kam ihr seltsam vor. Sie ahnte nicht, dass der Papa nicht von einem realen, hölzernen Behälter sprach. Trotzdem nickte sie mit ernstem Gesicht und betrachtete den Mund ihres Vaters, aus dem so kluge, unverstellbare Worte kamen.
„Du bist nicht die Einzige mit einem Kästchen“, wiederholte der Papa. „Ich hab auch eins.“ Er fasste sich mit der Hand an die Stirn und nahm mit der anderen Helgas kleine Hand. „Aber es sind andere Dinge darin. Dein Papa hat schlimme Dinge gesehen in Russland. Sehr schlimme Dinge, und er hat auch schlimme Dinge getan. Die sind jetzt alle in meinem Kästchen. Da müssen sie sein, bei uns allen, damit wir normal leben können. Damit das, was nicht richtig ist mit uns, uns nicht krank macht.“ Helga sah, dass die Augen ihres Vaters feucht geworden waren, und sie liebte ihn über alles. Sie blickte auf die Hand ihres Vaters, die noch immer das Kästchen hielt, sah seine Narben und den krummen kleinen Finger. Sie hatte es geträumt damals, daran konnte sie sich erinnern, obwohl es schon so lange her war. Am frühen Morgen vor Papas Unfall war sie weinend aufgewacht, und die Mama hatte sie trösten müssen. Sie hatte geträumt, dass ihrem Papa etwas Schlimmes passieren würde, und es war tatsächlich geschehen.
„Denk immer an dein Kästchen“, beschwor Kurt Rentrop seine Tochter noch einmal. „Und sieh zu, dass es drinbleibt.“ Das „es“ betonte er auf eine vielsagende, geheimnisvolle Weise.
Und heute wusste Helga, wie recht ihr Vater gehabt hatte. Ihr war klar, wie schlimm es ist, anders zu sein als die anderen. Man würde sie von einem Arzt zum anderen schicken. Vielleicht würde man sie in eine Irrenanstalt einweisen. Natürlich in einen speziell gesicherten Trakt, denn ihre Kraft war nicht ungefährlich. Bestimmt würde man Tests mit ihr machen. Man würde Elektroden an ihren Kopf befestigen, vielleicht sogar ihren Schädel öffnen und das Gehirn untersuchen. Vielleicht würde es in einem Glas mit Spiritus enden. Ein Opfer für die Wissenschaft. Eventuell würde auch das Militär auf sie aufmerksam werden und versuchen, ihre Abnormität für sonst was zu benutzen.
Das war der Grund, warum Helga ihre Fähigkeit für sich behielt. Warum sie ihr Kästchen verschlossen hielt. Da war sie doch lieber eine normale junge Frau mit hübschem Gesicht, guter Figur und langen Beinen, die von ihrer Umgebung gemocht wurde. Denn Dinge allein durch die Kraft der Gedanken bewegen zu können, war nun mal eine Abnormität. Die Sache mit den Träumen, die kurz darauf wahr wurden, passierte nur sehr selten. Vielleicht alle zwei oder drei Jahre. Meistens waren es auch nur Lappalien. Und nicht immer traf das tatsächlich ein, was sie geträumt hatte. Darauf konnte man sich nicht verlassen. Und die Sache mit den Träumen konnte man nicht ins Kästchen einschließen. Die Träume kamen, wenn sie kamen.
Aus Selbstschutz hatte Helga zu Beginn der Pubertät damit begonnen, ihre Abnormität zu unterdrücken, sie vor sich selbst zu leugnen. Wer da in der Vergangenheit im Kaufhaus die Rolltreppe angehalten und dadurch bewirkt hatte, dass die Leute wie die Dominosteine durcheinanderpurzelten, oder wer in der 6b der vorlauten Hedda den Tornister vom Rücken gerissen und den Treppenschacht hinuntergeworfen hatte, ohne überhaupt in ihrer Nähe zu sein, das war nicht sie gewesen, das war ihr böser Zwilling. Der war auch schuld daran, dass der Stuhl von Herrn Krähling, dem Geschichtslehrer, gerade in dem Moment nach hinten zur Tafel gerutscht war, als der sich daraufsetzen wollte.
Da Helga immer ein liebes Mädchen gewesen war, musste der böse Zwilling her. Sie selbst hatte ihm den Namen Lotte gegeben, weil ihr die Geschichte vom doppelten Lottchen in den Sinn gekommen war.
Hätte man sie gefragt, ob sie die Blicke der Mechaniker und der Männer im Verkauf genoss, sie hätte es wahrscheinlich abgestritten. Aber das wäre gelogen. Helga Rentrop war sich ihrer Wirkung auf Männer durchaus bewusst, und sie flirtete gern, auch wenn sie nur Augen für Emil Sternberg hatte, den ehemaligen Juniorchef des Autosalons Sternberg in Essen Rüttenscheid, der inzwischen nicht mehr Juniorchef war, sondern Chef. Weil der Alte sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen und den ganzen Laden an seinen Sohn übergeben hatte. Emil und sie hatten es nicht öffentlich gemacht, dass sie ein Paar waren, aber irgendjemand musste wohl eins und eins zusammengezählt und ein paar Blicke oder Berührungen beobachtet haben, wenn Helga im Büro des Chefs gewesen war und dieser die Glastür geschlossen hatte. Jedenfalls hielten sich die Mitarbeiter des Autosalons seit einiger Zeit sowohl mit ihren Flirtversuchen als auch mit Lästereien über den Chef zurück, denen sie früher in ihrer Gegenwart freien Lauf gelassen hatten.
„Kommt der Chef heute noch mal rein?“, fragte Lothar Siebert, einer der Verkäufer, als er sich neben Helga aufbaute. Er war in etwa mit ihr auf Augenhöhe, was aber an den hohen Plateausohlen von Helgas Sandalen lag, die mindestens siebzig Zentimeter vom Saum ihres Minirocks entfernt waren. Lothar Siebert, der selbst eine qualmende Zigarette im Mundwinkel hatte, hielt ihr seine Packung Marlboro vors Gesicht.
„Warum fragst du?“, antwortete sie mit einer Gegenfrage und blinzelte ihn spöttisch von der Seite an. Sie nahm eine Zigarette aus der Packung und ließ sich von ihrem Kollegen Feuer geben. Vermutlich wollte er nur ausloten, ob er heute früher vom Hof reiten konnte. Der junge Mann war zwei oder drei Jahre älter als Helga, die im Juni zweiundzwanzig werden würde. Er trug einen beigefarbenen, eng anliegenden Zweireiher mit breiten dunkelblauen Streifen.
„Na, wegen der zwei Verträge für den 911er und das 1602er Cabrio.“ Lothar Siebert deutete mit dem Daumen hinüber zu dem großen asphaltierten Platz, der sich entlang der Veronikastraße erstreckte und wo sich mindestens achtzig beinahe neuwertige Fahrzeuge aneinanderreihten. „Der Chef will das doch immer tagesaktuell wissen.“
„Klar, kommt er noch mal rein, wenn er aus Frankfurt zurück ist.“ Und danach kommt er zu mir, dachte sie. Und er bringt Champagner mit, und sie werden einen heißen Abend miteinander verbringen. Sie selbst wird sich mit einem Gläschen begnügen. Und dann wird sie ihn mit der schönen Neuigkeit überraschen.
Helga und ihr Kollege zogen an ihren Zigaretten und schauten zu, wie der Fahrer mit dem grünen Coupé das untere Ende der Verladeschienen erreichte und den Wagen auf die Straße lenkte. Und während sie mit ihrem Kollegen über Belangloses plauderte, lauschte Helga konzentriert in sich hinein, um sicherzustellen, dass Lotte sich brav im Hintergrund hielt, dass das Kästchen verschlossen war. Das hatte sie gelernt, es war Teil ihres Lebens. Sie tat das meistens unbewusst, in etwa so, wie andere ihren Bauch einzogen. Sie konnte es inzwischen steuern, obwohl Lotte oft sehr unzufrieden mit ihrer eingeschränkten Existenz war. Aber Helga war stärker als Lotte. Irgendwann würde sie es wahrscheinlich schaffen, ihr zweites Ich, ihr doppeltes Lottchen endgültig aus ihrem Kopf zu verbannen.
Von einer derartigen Selbstkontrolle war Helga zehn Jahre früher, im Jahr 1960, noch weit entfernt gewesen. Sie hatte damals die städtische Mädchenrealschule an der Franklinstraße in Düsseldorf besucht. Und Manuela Fricke war eine von den Schülerinnen, die einer Klicke angehörten, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, ihre mangelhaften schulischen Ambitionen dadurch zu kompensieren, Mitschülerinnen – vornehmlich solchen aus den unteren Jahrgängen – das Leben so schwer wie möglich zu machen. Manuela Fricke war ein langes und ungewöhnlich dünnes Geschöpf mit halblangen braunen Haaren, die immer so aussahen, als hätte ihre Trägerin kurz zuvor einen stromführenden Draht angefasst. Sie machte gerade ihren zweiten Durchlauf in der 7c, und Helga gehörte zu ihren Lieblingsopfern, mutmaßlich weil es Manuela nicht gefiel, dass Helga ein Mädchen mit langen dunkelblonden Haaren, einem hübschen Gesicht und nicht sehr teurer, aber dennoch geschmackvoller und gepflegter Kleidung war. Außerdem war Helga Rentrop bei allen Lehrern und den meisten Schülerinnen ihrer Klasse beliebt.
Einmal hatte Manuela Fricke Helga einen Teil ihrer Schulmilch in den Tornister gekippt, ein anderes Mal hatte sie ihr den Turnbeutel entrissen und über die hohe Ziegelsteinmauer geworfen, die den Pausenhof der Schule vom angrenzenden Busdepot trennte. Rempeleien und Boxhiebe in den Bauch oder den Rücken waren an der Tageordnung. Helga hatte bisher weder der Klassenlehrerin Frau Wehner noch ihren Eltern von den Attacken erzählt, denn Manuela Fricke war ausgesprochen talentiert darin, ihren jeweiligen „Schützlingen“ plastisch zu schildern, was ihnen blühen würde, wenn sie Ärger mit den Lehrern bekäme. Für Helga waren die Demütigungen schlimmer als die körperlichen Folgen, denn Manuela schlug nie so heftig zu, dass es zu ernsthaften Verletzungen kam, und in der Regel dauerten ihre Behandlungen nicht sehr lang. Ein kurzes Zerren an den Haaren hier und ein gestelltes Bein da waren die täglichen Wegbegleiter, wenn Manuela Fricke einen auf dem Kieker hatte. Oder sie nahm jemanden während der großen Pause in den Schwitzkasten und wanderte so mit ihm für eine Weile umher, während das Opfer mit rotem Kopf hoffte, dass die Tortur bald von selbst vorüber war, oder dass der Aufsichtslehrer aufmerksam wurde. Was leider nie geschah.
An einem Freitagmittag nach der letzten Stunde – es war Geschichte bei Herrn Stünkel, und sie nahmen gerade die drei Söhne Karls des Großen durch: Ludwig den Frommen, Karl den Kahlen und Lothar I., unter denen das Reich im Jahr 813 aufgeteilt worden war – streckte Helga wie üblich zunächst den Kopf vorsichtig aus der Tür des Klassenraums, bevor sie nach draußen auf den Flur trat. Von Manuela war nichts zu sehen, auch von ihren Spießgesellinnen fehlte zum Glück jede Spur.
So marschierte Helga, im Gegensatz zu allen anderen siebenunddreißig Schülerinnen der 6b, die rufend und lärmend das Klassenzimmer verließen – unter ihnen auch ihre Banknachbarin Klara und die rothaarige Lieselotte, die den gleichen Schulweg hatte wie sie selbst – zügig, aber dennoch gemessenen Schrittes über den Belag aus grauen, sechseckigen Fliesen, die den Boden des hohen und weitläufigen Flures zierten, und dessen Wände die vielen hellen Kinderstimmen zu einem schrillen Geräuschorkan verstärkten. Für die Pflege des Fliesenbodens, der seit dem Bau des Gebäudes im Jahr 1912 niemals erneuert worden war, war Hausmeister Claas zuständig, der im Krieg einen Arm verloren hatte, weshalb seine Frau in der Regel körperliche Arbeiten dieser Art verrichtete.
Weil alle Mitschülerinnen, die sich im Schulgebäude sorglos bewegen konnten, und nicht bei Manuela Fricke auf der Liste standen, dem wohlverdienten Wochenende entgegenrannten, bildete Helga bald das Schlusslicht im Flur, immer auf der Hut, nicht achtlos ihrer Peinigerin in die Arme zu laufen. Und tatsächlich, als sie an der weit geöffneten Tür der Schülertoiletten vorbeikam, sah sie Manuela Fricke dicht zusammen mit einer ihrer Mitschülerinnen bei den Waschbecken stehen. Die beiden Mädchen hatten offenbar etwas Wichtiges miteinander zu tuscheln, was Dreizehnjährige so miteinander zu tuscheln hatten. Eilig schritt Helga an der Tür vorbei und war froh, nicht bemerkt worden zu sein.
Schluss damit, sagte … die „Andere“. Helga erschrak und blieb abrupt stehen. Die Andere, das war die Stimme in ihrem Kopf. Das, was mit ihr nicht richtig war. Das, weswegen man sie irgendwann in eine Irrenanstalt sperren würde. Das, vor dem ihr Vater sie gewarnt hatte. Damals hatte Helga noch keinen Namen für die Stimme gehabt, sie nannte sie noch nicht Lotte. Wehr dich, maulte die Stimme. Wie lange willst du dir das gefallen lassen? Lass mich das doch mal machen. Helgas Klassenkameradin Lieselotte mit den dicken roten Zöpfen stand am Ende des Flures und hielt die breite Glastür auf, die zum Treppenhaus führte.
„Helga!“, rief sie und winkte ihr zu. Meistens machten sie sich gemeinsam auf den Heimweg von der Schule. Helga machte eine Handbewegung, die für Außenstehende bestimmt schwer zu deuten war. Vielleicht weil sie selbst unschlüssig war, was sie tun sollte. Der stärkste Impuls war der, so schnell wie möglich mit Lieselotte die Treppe hinunterzulaufen und die Schule zu verlassen, aber da war noch ein anderer Impuls. Lieselotte wartete ein paar Sekunden, zuckte dann mit den Schultern, ließ die Tür zu fallen und verschwand aus Helgas Blickfeld.
Mach schon, drängte die Andere, die Stimme in ihrem Kopf. Vor ihrem geistigen Auge schwebte ein kleines braunes Holzkästchen mit glänzenden Messingbeschlägen. Der Riegel war verschlossen. Noch. Nein, antwortete Helga stumm, ohne die Lippen zu bewegen, schüttelte aber den Kopf. Das war anscheinend Frau Klabunde, der Biologielehrerin, aufgefallen, die eben einen Klassenraum verließ und auf den Flur trat. Sie trug einen blauen Schnellhefter und das Klassenbuch unter dem Arm.
„Na, Helga?“, sagte sie, als sie näherkam. „Wenn du musst, dann solltest du lieber noch mal austreten, bevor du nach Hause gehst.“ Sie lächelte ihrer Schülerin aufmunternd zu und machte eine nickende Bewegung zur offenen Tür des Waschraums.
„Ja, ich …“, antwortete Helga, die noch immer reglos im Flur stand.
„Hab ein schönes Wochenende“, sagte Frau Klabunde und ging, ohne sich noch einmal umzudrehen, ebenfalls in Richtung Treppenhaus davon. Helga war jetzt allein auf dem Flur. Sie hakte die Daumen unter die Tragegurte ihres Tornisters und ging zaghaft ein paar Schritte zurück. Vorsichtig spähte sie in den Waschraum. Es war niemand zu sehen, offenbar waren die beiden Mädchen also in den Toilettenkabinen verschwunden.
Los jetzt, sagte die Stimme, das, was nicht in Ordnung war mit ihr. Weil niemand außer ihr so eine Stimme im Kopf hatte. Helga ging langsam durch die Tür und lugte um einen weiß gefliesten Mauervorsprung herum. Niemand war zu sehen, aber unterhalb von zwei nebeneinanderliegenden geschlossenen Türen der Toiletten-Boxen sah sie zwei Paar Mädchenschuhe und die heruntergelassenen Röcke von Manuela und der anderen Schülerin. War es die Faszination der Gefahr, die Lust am Risiko oder sogar eine sadistische Spannung, die in ihr aufkeimte? Helga wollte es ihr zeigen, es ihr heimzahlen, ihr einen Denkzettel verpassen. Jetzt oder nie, das Maß der Demütigung war schließlich schon lange voll.
Hinter den beiden geschlossenen Kabinen war zweistimmiges Kichern zu hören. Die beiden waren offenbar noch nicht fertig mit dem „Wichtigen“, das sie miteinander zu tuscheln hatten. Helgas Blick fiel auf die vier Waschbecken, die sich den Toilettenboxen gegenüber an der Wand aneinanderreihten. Die gebogenen Wasserhähne ragten aus der weißen Keramik. Es gab jeweils zwei Drehknäufe, einen für heißes, einen für kaltes Wasser, wobei Helga wusste, dass auf jeden Fall nur kaltes Wasser aus der Leitung kam, egal an welchem Knauf man drehte. Mit ihren Gedanken ertastete sie die metallenen Anschlüsse unterhalb der Waschbecken, die Verschraubungen, die Flansche und die u-förmigen Siphons. Noch immer hinter dem Mauervorsprung stehend, und während sie auf das Kichern und Murmeln hinter den Türen lauschte schloss Helga die Augen. Dann ertastete sie die Schraubverbindung unterhalb eines Waschbeckens. Nach anfänglichem Widerstand ließ es sich drehen. Aber so würde das nicht klappen. Das war zu kompliziert. Auch wusste sie nicht, welches Waschbecken Manuela nach ihrem Toilettenbesuch benutzen würde. Wenn sie überhaupt eins benutzte.
In einer der Boxen ertönte das Rauschen der Wasserspülung. Ein Rock wurde nach oben gezogen und verschwand hinter der Tür. Helga glaubte, den von Manuela erkannt zu haben.
„Komm, wir gehen nach Hause“, flüsterte sie leise in den leeren Raum hinein. Auch die andere Spülung wurde betätigt. Quatsch, jetzt wird´s lustig, behauptete die Andere. Der Fehler in ihrem Kopf. Nein, dachte Helga. Oh doch, erwiderte die Stimme. Und Helga spürte, dass die Andere dieses Mal stärker sein würde als sie. Sie würde es mit Gewalt machen. Beinahe konnte sie sehen, wie sich der kleine Messingriegel des Holzkästchens hob. Hastig ging Helga ein paar Schritte zurück an die Tür zum Flur. Draußen war alles ruhig. Eine der Toilettentüren wurde geöffnet. Kurz danach die andere.
„Du kannst ihn ja gerne küssen“, hörte Helga. Es war Manuelas Stimme. „Ich mach´s ganz sicher nicht.“ Weiteres Kichern ertönte. „Igitt“, zischte das andere Mädchen. Helga stand jetzt draußen im Flur neben der Tür, so dass man sie von drinnen nicht sehen konnte. Vorsichtig lugte sie um die Ecke und sah Manuela und ihre Freundin an den Waschbecken. Beide drehten das Wasser auf. Helga zog den Kopf wieder zurück und lehnte sich rückwärts an die Wand des Flurs. Sie schloss die Augen und griff nach dem Wasserhahn, den Manuela benutze. Wenn die Besitzerin der Stimme - die Andere - die Initiative ergriff, waren ihre Kräfte stark. Sie zerrte an dem Hahn, bog ihn leicht hin und her und sandte dann einen konzentrierten Impuls in Richtung Waschbecken. In ihrem Kopf konnte Helga spüren, wie der Hahn abriss und vom Wasserdruck wie ein Geschoss nach oben katapultiert wurde. Ein spitzer Schrei war zu hören, dann erfüllte Rauschen und Plätschern die Luft.
„Manu!“ Das war die helle Stimme von Manuelas Freundin. Helga nahm allen Mut zusammen und spähte in den Waschraum hinein. Wie ein Geysir spuckte der Stumpf oberhalb des Waschbeckens eine Wasserfontäne empor. Manuela stand nach vorn gebeugt ein paar Schritte vom Waschbecken entfernt und hielt sich beide Hände vors Gesicht.
Treffer versenkt, kicherte die Stimme in Helgas Kopf höhnisch, beinahe lustvoll. Dann war sie verschwunden. Sie ließ Helga allein. Allein mit den Folgen ihres Frevels. Manuelas Freundin, deren Namen Helga nicht kannte, stand direkt bei ihr und hatte ihr eine Hand auf den gekrümmten Rücken gelegt, während sie erschrocken und mit offenem Mund die noch immer aktive Wasserfontäne anstarrte. Der graue Fliesenboden glänzte vor Nässe, und Helga sah, dass zwischen Manuelas Fingern, die sie sich noch immer aufs Gesicht presste, Blut hervorquoll. Dabei wimmerte sie leise.
Das wollte ich nicht, dachte Helga verzweifelt. So was machst du nicht noch mal, klar? Mit schnellen Schritten lief sie den Flur entlang zur Glastür und rannte eilig die Treppe hinunter und zum Schultor hinaus. Was heute passiert war, hatte sie nicht vorher geträumt. Vielleicht hätte sie es dann verhindern können. Aber wollte sie das? Wenn etwas wirklich Wichtiges bevorstand, wurde man nicht durch einen Traum gewarnt. Das war gemein. Vielleicht steckte auch da Lotte dahinter.
Manuela tauchte eine Woche lang nicht in der Schule auf. Danach sah Helga sie zum ersten Mal auf dem Pausenhof wieder, innerhalb eines Pulks von Mitschülerinnen, die diskutierend mit ihr umherwanderten. Sie trug einen weißen Kopfverband, der auch ihr rechtes Auge verdeckte. Was genau ihr fehlte, erfuhr Helga nicht, denn sie waren nicht in derselben Klasse. Aber sie tat ihr leid. Der weiße Verband leuchtete in der Sonne, und Manuelas Miene war eine Mischung aus Ernst und Trauer.
Erst nach einer weiteren Woche kam Manuela ohne Verband in die Schule. Zum Glück war dem Auge nichts Dauerhaftes passiert, oder die Ärzte hatten es retten können. Von der Mitte ihrer Stirn bis zur rechten Augenbraue jedoch verlief eine dunkelrote, gezackte Narbe, die wirklich schlimm aussah. Der Wasserhahn, der sich durch den Wasserdruck und durch Helgas Gedankenkraft wie ein Geschoss aus seiner Verankerung gelöst hatte, musste sie voll am Kopf erwischt haben. Das war Helga gewesen. Und die Andere. Die Andere und Helga. Das hatte sie wirklich nicht gewollt. Wie auch immer, sie war schuld. Aber ein Gutes hatte die Sache: Manuela machte nie mehr einen Versuch, Helga zu ärgern oder zu quälen, obwohl sie gar nicht wissen konnte, dass diese hinter ihrem „Unfall“ steckte. Vielleicht war sie einfach nur in sich gegangen und hatte sich geändert. Die Gewissensbisse begleiteten Helga noch eine Weile. Bestimmt Wochen, vielleicht Monate. Und manchmal beneidete sie die Andere, ihr zweites Ich, welches offenbar keinerlei Skrupel zu kennen schien.
3
Im Fernsehen lief die Tagesschau. Nachrichtensprecher Karl-Heinz Köpcke berichtete mit feierlichem Ernst über ein Gipfeltreffen der beiden deutschen Staaten zwischen Bundeskanzler Brandt und Willi Stoph, dem Ministerpräsidenten der DDR, und außerdem über die heftige Kritik an der bemannten Raumfahrt, die im US-Senat laut geworden war, nachdem im April die dreiköpfige Besatzung einer Apollo-Raumkapsel nur knapp einer Katastrophe entronnen war.
Der in Berlin-Tegel einsitzende Kaufhaus-Brandstifter Andreas Baader war während eines vorgeblichen Recherchetermins für ein Buch von Komplizen mit Waffengewalt befreit worden. Oppositionspolitiker zeigten sich fassungslos über die nachlässigen Zustände im deutschen Strafvollzug.
Helga hatte weder Augen noch Ohren für das Fernsehprogramm. Der Ton war nur leise eingestellt, und das bläuliche Flimmern der Mattscheibe war lediglich Lichtkulisse. Sie hatte die Sofakissen gerichtet, die Jalousie eines der beiden Fenster im Wohnzimmer heruntergelassen und polierte mit einem Küchentuch zwei Sektgläser, die sie auf dem alten Nierentisch aus beigem Travertin-Marmor abstellte. Ihre Zigarette qualmte einsam auf dem Rand des Aschenbechers vor sich hin.
Eine Weile hatte sie überlegt, ob sie sich einen Pferdeschwanz binden sollte, sich dann aber doch dafür entschieden, die Haare offen zu tragen. Emil mochte es, wenn ihm beim Sex ihre Haare wild ins Gesicht fielen. In der engen Diele stellte sie sich noch einmal vor den ovalen Wandspiegel und betrachtete sich im Profil. Das dunkelblaue Minikleid saß wie angegossen, trotzdem entdeckte sie an den Hüften und am Bauch Stellen, die ihr nicht gefielen und die irgendwann eine Diät erforderlich machten. Aber das hatte Zeit, denn sie würde demnächst ohnehin noch deutlich zulegen.
Dem Spiegel gegenüber lag auf dem flachen Schuhschränkchen noch die aktuelle BRIGITTE-Ausgabe, in der sie gelesen hatte, wie sie in sieben Tagen bis zu vier Kilo loswerden konnte. Allerdings brachte der neue Playtex-BH, den sie unter dem Kleid trug, ihre Brüste optimal zur Geltung. Sie wirkten größer, als sie in Wirklichkeit waren, und standen spitz vom Körper ab, als hätte die Gravitation auf sie keinerlei Einfluss. Helga bürstete noch einmal ihre Haare, klatschte sich selbst mit beiden Händen auf die Pobacken und zwinkerte sich im Spiegel zu. Wenn Emil kam, sollte alles perfekt sein.
Gekocht hatte sie nicht, denn nach dem Champagner landeten sie meistens zuerst im Bett, bevor Emil sie zum Italiener ausführte. Oder in die Dubrovnik-Stube, wo es die besten Pfeffersteaks in der Stadt gab. Zumindest sagte Emil das, und der kannte sich aus. Helga beugte sich über den Wohnzimmertisch, griff nach der Zigarette und nahm einen tiefen Lungenzug.
Im Fernsehen kündigte eine hübsche dunkelhaarige Ansagerin einen Filmbericht über kinderreiche Familien in Latein-Amerika an. Danach sollte der Bericht aus Bonn ausgestrahlt werden. Die Dame mit der Perlenkette, der gemusterten Bluse und der hellen Weste, die sie darüber trug, wirkte ziemlich spießig. Sie könnte viel mehr aus sich machen, wenn sie die Haare wachsen ließe und sich nicht wie ein Hausmütterchen kleiden würde, dachte Helga.
Sie ging zum Fernseher und drückte den Aus-Knopf. Die Dame implodierte blitzschnell zu einem weißen Punkt und verschwand. Im Zweiten würde jetzt Der Kommissar anfangen, aber Emil hatte angekündigt, wahrscheinlich zwischen acht und halb neun zu erscheinen, und er sah nicht gern fern. Außer vielleicht Fußball und gelegentlich die Spätnachrichten.
Ihr fiel der blöde Traum von gestern Nacht ein. Sie hatte sich bei Emil untergehakt, während sie beide abends die Kettwiger Straße in der Innenstadt entlangbummelten. Seltsamerweise waren alle Schaufenster dunkel und trotz der späten Stunde hatte es keinerlei Straßenbeleuchtung gegeben. Aber so war das eben in Träumen. Mit einem Mal hatte Emil sich von ihr gelöst und war in die Richtung gelaufen, aus der sie gekommen waren. Helga hatte rufen wollen, aber keinen Ton herausgebracht. Emil drehte sich nicht um, sondern verschwand hinter der nächsten Hausecke. Sie wollte ihm nach, kam aber kaum vorwärts. Ihre Beine fühlten sich an, als würden sie von strammen Gummibändern zurückgehalten. Mit einem stummen Schrei auf den Lippen war sie aufgewacht und hatte sich für einige Sekunden ziemlich elend gefühlt.
Helga ging vor dem Plattenspieler in die Hocke und suchte aus dem Regal darunter eine LP aus. Zwischen Esther und Abi Ofarim und Barry Ryan fand sie The 5th Dimension und die Hollies. Eine Scheibe davon wäre ihre Wahl gewesen, aber Emil stand auf Bob Dylan. Nashville Skyline hatte er ihr zu Weihnachten geschenkt. Zusammen mit einem silbernen Medaillon und einem kleinen Bild von ihm darin.
Sie zog das schwarze Vinyl aus der Hülle und legte es auf den Plattenteller. Das Gerät reagierte mit einem leisen Krachen und nachfolgendem Knistern aus dem Lautsprecher, als sie den Tonabnehmer am äußeren Rand auf die Platte senkte. Das Album begann mit einem langsamen Song. Girl from the North Country hieß er, und Helga erinnerte sich, wie sie ihn noch vor drei Tagen mit geschlossenen Augen gehört hatte, als Emil sie ebenso langsam, wie intensiv geküsst hatte, während seine Finger an ihrer Strumpfhose gerieben hatten, genau dort im Zwickel, wo sie es nicht länger als eine Minute aushielt, bevor sie anfing, ihm mit zitternden Fingern das Hemd aufzuknöpfen.
Sehnsüchtig blickte sie hinüber zu dem kleinen billigen Zweisitzer-Sofa, auf dem sie gesessen und geknutscht hatten, bevor sie ins Schlafzimmer umgezogen waren. „In dem Song klingt Dylan beinahe wie Johnny Cash“, hatte Emil erklärt, als sie die Platte am Nachmittag des ersten Weihnachtstages zum ersten Mal aufgelegt hatten. „Findest du nicht?“ Helga hatte glücklich genickt und ihre Hand auf das Medaillon gelegt, dass auf ihrem türkisfarbenen Rollkragenpullover wunderschön ausgesehen hatte. Sie wusste von Johnny Cash überhaupt nichts, außer, dass er einer dieser Westernsänger war, mit denen sie überhaupt nichts anfangen konnte. Aber sie liebte es, wenn Emil für etwas schwärmte. Und dann musste Johnny Cash wohl gut ein, ebenso wie Bob Dylan, denn schließlich schwärmte Emil auch für sie, und das bewies seinen guten Geschmack. Gerade als sie sich mit der Zigarette in der Hand auf dem Sofa niedergelassen hatte, und der Titelsong der LP Nashville Skyline