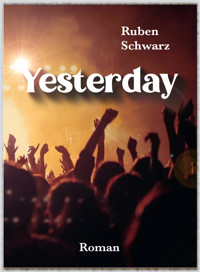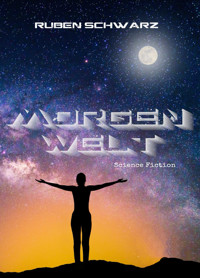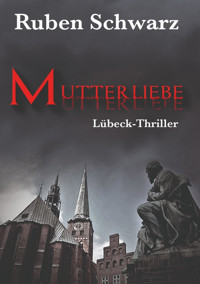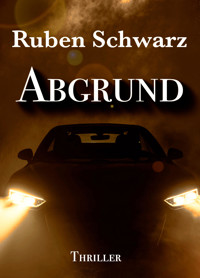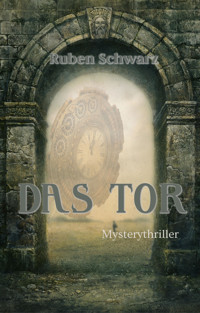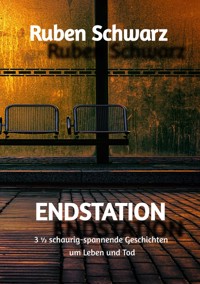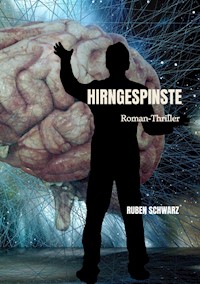
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Manfred Schuster ist ein friedfertiger Mensch. Ob bei Kollegen, Freunden und Familie oder bei fremden Leuten, er versucht meistens Konfrontationen zu vermeiden und Ärger aus dem Weg zu gehen, auch wenn er dabei die Fäuste in den Taschen ballt. Erst als er nach einem Treppensturz ins Koma fällt und verbittert im Rollstuhl landet, ändert sich alles. Manfred Schuster findet heraus, dass er in seinen Träumen die eigene Vergangenheit aufsuchen und sein jüngeres Ich dazu benutzen kann, um mit ehemaligen Widersachern gnadenlos abzurechnen. So kommt es zwischen den Sechzigerjahren und der Jetztzeit zu rätselhaften, für die Polizei unerklärlichen, Todesfällen. Der einzige Mensch, der eine winzige Chance hat, den Amoklauf zu stoppen, den Schuster in seinem Kopf steuert, ist zugleich die Frau, die ihn liebt. Es beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. HIRNGESPINSTE spannt den Bogen von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart und bringt trotz aller Spannung einen Hauch von Musik und Lebensgefühl der Vergangenheit zurück. Neben Momenten der Hochspannung ist HIRNGESPINSTE auch ein facettenreicher Gesellschaftsroman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch:
Manfred Schuster wächst in den Sechzigerjahren behütet als Einzelkind im vom Bergbau geprägten Ruhrgebiet auf und macht in den Siebzigern erste Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht. Seine Entwicklung verläuft in geordneten Bahnen, wären da nicht immer wieder unerklärliche Erinnerungen an schreckliche Ereignisse, die er bewusst so nie erlebt hat. Auch als Erwachsener hat Schuster stets das Gefühl, dass seit seiner Jugend Blut an seinen Händen klebt. In reiferen Jahren, nach Trennung und Scheidung, verliebt er sich in die etwa gleichaltrige Evelyn. Die beiden beginnen eine Liaison, die jäh durch einen ungeklärten Unfall gestört wird, bei dem Manfred ein schweres Hirntrauma erleidet und im Rollstuhl landet. Ab jetzt lebt Schuster in seiner eigenen, von der äußeren Umgebung abgeschotteten Welt, in der es lediglich Träume von der Vergangenheit sind, die ihn daraus entfliehen lassen. Was keiner, am Anfang nicht einmal er selbst, ahnen kann – seine Träume haben schreckliche Konsequenzen für Menschen, die in der Vergangenheit seinen Weg kreuzten. Aus seinem Krankenzimmer heraus, gefesselt an den Rollstuhl und in komatöser Enge, startet Manfred Schuster einen blutigen Rachefeldzug in seine eigene Vergangenheit, der auch seine neue Liebe bedroht und den nicht einmal die Polizei stoppen kann.
Der Autor:
Ruben Schwarz wurde in den 1950er Jahren im Herzen des Ruhrpotts geboren und ist seiner Heimatstadt Essen sechzig Jahre lang treu geblieben. Seit einigen Jahren lebt der ehemalige Medienkaufmann zusammen mit seiner zweiten großen Liebe im Bergischen Land. Inspiriert von unzähligen Begegnungen mit realen Charakteren sowie durch Werke großer Vorbilder wie Thomas Mann und Stephen King oder Margaret Atwood und John Irving fühlte er sich irgendwann dazu bereit, sich selbst an den Laptop zu setzen und aufzuschreiben, was schon lange in seinem Kopf gereift war.
HIRN-GESPINSTE
Ruben Schwarz
Roman-Thriller
© 2023 Ruben Schwarz
ISBN Softcover: 978-3-347-74794-4
ISBN Hardcover: 978-3-347-74800-2
ISBN E-Book: 978-3-347-74803-3
ISBN Großschrift: 978-3-347-74804-0
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Für Rosi.
Danke für deinen Mut zum gemeinsamen Abenteuer mit mir. Und danke für vieles mehr. Du weißt schon!
1
August 2016
Um festzustellen, dass es kurz vor 14:00 Uhr war, musste man nicht auf die Uhr sehen. Das helle Klappern auf dem Flur und das geräuschvolle Öffnen und Schließen der benachbarten Zellentüren waren eindeutige Indizien dafür, dass die Essensgeschirre eingesammelt wurden.
Evelyn faltete langsam und sorgfältig den Brief zusammen, den die Pfarrerin der Jakobus-Gemeinde in Magdeburg-Fermersleben ihr geschickt hatte.
Wenn es tatsächlich einen lieben Gott gab, so dachte sie, und man ihm keinen Sadismus unterstellen wollte, dann hatte er zumindest eine merkwürdige Art von Humor. Ein anderer Beweggrund fiel Evelyn nicht ein, warum er die Menschen am Anfang des Lebens mit Vitalität und Optimismus ausstattete, ihnen zeigte, wie schön das Leben sein konnte, um sie am Ende mit Demenz, Arthritis, Inkontinenz und anderen Liebhabereien zu demütigen. Ihr Vater Arthur Brandes war immerhin fünfundachtzig Jahre alt geworden, hatte aber die letzten zwei Jahre in seinem Pflegeheim in völliger geistiger Umnachtung zugebracht.
Man hatte ihr angeboten, an der Beisetzung teilzunehmen, sie hatte aber dankend darauf verzichtet, ihrem Vater an dessen Grab Seite an Seite mit zwei Polizeibeamten die letzte Ehre zu erweisen. Diese Show hatte sie der Verwandtschaft und ihren früheren Nachbarn nicht gegönnt. Außerdem hatte es in den vergangenen Jahren ohnehin keinen Kontakt zwischen Vater und Tochter gegeben.
Bei Arthur Brandes hatte es sich nicht um einen wirklich lieben Menschen gehandelt. In der Blüte seiner Jahre war er ein Quartalssäufer gewesen. Während seiner Phasen, wie Evelyns Mutter es oft verharmlosend auszudrücken pflegte, hatte er Frau und Kinder verdroschen und war auch nicht davor zurückgeschreckt, mit allen möglichen Gegenständen nach ihnen zu werfen, die er gerade zur Hand hatte. Wundersamerweise war Evelyn im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern und der Mutti von diesen Attacken immer verschont geblieben. Nach einem Entzug Mitte der Siebziger, da hatte Evelyn schon nicht mehr zu Hause gewohnt, hatte er nie mehr einen Tropfen angerührt. Trotzdem waren auch danach Jähzorn und permanente Unzufriedenheit mit Allem und Jedem seine herausragendsten Eigenschaften geblieben.
Es klopfte zweimal kurz an der Zellentür, bevor aufgeschlossen wurde. Frau Diepholz war eine nette Vollzugsbeamtin. Sie war immer freundlich zu Evelyn und – sie klopfte an. Wie man in den Wald hineinruft …
„Na, Frau Lengsfeld, wie isset? Geht’s wieder besser?“
Frau Diepholz war eingetreten und nahm das Tablett mit dem Plastikgeschirr entgegen, dass Evelyn von dem kleinen Schreibtisch genommen hatte und ihr reichte. Flora, die kleine Rothaarige mit den unzähligen Tattoos, wartete draußen auf dem Gang. Sie war wie Evelyn Insassin im Frauentrakt der Justizvollzugsanstalt in Essen-Frintrop und assistierte Frau Diepholz beim Einsammeln des Geschirrs.
„Ja, geht schon wieder, Frau Diepholz“, antwortete Evelyn und nickte. „Vielen Dank“, fügte sie hinzu, denn Frau Diepholz war wirklich nett.
„Ach, Sie haben ja wieder nich aufgegessen“, klagte Frau Diepholz, „kein Wunder, dat sie schlappmachen.“
„Danke, es war echt lecker, aber ich kann bei der Hitze nicht so viel essen“, erklärte Evelyn.
Es hatte Geflügelgeschnetzeltes mit Reis gegeben, dazu eine Art Brei, der mutmaßlich aus Erbsen und Möhren bestand.
„Ja, is aber auch echt heiß“, stimmte Frau Diepholz zu, „den ganzen Juni un Juli nur Scheißwetter, un jetzt gleich wieder über dreißig Grad. Dat geht auf ’n Kreislauf.“ Sie warf einen Blick auf den halbvollen Teller. „Na ja, morgen gibbtet Currywurst un Pommes. Dat is hier immer ganz lecker.“
Evelyn hatte heute Morgen vergessen, ihre Blutdrucktabletten einzunehmen, dazu kam die schwüle Hitze. Ihr war schwindlig geworden, und sie hatte sich hinlegen müssen.
„So sind die Sommer doch hier immer“, sagte Evelyn. Fast hätte sie gesagt: Hier bei euch im Westen. „Entweder nass und kalt oder Schwüle und Gewitter. Aber mir geht’s gut“, fügte sie hinzu, als sie erneut den besorgten Blick der Beamtin bemerkte.
„Tja, dat is der Klimawandel“, entschied Frau Diepholz, „dat ham die jetzt davon. Demnächst is dat hier wie inne Tropen, warten Se ma ab.“ Frau Diepholz mochte Anfang vierzig sein, so genau konnte man sie in ihrer hellblauen Berufskleidung - heute trug sie wegen der Hitze nur ein kurzärmeliges Uniformhemd zur Diensthose - nicht einschätzen, und sie behandelte Evelyn, die im Mai zweiundsechzig geworden war, wie eine zerbrechliche alte Dame. Dabei wirkte Evelyn trotz ihrer Falten im Gesicht viel jünger als die meisten Sechziger. „Na gut, ich muss“, sagte Frau Diepholz und wies mit dem Kinn zur offenen Zellentür.
Draußen neben dem vierstöckigen Servierwagen aus Stahlblech lächelte die rothaarige Flora trotz ihres unvollständigen Gebisses ein freundliches Lächeln. Ihr Typ hatte ihr die oberen Schneidezähne auf einem seiner Acid-Trips mit einem schweren Glasaschenbecher ausgeschlagen. Flora, die wirklich extrem dünn war, hatte in der Haft einen Entzug hinter sich gebracht, schien aber noch immer nicht ganz darüber hinweg zu sein.
„Tschüss dann“, sagte Frau Diepholz und ging hinaus.
„Tschüss“, rief Evelyn ihr hinterher.
Das Zuknallen und Verriegeln der Tür klang wie in einem dieser Gefängnisfilme, die man gelegentlich im Fernsehen sieht. Ansonsten war hier drin das meiste ganz anders, und zwar besser, als sie befürchtet hatte.
Die JVA Essen-Frintrop lag an der Grenze zwischen Essen und Mülheim in einem ansonsten unbebauten Gebiet, umgeben von einem Grüngürtel. Früher hatte hier mal ein großes Stahlwerk produziert. In den Achtzigerjahren war das komplett von den Chinesen demontiert und in Nanjing neu aufgebaut worden. Die JVA bestand aus fünf langgestreckten, jeweils viergeschossigen Gebäuden, die zusammen einen Halbkreis bildeten und ein großes Areal mit Sportplatz und einer modernen Sporthalle umgaben, die in ihrer annähernd linsenförmigen Architektur und der glänzenden Fassade aus Glas und Aluminium einem gelandeten UFO ähnelte. Das mittlere der fünf Gebäude beherbergte zum großen Teil die Verwaltung, Gemeinschaftseinrichtungen, Küche und Vorratsräume. Nur eines der vier verbleibenden Häuser war weiblichen Strafgefangenen vorbehalten. In der Strafanstalt saßen sechshundertdreißig Männer und zweihundertsiebzehn Frauen ein. Die bösen Buben waren also auch in emanzipierten Zeiten immer noch deutlich in der Überzahl.
Die Frauenquote ist bei uns immerhin viel besser als in den DAX-Vorständen, hatte die Leiterin der JVA Frau Doktor Wegener am zweiten Tag nach Evelyns Überstellung nach Frintrop in launigem Tonfall zu ihr gesagt. Frau Doktor Wegener war eine stämmige Frau Mitte fünfzig und hatte eine erstaunlich warmherzige Art, mit Leuten umzugehen. Es war das Einführungsgespräch gewesen. Neue Häftlinge bekamen hier immer ein Einführungsgespräch, in dem ihnen die Abläufe in der JVA nähergebracht und der Sinn der Haftstrafe im Allgemeinen noch einmal ausführlich erläutert wurde, die schließlich eine problemlose Wiedereingliederung in die Gesellschaft draußen zum Ziel hatte. Evelyn konnte sich deshalb so gut an das Gespräch erinnern, weil sie bei dem Vergleich zwischen den Insassen der Frintroper JVA und den DAX-Vorständen trotz des ansonsten ernsten Gesprächs hatte schmunzeln müssen. Es war ihr nämlich die Frage in den Sinn gekommen, in welcher der beiden Personengruppen unter dem Strich die kriminelle Energie wohl stärker ausgeprägt sein mochte.
Evelyn blickte auf den kleinen Reisewecker, der auf ihrem Nachttischchen neben dem schmalen Einzelbett stand. Es war viertel nach zwei. Um drei Uhr sah der Stundenplan sechzig Minuten Hofgang vor.
Evelyn setzte sich matt auf ihr Bett und blickte in den gegenüberliegenden kleinen Spiegel an der Wand. Die Haut unter ihren müden blauen Augen glänzte vom Schweiß. Die hellblond gefärbten Haare, die sie zu einem Knoten gebunden hatte, zeigten am Scheitel einen grauen Ansatz. Das orangefarbene T-Shirt (man gestattete hier auch einige private Kleidungsstücke) zeigte deutliche Schweißflecke. Dazu trug sie die dunkelblaue Arbeitshose der JVA. Die Hosenbeine hatte sie bis zu den Knien umgeschlagen. Sie blickte auf den zusammengefalteten Brief, der neben der kleinen gerahmten Fotografie auf dem Schreibtisch lag, und eine Welle der Trauer überrollte sie wie die Brandung, die sich schäumend auf den Strand wälzt und auf dem Rückweg ins Meer an einem zerrt. Evelyns Augen wurden feucht, und ein Teil der Trauer mochte durchaus ihrem toten Vater gelten. Der weitaus größere Teil ihres Kummers begleitete sie nun jedoch schon seit fast zehn Monaten und war der Grund dafür, dass ihr Leben aus den Fugen geraten war. Und es war der Grund dafür, dass sie hier gelandet war.
Manfreds Tod, der Tod der späten Liebe ihres Lebens, der letzten Liebe, dessen war sie sich ziemlich sicher, hatte ihr die Perspektive geraubt. Pläne, die sie noch miteinander geschmiedet hatten, Träume, die sie noch gemeinsam geträumt hatten, waren vom Tisch gewischt worden wie Krümel von einem abgeräumten Frühstückstisch.
Von dem Foto auf dem Schreibtisch lächelte er sie an, mit geschlossenen Lippen, wie er es meistens getan hatte, die Wangen voller, als er es sich gewünscht hatte, die ehemals blonden Haare ergraut und dünn geworden. Damals war die Welt noch in Ordnung gewesen, damals im Sommer 2014 auf Langeoog, als sie mit den Fahrrädern ein gutes Stück weit nach Osten gefahren waren. Dorthin, wo der ohnehin breite Strand, durch die Ebbe noch fast verdoppelt, schon relativ menschenleer gewesen war. Sie hatten sich am Rand der Dünen in den Sand gelegt und gemeinsam die vorüberziehenden Wolken beobachtet, die vom Wind ins Landesinnere getrieben wurden.
Evelyn legte sich auf das Bett und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Für einen Moment hörte sie das Rauschen des Meeres.
Die Zellendecke war weiß. Die Wände waren bis zur halben Höhe mit glänzender Ölfarbe in einem freundlichen Hellgrün gestrichen. Die Farbkombination aus Grün und Weiß war wohl das Konzept derjenigen gewesen, die für die Gestaltung der Vollzugsanstalt verantwortlich gewesen waren. Auch auf den Fluren und in den Treppenhäusern waren Grün und Weiß die vorherrschenden Farben. Aus dem vergitterten Fenster neben dem Kopfende ihres Bettes konnte sie nur hinunter auf den Sportplatz und die gegenüberliegenden Trakte blicken, wenn sie aufrecht davorstand. Trotzdem bekam die Zelle genügend Tageslicht ab. Es wäre schön gewesen, wenn man jetzt bei der schwülwarmen Wetterlage die Tür zum Lüften öffnen könnte. Dagegen sprach jedoch nicht nur die Hausordnung der JVA, sondern auch der gesunde Menschenverstand. Evelyn hatte sich schon immer ganz gut stundenlang allein in einem Raum aufhalten können und war sich dabei selbst genug. Aber zu wissen, dass sie diesen Raum nicht jederzeit verlassen konnte, dass sie sich hinter einer verriegelten Tür befand, bereitete ihr Unbehagen.
Sie setzte sich auf und strich sich ein paar Haarsträhnen hinter die Ohren, die stets den unwiderstehlichen Drang zu verspüren schienen, sich aus dem Knoten an ihrem Hinterkopf zu lösen. Dann ging sie zu dem Edelstahl-Waschbecken an der gegenüberliegenden Wand und ließ sich kaltes Wasser (was da aus der Leitung kam, war eher irgendetwas zwischen fast kühl und lauwarm) über Unterarme und Hände laufen. Sie legte die nassen Handflächen auf ihr Gesicht und sog die Luft tief durch die Nase ein.
Evelyn war ungeschminkt. Das hatte nichts damit zu tun, dass sie in Haft war, sondern sie schminkte sich grundsätzlich nie.
Auf ihrem Schreibtisch lag eine Reihe von Büchern, die sie sich schon vor Tagen aus der Bücherei ausgeliehen hatte. Effi Briest war dabei, von Fontane. Auch Der Schimmelreiter. Beide Bücher kannte sie aus ihrer Jugend und hatte sie mehr als einmal gelesen, aber sie gehörten immer noch zu ihren Lieblingsbüchern, und sie verband damit viele Erinnerungen. Außerdem beschwor es sowohl schöne als auch traurige Momente ihres Lebens herauf, den Namen Effi auf dem Buchdeckel zu lesen. Allerdings hatte sie es bisher nicht geschafft, mit dem Lesen eines der Bücher zu beginnen.
Nicht, dass sie dafür keine Zeit hätte, bewahre. Sie hatte sich noch nicht einmal für eine Tätigkeit entschieden, von denen in der JVA jede Menge angeboten wurden. Die kleine Flora, zum Beispiel, arbeitete in der Küche. Wahrscheinlich hoffte man, dass sie beim Umgang mit den Lebensmitteln ein bisschen zunehmen würde. Viele Häftlinge bastelten Geschenkartikel, die im Onlineshop der JVA verkauft wurden. Jenny Lumbeck, mit der Evelyn bis vor zwei Wochen vorübergehend wegen Platzmangel eine Gemeinschaftszelle hatte teilen müssen, arbeitete in der Wäscherei. Jenny hatte ihrem Mann seinen Bowlingpokal, auf den er mächtig stolz war, zielgenau ins Gesicht geschmettert und ihm dabei das Nasen- und das linke Jochbein gebrochen. Auf einem Auge hatte er bei der Attacke außerdem siebzig Prozent seiner Sehkraft eingebüßt. Anschließend hatte sie versucht, sein Flittchen übers Balkongeländer zu werfen, was zum Glück von Nachbarn, die durch das Geschrei alarmiert worden waren, im letzten Moment verhindert werden konnte.
Viele Wege führen nach Alcatraz.
Das Gefängnis war schon ein merkwürdiges Paralleluniversum. Evelyn erinnerte sich, dass Jenny Lumbeck durch das Zellenfenster über das Sportgelände hinweg eine Beziehung zu einem männlichen Häftling im gegenüberliegenden Trakt aufgenommen hatte. Dabei war auf diese Distanz bestenfalls schemenhaft ein Gesicht im Fenster zu erkennen, vorausgesetzt, der Lichteinfall war günstig. Und dies war durchaus kein Einzelfall. Massenhaft kam es im Knast zu Fernkontakten zwischen männlichen und weiblichen Insassen. Es hatte sich eine regelrechte hausinterne Zeichensprache entwickelt, mit der sich Männlein und Weiblein über die große Distanz miteinander verständigten. Sogar Prügeleien zwischen Frauen hatte es beim Hofgang gegeben, wenn eine es gewagt hatte, dem falschen Fenster zu winken.
Wenn beide Häftlinge einen Antrag stellten, war es durchaus möglich, dass Pärchen einen unbeaufsichtigten, sogenannten Langzeitbesuch, oder auch Intimbesuch genehmigt bekamen. Dafür musste es sich aber in beiden Fällen um Häftlinge mit sehr guter Führung handeln. Soweit Evelyn gehört hatte, kamen solche Zusammenkünfte häufiger vor, als man annehmen sollte. Der Trieb sucht sich seinen Weg, hatte sie bei sich gedacht und sich die absurde Situation damit erklärt. Am Ende kamen dort schließlich zwei Menschen zusammen, die sich zuvor niemals näher als hundert Meter gekommen waren. Ihr hatte sich der Vergleich von Laborratten aufgedrängt, die, sich einander völlig unbekannt, in einen Glaskäfig gesetzt wurden, um ihr Paarungsverhalten zu beobachten. Die immerhin recht wohnlich eingerichteten Besuchszimmer wurden zwar nicht beobachtet, aber schließlich wusste jeder Außenstehende, ob Vollzugsbeamter oder Häftling, was in den kostbaren Stunden darin geschah. Letzten Monat hatte ein Häftling seine Angebetete in einer solchen Begegnungszelle zusammengeschlagen, weil diese es sich plötzlich doch anders überlegt hatte. Seitdem hatte die Anstaltsleitung die Möglichkeit solcher Zusammenkünfte einstweilen auf Eis gelegt.
Natürlich hatte Evelyn irgendwo Verständnis für Jenny. Schließlich stand diese mit ihren fünfunddreißig Jahren voll im „Saft“. Aber sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie selbst, auch in früheren Jahren, jemals Gefahr gelaufen wäre, so tief zu sinken.
Manfred, dachte sie spontan. Das Foto blieb stumm, das Lächeln unbeweglich. Sie hatten sich spät gefunden. Für beide war es das zweite Glück gewesen, die zweite Chance, nun ja, was sie selbst betraf, wohl eher die dritte. Beide hatten gemeinsam die Leidenschaft neu entdeckt, die Schmetterlinge im Bauch (riesige Falter zuweilen) neu verspürt. Aber es hatte ihnen auch gereicht, einfach nur beisammen zu liegen, sich anzusehen, sich zu berühren.
Als der Hofgang fällig war, ging Evelyn nach draußen. Sie hätte auch darauf verzichten können, aber vielleicht wehte draußen ein angenehmes Lüftchen. Und was brachte es, in der Zelle die grün-weißen Wände anzuschauen, das ewige, stille Lächeln mit geschlossenen Lippen, den zusammengefalteten Brief auf liniertem Papier, den Waschtisch und die Kloschüssel aus Edelstahl. Viel zu selten konnte sie Letztere benutzen. Evelyn hatte nie, oder zumindest selten, Probleme mit der Verdauung gehabt, aber seit sie im Knast war, schien der Darm in einen Ruhemodus umgeschaltet zu haben.
Sie reihte sich ein in den Strom der überwiegend blau gekleideten Frauen, der sich die Treppen hinunter ergoss, hörte das schnatternde, kreischende Stimmengewirr aus unzähligen Frauenkehlen, das an eine Geflügelfarm erinnerte, und trat hinaus in grelles Sonnenlicht auf der Außenseite des Gebäudehalbkreises, von wo aus der Männertrakt nicht zu sehen war. Die Mauer, die das gesamte Areal der Justizvollzugsanstalt umgab, war an die sechs Meter hoch, und darauf befand sich eine glitzernde Walze aus gerolltem Stacheldraht.
Das war es, was ihr Probleme machte. Das gesamte Gebäude, die Zellen, die Gänge, das Treppenhaus, Gemeinschaftsräume, Sporthalle, auch die Kapelle, alles war freundlich eingerichtet und in warmen Farben gehalten. Jedoch gab es keinen Blick durch irgendein wie auch immer geartetes Fenster, der nicht durch Gitterstäbe zerteilt wurde. Hier wurde die Welt in kleine rechteckige Einheiten unterteilt. Das Leben wurde von hier aus durch ein grobes Raster betrachtet. Die einzige Ausnahme war, wenn man beim Hofgang den Kopf in den Nacken legte und in den freien Himmel hinaufsah. Dann zogen an manchen Tagen die Wolken dahin wie am Strand und über den Dünen von Langeoog. Nicht heute, denn das Thermometer zeigte vierunddreißig Grad Celsius, und der Himmel war nicht ganz blau, sondern milchig weiß, als hätte der liebe Gott (der mit dem merkwürdigen Humor) eine durchsichtige, aber nicht ganz neuwertige Folie über die Welt gespannt.
In dem einen Monat, den sie bisher hier verbracht hatte, und in den vier Monaten Untersuchungshaft davor, bis zu ihrem Prozess und währenddessen, hätte Evelyn schon viel Gelegenheit gehabt, sich an die Omnipräsenz von Gittern zu gewöhnen. Es war ihr bisher nicht wirklich gelungen.
Aus der Tageszeitung, die in der Gefängnisbibliothek eingesehen werden konnte, wusste sie, dass es vielen anderen Menschen ähnlich ging. In der Türkei zum Beispiel war der Staatspräsident dabei, nach einem gescheiterten Putschversuch unzählige Menschen, die nach seiner Auffassung von der Linie abwichen, unter dem Vorwurf terroristischer Umtriebe ins Gefängnis zu werfen. Unter ihnen waren neben Militärs auch Staatsanwälte, Lehrer und Journalisten in so großer Zahl, dass es kaum vorstellbar war, dass es sich tatsächlich ohne Ausnahme um Sympathisanten und Unterstützer staatsfeindlicher Organisationen handelte. Evelyn wusste, dass es diesen Leuten hinter ihren Gitterstäben weitaus schlechter ging als ihr. Sie war schließlich zu Recht hier. Sie war mit ihrem Urteil absolut einverstanden. Der Richter hatte keine Chance gehabt, anders zu entscheiden.
2
Juli 1962
Manfred saß am Küchentisch und zeichnete. Draußen war schönes Wetter, und das war es, was seine Eltern schon immer gewundert hatte. Es konnte das schönste Wetter sein, die Kinder aus der Nachbarschaft spielten johlend und rufend zwischen den Häusern – aber Manfred beschäftigte sich stundenlang mit seinen Bilderbüchern und vertiefte sich in die Abenteuer von Meckie und seinen Freunden. Oder er malte. Wobei das Malen mit Farben nie in besonderem Maße sein Interesse fand. Er zeichnete mit dem Bleistift. Voller Andacht entstanden die grauen Konturen einer Ritterburg mit Zinnen und Schießscharten auf dem frischen Blatt seines Zeichenblocks. Das unberührte weiße Blatt übte eine sinnliche Anziehungskraft auf ihn aus. Einen ganz neuen Zeichenblock zu beginnen, das bunte Deckblatt aufzuschlagen und die ersten Striche auf dem makellosen, holzfreien Papier auszuführen, war für ihn ein beinahe religiöser Akt.
Er genoss es, in der Küche allein zu sein. Der Papa war nebenan im Wohnzimmer und nahm Musik auf. Dabei kam es für Papa darauf an, genau im richtigen Moment, wenn der Ansager verstummte, gleichzeitig die Start- und Aufnahmetaste zu drücken, bevor die Musik einsetzte. Der Papa war stolz auf sein Grundig TK 23 Tonbandgerät. Mit den Magnetbandspulen von BASF konnte er bis zu zwei Stunden Musik am Stück aufnehmen.
Die Mama war noch mal zu Petzelberger gelaufen, einem kleinen Gemischtwarenladen ein paar hundert Meter entfernt an der Ecke auf der anderen Seite der Gelsenkirchener Straße.
Manfred nahm das stumpfe Ende seines Bleistifts in den Mund und sah gedankenverloren zum Küchenfenster hinaus. Direkt gegenüber war der „Stall“, in dem der Papa allerlei Gartengeräte aufbewahrte und in dessen oberem Teil sich ein Taubenschlag befand. Tauben hielten die Eltern zwar nicht, dafür versorgte Susi, die schwarz-weiße Katze aus der Nachbarschaft, dort im Stroh ihren Wurf von vier kleinen Welpen, die ihre Augen noch geschlossen hielten. Das hatte Manfred erst gestern noch überprüft.
Oberhalb der grauen Dachschindeln des Stalls konnte Manfred sehen, dass die beiden Kühltürme der Zeche dicke weiße Dampfwolken ausstießen, die sich kompakt und träge in den Himmel hinaufwälzten wie schwereloser Rasierschaum. Die Sicht auf die Kühltürme selbst wurde durch den Stall verdeckt.
Manfred zeichnete im Umfeld der Ritterburg mit schwungvollen Bögen ein paar Sträucher und Bäume. Den groben und unregelmäßigen Mauersteinen verlieh er durch Schraffierungen und Schatten ein möglichst realistisches Aussehen. Auf einem der Türme entstand ein kleiner, einsamer Ritter, der aus nicht ersichtlichen Gründen sein Schwert erhoben hatte und aussah wie eine Miniatur des Hermannsdenkmals.
Manfred hörte die Haustür ins Schloss fallen. Kurz darauf öffnete sich die Küchentür. Noch halb im Korridor (so nannten sie die Diele ihrer Erdgeschosswohnung) rief Elfriede ins Wohnzimmer: „Schorsch, willße am Sonntach Pellkartoffeln oder Bratkartoffeln?“
Durch die offene Küchentür drang die weiche, aber männliche Stimme von Gerhard Wendland. Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht?
Und dann die weniger weiche, jedoch ebenfalls männliche Stimme von Georg Schuster. „Bratkartoffeln!“
Tanze mit mir in den Morgen.…
„Manfred, du muss gleich ma hier den Küchentisch freimachen“, bemerkte die Mama und stellte ihre Einkaufstasche auf der Spüle ab.
Tanze mit mir in das Glück … Die Stimme wurde begleitet von einem beschwingten Tangorhythmus.
„Setz dich doch anne Fensterbank“, schlug die Mama vor.
In deinen Armen zu träumen ist so schön bei verliebter Musik…
Sie schloss die Küchentür.
Der Papa hatte damals keine abgeschlossene Lehre absolvieren können. Daran waren die Kinderlandverschickung schuld, die ihn als Heranwachsenden ins Oberhessische verschlagen hatte, und die Turbulenzen sowohl in den letzten Kriegs-, als auch in den ersten Friedensjahren. Trotzdem besaß er eine Menge handwerkliches Geschick. So hatte er die Küchenfensterbank um das Dreifache verbreitert und darunter einen Schrank mit Schiebetüren gebaut, sodass die neue Fensterbank den oberen Abschluss des Schrankes bildete. Die Materialien stammten ausnahmslos aus Zechenbeständen. Hinter den Schiebetüren verbargen sich Stapel von Meckie Bilderbüchern, Malbüchern, mehrere Autoquartette und eine große, rot lackierte Holzkiste mit verschieden großen Fächern (ebenfalls von Papa gebaut) in denen sich die Lego-Steine befanden.
Manfred klappte seinen Zeichenblock zu und räumte die Malsachen vom Tisch. Dann kniete er sich vor den Schiebeschrank und zog die Legokiste vor.
Mama begann, das Viertelpfund Aufschnitt, die Gurken und einen halbes Pfund Butter in den Bosch-Kühlschrank zu räumen, der friedlich und vertrauenerweckend vor sich hin brummte.
„Mensch, Manfred“, sagte sie, „warum gehße denn nich ma’n bisschen in’n Garten? Es is so’n schönes Wetter.“
„Nee, keine Lust“, bemerkte Manfred und begann, auf einer Lego-Bodenplatte die Außenmauern eines Hauses zu errichten.
„Ich hab Ingo und Siechfried draußen gesehn“, ließ die Mama nicht locker, „die haben gefracht, ob du nich raus komms.“
„Mhm … Mhm …“, machte Manfred und schüttelte den Kopf, was Mama nicht sehen konnte, weil sie ihm an der Spüle stehend den Rücken zuwandte. Er bemühte sich, die roten und weißen Steine abwechselnd zu verwenden, weil er wusste, dass er von jeweils einer Farbe nicht genügend Steine für ein Haus besaß. Und nichts war schlimmer, als eine Bauruine auf halber Strecke notgedrungen mit einer anderen Farbe weiterzubauen. Ein geordnetes rot-weißes Schachbrettmuster an den Mauern wirkte da erheblich ansprechender. Die Schwierigkeit stellte sich erst ein, wenn es an die Errichtung des Daches ging und man auf der einen Seite darauf achten musste, dass die Dachsteine genügend solide zusammengedrückt wurden, auf der anderen Seite jedoch aufpassen musste, dass das Dach nicht ab der dritten oder vierten Reihe einstürzte.
Als sich die Küchentür erneut öffnete, gab es im Wohnzimmer offenbar gerade die Nachrichten, irgendwas mit Adenauer, Chruschtschow und so weiter.
Tanze mit mir in den Morgen, hatte auf der Magnetspule in der Reihenfolge hinter der italienischen Sängerin Mina mit Heißer Sand seinen Platz gefunden. Es war das Jahr, in dem sich in England eine Bluesband namens The Rolling Stones gründete, damals noch mit Brian Jones und Ian Stewart. Zu der Zeit gab es die Beatles schon seit zwei Jahren. Der Tsunami, den die beiden Musikgruppen in der Musikbranche und in der Jugendbewegung insgesamt auslösten, würde erst mit Verspätung bei Manfred Schuster ankommen.
„Friede, ich geh noch ma im Garten“, verkündete Georg Schuster.
„Ja komm, Manfred, dann geh doch mit nach draußen“, machte Elfriede einen weiteren Versuch.
„Nee, ich will nich!“, bestimmte Manfred jetzt entschlossen.
„Keine Fissematenten, du k…k…komms mit nach draußen“, legte der Papa fest, und eine Entscheidung dieser Art galt in der Regel im Hause Schuster als unanfechtbar. Das leichte Stottern schlich sich nur gelegentlich in Georg Schusters Rede ein.
Er hatte in den letzten Jahren damit begonnen, ein bisschen füllig zu werden. Er aß gern, das Bier schmeckte, er hatte das Rauchen aufgegeben, und Elfriede kochte große, kalorienreiche Mahlzeiten (obwohl das Wort Kalorien zu Beginn der Sechziger in der Bevölkerung weitgehend unbekannt war). Es war die Zeit des Wirtschaftswunders. Ludwig Erhard würde noch ein gutes Jahr Bundeswirtschaftsminister bleiben, bevor er das Amt an seinen Nachfolger Kurt Schmücker übergab.
„Ach, Schorsch, dann lass doch den Jungen, wenner nich will“, war Elfriede nun plötzlich wieder ganz auf der Seite ihres einzigen Kindes.
„Junge“, befahl der Vater, „zieh deine Schuhe an, un ab!“
Der Papa hatte ihn noch nie geschlagen, aber er konnte Entscheidungen treffen, mochten sie richtig oder falsch sein. Und wenn er eine traf, dann teilte er das in einer Stimmlage mit, die bei Frau und Sohn jede Lust auf eine weitere Diskussion im Keim erstickte.
„Wenn der nächsten Monat inne Schule kommt, dann weht sowieso ’n anderer Wind!“
Das war ein Satz, den Manfred schon häufiger gehört hatte, auch von seiner Mutter. Auch der Oppa hatte ihn schon verwendet. Und dieser Satz war nicht eben dazu angetan, seine Vorfreude auf die Einschulung zu fördern. Die Begeisterung wurde zusätzlich gedämpft durch den Hinweis auf den sogenannten Ernst des Lebens, der offenbar mit dem Tag der Einschulung in sein Leben treten sollte.
Vater und Sohn gingen durch den Hausflur und die Hintertür, wo sie in die Gartenschuhe schlüpften, die Treppe hinunter über den mit Asche bedeckten Hof. Der Hof musste im Wochenrhythmus geharkt werden, damit sich kein Unkraut ansiedelte. Meistens übernahm das die Mama.
Wenn der Papa im Garten arbeitete, war Manfred grundsätzlich im Weg. Geduld und pädagogisches Einfühlungsvermögen gehörten nicht zu Georg Schusters Kernkompetenzen. Er liebte Frau und Kind. Das auf jeden Fall! Aber wenn bei der Arbeit nicht alles klappte, wie er es sich vorstellte, und wenn andere nicht seine Gedankengänge rechtzeitig errieten, konnte er schnell einmal laut werden. Aber er war nicht nachtragend. Bei ihm zogen Gewitter genauso schnell weiter, wie sie heraufzogen. Hatten in dem einen Moment noch die Türen geknallt, konnte er im nächsten schon wieder ganz ruhig und liebevoll sein.
Während sich der Vater mit der Schaufel daran machte, die Ausschachtung für den geplanten Gartenteich vor der Laube voranzutreiben, sah Manfred im überdachten Gang vor dem Hühnerstall (auch hier stammten die Baumaterialien ausnahmslos vom Pütt) nach seiner Ameisenfarm, die er vor ein paar Tagen angelegt hatte. Unter einem Trittstein im Garten hatte er eine Ameisenkolonie freigelegt, eine große Population kurzerhand gekidnappt und zusammen mit lockerer Erde und Sand in ein leeres Gurkenglas verfrachtet. In den Metalldeckel hatte er mit einem dünnen Nagel winzige Löcher gebohrt, so winzig, dass nicht einmal eine Ameise hindurchpasste. Auf die Erde, die das Glas zu zwei Dritteln füllte, hatte er einen Teelöffel Zucker gestreut, den die Mama beigesteuert hatte. Inzwischen hatten sich die Ameisen schon häuslich eingerichtet, einen Teil des Zuckers unter Tage befördert und Gänge gegraben, die zum Teil entlang der Glaswand verliefen, sodass man sie von außen einsehen konnte.
Manfred stellte das Glas beiseite und überlegte, was passieren würde, wenn er Insekten fing, eine Spinne oder eine Biene, vielleicht auch einen Regenwurm, und ihn zu den Ameisen ins Glas gab. Kinder können mitunter recht skrupellos sein.
Er schlenderte den Gartenweg entlang und kam an der Laube vorbei, wo sein Vater inmitten eines Blumenbeetes schaufelnd fast bis zur Hüfte in einem Erdloch stand. Der langgezogene Garten wurde am Ende durch eine rotbraune Backsteinmauer begrenzt. Schon wenige Meter dahinter erhoben sich auf dem Zechengelände die zwei mächtigen Kühltürme. Jenseits der Mauer hörte man das leise, aber stetige Rauschen von Wasser. Weiter links erhob sich, vielleicht zweihundert Meter Luftlinie entfernt, der Förderturm von Schacht 12, auch Doppelbock genannt, der die zentrale Förderanlage der Zeche Zollverein war. Beide Seilscheiben rotierten, was bedeutete, dass Bergleute auf Seilfahrt waren. Viele Jahre später, lange nach dem Ende des Ruhrbergbaus, würde das ganze Gelände zum Weltkulturerbe erklärt werden.
Drinnen in der Küche bereitete die Mutter die Schnittchen fürs Abendessen vor. Bald weht ein anderer Wind, dachte sie, und in ihrem Herzen saß die Sorge, wie sich ihr einziges Kind wohl in der Schule machen würde. Manfred war immer ein ruhiges Kind gewesen, kein Rabauke, keiner, der auf die Bäume kletterte, vorlaut war und sich mit anderen prügelte. Sicher hatte er mehrfach aufgeschürfte Knie gehabt, wenn er vom Roller fahren nach Hause kam. Aber Manfred war eben ein Kind, das lieber im Haus malte, in Bilderbüchern blätterte oder sich in ferne Welten träumte, als mit den anderen draußen Fangen zu spielen. Elfriede hoffte, dass der „andere Wind“ nicht zu rau für ihren kleinen Manfred sein würde.
3
Dezember 2015
Das Angela-von-Merici-Heil-und-Pflegeheim war 1911 ursprünglich von Nonnen des Ursulinenordens in Essen erbaut worden und dort zunächst gut besuchte Anlaufstelle für Wöchnerinnen aus den ärmsten Bevölkerungsschichten gewesen. Sehr bald allerdings kurierten hier überwiegend kriegsversehrte Soldaten ihre schweren Verwundungen aus, bis diese so weit verheilt waren, dass man ihnen den hölzernen Ersatz für verlorene Gliedmaßen anpassen konnte. Auch manches Giftgasopfer tat hier seinen letzten Atemzug, während eine der aufopferungsvollen Ordensschwestern ihm die Hand hielt. Was der Steinstaub in Bergwerken mit Namen wie Mathias Stinnes oder Langenbrahm nicht geschafft hatte, das Dianisidin aus den Reichswehr-Beständen der eigenen Artillerie konnte die Lungenfunktion in Minuten irreparabel schädigen, sofern die Windrichtung dafür günstig war.
Ab Juni 1930 hatte die Katholische Kirche in dem schönen Gebäude mit Stuckfassade und Zwiebeltürmchen unter dem neuen Namen Martinus-Heim ein Hospiz für Menschen mit langwierigen und unheilbaren Erkrankungen unterhalten. Im April 1944 war das Martinus-Heim dann, sozusagen als Kollateralschaden, einem alliierten Bombenangriff zum Opfer gefallen, der eigentlich den Krupp-Werken in Altendorf gegolten hatte. Erst 1957 war das Gelände vollständig vom Schutt befreit worden, auf dem nun ein zweckmäßiger Neubau entstand. Zu Beginn des Jahres 1993 hatte ein privater Träger der Kirche das Objekt abgekauft und eine Privatklinik daraus gemacht. Erst seit April 2004 war das Martinus-Heim, wie es bei den Anwohnern weiterhin hieß, eine externe Abteilung des Klinikums Essen. Aus Platzmangel bei der Hirnchirurgie auf dem eigentlichen Klinikgelände erfolgte hier die Nachsorge und Pflege von Patienten mit Hirntraumata und nach Schädeloperationen. Auf dem großzügigen Gartengrundstück hinter dem Haus entstand ein Anbau, der die Kapazität deutlich verbesserte.
Das Martinus-Heim lag in der Brunnenstraße in einem ruhigen Wohngebiet. Direkt gegenüber konnte man in den Stadtgarten blicken, der an diesem Tag menschenleer war. Die Straße wurde gesäumt von einer Reihe alter Ulmen, die zurzeit fast vollständig entlaubt waren. Von einem der Bäume, schräg gegenüber des Martinus-Heims, war nur noch der Stumpf übrig, an dessen glatter Schnittfläche sich im letzten Sommer schon wieder neue Triebe gebildet hatten. Der Baum war am Pfingstmontag des vergangenen Jahres dem Orkan Ela zum Opfer gefallen und hatte quer über der Fahrbahn gelegen, wobei er einer S-Klasse mit nur knapp fünftausend Kilometern auf dem Tacho den viel zu frühen Totalschadentod gebracht hatte.
Evelyn hatte ihren roten Renault Twingo mit zwei Rädern auf dem Bordstein abgestellt, zwischen zwei Fahrzeugen mit Anwohnerausweis hinter der Frontscheibe. Bei diesem Wetter würden garantiert keine Politessen unterwegs sein, vermutete sie, deshalb verzichtete sie darauf, einen Parkschein zu ziehen. Schon während sie den kleinen Strauß aus frischen Tannenzweigen aus dem Kofferraum nahm, hatte der Wind, der einen feinen, kalten Nieselregen durch die Luft trieb, erste Erfolge dabei errungen, den Knoten, den sie aus ihren Haaren geflochten hatte, aufzulösen. Eilig lief sie über die unbelebte Straße und erklomm die ersten Stufen des Haupteingangs, die sie unter das großzügige Vordach führten, wo sie immerhin vor dem Regen geschützt war. Evelyn drückte die Glastür auf und nickte grüßend dem älteren Mann zu, der hinter dem geschwungenen Tresen aus hellem Holz saß, der den Empfang bildete. Evelyn und der ältere Mann kannten sich vom Sehen, denn der Besuch heute war nicht ihr erster. Anfangs war Evelyn fast jeden Tag für eine Stunde hergekommen. Inzwischen hatten sich ihre Besuche auf freitags, weil sie da eher Dienstschluss hatte, und sonntags reduziert.
Der ältere Mann grüßte freundlich, aber irgendwie abwesend zurück. Offenbar war er dabei gewesen, ein Buch zu lesen.
Evelyn ging geradeaus durch die Empfangshalle auf den gläsernen Gang zu, der vom Haupthaus durch den Garten zum Anbau am hinteren Ende des Grundstücks führte. Das hintere Gebäude war nur zweigeschossig, und sie gelangte über eine moderne Steintreppe mit einem Geländer aus transparentem Plexiglas nach oben. Auf der Glastür stand in blassen grauen Versalien NEUROTRAUMATOLOGIE. Auf dem hellen Gang kam ihr Schwester Kathrin entgegen. Die weiblichen Pflegekräfte im Martinus-Heim nannten sich zwar in alter Tradition Schwestern, waren aber weit vom Bild der Ordensschwester mit Häubchen und Tracht entfernt. Erstens existierte offiziell der Begriff Krankenschwester nicht mehr, sondern es gab in Krankenhäusern schon lange sowohl weibliche als auch männliche Pflegekräfte. Zweitens war die vielleicht dreißigjährige „Schwester“ Kathrin eine in jeder Hinsicht weltliche Person in einer modischen kurzärmeligen Bluse, einer Brille mit einem Gestell in leuchtendem Orange, einer Jeans, die ihren nicht kleinen, aber ansehnlichen Hintern gut ins Bild setzte und dem Tattoo einer Elfe mit Schmetterlingsflügeln auf dem linken Unterarm. Evelyn vermutete unter der apricotfarbenen Bluse noch mehr solcher fantasievollen Abbildungen. Sie mochte Schwester Kathrin. „Hallo“, grüßte sie.
„Frau Lengsfeld“, Schwester Kathrin nickte ihr lächelnd zu, „kann sein, dass heute einer der schlechteren Tage ist. Is auch wieder ziemlich warm in seinem Zimmer.“
„Okay“, sagte Evelyn, „ich guck mal. Haben sie wohl noch mal ’ne Vase für mich?“
„Klar“, antwortete Kathrin, „gehn se nur schomma rein, ich komm gleich.“
Evelyn drückte die Türklinke von Zimmer 7 hinunter und trat ein. Die Sieben ist eine magische Zahl, und Evelyn hatte am Anfang gehofft, die Zahl könnte vielleicht ein Wunder bewirken. Diese Illusion hatte sie inzwischen aufgegeben. Allerdings fand sie nicht, dass es besonders warm im Zimmer war. Nicht im Moment jedenfalls.
Manfred saß in seinem Rollstuhl, beide Hände auf den Armlehnen abgelegt, und blickte geradeaus zum Fenster.
„Hallo Manni“, rief Evelyn in den Raum hinein. Ihre Stimme hatte einen fröhlichen, optimistischen Klang, der nicht im Mindesten ihrer tatsächlichen Stimmung entsprach. Erwartungsgemäß reagierte Manfred nicht. Sein Gesicht war unbeweglich, wie aus Wachs, und die Augen waren starr auf das Fenster gerichtet.
„Wie geht’s dir heute?“, fragte Evelyn und ging um den Rollstuhl herum zum Fenster, damit er sie sehen konnte. Er schien sie jedoch nicht wahrzunehmen. Also alles wie immer.
„Guck, ich hab frisches Tannengrün mitgebracht. Ist doch bald Weihnachten.“ Sie wedelte mit den Zweigen vor ihm herum und lächelte ihm in das schlaffe, blasse Gesicht. Sein Blick zielte eine Handbreit an ihrem Gesicht vorbei und endete irgendwo jenseits der großen Fensterscheibe im tristen Grau des Dezembernachmittages.
Die Situation war nicht neu, aber es tat immer noch weh. Denn sie liebte Manfred noch immer über alle Maßen, und war einfach nicht bereit, sich mit den paar schönen Jahren zufriedenzugeben, die sie miteinander gehabt hatten bis zu diesem schrecklichen Montag im Juni, den sie mit schöner Regelmäßigkeit in ihren Träumen wieder und wieder erlebte.
Die Tür ging auf und Schwester Kathrin brachte eine mittelgroße gläserne Vase, die optimal für die mitgebrachten Tannenzweige passte.
„Gehm se her, Frau Lengsfeld, ich mach das schon“, sagte sie und nahm Evelyn den Strauß aus der Hand.
Evelyn hatte schon mehrmals darüber nachgedacht, der Schwester das Du anzubieten, aber irgendwie hatte es nie eine passende Gelegenheit gegeben. Sie sah zu, wie Kathrin das Papier von den Tannenzweigen entfernte und diese geschickt in der Vase drapierte.
„Hierhin?“, fragte die Schwester und hielt die Vase mit den Zweigen über den kleinen runden Tisch, auf dem auch ein Foto von Evelyn und Manfred stand. Es war ein Selfie, allerdings ein gut gelungenes. Wenn sich Evelyn recht erinnerte, hatten sie es am Rhein aufgenommen, an der Ruine der Kaiserpfalz in Düsseldorf-Kaiserswerth an einem schönen, sonnigen Samstagnachmittag.
„Ja, schön“, sagte sie und nickte.
Schwester Kathrin stellte die Vase ab, richtete sich auf und hielt einen Moment inne. „Och, scheint doch alles normal zu sein“, stellte sie fest und ging zur Tür. „Einen schönen Tach noch, Frau Lengsfeld“, sagte sie.
„Danke, Ihnen auch.“
Schwester Kathrin war außer Evelyn die einzige Person, jedenfalls vermutete sie das, die es bemerkt hatte, dass es in Manfreds Umgebung wärmer wurde, wenn er diese Momente hatte. Evelyn wusste nicht, wie sie es anders nennen sollte.
„Liebster“, flüsterte sie und sah ihn traurig an. Sie nahm das weiße Tuch, eine Stoffwindel, von der Rückenlehne seines Rollstuhls und tupfte das Rinnsal aus Speichel ab, das sich aus Manfreds linkem Mundwinkel zum Kinn zog. Dann küsste sie ihn auf den Mund. Sie hatte sich daran gewöhnt, dass seine Lippen keinen Widerstand boten, dass sie sich schlaff und unbeteiligt anfühlten wie die Gummischnute eines Partyluftballons, den ihre kleine Enkelin bei unzähligen vergeblichen Versuchen, ihn selbst aufzublasen, bereits feuchtwarm vorgekaut hatte, bevor sie ihn weiterreichte mit dem weinerlichen Kommando: „Mach du, Omi.“
Manfred saß da, die früher einmal vollen Wangen merkwürdig eingefallen, weiß und teigig. Die früher einmal blonden Haare waren grau und schütter geworden. Die unteren Augenlider waren gerötet. Nur ganz selten blinzelte er, meistens starrten die Augen unbewegt.
„Was meinst du, Schatz, soll ich am Sonntag ein bisschen Weihnachtsschmuck mitbringen?“, fragte Evelyn hoffnungslos, „ich kann Zimtsterne backen, und wir machen uns einen schönen Nachmittag. Was meinst du?“
Von dem Tischchen neben dem Fenster zog sie einen der drei Stühle heran und setzte sich im rechten Winkel ihm gegenüber. Wie gern hätte sie ihm ein Glas Wasser eingeflößt oder sogar einen Kaffee mit ihm getrunken. Jeder Tropfen wäre an seinen schlaffen Lippen abgelaufen und von der dunkelblauen Trainingsjacke aufgesogen worden, die er trug.
Die Ärzte hatten gleich zu Anfang prognostiziert, dass er mit einiger Sicherheit nie mehr würde laufen können. Die beiden zertrümmerten Lendenwirbel hatten ein klares Urteil gesprochen. Die Hirnblutung hatten sie jedoch damals schnell stoppen und das Gerinnsel, das Druck auf sein Gehirn ausgeübt hatte, entfernen können. Nach Auffassung von Professor Lüdinghausen bestand durchaus berechtigte Hoffnung, dass Manfred die oberen Extremitäten wieder würde benutzen können, irgendwann. Die kognitiven Fähigkeiten dürften aus ärztlicher Sicht auch nicht derart geschädigt sein, dass er seine Umgebung nicht wahrnehmen und mit ihr kommunizieren konnte.
„Aber er muss es auch wollen“, hatte der Professor einmal zu ihr gesagt und sie vielsagend angesehen. Sie hatte ihn nicht verstanden.
Manfred saß nun seit über zwei Monaten im Rollstuhl und wurde künstlich ernährt.
„Ich mach das, ja, Schatz? Ich besorge ein paar kleine Kugeln und Sterne und schmücke damit die Tannenzweige, okay?“
Evelyn erwartete keine Antwort. Sie sah das wächserne Gesicht an, das ihr sein Profil zuwandte, und sie merkte, wie sich ihre Augen mit heißer Tränenflüssigkeit füllten.
„Weihnachten wollen auch deine Kinder kommen, das wird ein richtig schönes Fest, warte mal ab“, sagte sie und bemühte sich redlich, ihre Stimme fest klingen zu lassen, „und bis dahin kannst du bestimmt auch wieder sprechen.“
Sie sah auf seine Augen, bemerkte voller Angst, dass sie anfingen zu flackern wie die Adventskerze in dem Gesteck, das sie ihm letzten Sonntag mitgebracht hatte. Er blinzelte ein paar Mal schnell hintereinander, und dann begannen seine Pupillen in einem aberwitzigen Tempo auf und ab zu rollen. Seine Augen sahen aus wie die kleinen Sichtfenster in einem Glücksspielautomaten, in denen in schneller Folge Kirschen und Zitronen mit Spielkartenmotiven wechselten. Gleichzeitig spürte Evelyn, wie eine ungesunde Wärme in ihr aufstieg wie die Vorboten einer fiebrigen Erkältung. Die Temperatur im Zimmer 7 schien um ein paar Grad gestiegen zu sein. Sie wusste aber nicht, ob das tatsächlich so war, oder ob es ihr nur so vorkam. Außerdem bemerkte sie einen schwachen Chlorgeruch, der sie an Besuche im Hallenbad erinnerte. Sollte Manfred bisher noch ein Minimum dessen mitbekommen haben, was Evelyn zu ihm gesagt hatte, jetzt war er endgültig abgedriftet, war in seine Zwischenwelt abgetaucht, in der er für niemanden erreichbar war. Evelyn nahm an, dass er träumte, träumte mit offenen Augen, Augen, die flatterten wie die einer wahnsinnig gewordenen Trickfilmfigur. Wenn er seine Momente hatte, fürchtete sie sich vor ihm. So wie damals, als er diesen Unfall gehabt hatte, wie sie es für sich selbst nannte. Nur, damals war es kalt gewesen, nicht warm wie im Moment. Und so schrecklich sie den Gedanken fand, ein Teil von ihr wusste, dass es gut war, dass Manfred hier war, in diesem Raum, an diesen Rollstuhl gebunden. Nicht schön, aber richtig, besser so! Sicherer.
„Gib Antwort!“, schrie sie ihn plötzlich an, „antworte mir!“ Ihre Finger umklammerten die verchromten Armlehnen ihres Stuhles, bis ihre Knöchel weiß wurden. „Warum tust du das?“ Sie begann hemmungslos zu weinen. Wovor sollte sie auch Hemmungen haben?
„Hör doch damit auf! Wach auf!“, flehte sie die menschliche Kleiderpuppe im Rollstuhl an, aber im Zimmer 7 blieb es still.
4
Juni 1968
Dass es unbedingt ein Klappfahrrad sein musste, war auf Papas Mist gewachsen. Klappräder waren in letzter Zeit der Trend, man sah sie in der Zeitungswerbung und bei Lippmann, dem Fahrrad-Fachhändler in Essen-Katernberg (der Ur-Einwohner sagte Kaddernberch) konnte man sie im Schaufenster bewundern. Klappräder hatten den Vorzug, dass man sie mit wenigen Handgriffen auf ein handliches Format bringen und problemlos auch mit dem Auto transportieren konnte. In Wahrheit erforderte das Zusammenklappen doch einiges mehr an Geschick im Umgang mit den passenden Schraubenschlüsseln. Der praktische Nutzen eines Klappfahrrades für ihn persönlich erschloss sich Manfred auch insofern nicht, dass sein Vater Georg Schuster Zeit seines Lebens weder ein Auto noch einen Führerschein besessen hatte. Das traf ebenfalls sowohl auf seine Ehefrau Elfriede, Manfreds Mutter, als auch auf Omma und Oppa zu. Damals gab es auch im erweiterten familiären Kreis nicht ein einziges Automobil. Aber Klappräder waren nun mal ungemein praktisch, das hatten sie schließlich auch in der Zeitung geschrieben. Vielleicht hatten auch Arbeitskollegen dazu geraten. So war also die unverhandelbare Entscheidung durch Georg Schuster gefallen: „Wenn der Junge ’n Farratt will, krichter ’n K…K…Klappratt! Schluss!“
Es muss dabei erwähnt werden, dass Georg Schuster seinem Sohn durchaus wohlgesonnen war und ihm von Herzen ein Fahrrad gönnte. Manfreds Freund Rainer Bönnes, der im Haus neben Omma und Oppa wohnte, hatte immerhin schon seit einiger Zeit ein eigenes Fahrrad, und wenn sein Sohn auch eines bekam, sollte es auf jeden Fall auf dem neuesten Stand sein.
Manfred hatte am Anfang in einem gemäßigten Umfang versucht, Einspruch zu erheben, weil ein Klapprad mit seinen verhältnismäßig kleinen Rädern nach seiner Auffassung nicht gerade cool aussah (wobei der Begriff cool in den Sechzigern in Deutschland noch nicht sehr gebräuchlich war), dann war er allerdings angesichts der stimmlichen Dominanz des Vaters zu dem Schluss gekommen, dass ein Klapprad immerhin besser war als gar kein Fahrrad.
Bezahlt hatten das Klapprad Omma und Oppa, und Manfred hatte es zu Weihnachten vom Christkindchen bekommen, an das er nicht mehr glaubte, obwohl er sich seinen Glauben länger bewahrt hatte als die meisten Klassenkameraden. Einmal, vor Jahren, hatte er sich zu Hause bitterlich über Klassenkameraden beschwert, die die Behauptung aufgestellt hatten, das Christkindchen gäbe es überhaupt nicht.
Da Weihnachten bekanntermaßen in einer Jahreszeit stattfindet, die nicht gerade zu Radtouren einlädt, hatte es bis Ende April gedauert, bis Manfred mit dem Oppa und Rainer Bönnes das Klapprad erstmalig auf dem Kaddernberger Marktplatz ausprobiert hatte. Fahren lernen war kein Problem gewesen. Man musste nur sehen, dass das Rad in Bewegung kam, dann kippte man auch nicht um. Und das Prinzip des Lenkens ergab sich von selbst.
In den folgenden Wochen und Monaten ersetzte Manfred die aufgrund der kleinen Räder nur mangelhafte Coolness durch umso cooleres Zubehör wie neongrüne Handgriffe, Aufkleber, Reflektoren und bunte Filzringe, die man um die Radnaben schlang, wo diese schrill aussahen und gleichzeitig die Naben beim Fahren blank polierten.
Den knapp halbstündigen Fußmarsch zwischen seinem Zuhause in Schonnebeck und Omma und Oppa in Kaddernberch ersetzte Manfred nun durch eine zehnminütige Radfahrt, die auf besonderen Wunsch einer einzelnen Mutter überwiegend auf den Bürgersteigen stattfand. Oft musste er vor dem Bahnübergang warten, wenn der Schrankenwärter in dem würfelförmigen Backsteinhäuschen die Schranken herunterließ (was er meistens eine gefühlte halbe Stunde vor Ankunft des Zuges tat), damit die Werkslokomotive, eine rostrot gestrichene Diesellok, wieder einmal eine endlose Kette aus mit Koks beladenen Güterwaggons über die Gelsenkirchener Straße ziehen konnte.
Kurz vor dem Abzweig Katernberg, wo die Linie 7 aus Fahrtrichtung Innenstadt kommend Richtung