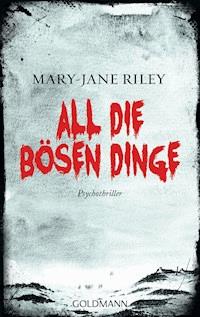
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alex Devlin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
„Der merkwürdig süßliche Geruch raubte ihr den Atem. Langsam ging sie in die Hocke und hob den Deckel an. Tote Augen starrten ihr entgegen. Im Koffer lag ein kleiner Junge in einem blauen „Thomas, die kleine Lokomotive“- Schlafanzug.“ – Im englischen Suffolk verschwinden die vierjährigen Zwillinge Harry und Millie, während sie bei ihrer Tante, der Journalistin Alex, zu Besuch sind. Harrys Leiche wird gefunden, Millies Schicksal bleibt ungeklärt. Ein Albtraum für Alex und ihre Schwester. Ein Albtraum, der fünfzehn Jahre später neu beginnt, als klar wird, dass damals zwei Unschuldige für die Tat verurteilt wurden. Alex ermittelt auf eigene Faust – und macht eine grauenvolle Entdeckung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Ähnliche
Buch
Im englischen Suffolk verschwinden die vierjährigen Zwillinge Harry und Millie, während sie bei ihrer Tante, der Journalistin Alex, zu Besuch sind. Harrys Leiche wird gefunden, Millies Schicksal bleibt ungeklärt. Ein Albtraum für Alex und ihre Schwester Sasha, die ohnehin mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Ein Albtraum, der fünfzehn Jahre später neu beginnt, als klar wird, dass damals zwei Unschuldige für die Tat verurteilt wurden. Alex ermittelt auf eigene Faust – und macht eine grauenvolle Entdeckung ...
Autorin
Mary-Jane Riley hat viele Jahre lang als Journalistin und Talkmasterin beim BBC gearbeitet und sich in dieser Zeit immer wieder mit spektakulären Verbrechensfällen befasst. Ihre Kurzgeschichten wurden in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, bevor sie ihren ersten Roman »All die bösen Dinge« verfasste. Mary-Jane Riley ist verheiratet, sie hat drei Kinder und lebt im ländlichen Suffolk. Mehr unter: www.facebook.com/maryjanerileyauthor.
MARY-JANE RILEY
All die
bösen Dinge
Roman
Aus dem Englischen
von Sibylle Schmidt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »The Bad Things« bei Killer Reads, an imprint of HarperCollins Publishers, London.
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Mary-Jane Riley
Copyright © dieser Ausgabe 2016 by Wilhelm Goldmann Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagbild: FinePic®, München
Redaktion: Friederike Arnold
LT · Herstellung: Str.
Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-16657-1V002
www.goldmann-verlag.de
Für
Kim, Edward, Peter und Esme
VOR FÜNFZEHN JAHREN
Der Gestank war grauenvoll. Als Kate in die Hocke ging und den Reißverschluss aufzog, zerriss er, und die Metallzähne ritzten ihr die Haut auf. Sollte sie lieber auf die Spurensicherung warten?, fragte sie sich nervös. Womöglich vernichtete sie Beweise. Sie hob den Deckel des Koffers an. Die blinden verwesenden Augen eines kleinen Jungen starrten sie an. Er trug einen Schlafanzug mit einem Muster von Thomas, der kleinen Lokomotive, und war so zusammengedrückt worden, dass er in den Koffer passte. Es sah aus, als sei der Junge eingepackt worden für eine Reise in den Tod.
GEGENWART
1
Alex Devlins Leben implodierte zum zweiten Mal an einem jener trüben grauen Tage, an denen der Frühling in Suffolk noch in weiter Ferne zu sein schien. Draußen hasteten bleiche Menschen gebückt die Straße entlang, vermutlich um Arbeit und Einkäufe so schnell wie möglich zu erledigen und sich dann in einem Café an der High Street aufzuwärmen. Der Februar in Sole Bay konnte gnadenlos sein.
Die dritte Tasse Kaffee dieses Morgens in Händen, stand Alex in der Küche ihres kleinen Reihenhauses und versuchte, ihre verkrampften Schultern zu lockern. Um sich zu entspannen, schaltete sie das Radio ein.
»Und jetzt die Nachrichten mit Susan Rae.«
Alex hoffte, dass sich die Arbeit an ihrem Artikel über einen Kripomann, der undercover in der osteuropäischen Mafia ermittelte, gelohnt hatte. Wieder einmal war Alex nachts um vier aufgewacht. Es war furchtbar gewesen, um diese Zeit erschien ihr alles so aussichtslos. Wie üblich machte sie sich Sorgen wegen ihrer finanziellen Lage und den Problemen ihres sechzehnjährigen Sohnes. Schließlich hatte sie beschlossen, sich nicht länger herumzuwälzen, sondern zu arbeiten.
»Fünf Menschen sind bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich bei hohem Verkehrsaufkommen und dichtem Nebel auf der M25 …«
Sie hätte gerne ein bisschen Zeit für sich gehabt, bevor Gus, ihr muffeliger Sohn, wieder auf der Bildfläche erschien und miese Stimmung verbreitete.
Zu spät.
»Also?« Gus starrte sie aggressiv an, die Arme trotzig vor der Brust verschränkt.
Die Debatte vom Vorabend wurde offenbar fortgesetzt, als sei keine Zeit vergangen. Alex hatte sich der Hoffnung hingegeben, dass Gus das Thema über Nacht vielleicht vergessen hätte. Weit gefehlt.
Sie rieb sich die Stirn, um die Kopfschmerzen zu vertreiben, die hinter einem Auge zu pulsieren begannen. »Gelassen bleiben« war Alex’ Mantra, seit sich ihr lieber blondlockiger kleiner Junge vor zwei Jahren in dieses mürrische hormongesteuerte Wesen verwandelt hatte.
»Wie verlautet, soll die ukrainische Opposition die Besetzung des Rathauses in Kiev beendet haben …«
»Nein, Gus, es wird nichts aus dieser Skireise mit der Klasse«, sagte Alex so schonend wie möglich. »Tut mir total leid, aber unsere Lage ist über Nacht nicht besser geworden.« Sie hätte sich natürlich gewünscht, Gus diesen Wunsch erfüllen zu können. Doch es war einfach zu wenig Geld da, und Aufträge kamen auch nicht gerade in Hülle und Fülle rein. Aber letztlich waren nicht nur die Finanzen der Grund. Alex fiel es schwer, ihren Sohn loszulassen und ihm die nötige Freiheit zu geben, um flügge zu werden. Das spürte Gus, und er rebellierte dagegen.
»Warum nicht?«, insistierte er.
Alex wandte sich zum Kühlschrank und holte Milch und Butter heraus. »Cornflakes oder Toast?«, fragte sie, in der Hoffnung, Gus’ Stimmung würde sich mit der Aussicht auf das Frühstück verbessern.
»Mum. Diese Reise ist mir echt wichtig. Alle meine Freunde fahren mit. Und die Plätze müssen jetzt gebucht werden. Du willst doch nicht, dass ich den Anschluss verpasse und als Außenseiter dastehe, oder?«
Alex nahm die Brotpackung aus dem Kasten und steckte ein Stück Weißbrot in den Toaster. »Du kennst die Gründe, Gus.«
»Ach, das ist doch Scheiße!«, schrie er so laut, dass Alex zusammenzuckte. »Nie darf ich irgendwas unternehmen und Spaß haben! Willst du vielleicht, dass ich irgendwann keine Freunde mehr habe?«
Schweigend füllte Alex den Wasserkessel und nahm einen Becher und einen Teebeutel aus dem Schrank. Dann wartete sie, bis das Wasser kochte und ihre Wut sich gelegt hatte. Als sie sich die Haare aus dem Gesicht strich, fiel ihr auf, dass die dringend getönt und geschnitten werden mussten. »Du weißt genau, dass das nicht stimmt, Gus. Ich will natürlich, dass es dir …«
»Ach, vergiss es, Mum.«
»Die Arbeitslosenzahlen sind weiter gesunken, und der Premierminister sagte …«
Gus sah jetzt so frustriert aus, dass Alex sich sofort miserabel fühlte. Plötzlich kam ihr der Gedanke, dass sie Gus unbedingt mehr Freiheit lassen sollte. Sie musste mit den Konflikten der letzten Monate innerlich abschließen und dankbar sein, dass Gus nicht von der Schule geflogen war – Doperauchen und mit anderen in einem gestohlenen Auto herumzukariolen stand nicht hoch im Kurs bei der Schulleitung.
»Sag mal, wann brauchst du das Geld?«, fragte sie wider besseres Wissen.
»Man kann immer noch in Raten zahlen. Fünf sind es jetzt, glaube ich.« Gus sah schlagartig hoffnungsvoll aus, und Alex versuchte, das flaue Gefühl im Magen zu ignorieren, das sich beim Thema Geld immer sofort einstellte. »Du musst nicht alles auf einmal zahlen«, fügte Gus hinzu. »Mum?«
Der Wasserkessel pfiff, und der Toast sprang heraus. Zu dunkel. Alex goss das Wasser auf den Teebeutel und schabte den Toast ab, wobei sie sich bemühte, nicht an die unbezahlten Rechnungen für Strom, Gas und Telefon zu denken. »Bring mir mal den Brief. Ich schau, was ich tun kann.« Sie drückte den Teebeutel innen an der Tasse aus und ließ den Löffel in die Spüle fallen.
Ein Lächeln trat auf Gus’ Gesicht, und der mürrische Flunsch verschwand – zumindest fürs Erste. »Du bist die Beste, Mum.«
»Eine Frau, die wegen Mordes an zwei Kindern vor fünfzehn Jahren zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, wurde vom Obersten Gerichtshof in London freigesprochen. Jackie Wood war …«
Alex erstarrte. Großer Gott, Sasha, dachte sie. O Gott, o Gott.
2
Detective Inspector Kate Todd ließ sich im Wartezimmer nieder und blätterte in einer Illustrierten. Dem blöden Gerät an der Wand, das nach ihren Daten in Großbuchstaben verlangte, hatte sie bestätigt, dass sie diejenige war, die einen Termin hatte. Und garantiert fing sie sich jetzt einen abscheulichen Virus ein, während sie hier herumhockte. In der Ecke murmelte der Fernseher, und Kate versuchte, sich auf die Zeitschrift zu konzentrieren. Alles voller Kleinkinder. Die richtige Ernährung für Ihr Baby. Wie können Kinder schlafen lernen. Alles voller elender Babys. Kate schmiss die Zeitschrift auf den niedrigen Holztisch, worauf die Frau neben ihr die Stirn runzelte.
»Entschuldigung«, sagte Kate.
Die Frau lächelte ein wenig und zuckte die Achseln. »Diese Hefte sind meist todlangweilig. Sind zum Teil schon Jahre alt. Ich lese hier grade was über Sommerurlaub vor drei Jahren.«
»Hmm. Ja«, antwortete Kate einsilbig. Sie hatte keine Lust auf ein Gespräch. Sie wollte den Termin möglichst schnell hinter sich bringen und zurück aufs Revier. Wo es zurzeit allerdings auch nicht gerade spannend zuging. Keine größeren Fälle. Lediglich geplante Razzien in einem gottverlassenen Kaff in den Fens, wo man den Handel mit irgendwelchen armen Menschen unterbinden wollte, die man dorthin geschafft hatte, wo sie nun unter verheerenden Bedingungen hausten – Cannabis-Lager oben, drei oder vier Familien im Untergeschoss. Das Problem bei den geplanten Razzien war nur, dass nicht nur die National Crime Agency, sondern auch Gott weiß wer daran beteiligt werden musste. Würde wahrscheinlich ein übles Chaos werden, diese Aktion.
Kate sah sich im Warteraum um. Sie kannte niemanden hier und anscheinend auch niemand sie. Das war der Vorteil, wenn man in Ipswich arbeitete, aber in einer Kleinstadt im Umkreis wohnte – die Wahrscheinlichkeit, hier auf Kollegen zu stoßen, war relativ gering.
»Meine Kleine hier …«, sagte die Frau. Als Kate sich ihr wohl oder übel zuwandte, bemerkte sie das Bündel in den Armen der Frau. Kate fragte sich, wieso sie das Baby nicht vorher schon bemerkt hatte. »Wurde mit einem Loch im Herzen geboren«, fuhr die Frau fort. »Musste gleich operiert werden, obwohl sie noch so winzig war. Ich wusste nicht, ob sie überleben würde.«
Kate spürte plötzlich den vertrauten Anflug von Angst in der Brust.
»Deshalb müssen wir ganz oft hierher zum Nachgucken kommen, nicht wahr, mein Schätzchen?«, säuselte die Frau dem Baby zu und betrachtete es mit einem innigen Lächeln.
Die Angst umschlang jetzt Kates Herz und erzeugte Druck. Wer behauptete, das Herz sei nur ein Organ, hatte einfach keine Ahnung. Kate holte tief Luft und bemühte sich um eine freundliche Miene.
»Haben Sie auch Kinder?«, fragte die Frau, während sie mit dem Finger die Wange des Babys streichelte.
»Nein«, antwortete Kate, wobei sie sich offenbar so schroff anhörte, dass die Frau errötete. »Tut mir leid«, sagte sie.
»Kein Problem.« Kate griff nach einer Wohnzeitschrift und blätterte sie unkonzentriert durch; Vorschläge, wie man sein Wohnzimmer besser einrichten konnte, welche Farben man für einen Wintergarten nach Süden benutzen sollte und Bilder von dem wunderschönen Heim eines drittrangigen VIPs. Dennoch fiel es ihr schwer, nicht an den Krach zu denken, den sie am Vorabend mit ihrem Mann gehabt hatte. Wieder einmal hatten sie sich über das gleiche Thema, das in mehr oder minder heftiger Form seit zehn Jahren für Streit sorgte, in die Haare gekriegt. Diesmal hatte Kate gerade das Licht ausschalten wollen, als Chris gesagt hatte: »Ich würde mir einfach wünschen, dass du irgendwo Rat suchst.«
Kate war in der Bewegung erstarrt. Sie hatte den ganzen Tag Aktenarbeit erledigt, war hundemüde und wollte einfach nur noch schlafen. Und jetzt sprach Chris dieses eine Thema an, das garantiert dafür sorgen würde, dass eine Ewigkeit nicht mehr an Schlaf zu denken war.
Erbittert starrte Kate auf ihren Mann, der ruhig atmend, mit auf der Brust verschränkten Armen und geschlossenen Augen im Bett lag. Er hatte verdammt noch mal schon wieder die Augen zugemacht. Was er grundsätzlich tat, damit sie nicht vernünftig mit ihm reden konnte. Sie bemerkte Furchen an seinem Mund, die neu waren, und hätte sie am liebsten berührt. Ihr Ärger verflog. Chris liebte sie bedingungslos, und dafür liebte Kate ihn. Er war ein ruhiger Mann, der ausgleichend auf sie wirkte. Und sie fand es wunderbar, ihm bei der Arbeit zuzusehen, wenn er mit seinen rauen, schwieligen Händen diese zauberhaften Gegenstände aus Holz erschuf. Kate liebte ihren Mann. Aber sie hatte eben ihre Bedingungen.
»Chris«, sagte sie, auf einen Ellbogen gestützt. Sie spürte, dass sie jetzt handeln, ihm ein wenig Hoffnung geben musste.
Er schlug ein Auge auf, zog sie in seine Arme. »Schatz, ich weiß, wie dir zumute ist, aber …«
Nein, das wusste er nicht. Er wusste nicht, dass ihr Mund trocken wurde und ihr Herz unangenehm hämmerte, sobald sie daran dachte, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen und dann für einen Menschen sorgen zu müssen, der komplett abhängig von ihr sein würde. Sie hatte Angst vor der emotionalen Bindung – wenn das Kind sich irgendwann von ihr löste, würde ihr das Herz brechen. Oder noch schlimmer: Falls dem Kind etwas zustieß, würde ihr das Herz sogar aus der Brust gerissen werden. So etwas konnte geschehen. Sie hatte es bei anderen schon erlebt.
»Können wir nicht einfach ein Kind adoptieren?« Schon als sie es aussprach, wusste Kate, dass die Frage nicht ernst gemeint war. Und was Chris antworten würde.
»Aber wir sollten doch erst mal klären, warum wir keine eigenen haben können, findest du nicht?« Seine Stimme war sanft, und Kate spürte, wie sich ihr die Kehle zuschnürte.
»Vielleicht liegt es eben an mir. Vielleicht kann ich gar nicht schwanger werden, weil ich zu alt bin.« Vielleicht allerdings sollte sie auch erst einmal die Pille absetzen.
»Nein, bist du nicht. Und wenn es demnächst nichts wird, können wir alles Mögliche andere unternehmen. Ich denke nur, du solltest dich untersuchen lassen.«
»Sind wir denn so nicht auch glücklich?«, fragte sie, kam sich aber dabei schlecht vor wegen ihrer Unaufrichtigkeit.
»Doch, natürlich.«
»Genüge ich dir nicht?«
»Darum geht es doch gar nicht, Liebling.«
»Ich weiß«, murmelte Kate an seinem Hals. »Ich weiß.«
Als sie morgens aufwachte, war Chris verschwunden – wenn er nachdenken und einen klaren Kopf bekommen wollte, stand er sommers wie winters früh auf und ging laufen.
Sobald die Arztpraxis öffnete, ließ Kate sich einen Termin geben.
Und deshalb saß sie nun hier auf diesem Plastikstuhl und blätterte in Zeitschriften, ohne die Worte wirklich aufzunehmen. Obwohl sie viel lieber im Revier abscheulichen Kaffee aus einem Pappbecher getrunken und dem Geplänkel der Kollegen zugehört hätte.
Das Signal ertönte, und Kate sah ihren Namen auf dem Aufrufdisplay. Sie sprang auf, und die Frau mit dem Baby warf ihr ein aufmunterndes Lächeln zu.
Kate war nervös, weil sie der Ärztin eine Erklärung liefern musste, sich aber noch nichts überlegt hatte. Hastig klopfte sie an die Tür und betrat das Sprechzimmer.
Die junge Ärztin, Dr. Bones, blickte von ihrem Computer auf und lächelte. »Nehmen Sie Platz, Kate. Was kann ich für Sie tun?«
Kate setzte sich und blinzelte. Was sollte sie jetzt antworten?
»Also?«, fragte Dr. Bones.
Kate räusperte sich. »Es geht um Folgendes, Frau Dr. …« Sie unterbrach sich. Sie sah Chris’ liebes Gesicht vor sich und seine Hände, die so fleißig für sie arbeiteten. Er verlangte nichts von ihr – außer dieser einen Sache. »Mein Mann möchte ein Kind«, sagte Kate hilflos.
»Und?«, fragte Dr. Bones ruhig.
»Und ich weiß nicht, ob ich das kann.«
Die Ärztin nickte. »Okay. Sie sind also …«, Dr. Bones warf einen Blick auf ihren Bildschirm, »… achtunddreißig und nehmen die Pille. Es gibt keinen Grund, warum Sie nicht schwanger werden sollten. Heutzutage bekommen viele Frauen ihre Kinder erst später …«
»Das ist nicht das Thema«, sagte Kate. »Ich denke eher, wenn man nicht dafür geschaffen ist, Kinder zu haben, sollte man es auch bleiben lassen.«
Dr. Bones nickte. »Das ist sicher Einstellungssache.« Abwartend legte sie die Hände auf den Tisch.
Was sollte Kate noch sagen? »Ich finde, es gibt so viel Elend auf der Welt, dass ich mir nicht sicher bin, ob es richtig ist, Kinder zu bekommen.«
»Richtig?«
Kate wich dem Blick der Ärztin aus und starrte an die Wand. Dort hingen bunte Kinderzeichnungen, eine Größenmesslatte, Plakate zum Thema gesundes Essen, eine Tabelle für Augentests. Kate ließ den Blick durchs Sprechzimmer schweifen, betrachtete die Kiste mit Spielsachen in der Ecke, den kleinen Stuhl und all die anderen Dinge für Kinder. Sie schluckte, weil sie merkte, dass ihr die Tränen kamen.
»Also schwanger zu werden, nur weil ich … weil wir ein Kind wollen. Das kommt mir so selbstsüchtig vor, wissen Sie.« Kate zuckte die Achseln. Sie fand ihr Gerede völlig sinnlos.
»Wie denkt denn Ihr Mann darüber?«
»Chris? Ach, der ist völlig versessen auf Kinder. Ich meine, so deutlich sagt er das nicht, aber ich weiß, dass es so ist.«
»Aber Sie sind nicht sicher, ob Sie es wollen?«
»Nein.« Herrgott noch mal, jetzt stiegen ihr die Tränen doch in die Augen. Sie blinzelte wütend.
»Ich weiß nicht«, sagte die Ärztin behutsam, »wie ich Ihnen helfen kann.«
»Ich bin nur hier, weil Chris …« Kate verstummte und stand auf. »Tut mir leid, ich weiß eigentlich nicht genau, weshalb ich hergekommen bin, ich …«
»Bitte setzen Sie sich wieder, Kate.«
»Nein, ich muss zurück zur Arbeit. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.«
Dr. Bones blickte auf ihren Computerbildschirm. »Sie haben einen anstrengenden Beruf, Kate. Kommen Sie da gut zurecht?«
»Ja.«
»Hören Sie, ich verschreibe Ihnen ein leichtes Antidepressivum. Sie müssen es nicht nehmen, aber es könnte Ihnen vielleicht helfen. Und ich setze Sie auf die Liste für eine Psychotherapie.«
Kate öffnete den Mund, um zu widersprechen.
Dr. Bones hielt die Hand hoch. »Es ist nur eine Warteliste. Denken Sie mal drüber nach. Es könnte Ihnen vielleicht guttun, mal mit jemand anderem zu reden als mit Ihrem Mann. Mit einer außenstehenden Person. Und lassen Sie sich bitte einen neuen Termin bei mir in einem Monat geben.«
Kate gelang es nur noch zu nicken.
Draußen vor dem Sprechzimmer lehnte sie sich an die Wand und rang um Atem. Die Luft war furchtbar stickig. Gut, es war ein Fehler gewesen hierherzukommen, aber zumindest hatte sie es hinter sich gebracht und konnte Chris davon berichten. Sie sei etwas erschöpft, hätte die Ärztin gesagt. Sicher war es gut, sich erst einmal eine Atempause zu verschaffen. Dann würde sich alles von selbst lösen, nicht wahr?
Kate eilte den Flur entlang ins Wartezimmer zurück. Zum Glück war die Frau mit dem Baby nicht mehr da. Als Kate auf die Ausgangstür zusteuerte, rief jemand hinter ihr: »Ms Todd?«
Kate drehte sich um. Es war die Frau von der internen Apotheke.
»Sie können Ihr Medikament gleich mitnehmen«, sagte sie. »Setzen Sie sich doch noch einen Moment.«
»Okay. Danke.«
Kate blickte auf den Fernseher in der Ecke und fuhr hoch, als sie den Text vom Newsticker am unteren Bildschirmrand las.
Jackie Wood aus Haft entlassen, Oberster Gerichtshof gibt Revision statt.
Sie starrte auf die Bilder. Jackie Wood stand auf der Treppe des Gerichtsgebäudes, umringt von Reportern mit Mikros und Kameras, neben ihr ein selbstgefällig wirkender Mann, der irgendetwas sagte, was Kate nicht hören konnte. Was auch nicht nötig war, denn es gab keinen Zweifel daran, was sich hier abspielte. Jackie Wood, gemeinsam mit einer weiteren Person verantwortlich für den Tod zweier kleiner Kinder, war freigesprochen worden.
»Ms Todd? Ihr Medikament.«
Mechanisch stand Kate auf, ging zu der Durchreiche und nahm die Papiertüte in Empfang, die ihr von der Apothekerin gereicht wurde.
Dann verließ Kate die Praxis, stieg in ihr Auto und ließ die Stirn aufs Lenkrad sinken.
3
Sasha war immer das Problemkind gewesen, das dauernd etwas brauchte und ihren Eltern ständig Sorgen machte. Die Tochter, die von den Eltern mit Samthandschuhen angefasst wurde. Von klein auf hatte Alex gelernt, dass man mit Sasha schonend umgehen müsse. Sie war nur zehn Monate jünger als Alex, aber in ihrer Kindheit hatte sich Alex oft gefühlt, als sei sie zehn Jahre älter als Sasha. »Du musst auf deine kleine Schwester aufpassen«, hatte man Alex eingeschärft. Dieses schutzbedürftige Gehabe, das Sasha regelrecht zu genießen schien, hatte Alex schon ihr Leben lang geärgert.
Ihre Schwester war gertenschlank und hatte feine blonde Locken, die sich allerliebst um ihr herzförmiges Gesicht ringelten. Wer die beiden in jüngeren Jahren zusammen sah, konnte nie glauben, dass sie Schwestern waren, denn Alex war eher klein und hatte dunkle glatte Haare. Und sie hatte von ihrem Vater den leicht bräunlichen Teint geerbt, den sie – wenn sie sich selbst gerade mal wohlgesonnen war – »olivfarben« nannte. Im Gegensatz zu ihrer Schwester war Alex keine Schönheit.
Doch inzwischen war auch deren Schönheit verflossen. Sasha war zwar noch immer feingliedrig, blond und blauäugig, wirkte aber ausgezehrt, ihre Haare hingen meist strähnig und kraftlos herab, und ihr Blick war stumpf. Außerdem trug sie immer langärmlige Sachen, um die Narben an den Armen zu verbergen.
Sasha hatte den Tod ihrer Zwillinge nie verkraftet. Die beiden waren vier Jahre alt gewesen, als sie verschwunden waren – Harry und Millie. Die beiden hatten die blonden Haare und blauen Augen von ihr geerbt. Harry war ein typischer Junge gewesen – wild und ungestüm und immer schmutzig. Millie war dem Wesen nach zwar genauso gewesen, hatte aber so mädchenhaft und niedlich ausgesehen, dass jeder sie in den Arm nehmen wollte. Sie hatte ein sonniges Gemüt gehabt und fast immer gelächelt. Beide waren abenteuerlustige, aufgeweckte und liebevolle Kinder gewesen. Harry war einige Wochen später gefunden worden, Millie nie.
Das Begräbnis von Harry war grauenvoll gewesen. Der kleine weiße Sarg auf der Schulter von Sashas Mann Jez und all die Trauernden, die jedwedem Gott, an den sie glaubten, dafür dankten, dass ihnen ein solches Schicksal erspart blieb. Alex hatte sich damals geschworen, ihren eigenen kleinen Sohn immer zu beschützen. In diesem Sommer hatte es – unytpisch für die Region – fast die ganze Zeit geregnet. Die Tränen Gottes, hatte Alex jemanden sagen hören.
Sie bezweifelte, dass Sasha und sie seither noch an einen Gott glaubten.
Ihre Eltern wirkten bei der Bestattung so erschüttert, als könnten sie nicht begreifen, wie ihnen so etwas widerfahren konnte. Die Kirche, St Mary Magdalene, war ein wunderschöner mittelalterlicher Ort der Andacht im ländlichen Suffolk. Sasha und Jez hatten beschlossen, Harry in der Gemeinde der Eltern bestatten zu lassen, weil Sasha es in Sole Bay nicht ausgehalten hatte. Sie hatte sich einen stillen Ort für Harry gewünscht, an dem Vögel zwitscherten und die Sonne durch das dichte Blattwerk der Bäume fiel und die Erde wärmte. Deshalb hatte sie sich für das Dorf entschieden, in dem ihre Eltern lebten, seit die Töchter zu Hause ausgezogen waren. Jemand – wahrscheinlich fürsorgliche Frauen aus der Kirchengemeinde – hatte die Kirche mit Weidenzweigen, Geißblatt und Rosen geschmückt, die ihren süßen Duft verströmten. Harry wurde in dem kleinen Friedhof hinter der Kirche begraben, und es brach einem fast das Herz, den kleinen Erdhügel zu sehen, unter dem sein Sarg für immer ruhen würde.
Aber zumindest hatten sie Harry bestatten können; nichts über das Schicksal von Millie zu wissen war unerträglich, bis heute.
Und jetzt musste Alex schnellstens zu ihrer Schwester, damit sie sich nicht wieder ritzte. Sasha wohnte noch immer in dem Haus, in dem sie mit Jez und den Zwillingen gelebt hatte. Sie könne es nicht verlassen, hatte sie gesagt. Alex fand das schädlich für Sasha und hatte sich immer wieder bemüht, sie zu sich zu holen oder zumindest zum Umzug an einen Ort zu überreden, der nicht von Erinnerungen überfrachtet war. Doch Sasha weigerte sich hartnäckig. »Und wenn Millie zurückkommt?«, sagte sie jedes Mal. »Wenn Millie zurückkommt und ich bin nicht da?« Eigentlich hätte Alex einwenden sollen, dass Millie bei ihrem Verschwinden vier Jahre alt gewesen sei und den Weg nach Hause gar nicht finden könne, selbst wenn sie noch am Leben wäre. Doch natürlich hielt sie den Mund. So etwas konnte man zu Sasha nicht sagen. Aber zumindest lebte Alex im selben Ort und konnte sich um ihre Schwester kümmern. An guten Tagen, wenn Alex sich fit fühlte, joggte sie in acht Minuten zu Sashas Haus.
Heute war kein guter Tag – zu wenig Schlaf und zu wenig Essen –, aber das Adrenalin würde ihr bestimmt Beine machen.
»Ich muss los, Gus«, rief Alex und lief zur Tür. »Iss in Ruhe deinen Toast. Im Schrank steht ein neues Glas Erdnussbutter.«
»Was ist denn, Mum?«
»Sag ich dir später.« Hektisch zog Alex ihren Mantel an und knöpfte ihn zu. »Ich muss zu Tante Sasha, okay?«
Gus zuckte die Achseln. »Klar.«
Das Radio plapperte weiter.
Die Straßen waren feucht, aber zum Glück nicht rutschig. Alex flitzte zwischen den Leuten auf dem Gehweg hindurch. Was war bloß mit dem Opferschutzbeauftragten los? Der hatte behauptet, so schnell werde keine Entscheidung fallen. Sie hätte Sasha doch darauf vorbereiten müssen, dass Jackie Wood eventuell freigelassen würde. Was war passiert?
Zwei schwatzende alte Frauen mit grell rotgrün gepunkteten Einkaufstrolleys blockierten schwatzend den gesamten Gehweg. Alex hasste diese Dinger, die unaufmerksame Fußgänger im Handumdrehen zum Stolpern brachten. Sie musste auf die Straße ausweichen und wurde von einem Auto angehupt, das sie beinahe gestreift hätte.
Dann blieb eine Frau mit einem von diesen klobigen Kinderwagen, mit denen man über Stock und Stein kariolen konnte, so abrupt stehen, dass Alex fast gestürzt wäre. Eine Horde kreischender und lachender Schulkinder, die sich gegenseitig schubsten, tauchte plötzlich vor ihr auf. Alex hätte sie am liebsten angeschrien, drängte sich aber wortlos durch die krakeelende Menge.Es war nicht mehr weit, nur noch um die Ecke.
Sie bog in Sashas Straße ein.
Inzwischen war Alex total außer Atem und hätte eigentlich stehen bleiben müssen, wollte aber keine Zeit verlieren.
Sie schlug einen Bogen um zwei schwarze Mülltonnen, von denen eine so überfüllt war, dass Kartons, Cornflakes-Schachteln und Hühnerknochen rundherum am Boden lagen. Jetzt nur noch die Straße überqueren, an den öffentlichen Toiletten vorbei. Sie mühte sich mit dem sperrigen Riegel am Gartentor ab und nahm sich vor, Jez zu bitten, dass er ihn reparierte. Dann sprintete sie die fünf Stufen zum Eingang hoch, schloss hastig auf und fiel fast in den Flur.
Sasha saß im Wohnzimmer, das früher einmal mit Leben und Fröhlichkeit erfüllt gewesen war, jetzt aber nur noch bedrückend wirkte mit seiner verblassten blauweiß gestreiften Tapete und dem abgewetzten beigen Teppichboden. Ein kleiner Heizstrahler im offenen Kamin bemühte sich, etwas Wärme zu verbreiten. Dicht vor dem Fernseher in der Ecke stand das Sofa. Die Luft roch muffig und war stickig, was darauf hinwies, dass Sasha sich wieder in besonders schlechtem Zustand befand. An die dreißig Fotos von den Zwillingen in unterschiedlichen Stadien ihrer Entwicklung waren überall im Zimmer verteilt. Eine Waldlichtung war auf einem Foto zu sehen. Auf einer karierten Decke stand der Picknickkorb, gefüllt mit Schinken-Sandwiches ohne Rinde, Apfel-, Mandarinen- und Bananenstücken. Und Limonade, bunt glasierte Kekse und Erdbeerjoghurt. Es war ein wunderbares Picknick gewesen. Ein paar Tage später waren Harry und Millie spurlos verschwunden.
Im Fernseher liefen die BBC-Nachrichten; das rote Logo war der einzige Farbfleck im Raum. Jackie Wood freigesprochen, brüllte die Schlagzeile Alex förmlich ins Gesicht, gefolgt von Fotos: Wood auf der Treppe des Gerichtsgebäudes, lächelnd und winkend, während ihr Anwalt eine Erklärung verlas. Alex fühlte sich von den Worten bombardiert.
»Fünfzehn Jahre in Haft … unschuldig … ein neues Leben beginnen …«
Worte aus dem Mund einer Schlange.
Und die Reporter schrien Fragen: »Wie haben Sie das Leben im Gefängnis ertragen?«
»Was wollen Sie jetzt machen?«
»Wollen Sie auf Schmerzensgeld klagen?«
Einige Worte gingen in Verkehrslärm und Hupen unter.
Wood lächelte selbstgefällig, und Alex hätte sich am liebsten in den Fernseher gestürzt und den dürren Hals der Frau gewürgt. Wenigstens sah sie ziemlich elend aus – bleich und dünner, als Alex sie in Erinnerung hatte. Rock und Jacke wirkten schäbig und billig. Den Anwalt hätte Alex auch sehr gerne gewürgt, obwohl dessen Hals weniger dürr war, und dieses Bedürfnis war so körperlich, dass sie geradezu spürte, wie sie dem Mann die Luft aus dem Leib presste. Würde der nun auch noch dafür sorgen, dass Wood für ihre Untat Geld bekam? In dritter Instanz war es der Frau gelungen freizukommen. Dreimal war Widerspruch gegen das Urteil eingelegt worden, und durch die Medienkampagne eines Fernsehproduzenten und die erwiesene Unglaubwürdigkeit eines Sachverständigen hatten sich zwei von drei Richtern des Obersten Gerichtshofs davon überzeugen lassen, dass Woods Verurteilung wegen Entführung und Mord an den Zwillingen nicht rechtens gewesen war. Jackie Wood war wieder auf freiem Fuß. Zumindest weilte der Komplize, Martin Jessop, nicht mehr unter den Lebenden. Er hatte sich nach wenigen Wochen im Gefängnis erhängt.
»Das war alles, was ich zu sagen habe, danke schön.« Wood wandte sich ab und ging ins Gerichtsgebäude zurück. Die nächsten Nachrichten wurden verlesen, während Alex und Sasha stumm auf den Bildschirm starrten.
Dann klingelte das Telefon, und beide zuckten erschrocken zusammen.
Alex dachte rasch nach, dann nahm sie ab.
»’allo?«, sagte sie in einem wenig gelungenen Versuch, einen französischen Akzent nachzuahmen.
»Spreche ich mit Sasha Clements?« Die atemlose, leicht schrille Stimme eines Journalisten, der das erste Interview ergattern wollte.
»Non.«
»Könnte ich bitte mit Sasha Clements sprechen?«
»Non. Sie iist weggesoggen vor zwei Jahre.« Alex konstatierte, dass diese Nummer wohl nicht einmal mehr fürs Schülertheater gereicht hätte, in dem sie früher aufgetreten war.
»Oh.« Die Enttäuschung in der Stimme des Mannes war nicht zu überhören. »Sie haben wohl nicht zufällig ihre neue Telefonnummer?«
»Tut mir leid, non.«
»Wissen Sie, wo Sasha Clements hingezogen ist?«
»Iisch glaube, nach Spanien.«
»Spanien?«
»Spanien, ja.«
»Oh. Verstehe. Na ja, trotzdem vielen Dank.«
»Plaisir.«
Alex beendete das Gespräch und legte das Telefon auf den Tisch. Beinahe hätte sie laut aufgelacht, weil die Situation so absurd war. Und ob sie ihnen die hungrige Meute mit diesem Auftritt lange vom Hals halten konnte, war auch nicht gesagt.
Nachdem sie den Fernseher ausgeschaltet hatte, nahm Alex ihre Schwester in Augenschein. Sasha schien nicht bemerkt zu haben, dass jemand hereingekommen war und dass der Fernseher nicht mehr lief. Unverwandt starrte sie auf den Bildschirm. Tränen rannen ihr über die Wangen, und sie hatte die Arme um sich geschlungen und die Hände in die Ärmel ihrer Bluse gesteckt – sie waren blutrot.
Beinahe hätte Alex auch zu weinen begonnen, doch sie setzte sich zu ihrer Schwester und legte ihr den Arm um die Schultern. Erschrocken zuckte Sasha zusammen. Alex wartete ab, bis ihr Atem sich beruhigt hatte und ihr Mund nicht mehr so trocken war. Unvermittelt lehnte sich Sasha an ihre Schulter und stieß einen zittrigen Seufzer aus.
»Alex«, flüsterte Sasha, so tonlos wie ein Windhauch. »Ich hätte nie gedacht, dass sie freigelassen wird. Sie haben mir gesagt, die Revision würde scheitern, ganz sicher.«
Alex küsste ihre Schwester auf den Kopf. »Ich weiß, Liebes, ich weiß.«
»Ich hab gedacht, ich hätte es jetzt akzeptiert«, murmelte Sasha, »dass Millie irgendwo vergraben wurde und wir nie erfahren werden, wo.«
Und ich erst, dachte Alex und umfasste Sashas Schultern noch fester.
»Aber jetzt …«
»Wir werden Millie eines Tages finden«, sagte Alex. »Ich verspreche es dir.« Als sie die Worte aussprach, spürte sie die ganze Last dieses Versprechens auf ihren Schultern.
»Ich will nicht, dass du hier bist«, sagte Sasha abrupt. »Du nicht.«
Alex schloss einen Moment die Augen. Sie versuchte, nicht verletzt zu sein, und sagte sich, dass ihre Schwester sich schon seit fünfzehn Jahren so verhielt. Dass sie Alex gar nicht mehr hassen konnte, als sie sich selbst hasste, und dass Sasha es nicht so gemeint hatte.
Ein paar Minuten saßen sie schweigend da. Alex ließ vorsätzlich Zeit verstreichen, dann sagte sie: »Sash? Kann ich mal deinen Arm angucken?«
Achselzucken.
Behutsam hob Alex Sashas Kopf von ihrer Schulter, nahm den Arm ihrer Schwester und streifte den Ärmel hoch. Der Schnitt am Unterarm glitzerte feucht, musste aber diesmal wohl nicht genäht werden. Alex ging in die Küche, füllte warmes Wasser in eine Schüssel, gab Salz hinzu und kehrte mit der Schüssel und einer Küchenrolle ins Wohnzimmer zurück. Dann säuberte sie Sashas Wunde. Zumindest hatte sie aufgehört zu bluten. Alex machte das alles mechanisch, ohne über die Hintergründe nachzudenken – andernfalls wäre sie nicht dazu imstande gewesen.
»Bitte bring mich nicht ins Krankenhaus«, flüsterte Sasha. »Bitte. Sonst spüre ich nichts mehr.« Sie wischte sich mit dem anderen Ärmel übers Gesicht. »Ich muss was fühlen können.«
Alex nickte. »Ist gut. Aber du musst auf dich selbst achtgeben.« Sie biss sich auf die Lippe, weil sie wusste, dass sie Quatsch redete. Niemand konnte ihre Schwester davon abhalten, sich selbst zu verletzen. Alex hatte es weiß Gott schon oft genug probiert. Ihre Eltern wollten nicht wahrhaben, was ihre jüngere Tochter sich antat. Sie hatten es nicht einmal geglaubt, als Sasha in der Klinik bleiben musste, weil sie sich so schlimm geritzt hatte. Und auch nicht, als sie vom Hausarzt in die Psychiatrie eingewiesen wurde, nachdem sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte, was nicht nur Ritzen und ein Hilferuf, sondern ein echter Selbstmordversuch gewesen war. Doch so schlimm hatte Sasha sich seit Monaten nicht verletzt, weshalb Alex sich der Hoffnung hingegeben hatte, ihre Schwester sei auf dem Weg der Besserung.
Sasha sah Alex mit leerem Blick an. »Wie soll ich denn auf mich selbst achtgeben, wenn ich nicht mal auf meine Kinder achtgeben konnte? Wenn die Frau, die dabei mitgeholfen hat, meine Kleinen umzubringen, frei herumläuft?«
Darauf wusste Alex nichts zu erwidern.
4
Erst am Spätnachmittag, als das Licht sich schon davonstahl, verließ Alex Sashas Haus. Sie hatte den Arm ihrer Schwester verbunden und ihr ein Mittagessen gekocht, von dem Sasha ein paar wenige Bissen zu sich genommen hatte. Danach hatte Alex versucht, Jez zu überreden, zumindest eine Nacht auf seine Exfrau aufzupassen – ein mühseliges Unterfangen. Alex wusste, dass die Statistik für Trennung von Paaren nach dem Verlust eines Kindes wesentlich höher war als unter normalen Umständen. Was den Verlust von zwei Kindern anging, waren ihr keine Zahlen bekannt. Aber Sasha und Jez hatten sich kurz nach Harrys Begräbnis getrennt; nicht einmal die Hoffnung, dass Millie vielleicht noch lebte, hatte die Trennung verhindern können. Alex war allerdings immer schon der Meinung gewesen, dass Jez Sasha mehr unterstützen sollte, und nahm deshalb für das Telefonat ihren ganzen Mut zusammen.
»Ja«, flüsterte Jez mit scharfem Unterton. »Natürlich weiß ich von dem Gerichtsurteil. Ich sitze an der richtigen Stelle, weißt du.«
»Und du bist nicht auf die Idee gekommen, mal nach Sasha zu schauen?«
Stille. Dann: »Das konnte ich nicht, Alex. Ich hatte gedacht, du …«
»Mir hat man gesagt, vor zwölf Uhr würde sich nichts tun, aber da haben sie sich wohl geirrt, wie?« Unwillkürlich flüsterte Alex auch. »Du kannst dir ja wahrscheinlich vorstellen, in welchem Zustand ich Sasha vorgefunden habe, als ich zu ihr kam und sie vor dem Fernseher saß und sich die Nachricht zum x-ten Mal angeschaut hatte.«
Jez seufzte, und Alex sah förmlich vor sich, wie er sich mit der freien Hand durch die Haare fuhr, sodass sie alle hochstanden. »Ich kann mich damit jetzt nicht befassen«, sagte er. »Ich stecke mitten in einem Fall.«
»Eigentlich hätte ich erwartet, dass du bei der Verhandlung dabei bist.« Alex konnte sich diese Bemerkung nicht verkneifen.
»Und wieso warst du nicht da?«
»Es waren nicht meine Kinder.« Nein, die Zwillinge waren nicht ihre Kinder gewesen, aber sie war schuld daran, dass Harry tot und Millie bis heute verschwunden war. Doch diesen Gedanken musste Alex sofort verdrängen, wenn sie nicht verrückt werden wollte.
»Hättest du nicht bei der Polizei um Urlaub aus familiären Gründen bitten können? Schau«, fuhr sie in versöhnlicherem Tonfall fort, »ich verlange ja nicht von dir, dass du jetzt alles stehen und liegen lässt. Ich möchte dich nur bitten, später zu Sasha zu fahren und bei ihr zu übernachten. Ich würde es ja machen, aber ich muss mich um Gus kümmern.«
Wieder Stille. »Das geht nicht, Alex«, sagte Jez. »Das kann ich nicht.«
»Wieso nicht? Findest du nicht, dass du ihr das schuldig bist?«
»Schuldig?«
»Du warst mit ihr verheiratet.«
»Und jetzt bin ich es nicht mehr. Ich wünsche mir ja auch, dass alles anders gekommen wäre. Gott, ich wünsche mir das so sehr. Ich hoffe immer noch …«
»Was?«
Nach einem langen Zögern sagte Jez: »Vergiss es. Spielt keine Rolle. Außerdem ist es zu spät.«
»Jez, ich weiß, dass …«
»Nein«, erwiderte er barsch. »Du weißt gar nichts. Ich bemühe mich wirklich, so gut es irgend geht, über sie hinwegzukommen, zu verkraften, was damals passiert ist. Aber der Schmerz ist immer noch so schlimm, verstehst du? Sogar nach all diesen Jahren. Es ist verflucht noch mal sogar extrem schwierig, mich überhaupt mit einer anderen Frau einzulassen. Und auch darum bemühe ich mich nach Kräften.« Er lachte bitter. »Hätte nie gedacht, dass ich so was mal sagen würde.« Jez verstummte erneut, dann sagte er: »Und sie hat sich doch bestimmt wieder geritzt.«
Alex antwortete nicht.
»Es stimmt, oder? Und ich weiß, dass daran auch ich Schuld trage. Alex, ich erwarte nicht von dir, dass du das verstehst, aber Sasha und ich, wir …«
»Ihr was?«
»Nichts. Wir sind nichts.«
»Wenn du selbst nicht bei ihr sein kannst, könntest du dann wenigstens jemand von deinen Leuten vor das Haus stellen? Ich möchte nicht, dass Sasha von Journalisten belagert wird.« Alex wusste wohl, dass ihr laienhafter Auftritt am Telefon keinen professionellen Journalisten lange von Sashas Haus fernhalten würde.
»Ich werd mal schauen, was ich tun kann«, sagte Jez schließlich.
Alex konnte nur hoffen, dass das vorerst ausreichen würde.
Als sie fröstelnd vor Kälte die Haustür aufschloss, umschlang plötzlich jemand ihre Taille und sagte: »Schön, dass du da bist, Süße.«
Alex verdrehte die Augen und merkte, wie sich ihre bedrückte Stimmung ein wenig aufhellte. »Du bist aber wirklich berechenbar, Malone.« Sie öffnete die Tür. »Und was machst du überhaupt hier? Hast du mir aufgelauert?«
»Wie soll ich denn sonst in dein Haus kommen? Du hast mir ja immer noch keinen Schlüssel gegeben.«
»Zu früh, Malone, zu früh.«
»Finde ich gar nicht.« Malone drückte die Haustür hinter ihnen zu und küsste Alex leidenschaftlich, die Hände in ihren Haaren. Er roch nach Rauch und Whiskey.
Alex bemühte sich um ein Lächeln und schob ihn sachte von sich weg. »Sitz, Junge.«
»Ach komm schon, Liebling. Und hab ich dir nicht alles gegeben, damit du dich mit Handtaschen und Schuhen eindecken kannst?«
»Ha. Schön wär’s. Und du weißt, dass ich dir sehr dankbar dafür bin. Aber um ehrlich zu sein: Ich hatte einen richtigen Scheißtag heute.«
Malone strich ihr über die Wange. »Waren sie nicht zufrieden mit dem Text?«
»Weiß ich nicht, ich hab noch nicht nachgeschaut.« Alex lockerte ihre Schultern und rieb sich den Nacken.
»Also was dann?«
»Sasha.«
»Ah.« In diesem kleinen Laut kam eine Menge zum Ausdruck.
Alex kannte Malone noch nicht lange. Sie hatte ihn bei der Recherche zu ihrer letzten Reportage kennengelernt, weil er Gegenstand der Reportage war – der Besessene, der den größten Teil seines Lebens als verdeckter Ermittler gearbeitet hatte. Er war undercover Mitglied einer rechtsextremistischen Gruppierung gewesen und hatte potenzielle Terroristen entlarvt. Dann hatte er die Szene radikaler Umweltaktivisten infiltriert, die Welt der flachen Sandalen, in der strikt vegan gelebt wurde. Er wolle in seinem ganzen Leben nie mehr auch nur eine einzige Linse essen, hatte er ihr mit seinem schiefen Grinsen erzählt.
»Wie sehr musstest du dich auf die Aktivisten einlassen?«, hatte sie gefragt.
Malone hatte die Achseln gezuckt. »So intensiv wie nötig.«
»Auch Sex?«
»Wie gesagt: so intensiv wie nötig.«
Er hatte es ihr nicht leicht gemacht, aber es war ihr gelungen, noch mehr Einzelheiten aus ihm herauszuquetschen, und sie bewunderte seine Arbeit mehr und mehr. Außerdem fand sie ihn amüsant und interessant, und er brachte sie auf andere Gedanken.
Sie erzählte ihm im Gegenzug von ihrer hilfsbedürftigen Schwester, deren gescheiterter Ehe, den Zwillingen. Doch über das, was ihr nachts den Schlaf raubte, sprach Alex nicht.
»Tee?« Malone griff zum Wasserkocher.
»Ja, gern.«
»Also, was ist jetzt mit Sasha?«
Alex schüttelte amüsiert den Kopf. Das gefiel ihr an Malone: Er entlarvte Terroristen und rettete die Welt, scherte sich aber keinen Deut um die aktuellen Nachrichten.
»Jackie Wood wurde freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen.« Alex hatte gehofft, diesen Satz ungerührt äußern zu können, indem sie ihn möglichst sachlich aussprach. Daraus wurde nichts – sie spürte das vertraute Brennen in den Augen.
»Ah«, wiederholte Malone. Er stellte den Wasserkocher beiseite, nahm Alex in die Arme und hielt sie fest.
»Sasha war in üblem Zustand«, murmelte Alex in Malones Pullover. »Ich habe versucht, Jez zu überreden, dass er über Nacht bei ihr bleibt. Aber ich weiß nicht, ob er es macht.«
»Wird er schon.« Malone küsste sie auf den Kopf. »Ganz bestimmt.«
»Ich hoffe es. Obwohl er ja eigentlich keinen Grund mehr hat. Aber ich frage mich manchmal …«
»Was?«
»Weiß nicht. Obwohl … doch, ich frage mich manchmal, ob er sie auf irgendeine Art immer noch liebt.«
»Du kannst doch morgen früh gleich nach ihr schauen. Oder auch später noch, wenn du möchtest. Ich kann hier bei Gus bleiben.«
Alex löste sich behutsam aus Malones Armen und wischte sich hastig die Tränen ab. »Danke. Jetzt weiß ich, warum ich dich so mag.«
»Und das erklärt auch, warum das Telefon dauernd klingelt.«
»Woher weißt du das?«
»Hab ich gehört, während ich ewig da draußen in der Kälte herumstand und auf dich gewartet habe.«
»Mist.«
Und wie aufs Stichwort klingelte das Telefon erneut.
»Alex Devlin?«, fragte eine Männerstimme.
»Ja.« Um Sasha zu schützen, konnte Alex sich verstellen, aber wenn es um sie selbst ging, war das nicht so einfach.
»Hallo. Ed Killingback von der Post. Hätten Sie ein paar Minuten Zeit, um mit mir über Jackie Wood und ihre Freilassung zu sprechen?«
»Wissen Sie was, Ed, dazu fühle ich mich nicht in der Lage«, antwortete Alex so abweisend wie möglich.
»Es wird gar nicht lange dauern, und wenn Sie mir das Interview exklusiv geben, haben Sie die anderen Journalisten nicht am Hals.« Die schwungvolle junge Stimme machte Alex müde. »Wir könnten Sie in einem Hotel unterbringen, damit Sie von der Boulevardpresse nicht belästigt werden, und …«
»Hören Sie«, fiel Alex ihm ins Wort. »Ich weiß, wie das läuft, und ich habe kein Interesse. Lassen Sie mich in Ruhe.« Alex beendete das Gespräch, froh über ihre Entschiedenheit.
Jetzt meldete sich ihr Handy mit dem Grunge-Stück, das Gus ihr als Klingelton eingerichtet hatte. Auf dem Display erschien eine unterdrückte Nummer. Alex seufzte und schaltete das Handy aus.
Malone stellte den Wasserkocher an.
»Tut mir leid«, sagte Alex. »Das ist genau das, was du nicht brauchen kannst.«
»Was meinst du damit?«
Sie verzog das Gesicht zu etwas, das ein ironisches Lächeln sein sollte, vermutlich aber zur Grimasse geriet. »Du bemühst dich doch, die Öffentlichkeit zu meiden, jetzt, wo du mit deinem letzten Auftrag durch bist. Und durch mich gerätst du nun mittenrein.«
»Hmm«, machte Malone, während das Wasser zu sieden begann. »Ich schätze mal, ich bin diese lästigen Parasiten gewöhnt, meinst du nicht?«
»Doch, wahrscheinlich schon. Aber ich möchte nicht, dass die dir schaden.« Im Klartext hieß das eigentlich, dass sie hoffte, Malone würde nicht wegen der Presseleute davonlaufen – weil Alex sich nämlich gerade daran gewöhnte, ihn um sich zu haben.
»Das wird nicht passieren.« Er goss das Wasser über die Teebeutel in den zwei Bechern. »Wie geht’s Gus?«
Rückkehr in die Wirklichkeit. Alex schaute auf die Uhr. Heute Abend Fußballtraining. »Ganz okay, denk ich.« Malone war im Bilde über Gus’ wechselhaftes Verhalten in jüngster Zeit. »Will mit der Klasse zum Skifahren gehen.«
Malone zog die Augenbrauen hoch. »Teurer Spaß.«
»Hmm.«
»Und?«
»Und was?« Alex wusste, dass sie schroff klang, und es ging ihn ja auch wirklich nichts an.
Malone trommelte mit den Fingern auf die Arbeitsfläche. »Und kannst du dir das leisten?«
»Darum, Malone«, antwortete Alex, »brauchst du dich nicht zu kümmern.« Er reichte ihr den Tee, stark und mit Milch und Zucker, wie sie ihn mochte. »Ich geh mal nach oben und schau, ob du Liz gefällst.«
»Ich hoffe, du hast mich lebensnah beschrieben.«
Alex blieb stehen, die Hand am Türknauf. »Sympathisch, denke ich.«
»Und es ist anonym?«
»Malone. Wofür hältst du mich? Es ist natürlich ein Artikel, in dem dein Name geändert wurde. Das weißt du doch genau.«
Er grinste. »Na ja, wollte nur auf Nummer sicher gehen.«
Alex lächelte trocken. »Bin bald wieder da. Nimm dir Kekse. Lies die Zeitung. Entspann dich.« Dann kam Alex ein Gedanke. »Was machst du überhaupt hier, Malone? Solltest du nicht irgendwo verdeckt ermitteln? In einem Bordell oder so? Menschen retten und ein Held sein?«
Ein langsames Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Mach dich nicht lustig. Meine Arbeit ist wichtig. Außerdem hab ich dir doch gesagt, dass der letzte Auftrag erledigt ist. Ich hab so viele wie möglich gerettet, und nun dachte ich, ich lass mich hier mal blicken.«
»Um zu überprüfen, ob meine Reportage über dich im Wochenendmagazin abgedruckt wird. Immer schön auf die eigenen Interessen bedacht.«
Malone zuckte die Achseln.
Alex setzte sich an den Schreibtisch, schaltete den Computer ein und wartete, bis er hochfuhr. Sie dachte an Malone, der entspannt unten auf der Couch saß, nach seiner Pflanzenseife duftend, und die Zeitung las, und an Sasha, die alleine in ihrer Wohnung hockte und nur den Fernseher und eine Rasierklinge zur Gesellschaft hatte. Es gab keinen Zweifel, wo Alex nun lieber gewesen wäre. Aber sie fühlte sich deshalb nicht schuldig – warum auch, wenn Schuld ohnehin so einen großen Teil ihres Lebens ausmachte? Man konnte nur ein bestimmtes Maß an Schuld empfinden.
Malone und sie hatten sich auf Anhieb gut verstanden. Das erste Treffen zu arrangieren war mühevoll gewesen und hatte etliche Geheimtelefonate mit Leuten erfordert, die vermutlich sogar beim Telefonieren Sturmhauben trugen. Irgendwann war Alex dann für würdig befunden worden, den Mann zu treffen, der die Welt rettete; sie nahm an, dass man ihre Daten sorgfältig überprüft hatte, um sicherzugehen, dass sie tatsächlich Journalistin und nicht Mitglied der russischen Mafia oder ein weiblicher Gangsterboss war. Schließlich war das Treffen in einem abgeranzten alten Pub südlich vom Fluss Wensum anberaumt worden, in einem schäbigen Viertel von Norwich, und Alex musste ihren ganzen Mut zusammennehmen, um selbstbewusst aufzutreten.
Ihr war nicht ganz klar, was sie eigentlich erwartet hatte, vielleicht am ehesten einen Typen mit Beanie und Jesuslatschen. Aber an dem Ecktisch unter dem Porträt der Queen (in Pubs gab es die tatsächlich immer noch, und man hatte ihr gesagt, dass sie den geheimnisumwitterten Malone dort vorfinden würde) saß ein Mann Anfang vierzig, der dunkle Jeans, ein hellblaues, weiß gepunktetes Hemd und Sneakers trug und ein Bier trank.
Sie streckte ihm die Hand hin. »Hallo, ich bin Alex Devlin. Sie müssen Malone sein.« Sie fand es ziemlich eitel, sich nur mit Nachnamen ansprechen zu lassen, und musste den Impuls unterdrücken, sich als »Devlin« vorzustellen.
Allerdings stand er höflich auf, schüttelte ihr die Hand und fragte, was sie trinken wolle. Das beeindruckte Alex, und sie unterhielten sich freundlich. Und auch das Interview lief gut. Malone erklärte ihr seine Motivation und seine Vorgehensweise; zum Beispiel stellte er sich immer mit der Freundin des Anführers der Gruppe gut, in der er ermitteln sollte. Alex ahnte, dass Malone unter »gut stellen« mehr verstand als einen Plausch bei einer Tasse Kaffee. Er berichtete, wie er auch andere Gruppierungen, die ganze Szene also, erforscht hatte. Und dass er sich eine Schar Gänse im Garten gehalten hatte, weil sie das beste Warnsystem gegenüber Eindringlingen darstellten. Zwar musste Malone angesichts der Gefahren, in die er sich begab, wohl ziemlich wahnsinnig sein, aber letztlich bewunderte Alex ihn. Ach ja, und schlief mit ihm. Bettgeflüster war ziemlich nützlich für den Wahrheitsgehalt gut recherchierter Porträts.
Als versierte Journalistin ließ Alex Malone natürlich über sich reden und erzählte sehr wenig über sich selbst. Aber sie fand es sowohl interessant als auch erstaunlich, dass der freundliche, eher sanftmütige Mann in den vergangenen Monaten für einige hochkarätige Verhaftungen gesorgt hatte, auf die er jahrelang hingearbeitet hatte. Als Alex wagte, ihn zu fragen, weshalb er sich überhaupt interviewen lasse, gab er zur Antwort, er wolle die Tatsachen publik machen, dabei aber selbst im Verborgenen bleiben. »Schau, wir müssen letztlich immer auf unser Glück setzen«, sagte er. »Und diese Leute, die uns und unsere Lebensform zerstören wollen, müssen nur einmal Glück haben. Deshalb mache ich diese Arbeit.«
Außerdem hasse er Ausbeutung, erklärte er, und hoffe, durch seinen Einsatz den Menschenhandel reduzieren zu können. Und auch das organisierte Verbrechen, das viel zu mächtig war. Kinder wurden als Sexsklaven eingeschleust. »Das steht alles in Verbindung mit dem Drogenhandel«, sagte er. »Es wimmelt hier in der Gegend von Drogenfabriken. Häuser mitten in der Stadt, alleinstehende Farmen, Scheunen, Heuschober – die nutzen alles.« Aber derzeit mache er eine Pause, sagte er, weil er vorerst genug getan habe.
Der Computer gab Laut, dass er zum Einsatz bereit sei, und Alex öffnete ihre E-Mails. Sie beschloss, nicht auf Facebook oder Twitter zu gehen, weil das nur ihren Blutdruck in ungesunde Höhen treiben würde. Das war das Problem, wenn man als selbstständige Journalistin arbeitete – man musste immer erreichbar sein.
Wie befürchtet bestanden die E-Mails aus Werbung von Kleidungsfirmen, Zugunternehmen und Supermärkten und Anfragen nach Interviews mit Sasha und ihr von diversen Zeitungen. Sie löschte alles – bis auf die E-Mail von ihrer Redakteurin.
Von: Liz Henderson
An: Alex Devlin
Betreff: Malone
Hallo Alex, finde den Text über Malone super, sehr ausgewogen, man bekommt ein gut greifbares, vollständiges Bild von dem Mann, schön ergänzt durch die Fotos.
Die Fotos waren alle im Halbdunkel und von hinten aufgenommen worden, damit Malone nicht erkennbar war. Zumindest hatte er nicht darauf bestanden, eine Sturmhaube zu tragen.
Es freut dich sicher zu hören, dass wir es ziemlich bald im Wochenendmagazin bringen wollen – in zwei Wochen müsste es klappen. Schick bitte die Rechnung.
Alex atmete tief aus; sie hatte gar nicht gemerkt, dass sie die Luft angehalten hatte. Gott sei Dank war zumindest für ein Weilchen Geld für Essen da, wenn sie auch noch nicht wusste, wie sie Gus’ Skireise finanzieren sollte. Die Sorgen stellten sich sofort wieder ein, als sie daran dachte.
Schick uns jederzeit gerne weitere Projektvorschläge, Alex, wir finden deine Texte toll.
Herzlich
Liz
Diese Mail erleichterte Alex ein wenig. Als freischaffende Journalistin den Lebensunterhalt zu verdienen war alles andere als einfach, und sie konnte von Glück sagen, dass sie vom Wochenendmagazin regelmäßig Aufträge bekam. Manchmal schrieb sie zusätzlich für Zeilenhonorar Meldungen für die Tageszeitung und kam sich dann vor wie ein Hansdampf in allen Gassen, der nirgendwo zu Hause ist. Aber ihre sorgfältig recherchierten Reportagen schienen gut ins Konzept des Wochenendmagazins zu passen.
Liz hatte die Mail geschrieben, nachdem die Freilassung von Jackie Wood in den Medien bekannt gegeben worden war. Weitere Projektvorschläge. Das war manchmal leichter gesagt als getan. Themen für eine umfassende Reportage fielen einem nicht in den Schoß, dafür musste man ständig Augen und Ohren offen halten und am Ball bleiben.
Plötzlich schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf.
Jackie Wood.
Ein nachdenklicher Text über deren Haftzeit, der zugleich Woods Leben schilderte.
Wo um alles in der Welt kam denn diese Idee plötzlich her? Alex lehnte sich zurück.
Das war doch absoluter Blödsinn.
Sie schaute hinaus auf die armselige Grünfläche, die als Garten fungierte, spärlich beleuchtet vom Küchenlicht. Die Terracottatöpfe, in denen sie im Sommer Geranien und Lilien angepflanzt hatte, waren durch die Kälte rissig geworden, und die Grünpflanzen hatten sich in dürre braune Stängel verwandelt. Man hätte sie hereinholen müssen, aber daran hatte Alex nicht rechtzeitig gedacht. Der Rasen bestand fast nur noch aus Schlamm, und sogar die Birke schien ihres Lebens überdrüssig zu sein.
Alex griff nach Stift und Block und machte sich Notizen. Nur einmal angenommen, sie hätte tatsächlich die Chance, mit Jackie Wood zu reden – was sprach dafür und was dagegen?
Auf der Pro-Seite: Sie wollte unbedingt mit Jackie Wood sprechen. Alex hätte nicht im Traum daran gedacht, dass sich diese Gelegenheit ergeben würde. Die Frau war durch juristische Kniffe freigekommen, aber Alex war überzeugt davon, dass Wood schuldig war und wusste, wo Millie begraben lag. Würde Wood auspacken, dann könnte Sasha zumindest ein wenig Seelenfrieden finden.
Auf der Kontra-Seite: Wahrscheinlich wollte Wood ebenso wenig mit ihr wie mit anderen Journalisten reden. Ob sie Alex wiedererkennen und sich an ihren Namen erinnern würde? Nicht notgedrungen. Inzwischen waren fünfzehn Jahre vergangen, und damals tauchten nur Sasha und Jez in den Schlagzeilen auf. Jez war es gelungen, Alex’ Namen weitgehend aus der Berichterstattung rauszuhalten; als Polizist hatte er das steuern können. Außerdem hatte Alex sich damals verkrochen und die Öffentlichkeit gemieden. Aber sie hatte beim Gerichtsprozess ausgesagt. Deshalb war es eine Illusion zu glauben, dass Wood sie nicht erkennen könnte.
Und welche Folgen hätte das Erscheinen des Interviews für Sasha und Jez?
Andererseits wollte Alex den beiden ja damit helfen.
Doch das Hauptproblem war ihre Redakteurin: Liz würde garantiert einwenden, Alex sei in diesem Fall voreingenommen und deshalb zu einer objektiven Berichterstattung nicht imstande. In Wirklichkeit hatte Liz wahrscheinlich nur Angst, der Presserat könne dem Wochenendmagazin mit einer Beschwerde drohen.
Aber vielleicht sollte sie den Text einfach schreiben und ihn dann an Liz schicken. Alex hatte schon öfter auf gut Glück geschrieben. Und falls die Redakteurin ablehnen würde, konnte Alex immer noch versuchen, die Reportage anderswo zu verkaufen. Ein gewisses finanzielles Risiko war dabei, aber irgendein Blatt würde den Artikel bestimmt haben wollen. Es wäre auch alles astrein, keinerlei Täuschung dabei. Sie würde den Text als Reportage mit persönlichem Hintergrund anbieten – so was kam immer gut an.
Alex starrte auf ihren Block. Es wäre eine ideale Möglichkeit, Jackie Wood die gesamte Geschichte zu entlocken – herauszufinden, was genau geschehen war an jenem Tag, als Harry und Millie entführt worden waren. Aus Alex’ Garten – als sie für die beiden Kinder ihrer Schwester verantwortlich gewesen war. An diesem Tag war die Familie in die Brüche gegangen, weil Alex versagt hatte. Und wenn sie nun endlich erfahren würde, warum Jackie Wood und Martin Jessop die Zwillinge damals entführt und getötet hatten, fände auch sie selbst vielleicht endlich nach anderthalb Jahrzehnten irgendeine Art von innerem Frieden.
Zugleich konnte sie etwas wiedergutmachen und die Schuldgefühle loswerden, die sie seither quälten.
Alex wandte sich wieder dem Computer zu und öffnete die Datei »Jessop und Wood«. Sie hatte sämtliches Material und alle Links zu dem Fall übersichtlich geordnet. Aussagen, Namen von Leuten, die behauptet hatten, sie hätten bereits gewusst, dass Jessop und Wood böse Menschen seien; sogar den Link zu einem Hellseher, der erklärt hatte, er könne die Familie – gegen ein gewisses Entgelt natürlich – zu Millies Leiche führen. Alex hatte nie erfahren, ob der Mann zur Polizei gegangen war. Sie starrte auf den Bildschirm. Bald würden neue Links hinzukommen, zum heutigen Stand der Dinge, aber zuerst …
Hier, Bild und Name von Jackie Woods Anwalt. Alex griff nach ihrem Handy.
Ihr Herz schlug schneller. Fünfzehn Jahre lang hatte sie nichts unternommen und geglaubt, der Gerechtigkeit sei Genüge getan und sie könne dem Grauen dieser Geschichte entkommen. Jetzt wusste Alex, dass sie sich geirrt hatte. Sie gab die Nummer des Anwalts ein.
5
Danach lief alles wie am Schnürchen. Alex erreichte Jonathan Danby sofort, und das Gespräch entwickelte sich wie erhofft. Er habe von ihr gehört und einige ihrer Reportagen sogar gerne gelesen, erklärte er in seiner schleimigen Art. Er sei ein großer Fan des Wochenendmagazins. Alex hoffte inständig, dass er nicht mit Liz befreundet war. Sie wollte das Interview fertig haben, bevor jemand etwas dagegen einwenden konnte. Doch Danby erwähnte nur, dass er den Herausgeber der Tageszeitung und des dazugehörigen Wochenendmagazins bei ein paar sozialen Anlässen getroffen hatte. Das machte nichts. Clive Lambert kannte kaum seine Redakteure, von den freien Journalisten ganz zu schweigen. Als Alex erklärte, sie sei an einem Exklusivinterview mit Jackie Wood interessiert, spürte sie, dass der Anwalt das Geld schon klingeln hörte.
»Und ich kann mich darauf verlassen, dass dabei eine objektive Darstellung von Jackie herauskommt? Dass Sie darüber berichten, was sie durchgemacht hat?«, erkundigte er sich. Alex hörte, wie er mit einem Stift auf etwas klopfte – wahrscheinlich auf die Schreibunterlage eines Mahagonitischs.
»Selbstverständlich«, antwortete sie. Es musste ja objektiv sein, sonst würde es gar nicht abgedruckt. Aber sie hoffte eben, noch viel mehr zu erfahren.
»Ich müsste natürlich dabei sein.«
»Nein, Mr Danby, das geht leider nicht«, erwiderte Alex so ruhig wie möglich. »Ich müsste alleine mit ihr sprechen, und zwar vorzugsweise an einem Ort, an dem sie sich wohl und entspannt fühlt. Das ist nötig, damit sie sich mir gegenüber öffnet.«
»Verstehe.« Alex hörte den Anwalt am anderen Ende atmen. »Und was springt für meine Klientin dabei heraus?«
»Das Magazin kann seinen üblichen Satz bezahlen.« Alex nannte die Summe und drückte die Daumen. Dieser Aufwand würde sich lohnen, um mit der Frau zu reden, die sie und ihre Familie ins Unglück gestürzt hatte. »Mehr ist leider nicht möglich. Ms Wood würde allerdings auch viel Publicity bekommen, die sie dann zu ihrem Vorteil nutzen könnte.«
»Sie ist unschuldig, wissen Sie. Sie ist von der Beihilfe zum Mord freigesprochen worden.«
»Wie Sie meinen, Mr Danby.«
»Wir möchten, dass das in Ihrem Text sehr deutlich betont wird.«
Alex umklammerte krampfhaft ihr Handy. »Ich kann nur mit dem Material arbeiten, was ich bekomme.«
»Und Sie würden für eine positive Darstellung von Ms Wood sorgen?«
Wenn sie nicht aufpasste, würde sie das Handy noch zerquetschen. »Das kommt darauf an, wie sie sich mir gegenüber darstellt. Auch deshalb sollte sie nur mit mir alleine sprechen.«
»Es gibt allerdings einen zwingenden Grund, weshalb ich auch anwesend sein sollte, Ms Devlin. Nämlich, um darauf zu achten, dass Ms Wood keine … Äußerungen zu ihren Ungunsten macht.«
Alex beschloss zu schweigen.
»Ihnen ist doch sicher bewusst, dass die Medien nur so weit davon entfernt sind«, Alex stellte sich vor, dass der Anwalt Daumen und Zeigefinger so dicht zusammenhielt, dass kaum Platz dazwischen war, »Mundverbot zu bekommen. Das schließt Sie ein, Ms Devlin.«
»Davon gehe ich aus«, erwiderte Alex.
»Und außerdem sind Sie Sasha Devlins Schwester.«
Verflucht. Damit war zu rechnen gewesen. Idiotisch von ihr, nicht darauf vorbereitet zu sein.
»Das befähigt mich zu einer noch persönlicheren Herangehensweise bei diesem Projekt, Mr Danby. Ich werde Ms Wood nicht manipulieren. Die Reportage wird ein sehr persönlicher Bericht über mein Treffen mit der Frau sein, die wegen der Beihilfe zum Mord an meinem Neffen und meiner Nichte zunächst verurteilt und nun freigesprochen wurde.«
»Natürlich.« Ein tiefer Seufzer war zu hören. »Ich werde Ms Wood fragen, gehe aber davon aus, dass sie nicht einwilligen wird. Sie will sich von der Öffentlichkeit fernhalten. Aber ich rufe sie an und melde mich dann wieder bei Ihnen, ja?«
»Das wäre wunderbar, Mr Danby, vielen Dank.«
Alex nannte ihm ihre Nummer und schaltete ihr Handy aus, völlig erschöpft von der Anstrengung, die ganze Zeit höflich zu bleiben, aber zugleich auch erstaunlich aufgedreht.
»Hey, du«, hörte sie Malone von unten rufen. »Krieg ich dich heute überhaupt noch zu Gesicht?«
Alex versetzte ihren Computer in Tiefschlaf und lief hinunter in die Küche. »Entschuldige, ich musste rasch mein nächstes Interview vorbereiten.«





























