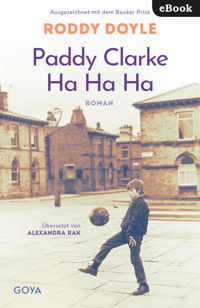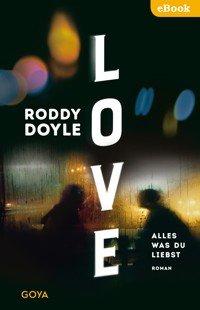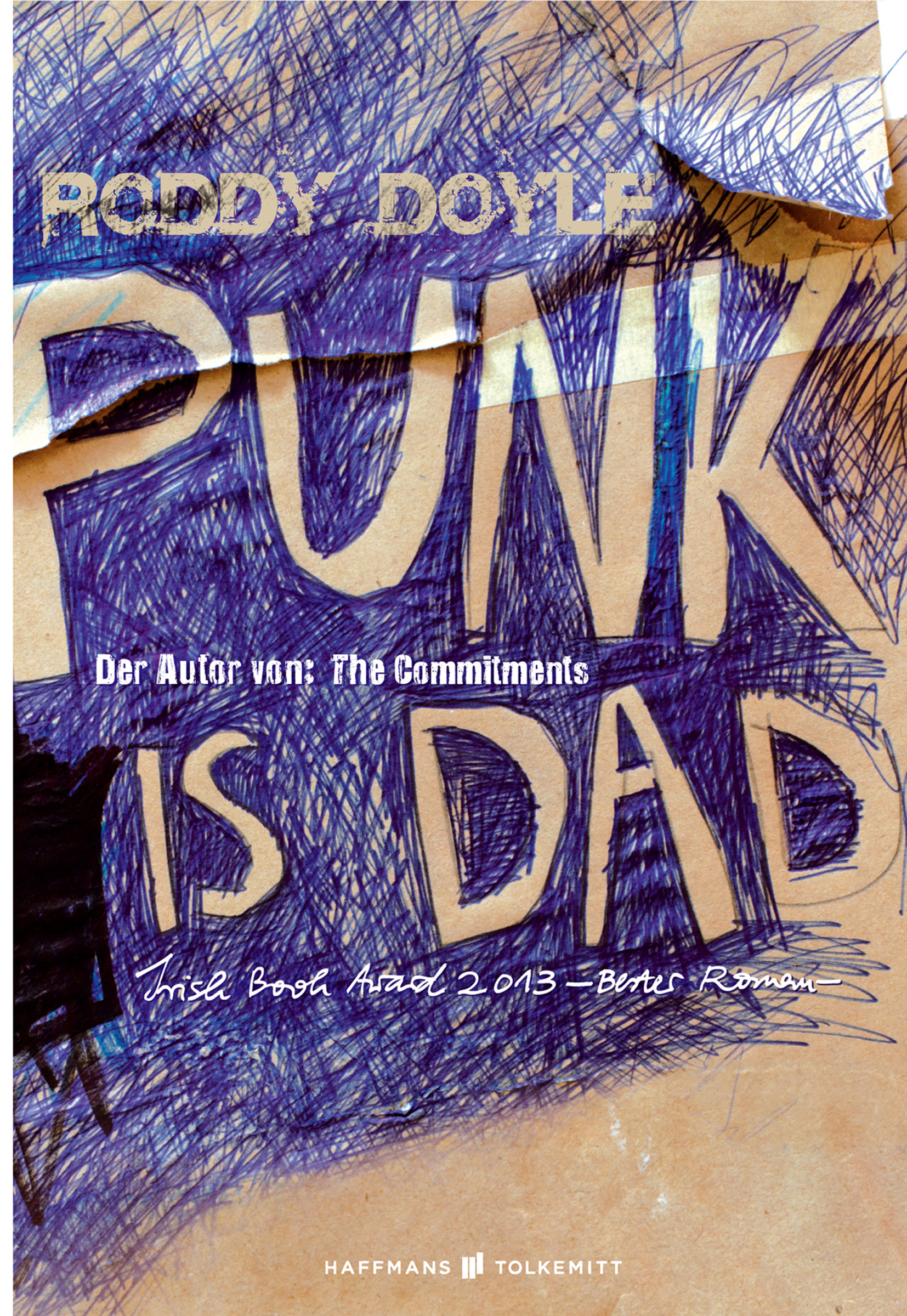9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Klug, feinfühlig, voller Humor: Kinderliteratur vom Feinsten
Als Onkel Ben sein Geschäft aufgeben muss, ist den Kindern Gloria und Raymond klar, dass irgendetwas Schlimmes passiert sein muss. Denn Onkel Ben ist einfach nicht mehr der alte, von seiner Fröhlichkeit ist ihm nichts mehr geblieben. Die Großmutter behauptet, ein »schwarzer Hund«, der die ganze Stadt Dublin heimsucht, sei die Ursache des Übels. Gloria und Raymond beschließen, etwas zu unternehmen! Und so beginnt für die Kinder von Dublin ein wundervolles Abenteuer. Am Ende sind es die Tiere aus dem Zoo, die den Kindern helfen, das Ungeheuer für immer zu vertreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für Dublins Möwen
Der Schwarze Hund kam in der Nacht. Er kam in einer Wolke – nein, er war selbst die Wolke. Eine riesige Wolke, die sich über die Stadt legte. Und die Stadt – die Luft über der Stadt – wurde noch dunkler. Jedenfalls für einen Moment. Dann wurde die schwarze Wolke kleiner und kleiner. Bis sie eine kleine Wolke war, die tief hinunter auf den Boden sank, und sie nahm die Form eines Hundes an, und die Form eines Hundes wurde zu einem Hund.
Der Schwarze Hund der Depression hatte sich nach Dublin eingeschlichen. Kein menschliches Wesen nahm von ihm Notiz.
Die Tiere allerdings schon.
Die Haustiere der Stadt versuchten, ihre Besitzer zu warnen, aber die Menschen hörten ihnen nicht zu. Gebell war für sie nichts weiter als Gebell, ein Miau nur ein Miau.
Der Schwarze Hund kroch durch die Straßen der Stadt. Er huschte durch die Schatten und machte dabei nicht das leiseste Geräusch. Er huschte und kroch und schlich sich in Häuser und Wohnungen ein – überall dort, wo er Menschen fand.
Die Hunde der Stadt fanden das, was da geschah, entsetzlich.
Dublin liebt Hunde. Und die Hunde der Stadt wissen, was für ein Glück sie haben.
»All das Futter und Wasser!«, sagte eine Hündin namens Sadie. »O mein Gott! Und ich muss nichts anderes dafür tun als, na ja, ein bisschen mit dem Schwanz wedeln und daran denken, dass ich im Garten mein kleines und, na ja, mein großes Geschäft machen muss.«
»Ich vergesse das manchmal«, gestand ein zweiter Hund namens Chester.
»Na ja, ich auch«, sagte Sadie.
»Das Einzige, was ich tun muss«, sagte Chester, »ist, so zu tun, als würde ich mich freuen, wenn mein Besitzer von der Arbeit nach Hause kommt.«
»Musst du denn wirklich so tun?«, fragte Sadie.
»Manchmal schon«, sagte Chester.
»Du liebes bisschen, sagte Sadie. »So was mache ich nie.«
»Du bist eben ein Wunderhund«, sagte Chester ein bisschen boshaft.
(Hunde, besonders die Hunde von Dublin, können ziemlich boshaft sein. Man sollte unbedingt darauf achten, wie ihr Bellen klingt, vor allem frühmorgens).
Die Hunde wussten eins: Es gab nur eine Möglichkeit, den Schwarzen Hund der Depression aufzuhalten. Und doch konnten sie nur zusehen, wie der Schwarze Hund sich nachts auf die Lauer legte und immer näher an die Menschen heranschlich. Es war entsetzlich anzusehen, wie er sich mit der Luft selbst verbinden und auf diese Weise heimlich in die Häuser eindringen konnte. Wie er dort die Stimmung verändern konnte, jedes Lachen erstickte, wie das Lächeln in Gesichtern erlosch, die jahrelang immer gelächelt hatten. Wie er sich in den Schlaf der Menschen einschlich und ihre angenehmen Träume in Alpträume verwandelte.
Die beiden Hunde Chester und Sadie lebten überhaupt nicht weit voneinander entfernt. Sie waren beinahe Nachbarn. Nur ein einziges Haus trennte sie voneinander, und das gehörte einem Mann namens Ben Kelly. Sie beide mochten Ben. Er hatte keinen eigenen Hund, aber er war immer nett zu ihnen, wenn sie ihm auf einem Spaziergang begegneten oder ihn durch die Fenster ihrer Häuser anbellten. Sadie und Chester saßen beide gerne im Wohnzimmer auf der Sofalehne.
»Liebes bisschen«, sagte Sadie. »Du machst das auch?«
»Ja, schon«, sagte Chester.
»Das ist, na ja, erstaunlich«, sagte Sadie.
»Ist ein bisschen Abwechslung.« Chester zuckte mit den Schultern.
Ben lebte allein, aber in seinem Haus herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Immer hörte man Musik und Gelächter. Und es gab zwei Kinder, die den Hunden gut gefielen. Zwei Kinder, die Ben häufig besuchten. Sie nannten ihn »Onkel Ben«.
»Was ist das, ein Onkel?«, erkundigte sich Sadie bei Chester.
»Keine Ahnung«, gab Chester zu. »Aber ich glaube, es hat vielleicht was mit Pommes zu tun.«
»Mit Pommes?«
»Ja«, sagte Chester. »Er kauft ihnen jedes Mal Pommes, wenn sie ihn besuchen.«
Die Kinder, ein Junge und ein Mädchen, liebten ihren Onkel Ben. Und es war deutlich zu sehen, dass auch Ben sie liebte. Aber dann schlich sich der Schwarze Hund in Bens Haus – und in Hunderte, Tausende weitere Häuser. Er kam nachts, im Schutz der Dunkelheit.
Hunde – und die meisten anderen Tiere auch – mögen die Nacht. Nachts können sie sein, wie sie sind, können sie fast nach Belieben bellen und heulen. Keiner erwartet von ihnen, dass sie ununterbrochen mit dem Schwanz wedeln oder Stöckchen und alberne Quietschtiere apportieren. Die Menschen gehen schlafen und ihre Haustiere können sich unbeobachtet entspannen. Es ist eine magische Zeit, wenn die Regeln des Tageslichts verschwimmen und die Menschen nicht mehr so genau aufpassen. Ungewöhnliche Ereignisse erscheinen plötzlich normal, ja, womöglich bemerkt sie gar keiner. Zwei sprechende Hunde könnten zum Beispiel auch zwei menschliche Stimmen sein, die der Wind daherweht. Ein schwarzer, hundeförmiger Schatten auf der Eingangstreppe entsteht wahrscheinlich nur, weil der Mond durch den großen Baum im Vorgarten scheint.
Die Tiere der Stadt waren wütend, weil der Schwarze Hund die Nacht nutzte, um sein Gift zu verteilen. Aber ihnen war klar, dass Sadie oder Chester oder irgendein anderes Haustier dieser Stadt nicht das Geringste tun konnten, um ihn aufzuhalten.
Nur die Kinder der Stadt konnten das schaffen.
1
Gloria Kelly lag im Bett. Sie war hellwach. Sie wusste, dass ihr Bruder Raymond genauso hellwach war. Das erkannte sie an der Art, wie er atmete. Es war ein waches Atmen. Er lag da, dachte nach und lauschte. Schlafatmen war anders. Es war länger und leichter, weniger ein und aus.
»Ray?«, flüsterte sie.
Raymond antwortete nicht. Aber das kümmerte sie nicht.
Sie fand es gut, ein Zimmer mit ihrem Bruder zu teilen. Auch wenn sie wusste, dass es Raymond nicht gefiel. Auch darum kümmerte sie sich nicht. Sie konnte es ja ganz heimlich gut finden. Sie musste es ihm überhaupt nicht erzählen.
Raymond und sie mussten sich ein Zimmer teilen, seit ihr Onkel Ben zu ihnen gezogen war. Für eine Weile. Das hatten jedenfalls Mam und Dad gesagt. Onkel Ben würde »eine Weile« bleiben. Zuerst hatte ihre Mutter es »eine kleine Weile« genannt. Aber das »kleine« war verschwunden, denn Onkel Ben blieb immer länger, und Gloria dachte schon, ihr Zimmer gehöre ihr gar nicht mehr. Und Raymond dachte wahrscheinlich das Gleiche. Sein Zimmer war ihr gemeinsames Zimmer geworden.
Manchmal spähte sie in ihr Zimmer, wenn Onkel Ben nicht drin war. Er hatte nichts verändert. Er hatte ihre Bilder und ihre anderen Sachen nicht angerührt. Das Zimmer war immer noch rosa, jedenfalls fast alles darin. Das einzig wirklich Neue im Zimmer war Onkel Bens Geruch. Es war eine Art Erwachsenengeruch. Eine Mischung aus Seife und Schweiß. Keines seiner Kleidungsstücke lag herum, nur ein Buch, das nicht ihr gehörte. Sie hatte sich den Umschlag angesehen, aber es erschien ihr langweilig, über einen Krieg oder so etwas. Wenn man außer Acht ließ, dass sie nicht mehr darin schlief oder spielte, war es immer noch Glorias Zimmer. Also blieb Onkel Ben vielleicht wirklich nur für eine Weile hier – bloß war diese Weile ein bisschen länger als erwartet.
Vielleicht.
»Ray?«
Er gab immer noch keine Antwort.
Sie mochte ihr Bett nicht. Es war kein richtiges Bett. Es war nur eine Matratze, die auf dem Boden lag. Am Anfang hatte es ihr gefallen. Es war witzig gewesen, ein bisschen wie Camping. Aber jetzt nicht mehr. Manchmal lag sie mit dem Gesicht direkt an der Wand, ganz unten, an der Fußleiste, beinahe an der Kante, wo diese an den Fußboden stieß. Da war es kalt. Immer, selbst wenn es im Zimmer sonst warm war. Und manchmal konnte sie merkwürdige Dinge hören. Jedenfalls glaubte sie, etwas zu hören. Hinter der Fußleiste.
Gloria wünschte, sie hätte ihr Zimmer wieder. Es war eigentlich das Einzige, was ihr fehlte. Sie hatte ihr Federbett und ihre rosa Decke. Aber es war nicht das Gleiche.
»Ray?«
Sie redete jetzt ein bisschen lauter. Beinahe normale Sprechlautstärke.
Vielleicht schlief er ja doch. Irgendwie gefiel ihr der Gedanke, dass ihr älterer Bruder vor ihr eingeschlafen war.
Sie versuchte es noch einmal.
»Ray?«
»Was?«
»Schläfst du nicht?«
»Das ist eine blöde Frage.«
»Ich wette, du hast schon geschlafen«, sagte Gloria. »Und ich habe dich geweckt.«
»Hab ich nicht«, sagte Raymond.
»Wetten, dass doch«, sagte Gloria. »Beweise es mir.«
»Kein Problem«, sagte Raymond. »Du hast schon vier Mal ›Ray‹ gesagt.«
Sie hörte, wie er sich bewegte, im Bett umdrehte.
»Stimmt doch, oder?«
»Ja«, sagte sie. »Ich glaube schon. Warum hast du nicht geantwortet?«
»Hatte keine Lust.«
»Das war mir klar«, sagte Gloria. »Mir war klar, dass du wach bist.«
»Was wolltest du denn?«
»Kannst du sie hören?«, fragte Gloria.
»Ja.«
Gloria meinte die Erwachsenen. Ihre Mam, ihren Paps, ihre Omi und Onkel Ben. Sie saßen unten in der Küche. Raymonds Zimmer befand sich direkt über ihren Köpfen.
»Sie murmeln schon wieder«, flüsterte Gloria.
»Ja«, sagte Raymond.
Das Haus war in den letzten Tagen voller Gemurmel. Ein Gemurmel, das verstummte, sobald Raymond oder Gloria ins Zimmer kamen. Murmeln, das machten Erwachsene, wenn sie glaubten, dass sie flüsterten. Geflüster blieb nur einen kurzen Moment lang in der Luft stehen, aber Gemurmel rumorte noch eine Ewigkeit in allen Ecken, an den Fensterrahmen, im ganzen Haus. Die gemurmelten Wörter waren schon beinahe lebendig geworden. Gloria stellte sich vor, dass man sie sehen konnte. Sie bestanden aus Staub- und Haarknäueln auf dünnen Beinchen, mit denen sie die Wände und Decken kaum berührten, wenn sie über Farbe, Glas und Holz krabbelten.
Das Gemurmel hatte angefangen, als Onkel Ben bei ihnen eingezogen war. Oder kurz bevor er kam. Gloria mochte das Gemurmel nicht. Es machte ihr Angst. Aber sie gab Onkel Ben nicht die Schuld daran.
Raymond tat das ebenso wenig. Es gefiel ihm nicht, dass er sein Zimmer mit Gloria teilen musste, aber auch daran gab er nicht Onkel Ben die Schuld. Gloria strapazierte seine Nerven … und auch sonst so einiges. Aber Raymond wusste, dass alle kleinen Schwestern so waren. Es war ein Naturgesetz. Und manchmal war es gar nicht so übel, sein Zimmer zu teilen. Jetzt zum Beispiel. Raymond hatte immer Angst vor der Dunkelheit gehabt. Jedenfalls ein kleines bisschen. Er war beinahe zwei Jahre älter als Gloria, deswegen ging er eine halbe Stunde später schlafen als sie. Für jedes Jahr eine Viertelstunde. So lautete die Regel, hatte sein Vater gesagt.
»Wer hat die Regel erfunden?«, hatte Raymond seinen Vater gefragt.
»Die Regierung«, hatte der geantwortet.
Sein Vater fand das lustig.
Jedenfalls hatte Raymond immer, wenn er schlafen ging, seine Zimmertür einen kleinen Spalt offen stehen lassen, sodass das Licht aus der Küche im unteren Stockwerk noch eindringen und die Dunkelheit ein Stück weit zurückdrängen konnte. Er war wütend gewesen, wenn er sah, dass Gloria ihre Tür fest verschloss, diese Tür mit dem dämlichen Schild »Draußen bleiben – Dich meine ich! XX«. Denn Gloria hatte keine Angst vor der Dunkelheit. Das hatte Raymond verstört und beschämt.
Aber jetzt, wo Gloria in seinem Zimmer schlief, hatte Raymond nicht mehr ernsthaft Angst vor der Dunkelheit. Und er musste gar nicht darüber reden, dankbar sein oder so etwas. Es war einfach eine Tatsache.
»Murmel murmel murmel«, sagte Gloria jetzt.
Raymond erwiderte mit einem grollenden Männergemurmel: »Mooormöll.«
Gloria fügte ein Damengemurmel hinzu: »Miiirmmmill, Miiiirmill. Weißt du, was wir tun sollten, Ray?«
»Was denn?«
»Uns unter den Tisch schleichen.«
»Cool.«
Es war der Abend vor dem Patrickstag. Der nächste Tag war also schulfrei und sie hatten schon länger aufbleiben dürfen als üblich.
Gloria hörte, wie Raymond aus dem Bett kletterte.
Sie stellte sich auf ihre Matratze.
Gloria und Raymond hatten ein Geheimnis. Es war ein Spiel. Nachdem man sie zu Bett geschickt hatte, schlichen sie einfach wieder die Treppe hinunter – natürlich nur an Wochenenden, und nur dann, wenn die Erwachsenen in der Küche saßen. In anderen Zimmern funktionierte das Spiel nicht so richtig. Sie schlichen über die Treppe nach unten und durch den Flur. Sie krochen auf allen vieren in die Küche oder robbten sogar auf ihren Bäuchen. Sie krabbelten unter den Tisch und dort blieben sie. So lange, wie es nur ging.
Sie durften die Füße der Erwachsenen nicht berühren, sonst erwischte man sie, das Spiel war zu Ende und sie mussten wieder ins Bett. Als sie es zum ersten Mal probierten, hielten sie nur zwei Minuten und vierzehn Sekunden lang durch, denn ihr Vater bewegte einen Fuß und spürte etwas.
»Unter dem Tisch sitzt ein Hund«, sagte er. »Aber wir haben gar keinen Hund.«
Dann sahen sie sein großes Gesicht, das sie verkehrt herum ansah.
»Ihr Schlawiner«, sagte er. »Los, zurück ins Bett.«
Ihre Mutter packte und kitzelte sie, als sie unter dem Tisch hervorkrochen.
»Ihr Gauner!«
Es wurde ein Spiel, das sich beinahe jeden Freitag- und Samstagabend wiederholte. Es war super, weil ihre Eltern es immer wieder vergaßen. Und ihre Omi – die vergaß es auch. Aber ihre Omi vergaß beinahe alles, also zählte das nicht wirklich.
Eines Abends, als sie siebenunddreißig Minuten und einundfünfzig Sekunden unter dem Tisch verbracht hatten, hatten Raymond und Gloria gleichzeitig dieselbe Erkenntnis: Ihre Eltern wussten, dass sie da waren. Sie spielten einfach mit. Ja, es war zu ihrem eigenen Spiel geworden, so zu tun, als wüssten sie nicht, dass die Kinder unter dem Tisch saßen. Das Spiel gehörte jetzt den Eltern, nicht mehr Gloria und Raymond.
ENDE DER LESEPROBE
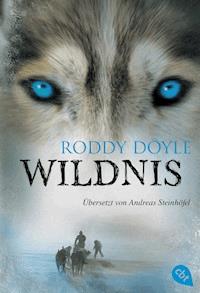
![Die Frauen hinter der Tür [ungekürzt] - Roddy Doyle - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/682ab1090d80118b80ef9e9e9b69681f/w200_u90.jpg)