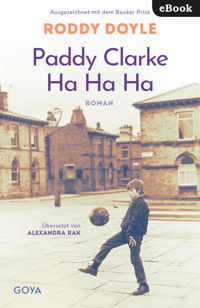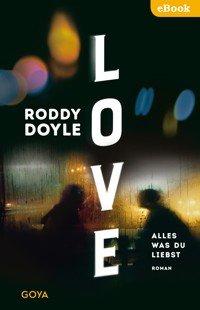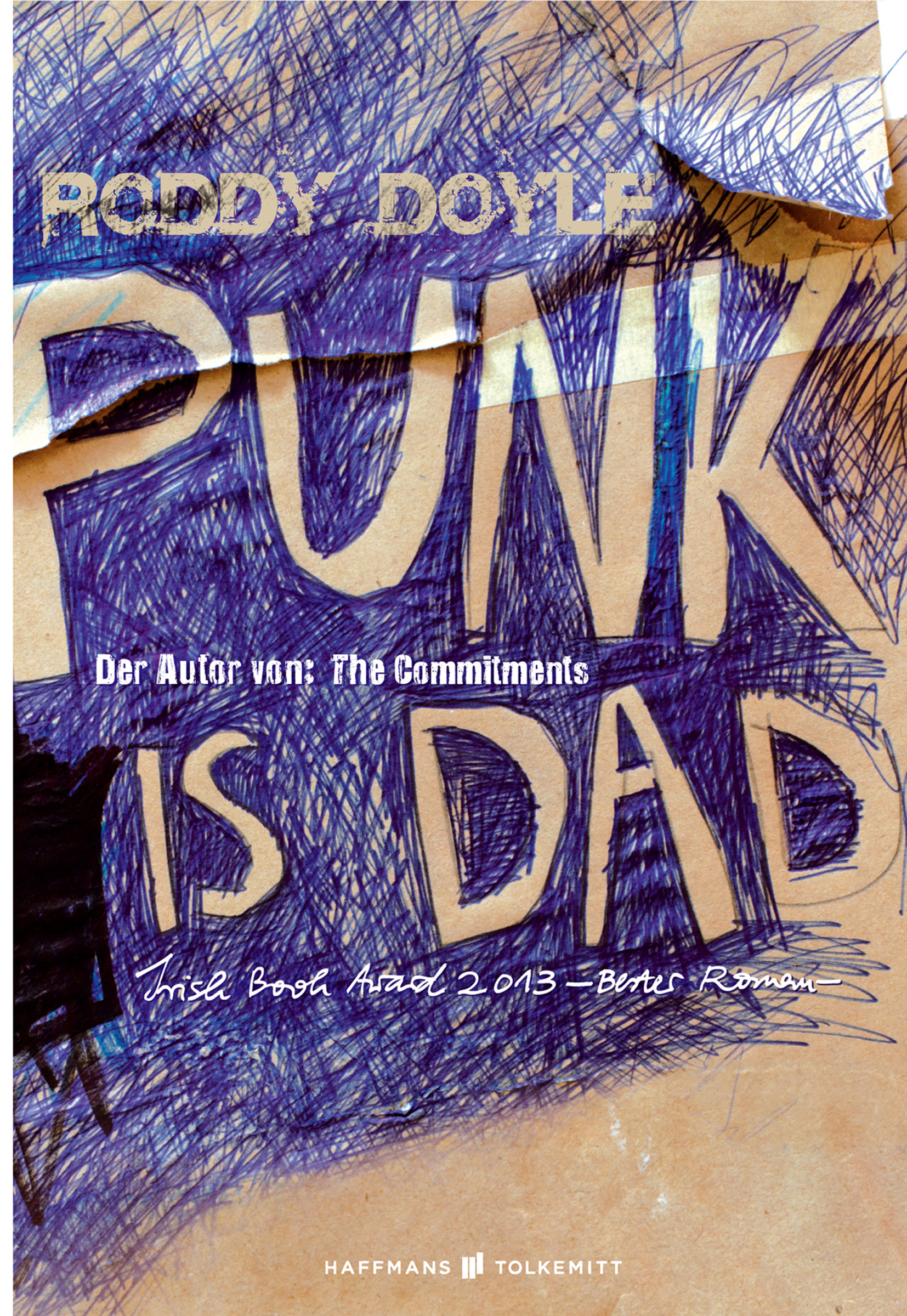19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paula Spencer lebt endlich ihr eigenes Leben. Sie ist Mutter, Großmutter, Witwe, trockene Alkoholikerin und Überlebende. Sie hat einen Job bei der Reinigung, der ihr Spaß macht, einen Mann - Joe -, mit dem sie ihre Gedanken teilen kann, Freundinnen, die sie so nehmen, wie sie ist, und vier erwachsene Kinder, die ihre eigenen Familien haben. Sie hat sich den Geistern ihrer Vergangenheit widersetzt und blickt nach vorn. Bis alles durcheinandergebracht wird, als ihre älteste Tochter Nicola vor der Tür steht. Paulas Vorzeigetochter ist auf einmal fest entschlossen, alles hinter sich zu lassen. In den kommenden Tagen vertraut Nicola ihrer Mutter nach und nach an, was diese Krise ausgelöst hat. Mutter und Tochter stellen sich dem lädierten aber wunderschönen Zusammenspiel dessen, was sie einander bedeuten. Fesselnd und schonungslos ehrlich: Die Frauen hinter der Tür ist eine bewegende Mutter-Tochter-Geschichte mit starken Frauenfiguren in Roddy Doyles unverwechselbarem Stil. Das gleichnamige Hörbuch erscheint bei GOYALiT.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eine Art zu lesen
Eine Art zu fliegen
Das Buch
Paula Spencer lebt endlich ihr eigenes Leben. Sie ist Mutter, Großmutter, Witwe, trockene Alkoholikerin und Überlebende. Sie hat einen Job bei einer Reinigung, der ihr Spaß macht, einen Mann – Joe –, mit dem sie ihre Gedanken teilen kann, Freundinnen, die sie so nehmen, wie sie ist, und vier erwachsene Kinder, die ihre eigenen Leben haben. Sie hat sich den Geistern ihrer Vergangenheit widersetzt und blickt nach vorn. Bis alles durcheinandergebracht wird, als ihre älteste Tochter Nicola vor der Tür steht. Die unabhängige, wohlhabende und liebevolle Ehefrau und Mutter – Paulas Vorzeigetochter – ist auf einmal fest entschlossen, alles hinter sich zu lassen. Mutter und Tochter finden sich zwischen Anekdoten, Witzen, Erinnerungen und Enthüllungen wieder, stellen sich der Vergangenheit und dem, was sie einander bedeuten.
Der Autor
Roddy Doyle, 1958 in Dublin geboren, ist ein mit dem Booker Prize ausgezeichneter Schriftsteller und Drehbuchautor. Der renommierte Schriftsteller studierte Anglistik und Geografie und arbeitete viele Jahre trotz großer literarischer Erfolge weiterhin als Lehrer, bevor er sich ab 1993 ganz dem Schreiben widmete. Spätestens seit Romanen wie The Commitments, The Snapper und Fish & Chips, deren Verfilmungen zu Kinohits wurden, besitzt er eine treue Leserschaft. Doyle zählt inzwischen zu den wichtigsten zeitgenössischen Autor*innen Irlands.
Die Übersetzerin
Sabine Längsfeld übersetzt seit über zwanzig Jahren Literatur aus dem Englischen und Amerikanischen ins Deutsche. Ihre Liebe für Zwischentöne und ihr feines Gespür für Dialoge haben schon manchem Titel in die Bestsellerlisten verholfen. Zu den von ihr übertragenen Autor*innen zählen u. a. Roddy Doyle, Glennon Doyle, Amitav Ghosh, Chan Ho-kei und Simon Beckett.
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel
The Women Behind the Door
bei Jonathan Cape, London.
Dieses Buch ist auch als E-Book erhältlich.
Das gleichnamige Hörbuch erscheint bei GOYALiT.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Aus Verantwortung für die Umwelt hat sich der GOYA Verlag dazu entschlossen, auf Schutzumschläge sowie Plastikfolie zum Einschweißen der Bücher zu verzichten.
1. Auflage 2025
GOYA Verlag © 2025 JUMBO Neue Medien & Verlag GmbH
Henriettenstraße 42a, 20259 Hamburg, Deutschland
www.goyaverlag.de
Copyright der Originalausgabe © 2024 by Roddy Doyle
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagabbildung: Matthias Brandes
Satz: Hanna Robinson
Gesetzt aus der Garamond Premiere
Druck und Bindearbeiten: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8337-4967-4
eISBN 978-3-8337-4968-1
Inhalt
EINS
7. MAI 2021
24. FEBRUAR 2022
13. MÄRZ 2022
12. JANUAR 2023
ZWEI
7. MAI 2021
DANKSAGUNG
Für Dan Franklin
EINS
7. MAI 2021
Sie ist gerade vom Impfen zurück. Sie setzt Wasser auf. Weshalb, weiß sie selbst nicht. Sie will gar keinen Tee. Nicht schwarz, nicht Kamille, nicht Pfefferminz. Es ist reine Gewohnheit. Manchmal schimpft sie mit sich, weil sie Tee kocht, den sie gar nicht trinkt, aber dann denkt sie – weiß sie: Der Tee hat den Alkohol ersetzt. Sie sorgt dafür, dass Hände und Kopf beschäftigt sind. Besser eine Tasse in der Hand als ein Glas, auch wenn sie – daran muss niemand sie erinnern – ihren Gin oder Wodka auch aus dem Kohleneimer gesoffen hätte. Früher waren oft nirgendwo im Haus Gläser zu finden gewesen, das hatte sie nie abgehalten.
Sie hat etwa sieben verschiedene Schachteln Tee in der Küche. Das meiste hat ihr Nicola, ihre Älteste, angeschleppt. Paula könnte schwören, dass einer – Salbei – schon seit mindestens zehn Jahren in der Ecke neben dem Toaster herumliegt. Soll er doch da bleiben. Paula würde niemals Zeug trinken, das man eigentlich dem Truthahn in den Hintern schiebt. Sie kann sich nicht mal mehr an den Geschmack erinnern. Sie weiß nur, dass sie’s hasst – sie hasst die Vorstellung.
Sie gießt Wasser in den Becher – »Glamourous Granny«, ein Geschenk von einem der Enkelkinder. Zögernd lässt sie die Hand über die Schachteln wandern und entscheidet sich für Kamille. Der besitzt beruhigende Eigenschaften, hatte Nicola behauptet.
– Genau wie der Tod, Liebes, hatte Paula gesagt.
– Sehr witzig.
– Bin ich dir nicht ruhig genug, Nicola?
– Vergiss es, sagte Nicola. – Ist übrigens auch gut bei prämenstruellen Krämpfen.
– Das sagst du mir jetzt!
Es ist seltsam, den eigenen Kindern beim Altwerden zuzusehen. Sie liebt es, mit Nicola zusammen zu sein, mit ihr unterwegs zu sein. Sie liebt es, wie die Leute sie anschauen, Frauen und Männer. Diese unglaubliche Frau, ihre Art, sich zu kleiden, sich zu geben, der Welt ins Gesicht zu schauen. Das ist meine Tochter, will Paula rufen. Ob ihr’s glaubt oder nicht, sie ist aus mir rausgekommen. Wenn Paula am absoluten Tiefpunkt ist, kann sie immer noch Nicola ansehen und sich sagen, dass nicht alles schlimm war. Und es glauben. Nicola ist eine echte Göttin, o ja. Eine Göttin in den Wechseljahren. Paula hat eine klimakterische Tochter.
– Ich hab mich durch meine Wechseljahre durchgesoffen, sagte sie zu Nicola, als sie das letzte Mal sprachen.
Arme Nicola.
Sie nimmt den Tee mit vor den Fernseher. Sie wird ihn nicht trinken, auch wenn er beruhigend ist. Der Dampf wird ihr Gesellschaft leisten. Außerdem ist sie absolut ruhig, ein bisschen beschwingt sogar. Es war ein toller Tag.
Sie hatte sich vor ungefähr zehn Tagen zur Impfung angemeldet, als es im Radio hieß, alle über fünfundsechzig dürften sich registrieren. Sie war stolz, dass sie es allein hinbekommen hatte, den ganzen Online-Kram, vor allem die Sache mit dem sechsstelligen Bestätigungscode. Sie hatte sich die Zahl nur ein einziges Mal angeschaut und lange genug gemerkt, um die Ziffern in die Kästchen zu tippen – es hatte geklappt. Fast hätte sie Nicola geschrieben, aber sie hatte es bleiben lassen. Sie war registriert – eindeutig. Es stand auf dem Bildschirm ihres Handys. Innerhalb von vier bis sieben Tagen würde sie eine Nachricht mit Datum und Uhrzeit bekommen. Sie hatte trotzdem damit gerechnet, dass es schiefging.
Sie trinkt den Tee nicht, und sie schaut auch nicht wirklich Fernsehen. Sie hat den Ton leise gestellt – sie kann kaum was verstehen. Ihre andere Tochter, Leanne, hat mal gesagt, sie hielte die Fernbedienung wie einen Zauberstab, um Voldemort abzuwehren.
– Welcher ist Voldemort?
– Ralph Fiennes.
– Den würde ich garantiert nicht abwehren.
– Er sieht aber nicht aus wie sonst.
– Ist mir egal.
– Sein Gesicht ist total zerdätscht, sagte Leanne, und sie lachten. – Er hat nicht mal ’ne richtige Nase.
– Keine Sorge, Süße, damit komm ich klar.
Sie schaltet jeden Tag um diese Zeit den Fernseher ein. Sie mag die Gesellschaft, aber eine Lieblingssendung hat sie nicht. Sie will einfach nur vor der Glotze hocken.
Als die Textnachricht kam, wurde sie nervös. Sie mochte keine Nachrichten von unbekannten Leuten oder Nummern. Die Kids, sogar ihre älteste Enkelin, haben sie alle davor gewarnt, zu antworten oder irgendwas anzuklicken. Das hätte sie sowieso nie gemacht. Paula besitzt ein Konto und eine Bankkarte, und ein paar Daueraufträge, die sie selbst eingerichtet hat. Manchmal ist sie stolz auf sich, wenn sie die Karte in der Hand hält. Sie hat einen langen Weg hinter sich, und sie hat keinen Bock, dass irgendein Penner am Arsch von Russland ihr das Konto leer räumt oder ihre Identität klaut. Paula war mit einem Dieb verheiratet und hatte Jahre gebraucht, um sich ihre Identität zurückzuholen. Das nimmt ihr niemand mehr weg. Nicht, wenn sie es verhindern kann.
Doch diese Nachricht sah sauber aus. »COVID-19-Reihenimpfung. Dosis 1, Teilnehmer/in: Spencer, Paula, Alter: 66 Jahre. Datum: Freitag, 7. Mai, 11:05h. Ort: Impfzentrum Helix Theatre (CVC). Helix Theatre DCU, Collins Avenue, Glasnevin, Dublin 9. Impfstoff: AstraZeneca. Bitte lesen Sie das Patienteninformationsblatt.« Sie sollte weder antworten noch irgendwas anklicken. Sie musste nur hingehen.
Paula hat eine gute Freundin, Mary. Sie sind gleich alt, zwischen ihnen liegen nur drei Wochen. Letztes Jahr hatten sie überlegt, gemeinsam ihren Fünfundsechzigsten zu feiern, doch dann hatte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als die Nachricht vom Impfzentrum kam, hatte sie Mary angerufen.
– Ich hab meinen Termin.
– Ich auch.
– Freitag.
– Wie bei mir.
– Im Helix.
– Super. Wir machen einen Ausflug daraus.
Das Helix befindet sich 3,2 Kilometer von dort entfernt, wo Paula jetzt sitzt. Als die Nachricht kam, hatte sie auf Google Maps nachgesehen und sich gefragt, wie sie dort hinkommen sollte. Doch dann fuhr eine gemeinsame Freundin sie hin, Mandy. Sie war vor etwa zehn Jahren in ein Haus in Paulas Straße gezogen. Sie ist ein ganzes Stück jünger als Paula und Mary – zwei von ihren Blagen gehen noch zur Schule. Sie war also noch gar nicht mit Impfen dran, sie kam einfach nur so mit, zum Spaß.
– Dürfen wir das eigentlich?, fragte Mary, als Mandy den Wagen wendete. – Ich meine, zu dritt in einem Auto.
– Die Fenster sind unten, da passiert nichts, sagte Mandy.
Sie hatte sich umgedreht, um zurückzusetzen. Sie trug eine Maske mit Leopardenmuster, die Brille war total beschlagen. Sie sah Paula direkt ins Gesicht, ohne es zu merken.
– Ich kann nichts sehen – bist du das, Paula?
– Du starrst mir direkt ins Gesicht, du Pflaume.
– Sag mir bitte, wenn ich gleich wo gegenfahre, ja?
Sie fuhr rückwärts durchs Tor, bremste und nahm die Maske ab.
– Corona oder Crash – was ist euch lieber, Mädels?
– Corona, bitte.
– Mir auch.
– Gut, sagte Mandy und hängte die Maske an den Rückspiegel.
Sie mussten lachen. Sie waren albern wie kleine Kinder. Hätte Paula es nicht besser gewusst, hätte sie meinen können, sie wäre ein bisschen beschwipst. Aber sie wusste es besser.
– Sag mal …, Paula lehnte sich so weit vor, wie der Gurt es zuließ. – Warum kommst du eigentlich mit?
– Ich geb dir einen Tipp, sagte Mandy. – Ich fahre.
– Mary hat doch auch ein Auto, sagte Paula.
– Ich hab sie darum gebeten, sagte Mary. – Ich hatte Angst, dass ich nach der Spritze nicht fahren kann.
– Und ich brauche dringend mal ein paar Stunden ohne die Kids, sagte Mandy.
– Die Kids sind in der Schule.
– Aber ihre Fotos nicht. Ihre Klamotten, ihr Essen. Einfach alles, was mit ihnen zu tun hat. Erinnerst du dich noch an unser Wochenende in Kilkenny letztes Jahr – nein, vorletztes Jahr?
– Ja, klar.
– Das jetzt ist für mich genau dasselbe, sagte Mandy. – Mein langes Wochenende.
– Okay.
– Wahnsinn, oder?, sagte Mary. – Kommt einem inzwischen wie ein anderes Leben vor.
– Stimmt.
Das Leben vor den Lockdowns ist inzwischen kaum noch vorstellbar. Auch wenn Paula das Ganze anfangs ziemlich vertraut vorgekommen war. Sie musste immer auf der Hut sein. Seit sie aufgehört hatte zu trinken und trocken geblieben war. Sie musste aufpassen, wohin sie ging und wie lange sie blieb. Sie musste mit ihren Freundinnen aufpassen. Aufpassen, was ihre Stimmung betraf. Absolut aufpassen in Sachen Geld. Es dauerte Jahre, bis sie lernte, darauf – das Auf-der-Hut-sein – stolz zu sein.
Sie sitzt allein vor dem Fernseher, mit einer Tasse Tee, den sie nicht trinkt. Genau dasselbe hatte sie vor gut einem Jahr getan, an dem Tag, als Leo Varadkar vors Mikro trat und das Land in den Lockdown schickte. Zum ersten Mal im Leben hatte Paula sich bereit gefühlt. Fähig dazu. Vorbereitet, den anderen einen Schritt voraus. Ihr ganzes Leben bestand seit Jahren aus Einschränkungen.
Sie kannte das Helix, war mit Joe schon ein paarmal dort gewesen, ihrem Freund. Hauptsächlich Opernzeug. Nur die gesungenen Arien, ohne das ganze Klimbim. Bei den ersten paar Besuchen mit ihm hatte sie sich vorgestellt, auf der anderen Seite neben ihr säße ihr Mann. Was zum Teufel soll der Scheiß, Paula? Du bist nicht hier, Charlo, du bist tot. Stimmt – aber trotzdem. Ernsthaft, Paula – dieser Bockmist? Sie hatte Charlo recht gegeben. Es war ein bisschen langweilig gewesen. Schön war es trotzdem. Und das Theater selbst war sehenswert. Außerdem hatte sie eine Schachtel Maltesers auf dem Schoß gehabt. Früher warst du auf was anderes heiß als auf beschissene Schokokugeln im Schoß – stimmt’s Paula? Verpiss dich, Charlo.
Das tut sie oft, mit Charlo sprechen, aber sie gibt dabei den Ton an. Er sagt nur, was sie will. Keine Überraschungen – es wird nie fies. Er ist in ihren Gesprächen halb so alt wie sie jetzt, aber sie auch.
– Komischer Ort für ein Theater, oder?, sagte Mandy, als sie, dirigiert von zwei Kids mit Masken und Warnwesten, die Rampe zum Parkhaus hochfuhren.
– Keine Parkgebühren, sagte Mary. – Hier kommen wir öfter her, Mädels.
– Was ist denn daran komisch?
Paula hatte das Gefühl, sich verteidigen zu müssen.
– Wir sind hier schließlich nicht am Broadway, sagte Mandy. – Sondern fast schon in Ballymun.
– In Ballymun gibt’s auch ein Theater, sagte Mary. – Das Axis. Die Kleinen von meinem John waren in einer Aufführung.
– Ein Theater in Ballymun macht ja auch Sinn, sagte Mandy. – Im Zentrum. Ballymun hat nämlich ein Zentrum – eine richtige Ortsmitte. Im Gegensatz zu hier. Wo sind wir hier eigentlich?
– Glasnevin.
– Whitehall – glaub ich.
– Versteht ihr, was ich meine? Wir sind am Arsch der Welt. Wir wissen nicht mal, wo genau.
– Das ist eine Uni, sagte Paula.
– Ja, ich bin mir sicher, dass es ganz toll ist, sagte Mandy. – Trotzdem ist die Location schräg – mehr sage ich doch gar nicht. Ich meine, würdet ihr etwa herfahren und euch hier Les Misérables ansehen?
Sie waren ausgestiegen und schauten, ob sie die Masken und alles andere dabeihatten, was sie brauchten.
– Klar, sagte Paula.
– Ich auch, sagte Mary. – Ich hab hier schon echt viel gesehen.
– The Wizard of Oz, sagte Paula. – Ich war mit Nicola und ihrer Bande hier.
– The Wizard of Oz als Theaterstück?
– Nein. Wir haben den Film gesehen.
– Warum geht man denn in ein Theater, um einen Film zu gucken?, fragte Mandy.
Sie folgten der Beschilderung zum Impfzentrum.
– Ein Orchester hat die Filmmusik gespielt, sagte Paula.
– Oh, das war sicher toll.
– Ja.
Sie war froh, dass ihr The Wizard of Oz eingefallen war. Sie hatte keine Lust, zu erzählen, dass sie mit Joe hier gewesen war. Die Mädels kapierten die Sache mit Joe nicht wirklich, was Paula mit ihm anfing, wie das zwischen ihnen lief. Obwohl sie nie ein Wort sagten, änderte sich bei beiden der Gesichtsausdruck, sobald das Thema Joe aufkam. Sie ließen die Rollläden runter. Ehrlich gesagt, wusste Paula selbst nicht, was das mit ihnen beiden war. Vor allem momentan, wo sie ihn so gut wie nie zu Gesicht bekam.
Sie standen außerhalb des eigentlichen Parkhauses, der nackten Betonschachtel, und schauten durch die Glasfront nach unten zum Theatereingang.
– Wie kommen wir da runter?
– Entweder Treppen oder Lift.
– Treppen habe ich zu Hause, sagte Mary. – Wir nehmen den Lift.
Als sich die Türen öffneten, trat ein Mann aus dem Aufzug. Die Maske bedeckte nicht mal ansatzweise sein Riesengesicht.
– Ist das hier? Ja, oder?
Er schaute sich suchend um, wahrscheinlich nach einem Mann, der ihm eine Antwort gab, dachte Paula. Aber es waren keine Männer da.
Er schaute Mary an.
– Was meinen Sie?, fragte sie.
– Das Impfen?
– Das hier ist der Parkplatz.
– Immer noch? Nein, oder? Ich dachte, ich wäre draußen.
– Das Zentrum ist da drüben, sehen Sie?
Mandy deutete auf die Glasscheiben, auf das Theater und das große Zelt vor dem Eingang und auf die Schlange, die Paula plötzlich so vorkam, als würde sie sich bis raus auf die Collins Avenue erstrecken.
– Ich dachte, das wäre hier, sagte der Mann. – Herrgott.
Er zog sich wieder in den Lift zurück und blieb mittig stehen.
– Die Treppen, Mädels, flüsterte Paula.
Als sie unten ins Freie traten, lachten sie immer noch. Die Schlange war doch nicht so schlimm und bewegte sich einigermaßen zügig vorwärts. Sie drehten sich um und sahen den dicken Mann hinter der Glasscheibe, der immer noch einen Weg ins Freie suchte, inzwischen im Erdgeschoss.
– Der Ärmste, sagte Paula. – Er ist nervös.
– Er ist einfach nur scheißblöd.
In der Nachricht vom Gesundheitsamt hatte gestanden, dass Paula nicht mehr als fünf Minuten vor dem Termin da sein sollte. Sie schaute auf ihr Telefon und freute sich. Sie war goldrichtig. Mary war eine Viertelstunde zu spät dran.
– Die schicken mich garantiert nicht wieder nach Hause, sagte sie. – Seamus, der Typ von meiner Schwester Jenny, kam einen ganzen Tag zu spät, und sie haben ihn trotzdem reingelassen. Das Wichtigste ist, dass sie uns alle geimpft bekommen – wir sind hier schließlich nicht in der Schule.
Die Schlange schob sich vorwärts, Frauen wie Männer, alle einzeln, mit Abstand, und Paula und die anderen setzten sich die Masken auf und reihten sich ein.
– Ist gar nicht so schlimm.
– Nein, läuft super.
– Da kommt ja unser Großmaul.
– Sei still.
– Dem hängt die Zunge unten aus der Maske raus.
– Sei still, verdammt.
Der Mann mit der Visage kam auf seinem Weg ans Schlangenende an ihnen vorbei. Er sah immer noch nicht glücklich aus. Er war nicht sicher, ob es die richtige Schlange war.
– Jetzt mal im Ernst, Mandy, sagte Paula. – Du solltest nicht hier sein.
– Wo ist das Problem?
Paula wollte Mary für sich allein. Das steckte dahinter. Nur kurz. Nur sie beide. Sie wollte etwas Gemeinsames mit ihr, ohne Eifersüchteleien oder Komplikationen.
– Die flippen aus, wenn die dich entdecken, sagte Paula. – ’ne Junge zwischen den ganzen Alten.
– Wobei, sagte Mary. – Hör mal.
Sie hatte die Stimme gesenkt. Paula musste mit dem Ohr nah an ihren Mund ran.
– Wir haben uns gar nicht schlecht gehalten, Mädels. Wenn man sich manche hier so anschaut.
Paula prustete in ihre Maske. Sie hatte genau dasselbe gedacht. Soweit sie sehen konnte, war sie auf ihrer Seite der Schlange die Einzige ohne Schlagseite. Alle vor ihr waren entweder nach links oder rechts geneigt oder kurz davor vornüberzukippen. Marys Brille war vom Lachen beschlagen. Es war, als könnte Paula das Lachen sehen, wie es die Gläser ausfüllte und dann verebbte.
– Die tragen alle denselben Riesentrainingsanzug – schaut doch mal, sagte Mary. – Diese Typen … Grundgütiger!
Tatsächlich, jede Menge Grau.
– Halt die Klappe, sagte Paula. – Die hören dich.
– Glaub ich nicht, sagte Mary. – Wetten, die sind auch noch stocktaub?
– Aber die Frauen, sagte Mandy. – Wenigstens ein bisschen Farbe.
Sie schaute sich mit gerecktem Hals um – glotzte – wie ein großes, nervöses Mädchen auf der Suche nach ihren Freundinnen.
– Auweia, Mädels, sagte Mary. – Ist das hier die Schlange für die Hüft-OPs oder wie?
In der Broschüre hatte was von möglichen Nebenwirkungen gestanden, aber bis jetzt: rein gar nichts; Paula fühlt sich bestens. Schmerzen im Arm, Bluterguss, Schwindel, erhöhte Temperatur – nichts davon, allerdings ist sie auch gerade erst wieder zu Hause. Joe hatte seine erste Impfung vor ein paar Wochen. Er ist ein gutes Stück älter als Paula. Ihm ging’s auch gut, hatte er ihr erzählt – er hatte sie am Tag danach angerufen. Wieder ein paar Tage später hatte sie sich mit ihm getroffen, unten am Wasser. Sie waren zum Kreisel am Ende der Causeway Road gelaufen und wieder zurück zu seinem Auto auf der Watermill Road. Das Pflaster klebt noch auf der Einstichstelle an ihrem Arm, deshalb sieht sie nicht, ob sie einen blauen Fleck hat. Aber ihr tut nichts weh. Es hatte Zeiten gegeben, da waren ihr Arm und der ganze restliche Körper mit Blutergüssen übersät.
Joe ging es gut, erzählte er ihr.
– Alles bestens, sagte er. – Nichts Ungehöriges.
Scheiße, Paula – ungehörig? Verpiss dich, Charlo. Zieh Leine.
Sie hatte Joe seitdem nicht gesehen, aber sie hatten telefoniert, und er hatte ihr, fünf Minuten nachdem sie aus dem Helix raus war, eine Nachricht geschickt. Er hatte recht gehabt. Rein und wieder raus in fünfzig Minuten. Er hatte seit letztem März keine einzige Nacht in ihrem Bett verbracht, und sie hatte nicht in seinem geschlafen. Vierzehn Monate. Zu Weihnachten hatte er sie geküsst. Das war alles. Auf die Wange. Sonst keinerlei Körperkontakt. Sie haben sich nicht an den Händen gehalten. Er nicht den Arm um sie gelegt. Sie könnte ihn anrufen. Könnte sie. Aber Paula fühlt sich wohl in ihrer Blase. Es war ein toller Tag. Morgen wird vielleicht nicht so toll.
Die Schlange hatte sich schnell auf das Zelt vor dem Eingang zubewegt, wo sie auf vier unterschiedliche Reihen aufgeteilt wurden und ein Mädchen in Warnweste mit Klemmbrett und Marker auf sie zugekommen war. Sie wollte die Uhrzeit wissen, zu der sie dran waren. Paula nannte ihren Termin und rechnete damit, gesagt zu bekommen, dass sie sich irrte, obwohl sie wusste, dass sie recht hatte. Sie sah zu, wie das Mädchen ihren Namen auf der Liste suchte und mit gelbem Marker darüberging. Sie hatte bestanden. Das Mädchen reagierte nicht, als Mary ihren Termin nannte, und interessierte sich auch nicht für ihre Ausrede – sie hörte ihr gar nicht zu. Sie blätterte nur ein paar Seiten zurück und suchte Marys Namen.
– Gut, sagte sie und markierte den Namen mit ihrem Gelbstift. – Haben Sie Ihren Ausweis dabei?
– Ja, hab ich, sagte Paula und griff in ihre Hemdtasche.
– Noch nicht, sagte das Mädchen. – Für drinnen. Die wollen den sehen.
– Ach so, sagte Paula. – Gut.
Mandy war plötzlich verschwunden, Paula hatte es gar nicht mitbekommen. Sie entdeckte sie an der Tür zum Parkhaus und winkte. Jetzt waren sie nur noch zu zweit, Paula und Mary.
– Ich bin ganz schön aufgeregt, Paula, sagte Mary. – Muss ich zugeben.
– Ja, ich auch, sagte Paula.
– Mich von einem attraktiven Doktor stechen lassen – nette Art, sich den Vormittag zu vertreiben.
– Du bist ein verdammtes Schandmaul, Mary.
– Lockdown-Leidenschaft, sagte Mary. – Gib’s zu, das würdest du dir nicht entgehen lassen. Egal, ob Film oder Buch.
– Na gut.
– Selbst in deinem Alter.
– Besonders in meinem Alter.
– Wart’s ab, Süße, das wird noch besser. Corona-Nächte.
– Ja, auf Netflix – genial.
– Spritzen in Spitzen.
– Wer spielt mit?
– Ich.
– Im Negligé.
– Ja, in meinem besten, sagte Mary. – Wie gefällt dir übrigens meine neue Strickjacke?
– Ach, ist die neu? Sehr hübsch.
Vor ein paar Jahren war sie zu dem Schluss gekommen, dass sie Strickjacken nicht ausstehen konnte. Sie hatte sich eines Tages – eines Abends – in der Ulster Bank am Bahnhof Tara Street im Spiegel einer Damentoilette gesehen, wo sie zum Putzen war. Sie trug eine Strickjacke, und weil sie sich ständig bückte und streckte und bückte und streckte, war die Jacke um die Taille herum so ausgeleiert wie ein platter Fahrradreifen. Die Jacke war ein Geschenk von Leanne gewesen, aber das war ihr egal – sie zog das Ding nie wieder an und auch keine andere Strickjacke.
– Von Dunnes, sagte Mary. – Ich bin total glücklich damit.
– Steht dir super.
– Tja, sagte Mary. – Du weißt ja, wie das ist, Süße. Wenn man’s tragen kann – man sollte nie mit seinen Reizen geizen. Hab ich recht?
– Absolut.
– Du und ich und Naomi Campbell. Wir wissen, wie man’s machen muss.
– Aber so was von, sagte Paula. – Wo steckt Naomi eigentlich?
– Die kommt doch immer zu spät, die Kuh, sagte Mary. – Ich schau mal, ob ich eine für dich finde.
Sie klopfte sich auf die Strickjacke.
– So eine hier.
– Das musst du nicht, sagte Paula.
– Kein Problem, sagte Mary. – Aber in ’ner anderen Farbe – nicht, dass du dich mit Farben auskennen würdest, Paula.
– Ach, halt’s Maul.
– Wir können unmöglich rumlaufen wie Zwillinge.
– Nein.
– Ob Zwillinge immer noch gleich aussehen, wenn sie in unser Alter kommen?
– Keine Ahnung, sagte Paula.
– Das wäre ziemlich schräg, sagte Mary.
Sie schaute sich um, als wäre sie auf der Suche nach Zwillingen im Seniorenalter.
– Ich sehe meiner Schwester kein bisschen ähnlich, sagte sie. – Gott sei Dank. Sie ist meinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten – inklusive Glatze.
– Hör auf!
Paula liebte das. Sie kam sich vor wie in der Schule, beim Anstehen vor dem Klassenzimmer. Mit ihrer besten Freundin, vertieft in ihre eigene Geheimsprache. Sie wurden von einem Mann mit Funkgerät ins Foyer geschickt, der sie weder ansah noch mit ihnen sprach. Er winkte sie einfach weiter, wie Schafe oder Autos.
– Der kriegt keine Rolle in dem Film, sagte Mary.
– Garantiert nicht.
– Fettes Schwein.
Irgendwie – es hatte was mit der niedrigen Decke zu tun – hallte Marys Stimme plötzlich sehr laut. Sie prusteten los – Paula spürte, wie ihr die Maske ins Fleisch schnitt. Sie waren von Menschen umzingelt, wortwörtlich, auch wenn die meisten versuchten, die zwei Meter Abstand einzuhalten – nicht alle. Sie konnten nicht aufhören zu lachen. Sobald sie sich ansahen, ging es von vorne los.
– Ich frage mich, ob schon mal jemand beim Lachen mit Maske in Ohnmacht gefallen ist.
– Würde mich nicht wundern.
Ein netterer Mann wies Paula einen Schalter zu. Ein junger Kerl – sie sah ihn hinter der Maske lächeln. Er redete sogar mit ihr.
– Die Nummer zehn – gleich da drüben. Danke.
Es war seltsam – nicht schön –, das Theater so zu sehen. Es war wie eine Szene aus einem Krieg oder nach einer Naturkatastrophe, einer Überflutung oder einem Großbrand vielleicht. Oder wie eine Kirche, die in einen Baumarkt oder einen Puff umgebaut worden war. Die Schalterreihe sah provisorisch aus, als wäre sie hektisch ins Foyer geworfen worden, aber das Mädchen hinter der Scheibe war nett – und geduldig, als Paula nach ihrem Ausweis kramte.
– Lassen Sie sich Zeit.
– Ich bin ein bisschen nervös, sagte Paula.
Es stimmte, merkte sie. Allein war sie nervös. Eher nervös als aufgeregt.
– Keine Sorge, sagte das Mädchen. – Ich hab meine auch schon bekommen. Ist gar nicht schlimm und tut auch nicht weh, wirklich nicht.
– Danke.
– Außerdem bekommen Sie einen Anstecker.
Das Mädchen lächelte.
– Super, sagte Paula.
Sie musste schon wieder lachen, aber diesmal unfreiwillig.
Das Mädchen schob ihr den Ausweis wieder zurück durch den Schlitz und eine Broschüre dazu.
– Das sollten Sie lesen.
– Super, sagte Paula. – Taugt es was?
Sie lachte und sah, dass das Mädchen an ihr vorbeischaute.
– Danke noch mal.
Sie folgte den Pfeilen auf dem Boden durch eine Tür in den Saal, der mal das Theater war. Durch dieselbe Tür war sie gegangen, als sie mit Nicola und den Kids und dem Jüngsten ihres Sohnes Paul hier gewesen war, um sich The Wizard of Oz anzusehen. Das war sicherlich zehn Jahre her – länger sogar. Sie erinnerte sich noch – in der Pause war Nicola mit Lily, ihrer Jüngsten, aufs Klo gegangen, und als sie sich an Paula vorbeiquetschte, hatte sie ihr etwas zugeraunt.
– Wir trennen uns.
Paula erinnerte sich, wie ihr Herz zu pochen angefangen hatte, als hätte es, noch ehe Paulas Kopf etwas mitbekam, schon kapiert, was Nicola gesagt hatte. Als sie nach dem Film in Artane bei McDonald’s gewesen waren, hatte Paula Gelegenheit gehabt, nachzufragen.
– Geht es dir gut?
Sie hoffte, dass es die richtige Frage war, wichtiger als die ganzen anderen Dinge, die sie wissen wollte.
– Klar, sagte Nicola. – Mir geht’s gut – danke. Alles in Ordnung.
– Gut. Bestens. Warum hast du – ich meine, warum hast du mir das ausgerechnet vorhin im Theater erzählt?
– Wegen dem Blechmann.
– Was?
– Wegen seinem Gesicht.
– Tony sieht doch nicht aus wie der Blechmann, Liebes.
– Ein bisschen schon.
– Nein.
– Der Blick.
Ihre Köpfe waren ganz dicht nebeneinander gewesen. Sie hatten sich zueinander gelehnt. Paula liebte diese Intimität. Trotzdem mochte sie Tony, Nicolas Mann.
– Wie lange seid ihr zwei verheiratet?
Nicola seufzte, atmete lang aus.
– Spielt doch keine Rolle.
– Weiß er es?
– Was?
– Weiß er, dass du ihn verlässt?
– Ich verlasse ihn nicht. Ich gehe nirgendwohin. Klar weiß er es. Er denkt, ich hätte einen anderen.
Nicola richtete sich etwas auf, weg von Paula, um sie anzusehen.
– Habe ich aber nicht.
– Nein.
– Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass es auch andere Gründe geben könnte, sagte Nicola. – Dass es was mit ihm zu tun haben könnte.
Sie ließ sich zurück neben Paula sinken.
– Es ist alles in Ordnung, sagte Nicola. – Mit Tony, meine ich. Er ist nett und – so wie immer. Aber …
– Was?
– Ich will ihn nicht mehr in meinem Rücken spüren. Weißt du, was ich meine?
– Ich glaube schon, sagte Paula. – Ja.
Sie war sich nicht sicher, ob sie es verstand, aber das spielte keine Rolle. Sie machte es richtig, dachte sie. Sie hörte zu. Sie urteilte nicht. Sie dachte zwar, dass Nicola wahrscheinlich den Verstand verloren hatte, aber sie behielt es für sich. Ließ sie reden. Schuf Vertrauen. Nicola war jahrelang Paulas Mutter gewesen, sie hatten in vertauschten Rollen gelebt, seit Nicola fünfzehn war – nein, noch jünger, seit sie mit angesehen hatte, wie Paula ihrem Vater die Bratpfanne über den Schädel gezogen und ihn aus dem Haus gejagt hatte. Aber jetzt war alles anders. Paula war wieder die Mutter, und das war einfach wunderbar. Und beängstigend.
Sie hatten sich nicht getrennt. Sie mussten sich ausgesprochen haben – hatten es wieder hingekriegt. Nicola erwähnte die Sache nie wieder, und Paula hakte nie nach.
Mary war jetzt vor ihr in der Schlange. Zwischen ihnen standen zwei Frauen und ein Mann. Es war der arme Volltrottel, der vorhin nicht den Weg aus dem Parkhaus gefunden hatte. Paula hoffte, dass Mary sich jetzt nicht umdrehte und ihn ebenfalls entdeckte, mit der Maske stramm auf seinem Riesengesicht, denn dann würde es sofort wieder losgehen, und er würde wissen – oder zumindest vermuten –, dass sie über ihn lachten. Er würde davon ausgehen. Das sah sie ihm an. Alles an ihm schrie Loser – er war verloren in seinem eigenen Körper. Sie beobachtete, wie er die Stufen zur Bühne hinaufstieg – sah seinen riesigen Rücken, die fetten Beine, wie er sich auf der zweiten Stufe die Jeans hochzog. Eine Frau am Ende der Stufen zeigte auf eine der Reihen, und der Typ verschwand.
Jetzt ging sie selbst die Stufen hoch. Sie fragte sich, ob sie gemerkt hätte, dass sie auf einer Bühne stand, wenn sie nicht schon einmal hier gewesen wäre. Die Bühne musste riesig sein, viel größer, als sie vom Zuschauerraum aus aussah. Sämtliche Impfkabinen waren hier untergebracht. Sie sah eine »39« und eine »38«. Auf der Bühne war genug Platz für den ganzen Impfbetrieb. Paula war jetzt nicht mehr ganz so nervös. Mary war nirgends zu sehen. Paula fühlte sich allein. Sie fühlte sich gut. Sie wartete – sie lächelte der Frau zu. Eine Frau in ihrem Alter, dachte Paula. Wahrscheinlich eine Freiwillige. Die Frau blickte in eine der Reihen hinein. Dann schaute sie Paula an.
– 27, sagte sie.
Sie machte kein Handzeichen.
Paula entdeckte die Nummer im Mittelgang, zumindest sah es so aus – da, wo in ihrem örtlichen Centra die Chips und die Kekse platziert wären. In der Kabine wurde sie von einem groß gewachsenen Mann erwartet. Er hielt ihr den Vorhang auf. Ende dreißig, schätzte sie. Hatte die Ausstrahlung eines Arztes, aber er schaute sie an und er lächelte und er machte einen Schritt zurück, um ihr genug Platz zu lassen, an ihm vorbeizukommen. Er trug ein hübsches blaues Hemd und eine seriöse Brille.
Die Kabine war so schmal wie das Klo in einem Pub – ein bisschen breiter vielleicht, aber genauso geschnitten. Nur dass hier statt einer Kloschüssel ein Tisch und zwei Stühle standen. Der Mann stand jetzt an dem Stuhl, der weiter vom Vorhang entfernt war. Paula hatte nicht gemerkt, dass er an ihr vorbeigegangen war. Er schaute sie an. Er hatte etwas gesagt, aber sie hatte es nicht gehört. Das passierte ihr manchmal – dass sie nichts hörte. Wenn sie nervös war oder Angst hatte, etwas falsch zu machen.
– Sie können sich setzen, sagte er – wieder, dachte sie.
Sie setzte sich.
– Danke.
Ihr fiel auf, dass er wartete, bis sie saß, ehe er sich selbst setzte. Er war wohlerzogen. Sie konnte es nicht fassen – sie spürte, dass Röte in ihr aufsteigen wollte, dass es direkt unter ihrer Haut warm wurde. Sie hatte geglaubt, dieser Teil von ihr wäre endgültig tot; war er hoffentlich auch. Es wäre schrecklich, hier zu sitzen und rot anzulaufen. Aber auch witzig. Sie hatte sich nie sehr weit von ihrem inneren Teenager entfernt. Es war peinlich, aber genial.
Sie hörte aufmerksam zu und antwortete an den richtigen Stellen – ihr Geburtsdatum, ihr Gesundheitszustand. Gut. Allergien. Keine. Allgemeinzustand. Auch bestens – der ging ihn nichts an. Ein bisschen inkontinent, Herr Doktor, aber nicht schlimm. Außerdem bin ich manchmal etwas einsam. Und manchmal finde ich mich zu Hause plötzlich im Flur wieder – also, ich komme wieder zu mir, meine ich, und habe keine Ahnung, wie ich dorthin gekommen bin. Aber ansonsten alles bestens.
Er war wieder aufgestanden. Er wartete darauf, dass sie den Ärmel hochkrempelte. Sie trug ein Hemd – ein Hemd, keine Bluse –, das Leanne ihr geschenkt hatte. Jeans und ein kariertes Baumwollhemd. Sie war Dolly Parton. Aber sie kriegte den Ärmel nicht schnell genug hoch. Sie musste das Hemd aufknöpfen und den Ärmel über die Schulter schieben. Wenn Mary das hörte! Nein – das würde sie ihr nicht erzählen. Es gab Dinge, die sie für sich behielt – die nur ihr allein gehörten.
– Ich verabreiche Ihnen jetzt den Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca, sagte er. – Haben Sie das verstanden?
– Klar, sagte sie. – Schießen Sie los.
Er lachte leise. Sie hörte es durch seine Maske.
– Den Einstich werden Sie wahrscheinlich spüren.
– Kein Problem, sagte sie.
Sie schaute nicht hin. Er hatte recht – es tat weh. Hätte er ihre Haut in dem Zustand von damals gesehen – so lange war das noch gar nicht her –, als sie noch der Lieblings-Punching-Bag ihres Mannes war, hätte er den Stich der Nadel mit Sicherheit nicht erwähnt. Er hätte überhaupt nichts gesagt. Aber vielleicht irrte sie sich. Vielleicht wäre er der eine Arzt in der Notaufnahme gewesen, der sich ihre Prellungen angesehen und gefragt hätte, wie das passiert war – er musste damals allerdings noch ein Kind gewesen sein, falls er überhaupt schon am Leben war, als sie das letzte Mal wegen Charlo im Krankenhaus gelandet war. Jedenfalls war er nett. Sie hatte ihn zum Lachen gebracht – es hatte ihm gefallen.
Sie zog sich das Hemd wieder über die Schulter und schloss die Knöpfe. Sie sah zu, wie er die Karte ausfüllte. Es war ihr Impfnachweis. Das wusste sie, weil Joe ihr ein Foto von seinem geschickt hatte.
Er hielt ihr die Karte hin.
– Bringen Sie das bitte mit, wenn Sie zur zweiten Impfung kommen. Er lächelte. Seine Maske bewegte sich mit seinem Gesicht.
– Paula.
Er flirtete mit ihr. So ein Bengel. Halb so alt wie sie. Sie wäre fast zu den Treppen auf der anderen Seite gerannt, um vor ihrem einfältigen Ich zu fliehen. Sie musste sich noch zehn Minuten in den Zuschauerraum setzen – es sah immer noch aus wie ein Zuschauerraum. Wahrscheinlich, um sicherzugehen, dass sie nicht in Ohnmacht fiel. Oder anfing zu kotzen. Mary war schon da. Sie saß in der Nähe der Treppe. Neben ihr stand ein freier Stuhl.
– Wie war’s?
– Die reinste Hölle, sagte Mary in einem Tonfall, der Paula zum Lachen brachte.
– Bei mir auch.
– Aber weißt du was, Paula?
– Was?
– Ich fühle mich großartig.
– Stimmt.
– Beschwingt.
– Stimmt.
– Das ist das richtige Wort, oder?
– Glaub schon, sagte Paula.
Sie hatte damit gerechnet, erleichtert zu sein. Sich sicher zu fühlen – jedenfalls sicherer. Aber nicht damit. Beschwingt. Wie nach dem Sex. Auf dem Nachklang des Orgasmus’ schwebend.
Sie sagten beide eine Zeit lang nichts, und Paula fragte sich, ob es Mary genauso ging. Manchmal vergaß sie, dass Mary eine Frau war. Mary war ein Clown, ein Witzbold, hatte immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Und sie, Paula, war ein Miststück, weil sie so dachte. Dabei konnte sie froh sein, in ihrem Alter jemanden zu haben, den sie als beste Freundin bezeichnen durfte. Sie konnte froh sein, an der Seite dieser Frau alt werden zu dürfen.
– Wie war deiner?
Die Stimme – so nah an ihrem Ohr – erschreckte sie.
– Herrgott!
Sie lachte.
– Entschuldige, Mary. Ich war gerade meilenweit weg. Was hast du gesagt?
Sie wusste nicht, warum sie fragte. Sie hatte gehört, was Mary gesagt hatte. Sie wollte Zeit schinden, Zeit, um sich zusammenzureißen.
– Wie war dein Stecher?
– Mein Stecher?
– Du weißt, was ich meine.
– Wie war dein Stecher denn?
– Ein echtes Sahneschnittchen, sagte Mary. – Der Mann mit der Maske.
Sie lachten. Paula wusste nicht genau, was daran so komisch war. Es war einfach so.
– Und was ist mit deinem?, fragte Mary.
Paula schüttelte den Kopf.
– Nix, sagte sie. – Nichts Erwähnenswertes.
– Aber schon ein Mann?
– Ja.
Sie sieht ihr Telefon aufleuchten, auf der Couch, neben ihrem Bein. Es ist immer noch stumm gestellt, seit heute Morgen in der Schlange vor dem Helix. Paula hat es oft auf stumm; sie hasst das Gebimmel.
Sie nimmt das Telefon in die Hand. Sie hält es sich vors Gesicht – die Brille liegt in der Küche. Es ist Nicola – sie hat es gewusst. Nicola hat es aufgegeben, darauf zu warten, dass Paula auf ihre Nachrichten antwortet. Paula lässt es klingeln. Sie wird Nicola in einer Minute zurückrufen, damit es sich wie ihre eigene Entscheidung anfühlt.
Sie hat die Nase voll von ihren Kindern. Nur ein bisschen. Sie darf so denken – das kann ihr niemand verbieten. Sie hat das Haus für sich allein, und sie liebt es. Leanne war als Letzte ausgezogen – endlich. Seitdem wohnt Paula allein – inzwischen sind es fünf Jahre, ein bisschen länger. Es tut ihr nicht gut, den Kindern beim Altwerden zuzusehen. Zuzusehen, wie sie Paula einholen. Das ist nicht richtig – nicht für die Kinder und nicht für sie. Es macht nur Sinn, wenn sie weggehen und dann zu Besuch kommen. Wenn ihnen ihr Leben selbst gehört. Manchmal ist Paula einsam – das gibt sie offen zu. Aber es hat nichts damit zu tun, allein in dem Haus zu leben. Es hat viel mit dem Tod zu tun. Glaubt sie. Ihr Mann – Ex-Mann. Nein, ihr Mann – sie ließen sich nie scheiden, er hatte es geschafft, sich umbringen zu lassen, ehe die Scheidung ins Land kam. Ihre Schwester Carmel. Die wichtigen Menschen sind tot. Einmal hat Joe ihr vorgeschlagen, angedeutet, auf seine verkackt höfliche Art, bei ihm einzuziehen. Nicht er bei ihr. Sie war diejenige, von der erwartet wurde, umzuziehen. Es könnte eine Überlegung wert sein. Der konnte sich verpissen, wirklich. Sie wollte in keine Wohnung ziehen, und sie wollte ihn nicht hier haben. Sie wollte überhaupt nicht mit ihm zusammenleben, egal wo. Sie erinnert sich nicht mehr daran, wann er den Vorschlag gemacht hatte. Vor Corona. Vor anderthalb Jahren. Vor zwei. Fünf. Sie weiß es nicht. Die Zeit funktioniert anders als früher.
Sie ist glücklich genug. Paula gefällt das – glücklich genug. Es heißt nicht, dass sie glücklich ist. Sie ist sich nicht sicher, wie sich Glücklichsein anfühlen würde. Aber sie weiß, dass sie glücklich genug ist. Ich bin glücklich genug – das bedeutet: Lass mich in Ruhe.
Sie schaut auf die Uhr am Telefon. Fast sechs Uhr.
Sie hält die Fernbedienung Richtung Fernseher, stellt den Ton lauter. Sie wird ihn wieder runterdrehen, wenn sie Nicola anruft. Damit sie denkt, Paula wäre beschäftigt, sie würde etwas Produktives tun. Auch wenn es nur Fernsehen ist. Sie scrollt durch die Nachrichtenkanäle und stoppt bei CNN. Das klingt schön seriös. Anfang des Jahres hatte sie auch CNN geschaut, als diese Typen in ihren Halloween-Kostümen versuchten, in Washington das Kapitol zu stürmen. Damals, als es aussah wie der Beginn eines Bürgerkriegs oder so was. Jack – ihr Jüngster – lebt in den Staaten, in Chicago. Sie schrieb ihm, um ihm zu sagen, dass sie vor dem Fernseher saß. Er schrieb zurück und sie ihm wieder. Sie saß währenddessen da und sah, was passierte und was nicht passierte, und wusste, dass Jack zur gleichen Zeit auch vor dem Fernseher saß. Es war wunderbar gewesen. Aufregend. Sie hatte durchgehalten bis drei Uhr früh und dann direkt auf der Couch geschlafen. Sie hatte sich die Federdecke aus Leannes altem Zimmer geholt. Und die Couch war ein Geschenk von Nicola. Gewissermaßen waren also ihre drei Kinder bei ihr gewesen, als sie der Demokratie beim Straucheln zusah. Auf dem Kamin steht ein Foto von John Paul und seiner Gang, er war also auch mit dabei. Alle waren sie da gewesen. Aber vor allem Jack.
Nicolas Nummer steht unter Favoriten. Sie ist absichtlich nicht ganz oben auf der Liste. Für den Fall, dass eins der anderen Kinder die Liste mal sieht. Dabei müsste sie eigentlich ganz oben stehen, aber nicht, weil Nicola ihr Lieblingskind wäre. Es ist die Nummer, die sie am häufigsten angerufen hat – die Nummer, die sie gerettet hat. Zuoberst auf der Liste stehen die Enkelkinder, dem Alter nach – das jüngste zuerst. Sie wettet, dass derjenige, der diese Funktion des Telefons entworfen hat, oder derjenige, der das Ding Favoriten genannt hat, keine Kinder hat. Maximal eins. Sie wettet, dass es ein Mann war.
– Hallo.
Nicola geht sofort dran. Sie hatte das Telefon garantiert in der Hand.
– Warte, ich stelle kurz die Kiste leise, sagt Paula. – Jetzt.
– Wie ist es gelaufen?, fragt Nicola.
– Bestens.
– Bestens?
– Ja, gut.
Paula ist der Teenager – sie gibt nur das absolute Minimum von sich preis.
– Hat es wehgetan?, fragt Nicola.
– Nein.
Nicola ist noch nicht geimpft worden. Ihr voraus zu sein, fühlt sich für Paula wie ein Sieg an. Ein Schauder rieselt durch sie durch, der so was wie Glück sein könnte.
– Und wie geht’s dir jetzt?
– Super.
– Müde?
– Nein.
Sie ist müde, aber das würde sie nicht zugeben. Es ist unwichtig. Auch wenn sie weiß, dass es ein bisschen fies ist.
– Heute war ein richtig toller Tag, sagt sie.
– Wieso das denn? Himmel.
– Warte doch mal, sagt Paula. – Schon klar, es war weder Tayto Park noch Disneyland. Aber es war – es war ein schöner Tag. Mary war dabei. Und Mandy.
Nicola toleriert Mary, aber Mandy kann sie nicht ausstehen. Mandy und Nicola sind gleichaltrig – vielleicht ist Mandy sogar ein, zwei Jahre jünger als Nicola. Paula hat Verständnis dafür. Ihre Mutter macht mit einer Frau in ihrem Alter auf Freundin. Sie müsste Mandy nicht erwähnen, aber sie tut es trotzdem. Mit Absicht. Sie hört Nicola nichts sagen, hört sie Worte runterschlucken.
– Mary hatte ihren Termin auch heute, sagt Paula. – Und Mandy hat uns gefahren. Wir haben einen Ausflug draus gemacht. Mandy wollte endlich mal ohne ihre Kids zu McDonald’s.
Nicola sagt immer noch nichts. Paula kommt sich ein bisschen grausam vor. Aber nicht grausam genug, um es bleiben zu lassen.
– Also sind wir losgezogen, sagt sie. – Nur so, zum Spaß. Wir waren im Drive-in. Reingehen ging nicht. Dafür haben wir die Sachen mit nach Dollymount genommen. Mary hatte eine Thermoskanne Kaffee und ein bisschen Kuchen dabei.
Paula fasst sich beim Reden an die Stirn.
– Ich glaub, ich hab mir tatsächlich einen kleinen Sonnenbrand geholt, sagt sie. – Wir waren den ganzen Nachmittag am Strand. Die Mädels haben sich sogar ein Glas Wein gegönnt.
– Nicht zu fassen, ihr habt ein Picknick gemacht?
– Ja. So habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber du hast recht.
Paula lacht.
– Verrückt, sagt sie. – Wie geht es dir, Süße?
Sie fühlt sich gesättigt. Das Wort hat sie von Joe. Gesättigt. Es klingt schöner als satt, und sie war überrascht gewesen, dass sie es nicht kannte, als sie es – zumindest bewusst – zum ersten Mal hörte. Paula lächelt bei der Erinnerung daran, wie er es sagte und wo und wann. Aber das wird sie Nicola nicht erzählen. Nicola ist wirklich die Beste, aber jetzt gerade und für den Rest dieses Tages kann sie ihr den Buckel runterrutschen. Sobald sie es gedacht hat, löst sich der Gedanke wieder auf – verschwindet einfach.
– Weißt du, wie ich mich hinterher gefühlt habe, Nicola?, sagt sie. – Nach der Impfung, meine ich. Nach der Erfahrung.
– Wie?
– Beschwingt, sagt Paula.
– Wie meinst du das?
Nicola gibt sich Mühe, das muss sie ihr lassen. Es liegt kein Unterton in ihrer Frage – keine Aggression, kein Sarkasmus.
– Ich hab mich einfach … Ich kam mir vor, als hätte ich meine Prüfungsergebnisse bekommen und richtig gut abgeschnitten.
Sie lacht. Nicola weiß Bescheid – sie muss nichts erklären. Paula hat in ihrem ganzen Leben noch keine Prüfung abgelegt. Nicht in der Schule und auch sonst nirgendwo.
– Außerdem hab ich jetzt meinen Teil beigetragen, weißt du? Ich stecke schon mal niemanden an. Jedenfalls war es toll.
– Gut.
– Und weißt du was?
Sie mag Nicola, sie liebt sie. Dieses »Gut«, es war ganz weich gewesen, so wie Nicola es sagte. Sie hatte verstanden. Sie hatte mit Paula auf Augenhöhe gesprochen. Als würde sie ihr vertrauen. Es lag sogar ein bisschen Neid darin.
– Wir haben Stare gesehen, sagt sie. – In Dollymount.
Paula weiß, wie Stare aussehen und konnte Mary und Mandy sagen, was das für Vögel waren.
– Das sind nicht einfach nur irgendwelche Vögel, Mary, hatte sie gesagt. – Das sind Stare.
Das wusste sie von Joe. Sie hatten an einem eiskalten Tag vor Jahren einen ganzen Schwarm Stare gesehen, eine Murmuration – es gibt einen Fachbegriff dafür –, eine Formation, die sich vor ihren Augen in der Luft verwandelte, wie eine Flugshow. Etwas später hatten sie dann auf der Stuhllehne vor einem Café einen einzelnen Vogel hocken sehen, und Joe hatte ihr gesagt, dass es ein Star war. Als sie heute in Dollymount die Vögel sah, draußen auf Bull Island, zwischen parkenden Autos und Motorrädern, direkt neben dem Happy Out, war sie – schon wieder – beschwingt gewesen. Es hatte sich schön angefühlt, sie benennen zu können.
– Das sind wirklich wunderschöne Vögel, erzählt sie Nicola. – Dieses schillernde Gefieder – meine Güte.
Paula fühlt sich ein bisschen high. Nicola könnte denken, sie wäre betrunken. Sie kann ihr nicht sagen, dass sie es nicht ist – das würde das Gegenteil beweisen.
– Es waren total viele, sagt sie. – Stare, meine ich. Auf der Suche nach Futter, Krümel und so. Und weißt du was?
– Was denn?
– Du glaubst nicht, was die für Geräusche machen. Sie haben die Autoschlösser nachgemacht.
– Wie bitte?
– Stare sind super Schauspieler, sagt Paula. – Sie machen die Rufe von anderen Vögeln nach und – das ist jetzt nicht gelogen, okay? Du kennst doch dieses Geräusch, wenn man auf das Schlüsseldings drückt und das Auto absperrt?
– Ja klar.
– Genau dieses Geräusch haben sie gemacht, sagt Paula. – Die Mädels waren total begeistert.
Paula hatte sich so über die Gesichter der anderen gefreut, als ihnen klar wurde, was sie da hörten, was Paula ihnen da erklärte. Sie war sich vorgekommen wie eine Dompteurin, als hätte sie das mit den Vögeln zusammen geprobt.
– Ich hatte einfach einen richtig schönen Tag, sagt sie. – Keine Angst, morgen bin ich wieder ganz normal.
Jetzt wäre Nicola mit Reden dran. Aber sie sagt nichts.
– Und du, Süße? Wie geht es dir?, fragt Paula wieder.
– Na ja …
– Nicola?
– Super, sagt Nicola. – Nein, wirklich, alles gut. Bin nur müde. Ich wollte nur wissen, wie es gelaufen ist.
Nicola hat aufgelegt. Paula lässt das Telefon aufs Sofa fallen. Sie ruft sie morgen noch mal an und redet wirklich mit ihr, fragt sie richtig, wie es ihr geht, ist ihr eine Mutter und Freundin. Aber nicht heute Abend. Sie würde ihr nicht zuhören. Joe ist sicher der Nächste – als Nächstes wird Joe sie anrufen. Joe mit seinen Scheißworten. Sie ist unfair zu ihm. Denkt sie manchmal. Der gesättigte Joe.
Sie hatten im Bett gelegen. In Joes Bett, in Howth. Er hatte ihr erzählt, dass die Japaner ein Wort für den mentalen Zustand des Mannes direkt nach dem Orgasmus hatten.
– Den Zustand des Mannes?, hatte sie gesagt.
Sie deckte sich wieder zu, wollte aber nicht, dass es zu hektisch oder zu offensichtlich wirkte.
– Ja.
– So wie keuchen und schwitzen?, sagte sie. – Ist das der Zustand, von dem du sprichst?
– Ich keuche nicht, sagte Joe.
– Aber du schwitzt, sagte sie. – Will ich doch hoffen.
Sie legte ihm die Hand auf den fleischigen Rücken. Er war feucht und warm. Sie fühlte seine Atemzüge unter ihrer Hand, sein höfliches kleines Keuchen.
Er lachte.
– Nein, den Zustand meine ich nicht, sagte er. – Ich meine den mentalen Zustand.
– Was für einen mentalen Zustand denn?
– Gute Frage.
– Ich dachte, nach einem guten Ritt wäre man hohl in der Birne?
– Ja, ganz genau.
Er setzte sich auf und lehnte sich gegen das Kopfteil. Er bedeckte sich nicht. Joe war eine seltsame Mischung. Beim Wort »fuck« zuckte er zusammen, aber wenn es um Sex ging, nahm er kein Blatt vor den Mund. Er redete total offen über einfach alles – fast wissenschaftlich. Außerdem verlor er beim Sex jede Unsicherheit. Es war ihm egal, dass er zweiundsiebzig war. Es war ihm egal, was sie sah oder was er von sich selbst sah.
– Hab ich gelesen, sagte er.
– Wo?
– In der Zeitung, sagte er. – Ist schon eine Weile her. Ich meine, es stand im Observer.
Joe las sonntags zwei verschiedenen Zeitungen, von der ersten bis zur letzten Seite. Er ging bei jedem Wetter los, um sie zu besorgen. Selbst ein Krieg hätte ihn nicht davon abgehalten. Joes Angewohnheiten waren mehr als nur Angewohnheiten. Ein paar Monate in Joes Gesellschaft hatten Paula gelehrt, dass es mehr Süchte gab als Alkohol und Glücksspiel.
– Na ja, jedenfalls dieser japanische Begriff, sagte er.
– Wie heißt das Wort?
– Weiß ich nicht mehr, sagte er.
– Sprichst du eigentlich Japanisch, Joe?
– Eine der wenigen Sprachen, die ich nicht beherrsche, sagte er.
Auch das, diese Antwort – so was hätte er nie gesagt, wenn sie unterwegs gewesen wären oder auch nur in der Küche. Es hätte ein bisschen gedauert, bis er gecheckt hätte, dass sie sich über ihn lustig machte. Diese Version von Joe existierte ausschließlich im Bett.
– Jedenfalls, dieser Begriff, sagte er. – Wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet dieses Wort übersetzt »Zeit des weisen Mannes«. Der Mann ist hinterher gelassen, weise, rational – solche Dinge eben.
– Ach was?
– Soweit ich mich erinnern kann, sagte er. – Ich finde das faszinierend.
– Die sind lustig, die Japaner.
– Findest du das nicht beeindruckend, Paula?
– Frauen kriegen ihre Tage und tragen Kinder aus, aber zu Männern sagt man weise, wenn sie sich einen runterholen?
Er lachte. Lauter, als er jemals sonst irgendwo lachte.
– Und überhaupt, sagte sie. – Was hat so ein Mist eigentlich in der Zeitung verloren?
Er lachte wieder. Sie fand es schön, den Kerl zum Lachen zu bringen. Er nahm es ihr nie übel, dass sie von ihnen beiden die Witzige war. Er zahlte ihr nie etwas heim.
Er packte sie am Knöchel und tat, als würde er sie zu sich zerren.
– Für die Japaner kann ich nicht sprechen, sagte er. – Aber als Bürger Irlands würde ich nicht für mich in Anspruch nehmen, weise oder besonders rational zu sein, wenn ich einen Orgasmus hatte – was mir in deiner Gesellschaft übrigens ausnehmend leichtfällt.
– Vielen Dank.
– Ehre, wem Ehre gebührt.
– Du solltest Viagra danken, nicht mir.
– Das solltest du auch tun, sagte er. – Finde ich. Soll ich dir sagen, wie ich mich gerade fühle?
– Na gut, spuck’s aus.
– Gesättigt, sagte er.
*
Er wird anrufen.
Warum ruft sie ihn nicht an?
Er hatte ihr vor der Impfung geschrieben, ihr Glück gewünscht, ihr gesagt, dass er an sie denkt. Sie fragt sich, ob das stimmt. Sie denkt nicht besonders viel an ihn. Ob das stimmt, weiß sie auch nicht. Ihr fällt die Vorstellung schwer, wie sie ihm die Hand auf den Rücken legt, oder sich daran zu erinnern, wie er ihr die Hand auf den Rücken legt – es ist alles so lange her. Körperkontakt ist eigentlich keine Erinnerung. Oder es ist ausschließlich Erinnerung.
Neulich wäre sie fast aus den Latschen gekippt – das ist jetzt vielleicht eine Woche her –, weil sie plötzlich Finger an ihrem Hals spürte, direkt unter dem Ohr – unter dem rechten. Es waren keine Finger da – keine echten. Sie war allein, aber es passierte trotzdem – die Finger, es waren zwei, lagen plötzlich auf ihrem Hals, nur ganz leicht, aber eindeutig spürbar, bewegten sich abwärts, streichelten ihre Haut, und sie glaubte ein Handgelenk zu spüren, das sich sanft gegen ihre Brust drückte. Dann war das Gefühl wieder verschwunden. Sie hatte sich gegen den Tisch gelehnt – es war in der Küche passiert. Sie wollte den Druck der Tischkante an ihren Beinen spüren. Es sollte nicht aufhören. Das Gefühl. Sie stöhnte, sie seufzte irgendwas – was, wusste sie selbst nicht –, es kam von tief unten. Die Finger waren weg. Es waren nicht Joes Finger gewesen – der letzte Mann, der sie angefasst hatte. Sie gehörten niemandem. Diese Finger waren ihre eigene Erfindung – ihre Einbildung. Trotzdem waren sie real gewesen, streichelnd, zärtlich. Übten Druck aus, waren lebendig. In dem Moment, als sie die Finger an ihrem pochenden Hals gespürt hatte, war sie von ihrer Realität überzeugt gewesen.
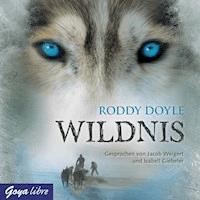

![Die Frauen hinter der Tür [ungekürzt] - Roddy Doyle - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/682ab1090d80118b80ef9e9e9b69681f/w200_u90.jpg)