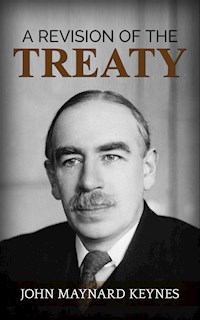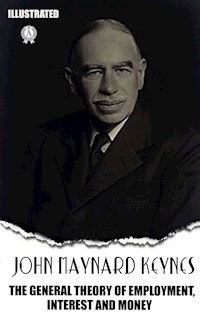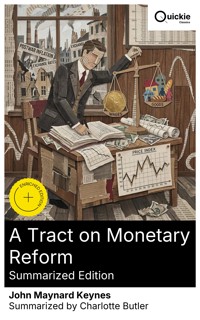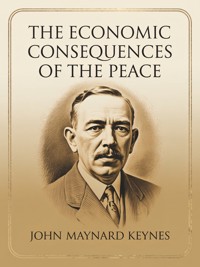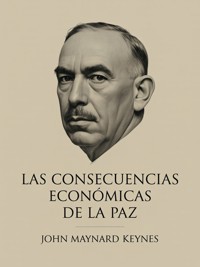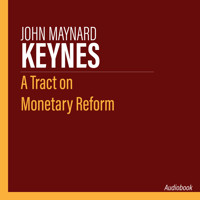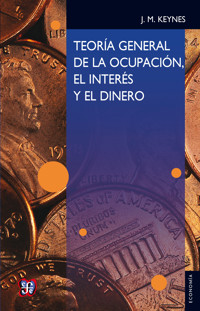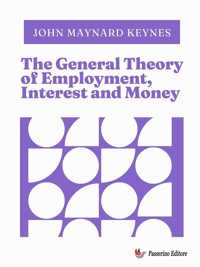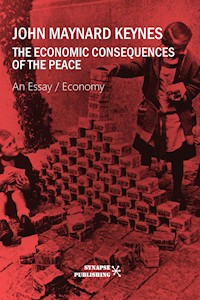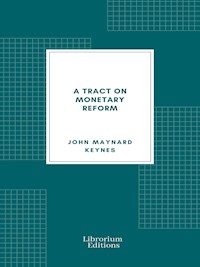35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes« gilt als das Hauptwerk des britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Das Werk erschien 1936 und stellte die bis dahin dominierende klassische ökonomische Theorie in Frage. Keynes wehrte sich insbesondere gegen die Annahme, ein freier Markt führe unweigerlich zu einem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht, bei dem auch Vollbeschäftigung erreicht wird, und kritisierte die bis dato vorherrschende »Laissez-faire«-Politik. Stattdessen forderte er eine aktive staatliche Konjunkturpolitik. Das Werk läutete in der Wirtschaftswissenschaft die Keynesianische Revolution ein. Das Opus magnum des großen Ökonomen liegt nun in einer vollständigen Neuübersetzung vor. Keynes' zum Teil revolutionäre und angesichts der wirtschaftlichen Turbulenzen und Krisen des neuen Jahrtausends höchst aktuell erscheinenden Überlegungen und Schlussfolgerungen endlich auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen, das ist die Hoffnung, die sich mit der Neuübersetzung dieses Buchs verbindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
John Maynard Keynes
Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlag: John Maynard Keynes (undatiert) (© ullstein bild)
Für die deutsche Ausgabe alle Rechte vorbehalten © 2017 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde Druck: Das Druckteam, Berlin Printed in Germany
ISBN 978-3-428-15048-9 (Print) ISBN 978-3-428-55048-7 (E-Book) ISBN 978-3-428-85048-8 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort zur neu übersetzten Ausgabe
Im Jahr 1935 vollendete John Maynard Keynes seine allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, und ein Jahr später erschien bereits die von Fritz Waeger unter Hochdruck übersetzte deutsche Ausgabe. Ist das englische Original, von dem Keynes selbst sagte, dass er es nicht für ein breites Publikum, sondern nur für Fachleute geschrieben habe, schon sowohl inhaltlich als auch sprachlich komplex, so war die bisherige Übersetzung bisweilen nur mehr schwer verständlich.
Keynes’ zum Teil revolutionäre und angesichts der wirtschaftlichen Turbulenzen und Krisen des neuen Jahrtausends höchst aktuell, ja sogar brisant erscheinenden Überlegungen und Schlussfolgerungen endlich auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen, das ist die Hoffnung, die sich mit der Neuübersetzung dieses Buchs verbindet.
Aus diesem Grund fiel in den Fällen, wo eine eng ans Original angelehnte Übersetzung den Lesefluss behindert hätte, die Entscheidung im Zweifel für die Lesbarkeit und damit für eine freiere Formulierung. Es wurde auch nicht versucht, Sprache und Begriffe an den Stil der 1930er Jahre anzupassen. So wurde die etwas altertümliche Bezeichnung Rentier, wo es sinnvoll erschien, durch Kapitalgeber ersetzt. Und wenn Keynes dem Rentier (in Waegers ursprünglicher Übersetzung war es ein Rentner) eine Euthanasie zudachte, wird ihm jetzt nur ein langsames Ende prophezeit.
Auch in einigen anderen Fällen wurde, wenn es der Klarheit dient, von einer allzu wörtlichen Übersetzung Abstand genommen. Die factors of production wurden beispielsweise zu einfachen Beschäftigten, wenn aus dem Zusammenhang klar hervorgeht, dass nur von diesen die Rede ist und nicht von anderen Faktoren wie Boden und Kapital. Ebenfalls aus dem Kontext ergibt sich, dass mit banking system meist nicht das gesamte Bankensystem, sondern speziell die Zentralbank gemeint ist.
Um den modernen Lesegewohnheiten Rechnung zu tragen und den Lesefluss möglichst wenig zu unterbrechen, wurden auch die Zitate aus anderen Werken, selbst da, wo diese in deutscher Fassung vorliegen, neu übersetzt (eine Ausnahme ist die von Bobertag et al. kongenial in deutsche Reime übertragene Bienenfabel von Bernard Mandeville).
Ohne die wertvolle Unterstützung von Prof. Dr. Ingo Barens und Prof. Dr. Volker Caspari von der TU Darmstadt, beide Mitglieder der Keynes[6]Gesellschaft, hätte ich in vielen Zweifelsfällen eine endgültige Entscheidung, welcher deutsche Begriff der Intention des Autors am nächsten kommt, kaum treffen können. Für die ausführlichen Antworten und Erläuterungen auf meine zahlreichen diesbezüglichen Fragen und für ihre Hilfe bei einer möglichst korrekten Übersetzung von Fachwörtern wie marginal prime cost oder rent-factors sowie historisch eingebetteten Begriffen wie animal spirits oder natural surplus bin ich beiden zu größtem Dank verpflichtet. Prof. Barens hat sich überdies der Mühe unterzogen, den gesamten Text noch einmal durchzugehen und, wo nötig, Änderungen vorzunehmen.
Nicola Liebert, 31. März 2016
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur englischen Originalausgabe
Vorwort zur deutschen Ausgabe
BUCH I
Einleitung
Kapitel 1:
Die allgemeine Theorie
Kapitel 2:
Die Postulate der klassischen Ökonomie
Kapitel 3:
Das Prinzip der effektiven Nachfrage
BUCH II
Definitionen und Konzepte
Kapitel 4:
Die Wahl der Maßeinheiten
Kapitel 5:
Erwartungen als Bestimmungsfaktor für Produktion und Beschäftigung
Kapitel 6:
Die Definition von Einkommen, Ersparnissen und Investitionen
Kapitel 7:
Weitere Betrachtungen über die Bedeutung von Ersparnissen und Investitionen
BUCH III
Die Konsumneigung
Kapitel 8:
Die Konsumneigung I: Die objektiven Faktoren
Kapitel 9:
Die Konsumneigung II: Die subjektiven Faktoren
Kapitel 10:
Die marginale Konsumneigung und der Multiplikator
BUCH IV
Der Anreiz zur Investition
Kapitel 11:
Die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals
Kapitel 12:
Die langfristige Erwartungshaltung
Kapitel 13:
Die allgemeine Theorie des Zinssatzes
Kapitel 14:
Die klassische Theorie des Zinssatzes
Kapitel 15:
Die psychologischen und wirtschaftlichen Liquiditätsanreize
Kapitel 16:
Verschiedene Betrachtungen über das Wesen des Kapitals
Kapitel 17:
Die wesentlichen Eigenschaften des Zinses und des Geldes
Kapitel 18:
Eine Neuformulierung der allgemeinen Theorie der Beschäftigung
BUCH V
Nominallöhne und Preise
Kapitel 19:
Änderungen der Nominallöhne
Kapitel 20:
Die Beschäftigungsfunktion
Kapitel 21:
Die Theorie der Preise
BUCH VI
Durch die allgemeine Theorie nahegelegte kurze Anmerkungen
Kapitel 22:
Anmerkungen zum Konjunkturzyklus
Kapitel 23:
Anmerkungen zu Merkantilismus, Wuchergesetzen, Freigeld und Unterkonsumtionstheorien
Kapitel 24:
Abschließende Bemerkungen über eine aus der allgemeinen Theorie abzuleitende Sozialphilosophie
Symbolverzeichnis
Vokabularium
Namenregister
Sachregister
Vorwort zur englischen Originalausgabe
Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Wirtschaftswissenschaftler. Ich hoffe zwar, dass es auch für andere verständlich ist. Aber sein Zweck ist vor allem die Erörterung schwieriger theoretischer Fragen und nur in zweiter Linie die praktische Anwendung dieser Theorien. Denn wenn sich die orthodoxe Ökonomie als fehlerhaft erweist, so liegt der Fehler nicht im Überbau, bei dessen Errichtung große Sorgfalt auf logische Konsistenz verwendet wurde, sondern in der mangelnden Klarheit und Allgemeingültigkeit ihrer Prämissen. Meine Absicht, Ökonomen zur kritischen Überprüfung einiger ihrer grundlegenden Annahmen zu bewegen, kann ich daher nur durch eine äußerst abstrakte Argumentation und kontroverse Thesen umsetzen. Letzteres hätte ich gerne vermieden. Ich hielt es jedoch für wichtig, nicht nur meinen eigenen Standpunkt darzulegen, sondern auch zu zeigen, inwiefern er von der herrschenden Theorie abweicht. Wer stark zu dem neigt, was ich die ‚klassische Theorie‘ nenne, dürfte meiner Vermutung nach schwanken zwischen der Überzeugung, dass ich völlig falsch liege bzw. dass ich nichts Neues zu sagen habe. Es mögen andere entscheiden, ob eine dieser Annahmen zutrifft oder aber eine dritte Alternative. Meine Streitschrift soll einen Beitrag zur Beantwortung der offenen Fragen leisten, und ich muss um Entschuldigung bitten, wenn im Bemühen um eine saubere Differenzierung die Kontroverse zu scharf ausfallen sollte. Ich selbst war jahrelang von den Theorien überzeugt, die ich jetzt kritisiere, und bin mir ihrer Stärken durchaus bewusst.
Die Bedeutung der strittigen Fragen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn meine Erklärungen zutreffen, muss ich jedoch zuerst meine Fachkollegen von deren Richtigkeit überzeugen und nicht die breite Öffentlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt ist die Öffentlichkeit, so willkommen ihre Teilnahme ist, doch nur Publikum bei dem Versuch, die tiefen Meinungsverschiedenheiten zwischen Ökonomen beizulegen, die den praktischen Einfluss der Wirtschaftswissenschaft derzeit – und, wenn sie nicht endlich ausgeräumt werden, auch in Zukunft – fast zunichte machten.
Die Verbindung zwischen diesem Buch und meiner vor fünf Jahren erschienenen Abhandlung Vom Gelde ist vermutlich mir selbst klarer als vielen anderen. Was in meiner eigenen Vorstellung die natürliche Fortentwicklung eines Gedankengangs ist, den ich nun schon seit mehreren Jahren verfolge, mag dem Leser gelegentlich als verwirrender Sinneswandel er[10]scheinen. Erschwerend kommt hinzu, dass ich gewisse Änderungen in der Terminologie für nötig erachtete, die ich auf den folgenden Seiten erläutern werde. Doch generell lässt sich das Verhältnis zwischen den beiden Büchern in aller Kürze wie folgt darstellen: Als ich Vom Gelde zu schreiben begann, dachte ich noch in den herkömmlichen Mustern, wonach der Einfluss des Geldes in keinem Zusammenhang mit der allgemeinen Theorie von Angebot und Nachfrage zu stehen scheint. Beim Abschluss des Buches hatte ich einige Fortschritte dabei gemacht, die Geldtheorie wieder als eine Theorie der Gesamtproduktion zu etablieren. Dass ich jedoch den hergebrachten Vorstellungen verhaftet geblieben war, zeigte sich in dem, was mir inzwischen als der größte Fehler im theoretischen Teil dieses Werks (Buch III und IV) erscheint: nämlich dass ich mich nicht gründlich genug mit der Wirkung von Veränderungen der Produktionsmenge befasst hatte. Meine sogenannten „Grundgleichungen“ waren eine Momentaufnahme, die auf der Annahme einer gegebenen Produktionsmenge beruhte. Sie sollten zeigen, wie unter dieser Annahme Kräfte entstehen können, die ein Gewinnungleichgewicht bedingen und so eine Veränderung der Produktionsmenge erforderlich machen. Aber im Gegensatz zu dieser Momentaufnahme blieb die dynamische Entwicklung unvollständig und äußerst verworren. Dieses Buch ist demgegenüber vor allem zu einer Untersuchung derjenigen Kräfte geworden, die Veränderungen des gesamten Produktionsvolumens und der Beschäftigung verursachen. Und auch wenn sich dabei zeigt, dass Geld eine wesentliche und zugleich eigentümliche Rolle im Wirtschaftssystem spielt, treten die technischen Details der Geldtheorie dabei in den Hintergrund. Wie wir noch sehen werden, lässt sich von einer Geldwirtschaft sprechen, wenn Veränderungen der Zukunftserwartung nicht nur die Art, sondern auch die Menge der Beschäftigung zu beeinflussen vermögen. Aber unsere Methode, das wirtschaftliche Verhalten der Gegenwart unter dem Einfluss sich ändernder Annahmen über die Zukunft zu analysieren, ist abhängig vom Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage und ist im Übrigen auch verknüpft mit unserer grundlegenden Werttheorie. Wir gelangen so zu einer allgemeineren Theorie, innerhalb derer die uns vertraute klassische Theorie einen Spezialfall darstellt.
Der Autor eines solchen Buchs, der auf unbekannten Pfaden wandelt, ist sehr auf Kritik und Diskussionen angewiesen, um allzu viele Fehler zu vermeiden. Es ist erstaunlich, auf welch törichte Ideen man zuweilen kommt, wenn man zu lange allein für sich nachdenkt, ganz besonders in der Volkswirtschaftslehre (aber auch anderen Geisteswissenschaften), wo es oft unmöglich ist, seine Ideen beweiskräftigen formalen oder experimentellen Tests zu unterziehen. Für dieses Buch habe ich mich, mehr noch als für Vom Gelde, auf den beständigen Rat und die konstruktive Kritik von R. F. Kahn verlassen. Umfangreiche Teile dieses Buches hätten ohne seine Anregungen [11] nie ihre jetzige Form erhalten. Des Weiteren habe ich wertvolle Hilfe erhalten von Joan Robinson, R. G. Hawtrey und R. F. Harrod, die sämtliche Druckfahnen Korrektur gelesen haben. Das Sachregister wurde von D. M. Bensusan-Butt vom King’s College in Cambridge erstellt.
Das Schreiben dieses Buches stellte für den Autor einen lang- wierigen Kampf dar, aus alten Denkmustern auszubrechen, und genauso muss es auch den Lesern ergehen, wenn der Autor mit seiner Kritik Erfolg haben will. Die Überlegungen, die hier so mühevoll dargelegt werden, sind äußerst einfach und geradezu offensichtlich. Die Schwierigkeit besteht nicht darin, neue Ideen zu entwickeln, sondern aus den alten auszubrechen, die sich in allen Winkeln der Köpfen derer festgesetzt haben, die so wie die meisten von uns unterrichtet wurden.
J. M. Keynes, 13. Dezember 1935
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Alfred Marshall, mit dessen Principles of Economics (Handbuch der Volkswirtschaftslehre) alle zeitgenössischen englischen Ökonomen groß geworden sind, strich stets die Kontinuität seines Werks mit dem Ricardos heraus. Seine Leistung bestand vor allem darin, die Tradition Ricardos um die Gesetze des Grenznutzens und der Substitution zu erweitern. Allerdings ist seine Theorie der Produktion und des Konsums insgesamt – im Gegensatz zu seiner Theorie der Produktion und Distribution einer gegebenen Gütermenge – nie aufgegriffen worden. Ich bin nicht sicher, ob er selbst eine solche Theorie für notwendig erachtete. Fest steht, dass seine unmittelbaren Nachfolger und Schüler darauf verzichteten und sie offenbar auch nie vermisst haben. Das war das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Ich habe dann selbst diese Theorien gelehrt, und erst in den vergangenen zehn Jahren wurde mir ihre Unzulänglichkeit bewusst. Im Zuge meiner eigenen Entwicklung stellt dieses Buch für mich daher eine Reaktion auf die klassische (oder orthodoxe) englische Tradition bzw. eine Loslösung davon dar. Dass ich darauf auf den folgenden Seiten einen Schwerpunkt lege ebenso wie auf meine Divergenzen zur bisherigen Doktrin, wurde in einigen Kreisen als unangemessen kontrovers angesehen. Aber wie kann jemand, der im orthodoxen ökonomischen Glauben erzogen wurde, Auseinandersetzungen vermeiden, wenn er zum protestantischen Glauben übertritt?
Ich kann mir jedoch vorstellen, dass deutsche Leser anders dazu stehen. Die orthodoxe Tradition, die im 19. Jahrhundert in England vorherrschte, war in der deutschen Debatte nie sehr fest verankert. Es gab in Deutschland immer auch wichtige wirtschaftswissenschaftliche Schulen, die die klassische Theorie als wenig geeignet für die Analyse aktueller Geschehnisse erachteten. Sowohl der Manchesterliberalismus als auch der Marxismus leiten sich letztlich von Ricardo ab – eine nur auf den ersten Blick überraschende Feststellung. In Deutschland gibt es jedoch seit jeher eine breite theoretische Strömung, die keiner dieser Schulen angehört.
Gleichwohl kann man nicht gerade behaupten, dass diese Denkschule ein rivalisierendes Theoriegebäude errichtet oder dies auch nur versucht hätte. Sie blieb vielmehr skeptisch und realistisch und gab sich mit historischen und empirischen Methoden bzw. Ergebnissen ohne formale Analyse zufrieden. Die in diesem Zusammenhang wichtigste heterodoxe theoretische Abhandlung stammt von Wicksell. Seine Bücher waren auf Deutsch [14] erhältlich (bis vor kurzem hingegen nicht auf Englisch), und eines seiner wichtigsten Werke wurde sogar auf Deutsch verfasst. Seine Anhänger aber waren hauptsächlich Schweden und Österreicher, wobei letztere seine Erkenntnisse mit spezifisch österreichischen Theorien kombinierten und sie so letztlich wieder in Richtung der klassischen Tradition zurückentwickelten. Somit kam Deutschland in der Volkswirtschaftslehre – ganz anders als es hier in anderen wissenschaftlichen Disziplinen üblich ist – ein ganzes Jahrhundert lang ohne vorherrschende und allgemein anerkannte formale Theorie aus.
Aus diesem Grund erwarte ich vielleicht weniger Widerstand von deutschen als von englischen Lesern, wenn ich ihnen eine Gesamttheorie der Beschäftigung und der Produktion darlege, die in wesentlichen Teilen von der orthodoxen Tradition abweicht. Besteht jedoch auch Hoffnung, den ökonomischen Agnostizismus in Deutschland zu überwinden? Wird es mir gelingen, deutsche Ökonomen davon zu überzeugen, dass formale Analysemethoden einen wichtigen Beitrag zur Interpretation aktueller Ereignisse und zur Gestaltung aktueller Politik leisten können? Immerhin ist es doch typisch deutsch, Gefallen an Theorien zu finden. Wie hungrig und durstig müssen deutsche Volkswirte sein, nachdem sie so viele Jahre ganz ohne auskommen mussten! Gewiss wird sich da ein Versuch lohnen. Ich bin schon zufrieden, wenn ich einige Happen zu einem Mahl beitragen kann, das von deutschen Ökonomen speziell für die deutschen Bedürfnisse zubereitet wird. Ich muss nämlich gestehen, dass sich das hier folgende Buch zur Illustrierung größtenteils auf die Bedingungen in den angelsächsischen Ländern stützt.
Gleichwohl lässt sich die im vorliegenden Buch dargestellte Theorie der Gesamtproduktion viel einfacher auf die Verhältnisse in einem totalitären Staat anwenden als die Theorie der Produktion und Distribution einer gegebenen Gütermenge, die unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs und eines hohen Maßes an Laissez-faire produziert wurde. Das ist einer der Gründe, durch die sich die Bezeichnung allgemeine Theorie für meine Theorie rechtfertigen lässt. Da sie sich auf weniger enge Voraussetzungen stützt als die orthodoxe Theorie, lässt sie sich umso leichter den verschiedenartigsten Situationen anpassen. Obschon ich sie also mit dem Blick auf die Verhältnisse in den angelsächsischen Ländern ausgearbeitet habe, wo immer noch ein großes Maß von Laissez-faire vorherrscht, bleibt sie trotzdem auch auf Bedingungen anwendbar, in denen der Staat eine aktivere Rolle übernimmt. Die Theorie der psychologischen Gesetze, die Konsum mit Ersparnis verbinden, der Einfluss von kreditfinanzierten Ausgaben auf Preise und Reallöhne, die Rolle des Zinssatzes – all dies gehört zu den notwendigen Bestandteilen unseres Denkansatzes.
[15] Ich möchte bei dieser Gelegenheit meinem Übersetzer, Herrn Waeger, für seine ausgezeichnete Arbeit danken (ich hoffe, dass sich sein Glossar am Ende dieses Buches über seinen unmittelbaren Zweck hinaus als hilfreich erweist) und ebenso meinen Verlegern, den Herren Duncker und Humblot. Deren Unternehmen erlaubt es mir seit 16 Jahren, seit es mein Buch Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages herausgab, mit den deutschen Lesern in Kontakt zu bleiben.
J. M. Keynes, 7. September 1936
BUCH I
Einleitung
Kapitel 1
Die allgemeine Theorie
Ich habe dieses Buch „Die allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ genannt, mit Betonung auf dem Wort „allgemein“. Die Absicht hinter einem derartigen Titel ist, meine Argumente und Schlussfolgerungen denen der klassischen1 Theorie gegenüberzustellen, mit der ich aufgewachsen bin und die wie schon in den vergangenen hundert Jahren auch die ökonomischen Ideen der jetzigen Generation sowohl in der Praxis als auch in der Theorie beherrscht. Ich vertrete im Folgenden die These, dass die Postulate der klassischen Theorie lediglich in einem Spezialfall Gültigkeit besitzen und nicht im Regelfall, denn die von dieser Theorie unterstellte Situation ist nur ein Grenzfall aller möglichen Gleichgewichtslagen. Überdies entsprechen die Eigenschaften des Sonderfalls, von dem die klassische Theorie ausgeht, ganz und gar nicht denen der Volkswirtschaft, in der wir in Wirklichkeit leben. Infolgedessen sind ihre Lehren irreführend und, wenn wir sie auf die realen Erfahrungen anzuwenden versuchen, von verheerender Wirkung.
Kapitel 2
Die Postulate der klassischen Ökonomie
Die meisten Abhandlungen über die Wert- und Produktionstheorie befassen sich vor allem mit der Verteilung einer gegebenen Menge beschäftigter Ressourcen auf unterschiedliche Verwendungszwecke sowie mit den Bedingungen, die beim Einsatz der Arbeitskräfte ihre relative Vergütung und die relativen Werte ihrer Produkte determinieren.1
Auch die Frage der Menge der verfügbaren Produktionsfaktoren – im Sinne der Größe der Erwerbsbevölkerung, Rohstoffvorkommen und Kapitalausstattung – wurde schon häufig deskriptiv abgehandelt. Aber wodurch sich die tatsächliche Verwendung der verfügbaren Faktoren bestimmt, wurde auf rein theoretischer Ebene bislang noch kaum detailliert untersucht. Es wäre falsch zu behaupten, diese Frage sei überhaupt noch nicht untersucht worden. Denn jede Diskussion über Schwankungen des Beschäftigungsstands – und davon gab es schon viele – hat sich damit befasst. Ich will damit sagen, das Thema wurde nicht übersehen, aber die dahinter stehende grundlegende Theorie wurde als so simpel und offensichtlich erachtet, dass sie bestenfalls nur am Rande Erwähnung fand.2
[21] I.
Die angeblich so einfache und offensichtliche Theorie der Beschäftigung stützt sich meiner Ansicht nach auf die folgenden beiden grundlegenden, aber so gut wie nie diskutierten Postulate:
1. Der Lohn ist gleich dem Grenzprodukt der Arbeit.
Das bedeutet, der Lohn eines Arbeitnehmers entspricht den Einnahmen, die eingebüßt würden, wenn die Beschäftigung um eine Einheit vermindert würde (nach Abzug sonstiger Kosten, die aber durch diese Produktionssenkung vermieden werden sollen). Einschränkend muss jedoch hinzugefügt werden, dass diese Gleichsetzung entsprechend gewissen Grundsätzen nicht gilt, wenn Wettbewerb und Märkte unvollkommen sind.
2. Der Nutzen des Lohns bei Einsatz einer bestimmten Menge Arbeitskraft ist gleich dem Grenzleid3 dieses Beschäftigungsvolumens.
Das bedeutet, der Reallohn eines Arbeitnehmers ist so hoch, dass er (nach eigener Einschätzung des Arbeitnehmers) gerade ausreichend ist, damit das tatsächlich eingesetzte Arbeitsvolumen angeboten wird. Ebenso wie beim ersten Postulat, das durch die Unvollkommenheit der Märkte relativiert wird, gilt jedoch auch hier eine Einschränkung: Die Gleichsetzung kann für jeden einzelnen Erwerbstätigen durch Zusammenschlüsse von Arbeitern ungültig werden. Der Begriff Grenzleid soll hier er alle möglichen Gründe abdecken, aus denen Menschen es vorziehen, nicht zu arbeiten, statt einen Lohn zu akzeptieren, dessen Nutzen für sie ein gewisses Minimum unterschreitet.
Dieses Postulat steht in Einklang mit einem Phänomen, das man als „friktionelle“ Arbeitslosigkeit bezeichnen kann. Schließlich kalkuliert eine realistische Interpretation des Postulats ungenaue Justierungen, die einer dauerhaften Vollbeschäftigung im Weg stehen, durchaus mit ein. Ein Beispiel ist die Arbeitslosigkeit wegen zeitweiliger Ungleichgewichte bei den relativen Mengen spezieller Produktionsfaktoren etwa infolge von Fehlkalkulationen oder periodischen Nachfrageausfällen, von Verzögerungen aufgrund unvorhergesehener Entwicklungen oder weil der Wechsel von einem Beschäftigungsverhältnis zum nächsten mit gewissen Verzögerungen einhergeht. In einer nichtstatischen Gesellschaft wird darum immer ein gewisser Teil der verfügbaren Arbeitskräfte im Übergang von einem Beschäftigungsverhältnis zum nächsten arbeitslos sein. Neben der friktionellen Arbeitslo[22]sigkeit ist das Postulat auch vereinbar mit „freiwilliger“ Arbeitslosigkeit, wenn Arbeitnehmer aufgrund von Gesetzen, gesellschaftlichen Gepflogenheiten, der Bildung von Arbeitnehmerorganisationen, langsamer Anpassung an veränderte Bedingungen oder einfach nur aus Starrsinn nicht willens oder fähig sind, eine Entlohnung entsprechend dem Wert des Produkts zu akzeptieren, das ihrer Grenzproduktivität entspricht. Mehr als diese beiden Kategorien, die friktionelle und die freiwillige Arbeitslosigkeit, ist in dem Postulat jedoch nicht vorgesehen. Die klassische Theorie lässt die Möglichkeit einer dritten Kategorie nicht zu: die „unfreiwillige“ Arbeitslosigkeit, die ich im Folgenden definieren werde.
Der klassischen Theorie zufolge wird die Höhe der Beschäftigung, vorbehaltlich der genannten Einschränkungen, durch die beiden Postulate hinreichend genau bestimmt. Das erste ergibt die Arbeitsnachfragekurve, das zweite die Angebotskurve. Die Beschäftigungsmenge lässt sich an dem Punkt ablesen, wo der Nutzen des Grenzprodukts mit dem Grenzleid der Beschäftigung übereinstimmt. Daraus würde dann folgen, dass es nur vier Möglichkeiten gibt, für mehr Beschäftigung zu sorgen:
a) eine Verbesserung von Verwaltung und Planung, wodurch sich die friktionelle Arbeitslosigkeit reduzieren lässt,
b) eine Verminderung des Grenzleids der Arbeit, das sich in dem Reallohn ausdrückt, zu dem zusätzliche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, um so die freiwillige Arbeitslosigkeit zu senken,
c) eine Erhöhung der physischen Grenzproduktivität der Arbeit in den Lohngüter (Pigous praktischer Begriff für Güter, von deren Preis der Nutzen des Nominallohns abhängt) produzierenden Branchen oder
d) eine Preiserhöhung bei den Nicht-Lohngütern relativ zum Preis der Lohngüter verbunden mit einer Verschiebung der Ausgaben der Nicht- Lohnempfänger von Lohngütern zu Nicht-Lohngütern.
Dies ist meinem Verständnis nach der Kern von Pigous Theory of Unemployment, der einzigen detaillierten Darstellung der klassischen Theorie der Beschäftigung.4
II.
Handeln die oben genannten Kategorien das Thema wirklich erschöpfend ab angesichts dessen, dass die Menschen kaum je so viel arbeiten, wie sie es auf der Basis des jeweils aktuellen Lohnniveaus gerne täten? Man muss [23] doch zugeben, dass auch beim derzeitigen Nominallohn mehr Leute eine Arbeit aufnehmen würden, wenn es nur eine entsprechende Nachfrage nach Arbeitskräften gäbe.5 Die klassische Schule versucht dieses Phänomen folgendermaßen mit ihrem zweiten Postulat in Einklang zu bringen: Auch wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften zum aktuellen Nominallohn befriedigt sein mag, bevor jeder zu diesem Lohn Arbeitswillige Arbeit gefunden hat, so sei diese Situation doch nur einer offenen oder stillschweigenden Übereinkunft unter den Arbeitern geschuldet, für weniger Geld nicht zu arbeiten. Wäre die Arbeiterschaft zu einer Nominallohnsenkung bereit, würden mehr Arbeitsplätze geschaffen. In diesem Fall erschiene die Arbeitslosigkeit zwar als eine unfreiwillige, wäre es aber streng genommen gar nicht. Vielmehr würde sie in die Kategorie „freiwillige“ Arbeitslosigkeit infolge von Kollektivverhandlungen und dergleichen fallen.
An dieser Stelle bedarf es zweier Anmerkungen. Die erste bezieht sich auf die tatsächliche Einstellung der Arbeiter zu Real- bzw. Nominallöhnen, während es bei der zweiten um Grundsätzliches geht.
Nehmen wir einmal an, die Arbeiter wären nicht bereit, zu einem niedrigeren Nominallohn zu arbeiten, und eine Nominallohnsenkung würde zu einem Rückzug der bislang Beschäftigten vom Arbeitsmarkt führen, sei es durch Streiks, sei es durch andere Maßnahmen. Folgt daraus nun, dass das aktuelle Reallohnniveau das Grenzleid der Arbeit exakt wiedergibt? Nicht unbedingt. Denn auch wenn eine Nominallohnsenkung zum Rückzug von Arbeitskräften führt, so lässt sich daraus keineswegs schließen, dass eine Senkung des in Lohngütern ausgedrückten Nominallohns denselben Effekt hätte, wenn sie die Folge gestiegener Preise dieser Güter wäre. Es kann mit anderen Worten durchaus sein, dass sich zumindest in einem gewissen Rahmen die von den Arbeitern geforderte Lohnuntergrenze auf den Nominal- und nicht den Reallohn bezieht. Die klassischen Ökonomen gehen stillschweigend von der Annahme aus, dass sich dadurch keine nennenswerten Änderungen ihrer Theorie ergäben. Doch das ist ein Fehler. Denn wenn das Arbeitskräfteangebot nicht vom Reallohn als einziger Variable abhängt, dann fällt ihre ganze Argumentation in sich zusammen, womit völlig ungeklärt bleibt, wodurch sich das Beschäftigungsvolumen denn nun eigentlich bestimmt.6 Die Klassiker machen sich offenbar nicht bewusst, dass sich ihre Arbeitsangebotskurve, wenn sich das Angebot an Arbeitskraft nicht allein aus den Reallöhnen ableitet, mit jeder Preisänderung insgesamt verschiebt. Somit ist ihre Verfahrensweise aufs Engste mit ihren höchst speziellen Annahmen verknüpft und lässt sich auf den Normalfall gar nicht anwenden.
[24] Die Erfahrung lässt keinen Zweifel daran, dass eine Situation, in der die Arbeiterschaft (innerhalb gewisser Grenzen) ihre Forderungen am Nominalstatt am Reallohn ausrichtet, beileibe keine Möglichkeit unter vielen ist, sondern vielmehr die Norm. Arbeiter leisten zwar normalerweise Widerstand gegen eine Nominallohnsenkung, aber sie ziehen sich nicht gleich vom Arbeitsmarkt zurück, sobald es zu Preiserhöhungen bei den Lohngütern kommt. Mitunter wird den Arbeitern vorgeworfen, es sei unvernünftig, sich einer Nominallohnsenkung zu widersetzen, nicht aber einer Senkung der Reallöhne. Aus Gründen, die weiter unten noch ausgeführten werden (siehe S. 27), ist das vielleicht nicht so unvernünftig, wie es auf den ersten Blick wirken mag – glücklicherweise, wie wir noch sehen werden. Unabhängig davon zeigt die Erfahrung, dass sich die Arbeitnehmer jedenfalls genau so verhalten.
Zudem hält die Behauptung, die in Depressionen übliche Arbeitslosigkeit sei auf die Weigerung der Arbeiter zurückzuführen, niedrigere Nominallöhne zu akzeptieren, den Fakten nicht stand. Nicht gerade plausibel ist auch die Feststellung, dass in den Vereinigten Staaten die Arbeitslosigkeit im Jahr 1932 die Schuld der Arbeiter gewesen sei, die sich stur einer Nominallohnsenkung widersetzt oder ebenso stur auf höhere Reallöhne bestanden hätten, als die wirtschaftliche Produktivität hergab. Auch ganz ohne erkennbare Veränderungen bei den Lohnforderungen der Arbeiterschaft oder der Arbeitsproduktivität schwankt die Zahl der Arbeitsplätze erheblich. Die Arbeiter sind in wirtschaftlichen Krisenzeiten weder aufsässiger als sonst – ganz im Gegenteil! – noch ist ihre Produktivität geringer. Diese empirisch nachweisbaren Fakten sind allein schon Grund genug, die klassische Theorie in Frage zu stellen.
Es wäre interessant, die Ergebnisse einer statistischen Erhebung über den Zusammenhang von Nominal- und Reallohnveränderungen zu sehen. Im Fall einer auf eine einzelne Branche beschränkten Veränderung wäre zu erwarten, dass sich beide in dieselbe Richtung entwickeln. Bei einer Veränderung des allgemeinen Lohnniveaus aber dürfte sich meiner Ansicht nach der Reallohn, weit davon entfernt, dieselbe Richtung wie der Nominallohn einzuschlagen, fast immer in die Gegenrichtung bewegen. Bei steigenden Nominallöhnen werden sich also sinkende Reallöhne beobachten lassen, und bei sinkenden Nominallöhnen werden die Reallöhne steigen. Das liegt daran, dass auf kurze Sicht sowohl sinkende Nominallöhne als auch steigende Reallöhne jeweils mit geringerer Beschäftigung einhergehen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Bei einem schrumpfenden Beschäftigungsniveau werden die Arbeiter nämlich eher zu Lohnkürzungen bereit sein. Zugleich aber steigen zwangsläufig die Reallöhne, weil das Grenzprodukt der Arbeit zunimmt, wenn bei einem gegebenen Sachkapital die Produktion zurückgeht.
Wenn der aktuelle Reallohn wirklich und wahrhaftig die Untergrenze wäre, unterhalb derer das Arbeitsangebot unter keinen Umständen über den [25] jetzigen Stand hinausginge, dann gäbe es, von der friktionellen Arbeit abgesehen, keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Es ist aber geradezu abwegig anzunehmen, dass diese Behauptung ausnahmslos zutrifft. In der Regel stehen zu den aktuellen Nominallöhnen mehr Arbeitssuchende zur Verfügung, als es Arbeitsplätze gibt, auch wenn die Lohngüterpreise steigen und infolgedessen die Reallöhne rückläufig sind. Wenn das stimmt, dann ist der in Lohngütern ausgedrückte Gegenwert eines bestimmten Nominallohns kein exakter Indikator für das Grenzleid der Arbeit. Das zweite Postulat ist damit hinfällig.
Es gibt allerdings noch einen grundsätzlicheren Einwand. Das zweite Postulat geht von der Annahme aus, dass die Reallöhne der Arbeiter das Ergebnis von Lohnabschlüssen der Arbeitnehmervertreter mit den Unternehmern sei. Seine Verfechter geben natürlich zu, dass diese Abschlüssen in Wirklichkeit auf nominaler Basis erfolgen, und sogar, dass die den Arbeitnehmern annehmbar erscheinenden Reallöhne nicht ohne Bezug zum entsprechenden Nominallohn sind. Gleichwohl ist es der auf diese Weise vereinbarte Nominallohn, der ihrer Ansicht nach den Reallohn bestimmt. Die klassische Theorie geht also davon aus, dass es den Arbeitnehmern immer freistehe, ihren Reallohn zu senken, indem sie einer Nominallohnsenkung zustimmen. Das Postulat über die tendenzielle Angleichung des Reallohns an das Grenzleid der Arbeit unterstellt ganz klar, dass die Arbeiter den Reallohn, für den sie arbeiten, selbst bestimmen können, nicht aber die Menge der zu diesem Lohn angebotenen Beschäftigung.
Der traditionellen Theorie zufolge wird kurz gesagt der Reallohn durch Lohnverhandlungen zwischen Unternehmern und Arbeitern bestimmt. Sofern zwischen den Arbeitgebern freier Wettbewerb herrscht und es keine den Wettbewerb einschränkenden Arbeitnehmervereinigungen gibt, können letztere ihre Reallöhne, wenn sie wollen, mit dem Grenzleid der von den Arbeitgebern bei diesem Lohnniveau angebotenen Beschäftigung in Übereinstimmung bringen. Trifft das aber nicht zu, gibt es keinen Grund mehr, von einer tendenziellen Angleichung des Reallohns an das Grenzleid der Arbeit auszugehen.
Es sei daran erinnert, dass sich die Aussagen der klassischen Theorie auf die gesamte Arbeiterschaft beziehen und keineswegs nur besagen, dass ein Einzelner einen Arbeitsplatz finden kann, indem er einen niedrigeren Nominallohn akzeptiert als seine Mitbewerber. Sie sollen überdies für offene genauso wie für geschlossene Volkswirtschaften Gültigkeit besitzen – unabhängig von den Besonderheiten einer offenen Volkswirtschaft oder von den Auswirkungen einer Nominallohnkürzung in einem einzelnen Land auf dessen Außenhandel (was jedoch nicht Thema dieser Abhandlung ist). Ebenso wenig gehen sie von indirekten Effekten niedrigerer nominaler Lohnkosten auf das Bankensystem und dessen Vertrauen in die Kreditwür[26]digkeit seiner Kunden aus (womit sich Kapitel 19 noch eingehender befasst). Vielmehr liegt ihnen die Überzeugung zugrunde, dass in einem geschlossenen System niedrigere Nominallöhne – zumindest kurzfristig und vorbehaltlich geringfügiger Einschränkungen – mit einer gewissen, wenn auch nicht immer proportionalen Senkung der Reallöhne einhergehen.
Nun trifft die Annahme, dass das allgemeine Reallohnniveau aus den nominalen Lohnabschlüssen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern resultiert, nicht unbedingt zu. Es ist doch merkwürdig, dass kaum je der Versuch unternommen wurde, diese Behauptung zu beweisen oder zu widerlegen. Schließlich steht sie alles andere als im Einklang mit dem Tenor der klassischen Theorie, die uns glauben machen will, dass Preise durch die nominalen Grenzkosten und diese wiederum im Wesentlichen durch Nominallöhne bestimmt werden. Im Falle einer Veränderung der Nominallöhne wäre nun zu erwarten gewesen, dass die Anhänger der klassischen Schule eine Veränderung der Preise in ähnlicher Größenordnung postulieren bei mehr oder weniger unveränderten Reallöhnen und Arbeitslosenquote. Etwaige kleine Zugewinne oder Verluste für die Arbeiter würden dabei mit den übrigen Bestandteilen der Grenzkosten verrechnet, die ja gleich geblieben sind.7 Sie scheinen jedoch von dieser Vorstellung abgekommen zu sein, teils aufgrund der festen Überzeugung, die Arbeiter könnten ihren eigenen Reallohn festsetzen, und teils wohl aufgrund ihrer fixen Idee, Preise seien eine Funktion der Geldmenge. Dass der einmal gefasste Glauben an die Fähigkeit der Arbeiter, den eigenen Reallohn zu bestimmen, nie hinterfragt wurde, liegt wohl auch daran, dass er mit der These verwechselt wurde, die Arbeiter könnten bestimmen, welcher Reallohn dem Zustand Vollbeschäftigung entspricht, das heißt mit der maximalen Beschäftigung, die mit einem gegebenen Reallohn vereinbar ist.
Es gibt zusammenfassend also zwei Einwände gegen das zweite Postulat der klassischen Theorie. Der erste bezieht sich auf das wirkliche Verhalten der Arbeiter. Ein Sinken der Reallöhne aufgrund von Preissteigerungen sorgt normalerweise nicht dafür, dass das zum aktuellen Lohn bestehende Arbeitskräfteangebot unter die tatsächliche Beschäftigtenzahl vor der Preiserhöhung fällt. Unter der Annahme eines derartigen Rückgangs müssten sich alle Arbeitslosen, die zum gegenwärtigen Lohn zu arbeiten bereit wären, schon beim geringsten Anstieg der Lebenshaltungskosten vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Und doch liegt diese merkwürdige Auffassung anscheinend Pigous Theory of Unemployment8 zugrunde und wurde von allen Anhängern der orthodoxen Schule stillschweigend übernommen.
[27] Dass sich die Behauptung, das allgemeine Reallohnniveau sei das unmittelbare Ergebnis von Lohnverhandlungen, anfechten lässt, bringt uns zu dem anderen, grundlegenderen Einwand, der in den folgenden Kapiteln noch näher ausgeführt werden soll. In den Lehrsatz der klassischen Schule, dass der Lohnabschluss den Reallohn bestimmt, hat sich eine unzulässige Prämisse eingeschlichen. Die Arbeiterschaft als Ganze verfügt nämlich möglicherweise über kein Instrument, das Lohngüter-Äquivalent des durchschnittlichen Nominallohns mit dem Grenzleid des aktuellen Beschäftigungsvolumens in Übereinstimmung zu bringen. Womöglich steht der Arbeiterschaft gar kein Mittel zur Verfügung, ihren Reallohn im Zuge von nominalen Lohnabschlüssen mit den Arbeitgebern auf ein ganz bestimmtes Niveau zu senken. Das jedenfalls ist die These, die wir im Folgenden näher ausführen werden. Wir werden nachzuweisen versuchen, dass das allgemeine Reallohniveau im Wesentlichen durch ganz andere Einflüsse bestimmt wird. Dieser Klärungsversuch ist einer der Schwerpunkte dieses Buches. Wir werden darlegen, dass bislang die Funktionsweise unserer Volkswirtschaft von Grund auf falsch verstanden wurde.
III.
Zwar gehen die meisten davon aus, die Kämpfe zwischen Einzelpersonen und Organisationen um die Nominallöhne seien entscheidend für das allgemeine Niveau der Reallöhne. Aber in Wirklichkeit geht es dabei um etwas anderes. Weil die Arbeitnehmermobilität unvollkommen ist und weil sich Löhne meist nicht einfach mit dem Nettovorteil in verschiedenen Beschäftigungszweigen gleichsetzen lassen, würden all diejenigen, die eine Nominallohnsenkung relativ zu anderen Gruppen akzeptieren, auch eine relative Verminderung ihrer Reallöhne hinnehmen müssen – was allein schon ein hinreichender Grund für die Ablehnung von Lohnsenkungen ist. Andererseits wäre es undurchführbar, sich jeder Reallohnkürzung zu widersetzen, die durch eine Änderung der Kaufkraft des Geldes verursacht wird und die alle Arbeiter gleichermaßen trifft. Und tatsächlich gibt es kaum Widerstand gegen derartige Reallohnsenkungen, sofern sie nicht übermäßig hoch ausfallen. Ohnehin stellt der Widerstand gegen Reallohnsenkungen in einzelnen Branchen kein so unüberwindliches Hindernis für die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze dar wie die Verweigerung jeglicher Reallohnkürzungen.
Der Kampf um die Nominallöhne wirkt sich mit anderen Worten in erster Linie auf die Verteilung der realen Lohnsumme zwischen verschiedenen Arbeitnehmergruppen aus und nicht etwa auf deren durchschnittliche Höhe pro Beschäftigtem – die, wie wir noch sehen werden, von anderen Faktoren abhängt. Der Zusammenschluss von Arbeitern zielt darauf, ihren relativen[28] Reallohn zu sichern. Das allgemeine Reallohnniveau hängt demgegenüber von anderen volkswirtschaftlichen Einflüssen ab.
Instinktiv und ohne es zu merken sind die Arbeiter also vernünftigere Ökonomen als die Anhänger der klassischen Schule. So leisten sie Widerstand gegen Nominallohnkürzungen, die so gut wie nie allumfassend sind, auch wenn das reale Äquivalent dieser Löhne größer ist als das Grenzleid der aktuellen Beschäftigungsmenge. Sie wehren sich indes nicht gegen niedrigere Reallöhne, wenn diese mit höherer Gesamtbeschäftigung einhergehen und die relativen Nominallöhne unverändert lassen. Etwas anderes ist es, wenn die Kürzungen so weit gehen, dass die Reallöhne unter das Grenzleid des aktuellen Beschäftigungsvolumens fallen. Jede Gewerkschaft wird sich natürlich gegen eine noch so kleine Nominallohnkürzung zur Wehr setzen. Da jedoch Gewerkschaften nicht im Traum darauf kämen, bei jeder Erhöhung der Lebenshaltungskosten zu streiken, stellen sie auch nicht das Hindernis für die Schaffung von Arbeitsplätzen dar, für das die klassische Schule sie hält.
IV.
Es bleibt nun noch, die dritte Art von Arbeitslosigkeit zu definieren, nämlich die „unfreiwillige“ Arbeitslosigkeit im engeren Sinne, deren Existenz die klassische Theorie nicht anerkennt.
Mit unfreiwilliger Arbeitslosigkeit ist selbstredend nicht das bloße Vorhandensein nicht ausgeschöpfter Arbeitskapazitäten gemeint. So kann bei einem Achtstundentag noch nicht von Arbeitslosigkeit gesprochen werden, nur weil es nicht über die menschlichen Kräfte geht, auch zehn Stunden zu arbeiten. Genauso wenig handelt es sich um Arbeitslosigkeit, wenn eine Arbeiterorganisation die Arbeit niederlegt, weil die Mitglieder nicht für einen Reallohn unterhalb bestimmter Grenzen arbeiten wollen. Zudem ist es sinnvoll, die friktionelle Arbeitslosigkeit aus unserer Definition von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit auszuklammern. Meine Definition lautet demnach folgendermaßen: Menschen sind unfreiwillig arbeitslos, wenn bei einer kleinen Preiserhöhung von Lohngütern relativ zum Nominallohn sowohl das Gesamtangebot an Arbeitskraft zu diesem Nominallohn als auch die zu diesem Lohn bestehende Gesamtnachfrage danach größer ist als die tatsächliche Beschäftigungsmenge. Eine alternative Definition, die letztlich jedoch auf das Gleiche hinausläuft, findet sich in Kapitel 3.
Aus dieser Definition folgt, dass die Gleichsetzung von Reallohn und Grenzleid der Beschäftigung, von der das zweite Postulat ausgeht, unter realistischer Betrachtung der Abwesenheit unfreiwilliger Arbeitslosigkeit entspricht. Dieser Zustand soll hier als „Vollbeschäftigung“ bezeichnet wer[29]den, wobei sowohl friktionelle als auch freiwillige Arbeitslosigkeit mit einer so definierten Vollbeschäftigung vereinbar sind. Dies passt, wie wir noch sehen werden, zu anderen Merkmalen der klassischen Theorie, die sich am besten als Theorie der Verteilung unter den Bedingungen der Vollbeschäftigung begreifen lässt. Geht man von der Gültigkeit der klassischen Postulate aus, ist keine in diesem Sinne unfreiwillige Arbeitslosigkeit möglich. Für die unbestritten vorhandene Arbeitslosigkeit kann es deswegen nur drei Gründe geben: ein vorübergehender Arbeitsplatzverlust vom Typ „Übergang von einem Beschäftigungsverhältnis zum nächsten“, die schwankende Nachfrage nach hochspezialisierten Arbeitskräften oder aber die Auswirkungen eines Gewerkschaftszwangs9 auf die Beschäftigungssituation unorganisierter Arbeitnehmer. In der klassischen Tradition verwurzelte Autoren übersehen stets, dass die ihrer Theorie zugrunde liegende Annahme nur in Sonderfällen zutrifft. Auf diese Annahme gestützt, erscheint es ihnen dann ganz logisch, dass jedwede bestehende Arbeitslosigkeit (von den genannten Ausnahmen abgesehen) im Grunde genommen nur an der Weigerung der Arbeitslosen liegen kann, sich mit einem Lohn zufrieden zu geben, der ihrer Grenzproduktivität entspricht. Ein klassischer Ökonom mag sogar Verständnis haben für den Widerstand der Arbeiter gegen Nominallohnkürzungen. Er gibt vielleicht auch zu, dass diese zur Bekämpfung nur kurzzeitiger Probleme unklug sein könnten. Aber seine wissenschaftliche Integrität zwingt ihn gleichwohl zu der Behauptung, allein die Weigerung der Arbeiter sei die Wurzel aller Probleme.
Wenn jedoch die klassische Theorie nur für einen Zustand der Vollbeschäftigung gültig ist, wäre es abwegig, sie auf das Problem der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit anzuwenden – wenn es so etwas gibt (und wer würde das bestreiten?). Die klassischen Theoretiker gleichen euklidischen Mathematikern in einer nichteuklidischen Welt, die entdecken, dass scheinbar parallele Geraden sich in Wirklichkeit oft treffen, und denen kein anderes Mittel gegen die bedauerlichen Zusammenstöße einfällt, als die Linien dafür zu tadeln, dass sie nicht gerade bleiben. Dabei gäbe es in Wahrheit kein anderes Mittel als das Axiom der Parallelen zu verwerfen und eine nichteuklidische Geometrie zu erarbeiten. Etwas Vergleichbares ist heute in der Volkswirtschaftslehre nötig. Wir müssen das zweite Postulat der klassischen Doktrin aufgeben und stattdessen das Verhalten eines Wirtschaftssystems erforschen, in dem unfreiwillige Arbeitslosigkeit im engeren Sinne möglich ist.
[30] V.
Bei aller Betonung der Punkte, in denen wir vom klassischen System abweichen, dürfen wir nicht übersehen, dass es in einem Punkt eine Übereinstimmung gibt. Das erste Postulat nämlich werden wir beibehalten, mit denselben Einschränkungen wie in der klassischen Theorie. Wir sollten uns einen Moment Zeit nehmen, um uns der Folgen bewusst zu werden.
Reallöhne und Produktionsvolumen (und damit auch das Beschäftigungsvolumen) weisen demnach bei gleicher Organisation, Ausrüstung und Technik eine starke Korrelation auf. Ein Beschäftigungszuwachs muss daher im Allgemeinen mit einem sinkenden Reallohnniveau einhergehen. Diese für die klassischen Ökonomen (zu Recht) unantastbare, zentrale These stelle ich also nicht in Frage. Bei gegebener Organisation, Ausrüstung und Technik korreliert der Reallohn einer Arbeitskraft auf eine ganz bestimmte Weise (negativ) mit dem Beschäftigungsvolumen. Wenn also die Beschäftigung zunimmt, muss auf kurze Sicht die in Lohngütern ausgedrückte Entlohnung einer Arbeitskraft für gewöhnlich sinken, während zugleich die Gewinne steigen.10 Das ist ganz einfach der Umkehrschluss des bekannten Lehrsatzes, dem zufolge das produzierende Gewerbe auf kurze Sicht und bei konstanten Betriebsmitteln etc. mit abnehmenden Erträgen arbeitet, so dass eine zunehmende Beschäftigung zwingend mit einem geringeren Grenzprodukt in den Lohngüterbranchen (welches ja die Reallöhne determiniert) einhergeht. Solange dies der Fall ist, muss jeder Versuch, mehr Beschäftigung zu schaffen, zugleich auf eine Verringerung des Grenzprodukts hinauslaufen und infolgedessen auch des in diesen Produkten ausgedrückten Lohnniveaus.
Auch wenn wir das zweite Postulat verworfen haben, so ergibt sich doch ein Beschäftigungsrückgang – obschon dann die Arbeiter zwangsläufig einer größeren Menge an Lohngütern entsprechende Löhne erhalten – nicht zwangsläufig daraus, dass die Arbeiter mehr Lohngütern fordern. Und die bereitwillige Hinnahme niedrigerer Nominallöhne durch die Arbeiter ist auch nicht unbedingt ein Allheilmittel gegen Arbeitslosigkeit. Die Theorie über den Zusammenhang von Löhnen und Beschäftigung, auf die hier an[31]gespielt wird, kann jedoch erst in Kapitel 19 und dessen Anhang im Detail ausgeführt werden.
VI.
Seit Say und Ricardo haben die klassischen Ökonomen gelehrt, dass das Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Gemeint ist damit, dass in gewisser, leider nicht näher definierter Weise die gesamten Produktionskosten direkt oder indirekt wieder für den Kauf der Produkte ausgegeben werden müssen.
In J. S. Mills Principles of Political Economy (Grundsätze der politischen Ökonomie) wird diese Doktrin ausdrücklich dargelegt:
Die Zahlungsmittel für Waren sind ihrerseits schlicht Waren. Die Mittel des einen zum Kauf der Erzeugnisse eines anderen sind seine eigenen Erzeugnisse. Alle Verkäufer sind unweigerlich und im strengen Sinne des Wortes Käufer. Könnten wir plötzlich die Produktivkräfte eines Landes verdoppeln, dann würden wir damit nicht nur das Warenangebot in jedem Markt verdoppeln, sondern gleichzeitig auch die Kaufkraft. Jeder würde sowohl die doppelte Nachfrage als auch das doppelte Angebot auf den Markt bringen. Jeder könnte doppelt so viel kaufen, weil jeder im Tausch dafür doppelt so viel anzubieten hätte.11
Aus dieser Doktrin wurde dann logisch abgeleitet, jeder Akt des Konsumverzichts bedeute zwangsläufig, dass alle Arbeit und Güter, die nun nicht mehr für die Befriedigung des Konsums nötig sind, stattdessen für die Bildung von Kapitalvermögen verwendet würden. Die folgende Textstelle aus Marshalls Pure Theory of Domestic Values12 ist ein Beispiel für diesen traditionellen Ansatz:
Menschen geben ihr ganzes Einkommen für den Kauf von Dienstleistungen und Waren aus. Es wird zwar gemeinhin angenommen, dass die meisten Leute nur einen Teil ihres Einkommens ausgeben und den Rest sparen. Doch einem geläufigen ökonomischen Grundsatz zufolge nutzen sie ihre Ersparnissen genauso zum Kauf von Dienstleistungen und Waren wie den Teil des Einkommens, den sie gleich ausgeben. Man hat den Eindruck, dass sie Geld ausgeben, wenn sie erworbene Dienstleistungen und Waren aktuell nutzen wollen. Und man hält es für Sparen, wenn sie die zu kaufenden Dienstleistungen und Waren für die Erzeugung von Vermögen übrig lassen, durch welches sie die Mittel für deren späteren Genuss zu erhalten hoffen.
Es ist wahr, dass sich vergleichbare Textstellen in Marshalls späterem Werk13 oder in den Arbeiten von Edgeworth oder Pigou kaum finden las[32]sen. In dieser groben Form wird die Doktrin heutzutage nicht mehr vertreten. Dennoch liegt sie nach wie vor der ganzen klassischen Theorie zugrunde, die ohne sie einfach in sich zusammenfiele. Zeitgenössische Ökonomen, die vielleicht nicht unbedingt mit Mill einverstanden sind, haben keinerlei Probleme mit Befunden, die auf Mills Doktrin basieren. So durchzieht die Überzeugung beispielsweise Pigous gesamtes Werk, dass Geld von friktionellen Effekten abgesehen keine größere Bedeutung hat und dass sich die Theorie der Produktion und Beschäftigung (wie die von Mill) allein auf der Grundlage „realer“ Tauschhandlungen entwickeln lasse – Geld wird erst später im Text oberflächlich behandelt. Doch dies ist nichts anderes als eine modernere Variante der klassischen Tradition. Die zeitgenössische Lehrmeinung bleibt der Vorstellung verhaftet, Leute würden ihr Geld so oder so ausgeben.14 Den Ökonomen der Nachkriegszeit gelingt es zwar selten, diesen Standpunkt konsequent zu vertreten, weil ihr Lehrgebäude zu stark von gegenläufigen Tendenzen und von Erfahrungen durchdrungen ist, die allzu offensichtlich ihren früheren Ansichten widersprechen.15 Aber sie haben daraus keine hinreichend umfassenden Schlüsse gezogen, geschweige denn, dass sie ihre grundlegenden Theorien entsprechend überarbeitet hätten.
Zunächst einmal wurden diese Schlussfolgerungen wohl auf unsere tatsächliche Wirtschaft übertragen, indem diese fälschlicherweise mit einer Robinson-Crusoe-Wirtschaft ohne Tauschgeschehen gleichgesetzt wurde, in der das Einkommen, das die Menschen durch ihre Produktionstätigkeit erzielen und entweder verbrauchen oder zurückbehalten, nichts anderes ist als die sich durch diese Tätigkeit ergebende Gütermenge. Aber davon abgesehen ist die Annahme, dass die Produktionskosten immer und in Gänze durch [33] die aus der Nachfrage resultierenden Verkaufserlöse gedeckt sind, durchaus plausibel. Denn sie ist kaum von einem ähnlichen, unstrittigen Grundsatz zu unterscheiden, demzufolge das Gesamteinkommen aller Erwerbstätigen zwingend genau denselben Wert haben muss wie der Produktionswert.
Genauso ist auch die Vermutung naheliegend, dass jede Tätigkeit eines Einzelnen, durch die dieser sich bereichert, ohne anderen erkennbar etwas wegzunehmen, zugleich die Allgemeinheit bereichert. Folglich müssen (wie im obigen Zitat von Marshall) die Ersparnisse eines Einzelnen unweigerlich zu entsprechenden Investitionen führen. Denn um es noch einmal zu sagen: Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Summe der individuellen Reinvermögenszuwächse genau gleich dem aggregierten Reinvermögenszuwachs der Bevölkerung ist.
Wer so denkt, sitzt jedoch einer optischen Täuschung auf, die zwei grundsätzlich verschiedene Tätigkeiten gleich erscheinen lässt. Die Annahme einer Verbindung zwischen aktuellem Konsumverzicht und der Vorsorge für künftigen Konsum ist irrig. Vielmehr stehen die Motive für letzteres in keinem einfachen Zusammenhang mit den Beweggründen für ersteres.
Die Annahme einer Gleichheit zwischen dem Nachfrage- und dem Angebotspreis der gesamten Produktionsmenge ist gleichsam das „Axiom der Parallelen“ der klassischen Theorie. Basierend auf dieser Annahme ergibt sich alles andere von selbst – die gesellschaftlichen Vorteile privater und nationaler Sparsamkeit, die traditionelle Einstellung zum Zins, die klassische Theorie der Arbeitslosigkeit, die Quantitätstheorie des Geldes, die nicht näher ausgeführten Vorteile des Laissez-faire im Außenhandel und noch viel mehr, was wir alles in Frage stellen müssen.
VII.
In diesem Kapitel wurde immer wieder die Abhängigkeit der klassischen Theorie von mehreren Annahmen beschrieben, nämlich
1. dass der Reallohn gleich dem Grenzleid der aktuellen Beschäftigung ist,
2. dass es keine im engeren Sinne unfreiwillige Arbeitslosigkeit gibt und
3. dass das Angebot seine eigene Nachfrage schafft, in dem Sinne, dass auf allen Produktions- und Beschäftigungsstufen der aggregierte Nachfragepreis gleich dem aggregierten Angebotspreis ist.
Diese drei Annahmen laufen jedoch alle insofern auf das gleiche hinaus, als sie miteinander stehen und fallen, denn jede von ihnen bezieht die jeweils anderen beiden logisch mit ein.
Kapitel 3
Das Prinzip der effektiven Nachfrage
I.
Wir brauchen zunächst einmal einige Begriffe, die erst später genauer definiert werden. Für einen Unternehmer geht bei einem gegebenen Stand an Technik, Ressourcen und Kosten die Beschäftigung einer bestimmten Menge Arbeitskraft mit zweierlei Ausgaben einher: zum einen den Beträgen, die er für den Faktor Arbeit (ausgenommen andere Unternehmer) für dessen laufende Dienste zahlt, die wir die Faktorkosten der fraglichen Beschäftigungsmenge nennen. Zur zweiten Art von Ausgaben zählen die Beträge, die er anderen Unternehmern für das zahlt, was er von ihnen einkaufen muss, sowie die Kosten, die ihm entstehen, wenn er seine Anlagen laufen lässt, statt sie ungenutzt zu lassen. Diese bezeichnen wir als Nutzungskosten der fraglichen Beschäftigungsmenge.1 Der Wert der Produkte abzüglich der Summe der bei ihrer Produktion anfallenden Faktor- und Nutzungskosten ist der Gewinn bzw. in unserer Terminologie das Einkommen des Unternehmers. Die Faktorkosten aus Sicht des Unternehmers sind natürlich nichts anderes als das, was die Produktionsfaktoren als ihr Einkommen betrachten. Die Faktorkosten und der Unternehmergewinn zusammengenommen ergeben das, was wir als das Gesamteinkommen aus der durch den Unternehmer geschaffenen Beschäftigung bezeichnen. So definiert, ist der Gewinn des Unternehmers die Größe, die er zu maximieren versucht, wenn er über die Menge der von ihm angebotenen Beschäftigung entscheidet. Von der Warte des Unternehmers aus gesehen ist es mitunter praktisch, das Gesamteinkommen (d. h. Faktorkosten plus Gewinn) aus einer bestimmten Beschäftigungsmenge als den Erlös aus dieser Beschäftigung zu bezeichnen. Auf der anderen Seite entspricht der aggregierte Angebotspreis2 der von einer bestimmten Zahl Beschäftigter erzeugten Gütermenge der Erwartung des Erlöses, bei dem es sich für die Unternehmer gerade noch lohnt, diese Beschäftigung anzubieten.3
[35] Folglich hängt bei einem gegebenen Stand von Technik, Ressourcen und Faktorkosten pro Beschäftigtem das Beschäftigungsvolumen sowohl in jeder einzelnen Firma oder Branche als auch insgesamt von der Höhe der Erlöse ab, die die Unternehmer aus dem Verkauf ihres entsprechenden Produkts erwarten.4 Denn die Unternehmer werden das Beschäftigungsvolumen stets so festzusetzen versuchen, dass die Erlöse möglichst weit über den Faktorkosten liegen.
Liegt nun für einen gegebenen Wert von N der erwartete Erlös über dem aggregierten Angebotspreis, ist also D größer als Z, so stellt dies für die [36] Unternehmer einen Anreiz dar, die Beschäftigung über N hinaus zu erhöhen. Wenn nötig, werden sie dann auch die Kosten erhöhen, weil sie miteinander um Arbeitskräfte konkurrieren, und zwar bis zu einem Niveau von N, an dem Z gleich D ist. Somit lässt das Beschäftigungsvolumen am Schnittpunkt der Gesamtnachfragekurve mit der Gesamtangebotskurve ablesen. Es ist derselbe Punkt, an dem die Gewinnerwartung der Unternehmer ihr Maximum erreicht. Der Wert von D am Schnittpunkt der Gesamtangebots- und Gesamtnachfragekurven soll als effektive Nachfrage bezeichnet werden. Da dies der Kern der allgemeinen Theorie der Beschäftigung ist, die wir hier darlegen wollen, werden sich die folgenden Kapitel hauptsächlich mit der Untersuchung der verschiedenen Faktoren befassen, von denen diese beiden Funktionen abhängen.
Die klassische Doktrin hingegen, die unmissverständlich in der Feststellung, „das Angebot schafft seine eigene Nachfrage“, ihren Ausdruck fand und die immer noch allen orthodoxen ökonomischen Theorien zugrunde liegt, geht mit einer ganz besonderen Annahme über das Verhältnis zwischen diesen beiden Funktionen einher. Denn „das Angebot schafft seine eigenen Nachfrage“ läuft darauf hinaus, dass f(N) und φ(N) bei allen Werten von N gleich sind, d. h. auf allen Niveaus von Produktion und Beschäftigung. Es bedeutet überdies, dass bei einer Zunahme von Z (= φ(N)), die einer Zunahme von N entspricht, zwangsläufig auch D (= f(N)) um denselben Betrag wie Z zunimmt. Anders gesagt, der klassischen Theorie zufolge passt sich der aggregierte Nachfragepreis (oder Erlös) immer dem aggregierten Angebotspreis an. Folglich nimmt, unabhängig vom Wert von N, der Erlös D einen Wert gleich dem aggregierten Angebotspreis Z an, der wiederum N entspricht. Die effektive Nachfrage wird also nicht durch einen einzigen Gleichgewichtspreis bestimmt, sondern besteht aus einer unendlichen Reihe von Werten, die alle gleichermaßen zulässig sind. Ansonsten ist das Beschäftigungsvolumen unbestimmt, abgesehen von der durch das Grenzleid der Arbeit gesetzten Obergrenze.
Wenn das zuträfe, dann würde der Wettbewerb zwischen Unternehmern immer zu einer Ausdehnung des Beschäftigungsvolumens führen, und zwar bis zu dem Punkt, an dem das Angebot nicht mehr elastisch ist, d. h. an dem ein weiterer Wertzuwachs der effektiven Nachfrage nicht mehr mit einem Zuwachs der Produktion einhergeht. Dies kommt ganz offensichtlich dem Zustand der Vollbeschäftigung gleich. Im vorangegangenen Kapitel wurde Vollbeschäftigung über das Verhalten der Arbeiter definiert. Hier gelangen wir nun zu einem alternativen, aber gleichwertigen Kriterium, nämlich einer Situation, in der die Gesamtbeschäftigung unelastisch auf eine zunehmende effektive Nachfrage nach ihren Produkten reagiert. Das Saysche Theorem, wonach der Nachfragepreis der gesamten Produktionsmenge gleich ihrem Angebotspreis ist, entspricht demnach der Annahme, dass einer Vollbeschäftigung [37] nichts im Wege steht. Wenn dies jedoch nicht die wahre Gesetzmäßigkeit ist, die die aggregierten Nachfrage- und Angebotskurven zueinander in Beziehung setzt, dann handelt es sich hierbei um ein höchst bedeutsames Kapitel der Wirtschaftstheorie, das noch nicht geschrieben wurde, ohne das aber alle Debatten über die Gesamtbeschäftigungsmenge vollkommen nutzlos sind.
II.
Eine kurze Zusammenfassung der Theorie der Beschäftigung, die in den folgenden Kapiteln noch weiter ausgearbeitet werden soll, ist an diesem Punkt sicher hilfreich, selbst wenn sie noch nicht völlig verständlich erscheinen mag. Die fraglichen Begriffe werden zu gegebener Zeit noch genauer definiert. In dieser Zusammenfassung gehen wir von konstanten Nominallöhnen und sonstigen Faktorkosten für jede Beschäftigungseinheit aus. Diese Vereinfachung, auf die später verzichtet werden kann, wird hier nur zwecks Erleichterung der Darstellung vorgenommen. Der Kern des Arguments bleibt aber genau derselbe, unabhängig davon, ob Nominallöhne etc. veränderlich sind oder nicht.
Unsere Theorie lässt sich folgendermaßen umreißen: Bei zunehmender Beschäftigung nehmen die aggregierten Realeinkommen zu. Es ist psychologisch erklärbar, dass bei steigenden Realeinkommen auch der Gesamtkonsum steigt, wenngleich nicht im gleichen Maße wie das Einkommen. Für die Arbeitgeber würde es einen Verlust bedeuten, wenn der gesamte Beschäftigungszuwachs allein für die unmittelbare Befriedigung der zusätzlichen Nachfrage nach Konsumgütern aufgewandt würde. Zur Rechtfertigung eines bestimmten Beschäftigungsvolumens müssen die laufenden Investitionen deshalb so hoch sein, dass sie den Betrag binden, um den die Gesamtproduktion über dem Konsum der Bevölkerung bei diesem Beschäftigungsniveau liegt. Bei einem niedrigeren Investitionsvolumen wären die Einkünfte der Unternehmer zu gering, um einen Anreiz zur Schaffung der jeweiligen Menge an Beschäftigung darzustellen. Bei einer bestimmten Konsumneigung der Bevölkerung, wie wir das künftig nennen wollen, hängt folglich das Gleichgewichtsniveau der Beschäftigung – also das Niveau, auf dem die Arbeitgeber weder einen Anreiz zur Verminderung noch zur Erhöhung der Beschäftigung hat – von der Höhe der laufenden Investitionen ab. Diese ist ihrerseits vom Investitionsanreiz, wie wir es nennen wollen, abhängig, welcher wiederum, wie wir noch sehen werden, vom Verhältnis zwischen der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals auf der einen und den Zinssätzen für Darlehen verschiedener Laufzeiten und Risiken auf der anderen Seite abhängt.
Bei einer bestimmten Konsumneigung und Investitionshöhe kann es nur ein Beschäftigungsniveau geben, das mit dem Gleichgewichtszustand ver[38]einbar ist. Alles andere würde dazu führen, dass der aggregierte Angebots- und Nachfragfragepreis der gesamten Produktmenge nicht mehr übereinstimmt. Dieses Niveau kann nicht über Vollbeschäftigung liegen, d. h. der Reallohn kann nicht geringer sein als das Grenzleid der Arbeit. Aber es gibt auch keinen Grund für die Annahme, dass es auf der gleichen Höhe wie Vollbeschäftigung liegt. Die mit Vollbeschäftigung verbundene effektive Nachfrage ist ein Spezialfall, der nur eintritt, wenn Konsumneigung und Investitionsanreiz in einem ganz bestimmten Verhältnis zu einander stehen. Diese spezielle Beziehung, die mit den Annahmen der klassischen Theorie übereinstimmt, könnte man als optimales Verhältnis bezeichnen. Dieses kann jedoch nur bestehen, wenn die laufenden Investitionen – zufällig oder absichtlich – eine Nachfragemenge schaffen, die genau der Differenz entspricht zwischen dem aggregierten Angebotspreis des bei Vollbeschäftigung produzierten Ausstoßes und dem, was die Bevölkerung bei Vollbeschäftigung für ihren Konsum auszugeben bereit ist.
Diese Theorie lässt sich in folgenden Aussagen zusammenfassen:
1. Bei einem gegebenen Stand von Technik, Ressourcen und Kosten hängt das Einkommen (sowohl nominal als auch real) von der Menge der Beschäftigung N ab.
2. Das mit D1 bezeichnete Verhältnis zwischen dem Einkommen der Bevölkerung und der Summe, die sie voraussichtlich für den Konsum ausgibt, ist von einer psychologischen Eigenschaft der Menschen abhängig, die wir als Konsumneigung bezeichnen. Genauer gesagt hängt der Konsum also bei unveränderter Konsumneigung von der Höhe des Gesamteinkommens und infolgedessen von der Höhe der Beschäftigung N ab.
3. Die Menge an Arbeitskraft N, die die Unternehmer beschäftigen, hängt von der Summe (D) zweier Größen ab: von D1, dem Betrag, der voraussichtlich für Konsum ausgegeben wird, und D2, dem Betrag, der wahrscheinlich für Neuinvestitionen verwendet wird. D ist das, was wir oben als die effektive Nachfrage bezeichnet haben.
5. Das Beschäftigungsvolumen im Gleichgewichtszustand hängt daher 1. von der aggregierten Angebotsfunktion φ ab, 2. von der Konsumneigung χ und 3. vom Investitionsvolumen D2. Dies ist der Kern der allgemeinen Theorie der Beschäftigung.
6. Für jeden Wert von N gibt es eine entsprechende Grenzproduktivität der Arbeit in den Lohngüterbranchen, durch die sich der Reallohn definiert. [39] Punkt 5 basiert deshalb auf der Voraussetzung, dass N nicht über dem Wert liegen kann, bei dem der Reallohn gleich dem Grenzleid der Arbeit ist. Demzufolge sind nicht alle Änderungen von D kompatibel mit unserer vorläufigen Annahme konstanter Reallöhne. Für die vollständige Darstellung unserer Theorie müssen wir darum auf diese Annahme verzichten.
8. Bei zunehmender Beschäftigung nimmt auch D1 zu, aber nicht im gleichen Maße wie D. Denn bei zunehmendem Einkommen nimmt auch unser Konsum zu, aber nicht im gleichen Maße. Dieses psychologische Gesetz liefert den Schlüssel zu unserem konkreten Problem. Denn daraus lässt sich ableiten: Je größer das Beschäftigungsvolumen, desto größer ist auch die Differenz zwischen dem aggregierten Angebotspreis (Z) der entsprechenden Produkte und der Summe (D1), die die Unternehmer durch die Konsumausgaben der Verbraucher voraussichtlich zurückbekommen. Bei unveränderter Konsumneigung kann die Beschäftigung mithin nur zunehmen, wenn zugleich auch D2 zunimmt und so die wachsende Differenz zwischen Z und D1 ausgleicht. Daher ist es durchaus möglich, dass sich die Gesamtwirtschaft auch bei einem N unterhalb des Vollbeschäftigungsniveaus in einem stabilen Gleichgewicht befindet, und zwar auf dem Niveau, das durch den Schnittpunkt der Gesamtnachfrage- und Gesamtangebotskurven angezeigt wird – jedenfalls, wenn wir einmal von der speziellen Annahme der klassischen Theorie absehen, der zufolge irgendeine Kraft bei steigender Beschäftigung stets für einen ausreichenden Anstieg von D2 sorgt, um die wachsende Differenz zwischen Z und D1 auszugleichen.
Das in Reallöhnen ausgedrückte Grenzleid der Arbeit determiniert also nur insoweit das Beschäftigungsvolumen, als die zu einem bestimmten Reallohn angebotene Arbeitsmenge dessen Obergrenze darstellt. Vielmehr bestimmen Konsumneigung und Investitionsquote zusammen das Beschäftigungsvolumen, welches in direktem Zusammenhang mit dem gegebenen Reallohnniveau steht – und nicht umgekehrt. Wenn Konsumneigung und Investitionsquote nur zu einer unzureichenden effektiven Nachfrage führen, bleibt das tatsächliche Beschäftigungsniveau hinter dem beim gegebenen Reallohn potenziell verfügbaren Angebot an Arbeitskraft zurück. Der reale Gleichgewichtslohn ist dann größer als das Grenzleid des Gleichgewichtsniveaus der Beschäftigung.
[40] Diese Analyse bietet eine Erklärung für das Paradox der Armut mitten im Überfluss. Allein die unzureichende effektive Nachfrage bringt nämlich das Beschäftigungswachstum allzu oft schon zum Stillstand, bevor Vollbeschäftigung erreicht ist. Sie bremst den Produktionsprozess, obwohl das Grenzprodukt der Arbeit immer noch einen Wert hat, der über dem des Grenzleids der Beschäftigung liegt.
Je reicher die Bevölkerung außerdem ist, desto größer ist zumeist auch die Differenz zwischen ihrer tatsächlichen und ihrer potenziellen Produktion – und desto offensichtlicher und schändlicher treten die Mängel unseres Wirtschaftssystems zutage. Denn eine arme Bevölkerung wird tendenziell ihre Produktion zum allergrößten Teil konsumieren, so dass schon eine sehr bescheidene Menge an Investitionen ausreicht, um Vollbeschäftigung zu erzielen. Eine reiche Bevölkerung muss hingegen viel umfangreichere Investitionsgelegenheiten auftun, damit die Sparneigung der wohlhabenden Bürger mit der Beschäftigung der ärmeren Bevölkerungsschichten vereinbar ist. Bestehen in einem potenziell wohlhabenden Gemeinwesen nur ein schwacher Investitionsanreiz, dann sorgt das Prinzip der effektiven Nachfrage trotz des potenziellen Reichtums für eine Verringerung der Produktion. Dies setzt sich so lange fort, bis die Bevölkerung trotz all ihres potenziellen Reichtums so arm geworden ist, dass ihre über den Konsumausgaben liegenden Einnahmen hinreichend geschrumpft sind, um sich mit dem schwachen Investitionsanreiz zu decken.
Aber es kommt noch schlimmer. Nicht nur ist in einem wohlhabenden Gemeinwesen die marginale Konsumneigung6 schwächer, sondern es sind auch die Investitionsgelegenheiten wegen der bereits fortgeschrittenen Kapitalakkumulation weniger attraktiv, es sei denn, der Zinssatz sinkt schnell genug. Dies führt uns zur Theorie des Zinssatzes und zu den Gründen, warum dieser nicht automatisch auf das angemessene Niveau sinkt. Dies wird Thema von Buch IV sein.
Bei der Analyse der Konsumneigung, der Definition der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und der Theorie des Zinssatzes handelt es sich um unsere drei größten Wissenslücken, die es zu füllen gilt. Dabei wird sich dann die Theorie der Preise als ein unserer allgemeinen Theorie untergeordnetes Thema entpuppen. Dagegen wird sich herausstellen, dass Geld in unserer Theorie des Zinssatzes eine wesentliche Rolle spielt. Wir wollen deshalb versuchen, die besonderen Eigenschaften von Geld herauszuarbeiten, die es von allen anderen Dingen unterscheidet.
[41] III.