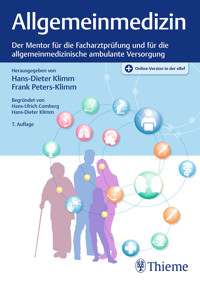
Allgemeinmedizin E-Book
139,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch liefert Ihnen den roten Faden für den Einstieg in die Hausarztmedizin: Akutsprechstunde, Familienmedizin, Gesundheitsförderung, Prävention, ambulante und hausärztliche Versorgung.
Alle Krankheitsbilder sind mit Empfehlungen, Evidenzgraden und ICD-Kodierung versehen. Hinweise auf Leitlinien der DEGAM und Online-Ressourcen ermöglichen ein schnelles Auffinden von weiterführenden Informationen.
Die 7. Auflage wurde aktualisiert und erweitert:
- neue Kapitel zu Videosprechstunde und Digitalisierung
- neue Beiträge zu den Rechtsgrundlagen
- Erweiterung der Tertiärprävention und diverser Therapieverfahren
- Aufnahme neuer Krankheitsbilder
Sie erfahren alles Wichtige zum Berufsbild sowie aktuelle Informationen zur Weiterbildung Allgemeinmedizin. Durch die übersichtliche Struktur ist es ideal als Nachschlagewerk in der Hausarztpraxis und als Repetitorium zur Vorbereitung auf die Facharztprüfung Allgemeinmedizin.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1755
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Allgemeinmedizin
Der Mentor für die Facharztprüfung und für die allgemeinmedizinische ambulante Versorgung
Herausgegeben von
Hans-Dieter Klimm, Frank Peters-Klimm
Jörg Barlet, Tobias Freund*, Christine Faller, Katharina Glassen, Walter E. Haefeli, Nicolas Hohmann, Stefanie Joos, Sven Karstens*, Susanne Klimm, Katja Krug, Thomas Kühlein, Anette Lampert, Stefan Bilger, Thomas Ledig, Rüdiger Leutgeb, Claudia Lutz, Antje Miksch, Gerd Mikus, Uwe Müller-Bühl, Karl-Christian Münter, Dominik Ose, Frank Peters-Klimm, Benedikt Pflanz, Antje Blank, Rainer Schaefert, Mark Schäfer, Tilman Schöning, Niklas Schurig, Simon Schwill, Hanna Seidling, Alexander Send*, Jost Steinhäuser, Gert Ulrich, M.A., Cornelia Wachter, Nicola Buhlinger-Göpfarth, Ingeborg Walter-Sack, Victoria Ziesenitz, David Czock, Christiane Eicher*, Peter Engeser, Maren Erhardt*, Elisabeth Flum*
7., überarbeitete und erweiterte Auflage
42 Abbildungen
Vorwort
Im Frühjahr 1996 erschien zum ersten Mal das Buch „Allgemeinmedizin“, damals im Enke-Verlag. Das Ziel der Autoren war damals wie heute, Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin, insbesondere aber solchen in der Weiterbildung, das Verständnis ihres Faches ebenso wie die Breite der Aufgaben und deren Bewältigung zu erleichtern.
Die faktenreiche Darstellung von vielen Krankheitsbildern in Kombination mit dem didaktischen Aufbau und der verständlichen Diktion haben sich bewährt. Dies wird durch die Notwendigkeit für eine weitere Auflage bestätigt. In diesen vergangenen, bald 30 Jahren hat sich vieles in der Medizin, auch in der Allgemeinmedizin, verändert. Das wurde, wenn nötig, bedacht und berücksichtigt. Verändert haben sich auch manche äußeren Bedingungen in diesen Jahren, vor allem hinsichtlich technischer Strategien, aber auch rechtlicher wie sozialer Voraussetzungen. Geblieben ist der Patient* im Zentrum, der mit seinen Beschwerden immer noch primär seinen Hausarzt* kontaktiert und dort adäquate Versorgung und Hilfe erwartet. Dafür sprechen nach wie vor die hohen Zahlen der Kontaktaufnahmen zum primärversorgenden Arzt sowie die positive Bewertung der Patienten in der Beurteilung der hausärztlichen Leistungen.
Das Herausgeber- und Autorenteam setzt sich zusammen aus Fachärztinnen und Fachärzten für Allgemeinmedizin und/oder auch an der Hochschule tätigen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen bzw. Professoren in der klinischen Pharmakologie oder in der Allgemeinmedizin, sei es als verantwortliche Leiter der jeweiligen Abteilung oder akademische Mitarbeiter und Lehrbeauftragte. Alle haben dazu beigetragen, dass die nun vorliegende 7. Auflage weiterhin dazu dienen kann, den Praxisalltag besser zu verstehen und evidenzorientiertes praktisches Handeln zu fördern.
Eingedenk des schier unendlichen „Problemraums“ in der Hausarztpraxis ist eine Fokussierung auf das Wesentliche umso wichtiger, und auch ein eventuell aufkommendes Bedürfnis nach Struktur und Übersicht nur zu verständlich. Das vorliegende Buch und die folgenden Hinweise zu seinem Aufbau sollen dabei helfen, einen Überblick im hausärztlichen Setting zu bekommen bzw. ihn zu behalten:
Teil I: Im Allgemeinen Teil werden neben den (auch gesetzlichen) Rahmenbedingungen unter dem Begriff der „DEGAM-Fachdefinition“ die vielfältigen Dimensionen hausärztlicher Tätigkeit ausführlich beschrieben. So soll ein erweitertes Grundverständnis hausärztlicher Identität vermittelt werden.
Teil II: Im Teil Prävention werden konkrete präventive Maßnahmen und Programme strukturiert erläutert: „Gesund bleiben“ fördern (Primärprävention), „symptomlose Krankheit“ früh erkennen und möglichst heilen (Sekundärprävention) und „Leben mit Krankheit“ verbessern bzw. Folgeschäden möglichst verhindern (Tertiärprävention) werden hier in ihrer konkreten hausärztlichen Anwendung und Fülle erkennbar.
Teil III: In der „Akutsprechstunde“ sind die häufigsten Beratungsanlässe nach „Schmerzen“, „Beschwerden“ und „Leitsymptomen“ gegliedert und unter Berücksichtigung der diagnostischen Möglichkeiten in und außerhalb der Praxis differenzialdiagnostisch aufbereitet. Hausarztspezifische Aspekte wie „Abwendbar gefährliche Verläufe“ sowie „Abwartendes Offenhalten“ wurden integriert. Querverweise stellen den Bezug zu häufigen hausärztlichen Beratungsergebnissen aus Teil V her.
Teil IV: Dieser Teil gibt einen Überblick über die verschiedenen therapeutischen Methoden und Verfahren in der Allgemeinmedizin. Erkennbar wird, welche Vielfalt an Möglichkeiten vorhanden ist, in der Hausarztpraxis therapeutisch wirksam zu werden.
Teil V: Hier werden in alphabetischer Reihenfolge 212 wichtige und häufige Krankheitsbilder eingehend besprochen.
Die insgesamt im Buch besprochenen Symptome, Symptomgruppen, Bilder von Krankheiten und Diagnosen sollten entsprechend der Kenntnisse zur Praxisepidemiologie einer Hausarztpraxis im langjährigen Durchschnitt mengenmäßig über 95% aller Beratungsergebnisse abdecken. Auf COVID-19 haben wir trotz der hohen Praxisprävalenz aufgrund der sich rasch ändernden Wissensbasis bewusst verzichtet.
Nicht nur der Aufbau, auch die Querverweise zwischen den Buchteilen bzw. den Kapiteln sollen helfen, konzeptionelle wie auch inhaltliche Orientierung zu ermöglichen. Wo es passend erschien, werden Hinweise zu Leitlinien gegeben. Neben der Zielsetzung des vorliegenden Werkes als Lese- bzw. Lehrbuch und Repetitorium hat sich mit der Einführung der eRef gezeigt, dass durch die Online- und Offline-Version zusätzliche Mehrwerte geschaffen wurden: Die eRef erleichtert ein noch schnelleres Auffinden der gesuchten Informationen. Darüber hinaus haben erfreulicherweise die Anbieter von Praxisverwaltungssystemen in zunehmender Häufigkeit eine direkte Verknüpfungsmöglichkeit zur eRef eingerichtet.
Wir, die Herausgeber, danken dem Thieme Verlag für das Vertrauen und Frau Dr. Tegude und Frau Dr. Bouché für die tatkräftige Unterstützung in den letzten Monaten, mit der eine Umsetzung trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie möglich war. Wir danken allen Mitautoren für ihre tatkräftige Unterstützung und Hilfe sowie für ihre wunderbaren Beiträge. Möge auch die 7. Auflage ein guter Praxisbegleiter sein.
Kuppenheim/Heidelberg im Frühjahr 2023Prof. Dr. med. Hans-Dieter Klimm,Prof. Dr. med. Frank Peters-Klimm
* Hinweis zur Sprachform: Wir haben auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen meistens verzichtet und dafür das generische Maskulinum verwendet. Wo verwendet, gelten die Personenbezeichnungen gleichermaßen für alle Geschlechter.
Geleitwort
Die allgemeinärztliche Betreuung von Menschen aus allen sozialen Schichten, verschiedenen Alters und Geschlechts im langzeitlichen Kontext ihrer Beziehungspersonen ist gleichzeitig belohnend und herausfordernd. Es bedarf hierzu eines umfangreichen Fachwissens und mannigfaltiger technischer, manueller und kommunikativer Kompetenzen. Es braucht aber, um als wirkliche Allgemeinärzt:in tätig zu sein, noch mehr: Es braucht ein Verständnis über die spezifische Arbeitsweise und die Theorie des Faches. Nur so kann wirkliche Expertise entstehen.
Kaum anderswo ist die Diagnosestellung so komplex, kaum anderswo ist ein kritisch reflektiertes Abwägen – am besten gemeinsam mit den Patient:innen – so essenziell, um Fehlversorgung zu vermeiden. Kaum anderswo muss so stark berücksichtigt werden, dass Einstellungen und Präferenzen nicht statisch sind, sondern einer permanenten Anpassung und Wandlung unterliegen.
Auf diesem Hintergrund ermöglicht das Buch seinen Leser:innen durch seine klare didaktische Aufteilung in theoretisch-grundlegende und praktisch-klinische Teile, die Allgemeinmedizin fundiert kennenzulernen. Auch neue relevante Entwicklungen wie die Errichtung der Kompetenzzentren für die allgemeinmedizinische Weiterbildung oder die zunehmende Bedeutung der eigenen ärztlichen Gesundheit werden im Kontext des Faches dargestellt.
Den vielen sorgfältig ausgewählten Behandlungsanlässen kommt zugute, dass die Autor:innen die neben ihrer akademischen Verortung allesamt über langjährige Praxiserfahrung verfügen. Den Autor:innen gelingt es dabei, eine Synthese aus allgemeinmedizinischer Arbeitsweise, allgemeinärztlicher Haltung sowie klarem evidenzbasierten Vorgehen zu beschreiben. In den dargestellten Behandlungsanlässen werden dadurch auch immer wieder die generalisierbaren Prinzipien der Allgemeinmedizin deutlich.
Wer sich schon einmal damit beschäftigt hat, ahnt vielleicht, wie schwer es ist, das Fach Allgemeinmedizin in seiner Mannigfaltigkeit und in seiner Tiefe umfassend auf dem limitierten Raum eines Buches darzustellen. Dass dies den Autor:innen auf „nur“ knapp 900 Seiten gelungen ist, verdient Respekt und Anerkennung.
Ich wünsche der 7. Auflage des Buches den gleichen, wenn nicht noch größeren Erfolg als schon bisher. Ich bin mir sicher, dass es ein guter und oft genutzter Begleiter für Studierende, Ärzt:innen in Weiterbildung, Quereinsteiger:innen und Fachärzt:innen in unserem, auch für die Zukunft so wichtigen Fach, sein wird.
Heidelberg Mai 2023
Prof. Dr. med. Attila Altiner
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort
Geleitwort
Teil I Allgemeiner Teil
1 Definition der Allgemeinmedizin (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin)
1.1 Entstehung des Fachs Allgemeinmedizin
1.2 Fachdefinitionen
1.3 Familienmedizin
1.4 Literatur
2 Definition der Allgemeinmedizin (Bundesärztekammer)
2.1 Literatur
3 Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin
3.1 Zielsetzung
3.2 Weiterbildung
3.3 Bedeutung der Weiterbildung Allgemeinmedizin
3.4 Ablauf der Weiterbildung
3.5 Miller-Pyramide (klinische Kompetenz)
3.6 Erlangung der Weiterbildungsbefugnis
3.7 Honorierung des Arztes in Weiterbildung
3.8 Fachgespräch
3.9 Literatur
4 Stellung der Allgemeinmedizin in der ärztlichen Versorgung in der BRD
4.1 Allgemeinärzte und berufstätige Ärzte
4.2 Allgemeinärzte in der ambulanten Versorgung
4.3 Angestellte Ärzte
4.4 Ärzte im Ruhestand
4.5 Literatur
5 Arbeitsbereiche
5.1 Fächerübergreifende und ‑integrierende Grundversorgung
5.2 Akut- und Notfallversorgung
5.2.1 Notfälle
5.2.2 Ärztlicher Bereitschaftsdienst bzw. Notdienst
5.3 Koordinations- und Verteilerfunktion
5.4 Kinder und Jugendliche
5.5 Versorgung alter Patienten
5.6 Case-Management
5.7 Langzeitversorgung
5.8 Versorgung von häuslichen und familiären Gemeinschaften
5.9 Betreuung unheilbar Kranker und Sterbender
5.10 Prävention
5.11 Rehabilitation
5.12 Literatur
6 Ganzheitlicher Arbeitsansatz/Arbeitsweise
6.1 Einleitung
6.2 Somatische Aspekte
6.3 Psychosoziale/psychosomatische Aspekte
6.3.1 Psychosomatische Probleme
6.3.2 Psychosoziale Probleme
6.4 Soziokulturelle Aspekte
6.5 Ökologische Aspekte
6.6 Ökonomische Aspekte
6.7 Literatur
7 Arbeitsgrundlagen
7.1 Arzt-Patient-Beziehung
7.2 Beziehungen auf Dauer
7.3 Erlebte Anamnese
7.4 Niedrigprävalenz
7.5 Abwartendes Offenlassen
7.6 Abwendbar gefährlicher Verlauf
7.7 Literatur
8 Arbeitsauftrag und Arbeitsaufteilung
8.1 Filter- und Steuerfunktion
8.2 Stufendiagnose und Stufentherapie
8.3 Fachspezialisten und Kliniken
8.3.1 Niedergelassene Fachspezialisten
8.3.2 Fachspezialisten in Kliniken
8.4 Medizinische Fachangestellte
8.5 Familie
8.6 Häusliches Umfeld und soziale Gemeinschaft
8.6.1 Hausbesuch
8.6.2 Pflegebedürftigkeit
8.7 Literatur
9 Rechtliche Bestimmungen
9.1 Arztrecht
9.2 Berufsordnung der Ärzte
9.3 Gesetzliche Krankenversicherung
9.4 Privatärztliche Versorgung
10 Hausärztliche Versorgung
10.1 Kassenärztliche Versorgung
10.2 Privatärztliche Versorgung
10.3 Gesetzliche Unfallversicherung
10.4 Hausarztzentrierte Versorgung
10.5 Verträge der integrierten Versorgung
10.6 Videosprechstunde
10.7 Literatur
11 Formen der Praxisausübung
11.1 Einzelpraxis
11.2 Gemeinschaftspraxis
11.3 Gruppenpraxis
11.4 Angestellter Arzt
11.5 Medizinisches Versorgungszentrum
11.6 Praxisvertretungen
11.7 Literatur
12 Qualitätsmanagement in der Hausarztpraxis
12.1 Definition von Qualität
12.2 Rechtlicher Hintergrund
12.3 Qualitätsmanagementsysteme und Praxiszertifizierung
12.4 Instrumente der Qualitätsförderung
12.5 Einführung des QM in der Arztpraxis
12.6 Besondere qualitätssichernde Maßnahmen (Hygiene)
12.7 Digitalisierung in der Medizin
12.8 Literatur
13 Evidenzbasierte Medizin und Leitlinien
13.1 Evidenzbasierte Medizin
13.1.1 Definition und Ziele
13.1.2 Praktische Anwendung
13.2 Leitlinien
13.2.1 Definition und Anwendung
13.2.2 Leitlinienentwicklung
13.2.3 DEGAM-Leitlinien
13.3 Literatur
14 Rechtsgrundlagen und Definitionen
14.1 Versicherungen
14.1.1 Gesetzliche Krankenkassen
14.1.2 Private Krankenkassen
14.1.3 Zusatzversicherungen
14.1.4 Berufsgenossenschaft
14.1.5 Unfallversicherung
14.2 Arbeitsunfähigkeit
14.2.1 Definition
14.2.2 Details zur Arbeitsunfähigkeit
14.2.3 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
14.2.4 Lohnfortzahlung und Krankengeld
14.2.5 Arbeitslosenversicherung
14.3 Arbeitsverbot
14.4 Schwerbehinderung
14.5 Berentung – Grundrente
14.5.1 Rentenversicherung
14.5.2 Versicherte
14.5.3 Rentenformen
14.5.4 Finanzierung
14.5.5 Vorgezogene Berentung
14.5.6 Teilberentung
14.5.7 Grundrente
14.6 Pflegebedürftigkeit
14.6.1 Pflegekassen
14.6.2 Pflegebedürftige
14.6.3 Pflegegrade (früher Pflegestufen)
14.6.4 Vorgehen bei Pflegebedürftigkeit
14.6.5 Kooperationsverträge und Pflegeheimbewohner
14.6.6 Pflegende Angehörige
14.6.7 Häusliche Krankenpflege
14.7 Gutachten und Untersuchungen
14.7.1 Versicherungsuntersuchung
14.7.2 Fitnessuntersuchung
14.8 Meldepflicht
14.9 Patientenverfügung und Betreuung
14.9.1 Voraussetzungen
14.9.2 Vorsorgeverfügungen
14.10 Leichenschau
14.10.1 Voraussetzungen
14.10.2 Durchführung
14.11 Dokumentation
14.12 Umgang mit Beschwerden und Behandlungsfehlern
14.13 Atteste
14.13.1 Feststellung Verhandlungsfähigkeit
14.13.2 Fahr- und Reisetauglichkeit
14.13.3 Reiserücktritt
14.13.4 Sportbefreiung
14.13.5 Ärztliche Zeugnisse zum Ausüben bestimmter Sportarten
14.14 Fixierung
14.15 Beschäftigungsverbot für Schwangere
14.16 Kündigung auf ärztlichen Rat
14.17 Schweigepflicht
14.18 Aggressiver Patient
14.19 Zweitmeinung
14.20 Organspende
14.20.1 Organspendegesetz
14.20.2 Organspendeausweis
14.21 Literatur
Teil II Prävention
15 Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten
15.1 Einleitung
15.2 Mögliche Herausforderungen im Arztberuf
15.3 Resilienz
15.4 Stressmanagement
15.5 Achtsamkeit
15.6 Arbeitsbewältigungsfähigkeit
15.7 Literatur
16 Gesundheitsförderung
16.1 Definition
16.2 Modelle und Konzepte der Gesundheitsförderung
16.3 Rolle des Hausarztes in der Gesundheitsförderung
16.4 Literatur
17 Häufigkeit präventiver Leistungen in der BRD
17.1 Definition
17.2 Primärprävention
17.3 Sekundärprävention
17.4 Literatur
18 Primärprävention
18.1 Grundlagen
18.2 Gesundheitsaufklärung
18.3 Gesundheitsberatung und Coaching
18.3.1 Gesundheitsberatung
18.3.2 Gesundheitscoaching
18.3.3 Anbieter
18.3.4 Setting-Ansatz
18.4 Impfempfehlungen
18.4.1 Einleitung
18.4.2 Impfempfehlungen der STIKO
18.4.3 Impfpraxis
18.4.4 Umgang mit Impfstoffen und Vorgehen bei der Impfung
18.4.5 Dokumentation
18.4.6 Unerwünschte Arzneimittelwirkungen nach Impfung
18.4.7 Impfkalender
18.4.8 Indikationsimpfungen
18.4.9 Anmerkungen zu einzelnen Impfungen
18.4.10 Impfungen in der Schwangerschaft
18.4.11 Impfempfehlungen für Aussiedler, Flüchtlinge oder Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften
18.5 Reisemedizin
18.5.1 Definition
18.5.2 Reisevorbereitung
18.5.3 Erkrankungen nach Fernreisen
18.6 Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
18.7 Literatur
19 Sekundärprävention
19.1 Gesetzlich geregelte Vorsorgemaßnahmen
19.1.1 Kindervorsorge
19.1.2 Gesundheitsuntersuchung
19.1.3 Krebsfrüherkennung bei Männern
19.1.4 Krebsfrüherkennung bei Frauen
19.1.5 Mammografie-Screening
19.1.6 Hautkrebs-Screening
19.1.7 Darmkrebs-Screening
19.1.8 Früherkennung: Bauchaortenaneurysma
19.2 Ungeregelte Vorsorgemaßnahmen (IGeL)
19.2.1 Definition der individuellen Gesundheitsleistungen
19.2.2 Erweitertes Laborscreening
19.2.3 Doppler-Sonografie der Beine
19.2.4 Sonografie der Karotiden
19.2.5 EKG
19.3 Literatur
20 Tertiärprävention
20.1 Stufenweise Wiedereingliederung
20.2 Umschulung
20.3 Rehabilitation
20.3.1 Stationäre Rehabilitation
20.3.2 Ambulante Rehabilitation
20.3.3 Teilstationäre Rehabilitation
20.3.4 Offene Badekur
20.4 Spezifische Disease-Management-Programme
20.4.1 Allgemeines
20.4.2 DMP Mammakarzinom
20.4.3 Koronare Herzkrankheit (KHK)
20.4.4 Asthma bronchiale
20.4.5 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
20.4.6 Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2
20.4.7 Herzinsuffizienz
20.4.8 Chronischer Rückenschmerz
20.4.9 Depression
20.4.10 Osteoporose
20.4.11 Rheumatoide Arthritis
20.5 Hausärztliche und spezialisierte geriatrische Versorgung
20.6 Literatur
21 Quartäre Prävention
Teil III Akute Sprechstunde – Vom Symptom zur Diagnose
22 Beratungsanlässe und erstellte Diagnosen
22.1 Definition des Beratungsanlasses
22.2 Erwachsene
22.3 Kinder
22.4 Krankheitskombinationen
22.5 Literatur
23 Schmerzen
23.1 Kopfschmerz (R51)
23.1.1 Definition und Epidemiologie
23.1.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.1.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.1.4 Leitlinien
23.2 Halsschmerz (R07, J02, M54.-)
23.2.1 Definition und Epidemiologie
23.2.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.2.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.2.4 Leitlinien
23.3 Ohrenschmerz (H92)
23.3.1 Definition und Epidemiologie
23.3.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.3.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.3.4 Leitlinien
23.4 Brustschmerz
23.4.1 Definition und Epidemiologie
23.4.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.4.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.4.4 Leitlinien
23.5 Bauchschmerz (R10.4)
23.5.1 Definition und Epidemiologie
23.5.2 Schweregrade: akutes Abdomen
23.5.3 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.5.4 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.5.5 Leitlinien
23.6 Beinschmerz (M79.6)
23.6.1 Definition und Epidemiologie
23.6.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.6.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.6.4 Leitlinie
23.7 Rückenschmerz (M54.99)
23.7.1 Definition und Epidemiologie
23.7.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.7.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.7.4 Leitlinien
23.8 Gelenkschmerz (M25.59)
23.8.1 Definition und Epidemiologie
23.8.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.8.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.8.4 Leitlinien
23.9 Muskelschmerz (M62.9)
23.9.1 Definition und Epidemiologie
23.9.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.9.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.9.4 Leitlinien
23.10 Schmerz im Urogenitalbereich
23.10.1 Definition und Epidemiologie
23.10.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.10.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.10.4 Leitlinien
23.11 Schmerz beim Stuhlgang (R15–19)
23.11.1 Definition
23.11.2 Epidemiologie
23.11.3 Differenzialdiagnostische Überlegungen
23.11.4 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
23.11.5 Leitlinien
23.12 Literatur, Links und Leitlinien
24 Beschwerden
24.1 Allgemeine Schwäche und Müdigkeit (R53)
24.1.1 Definition und Epidemiologie
24.1.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.1.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.1.4 Leitlinien
24.2 Schwindel (R42)
24.2.1 Definition und Epidemiologie
24.2.2 Differenzialdiagnostische Überlegung
24.2.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.2.4 Leitlinien
24.3 Tinnitus (H93.1)
24.3.1 Definition
24.3.2 Differenzialdiagnostische Überlegung
24.3.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.3.4 Leitlinien
24.4 Heiserkeit (R49.0) und Stridor (R06.1)
24.4.1 Definition und Epidemiologie
24.4.2 Differenzialdiagnostische Überlegung
24.4.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.4.4 Leitlinien
24.5 Globusgefühl (F45.8)
24.5.1 Definition und Epidemiologie
24.5.2 Differenzialdiagnostische Überlegung
24.5.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.5.4 Leitlinien
24.6 Schnupfen (Rhinitis, J00, J30, J31)
24.6.1 Definition und Epidemiologie
24.6.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.6.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.6.4 Leitlinien
24.7 Husten (R05)
24.7.1 Definition und Epidemiologie
24.7.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.7.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.7.4 Leitlinien
24.8 Auswurf (Sputum, R09.3)
24.8.1 Definition und Epidemiologie
24.8.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.8.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.8.4 Leitlinien
24.9 Atemnot – Dyspnoe (R06.0)
24.9.1 Definition und Epidemiologie
24.9.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.9.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.9.4 Leitlinien
24.10 Herzstolpern – Palpitation (R00.2)
24.10.1 Definition und Epidemiologie
24.10.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.10.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.10.4 Leitlinien
24.11 Übelkeit und Erbrechen (R11)
24.11.1 Definition und Epidemiologie
24.11.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.11.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.11.4 Leitlinien
24.12 Durchfall (A09.9)
24.12.1 Definition und Epidemiologie
24.12.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.12.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.12.4 Leitlinien
24.13 Verstopfung (K59.0)
24.13.1 Definition und Epidemiologie
24.13.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.13.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.13.4 Leitlinien
24.14 Inkontinenz (R32)
24.14.1 Definition und Epidemiologie
24.14.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.14.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.14.4 Leitlinien
24.15 Appetitlosigkeit (R63.0)
24.15.1 Definition
24.15.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.15.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.15.4 Leitlinien
24.16 Beschwerden beim Wasserlassen (N.–)
24.16.1 Definition
24.16.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.16.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.16.4 Leitlinien
24.17 Juckreiz (L29.9)
24.17.1 Definition
24.17.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.17.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.17.4 Leitlinien
24.18 Haarausfall (L65.–)
24.18.1 Definition
24.18.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.18.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.18.4 Leitlinien
24.19 Zittern (R25.1)
24.19.1 Definition
24.19.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.19.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.19.4 Leitlinien
24.20 Gedächtnisstörungen (R41.3)
24.20.1 Definition und Epidemiologie
24.20.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.20.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.20.4 Leitlinien
24.21 Sehstörung (H0–59)
24.21.1 Definition
24.21.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.21.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.21.4 Leitlinien
24.22 Hörstörungen (H93.2)
24.22.1 Definition und Epidemiologie
24.22.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.22.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.22.4 Leitlinien
24.23 Schlafstörungen (G47.9)
24.23.1 Definition und Epidemiologie
24.23.2 Formen der Schlafstörungen
24.23.3 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.23.4 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.23.5 Leitlinien
24.24 Traurigkeit (F32.9)
24.24.1 Definition und Epidemiologie
24.24.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.24.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.24.4 Leitlinien
24.25 Angst (F41.9)
24.25.1 Definition und Epidemiologie
24.25.2 Schweregrad und Leitsymptome
24.25.3 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.25.4 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.25.5 Leitlinie
24.26 Nervosität (R45.9)
24.26.1 Definition und Epidemiologie
24.26.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.26.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.26.4 Leitlinie
24.27 Nervenzusammenbruch (F43.9)
24.27.1 Definition
24.27.2 Schweregrade und Leitsymptome
24.27.3 Differenzialdiagnostische Überlegungen
24.27.4 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
24.28 Literatur, Links und Leitlinien
25 Leitsymptome
25.1 Bewusstseinsstörungen (R41.8)
25.1.1 Definition und Epidemiologie
25.1.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.1.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.1.4 Leitlinien
25.2 Lähmungen (G83.9)
25.2.1 Definition
25.2.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.2.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.2.4 Leitlinie
25.3 Krampfanfall (R56.8)
25.3.1 Definition und Epidemiologie
25.3.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.3.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.3.4 Leitlinien
25.4 Fieber (R50.9)
25.4.1 Definition und Epidemiologie
25.4.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.4.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.4.4 Leitlinien
25.5 Blässe
25.5.1 Differenzialdiagnostische Überlegung
25.5.2 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.5.3 Leitlinien
25.6 Gelbsucht (R17)
25.6.1 Definition
25.6.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.6.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.6.4 Leitlinien
25.7 Rotes Auge (H01–H59)
25.7.1 Definition und Epidemiologie
25.7.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.7.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.7.4 Leitlinien
25.8 Wassereinlagerungen (Ödeme) (R60.9)
25.8.1 Definition
25.8.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.8.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.8.4 Leitlinien
25.9 Gewichtsverlust (R63.4)
25.9.1 Definition
25.9.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.9.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.9.4 Leitlinien
25.10 Blut im Urin (N30, N34)
25.10.1 Definition und Epidemiologie
25.10.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.10.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.10.4 Leitlinien
25.11 Blut im bzw. auf dem Stuhl (R19, K92.1)
25.11.1 Definition
25.11.2 Epidemiologie
25.11.3 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.11.4 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.11.5 Leitlinien
25.12 Vaginaler Ausfluss (N89.8)
25.12.1 Definition und Epidemiologie
25.12.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.12.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.12.4 Leitlinien
25.13 Gelenkentzündungen (M13.99)
25.13.1 Definition
25.13.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.13.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.13.4 Leitlinien
25.14 Hautveränderungen (L,B,R)
25.14.1 Definition und Epidemiologie
25.14.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.14.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.14.4 Leitlinien
25.15 Lymphknotenvergrößerungen (R59.9)
25.15.1 Definition
25.15.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.15.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.15.4 Leitlinien
25.16 Resistenzen und Hernien im Abdomen (K56.9)
25.16.1 Definition und Epidemiologie
25.16.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.16.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.16.4 Leitlinien
25.17 Psychische Auffälligkeiten (F32.2)
25.17.1 Definition
25.17.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.17.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.17.4 Leitlinien
25.18 Hyperventilation (R06.4)
25.18.1 Definition und Epidemiologie
25.18.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.18.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.19 Unruhige Beine („restless legs“, G25.81)
25.19.1 Definition und Epidemiologie
25.19.2 Differenzialdiagnostische Überlegungen
25.19.3 Diagnostische Möglichkeiten in der Praxis
25.19.4 Leitlinien
25.20 Literatur
Teil IV Therapie in der Praxis
26 Gesprächstherapie
26.1 Einleitung
26.1.1 Bedeutung von Gesprächen
26.1.2 Strukturierte Gespräche
26.2 Permanenter Dialog
26.3 Adhärenz
26.3.1 Begrifflichkeiten und Dimensionen
26.3.2 Assessment der (Non-)Adhärenz
26.3.3 Strategien-Mix zur Unterstützung von Adhärenz
26.4 Beratung des Patienten
26.4.1 Allgemeine Beratung
26.4.2 Soziale Beratung
26.5 Kleine Psychotherapie
26.6 Sexualmedizin
26.7 Krisenintervention
26.7.1 Definition und Ziele
26.7.2 Suizide und Suizidversuche
26.7.3 Abschätzung der Suizidalität
26.7.4 Verhalten des Arztes
26.8 Gruppentherapie
26.8.1 Ziele
26.8.2 Gruppentherapie als Präventivmaßnahme
26.8.3 Gruppen-Psychotherapie
26.8.4 Weitere Gruppentherapieformen
26.9 Familientherapie
26.10 Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen
26.11 Literatur, Links und Leitlinien
27 Medikamentöse Therapie
27.1 Rezeptschreibung
27.2 Ansetzen und Beenden von Therapien
27.2.1 Kurzzeitige Behandlung
27.2.2 Langzeittherapien
27.3 Polypharmazie und Interaktionen
27.3.1 Polypharmazie
27.3.2 Wechselwirkungen (Interaktionen)
27.4 Dosierung bei Leber- und Niereninsuffizienz
27.4.1 Niereninsuffizienz
27.4.2 Leberinsuffizienz
27.5 Besonderheiten der Arzneimitteltherapie bei Kindern
27.5.1 Entwicklungsprozesse
27.5.2 Besonderheiten
27.6 Besonderheiten der Arzneimitteltherapie bei Erwachsenen
27.6.1 Wahl des Wirkstoffs
27.6.2 Wahl der Dosis und Therapiedauer
27.6.3 Arzneimittelinformationen
27.6.4 Dokumentation und Medikationsplan
27.7 Besonderheiten der Arzneimitteltherapie bei Betagten
27.7.1 Polypharmazie, Multimorbidität, Begleiterkrankungen
27.7.2 Behandlungsziele
27.7.3 Qualitätssicherung
27.7.4 Leitlinie
27.8 Medikamente während Schwangerschaft und Stillzeit
27.8.1 Nutzen-Risiko-Abwägung
27.8.2 Schwangerschaft
27.8.3 Stillzeit
27.9 Medikamentöse Schwangerschaftsverhütung
27.9.1 Mögliche Formen der Verhütung
27.9.2 Wechselwirkungen
27.9.3 Notfallverhütung
27.10 Gerinnungshemmer und Bridging
27.10.1 Gerinnungshemmer
27.10.2 Bridging
27.11 Medikamentöse Therapie neoplastischer Erkrankungen (Chemotherapie)
27.11.1 Prinzipien
27.11.2 Begleitmedikation
27.11.3 Unerwünschte Arzneimittelwirkungen/Toxizität
27.12 Monitoring der Therapie inklusive therapeutisches Drug-Monitoring
27.12.1 Monitoring des Medikationsprozesses
27.12.2 Überprüfung von Wirksamkeit und Risiken
27.12.3 Therapeutisches Drug Monitoring
27.13 Unerwünschte Arzneimittelwirkungen
27.13.1 Definition
27.13.2 Kausalitätsabklärung
27.13.3 Mechanismen
27.13.4 Schwerwiegende UAW
27.13.5 Häufigkeitsbezeichnungen
27.13.6 Informationsquellen
27.13.7 Medikationsfehler
27.14 Arzneimittel richtig anwenden
27.15 Selbstmedikation
27.16 Moderne Immuntherapie
27.16.1 Grundlagen
27.16.2 Überblick über die Arzneimittel
27.17 Biosimilars
27.18 Neue Cannabis-Therapieverfahren
27.18.1 Gesetzlicher Rahmen
27.18.2 Einsatzgebiete
27.18.3 Besonderheiten bei der Verschreibung
27.18.4 Cannabissorten
27.18.5 Literatur, Links und Leitlinien
28 Heil- und Hilfsmittel
28.1 Einleitung und Definition
28.1.1 Heilmittel
28.1.2 Hilfsmittel
28.2 Heilmittel
28.2.1 Heilmittelerbringer
28.2.2 Verordnung von Heilmitteln
28.3 Hilfsmittel
28.3.1 Prothesen
28.3.2 Gehhilfen
28.3.3 Rollstuhl
28.3.4 Inkontinenzhilfen
28.3.5 Hörhilfen
28.4 Literatur, Links und Leitlinien
29 Komplementärmedizin
29.1 Grundlagen
29.1.1 Begriffsdefinition
29.1.2 Verbreitung
29.1.3 Forschungsstand
29.1.4 Kostenübernahme
29.2 Klassische Naturheilverfahren
29.2.1 Hydrotherapie
29.2.2 Phytotherapie
29.2.3 Ordnungstherapie
29.3 Nicht klassische komplementäre Verfahren
29.3.1 TCM/Akupunktur
29.3.2 Homöopathie
29.3.3 Manuelle Medizin
29.4 Literatur
30 Ernährungstherapie
30.1 Säuglinge
30.2 Kleinkinder
30.3 Jugendliche
30.4 Schwangerschaft
30.5 Mangelernährung
30.5.1 Therapie der Mangelernährung
30.6 Alter
30.7 Untergewicht
30.8 Übergewicht und Adipositas
30.9 Ballaststoffe
30.10 Vitamine und Ersatzstoffe
30.11 Jodstoffwechsel
30.12 Ernährungstherapie bei bestimmten Erkrankungen
30.12.1 Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2
30.12.2 Hyperlipidämie
30.12.3 Hyperurikämie
30.12.4 Lebererkrankungen
30.12.5 Pankreaserkrankungen
30.12.6 Osteoporose
30.13 Literatur
31 Bewegungstherapie
31.1 Definition
31.2 Körperliche Aktivität und Gesundheit
31.3 Aktivitätsempfehlungen der WHO
31.4 Sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung
31.5 Präventionssport
31.6 Rehasport
31.7 Funktionstraining
31.8 Literatur
32 Besondere Therapieverfahren
32.1 Vorbereitung und Nachsorge bei Operationen
32.1.1 Indikation
32.1.2 Methodik
32.1.3 Kosten (Vergütung)
32.2 Wundmanagement
32.2.1 Indikation
32.2.2 Methodik
32.2.3 Kosten
32.2.4 Delegationsverfahren
32.2.5 Leitlinie
32.3 Dekubitusbehandlung
32.3.1 Indikation
32.3.2 Methodik
32.3.3 Ergebnisse
32.3.4 Kosten
32.3.5 Delegationsverfahren
32.3.6 Leitlinien
32.4 Sondenernährung
32.4.1 Einleitung
32.4.2 Indikationen und Kontraindikationen
32.4.3 Methodik
32.4.4 Arzneimittelgabe durch Sonden
32.4.5 Wirksamkeit
32.4.6 Komplikationen
32.5 Stomaversorgung
32.5.1 Einleitung
32.5.2 Indikation
32.5.3 Methodik
32.5.4 Ergebnisse
32.5.5 Delegationsverfahren
32.6 Schmerztherapie
32.6.1 Bedeutung
32.6.2 Epidemiologie
32.6.3 Indikation
32.6.4 Einteilung
32.6.5 Strategie
32.6.6 WHO-Schmerztherapie
32.6.7 Ergebnisse
32.7 Palliativmedizin
32.7.1 Einleitung
32.7.2 Indikation
32.7.3 Methodik
32.7.4 Hausärztliche Palliativmedizin
32.7.5 Symptomlinderung
32.7.6 Leitlinie
32.8 Portspülung
32.8.1 Portsysteme
32.8.2 Indikationen und Kontraindikationen
32.8.3 Vorgehen
32.8.4 Komplikationen
32.9 Tabakentwöhnung
32.9.1 Tabakkonsum und Sterblichkeit
32.9.2 Effekte der Tabakentwöhnung
32.9.3 Vorgehen
32.9.4 Leitlinie
32.10 Tumornachsorge
32.10.1 Einleitung
32.10.2 Vorgehen
32.10.3 Rolle des Hausarztes
32.10.4 Leitlinien
32.11 Radiotherapie
32.11.1 Einleitung und Indikationen
32.11.2 Methoden
32.11.3 Rolle des Hausarztes
32.12 Schlafstörungen
32.12.1 Einleitung
32.12.2 Indikation
32.12.3 Methodik
32.12.4 Leitlinien
32.13 Zwangseinweisung
32.13.1 Indikation
32.13.2 Methodik
32.14 Literatur
33 Häusliche und lokale Pflege- und Hilfsdienste und andere Heilberufe
Teil V Ausgewählte Krankheitsbilder
34 Ausgewählte Krankheitsbilder
34.1 Abort (O06.9)
34.1.1 Definition
34.1.2 Epidemiologie
34.1.3 Ätiologie
34.1.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.1.5 Differenzialdiagnostik
34.1.6 Therapie
34.1.7 Leitlinien
34.2 Abszess (L02.9)
34.2.1 Definition
34.2.2 Epidemiologie
34.2.3 Ätiologie
34.2.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.2.5 Differenzialdiagnostik
34.2.6 Therapie
34.2.7 Leitlinien
34.3 Achillessehnenruptur (M66.5)
34.3.1 Definition
34.3.2 Epidemiologie
34.3.3 Ätiologie
34.3.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.3.5 Differenzialdiagnostik
34.3.6 Therapie
34.4 Adipositas
34.4.1 Definition
34.4.2 Epidemiologie
34.4.3 Ätiologie
34.4.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.4.5 Differenzialdiagnostik
34.4.6 Therapie
34.4.7 Leitlinien
34.5 Adnexitis (N70, N70.0, N70.1)
34.5.1 Definition
34.5.2 Epidemiologie
34.5.3 Ätiologie
34.5.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.5.5 Differenzialdiagnostik
34.5.6 Therapie
34.5.7 Leitlinien
34.6 AIDS und HIV-Infektion (B24)
34.6.1 Definition
34.6.2 Epidemiologie
34.6.3 Ätiologie
34.6.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.6.5 Differenzialdiagnostik
34.6.6 Therapie
34.6.7 Leitlinien und Links
34.7 Akne vulgaris (L70.9)
34.7.1 Definition
34.7.2 Epidemiologie
34.7.3 Ätiologie
34.7.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.7.5 Differenzialdiagnostik
34.7.6 Therapie
34.7.7 Leitlinien
34.8 Alkoholbezogene Störungen (F10.X)
34.8.1 Definition
34.8.2 Epidemiologie
34.8.3 Ätiologie
34.8.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.8.5 Differenzialdiagnostik
34.8.6 Therapie
34.8.7 Leitlinien
34.9 Alopezie (L65)
34.9.1 Definition
34.9.2 Epidemiologie
34.9.3 Ätiologie
34.9.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.9.5 Differenzialdiagnostik
34.9.6 Therapie
34.9.7 Leitlinie
34.10 Analekzem (L20.9, L23.9, L24.9)
34.10.1 Definition
34.10.2 Epidemiologie
34.10.3 Ätiologie
34.10.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.10.5 Differenzialdiagnostik
34.10.6 Therapie
34.10.7 Leitlinie
34.11 Analfissur (K60.0/K60.1)
34.11.1 Definition
34.11.2 Epidemiologie
34.11.3 Ätiologie
34.11.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.11.5 Differenzialdiagnostik
34.11.6 Therapie
34.11.7 Leitlinie
34.12 Anämie (D64.9)
34.12.1 Definition
34.12.2 Epidemiologie
34.12.3 Ätiologie
34.12.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.12.5 Therapie
34.12.6 Leitlinien
34.13 Akuter Angstanfall (Panikattacke)
34.13.1 Definition
34.13.2 Epidemiologie
34.13.3 Ätiologie
34.13.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.13.5 Differenzialdiagnostik
34.13.6 Therapie
34.13.7 Leitlinie
34.14 Angulus infectiosus (K13.0)
34.14.1 Definition
34.14.2 Ätiologie
34.14.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.14.4 Differenzialdiagnostik
34.14.5 Therapie
34.15 Anorexia nervosa (Magersucht) (F50.0)
34.15.1 Definition
34.15.2 Epidemiologie
34.15.3 Ätiologie
34.15.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.15.5 Differenzialdiagnostik
34.15.6 Therapie
34.15.7 Leitlinie
34.16 Aortenaneurysma und -dissektion (I71.–)
34.16.1 Definition
34.16.2 Epidemiologie
34.16.3 Ätiologie
34.16.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.16.5 Differenzialdiagnostik
34.16.6 Therapie
34.16.7 Leitlinien
34.17 Aphthen (B00.2)
34.17.1 Definition
34.17.2 Epidemiologie
34.17.3 Ätiologie
34.17.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.17.5 Differenzialdiagnostik
34.17.6 Therapie
34.17.7 Leitlinie
34.18 Apoplektischer Insult (I63.0, I64.0)
34.18.1 Definition
34.18.2 Epidemiologie
34.18.3 Ätiologie
34.18.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.18.5 Differenzialdiagnostik
34.18.6 Therapie
34.18.7 Leitlinien
34.19 Appendizitis (K37)
34.19.1 Definition
34.19.2 Epidemiologie
34.19.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.19.4 Differenzialdiagnostik
34.19.5 Therapie
34.19.6 Leitlinien
34.20 Arthrose (M19.0)
34.20.1 Definition
34.20.2 Epidemiologie
34.20.3 Ätiologie
34.20.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.20.5 Differenzialdiagnostik
34.20.6 Therapie
34.20.7 Leitlinien
34.21 Asthma bronchiale (J45.9)
34.21.1 Definition
34.21.2 Epidemiologie
34.21.3 Ätiologie
34.21.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.21.5 Differenzialdiagnostik
34.21.6 Therapie
34.21.7 Leitlinien und Links
34.22 Atherom (L72.1)
34.22.1 Definition
34.22.2 Epidemiologie
34.22.3 Ätiologie
34.22.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.22.5 Differenzialdiagnostik
34.22.6 Therapie
34.23 Baker-Zyste (M71.2)
34.23.1 Definition
34.23.2 Epidemiologie
34.23.3 Ätiologie
34.23.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.23.5 Therapie
34.23.6 Leitlinie
34.24 Balanitis (N48.1)
34.24.1 Definition
34.24.2 Epidemiologie
34.24.3 Ätiologie
34.24.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.24.5 Therapie
34.24.6 Leitlinie
34.25 Basaliom (C44.9)
34.25.1 Definition
34.25.2 Epidemiologie
34.25.3 Ätiologie
34.25.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.25.5 Differenzialdiagnostik
34.25.6 Therapie
34.25.7 Leitlinien
34.26 Morbus Bechterew (M45.09)
34.26.1 Definition
34.26.2 Epidemiologie
34.26.3 Ätiologie
34.26.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.26.5 Differenzialdiagnostik
34.26.6 Therapie
34.26.7 Leitlinien
34.27 Blasenkarzinom
34.27.1 Definition
34.27.2 Epidemiologie
34.27.3 Ätiologie
34.27.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.27.5 Differenzialdiagnostik
34.27.6 Therapie
34.27.7 Leitlinie
34.28 Borreliose (A69.2)
34.28.1 Definition
34.28.2 Epidemiologie
34.28.3 Ätiologie
34.28.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.28.5 Differenzialdiagnostik
34.28.6 Therapie
34.28.7 Leitlinien
34.29 Bronchialkarzinom (C34.9)
34.29.1 Definition
34.29.2 Epidemiologie
34.29.3 Ätiologie
34.29.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.29.5 Differenzialdiagnostik
34.29.6 Therapie
34.29.7 Leitlinie
34.30 Bronchitis (J20.9)
34.30.1 Definition
34.30.2 Epidemiologie
34.30.3 Ätiologie
34.30.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.30.5 Differenzialdiagnostik
34.30.6 Therapie
34.30.7 Leitlinien
34.31 Bulimia nervosa (F50.2)
34.31.1 Definition
34.31.2 Epidemiologie
34.31.3 Ätiologie
34.31.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.31.5 Differenzialdiagnostik
34.31.6 Therapie
34.31.7 Leitlinien und Links
34.32 Bursitis (M71.99)
34.32.1 Definition
34.32.2 Epidemiologie
34.32.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.32.4 Differenzialdiagnostik
34.32.5 Therapie
34.32.6 Leitlinien
34.33 Chalazion (Hagelkorn, H00.1)
34.33.1 Definition
34.33.2 Epidemiologie
34.33.3 Ätiologie
34.33.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.33.5 Differenzialdiagnostik
34.33.6 Therapie
34.34 Cholelithiasis (K80.2)
34.34.1 Definition
34.34.2 Epidemiologie
34.34.3 Ätiologie
34.34.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.34.5 Differenzialdiagnostik
34.34.6 Therapie
34.34.7 Leitlinie
34.35 Cholezystitis (K80.2)
34.35.1 Definition
34.35.2 Epidemiologie
34.35.3 Ätiologie
34.35.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.35.5 Differenzialdiagnostik
34.35.6 Therapie
34.35.7 Leitlinie
34.36 Chronische Schmerzsyndrome
34.36.1 Definition
34.36.2 Epidemiologie
34.36.3 Ätiologie
34.36.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.36.5 Differenzialdiagnostik
34.36.6 Therapie
34.36.7 Leitlinien
34.37 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (J44.–)
34.37.1 Definition
34.37.2 Epidemiologie
34.37.3 Ätiologie
34.37.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.37.5 Differenzialdiagnostik
34.37.6 Therapie
34.37.7 Leitlinien und Links
34.38 Commotio (F06.0)
34.38.1 Definition
34.38.2 Epidemiologie
34.38.3 Ätiologie
34.38.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.38.5 Therapie
34.38.6 Leitlinien
34.39 Cor pulmonale (I27.9), pulmonale Hypertonie (I27.28)
34.39.1 Definition
34.39.2 Epidemiologie
34.39.3 Ätiologie
34.39.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.39.5 Differenzialdiagnostik
34.39.6 Therapie
34.39.7 Leitlinien
34.40 Morbus Crohn (K50.0)
34.40.1 Definition
34.40.2 Epidemiologie
34.40.3 Ätiologie
34.40.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.40.5 Differenzialdiagnostik
34.40.6 Therapie
34.40.7 Leitlinie
34.41 Cushing-Syndrom (E24.9)
34.41.1 Definition
34.41.2 Epidemiologie
34.41.3 Ätiologie
34.41.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.41.5 Differenzialdiagnostik
34.41.6 Therapie
34.41.7 Leitlinien
34.42 Dekubitus (L89.99)
34.42.1 Definition
34.42.2 Epidemiologie
34.42.3 Ätiologie
34.42.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.42.5 Differenzialdiagnostik
34.42.6 Therapie
34.42.7 Leitlinien
34.43 Demenz
34.43.1 Definition
34.43.2 Epidemiologie
34.43.3 Ätiologie
34.43.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.43.5 Differenzialdiagnostik
34.43.6 Therapie
34.43.7 Leitlinie
34.44 Depression (F32, F33, F31)
34.44.1 Definition
34.44.2 Epidemiologie
34.44.3 Ätiologie
34.44.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.44.5 Differenzialdiagnostik
34.44.6 Therapie
34.44.7 Leitlinien und Links
34.45 Diabetes mellitus (E10.– bis E14.–)
34.45.1 Definition
34.45.2 Epidemiologie
34.45.3 Ätiologie
34.45.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.45.5 Therapie
34.45.6 Leitlinien
34.46 Distorsionen (T14.3)
34.46.1 Definition
34.46.2 Epidemiologie
34.46.3 Ätiologie
34.46.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.46.5 Therapie
34.46.6 Leitlinien
34.47 Divertikulose/Divertikulitis (K57.–)
34.47.1 Definition
34.47.2 Epidemiologie
34.47.3 Ätiologie
34.47.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.47.5 Differenzialdiagnostik
34.47.6 Therapie
34.47.7 Leitlinie
34.48 Dreitagefieber (B08.2)
34.48.1 Definition
34.48.2 Epidemiologie
34.48.3 Ätiologie
34.48.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.48.5 Differenzialdiagnostik
34.48.6 Therapie
34.49 Ekzem (L30.9)
34.49.1 Definition
34.49.2 Epidemiologie
34.49.3 Ätiologie
34.49.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.49.5 Differenzialdiagnostik
34.49.6 Therapie
34.49.7 Leitlinien
34.50 Enuresis nocturna
34.50.1 Definition
34.50.2 Epidemiologie
34.50.3 Ätiologie
34.50.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.50.5 Differenzialdiagnostik
34.50.6 Therapie
34.50.7 Leitlinien
34.51 Epididymitis (N45.9)
34.51.1 Definition
34.51.2 Epidemiologie
34.51.3 Ätiologie
34.51.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.51.5 Differenzialdiagnostik
34.51.6 Therapie
34.51.7 Leitlinien
34.52 Epikondylitis (M77.8)
34.52.1 Definition
34.52.2 Epidemiologie
34.52.3 Ätiologie
34.52.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.52.5 Differenzialdiagnostik
34.52.6 Therapie
34.52.7 Leitlinie
34.53 Epilepsie (G40.9)
34.53.1 Definition
34.53.2 Epidemiologie
34.53.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.53.4 Differenzialdiagnostik
34.53.5 Therapie
34.53.6 Leitlinien
34.54 Erektile Dysfunktion (F52.2)
34.54.1 Definition
34.54.2 Epidemiologie
34.54.3 Ätiologie
34.54.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.54.5 Therapie
34.54.6 Leitlinie
34.55 Erysipel (A46)
34.55.1 Definition
34.55.2 Epidemiologie
34.55.3 Ätiologie
34.55.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.55.5 Differenzialdiagnostik
34.55.6 Therapie
34.55.7 Leitlinie
34.56 Extrauteringravidität (O00.9)
34.56.1 Definition
34.56.2 Epidemiologie
34.56.3 Ätiologie
34.56.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.56.5 Differenzialdiagnostik
34.56.6 Therapie
34.56.7 Leitlinie
34.57 Fazialisparese (idiopathische Form) (G51.0)
34.57.1 Definition
34.57.2 Epidemiologie
34.57.3 Ätiologie
34.57.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.57.5 Differenzialdiagnostik
34.57.6 Therapie
34.57.7 Leitlinie
34.58 Fersensporn (M77.3)
34.58.1 Definition
34.58.2 Epidemiologie
34.58.3 Ätiologie
34.58.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.58.5 Therapie
34.59 Fettleber (K76.0)
34.59.1 Definition
34.59.2 Epidemiologie
34.59.3 Ätiologie
34.59.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.59.5 Therapie
34.59.6 Leitlinie
34.60 Fibromatose (M72.99)
34.60.1 Definition
34.60.2 Epidemiologie
34.60.3 Ätiologie
34.60.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.60.5 Therapie
34.60.6 Leitlinie
34.61 Fibromyalgiesyndrom (M79.70)
34.61.1 Definition
34.61.2 Epidemiologie
34.61.3 Ätiologie
34.61.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.61.5 Differenzialdiagnostik
34.61.6 Therapie
34.61.7 Leitlinien und Links
34.62 Fieberkrampf (R56.0)
34.62.1 Definition
34.62.2 Epidemiologie
34.62.3 Ätiologie
34.62.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.62.5 Differenzialdiagnostik
34.62.6 Therapie
34.62.7 Leitlinien
34.63 Frakturen
34.63.1 Definition
34.63.2 Epidemiologie
34.63.3 Ätiologie
34.63.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.63.5 Therapie
34.63.6 Leitlinien
34.64 Frühsommermeningoenzephalitis (A84.–)
34.64.1 Definition
34.64.2 Epidemiologie
34.64.3 Ätiologie
34.64.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.64.5 Differenzialdiagnostik
34.64.6 Therapie
34.64.7 Leitlinien
34.65 Funktionelle Störungen (F45.–)
34.65.1 Definition
34.65.2 Epidemiologie
34.65.3 Ätiologie
34.65.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.65.5 Differenzialdiagnostik
34.65.6 Therapie
34.65.7 Leitlinie
34.66 Gangrän/Nekrose (I73.–)
34.66.1 Definition
34.66.2 Epidemiologie
34.66.3 Ätiologie
34.66.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.66.5 Therapie
34.66.6 Leitlinie
34.67 Gastritis (K29.7)
34.67.1 Definition
34.67.2 Ätiologie
34.67.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.67.4 Differenzialdiagnostik
34.67.5 Therapie
34.67.6 Leitlinie
34.68 Gastroenteritis (K52.9)
34.68.1 Definition
34.68.2 Epidemiologie
34.68.3 Ätiologie
34.68.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.68.5 Differenzialdiagnostik
34.68.6 Therapie
34.68.7 Leitlinien
34.69 Morbus Gilbert-Meulengracht (E80.4)
34.69.1 Definition
34.69.2 Epidemiologie
34.69.3 Ätiologie
34.69.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.69.5 Differenzialdiagnostik
34.69.6 Therapie
34.70 Glaukom (H40.–)
34.70.1 Definition
34.70.2 Epidemiologie
34.70.3 Ätiologie
34.70.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.70.5 Differenzialdiagnostik
34.70.6 Therapie
34.70.7 Leitlinien
34.71 Grippaler Infekt (J06.9)
34.71.1 Definition
34.71.2 Epidemiologie
34.71.3 Ätiologie
34.71.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.71.5 Differenzialdiagnostik
34.71.6 Therapie
34.71.7 Leitlinien
34.72 Hallux valgus (M20.1)
34.72.1 Definition
34.72.2 Epidemiologie
34.72.3 Ätiologie
34.72.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.72.5 Therapie
34.72.6 Leitlinie
34.73 Halswirbelsäulenschleudertrauma (S13.4)
34.73.1 Definition
34.73.2 Epidemiologie
34.73.3 Ätiologie
34.73.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.73.5 Therapie
34.73.6 Leitlinie
34.74 Hämorrhoiden
34.74.1 Definition
34.74.2 Epidemiologie
34.74.3 Ätiologie
34.74.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.74.5 Differenzialdiagnostik
34.74.6 Therapie
34.74.7 Leitlinie
34.75 Harnwegsinfekt (N30, N34)
34.75.1 Definition
34.75.2 Epidemiologie
34.75.3 Ätiologie
34.75.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.75.5 Differenzialdiagnostik
34.75.6 Therapie
34.75.7 Leitlinien
34.76 Hautwunden/kleine Chirurgie (T14.00)
34.76.1 Definition
34.76.2 Epidemiologie
34.76.3 Ätiologie
34.76.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.76.5 Therapie
34.76.6 Leitlinien
34.77 Hepatitis (B15.– bis B19.–)
34.77.1 Grundlagen
34.77.2 Hepatitis A (B15.–)
34.77.3 Hepatitis B (B16.–)
34.77.4 Hepatitis C (B17.1)
34.77.5 Hepatitis D (B17.0)
34.77.6 Hepatitis E (B17.2)
34.77.7 Akute Hepatitisformen anderer Genese
34.77.8 Leitlinien
34.78 Herpes simplex (B00.9)
34.78.1 Definition
34.78.2 Epidemiologie
34.78.3 Ätiologie
34.78.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.78.5 Differenzialdiagnostik
34.78.6 Therapie
34.79 Herzinfarkt (I21.9) / Akutes Koronarsyndrom (ACS)
34.79.1 Definition
34.79.2 Epidemiologie
34.79.3 Ätiologie (Definition/Einteilung)
34.79.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.79.5 Differenzialdiagnostik
34.79.6 Therapie
34.79.7 Leitlinien
34.80 Herzinsuffizienz (I50.9)
34.80.1 Definition
34.80.2 Epidemiologie
34.80.3 Ätiologie
34.80.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.80.5 Differenzialdiagnostik
34.80.6 Therapie
34.80.7 Leitlinien
34.81 Herzrhythmusstörungen (I49.9)
34.81.1 Definition
34.81.2 Epidemiologie
34.81.3 Ätiologie
34.81.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.81.5 Differenzialdiagnostik
34.81.6 Therapie
34.81.7 Leitlinien
34.82 Hiatushernie (K44.9)
34.82.1 Definition
34.82.2 Epidemiologie
34.82.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.82.4 Differenzialdiagnostik
34.82.5 Therapie
34.82.6 Leitlinie
34.83 Hodentumoren (C62.–)
34.83.1 Definition
34.83.2 Epidemiologie
34.83.3 Ätiologie
34.83.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.83.5 Differenzialdiagnostik
34.83.6 Therapie
34.83.7 Leitlinien
34.84 Hörsturz (H91.2)
34.84.1 Definition
34.84.2 Epidemiologie
34.84.3 Ätiologie
34.84.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.84.5 Differenzialdiagnostik
34.84.6 Therapie
34.84.7 Leitlinie
34.85 Hordeolum (H00.0)
34.85.1 Definition
34.85.2 Ätiologie
34.85.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.85.4 Differenzialdiagnostik
34.85.5 Therapie
34.86 Hydrocele testis (N43.–)
34.86.1 Definition
34.86.2 Epidemiologie
34.86.3 Ätiologie
34.86.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.86.5 Differenzialdiagnostik
34.86.6 Therapie
34.86.7 Leitlinie
34.87 Hyperlipidämie (E78.9)
34.87.1 Definition
34.87.2 Epidemiologie
34.87.3 Ätiologie
34.87.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.87.5 Therapie
34.87.6 Leitlinien
34.88 Hyperthyreose (E05.9)
34.88.1 Definition
34.88.2 Epidemiologie
34.88.3 Ätiologie
34.88.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.88.5 Differenzialdiagnostik
34.88.6 Therapie
34.88.7 Leitlinien
34.89 Hypertonie (I10.–)
34.89.1 Definition
34.89.2 Epidemiologie
34.89.3 Ätiologie
34.89.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.89.5 Therapie
34.89.6 Leitlinien
34.90 Hyperurikämie (E79.0) und Gicht (M10.–)
34.90.1 Definition
34.90.2 Epidemiologie
34.90.3 Ätiologie
34.90.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.90.5 Differenzialdiagnostik
34.90.6 Therapie
34.90.7 Leitlinien
34.91 Hyposphagma (H11.3)
34.91.1 Definition
34.91.2 Epidemiologie
34.91.3 Ätiologie
34.91.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.91.5 Differenzialdiagnostik
34.91.6 Therapie
34.92 Hypothyreose (E03.9)
34.92.1 Definition
34.92.2 Epidemiologie
34.92.3 Ätiologie
34.92.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.92.5 Differenzialdiagnostik
34.92.6 Therapie
34.92.7 Leitlinien
34.93 Hypotonie und Kreislaufdysregulation (I95.9/I95.1)
34.93.1 Definition
34.93.2 Epidemiologie
34.93.3 Ätiologie
34.93.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.93.5 Differenzialdiagnostik
34.93.6 Therapie
34.93.7 Leitlinien
34.94 Induratio penis plastica (N48.6)
34.94.1 Definition
34.94.2 Epidemiologie
34.94.3 Ätiologie
34.94.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.94.5 Differenzialdiagnostik
34.94.6 Therapie
34.95 Influenza (Virusgrippe) (J11.1)
34.95.1 Definition
34.95.2 Epidemiologie
34.95.3 Ätiologie
34.95.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.95.5 Differenzialdiagnostik
34.95.6 Therapie
34.95.7 Leitlinien
34.96 Impetigo contagiosa (L01.0)
34.96.1 Definition
34.96.2 Epidemiologie
34.96.3 Ätiologie
34.96.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.96.5 Differenzialdiagnostik
34.96.6 Therapie
34.97 Interstitielle Lungenerkrankungen (J84.-)
34.97.1 Definition
34.97.2 Epidemiologie
34.97.3 Ätiologie
34.97.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.97.5 Differenzialdiagnostik
34.97.6 Therapie
34.97.7 Leitlinien und Links
34.98 Karotisstenose (I65.–)
34.98.1 Definition
34.98.2 Epidemiologie
34.98.3 Ätiologie
34.98.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.98.5 Therapie
34.98.6 Leitlinien
34.99 Karpaltunnelsyndrom (G56.0)
34.99.1 Definition
34.99.2 Epidemiologie
34.99.3 Ätiologie
34.99.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.99.5 Differenzialdiagnostik
34.99.6 Therapie
34.99.7 Leitlinie
34.100 Keuchhusten (A37.9)
34.100.1 Definition
34.100.2 Epidemiologie
34.100.3 Ätiologie
34.100.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.100.5 Differenzialdiagnostik
34.100.6 Therapie
34.100.7 Leitlinien
34.101 Klavus (L84)
34.101.1 Definition
34.101.2 Epidemiologie
34.101.3 Ätiologie
34.101.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.101.5 Differenzialdiagnostik
34.101.6 Therapie
34.101.7 Leitlinie
34.102 Knick-Senk-Spreizfuß (Q66.4–Q66.8)
34.102.1 Definition
34.102.2 Epidemiologie
34.102.3 Ätiologie
34.102.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.102.5 Differenzialdiagnostik
34.102.6 Therapie
34.102.7 Leitlinie
34.103 Kolitis
34.103.1 Definition
34.103.2 Epidemiologie
34.103.3 Ätiologie
34.103.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.103.5 Differenzialdiagnostik
34.103.6 Therapie
34.103.7 Leitlinien
34.104 Kolorektales Karzinom (C18-C20)
34.104.1 Definition
34.104.2 Epidemiologie
34.104.3 Ätiologie
34.104.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.104.5 Differenzialdiagnostik
34.104.6 Therapie
34.104.7 Leitlinie
34.105 Kolonpolypen
34.105.1 Definition
34.105.2 Epidemiologie
34.105.3 Ätiologie
34.105.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.105.5 Differenzialdiagnostik
34.105.6 Therapie
34.105.7 Leitlinie
34.106 Konjunktivitis (H10.9)
34.106.1 Definition
34.106.2 Epidemiologie
34.106.3 Ätiologie
34.106.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.106.5 Differenzialdiagnostik
34.106.6 Therapie
34.106.7 Leitlinie
34.107 Koronare Herzkrankheit (I25.9)
34.107.1 Definition
34.107.2 Epidemiologie
34.107.3 Ätiologie
34.107.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.107.5 Differenzialdiagnostik
34.107.6 Therapie
34.107.7 Leitlinien und Links
34.108 Kostovertebrales Schmerzsyndrom (M79.18, M99.82, G58.0)
34.108.1 Definition
34.108.2 Ätiologie
34.108.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.108.4 Differenzialdiagnostik
34.108.5 Therapie
34.109 Laktoseintoleranz (E73.9)
34.109.1 Definition
34.109.2 Epidemiologie
34.109.3 Ätiologie
34.109.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.109.5 Differenzialdiagnostik
34.109.6 Therapie
34.110 Leberzirrhose (K74.–)
34.110.1 Definition
34.110.2 Epidemiologie
34.110.3 Ätiologie
34.110.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.110.5 Differenzialdiagnostik
34.110.6 Therapie
34.110.7 Leitlinien
34.111 Leukämie (C95.90)
34.111.1 Definition
34.111.2 Epidemiologie
34.111.3 Ätiologie
34.111.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.111.5 Therapie
34.111.6 Leitlinien
34.112 Lipom (D17.9)
34.112.1 Definition
34.112.2 Epidemiologie
34.112.3 Ätiologie
34.112.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.112.5 Differenzialdiagnostik
34.112.6 Therapie
34.113 Lungenembolie (I26.9)
34.113.1 Definition
34.113.2 Epidemiologie
34.113.3 Ätiologie
34.113.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.113.5 Differenzialdiagnostik
34.113.6 Therapie
34.113.7 Leitlinien
34.114 Lungenemphysem (J43.9)
34.114.1 Definition
34.114.2 Epidemiologie
34.114.3 Ätiologie
34.114.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.114.5 Differenzialdiagnostik
34.114.6 Therapie
34.114.7 Leitlinien
34.115 Lymphangitis (I89.1)
34.115.1 Definition
34.115.2 Ätiologie
34.115.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.115.4 Differenzialdiagnostik
34.115.5 Therapie
34.115.6 Leitlinien
34.116 Lymphogranulomatose (Morbus Hodgkin) (C81.9)
34.116.1 Einleitung
34.116.2 Definition
34.116.3 Epidemiologie
34.116.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.116.5 Differenzialdiagnose
34.116.6 Therapie
34.116.7 Prognose
34.116.8 Leitlinie
34.117 Magenkarzinom (C16.–)
34.117.1 Epidemiologie
34.117.2 Ätiologie
34.117.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.117.4 Differenzialdiagnostik
34.117.5 Therapie
34.117.6 Leitlinie
34.118 Makuladegeneration (H35.38)
34.118.1 Definition
34.118.2 Epidemiologie
34.118.3 Ätiologie
34.118.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.118.5 Differenzialdiagnostik
34.118.6 Therapie
34.118.7 Leitlinien
34.119 Malaria (B54)
34.119.1 Definition
34.119.2 Epidemiologie
34.119.3 Ätiologie
34.119.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.119.5 Differenzialdiagnostik
34.119.6 Therapie
34.119.7 Leitlinien
34.120 Malignes Melanom (C43.9)
34.120.1 Definition
34.120.2 Epidemiologie
34.120.3 Ätiologie
34.120.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.120.5 Differenzialdiagnostik
34.120.6 Therapie
34.120.7 Leitlinien
34.121 Mammakarzinom (C50.9)
34.121.1 Definition
34.121.2 Epidemiologie
34.121.3 Ätiologie
34.121.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.121.5 Differenzialdiagnostik
34.121.6 Therapie
34.121.7 Leitlinie
34.122 Masern (B05.9)
34.122.1 Definition
34.122.2 Epidemiologie
34.122.3 Ätiologie
34.122.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.122.5 Differenzialdiagnostik
34.122.6 Therapie
34.122.7 Leitlinien
34.123 Mastitis (N61)
34.123.1 Definition
34.123.2 Epidemiologie
34.123.3 Ätiologie
34.123.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.123.5 Differenzialdiagnostik
34.123.6 Therapie
34.123.7 Leitlinie
34.124 Mastopathie (N64.9)
34.124.1 Definition
34.124.2 Epidemiologie
34.124.3 Ätiologie
34.124.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.124.5 Differenzialdiagnostik
34.124.6 Therapie
34.124.7 Leitlinie
34.125 Menière-Erkrankung (H81.0)
34.125.1 Definition
34.125.2 Epidemiologie
34.125.3 Ätiologie
34.125.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.125.5 Differenzialdiagnostik
34.125.6 Therapie
34.125.7 Leitlinien
34.126 Meningitis (G03.9)
34.126.1 Definition
34.126.2 Epidemiologie
34.126.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.126.4 Differenzialdiagnostik
34.126.5 Therapie
34.126.6 Leitlinie
34.127 Meniskopathien (M23.39)
34.127.1 Definition
34.127.2 Epidemiologie
34.127.3 Ätiologie
34.127.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.127.5 Differenzialdiagnostik
34.127.6 Therapie
34.127.7 Leitlinien
34.128 Migräne (G43.9)
34.128.1 Definition
34.128.2 Epidemiologie
34.128.3 Ätiologie
34.128.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.128.5 Differenzialdiagnostik
34.128.6 Therapie
34.128.7 Leitlinien und Links
34.129 Mononucleosis infectiosa (B27.9)
34.129.1 Definition
34.129.2 Epidemiologie
34.129.3 Ätiologie
34.129.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.129.5 Differenzialdiagnostik
34.129.6 Therapie
34.129.7 Leitlinie
34.130 Multiple Sklerose (G35.–)
34.130.1 Definition
34.130.2 Epidemiologie
34.130.3 Ätiologie
34.130.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.130.5 Differenzialdiagnostik
34.130.6 Therapie
34.130.7 Leitlinien
34.131 Mykosen (B36.9)
34.131.1 Definition
34.131.2 Epidemiologie
34.131.3 Ätiologie
34.131.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.131.5 Differenzialdiagnostik
34.131.6 Therapie
34.131.7 Leitlinien
34.132 Myokarditis (I40.9)
34.132.1 Definition
34.132.2 Epidemiologie
34.132.3 Ätiologie
34.132.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.132.5 Differenzialdiagnostik
34.132.6 Therapie
34.132.7 Leitlinien
34.133 Nephrolithiasis (N20.0)
34.133.1 Definition
34.133.2 Epidemiologie
34.133.3 Ätiologie
34.133.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.133.5 Differenzialdiagnostik
34.133.6 Therapie
34.133.7 Leitlinien
34.134 Neurodermitis (L28.0)
34.134.1 Definition
34.134.2 Epidemiologie
34.134.3 Ätiologie
34.134.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.134.5 Differenzialdiagnostik
34.134.6 Therapie
34.134.7 Leitlinien
34.135 Niereninsuffizienz (N18.–)
34.135.1 Chronische Niereninsuffizienz (N18.9)
34.135.2 Akutes Nierenversagen (N17.9)
34.135.3 Leitlinien
34.136 Nierentumoren (C64, C65)
34.136.1 Definition
34.136.2 Epidemiologie
34.136.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.136.4 Differenzialdiagnostik
34.136.5 Therapie
34.136.6 Leitlinien
34.137 Orchitis (N45.–)
34.137.1 Definition
34.137.2 Epidemiologie
34.137.3 Ätiologie
34.137.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.137.5 Differenzialdiagnostik
34.137.6 Therapie
34.137.7 Leitlinie
34.138 Osgood-Schlatter-Erkrankung (M92.5)
34.138.1 Definition
34.138.2 Epidemiologie
34.138.3 Ätiologie
34.138.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.138.5 Therapie
34.138.6 Leitlinien
34.139 Osteoporose (M81.99)
34.139.1 Definition
34.139.2 Epidemiologie
34.139.3 Ätiologie
34.139.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.139.5 Therapie
34.139.6 Leitlinien
34.140 Otitis externa (H60.9)
34.140.1 Definition
34.140.2 Epidemiologie
34.140.3 Ätiologie
34.140.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.140.5 Therapie
34.140.6 Leitlinie
34.141 Otitis media (H66.9)
34.141.1 Definition
34.141.2 Epidemiologie
34.141.3 Ätiologie
34.141.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.141.5 Therapie
34.141.6 Leitlinien
34.142 Panaritium (L03.02)
34.142.1 Definition
34.142.2 Epidemiologie
34.142.3 Ätiologie
34.142.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.142.5 Differenzialdiagnostik
34.142.6 Therapie
34.143 Pankreaskarzinom (C25.–)
34.143.1 Definition
34.143.2 Epidemiologie
34.143.3 Ätiologie
34.143.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.143.5 Differenzialdiagnostik
34.143.6 Therapie
34.143.7 Leitlinien
34.144 Pankreatitis (K85.–)
34.144.1 Definition
34.144.2 Epidemiologie
34.144.3 Ätiologie
34.144.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.144.5 Differenzialdiagnostik
34.144.6 Therapie
34.144.7 Leitlinien
34.145 Parkinson-Syndrom (G20.90)
34.145.1 Definition
34.145.2 Epidemiologie
34.145.3 Ätiologie
34.145.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.145.5 Differenzialdiagnostik
34.145.6 Therapie
34.145.7 Leitlinien
34.146 Parotitis epidemica (Mumps) (B26.9)
34.146.1 Definition
34.146.2 Epidemiologie
34.146.3 Ätiologie
34.146.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.146.5 Differenzialdiagnostik
34.146.6 Therapie
34.147 Pedikulose (B85.2)
34.147.1 Definition
34.147.2 Epidemiologie
34.147.3 Ätiologie
34.147.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.147.5 Differenzialdiagnostik
34.147.6 Therapie
34.147.7 Links
34.148 Perianalthrombose
34.148.1 Definition
34.148.2 Epidemiologie
34.148.3 Ätiologie
34.148.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.148.5 Differenzialdiagnostik
34.148.6 Therapie
34.148.7 Leitlinie
34.149 Periarthropathia humeroscapularis (M75.0)
34.149.1 Definition
34.149.2 Epidemiologie
34.149.3 Ätiologie
34.149.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.149.5 Differenzialdiagnostik
34.149.6 Therapie
34.149.7 Leitlinien
34.150 Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) (I70.2)
34.150.1 Definition
34.150.2 Epidemiologie
34.150.3 Ätiologie
34.150.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.150.5 Differenzialdiagnostik
34.150.6 Therapie
34.150.7 Leitlinie
34.151 Pharyngitis (J02.9)
34.151.1 Definition
34.151.2 Epidemiologie
34.151.3 Ätiologie
34.151.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.151.5 Differenzialdiagnostik
34.151.6 Therapie
34.151.7 Leitlinie
34.152 Phimose (N47)
34.152.1 Definition
34.152.2 Epidemiologie
34.152.3 Ätiologie
34.152.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.152.5 Therapie
34.152.6 Leitlinie
34.153 Phlebothrombose (I80.1)
34.153.1 Definition
34.153.2 Epidemiologie
34.153.3 Ätiologie
34.153.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.153.5 Differenzialdiagnostik
34.153.6 Therapie
34.153.7 Leitlinie
34.154 Pityriasis versicolor (B36.0)
34.154.1 Definition
34.154.2 Epidemiologie
34.154.3 Ätiologie
34.154.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.154.5 Differenzialdiagnostik
34.154.6 Therapie
34.155 Plasmozytom (C90.30)
34.155.1 Definition
34.155.2 Epidemiologie
34.155.3 Ätiologie
34.155.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.155.5 Differenzialdiagnostik
34.155.6 Therapie
34.155.7 Leitlinie
34.156 Pneumonie (J18.9)
34.156.1 Definition
34.156.2 Epidemiologie
34.156.3 Ätiologie
34.156.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.156.5 Differenzialdiagnostik
34.156.6 Therapie
34.156.7 Leitlinien
34.157 Pollinosis/Pollenallergie (J30.1)
34.157.1 Definition
34.157.2 Epidemiologie
34.157.3 Ätiologie
34.157.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.157.5 Differenzialdiagnostik
34.157.6 Therapie
34.157.7 Leitlinien
34.158 Polymyalgia rheumatica (M31.5)
34.158.1 Definition
34.158.2 Epidemiologie
34.158.3 Ätiologie
34.158.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.158.5 Differenzialdiagnostik
34.158.6 Therapie
34.158.7 Leitlinien
34.159 Polyneuropathie (G63.–)
34.159.1 Definition
34.159.2 Einteilung/Manifestationstypen
34.159.3 Ätiologie
34.159.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.159.5 Therapie
34.159.6 Leitlinien
34.160 Prostataadenom (D29.1) – Benigne Prostatahyperplasie (N40)
34.160.1 Definition
34.160.2 Epidemiologie
34.160.3 Ätiologie
34.160.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.160.5 Differenzialdiagnostik
34.160.6 Therapie
34.160.7 Leitlinien
34.161 Prostatakarzinom (C61)
34.161.1 Epidemiologie
34.161.2 Ätiologie
34.161.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.161.4 Differenzialdiagnostik
34.161.5 Therapie
34.161.6 Leitlinien
34.162 Prostatitis (N41.-)
34.162.1 Definition
34.162.2 Epidemiologie
34.162.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.162.4 Differenzialdiagnostik
34.162.5 Therapie
34.162.6 Leitlinien
34.163 Postthrombotisches Syndrom (I87.0–)
34.163.1 Definition
34.163.2 Epidemiologie
34.163.3 Ätiologie
34.163.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.163.5 Differenzialdiagnostik
34.163.6 Therapie
34.163.7 Leitlinien
34.164 Psoriasis (L40)
34.164.1 Definition
34.164.2 Epidemiologie
34.164.3 Ätiologie
34.164.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.164.5 Differenzialdiagnostik
34.164.6 Therapie
34.164.7 Leitlinien
34.165 Purpura (B69.2)
34.165.1 Definition
34.165.2 Epidemiologie
34.165.3 Ätiologie
34.165.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.165.5 Therapie
34.165.6 Leitlinien
34.166 Raynaud-Syndrom
34.166.1 34.166.1 Definition
34.166.2 Epidemiologie
34.166.3 Ätiologie
34.166.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.166.5 Differenzialdiagnostik
34.166.6 Therapie
34.166.7 Leitlinien
34.167 Reaktiver Verstimmungszustand (F34.1)
34.167.1 Definition
34.167.2 Epidemiologie
34.167.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.167.4 Differenzialdiagnostik
34.167.5 Therapie
34.167.6 Leitlinien
34.168 Refluxösophagitis (K21.0)
34.168.1 Definition
34.168.2 Epidemiologie
34.168.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.168.4 Differenzialdiagnostik
34.168.5 Therapie
34.168.6 Leitlinie
34.169 Reizdarmsyndrom (K58.-)
34.169.1 Definition
34.169.2 Epidemiologie
34.169.3 Ätiologie
34.169.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.169.5 Differenzialdiagnostik
34.169.6 Therapie
34.169.7 Leitlinie
34.170 Rheumatoide Arthritis (M08.–)
34.170.1 Definition
34.170.2 Epidemiologie
34.170.3 Ätiologie
34.170.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.170.5 Differenzialdiagnostik
34.170.6 Therapie
34.170.7 Leitlinien
34.171 Ringelröteln (B08.3)
34.171.1 Definition
34.171.2 Epidemiologie
34.171.3 Ätiologie
34.171.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.171.5 Differenzialdiagnostik
34.171.6 Therapie
34.171.7 Leitlinien
34.172 Röteln (B06.9)
34.172.1 Definition
34.172.2 Epidemiologie
34.172.3 Ätiologie
34.172.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.172.5 Differenzialdiagnostik
34.172.6 Therapie
34.172.7 Leitlinien
34.173 Rückenschmerz Teil 2
34.173.1 Therapie
34.173.2 Leitlinien
34.174 Salmonellen/Salmonellose (A02.9)
34.174.1 Definition
34.174.2 Epidemiologie
34.174.3 Ätiologie
34.174.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.174.5 Differenzialdiagnostik
34.174.6 Therapie
34.174.7 Leitlinien
34.175 Scabies (B86)
34.175.1 Definition
34.175.2 Epidemiologie
34.175.3 Ätiologie
34.175.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.175.5 Differenzialdiagnostik
34.175.6 Therapie
34.175.7 Leitlinien und links
34.176 Scharlach (A38)
34.176.1 Definition
34.176.2 Epidemiologie
34.176.3 Ätiologie
34.176.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.176.5 Differenzialdiagnostik
34.176.6 Therapie
34.176.7 Leitlinie
34.177 Schizophrenie (F20.9)
34.177.1 Definition
34.177.2 Epidemiologie
34.177.3 Ätiologie
34.177.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.177.5 Differenzialdiagnostik
34.177.6 Therapie und Prognose
34.177.7 Leitlinie
34.178 Schlafapnoe-Syndrom (G47.39)
34.178.1 Definition
34.178.2 Epidemiologie
34.178.3 Ätiologie
34.178.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.178.5 Differenzialdiagnostik
34.178.6 Therapie
34.178.7 Leitlinien und Links
34.179 Sepsis/SIRS
34.179.1 Definition
34.179.2 Epidemiologie
34.179.3 Ätiologie
34.179.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.179.5 Differenzialdiagnostik
34.179.6 Therapie
34.179.7 Leitlinie
34.180 Sexuell übertragbare Krankheiten (B)
34.180.1 Definition
34.180.2 Epidemiologie und Ätiologie
34.180.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.180.4 Differenzialdiagnostik
34.180.5 Therapie
34.180.6 Leitlinien
34.181 Somatoforme Störungen (F45.0–9)
34.181.1 Definition
34.181.2 Leitsymptome, Diagnostik und Epidemiologie
34.181.3 Ätiologie und Behandlungsrationale
34.181.4 Leitlinie
34.182 Sinusitis (J32.9)
34.182.1 Definition
34.182.2 Epidemiologie
34.182.3 Ätiologie
34.182.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.182.5 Therapie
34.182.6 Leitlinien
34.183 Sprue (K90.1)
34.183.1 Definition
34.183.2 Epidemiologie
34.183.3 Ätiologie
34.183.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.183.5 Differenzialdiagnostik
34.183.6 Therapie
34.183.7 Leitlinie
34.184 Struma (E01.–, E04.9)
34.184.1 Definition
34.184.2 Epidemiologie
34.184.3 Ätiologie
34.184.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.184.5 Differenzialdiagnostik
34.184.6 Therapie
34.184.7 Leitlinie
34.185 Sudeck-Dystrophie (CRPS) (M89.09)
34.185.1 Definition und Epidemiologie
34.185.2 Ätiologie
34.185.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.185.4 Differenzialdiagnostik
34.185.5 Therapie
34.185.6 Leitlinie
34.186 Tendovaginitis (M65.99)
34.186.1 Definition
34.186.2 Epidemiologie
34.186.3 Ätiologie
34.186.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.186.5 Differenzialdiagnostik
34.186.6 Therapie
34.186.7 Leitlinie
34.187 Thrombophilie (D68.–)
34.187.1 Definition
34.187.2 Epidemiologie und Ätiologie
34.187.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.188 Thrombophlebitis (I80.–)
34.188.1 Definition
34.188.2 Epidemiologie
34.188.3 Ätiologie
34.188.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.188.5 Therapie
34.188.6 Leitlinien
34.189 Thyreoiditis (E06.–)
34.189.1 Definition
34.189.2 Epidemiologie
34.189.3 Ätiologie
34.189.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.189.5 Differenzialdiagnostik
34.189.6 Therapie
34.189.7 Leitlinie
34.190 Tietze-Syndrom (M94.0)
34.190.1 Definition
34.190.2 Epidemiologie
34.190.3 Ätiologie
34.190.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.190.5 Differenzialdiagnostik
34.190.6 Therapie
34.190.7 Leitlinie
34.191 Tonsillitis, Pharyngitis, Tonsillopharyngitis (J03.–; J35; J06.9)
34.191.1 Definition
34.191.2 Epidemiologie
34.191.3 Ätiologie
34.191.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.191.5 Differenzialdiagnostik
34.191.6 Therapie
34.191.7 Leitlinien
34.192 Toxoplasmose (B58.9)
34.192.1 Definition
34.192.2 Epidemiologie
34.192.3 Ätiologie
34.192.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.192.5 Differenzialdiagnostik
34.192.6 Therapie
34.193 Transitorische ischämische Attacke (TIA) (G45.–)
34.193.1 Definition
34.193.2 Epidemiologie
34.193.3 Ätiologie
34.193.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.193.5 Differenzialdiagnostik
34.193.6 Therapie
34.193.7 Leitlinien
34.194 Trigeminusneuralgie (G50.0)
34.194.1 Definition
34.194.2 Ätiologie
34.194.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.194.4 Differenzialdiagnostik
34.194.5 Therapie
34.194.6 Leitlinie
34.195 Tubenkatarrh (H68.0)
34.195.1 Definition
34.195.2 Epidemiologie
34.195.3 Ätiologie
34.195.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.195.5 Therapie
34.195.6 Leitlinien
34.196 Tuberkulose (A16.9)
34.196.1 Definition
34.196.2 Epidemiologie
34.196.3 Ätiologie
34.196.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.196.5 Differenzialdiagnostik
34.196.6 Therapie
34.196.7 Leitlinie
34.197 Ulcus cruris venosum (I83.0)
34.197.1 Definition
34.197.2 Epidemiologie
34.197.3 Ätiologie
34.197.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.197.5 Differenzialdiagnostik
34.197.6 Therapie
34.197.7 Leitlinien
34.198 Ulcus duodeni (K26.–)
34.198.1 Definition
34.198.2 Epidemiologie
34.198.3 Ätiologie
34.198.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.198.5 Differenzialdiagnostik
34.198.6 Therapie
34.198.7 Leitlinie
34.199 Ulcus ventriculi (K25.–)
34.199.1 Definition
34.199.2 Epidemiologie
34.199.3 Ätiologie
34.199.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.199.5 Differenzialdiagnostik
34.199.6 Therapie
34.199.7 Leitlinie
34.200 Unguis incarnatus (L60.0)
34.200.1 Definition
34.200.2 Epidemiologie
34.200.3 Ätiologie
34.200.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.200.5 Therapie
34.200.6 Leitlinie
34.201 Urtikaria (L50.9)
34.201.1 Definition
34.201.2 Epidemiologie
34.201.3 Ätiologie
34.201.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.201.5 Differenzialdiagnostik
34.201.6 Therapie
34.201.7 Leitlinien
34.202 Uterus myomatosus (D25.9)
34.202.1 Definition
34.202.2 Epidemiologie
34.202.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.202.4 Differenzialdiagnostik
34.202.5 Therapie
34.202.6 Leitlinien
34.203 Varikose (I83.–)
34.203.1 Definition
34.203.2 Epidemiologie
34.203.3 Ätiologie
34.203.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.203.5 Therapie
34.203.6 Leitlinien
34.204 Verbrennungen und Verbrühungen (T30)
34.204.1 Definition
34.204.2 Epidemiologie
34.204.3 Leitsymptome und Diagnostik
34.204.4 Differenzialdiagnostik
34.204.5 Therapie
34.204.6 Leitlinien
34.205 Verrucae (B07)
34.205.1 Definition
34.205.2 Epidemiologie
34.205.3 Ätiologie
34.205.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.205.5 Differenzialdiagnostik
34.205.6 Therapie
34.205.7 Leitlinien
34.206 Windeldermatitis (L22)
34.206.1 Definition
34.206.2 Epidemiologie
34.206.3 Ätiologie
34.206.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.206.5 Differenzialdiagnostik
34.206.6 Therapie
34.207 Windpocken (B01.9)
34.207.1 Definition
34.207.2 Epidemiologie
34.207.3 Ätiologie
34.207.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.207.5 Differenzialdiagnostik
34.207.6 Therapie
34.207.7 Leitlinien
34.208 Wurmbefall (B83.9)
34.208.1 Definition
34.208.2 Epidemiologie
34.208.3 Ätiologie
34.208.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.208.5 Therapie
34.208.6 Leitlinien
34.209 Zerumen (H61.2)
34.209.1 Definition
34.209.2 Epidemiologie
34.209.3 Ätiologie
34.209.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.209.5 Therapie
34.209.6 Leitlinien
34.210 Zervikalsyndrom (M54.2)
34.210.1 Definition
34.210.2 Ätiologie
34.210.3 Epidemiologie
34.210.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.210.5 Differenzialdiagnostik
34.210.6 Therapie
34.210.7 Leitlinien
34.211 Zoster (B02.9)
34.211.1 Definition
34.211.2 Epidemiologie
34.211.3 Ätiologie
34.211.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.211.5 Differenzialdiagnostik
34.211.6 Therapie
34.211.7 Leitlinien
34.212 Zytomegalie (B25.9)
34.212.1 Definition
34.212.2 Epidemiologie
34.212.3 Ätiologie
34.212.4 Leitsymptome und Diagnostik
34.212.5 Differenzialdiagnostik
34.212.6 Therapie
34.212.7 Leitlinien
34.213 Literatur
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code





























