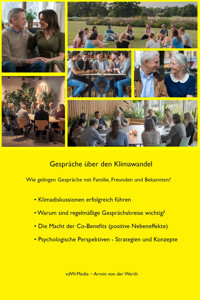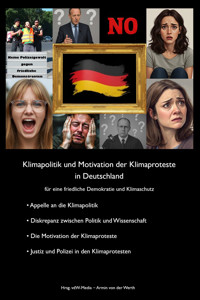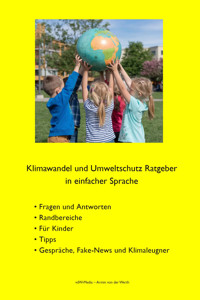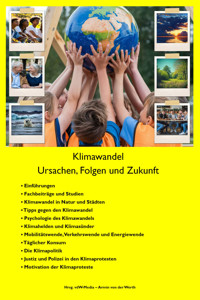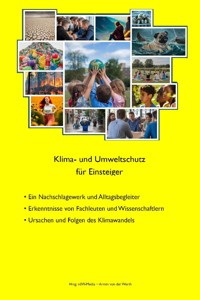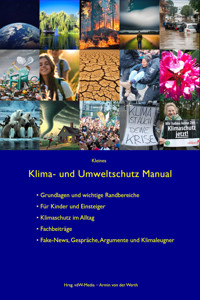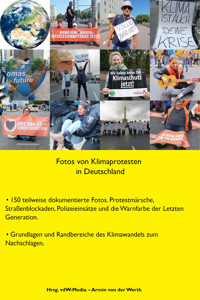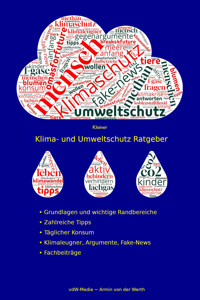2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vdW-Media ~ Armin von der Werth
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der Klimawandel ist längst kein fernes Zukunftsszenario mehr, er betrifft uns alle, hier und heute. Doch wie können wir im Alltag mit diesem komplexen Thema umgehen? Wie lassen sich Fakten von Fake-News unterscheiden, wie gelingen Gespräche mit Familie, Freunden und Bekannten, und warum ist Gemeinsamkeit beim Umweltschutz so entscheidend? Das Buch bietet Antworten auf genau diese Fragen. Es verbindet wissenschaftlich fundierte Informationen mit praktischen Tipps für den Alltag und richtet sich an alle, die sich aktiv für eine nachhaltige Zukunft einsetzen wollen, egal, ob sie gerade erst beginnen oder bereits engagiert sind. • Häufige Fragen – verständlich beantwortet • Randbereiche des Klimawandels – kurz und kompakt erklärt • Warum Gemeinsamkeit entscheidend ist • Argumentieren gegen Klima- und Umweltschutz-Gegner • Gespräche im persönlichen Umfeld – Familie, Freunde, Bekannte • Gesprächskreise – gemeinsam stärker • Klimaleugner und Fake-News erkennen Dieses Buch ist mehr als ein Ratgeber, es ist ein Mutmacher. Er zeigt, dass jeder Einzelne etwas bewirken kann, dass Wissen vor Desinformation schützt und dass Gemeinschaft der Schlüssel zum Erfolg ist. Ob Einsteiger oder Fortgeschrittener: Dieses Buch vermittelt, was wirklich zählt, nicht nur Fakten über den Klimawandel, sondern vor allem Wege, wie wir im Alltag handlungsfähig bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
© Herausgeber:
vdW-Media Redaktion und Webentwicklung
Armin von der Werth, Berlin
Kontakt: [email protected]
Erste Auflage November 2024
ISBN: 978-3-759-26733-7
Umschlaggestaltung © vdW-Media
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt
Herausgeber vdW-Media Redaktion ~ Armin von der Werth
Armin von der Werth, Jahrgang 1959, lebt in Berlin und arbeitet seit vielen Jahren als Journalist in unterschiedlichen redaktionellen Bereichen und als Betriebswirt.
Die vdW-Media Redaktion steht für fundierte und gut verständliche Inhalte qualifizierter Fachautoren. Seit 2019 ist die Redaktion ein verlässlicher Partner in der Veröffentlichung ausgewählter Inhalte in den Bereichen Klima- und Umweltschutz. Gemeinsam mit dem vdW-Media Netzwerk aus Experten bietet vdW eine zielgruppengerechte Textauswahl aus wissenschaftlichen Artikeln, Branchenberichten, Ratgeber-Texten und journalistischen Beiträgen.
Anspruch ist es, den Leser zu informieren, zu inspirieren und ihm einen echten Mehrwert zu bieten.
» https://klimanotfall.com/» https://vdw-media.com/
» https://web16.de/
Häufige Fragen und Antworten zum Klimawandel
Wann wurde das erste Mal vom Klimawandel gesprochen? Wer hat den Klimawandel entdeckt?
Der Mathematiker und Physiker Jean Baptiste Joseph Fourier formulierte 1824 erstmals das Prinzip des Treibhauseffekts in der Atmosphäre und stellte fest, die Erde ist viel wärmer, als sie ohne Atmosphäre sein dürfte.
Die Amerikanerin Eunice Foote experimentierte in den 1850er-Jahren mit Wasserdampf und Kohlendioxid (CO2) und stellte fest, dass letzteres die Temperatur steigen lässt. Sie kam zu dem Schluss, dass "eine Atmosphäre mit diesem Gas unserer Erde eine hohe Temperatur verleiht".
Ist der menschengemachte Klimawandel bewiesen?
1995 gelingt einem Forscherteam um den deutschen Physiker Klaus Hasselmann der Beweis für den menschengemachten Klimawandel. Die inzwischen bereits gemessene Erderwärmung lässt sich mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf den Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre zurückführen.
Über 99,99% der Klimawissenschaftler stimmen der These zu, dass der menschengemachte Klimawandel existiert. Im November 2019 zeigte eine Untersuchung zu über 11.600 Peer-Review-Artikeln, die in den ersten sieben Monaten des Jahres 2019 veröffentlicht wurden, dass der Konsens 100% erreicht hatte.
Außerdem hat eine Überprüfung wissenschaftlicher Arbeiten aus dem Jahr 2019 ergeben, dass der Konsens über die menschliche Ursache des Klimawandels bei 100% liegt. Dieser wissenschaftliche Konsens zum Klimawandel wird durch verschiedene Studien zu Standpunkten von Wissenschaftlern und durch Positionserklärungen von Wissenschaftsorganisationen gestützt, von denen viele ausdrücklich mit den Übersichtsarbeiten des IPCC (Intergouvernemental Panel on Climate Change) übereinstimmen. Siehe hierzu » https://klimanotfall.com/78.
Ist der Klimawandel menschengemacht oder natürlich?
Der Klimawandel ist menschengemacht. Menschengemachte Treibhausgase sind die Ursache für den aktuellen Klimawandel. Zahlreiche Studien weltweit belegen den Zusammenhang. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen (IPCC) legt dazu regelmäßig seine wissenschaftlich fundierten Berichte vor. Siehe hierzu » https://klimanotfall.com/78.
Was ist am meisten für den Klimawandel verantwortlich?
Die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Abholzung von Wäldern und die Viehzucht beeinflussen zunehmend das Klima und die Temperatur auf unserer Erde. So erhöht sich die Menge der in der Atmosphäre natürlich vorkommenden Treibhausgase enorm, was den Treibhauseffekt und somit die Erderwärmung verstärkt. Bis 2020 war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf einen Wert von 48% über dem vorindustriellen Niveau (vor 1750) gestiegen. Andere Treibhausgase werden durch menschliche Tätigkeiten in geringeren Mengen emittiert.
Ist CO2 wirklich für den Klimawandel verantwortlich?
CO2 trägt daher vor allem zum natürlichen Treibhauseffekt bei. Das Problem ist, dass der Anteil von Wasserdampf in der Atmosphäre von der Temperatur abhängig ist. Mehr CO2 führt zu steigenden Temperaturen, das führt zu mehr Wasserdampf und verstärkt den Treibhauseffekt. Eine positive Rückkopplung, die große Auswirkungen haben kann.
Warum ist der Klimawandel menschengemacht?
Für Wissenschaftler ist die Antwort eindeutig. Der Mensch hat die Erderwärmung maßgeblich zu verantworten. Das liegt vor allem am Anstieg des klimaschädlichen Kohlendioxids in der Erdatmosphäre, den wir Menschen seit der Industrialisierung um 1850 verursachen.
Die 10 größten Klimasünder weltweit:
Platz Land Anteil weltweiter CO2-Emissionen in %
1 China 32,93
2 USA 12,55
3 Indien 7,00
4 Russland 5,13
5 Japan 2,87
6 Iran 2,02
7 Deutschland 1,82
8 Saudi-Arabien 1,81
9 Indonesien 1,67
10 Südkorea 1,66
Siehe VDI Verlag GmbH (Stand 13.02.23): https://klimanotfall.com/79
Was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima?
"Wetter" meint, was heute oder morgen draußen passiert. Es regnet oder die Sonne scheint, es ist neblig oder bedeckt. "Klima" beschreibt, wie das Wetter sich über einen langen Zeitraum darstellt. Wenn es in einer Gegend über viele Jahre regnet, spricht man von einem "feuchten Klima".
In welchem Jahr wird der Klimawandel gefährlich?
Der IPCC-Weltklimarat geht davon aus, dass die 1,5-Grad-Grenze wohl zwischen 2030 und 2052 überschritten werden wird. Am wahrscheinlichsten scheint es demnach in den frühen 2030er Jahren so weit zu sein. Je nachdem, wie viele Treibhausgase die Welt in den kommenden Jahren noch in die Atmosphäre bläst.
Ist die Erderwärmung noch zu stoppen?
Nur eine schnelle Umstellung der Energieproduktion auf erneuerbareEnergien und ein drastisches Absenken des CO2-Ausstoßeskann den Klimawandel - vielleicht - noch aufhalten.
Dieses Buch dokumentiert und beschreibt einige Klimaschutz-Ereignisse aus dem Jahr 2023 mit wahrscheinlich gravierenden Folgen für unsere Lebensgrundlagen für die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte. Jeder Mensch kann und muss sich im Großen und Kleinen, in seinem Rahmen und mit seinen Möglichkeiten für den Klimaschutz einsetzen und handeln.
Autor © vdW-Media.com mit KI-Unterstützung.
Randbereiche des Klimawandels
Es gibt Randbereiche des Klimawandels, die oft übersehen bzw. nicht erwähnt werden. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass der Klimawandel zahlreiche Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Sie sind komplex, miteinander verflochten und betreffen verschiedene Bereiche wie die Umwelt, Nahrungsmittelversorgung, Infrastruktur und soziale Ungleichheiten.
Direkte und indirekte Auswirkungen auf Gesundheit und Leben.
Direkte Auswirkungen des Klimawandels auf Gesundheit und Leben
Hitze und Hitzewellen. Hitzebedingte Erkrankungen. Durch steigende Temperaturen und häufigere Hitzewellen steigt die Gefahr von hitzebedingten Erkrankungen wie Hitzschlag, Dehydratation und Herz-Kreislauf-Problemen. Höhere Sterblichkeit: Vor allem ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen sind von hitzebedingten Todesfällen bedroht. Beispielsweise führten Hitzewellen in Europa (z. B. 2003) zu zehntausenden von Todesfällen.
Extremwetterereignisse. Stürme, Überschwemmungen und Dürren. Naturkatastrophen wie Hurricanes, Stürme, Starkregen und Überschwemmungen werden durch den Klimawandel intensiver und häufiger. Diese Ereignisse können Verletzungen, Todesfälle und langfristige Beeinträchtigungen der Gesundheit verursachen. Verletzungen und Traumata: Extremwetterereignisse führen zu direkten Verletzungen (z. B. durch Gebäudeeinstürze) und erhöhen das Risiko für psychische Erkrankungen wie posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS).
Luftqualität. Zunahme von Atemwegserkrankungen. Der Klimawandel verstärkt Luftverschmutzung (z. B. durch Feinstaub und Ozon), was zu Atemwegserkrankungen wie Asthma und chronischer Bronchitis führt. Höhere Temperaturen können auch die Bildung von bodennahem Ozon fördern, das Lungengewebe schädigt.
Meeresspiegelanstieg. Verlust von Lebensräumen und Migration. Küstennahe Gebiete sind durch den Anstieg des Meeresspiegels bedroht, was zu Zwangsmigration, Heimatverlust und damit verbundenen gesundheitlichen und sozialen Belastungen führt. Verdrängung und psychische Belastungen. Menschen, die durch Überschwemmungen oder den steigenden Meeresspiegel ihre Heimat verlieren, sind oft psychischen Belastungen, Angst und sozialer Unsicherheit ausgesetzt.
Indirekte Auswirkungen des Klimawandels auf Gesundheit und Leben
Ernährungssicherheit und Nahrungsmittelknappheit. Ernährungsunsicherheit. Klimawandel beeinflusst die Landwirtschaft durch Dürren, Unregelmäßigkeiten im Niederschlag und Bodenverschlechterung. Dies führt zu Nahrungsmittelknappheit, Ernährungsunsicherheit und Unterernährung, besonders in Regionen, die ohnehin schon anfällig sind. Mangelernährung. Kinder und vulnerable Gruppen sind besonders gefährdet, da die Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Weizen, Reis und Mais beeinträchtigt wird.
Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Verbreitung von durch Vektoren übertragenen Krankheiten. Der Klimawandel verändert das Verbreitungsgebiet von Krankheitsüberträgern wie Malaria, Borreliose, FSME, Dengue-Fieber, Krim-Kongo-Hämorrhagisches Fieber, Leishmaniose, Zika-Virus oder Mückenübertragene Erkrankungen. Warme Temperaturen begünstigen die Vermehrung von Insekten und verlängern deren Lebenszyklus. Wassergebundene Krankheiten. Überschwemmungen und höhere Temperaturen können die Ausbreitung von Wasserkrankheiten wie Cholera und Durchfallerkrankungen fördern, insbesondere in Gebieten mit mangelhafter Wasserversorgung und Hygiene.
Wasserversorgung und Hygiene. Wassermangel. In vielen Teilen der Welt führt der Klimawandel zu veränderten Niederschlagsmustern, was Wasserknappheit zur Folge hat. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Gesundheit, da sauberes Trinkwasser und Hygiene entscheidend für die Vermeidung von Krankheiten sind. Krankheiten durch schlechte Hygiene. Wenn Wasserressourcen knapp sind, können sich wasserbedingte Krankheiten wie Durchfall und Hepatitis A schneller verbreiten.
Migration und soziale Konflikte. Klimamigration. Der Verlust von Lebensräumen, z. B. durch Meeresspiegelanstieg oder Wüstenbildung, zwingt viele Menschen zur Migration. Dies kann zu sozialen Spannungen und Konflikten führen, was die Lebensqualität und Gesundheit sowohl der Migranten als auch der aufnehmenden Gemeinschaften beeinträchtigt. Psychische Belastungen. Der Stress und die Unsicherheit durch Zwangsmigration und den Verlust von Lebensgrundlagen können Depressionen, Angststörungen und andere psychische Erkrankungen fördern.
Verlust der Biodiversität. Indirekte Auswirkungen auf Ernährung und Gesundheit. Der Verlust an Biodiversität beeinträchtigt die Ökosystemleistungen, von denen die menschliche Gesundheit abhängt, z. B. durch die Reduktion der Artenvielfalt in der Nahrungsmittelproduktion. Weniger Vielfalt kann zu einer schlechteren Ernährung und einem erhöhten Krankheitsrisiko führen.
Soziale Ungleichheit und gesundheitliche Disparitäten
Der Klimawandel trifft ärmere und sozial schwächere Bevölkerungsgruppen oft besonders hart. Sie haben oft schlechteren Zugang zu Gesundheitsdiensten, weniger Ressourcen zur Anpassung und sind in stärker gefährdeten Gebieten ansässig. Soziale Ungleichheiten werden durch den Klimawandel weiter verschärft, was zu Ungerechtigkeiten in der Gesundheitsversorgung führt.
Fazit:
Der Klimawandel stellt eine wachsende Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar, indem er die Umwelt, die Nahrungsmittelversorgung, die Wasserverfügbarkeit und die allgemeine Lebensqualität beeinträchtigt. Direkte Auswirkungen wie Hitzewellen und Extremwetterereignisse gefährden unmittelbar Leben, während indirekte Effekte durch verschärfte soziale und wirtschaftliche Probleme langfristige Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Anpassungsmaßnahmen und eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sind entscheidend, um die negativen Auswirkungen zu mildern.
Biodiversität und Ökosysteme.
Verlust von Lebensräumen, ArtenverschiebungenOzeanversauerung. Der Klimawandel hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Biodiversität und Ökosysteme, da er natürliche Lebensräume, Nahrungsnetze und die Artenvielfalt verändert. Diese Veränderungen betreffen alle Ebenen der biologischen Vielfalt, von Genen über Arten bis hin zu Ökosystemen.
Artenvielfalt. Artenwanderung. Da sich die Temperaturzonen verschieben, müssen viele Arten neue Lebensräume suchen, um geeignete klimatische Bedingungen zu finden. Dies gilt besonders für kälteangepasste Arten in Polarregionen oder Hochgebirgen, die zunehmend an den Rand ihrer Lebensräume gedrängt werden. Rückgang der Artenvielfalt. Nicht alle Arten können schnell genug migrieren oder sich anpassen. Arten mit geringem Verbreitungsgebiet, schlechter Mobilität oder spezifischen Habitatansprüchen (z. B. Korallen) sind stärker gefährdet und könnten aussterben.
Veränderung der Phänologie. Veränderung von Jahreszyklen. Klimaveränderungen beeinflussen die saisonalen Zyklen vieler Organismen. Pflanzen blühen früher, Tiere migrieren oder brüten zu anderen Zeiten. Diese Verschiebungen können zu "Phänologie-Mismatches" führen, z. B. wenn Bestäuber nicht zur Blütezeit der Pflanzen vorhanden sind, was zu einem Rückgang von Pflanzenpopulationen und Nahrungsquellen führt.
Erhöhtes Aussterberisiko. Aussterben von Arten. Arten, die nicht in der Lage sind, sich schnell genug anzupassen, können aussterben. Besonders gefährdet sind Arten in sensiblen Lebensräumen wie Korallenriffen, der Arktis, den Tropen und alpinen Ökosystemen. Studien schätzen, dass bis zu 20-30 % aller Tier- und Pflanzenarten weltweit vom Aussterben bedroht sein könnten, wenn die Temperaturen weiter steigen.
Verlust von Lebensräumen. Habitatverlust: Steigende Temperaturen und Extremwetterereignisse wie Dürre und Überschwemmungen zerstören und verändern Lebensräume. Korallenriffe, Regenwälder, Mangroven und Feuchtgebiete sind besonders anfällig. Der Verlust von Korallenriffen, die durch die Ozeanerwärmung und Versauerung beeinträchtigt werden, gefährdet Tausende von Meerestieren, die dort ihren Lebensraum finden.
Fragmentierung von Lebensräumen. Wenn sich Lebensräume aufgrund des Klimawandels verändern oder schrumpfen, werden sie fragmentiert. Dies erschwert Tieren und Pflanzen die Migration und verringert die genetische Vielfalt, was sie anfälliger für Krankheiten und andere Bedrohungen macht.
Veränderungen in Ökosystemfunktionen. Störung von Nahrungsnetzen. Da sich Arten unterschiedlich schnell an den Klimawandel anpassen, kann dies Nahrungsnetze destabilisieren. Beutetiere könnten verschwinden oder weniger verfügbar sein, was wiederum Auswirkungen auf Raubtiere hat. In marinen Ökosystemen haben sich beispielsweise durch das Absterben von Korallen und Algen grundlegende Nahrungsnetze verändert. Verschiebung von Ökosystemen. Ganze Ökosysteme können sich in neue Regionen verschieben. Zum Beispiel wandern viele Pflanzen- und Tierarten in höhere Lagen oder breitere Breitengrade, um kühlere Bedingungen zu finden. Diese Verschiebung kann neue Artenkonkurrenzen und Interaktionen erzeugen, die bestehende Gemeinschaften destabilisieren.
Verlust von Ökosystemdienstleistungen.