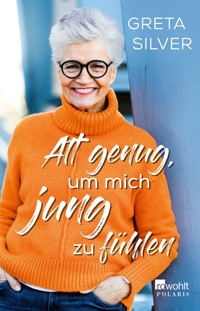
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin, YouTube- und Podcast-Star Greta Silver stellt sich einer großen Frage: Wenn Jugend bedeutet, unbeschwert auf alles zuzugehen, begeisterungsfähig, mutig, neugierig zu sein - wann haben wir das wirklich gelebt? Mit 20, als wir hin- und hergerissen waren, wo die Reise hingeht? Mit 30, als Stress und schlaflose Nächte uns erschöpften? Mit 40 oder 50, als Gewohnheiten vermeintliche Sicherheit vermittelten? Tatsache ist: Die Zeit von 60 bis 90 Jahren ist genau so lang wie von 30 bis 60 – JETZT ist die Zeit, in der wir jung sein können. Denn das Alter ist Erntezeit: Vorher war Pflicht, jetzt kommt die Kür, mit allen Möglichkeiten der Jugend, nur ohne deren Stress und Ängsten. Wie das mit spielerischer Leichtigkeit gelingt und warum noch mehr auf uns wartet als Ruhestand und Enkelkinder, erklärt Greta Silver in diesem Buch. Sie widmet sich den großen Themen der neuen spannenden Lebensphase, findet Antworten auf die dringendsten Fragen, Rat für die größten Sorgen und Ängste und lebt selbst am besten vor: Jugendwahn war gestern - heute rockt das Alter!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Greta Silver
Alt genug, um mich jung zu fühlen
Über dieses Buch
Greta Silver geht mit dem Motto «Erwarte das Beste, es steht dir zu!» durch das Leben. Mit ihrer positiven Art steckt sie alle an. Egal ob auf Instagram oder YouTube, als Podcasterin, Model oder als Bestsellerautorin – die Powerfrau hat ihr Leben fest im Griff. «Ein Leben ohne Handbremse, Angst, Verletzung, Selbstzweifel und schräge Glaubenssätze ist Freiheit pur» – Greta Silver verrät uns, wie genau dieses Leben gelingt und widmet sich in ihrem neuen Buch sehr praktisch den großen Themen der neuen spannenden Lebensphase, findet Antworten auf die dringendsten Fragen, Rat für die größten Sorgen und Ängste und lebt selbst am besten vor: Jugendwahn war gestern, heute rockt das Alter!
Vita
Greta Silver, geboren 1948, nahm bereits in jungen Jahren die Verantwortung für ihr Glück selbst in die Hand. Das Alter entdeckt sie als begeisternde Lebensphase, in der das Lebensknowhow trägt und das Gezappel der jungen Jahre mit Stress und Zeitnot vorbei ist. Als millionenfach geklickte YouTuberin, Podcasterin und BestAger-Model macht die Unternehmerin und Mutter von drei Kindern anderen Mut und steckt mit ihrer Lebensfreude an. Greta Silver lebt in Hamburg.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Lotta Fotografie
ISBN 978-3-644-00389-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt – sie ist ein Geisteszustand.
Sie ist Schwung des Willens, Regsamkeit der Phantasie,
Stärke der Gefühle, Sieg des Mutes über die Feigheit,
Triumph der Abenteuerlust über die Trägheit.
Niemand wird alt, weil er eine Anzahl Jahre hinter sich gebracht hat.
Man wird nur alt, wenn man seinen Idealen Lebewohl sagt.
Mit den Jahren runzelt die Haut,
mit Verzicht auf Begeisterung aber runzelt die Seele.
Du bist so jung wie deine Zuversicht, so alt wie deine Zweifel,
so jung wie dein Selbstvertrauen, so alt wie deine Furcht,
so jung wie deine Hoffnungen, so alt wie deine Verzagtheit.
Solange die Botschaften der Schönheit, Freude,
Kühnheit, Größe dein Herz erreichen,
solange bist du jung.
Albert Schweitzer
Für meine wunderbare, große trubelige Familie – ein Geschenk des Himmels
Weißt du eigentlich, wie leicht es ist, sich jung zu fühlen?
Ich bin eine verdorbene YouTuberin. Im Netz duzt man sich – darf ich das hier auch? Ich bin Greta.
Wann ist man eigentlich jung, und was meinen wir damit? Ich verstehe darunter dieses «Alles ist möglich». Keine Grenzen im Kopf, sondern «Was kostet die Welt?». Das Herz auf offen schalten, ohne Vorbehalte auf alles zugehen, was das Leben bietet, begeisterungsfähig, mutig, neugierig sein. Unbeschwert sein, keine Verantwortung tragen. Jugend ist Leichtigkeit, bunt und fröhlich. Wann aber haben wir so gelebt? Mit zwanzig, als wir hin und her gerissen waren, wo die Reise hingeht, im Job, mit dem Partner? War diese Zeit nicht vor allem von Unsicherheit geprägt, was das Leben und die Liebe betrifft? Sicher, es gab auch Zeiten, in denen wir ordentlich gefeiert oder als Backpacker in Australien unsere Freiheit genossen haben. Doch dieser Rausch war kurz. Es folgte ein Bruch – wir hatten so etwas wie «Jetzt beginnt der Ernst des Lebens» im Ohr. Obwohl wir froh waren, die Schule endlich verlassen zu haben, war schnell klar: Ausbildung und Studium sind nicht die ganz große Erfüllung. Immer noch vom elterlichen Portemonnaie abhängig zu sein oder keine großen Sprünge machen zu können – wir hatten die Wahl.
In den Dreißigern waren dann Karriere und Familiengründung dran. Das Leben wurde stabiler. Wir waren stark und fühlten uns fit für die Zukunft. Die Kehrseite waren Stress und schlaflose Nächte. Kranke Kinder, die Herausforderungen des Jobs – wo blieben wir selbst zwischen alldem?
Mit vierzig oder fünfzig vermittelten Gewohnheiten vermeintliche Sicherheit. Veränderungen, so glaubten wir, lohnen sich schon nicht mehr. Von Aufbruch keine Spur.
Im Alter aber fallen plötzlich alle Verpflichtungen weg – die Kinder sind aus dem Haus, im Büro wartet niemand mehr auf uns. (Allerdings werden wir noch sehen, wie wir unser berufliches Know-how weiter einsetzen können.) Man kann das als Verlust betrachten. Ich sehe es als geschenkte Freiheit.
Ich habe früher auch nicht geahnt, was sich in diesem neuen Lebensabschnitt für spannende Möglichkeiten ergeben. Mit 17 war ich sicher, dass der Spaß im Leben mit 35 Jahren vorbei sein würde. Dann folgt alles nur noch vorgefertigten Bahnen, dachte ich. Natürlich habe ich diese mentale Grenze im Laufe meines Lebens immer weiter rausgeschoben – aber irgendwann würde das graue Ende schon kommen, davon blieb ich überzeugt. Jetzt weiß ich: Das Gegenteil ist der Fall.
Ich war offensichtlich nicht die Einzige, die mit solchen schrägen Bildern im Kopf herumlief. Doch der Reihe nach. «Du musst der Welt da draußen erzählen, wie toll es ist, alt zu sein», forderte mich eine jugendliche Freundin auf. Gesagt, getan – mit 66 Jahren begann ich einen YouTube-Kanal, wo über zwei Millionen Klicks mir sagen: Hurra, endlich ist der Grauschleier weg, der über dem Alter lag. Alt und Jung sind begeistert von dieser neuen Perspektive. Es ist ein Lauffeuer geworden, das sich Bahn bricht in meinen Büchern und Podcasts sowie in den Reden, die ich überall halte – auf Kongressen genauso wie in Unternehmen, bei Verbänden und sonst wo. In Talkshows und Zeitungsinterviews verkündete ich meine frohe Botschaft. Ein Fernsehteam aus Chile hörte davon, kam nach Hamburg und drehte einen dreißigminütigen Film über mich, der jetzt auf der Plattform der UNO steht als Beispiel dafür, wie unterschiedliche Länder mit dem Alter umgehen. Im Vorspann sind der Bundesadler und das Emblem der UNO zu sehen. Ich fasse es immer noch nicht – auch jetzt beim Schreiben bin ich ganz ehrfürchtig. Muss mich zwicken, ob ich vielleicht gerade träume.
Ja, ich möchte der Welt die Augen öffnen, damit sie sieht, was alles möglich ist im Alter. Obwohl ich den starken Verdacht hatte, dass mit 35 der Spaß im Leben vorbei ist, habe ich mit 17 Jahren entschieden, dass ich 120 werde. Ich bin unfassbar dankbar dafür, jetzt mit 71 Jahren in der Blütezeit meines Lebens zu stehen.
Es ist zunächst irgendwie niemandem so richtig klar, dass die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist wie die von 30 bis 60. Wenn wir die gleiche Intensität leben wollen wie mit 30 Jahren, dann sitzen wir diese Zeit nicht einfach ab. Dann verstehen wir diese neue Lebensphase als Start-up-Unternehmen und verwirklichen die Träume, die in unserem hektischen Berufsalltag zu kurz gekommen sind.
Wir bekommen so viele Geschenke im Alter, leben zumeist stressfrei und mit großer Gelassenheit. Wir machen uns nicht mehr wegen Quatschkram verrückt. Wir wissen, wie das Leben funktioniert, beruflich wie privat. Haben Krisen durchlebt, gemeistert und daraus gelernt, das macht uns stark. Nach einer Krise sind wir nicht mehr die Alten: Ja, Gott sei Dank! Wir gehen gestärkt daraus hervor. Wir müssen keinem mehr etwas beweisen, und was die Nachbarn denken, ist uns mittlerweile auch egal.
Alter ist Erntezeit. Vorher war Pflicht, jetzt folgt die Kür. Das Leben leben mit all unserem Wissen, das ist Freiheit pur. Wir haben die Wahl. Wir entscheiden selbst, was für ein Leben wir führen wollen. Auf geht’s.
Der Blick auf die Alten
Wenn man früher sagte: Der oder die wird 65, 70 Jahre alt, dann schwang da Bedauern mit. Unausgesprochen hing da ein «Ach, der Arme» in der Luft.
Ich weiß noch, dass ich – auch wenn es mir jetzt peinlich ist – als Ende-Zwanzigjährige meine Mutter mit Ende fünfzig als alt empfunden habe. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was sie noch für Wünsche an das Leben hatte. Klar sind Eltern alt, wenn man Kind ist. Aber irgendwann sollte man verstehen, dass sie nicht nur Eltern sind, sondern auch Frauen und Männer mit Sehnsüchten und Ideen für das eigene Leben. Ich selbst kam erschreckend spät zu dieser Erkenntnis. Wohl erst ungefähr mit Ende vierzig. Von da an war es mir aber auch wichtig, mich immer wieder an die junge Frau zu erinnern, die meine Mutter irgendwann in meinem Leben gewesen war. Es wäre für mich nicht leicht, um nicht zu sagen ein Albtraum, wenn ich wegen körperlicher Gebrechen nicht mehr alleine im Leben klarkäme und meine Kinder sich später nur noch an diese kranke und eingeschränkte Frau erinnern würden. Das macht doch nur einen Teil des alten Menschen aus. Genauso wie es bei einem körperlich behinderten Menschen auch immer nur ein Teil ist, der nicht so funktioniert, wie er vielleicht sollte. Daher ist es mir sehr wichtig, stets den ganzen Menschen zu sehen, statt mich auf seine Beschwerden zu fokussieren. Ich habe viel lernen dürfen von Menschen mit schwerer Krankheit und wenig finanziellen Mitteln – egal in welchem Alter.
Sich vor Augen zu führen, dass die Generation, die jetzt zum Teil im Altersheim lebt, genau jene Generation ist, die das Handy erfunden und an Deutschlands Wirtschaftswunder mitgewirkt hat, bringt eine neue Blickrichtung. Aber davon erzähle ich später. Eines steht jedenfalls fest: Die heutigen Alten lassen sich nicht mehr so schnell aufs Abstellgleis schieben.
Ja, es gibt eine riesige Lücke beim Blick auf die Alten. Da bin ich gerne Brückenbauer. Mein Material ist unter anderem der Respekt vor der Lebensleistung eines jeden Menschen. Es gibt viel zu tun – packen wir’s an.
In meinem Buch geht es nicht allein darum, wie spannend das Alter heutzutage ist. Ich gehe auch der Frage nach, wie wir Älteren denn eigentlich ticken. Wie sind wir so jung alt geworden, und was können wir tun, damit es so bleibt?
Wir sind nach dem Krieg geboren und atmeten die frische Luft des weltweit berühmten Wirtschaftswunders ein. Das Leben wurde von Jahr zu Jahr besser, schöner, leichter. Unsere Erwartungen an die Zukunft waren hoch. «Den Kindern soll es später mal besser ergehen», wünschten sich viele unserer Eltern. Diese positive Erwartungshaltung an das Leben haben wir beibehalten und nicht mit sechzig an den Nagel gehängt. Wieso denn auch?
Die lange Suche nach dem Glück
Der sogenannte Weltglücksreport gibt Aufschluss darüber, wo auf der Welt die glücklichsten Menschen leben. 156 Länder wurden dafür verglichen, die Studie wurde 2019 zum siebten Mal durchgeführt. Auf Platz eins steht in diesem Jahr Finnland, Deutschland liegt auf Platz 17. Vor uns, auf Platz zwölf, findet sich zum Beispiel Costa Rica. Da erkennen wir, dass nicht das Geld allein ausschlaggebend ist. Tatsächlich war das Bruttoinlandprodukt – neben Demokratie, Korruption und den Aussagen der Menschen selbst – nur einer der Faktoren, die in die Berechnung einbezogen wurden. Auf der Liste stehen durchaus ärmere Länder vor reichen Industriestaaten. Trotzdem halten sich hartnäckig Bilder im Kopf, die uns das Gegenteil vorgaukeln. Auch das Wetter ist nicht ausschlaggebend – da ist Finnland nicht besser dran als Deutschland.
Als ich mit Ende zwanzig in Hongkong war, begriff ich etwas Wesentliches. Auf einer Stadtrundfahrt erklärte man uns, dass ehemalige Boat People vor kurzem aus dem Hafen in ein neues Quartier umgesiedelt worden waren. Diese Menschen hatten ihr ganzes bisheriges Leben auf einem kleinen Boot im Hafen verbracht. Man beschrieb uns, wie viele Menschen nun in den neuen Häusern auf wie viel Quadratmetern lebten. Ich fand das immer noch unglaublich beengend und hatte Mitleid mit den Bewohnern. Irgendwie war ich davon überzeugt, dass man zum Glücklichsein richtig viel Platz braucht. Wie merkwürdig unsere Normvorstellungen mitunter sind, merkt man ja oft erst auf Umwegen. Ich erwartete wohl nur weinende und traurige Menschen. Das Gegenteil war der Fall. Auf den Straßen herrschte eine ausgelassene Fröhlichkeit, während die Menschen auf dem Hamburger Jungfernstieg so aussehen, als trügen sie die Last der Welt auf den Schultern. In der neuen Siedlung in Hongkong schlug mir eine quirlige Freude und Unbeschwertheit entgegen, die mich zum Grübeln brachte. Ich wusste, diese Menschen waren arm an Geld und Quadratmetern, aber reich an Glück. Oh ja, ich fuhr mit einem großen Fragenkatalog im Kopf nach Hamburg zurück: Was brauche ich selbst eigentlich für mein Glück? Und was kann ich selber tun, um glücklich zu sein?
In jungen Jahren habe ich das Glück an der falschen Stelle gesucht. Nur kurzfristige Hochgefühle gefunden statt ein anhaltendes Glücksempfinden. Wir alle kennen das: Du könntest ausrasten vor Glück, dein Herz schlägt Purzelbäume – endlich hast du erreicht, wofür du so lange gekämpft hast. Endlich ist der heißersehnte Wunsch Wirklichkeit geworden – doch nach ein paar Tagen oder spätestens Wochen ist das Glücksgefühl wieder futsch. Es schaltet einfach alles wieder auf normal. Das ist gemein. Natürlich weißt du, dass man Glück nicht festhalten kann, aber es wäre doch zu schön, wenn es diesmal anders wäre, schließlich hast du es dir so sehr gewünscht und dafür geackert. Du warst felsenfest davon überzeugt: Wenn dieser Schritt getan sein würde, dann bliebe die spürbare Erleichterung, dann wäre da endlich dieses dauerhaft prickelnde Glücksgefühl, etwas Besonderes geschafft zu haben.
Es ist bitter, wenn du merkst, dass es wieder nicht geklappt hat, wieder ist nach ein paar Tagen oder Wochen alles wie vorher. Du fühlst dich um dein Glück betrogen. Erschwerend hinzu kommt oft: Neider machen komische Bemerkungen – du wirst gar nicht nur bewundert, wie du es dir erhofft hattest. Stattdessen Geraune, ob das denn mit rechten Dingen zugegangen sei. Ich kenne den Vorstandsvorsitzenden eines großen Konzerns, der nach seiner Beförderung tief enttäuscht war. Doch diese Geschichte erzähle ich an anderer Stelle.
Vielleicht machst du dieses Spielchen ein paar Mal mit, hechelst dem nächsten Glücksversprechen hinterher, bis du irgendwann merkst, dass du dir selbst Daumenschrauben anlegst. Dein Stress wird mehr statt weniger. Mehr Verpflichtungen, aus denen du nicht so schnell wieder rauskommst. Sei es die Hypothek für das Haus oder die hohe Miete für die tolle Wohnung. Wie heißt es doch so schön: Auch das Hamsterrad mag von innen wie eine Karriereleiter aussehen. Hinzu kommt, dass es uns schwerfällt, einen hohen Standard wieder abzugeben. Wir fühlen uns wie Versager. Wären wir gleich in der kleineren Wohnung geblieben, hätten wir uns den Kummer erspart.
Die Wirtschaft und ihr Marketingteam verspricht uns das Blaue vom Himmel. Klappt es doch mit dem Nachbarn, wenn das Geschirrspülmittel stimmt! Wir glauben der Werbung und kaufen uns Sachen, von denen wir uns dauerhaftes Glück erhoffen. Doch leider klappt es nicht. Wir versuchen es immer wieder – bis wir merken, wir drehen uns im Kreis.
Selbst die zwanzig Jahre jüngere neue Ehefrau oder der neue Partner wird irgendwann Alltag sein. Das können wir uns zu Beginn einfach nicht vorstellen. Wir blenden diese Möglichkeit aus, bis unsere Hoffnung zerdampft wie ein Wassertropfen auf der heißen Herdplatte.
Für all diese Gemeinheiten – dass unser Glück nicht dauerhaft ist – gibt es einen simplen Grund. Die Forschung nennt diesen Umstand die hedonistische Tretmühle. Der Mensch ist so angelegt, dass er nach einem stark positiven oder negativen Lebensereignis relativ schnell zu einem stabilen Level von Glück und Lebensfreude zurückfindet. Wir haben eine Basisfröhlichkeit in uns, auf die wir uns immer wieder einpendeln.
Das Shoppingglück ist oftmals schon an der Haustür verflogen, und der Lottogewinn in Millionenhöhe trägt nur ein paar Wochen oder Monate zu einem etwas höheren Glücksgefühl bei – das ist längst erwiesen.
Gott sei Dank verhält es sich bei traurigen Gefühlen genauso. Irgendwann kommt man auch nach der Trauer wieder zur Grundlinie von Fröhlichkeit zurück. Wie lange das dauert, variiert. Der Verlust von Gegenständen ist schneller verflogen als der von Menschen: Über ein kaputtes Auto ist man schneller hinweg als über den Kontaktabbruch einer Freundin, die Trennung vom Partner oder den Tod eines Angehörigen.
Für mich war das eine bahnbrechende Erkenntnis: Ich kann mich abrackern ohne Ende und werde trotzdem nicht dauerhaft glücklich sein. Das musste ich erst einmal realisieren. Irgendwie ahnen wir es schon, dass äußere Dinge nicht langfristig zufriedenstellen, und trotzdem haben wir ein Bild im Kopf von dem, was uns zum Glück noch fehlt. So steigen wir freiwillig ins Hamsterrad – oder in die Tretmühle – und bereiten uns selbst unglaublichen Stress, nur um immer wieder aufs Neue frustriert zu sein. Dazu hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Ich wollte herausfinden, wie ich meine Grundfröhlichkeit dauerhaft anheben kann.
Und ich wurde fündig, sonst gäbe es dieses Buch nicht. Es gibt zwei Ansätze. Erstens sollte man sich fragen: Was zieht mein persönliches Glückslevel runter, was verdirbt mir die Stimmung und spuckt mir in die Suppe, und wie kann ich das ändern? Zweitens: Was hebt die Grundlinie an, was verleiht mir dauerhaft Flügel, und wie schaffe ich es, diese Dinge in meinen Alltag einzubauen?
Unglücklich machen uns Verletzungen, alte wie neue, außerdem Gefühle wie Hass, Neid, Angst, Wut und viele mehr. Wie du diese negativen Gefühle loswerden und neue verhindern kannst, davon ist hier im Buch die Rede. Außerdem natürlich von den vielen wunderbaren Möglichkeiten, mit denen du dein Glück dauerhaft anheben kannst. Dieses Buch ist dein kleiner Werkzeugkoffer dafür. Viel Freude auf deiner Reise!
AlltagWeißt du eigentlich, wie dringend nötig es ist, den Alltag mit Konfetti zu bestreuen?
Worauf warten wir eigentlich? Als Kinder warteten wir darauf, endlich in die Schule gehen zu dürfen, dann darauf, dass die Schulzeit endlich vorbei und Ausbildung oder Studium beginnt. Dann begriffen wir, dass wir noch immer von unseren Eltern abhängig waren, und fieberten fortan dem ersten Job entgegen, der uns endlich auf eigenen Beinen stehen lassen sollte. Doch mit dem Berufsleben gehen Druck und Stress einher, und so freuen wir uns am Montag schon aufs Wochenende. Wenn man den sozialen Medien Glauben schenken darf, dann betrachten viele die Zeit zwischen Montag und Freitag lediglich als notwendiges Übel, das es zu überstehen gilt. Und das Wochenende wird nur noch getoppt vom Urlaub, der uns die ganz große Freiheit verspricht.
Gehen wir davon aus, dass nur Urlaube und Wochenenden fröhlich gelebte Lebenszeit sind, ergibt sich folgende Rechnung: Bei dreißig Tagen Urlaub im Jahr sind wir hundertvierunddreißig Tage glücklich. Das wiederum würde bedeuten, dass wir von unseren neunzig Lebensjahren nur dreiunddreißig als vergnügtes Leben betrachten. Sicherlich müsste man die Rechnung durch Kindheit und Alter etwas korrigieren – die Tendenz bleibt jedoch die gleiche.
Der Alltag hat einen schlechten Ruf. Immer durchkreuzt er unsere schönen Pläne! Er scheint eine Aneinanderreihung von Dingen zu sein, die wir erledigen müssen, so ohne jedes Vergnügen. Wir wollen den Alltagstrott hinter uns lassen. Er ist wie eine schleichende Krankheit, die schließlich dazu führen kann, dass sich das Leben nicht mehr lebendig anfühlt. Nach und nach geben wir uns mit weniger Lebensintensität zufrieden und haken Alltag ab als etwas Lästiges, das vorübergehen muss. Ich habe mich in jungen Jahren dabei erwischt, wie ich meinen Alltag hinter mich bringen wollte, um endlich Zeit für mich zu haben. Das fing schon morgens an: Betten machen, das Badezimmer putzen, einkaufen gehen, kochen, Kinder abholen und was es noch alles zu tun gibt in einem trubeligen Haushalt. Bei drei Kindern, Mann und Hund blieb da nicht viel Zeit «für mich». Vielleicht fünfzehn Minuten oder auch mal eine Stunde. Mehr nicht. Irgendwann wurde mir bewusst, dass da etwas falschlief. Ich hake hier einfach meine Lebenszeit ab – das darf nicht sein.
Es fiel mir nicht leicht, das zu ändern. Wie sollte ich dem Bettenmachen einen tieferen Sinn geben? Ich dachte daran, dass es Menschen gibt, die mich darum beneiden würden, weil sie es temporär oder dauerhaft nicht können. Das half, ich erledigte meine Aufgaben leichter und bewusster. Doch ich will nicht erst dann etwas zu schätzen wissen, wenn ich es nicht mehr oder nur noch mit Mühe machen kann. Oder mir das zumindest vorstelle.
Alltag ist kostbare Lebenszeit
Inzwischen hat der Begriff der Quality Time Karriere gemacht. Hm, was ist denn dann die andere Zeit? Ist das die Abfallzeit, die wir notgedrungen hinter uns bringen müssen? Wenn wir verstehen, dass alles unsere Lebenszeit ist, dann gehen wir mit jedem einzelnen Tag anders um. An sich ist Quality Time ein wunderbarer Ansatz, um auf die wirklich wichtigen Situationen im Leben zu achten und ihnen mehr Raum zu geben. Doch letztlich sollte das Ziel sein, auch unserer anderen Lebenszeit den Stellenwert zu geben, die ihr zusteht.
Was ist Lebensqualität? Für mich ist es Lebenshunger und Lebensintensität – mit allen Sinnen und mit Haut und Haaren das Leben wahrzunehmen. Lass uns den Satz «Lebe jeden Tag, als wäre er dein letzter» einmal auf den Kopf stellen: Nutze ihn, als wenn es dein erster wäre! Man stelle sich vor, wir würden ohne unsere Vorbehalte leben, ohne unsere Vergangenheit, ohne unsere Verletzungen. Wir gingen unbeschwert in den Tag hinein, als wären wir Kinder. Die Vorstellung vom letzten Tag erzeugt Druck – man möchte eine Prioritätenliste anlegen, um auf keinen Fall etwas Wichtiges zu versäumen. Die Vorstellung vom ersten Tag aber lässt uns Leichtigkeit und Neugier aufs Leben verspüren.
Der Alltag jedoch scheint uns da einen Strich durch die Rechnung zu ziehen. Es trifft uns ja in jedem Alter: Wir leben in Zwängen, wollen raus aus den eingefahrenen Bahnen, doch wissen nicht, wie. Zu unterschiedlichen Zeiten gibt es dafür unterschiedliche Gründe. Häufig liegt es jedoch daran, dass wir meinen, wir hätten nicht genug Zeit.
Auch der Alltag hat vierundzwanzig Stunden
Zeit ist eine feste Größe – vierundzwanzig Stunden bleiben vierundzwanzig Stunden –, wir rennen nur meist zu schnell hindurch oder trödeln übermäßig herum. Das passiert hauptsächlich, wenn wir mit unseren Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind. Sehnen wir die Zukunft herbei wie Kinder die Bescherung an Heiligabend, vergeht die Zeit ganz langsam. Wir dehnen unser Zeitgefühl. Und wenn wir uns wünschen, die Zeit möge stillstehen, dann rast sie nur so vorbei. Immer wieder das neue Jetzt anzunehmen, die Gegenwart zu schätzen wissen lässt die Zeit hingegen gleichmäßig laufen.
Ich musste schmunzeln, als ich las, dass wahrscheinlich ein Mönch die mechanische Uhr erfunden hat, um zu wissen, wann es Zeit für das Gebet ist. Er brauchte die Uhr, um innezuhalten. Heute ist es genau andersherum: Das Messen der Zeit bringt Stress. Wir sollten uns nicht mehr so hetzen lassen von der Zeit.
Es gibt Völker, in denen die Zeit noch immer vom Tag- und Nachtrhythmus, vom Wechsel von Hell und Dunkel bestimmt wird. Oft leben sie in Gegenden, die ich oft nur aus Büchern und der Presse kenne, wie Teile der Mongolei, entlegene Bergregionen in Nepal. Aber ich lernte auch mal eine junge Frau kennen, die ein Jahr auf einer entlegenen Ziegenfarm hoch oben in den Alpen verbrachte. Selbst da wurde der Lebensrhythmus durch die Sonne und das Wetter vorgegeben.
Diese Menschen sagen dann gern mal zu uns: Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Wir sehen uns so schnell auf der Gewinnerseite – aber sind wir das wirklich? Unser Tagesablauf, von der Stechuhr getaktet, lässt unseren natürlichen Biorhythmus meist außer Acht. Auch der Unterschied zwischen Stadt und Land scheint eine Rolle zu spielen. Meine Schwester lebt auf dem Land, da «ticken die Uhren anders» – so fühlt es sich für mich an. Dort hat man immer Zeit für einen Plausch über den Gartenzaun oder beim Händler. Dagegen kommt mir das laute Hamburg viel gehetzter vor. Wir haben es sicherlich geschafft, einen Filter über all diese Ablenkungen zu legen, um sie weitestgehend auszublenden. Aber unser Unterbewusstsein registriert sie doch. Das spüren wir im Urlaub, wo wir deutlich weniger Ablenkungen zu verarbeiten haben. Dann schlafen wir entspannter. Im Alter weiß ich Ruhe deutlich mehr zu schätzen als früher. Da gehörten Lautstärke und Trubel irgendwie dazu. Jetzt liebe ich den Unterschied. Mag und schätze beides, Trubel und Ruhe – nur weil ich beides habe, kann ich die Extreme leben. Jetzt liebe ich den Unterschied. Dank des Trubels weiß ich die Ruhe zu schätzen. Und die Ruhe gibt mir die Kraft, auch den Trubel genießen zu können. Ich stelle es mir wie eine Balancierstange vor, mit der ich über ein gespanntes Seil gehe – mein Leben. Nur wenn ich das Gewicht an beiden Enden erhöhe, bleibe ich in Balance. Ja, ich kann immer mutiger neue Bereiche ausprobieren, wenn ich auch auf den Ausgleich achte.
Bei all diesen Dingen, die im Alltag nach unserer Aufmerksamkeit heischen, fällt mir Momo ein, das wundervolle Buch von Michael Ende. Dort rauchen die grauen Männer die Zeit der anderen auf. Momo jedoch entlarvt sie alle: Sie wollen uns glauben machen, dass all das Schöne im Leben, das, was der Seele guttut, vergeudete Zeit ist – damit sie uns diese Zeit stehlen können. Kennst du sie auch, die grauen Männer? Wo überall sie sich einmischen! Sie bieten uns alles Mögliche an, das wir kaufen sollten, damit wir Zeit sparen, lassen uns gar dem Glauben anfallen, dass wir Zeit sparen können für später. Aber mal ehrlich: Wie soll das denn gehen? Wir können doch immer nur im Jetzt leben, mit unseren 24 Stunden, die uns der Tag bringt.
Wir sollten uns vor diesen grauen Männern hüten, die uns weismachen wollen, wir verlören unsere Zeit. Wenn ich innehalte, könnte ich glauben, ich hörte diese Stimmen sogar heute noch … Früher bin ich auf sie hereingefallen. Was habe ich mich aufgeregt, wenn jemand meinen Terminkalender durcheinanderbrachte! Wartezeit beim Arzt, auf Dinge, die nicht fertig waren, auf Handwerker, die nicht pünktlich kamen. Wie können wir diese Wartelebenszeit sinnvoller nutzen? Da ist unsere Kreativität gefragt. Ich selbst schreibe Gedichte, lese ein Buch, höre Podcasts oder genieße einfach die Zeit für mich. Es ist meine Entscheidung, wie ich mit Verzögerungen umgehe: Ich sehe sie inzwischen als Zeit, die ich geschenkt bekomme, um mich mit Dingen zu befassen, die mir Freude bereiten.
Wir verlieren also keine Zeit, wir nutzen sie nur anders. Vierundzwanzig Stunden bleiben vierundzwanzig Stunden. «Ich habe keine Zeit» ist ein falscher Glaubenssatz. Als ich das irgendwo las, brauchte ich eine Weile, bis ich es begriff und akzeptieren konnte, denn ich war mir sicher: Zeit habe ich tatsächlich viel zu wenig. Alles in mir wehrte sich gegen die Einsicht, dass ich mich geirrt haben könnte. Doch nach diesem Gedankenkampf musste ich erkennen, ein Tag ist ein Tag, und dabei bleibt es. Zu verstehen, dass wir hier selbst unsere Bewertung liefern, dass der wichtige Hebel in unserer Hand liegt, das macht den Unterschied. Der Begriff «Zeitnot» wird falsch interpretiert. Wir kennen Hungersnot – dann gibt es weit und breit für betroffene Menschen keine Lebensmittel. Bei Wohnungsnot mangelt es an Wohnraum. Doch bei der Zeitnot hat sich meist etwas in unserem Terminkalender verschoben, oder wir haben zu viel reingepackt – so oder so haben wir dabei das Gefühl, wir müssten gerade die Zeit anders nutzen, als wir es wollen. Bei einer Hungersnot stehen die Lebensmittel nicht etwa ungeplant zu einer anderen Uhrzeit parat – nein, es gibt sie gar nicht in ausreichendem Maße, es herrscht ein klar messbarer Mangel. Das ist der Unterscheid. Unsere Zeit wird nicht einfach weniger. Wir haben weiterhin unsere 24 Stunden. Zeitnot gibt es also gar nicht. Es dauerte etwas bei mir, bis ich das überhaupt so denken konnte. Denn das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben, weil ich so viel mehr Dinge tue, an deren Stelle ich lieber anderes täte, kenne ich sehr gut. Ich war erschreckend stark auf dieses innere Stress-Mantra «Keine Zeit!» programmiert. In schwierigen Situationen fang ich heute an mir zu sagen: Ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe Zeit. Unglaublich, es fühlte sich wirklich anders an.
Aber womit füllen wir denn eigentlich unsere Lebenszeit? Unsere Sprache hält tatsächlich die Wendung bereit, man müsse «Zeit totschlagen». Das ist doch unfassbar. Wenn ich etwas oder jemanden totschlage, dann nehme ich ihm das Leben. Das heißt, wir würden uns unserer eigenen Lebendigkeit berauben. Nein, das darf nicht sein. Leider passiert es aber doch zu oft – bekämen wir am Ende unseres Lebens eine Bilanz vorgelegt, wie wir unsere Zeit genutzt haben, schlügen wir uns wahrscheinlich an die Stirn. Wie oft hängen wir zum Beispiel vorm Fernseher ab und lassen uns berieseln? Hin und wieder mag das Freude machen, aber meistens sind doch die wirklichen Dinge viel spannender als die, die andere uns vorspielen. Ich lebe zu gern selbst, als dass ich mir anschaue, wie andere leben.
All dies zu hinterfragen gelingt sicherlich vielen bei einer Meditation – aber es kann auch beim Spaziergang oder bei der Fahrradtour sein, beim Stricken oder in der Sonne liegen. Dabei können wir abtauchen zu einer inneren Insel, zu unserem Kern, der unkaputtbar ist, egal, wie wir behandelt wurden. Als wir auf die Welt kamen, wurde uns eine Würde mitgegeben, die schon laut Grundgesetz unantastbar und schützenswert ist. Wann nehmen wir uns die Zeit, dieses Ich in uns mal zu Wort kommen zu lassen?
Sich selbst Zeit zu schenken sind wir nicht gewohnt. Wir halten es für egoistisch. Dabei sind wir selbst in unserem Leben die wichtigste Person. Erst wenn es uns gutgeht, können wir die Welt aus den Angeln heben.
Bringt den Alltag und euer Gesicht zum Leuchten
Doch wie verleihen wir unserem Alltag den Wert, den er verdient? Wir könnten zum Beispiel jeden Tag etwas Zeit einplanen, um Dinge zu tun, die uns am Herzen liegen. Egal, wofür wir uns entscheiden – den Segelschein machen, eine Sprache lernen, kochen, sportlicher werden, Beziehungen pflegen, sich für den Tierschutz engagieren – wir sollten uns täglich eine halbe Stunde dafür nehmen. Wir können monatliche Pläne machen, welches Thema gerade dran ist. Wenn ich den Segelschein in der Tasche habe, kommt das nächste Projekt.
Das gibt dem Tag ein ganz anderes Gesicht und mir ein ganz anderes Lebensgefühl. Der Knackpunkt ist, ich muss es ernst meinen, mir diese Zeit im Kalender eintragen. Wenn mein Leben mir selbst nicht wichtig ist – wem denn dann? Es liegt an uns, uns selber wichtig zu nehmen. Zu verstehen, dass es um unser Leben geht und kein anderer vorbeikommt und es für uns regelt.
Wir sollten uns daher morgens die ernsthafte Frage stellen: Was würde diesen Tag zu etwas ganz Besonderem machen? Was kann ich selbst dafür tun? Wenn wir aufstehen mit dem grummeligen Gedanken: Leider muss ich jetzt wieder einkaufen gehen oder in das unangenehme Büro fahren mit der schrecklichen Kollegin, dann wird das nichts. Denn genau in diesem Moment stellen wir bereits die Weichen für den Tag. Wir werden es tatsächlich genau so empfinden, wie wir es uns morgens vorstellen.
Dazu gibt es Versuche des amerikanischen Neurowissenschaftlers Joe Dispenza: Eine Gruppe von Studenten übte fünf Tage lang täglich zwei Stunden mit einer Hand eine bestimmte Melodie auf dem Klavier. Eine zweite Gruppe lernte diese Melodie auswendig und verwendete die gleiche Zeit dazu, die Melodie nur mental, also in Gedanken, nachzuspielen. Eine weitere Gruppe spielte eine beliebige Klangfolge auf dem Klavier. Diese letzte Gruppe zeigte nach Ablauf der fünf Tage überhaupt keine Veränderungen im Gehirn, während jene, die sich bei den Studenten der ersten beiden Gruppen beobachten ließen, identisch waren. Die Probanden, die diese Klavierübung nur in Gedanken erledigten, hatten im Gehirn die gleichen Verknüpfungen erzeugt wie jene, die tatsächlich am Klavier saßen – und das nach nur fünf Tagen.




























