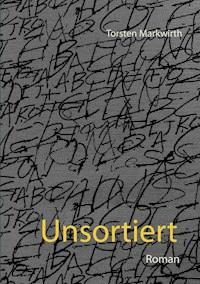Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Altenheim. Oft die letzte Station im Diesseits. Manche erleben sie angenehm und in Würde. Andere erfahren dort Leid und Unmenschlichkeit. Und einige erleben den blanken Horror. Wie Herbert, Julian und Frieder, drei Fast-Hundertjährige. Das Schicksal brachte sie in ein Heim mit kaltem, verrohtem Personal, mit entsetzlichen Demütigungen, nackter Gewalt und schlimmen Verbrechen. Die drei Freunde halten zusammen, versuchen immer wieder, Licht ins traurige Dunkel ihres Alltags zu bekommen. Hier und da gelingt es. Als die Schrecknisse in ihrem Heim überhandnehmen, stehen sie auf. Sie wehren sich und kämpfen. Nicht nur mit Worten. Der Roman legt Finger in Wunden. Wunden, die in der Welt eines Altenheims zu finden sind. Und es sind derer nicht wenige und sie sind nicht nur oberflächlicher Art. Der Roman bestürzt und kann Angst machen. Aber er birgt auch Hoffnung. Und die Erkenntnis, dass trotz aller Finsternis in dieser Sphäre auch Schönes erlebbar ist, dass man auch dort menschliche Tiefe spüren kann. Vielleicht sogar mehr als in der Lebenszeit zuvor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adeling! Erschießen Sie den Jungen!“
Ich trete vor.
Ungläubig.
„Wie bitte?“
„Erschießen Sie ihn.“
Seine Stimme ist leiser geworden, gesenkter.
Aber nicht weniger deutlich.
„Sie meinen…jetzt? Hier auf der Stelle?“
„Ja wann denn sonst? Morgen früh vielleicht?“
Seine Stimme nur noch Wispern.
„Er ist völlig wehrlos“, flüstere ich, ebenso leise.
„Das weiß ich. Machen Sie endlich …“
Ich blicke nach unten.
Vor mir kauert er.
Er, der Junge genannt wurde.
Was er auch ist.
14 oder 15 Jahre?
Schwierig zu schätzen.
In jedem Fall mehr Kind als Mann.
Ein Mensch, der bis vor kurzem sein Leben noch vor sich hatte.
Und es jetzt verlieren wird.
Unabänderlich.
Ich schaue in seine Augen.
Gespannt ist er in seiner Kauerhaltung unserem Dialog gefolgt.
Hin und her sind seine Augen gegangen zwischen uns.
Er hat unsere Worte nicht begriffen.
Und doch hat er verstanden.
Ja.
Er hat verstanden, was besiegelt ist.
Jetzt schaut er nur noch zu mir.
Eine unfassbare Traurigkeit blickt mich aus seinen braunen Augen an.
Feucht sind sie, fiebrig, die Kinderaugen.
Er sagt etwas, leise, sehr leise.
Ich kann es nicht verstehen.
Ich beuge mich über ihn.
Es ist eine Bitte, dessen bin ich mir sicher.
Eine flehende Bitte.
Um was mag er bitten?
Um Gnade?
Um Verschonung?
Oder lediglich darum, dass es schnell geht?
Ich weiß es nicht.
Keiner von uns weiß es.
Ich stehe regungslos.
Kann mich nicht abwenden.
Vom Gesicht, vom Blick des Jungen.
Des todgeweihten Jungen.
Der verstanden hat, was beschlossen wurde.
Er beginnt jetzt wieder leise zu sprechen.
Es ist wie ein Psalmodieren.
Vielleicht ein Gebet?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, was in seinen Augen, in diesen tiefen, braunen Augen steht.
Gewissheit.
Traurigkeit.
Schmerz.
Leid.
Tod.
„Nun machen Sie schon, Adeling …“
Ich erschrecke, löse mich aus meiner Starre.
Greife ans Halfter.
Die Pistole ist leicht, griffig.
Eine Null Acht.
Schon oft habe ich sie benutzt.
Eine verlässliche Waffe.
Ich entsichere sie.
Der Junge schaut mich unverändert tief an.
Er ist wirklich noch ein Kind.
Es ist ein Verbrechen …
Aber alles ist ein Verbrechen, alles hier, die ganze Scheiße.
Der Junge blickt jetzt von meinem Gesicht weg.
Auf die Pistole.
In ihren Lauf.
In die Schwärze ihrer Mündung.
Ich beginne zu zittern.
Der Lauf zittert, die Mündung zittert.
Noch nie habe ich gezittert.
Nicht mal in schlimmster Stunde.
Und derer gab es viele, oh ja, sehr viele, in dieser Zeit.
Mehr, als für ein Menschenleben gut ist.
Aber jetzt zittere ich.
Ich sichere die Null Acht und stecke sie zurück ins Halfter.
„Tut mir leid …“
Von Maltwitz nickt.
Es wirkt verstehend.
Er nestelt in seiner Jackentasche.
„Papirossa?“, fragt er den Jungen auf der Erde, das Kind.
Dessen Augen beginnen zu leuchten, zu strahlen.
Seine blutverschmierten Finger greifen nach der Zigarette.
Sie sind zart und filigran, diese Finger.
Wie von einem jungen Pianisten.
Nie und nimmer passen sie hierher, in diese Welt hier.
Von Maltwitz entflammt sein Sturmfeuerzeug und entzündet die Zigarette.
Der Junge hat sich etwas aufgesetzt auf dem schlammigen Boden.
Wie bei einem Picknick sitzt er nun auf der Erde und schmaucht genüsslich die Zigarette.
Seine Augen leuchten, er beginnt fröhlich zu plappern.
Wir verstehen seine Worte nicht.
Alles wird gut.
Ich muss wieder in seine großen Augen schauen.
Die Augen, die jetzt so anders sind wie eben zuvor, so viel heller.
Und dennoch die gleiche Tiefe, die gleiche Stärke besitzen.
Der Junge nimmt einen letzten Zug von der aufgerauchten Zigarette, atmet entspannt aus und blickt selig in den Sommerhimmel.
Ein Schuss.
Aus der Stirn des Jungen spritzt Gehirnmasse und liegt jetzt vermengt mit kleinen Knochensplittern vor ihm auf der Erde.
Verdutzt schauen seine Augen auf das Häufchen vor ihm.
Erstaunt.
Dann sackt er zur Seite.
Von Maltwitz sichert seine Pistole und steckt sie in den Gürtel. „Kommen Sie jetzt, Adeling, wir müssen weiter …“
Unsere Gruppe, wir sind zwölf Mann, nimmt Waffen und Gepäck auf und zieht schweigend los, Richtung Westen.
Nördlich von uns donnert schweres Artilleriefeuer.
„Mann, Adeling! Das war glatte Befehlsverweigerung! Die können dich vors Kriegsgericht stellen! Dann baumelst du!“, flüstert mir Hein zu, mein Kamerad neben mir.
Ich zucke nur die Achseln.
„Quatsch ...“ Ein Murmeln.
Hauptmann von Maltwitz, der voraus marschiert, hatte die Worte gehört. Er lässt sich zurückfallen und flüstert mir ins Ohr.
„Kokolores, Adeling … Außerdem müssen wir aus dem Schlamassel hier erst mal heile rauskommen …“
„Verzeihen Sie, Herr Hauptmann …“ Ich suche nach Worten, die es nicht gibt. „Ich konnte es einfach nicht, es war …“
„Schon gut, mein Junge.“ Der Hauptmann nimmt seine Maschinenpistole, eine Schmeisser MP 40, in die linke Hand und legt mir sehr unmilitärisch seine Rechte über die Schulter. Er drückt mich kurz an sich. „Mir fiel das auch nicht leicht. Aber es gab keine Alternative.“
Das wusste ich, das weiß ich.
Wie jeder von uns.
„Haben Sie seine Verletzung gesehen?“, fragt von Maltwitz.
Ich nicke.
Eine Granate hatte dem Jungen den halben Bauch aufgerissen.
Darmschlingen lagen frei, Essensreste waren sichtbar aus dem zerfetzten Magen in die offen liegende Bauchhöhle getreten.
Seine Einheit hat ihn wahrscheinlich sterbend zurückgelassen, inmitten der endlosen russischen Steppe.
„Er wäre von keinem Arzt der Welt zu retten gewesen. Er wäre noch ein paar Stunden hier elendig herumgelegen mit seinen bestialischen Schmerzen und dann jämmerlich krepiert.“ Der Hauptmann zündet sich eine Zigarette an.
„Und außerdem sind uns die Russen verdammt hart auf den Fersen. Hätten Sie den armen Jungen hier gefunden, hätte er unsere Position und unsere Absetzbewegung ausplaudern können. Ungut für uns, sehr ungut …“
Ich nicke.
Er hat recht, der Hauptmann.
In der Ferne höre ich das Rasseln von Panzerketten.
Wir waren zur Nachhut abkommandiert worden.
Wir sind die Letzten der Letzten.
Die Russen jagen uns nach.
Juli 1943.
Sie liegt gerade hinter uns.
Die größte Panzerschlacht der Geschichte.
Unternehmen Zitadelle.
Der letzte Versuch der deutschen Wehrmacht, im Osten den entscheidenden Sieg zu erringen.
Die neueste Generation an Panzern war hier bei Kursk erstmalig zum Einsatz gekommen, der ‚Panther’, der ‚Tiger’, der ‚Königstiger’.
Aber der Sieg blieb aus.
Zahlenmäßig um ein Vielfaches überlegen, rücken die russischen Armeen jetzt an allen Fronten vor und drohen die gesamte deutsche Heeresgruppe Mitte einzukesseln.
Was einen völligen Zusammenbruch der gesamten Ostfront zur Folge hätte.
Schweigend marschieren wir durch die endlose Weite.
Hinter uns die russischen Divisionen, vor uns eigene, versprengte Einheiten, die sich zurückziehen, neu formieren, um das Schlimmste abzuwenden.
Eigentlich bin ich Sanitäter.
Und dennoch trage ich ein schweres MG.
Denn ich bin ein Hüne, ein Schrank.
Ein Meter vierundneunzig athletisches Gardemaß.
Sie hatten mich in die SS stecken wollen, aber ich hatte dankend abgelehnt.
Das MG ist schwer, rund 10 Kilo, dazu trage ich noch die Munitionsgurte.
‚Knochensäge’ nennen die Landser das MG 42.
So falsch ist das nicht.
20 Schuss pro Sekunde feuert es aus seinem Lauf.
Wie viele Menschen mag ich damit niedergemäht haben?
Wie viel verstümmelt? Wie viele getötet?
Hunderte?
Bestimmt.
Von Anfang an war ich dabei, vom 22. Juni 41 an, dem Tag des Überfalls auf die Sowjetunion, dem Unternehmens ‚Barbarossa’.
Dabei, zusammen mit Millionen anderen deutschen Landsern.
Ich habe sie nicht mehr gezählt, die Schlachten, die großen Gefechte, die kleinen Scharmützel, die Nahkämpfe, die Verwundeten, die Toten.
Anfangs belastete es, anfangs hatte man noch Albträume.
Aber dann stumpfte man ab.
Schnell ging das, beängstigend schnell.
Und ich funktionierte.
Funktionierte als einfacher Soldat in einer Panzerdivision an der Ostfront, als Soldat, dem man die Sanitätstasche abgenommen und ein schweres MG umgehängt hat.
Weil ich so kräftig bin.
Oder weil MGs im Schützengraben wichtiger waren als Mullbinden.
Ja, bisher habe ich funktioniert.
Habe gemacht, was befohlen wurde.
Auf Punkt und Komma.
Bis jetzt eben.
Bis zu diesem Jungen.
Was war anders?
Seine Augen?
Seine Wehrlosigkeit?
Nie werde ich es vergessen.
Nie.
Wir erreichen ein brennendes Dorf, kaum größer als ein Weiler.
Wir bleiben in Deckung und beobachten es eine Weile.
Wir wissen nicht, wie und wo die Front verläuft, ob vielleicht schon die Russen da sind, uns überholt, eingekesselt haben.
Wir haben keinen Funk, keine Karten, keine Orientierung.
Es erscheint uns sicher, daher gehen wir langsam rein.
Ich halte das MG in der Hüfte, entsichert und schussbereit.
Jede der Hütten steht in Flammen.
Wir wissen, warum.
Verbrannte Erde.
So ist es befohlen.
Beim Rückzug alles zu zerstören, alles zu vernichten.
Alles abfackeln, auch dieses Dorf.
So nutzlos das sein mag.
Aber was ist schon von Nutzen in diesem abartigen Krieg.
Es ist nicht das erste Verbrechen, das ich in diesem Krieg erlebe.
Und dazu kommt noch das Munkeln.
Über die Dinge, die hinter der Front passieren, im ‚rückwärtigen Heeresgebiet’, wie es genannt wird.
Dinge, für die es keine Worte gibt.
„Was soll denn das bringen, warum machen wir das?“, fragt mich Hein und blickt auf die Flammen.
Die Frage könnte man sich hier häufiger stellen, jeden Tag, jede Stunde …
Ich zucke nur mit den Achseln.
Vor einem der lichterloh brennenden Häuser steht eine junge Bauersfrau.
Vor ihr liegen zwei tote Kinder.
Ein verbrannter Säugling.
Wie ein kleines, schwarzes Paket schaut er aus.
Abgestellt zur Abholung.
Daneben ein Kleinkind, ein Mädchen, vielleicht zwei Jahre.
Äußerlich unversehrt, ohne Verletzungen.
Wahrscheinlich erstickt.
Hein geht auf die Frau zu und reicht ihr die Hälfte seines Kommissbrots aus seinem Beutel.
Die Frau spuckt ihn an.
Beginnt gellend zu schreien.
Ihre Stimme hoch und schrill.
Ihr Klagen steigert sich zu einem Inferno.
Anklagend zeigt sie auf ihre toten Kinder, vor ihr auf der Erde.
Beschämt wenden wir uns ab und marschieren wortlos weiter.
Sie läuft uns nach.
Sie beschimpft uns gellend.
Ihr Schreien wird immer entsetzlicher, immer schriller.
Schreien.
Schreien.
Schreien.
Ein Rütteln.
Ein Schreck.
„Morgen Herbie! Aufstehen! Hast ja verpennt! Gibt ja gleich Frühstück!“
Die Stimme schrill und kreischend.
Ich zittere, bin orientierungslos, alles durcheinander.
Erst langsam, ganz allmählich gewinne ich Ordnung.
Ordnung.
Ordnung ist ganz wichtig.
Ich sammle mich langsam, atme tief durch.
Bettdecke, Zimmerwände, links das Fenster, rechts die Tür.
Vertrautheit.
Ich blicke auf den Wecker.
Halb acht.
Mühsam sortiere ich mich und rapple mich hoch.
Geht alles nicht mehr so schnell.
Bin ja 75 Jahre älter als in meinem Traum.
Der Traum…
Wohlbekannt ist er mir.
Geläufig.
Wieder und wieder träume ich ihn.
In den vergangenen, vielen Jahrzehnten.
Manchmal in Nuancen unterschiedlich, manchmal mit diesem oder jenem neuen Detail.
Aber im Grunde genommen bleibt er immer gleich.
Nie habe ich ihn vergessen.
Den Jungen, das Kind, mit den großen Augen.
Mit seinen Gedärmen in der Blutlache.
Wie er die Zigarette rauchte und nochmal für zwei Minuten glückselig war.
Auch anderes habe ich nicht vergessen aus dieser apokalyptischen Zeit.
Aus dieser Zeit jenseits der Worte.
Die immer wiederkehrenden Träume frischen es auf.
Mein seniles Gedächtnis.
Halten das Erinnern wach.
Lassen nicht vergessen.
Heute heiße ich übrigens gar nicht mehr Adeling.
Heute heiße ich Altmann.
Herbert Altmann.
Aber das ist eine alte und eine lange Geschichte.
Ich erzähl sie ein andermal.
Kreischen.
Schon wieder das Kreischen.
Schlimmer als jedes Weckergeläut.
„Los! Los! Raus aus den Federn! ’Kannst ja nach dem Frühstück noch mal pennen!
Jaqueline.
So heißt sie.
Sie, das Gör.
Die Pflegerin im heutigen Frühdienst.
Trotz meines Greisenalters kann ich mir ihren Namen merken.
„Komm jetzt bitte in die Pötte, Herbie!“
Ich staune.
Ich muss immer wieder staunen.
Darüber, dass Jaqueline – im Übrigen wie auch viele andere Pflegekräfte – mich permanent duzen.
Ich duze sie nie.
Aber es gibt größere Probleme, wenn man auf die Hundert zugeht.
Ich staune nochmal.
Über etwas anderes.
Über etwas, über das ich immer wieder staune.
Etwas, das ich nicht verstehe und nie verstehen werde.
Jaquelines junges, grade mal zwanzigjähriges Gesicht.
Von Natur aus ansehnlich, äußerst hübsch und anziehend.
Von Natur aus ist es so.
In der Realität, jetzt und hier, wo ich es betrachte, ist es ganz gar und nicht so.
So finde ich es.
Aber das liegt wohl in der Natur des Betrachters.
Ich habe immer wieder versucht, sie zu zählen.
Wieder und wieder, aber es gelang mir nie.
Es müssen über ein Dutzend sein.
Metallsplitter, Metallnadeln, Metallringe.
An jedem nur erdenklichen Ort in diesem Gesicht.
‚Piercings’ nennt man es heute, so wurde mir gesagt.
Warum um Himmels willen macht man das?
Ich werde alt …, denke ich und muss schmunzeln.
Dann schlupfe ich mit meinen 96-jährigen Füßen mühsam in die Pantoffeln.
„Was gibt’s zu grinsen, Herbie?“
Ich schüttle den Kopf.
Ich muss nicht auf alles antworten.
Ich muss nicht alles verstehen.
In vier Jahren wäre ich Hundert …
Herbert Altmann ist ein alter Mann.
„Stuhlgang, Herbie?“
Jacqueline steht inquisitorisch mit meiner Akte vor mir und zeigt mit dem Kugelschreiber wie mit einer Waffe auf mich.
Eine prinzipiell nicht unwichtige Frage bei betagten Menschen.
Aber jetzt und in diesem Moment einigermaßen dämlich, wie ich finde.
„Jacqueline, ich bin erst vor zehn Sekunden aufgestanden, nachdem Sie mich so liebenswürdig geweckt haben …“ Ich grinse. „Daher ist die Frage verhältnismäßig leicht zu beantworten.“
„Ach, ich muss diesen Scheiß hier ausfüllen, das weißt du doch. Das System will es so!“
Das ist einer ihrer Lieblingssätze.
Das System.
Das System, in dem ich mich befinde.
Altenheim.
Herbert Altmann ist im Altenheim.
Was für ein Wortspiel …
Ein Insasse bin ich.
In diesem System hier.
Man nennt uns ‚Bewohner’.
Klingt irgendwie besser.
Ist es aber nicht.
Ich sehe in meine aufgeschlagene Akte.
Meine Medikamente, meine Blutdruckwerte, meine Pulsfrequenzen.
Oben rechts in der Ecke zwei Lichtbilder von mir.
Porträtaufnahmen, von vorn und von der Seite, wie bei Verbrechern.
Die Photos haben sie letztes Jahr eingeführt, von jedem Bewohner finden sie sich in der Akte.
Es gab zu viele Flüchtige.
Meist demente Bewohner, die ausgebüxt waren und von der Polizei gesucht werden mussten.
Die Photos erleichtern die Suche.
Dennoch schüttle ich unmerklich den Kopf.
Wie ich ausschaue auf den Bildern … Standardisiert aufgenommen wie für die Verbrecherkartei …
Ich starre auf meine Photos.
Schauen aus wie Totenschädel …
Kaum Haare, kaum Fettgewebe oder Muskulatur.
Die faltige Haut eng auf den Knochen aufgespannt.
Die Augen in tiefen Höhlen, der Mund ein wenig schief.
Früher war ich mal recht hübsch gewesen.
„Kommst du im Bad alleine klar? Dann kann ich schon mal weiter!“, schnarrt Jacqueline.
Ich nicke.
„Mach aber hinne, sonst wird der Kaffee kalt!“
Erneutes Nicken.
„Brauchste den Rolli?“
Kopfschütteln.
Das Laufen geht noch erstaunlich gut bei mir.
Hab ja Übung darin.
Aus Russland.
*
Hilfsmittelfrei erreiche ich den Speisesaal.
Er liegt auf der gleichen Etage des fünfstöckigen Heims.
Das hat Vor- und Nachteile.
Wie vieles im Leben.
Äußerlich mutet er wie eine billige, heruntergekommene Kantine an.
Einfaches, grobes Möbel in hässlichen Orangetönen.
Die Farbe assoziiert Erbrochenes.
Aber die Oberflächen sind gut zu reinigen und zu desinfizieren.
Das ist nicht ganz unwichtig hier.
Manchmal wird es auch gemacht.
Am Schwarzen Brett blicke ich auf den Wochenaushang des Speiseplans.
Heute ist Freitag.
Dass ich das weiß, unterscheidet mich vom Gros der Bewohner hier.
Ich sage es keineswegs überheblich oder borniert.
Es ist lediglich ein Sachverhalt.
Ein trauriger.
Es ist keineswegs mein eigener Verdienst oder meine Leistung, dass ich noch über halbwegs Verstand verfüge.
Es ist ein Geschenk.
Manchmal auch eine Bürde.
Die Frühstücksrubrik ist uninteressant, hier gibt es immer das gleiche.
Wenngleich andere Formulierungen und Bezeichnungen aufgeführt sind.
Heute Mittag: Seelachs, paniert, mit Kartoffelsalat und Remouladensoße.
Das Fischstäbchen für Erwachsene.
Die Remoulade muss ich weglassen, sie verursacht mir Bauchschmerzen.
Ich habe Erfahrungswert.
Außerdem ist sie gefährlich.
Manchmal lebensgefährlich, für uns Greise.
Habe ich eigentlich schon gestern auf den Speiseplan geschaut?
Weiß ich nicht mehr.
Derlei Inhalte behalte ich nicht mehr über Nacht.
Auf dem Aushang prangt das Logo dieser Einrichtung.
‚Residenz am Park’ will sie genannt sein.
Ich muss lachen.
Das eine Substantiv so falsch wie das andere.
Der ‚Park’ ist eine trostlose, ungepflegte Anlage, mit schmutzigem Grün und viel Asphalt, die überwiegend als Hundekackplatz von den Anwohnern und zum Drogenverkauf von lichtscheuen Zwielichtigen genutzt wird.
‚Residenz’ Noch lächerlicher.
Eine Verwahranstalt ist das hier.
Ein Wartezimmer des Todes.
Jeder der Bewohner wird hier sein Ende erleben.
Jeder, ohne Ausnahme.
Niemand zieht mehr von hier weg, niemand wechselt mehr den Ort oder gar die Stadt.
Jeder hat hier zu bleiben.
Endgültig, bis zum Schluss.
Es besteht für uns Bewohner ‚Residenzpflicht’.
Von daher ist der Name unserer Wohnstatt hier in gewisser Weise doch stimmig.
Nicht nur der lächerliche Name unserer Einrichtung, auch das Logo bringt mich in steter Regelmäßigkeit zum Lachen.
Es ziert ein stilisiertes Schloss, das keinerlei architektonische Gemeinsamkeit mit unserem potthässlichen Zweckbau aus den Siebzigern hat.
Die Lügen fangen hier schon mit dem Namen und dem Logo an.
Es sind bei weitem nicht die einzigen und nicht die schlimmsten.
Ich setze mich zu Julian.
Auch er ist ein ‚Neunziger’.
Er doziert gerade.
„Guten Morgen“, sage ich leise.
Julian referiert ohne Unterbrechung weiter.
Er sitzt allein am Tisch.
Niemand hört ihm zu.
Am Buffet nehme ich mir ein Gummibrötchen und etwas Marmelade, von der ich nicht weiß, nach welcher Frucht sie schmeckt und auch nicht, welche Frucht sie vorgibt, nach der sie schmecken sollte und auch nicht, ob sie überhaupt eine natürliche Frucht enthält.
Jedenfalls ist sie rot.
Den Wurstaufschnitt meide ich, er ist heute noch schmieriger als sonst und an den Rändern bedrohlich angedunkelt.
Die normiert quadratischen Käsescheiben sehen aus wie Bierdeckel.
Darf ich mich beklagen?
Ja.
Das Heim kassiert mehrere Tausend Euro monatlich für meinen Aufenthalt hier.
Nein.
Vor 75 Jahren in Kursk hätten wir uns die Finger danach geleckt.
Und es gibt nicht wenige Menschen auf der Erde, die das heute noch immer tun würden.
Ivanka, die Pflegekraft und heutige Herrscherin über den Speisesaal schenkt mir Kaffee in eine große, klobige Plastiktasse ein.
Muckefuck ohne Koffein.
Ich nicke ihr dankend zu.
Ihr scharfkantiges Gesicht ähnelt dem der Bauersfrau vor ihren toten Kindern …
„Guck, dass dein Freind was isst!“, fordert sie mich mit ihrer gutturalen Stimme auf und schwenkt ihren massigen Kopf wie ein Pferd in Richtung Julian.
„Er rädet nur! Isst nicht!“
Ich weiß es.
Ich komme mit meinem Tablett zurück an den Tisch.
Sein Vortrag ist noch nicht zu Ende.
Doktor Julian Dörflinger.
‚Dörfi’ nennen ihn die Pflegekräfte.
Er gehört zu den wenigen Menschen in dieser absonderlichen Welt, dieser Welt, von der ich früher nichts wusste und nichts ahnte und vor allem nie dachte, dass ich ihr eines Tages angehören würde, und zwar unwiderruflich, bis zum Ende, Julian gehört in diesem Kosmos zu den wenigen Menschen, mit denen mir ein menschlicher Austausch vergönnt ist.
Ein Drittel in dieser Welt hier ist nahezu taub, ein weiteres Drittel mehr oder weniger dement, und einen nicht unbeträchtlichen Teil bekomme ich gar nicht zu Gesicht.
Die schlimmsten Pflegefälle, Menschen, die nur noch im Bett vegetieren.
Die Ärmsten der Armen.
Man sieht sie nicht.
Man hört sie nur.
Vor allem nachts.
Ich stelle mein Tablett ab und setze mich.
Julian schaut mich den Bruchteil eines Augenblicks an, er scheint mich zu erkennen, ich bin mir aber nicht sicher, dann fährt er unbeirrt und mit kräftiger Stimme fort.
„Die Planck-Ära bezeichnet den Zeitraum nach dem Urknall bis zur kleinsten physikalisch sinnvollen Zeitangabe, nämlich der so genannten 'Planck-Zeit'. Sie beträgt 10-43 Sekunden und stellt das kleinstmögliche Zeitintervall dar, für das die bekannten Gesetze der Physik gültig sind.“
Julians Blick schweift in das weite Rund.
Knapp zwei Dutzend Tische umgeben ihn, die meisten mit Bewohnern besetzt.
Ein Teil sitzt in Rollstühlen stoisch vor den Tabletts ohne zu essen, ohne zu reden, ohne irgendetwas äußerlich Erkennbares zu tun.
Sie sitzen einfach da.
Man hat sie einfach hingeschoben.
Niemand füttert sie.
Ivanka ist noch am Buffet zugange, sie wird nachher, wie ich weiß, den Hilflosen im Schnelldurchgang hastig ein paar Happen in den Mund schieben, manchmal drücken, manchmal pressen.
Ein mechanischer Vorgang, der bei jedem kaum eine halbe Minute dauert.
Es gibt nicht mehr Pflegepersonal, diese Ressource ist sehr knapp, wird postuliert.
Aber nicht nur die gänzlich Hilflosen, die völlig passiv stoisch an den Tisch abgestellten Bewohner, beachten Julian nicht.
Niemand tut es.
Auch nicht die, die mehr schlecht als recht mit den Herausforderungen des Essens kämpfen.
Und auch nicht die, die noch körperlich und geistig ein gewisses Maß an Rüstigkeit besitzen.
Nur ich höre ihm zu.
Nur ich allein.
Auch wenn ich den Vortrag bereits auswendig kenne.
Jeden Satz, jedes Wort.
„Daher können wir uns also fragen: ‚Wie sah das Universum 10-43 Sekunden nach dem Urknall aus, aber nicht früher! Denn die Planck-Zeit ist die allerkleinste Zeitspanne, die es gibt! Sie ist definiert als diejenige Zeit, die das Licht benötigt, um eine Planck-Länge zurückzulegen, und Sie erinnern sich, verehrte Kollegen, dass dies die kürzeste Distanz darstellt, die in der Physik möglich ist. Kürzer geht nicht …“
Ich blicke auf Julians Teller.
Er ist einigermaßen verwüstet.
Reste eines Honigbrötchens.
Es schaut aus, als sei es zerrissen worden, größere und kleinere Brocken liegen verstreut auf und neben dem Teller.
Zerrissen wie von einem Tier.
Manchmal sind wir hier so.
Wie Tiere.
Oft werden wir aber auch so behandelt.
Wie Tiere.
„Bei kleineren Zeitintervallen als der Planck-Zeit verlöre die Zeit ihre vertrauten Eigenschaften als Kontinuum. Sie würde quantisieren, das heißt die Zeit liefe unterhalb der Planck-Zeit in diskreten Sprüngen ab und nicht mehr kontinuierlich. Daraus folgt, dass jedes Objekt, welches einen Vorgang kürzer als die Planck-Zeit durchlebt, zu einer Singularität wird. Können Sie folgen?“
Julian blickt sich um und lächelt.
Souverän wirkt es, sein Lächeln.
Grotesk ist es, in diesem schrecklichen Speisesaal.
Aus Lautsprechern neben dem Buffet dröhnt unangenehm laut grauenvolle Volksmusik.
Meistens so beim Essen hier.
Es übertönt das Stöhnen und Brabbeln, übertüncht das Schreien.
Ich schaue zu den Menschen an den Tischen, meinen Schicksalsgenossen hier.
Es müffelt aus den undichten Urinbeuteln.
Eine Schnabeltasse fällt zu Boden, Muckefuck spritzt heraus.
Ivanka flucht auf Russisch.
„Also wie ich sehe, bestehen keine Fragen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir setzen die Vorlesung morgen thematisch mit der Singularität und ihrer zentralen Bedeutung in Schwarzen Löchern und beim big bang fort.“
Julian deutet eine kurze Verbeugung an.
Er hört den Beifall, das akademische Klopfen.
Seine Augen leuchten.
„Guten Appetit, Julian.“
Erstaunt mustert er mich, dann blickt er noch erstaunter vor sich, auf seinen verwüsteten Teller, er scheint kurz nachzudenken, dann greift er blitzartig nach Brötchenbrocken, stopft sie sich nacheinander in seinen Mund und beginnt mit seiner schauerlich schlecht passenden Zahnprothese darauf zu malmen.
„Gut geschlafen, Herbert?“, fragt er mich aufgeräumt.
Er ist wieder da.
Wieder zurück.
Das freut mich.
Denn jetzt kann ich mich mit ihm ein wenig unterhalten, mit meinem Freund, dem Physiker Doktor Julian Dörflinger.
*
Wir räumen unsere Tabletts ab, ernten dafür Ivankas Dank in Form eines angedeuteten Lächelns und tappen zurück in unseren Flur.
Der Speisesaal trennt im dritten Obergeschoss den Flur in einen Ost- und einen Westteil.
Wir sind im Westen.
Im ‚Luxusflur’, wie er genannt wird.
Wobei Luxus, wie so vieles im Leben, sehr relativ ist.
In unserem Stock sind die Bewohner des so genannten ‚Betreuten Wohnens’ untergebracht.
Wir besitzen neben einer geringen Eigenständigkeit ein verhältnismäßig großzügiges, geräumiges Zimmer mit einem kleinen Vorraum und einem Bad.
Das bei weitem bedeutendste Privileg besteht darin, dass wir alleine in diesem Zimmer wohnen.
Nahezu alle anderen Heimbewohner hausen zu zweit in kargen Gelassen, manchmal wird aus Platznot zeitweilig noch ein drittes Bett eingeschoben.
Je nachdem, mit wem man das Zimmer teilt, kann das durchaus äußert unkomfortabel sein, vor allem nachts.
Selbstredend bezahlen wir für unsere ‚Luxuszimmer’ mit dem Privileg der erhaltenen Privatsphäre.
Und das nicht zu knapp, sie sind sehr kostspielig.
Dafür könnte ich eigentlich auch in einem eleganten Hotel leben.
Julian wohnt drei Zimmer weiter.
Auf unserem Flur begegnen wir einem Neuen.
Ein Mann, eher einem Männchen, denn er ist überaus klein, selbst für unsere Verhältnisse (die Körperhöhe schrumpft beträchtlich im Senium).
Ein wenig ratlos steht er verloren da, nestelt an seiner viel zu großen Brille herum, die ihn noch kleiner erscheinen lässt.
Ich mustere ihn.
Ein schlohweißer Haarkranz umgibt einen nahezu elliptischen Schädel, seine Bekleidung ist recht sauber, er trägt ein älteres Jackett, ich taxiere das Männchen auf unsere Altersklasse.
Ich habe ihn noch nie hier bei uns gesehen.
Und ich bin schon eine Weile hier.
Das Männlein erblickt uns und stürmt auf uns zu. „Guten Morgen, die Herren. Arndt mein Name, Frieder Arndt.“ Er lächelt freundlich und drückt uns überraschend kräftig die Hand. „Ich ziehe heute hier ein!“
„In die ‚325’“, wispert mir Julian leise zu. „Da ist doch frei geworden“.
Frei geworden …
Der hiesige Terminus technicus für Verstorben.
Der nahezu einzige Mechanismus, durch den eines der Zimmer frei wird.
Der Tod ist der einzige Ausgang aus dieser Anstalt.
„Willkommen.“ Wir stellen uns beide vor.
„Der früher Vogel fängt den Wurm“, lächle ich. „Sie sind ja ganz schön zeitig hier.“
Es ist noch nicht einmal neun Uhr.
„Sie haben mich heute Morgen recht früh aus dem Krankenhaus entlassen.
Sie brauchten dringend Betten, da musste plötzlich alles hopplahopp gehen …“
Julian und ich blicken uns kurz an.
Wir verstehen.
Wir wissen, wie’s läuft.
„Haben Sie denn wenigstens noch das Frühstück in der Klinik bekommen?“, frage ich ihn.
„Äh, ja, so ganz kurz … So zwischen Tür und Angel. Es war alles etwas hektisch.“
Wir verstehen.
„Aber ich hatte ohnehin keinen so großen Appetit. Wissen Sie, dieser Tag heute … Der ist für mich kein so leichter …“
Wir wissen.
Wir wissen es sogar sehr genau.
Wir stehen unschlüssig auf dem Gang, es riecht nach scharfen Putzmitteln, das Gespräch ist versiegt.
„Das Umzugsunternehmen kommt mit meinem Mobiliar erst um die Mittagszeit, hieß es“, beginnt Herr Arndt wieder.
Ich fasse einen Gedanken. „Mein Freund und ich machen noch kurz Morgentoilette und würden dann zu einem kleinen Spaziergang aufbrechen.
Möchten Sie uns begleiten?“
„Nicht weit. Nur ‚hinters Haus’“, ergänzt Julian.
Hinters Haus.
Die hiesige Bezeichnung für das schäbige Gelände, das fälschlicherweise ‚Park’ genannt wird.
„Oh fein, gerne! Ich habe bis Mittag ohnehin nichts zu tun!“
Das wird Ihnen hier noch öfter so gehen …
Ich lege meine Zahnprothesen in die Reinigungslösung und setze mich auf den Thron.
Nach einigen Minuten gebe ich auf.
In meinem früheren Leben habe ich mich einen Scheißdreck ums Scheißen geschert.
Wenn ich scheißen musste, schiss ich.
Fertig.
Mit Ende achtzig hatte es angefangen.
Langsam wurde es schwieriger.
Und mit jedem weiteren Jahr stetig mühseliger.
Oft klappt es nur mit Medikamenten.
Aber ich darf nicht klagen.
Bei Julian helfen nicht mal die.
Schon mehrmals musste er ausgeräumt werden.
So nennen sie das hier.
Ausgeräumt.
‚Skybala’ hatten sich bei Julian gebildet, Kotsteine.
Er war so verstopft, dass sie Pjotr holten.
Den hiesigen Experten für diese Angelegenheit.
Pjotr ist der Ausräumer.
Er räumt aus.
Mechanisch.
Mit seinen Fingern und mit allerlei Werkzeug.
Es ist nicht sonderlich angenehm.
Aber was ist das hier schon, in dieser Welt?
Pjotr, einer der rohsten und aggressivsten Pfleger, scheint sein krudes Werk Freude zu bereiten.
Mir ist nicht klar, ob es reiner Sadismus ist, Spaß daran, die Menschen zu quälen.
Oder eine abartige … eine perverse Freude an…der Sache per se.
Eine Koprophilie…
Gibt es das überhaupt?
Hier gibt es so manches, von dem ich zuvor nie gedacht habe, nicht einmal geahnt habe, dass es Realität ist.
Traurige Realität.
Julian und ich kommen zeitgleich aus unseren Zimmern.
Frieder Arnd liest am Schwarzen Brett.
„Heute Nachmittag zeigen sie das WM-Endspiel Deutschland – Ungarn von 54! Klasse!“
Mein Freund und ich schauen uns an.
Wir rollen mit den Augen.
Als wären wir achtzig Jahre jünger und Teenager.
Herr Arndt registriert unsere Reaktion. „Oh … Sind Sie nicht fußballbegeistert?“
„Doch, doch. Durchaus“, antworte ich. „Allerdings habe ich dieses Spiel schon genau zwei Dutzend Mal in voller Länge gesehen. Ein Mal live, 1954, in einer drängelnden Menschentraube vor dem Schaufenster eines Fernsehgeschäftes. Und dann 23 Mal hier in dieser Einrichtung.“
Herr Arndt blickt verdutzt.
„Sie müssen wissen“, erläutert Julian, „das so genannte Unterhaltungsprogramm für die Bewohner hier folgt einem festgelegten Turnus. Das 54er-WM-Spiel ist beispielsweise alle vier Wochen freitagnachmittags dran.“
Eine hier beliebte, da wenig arbeitsaufwändige Technik des Programms für uns.
Glotze an, Ton auf Maximallautstärke, Rollis davor gekarrt und fertig.
„Sie werden den turnusmäßigen Ablauf des immer wiederkehrenden Unterhaltungsprogramms noch aus eigener Anschauung kennen lernen“, fährt Julian fort. „Es ist ähnlich wie das Animationsprogramm in einem Urlaubshotel. Nur mit dem Unterschied, dass die Gäste hier immer die gleichen bleiben.“
„Oh.“ Der kleine Herr Arndt blickt ernüchtert.
Ich selbst werde aber trotzdem das Spiel anschauen.
Auch zum 24. Mal.
Auch wenn ich mittlerweile jedes Detail jedes Spielzugs, und jeden Satz, jedes Wort, jede Nuance in der Stimmlage des Kommentators Herbert Zimmermann kenne.
Die Vorführung des WM-Spiels hat neben dem geringen Arbeitsaufwand für das Personal noch einen anderen, einen weiteren günstigen Effekt.
Nicht wenige der Zuschauer haben lebhafte Freude an der Darbietung.
Und zwar wieder und wieder.
Die dementen unter unseren Bewohnern zittern und bibbern für die deutsche Mannschaft, stöhnen bei den Toren der Ungarn und jubeln lauthals bei den deutschen.
Sie sehen alle vier Wochen ein Fußballspiel.
Jedes Mal ist es für sie ein neues.
Nichts bleibt ihnen in Erinnerung.
Sie leben nur noch in der Gegenwart.
Was früher war, ist vergessen, was kommen mag, ist ohne Bedeutung.
Nur noch Gegenwart, nur noch Präsens.
Irgendwie praktisch.
Das immer gleiche Spiel ist für sie immer wieder gleich spannend.
Vielleicht haben es diese Bewohner besser als ich.
Sie schauen ein für sie unterhaltsames Spiel, während ich dröge vor dem Schirm sitze und über die Trostlosigkeit sinniere.
Wir nehmen den Aufzug nach unten.
In der muffigen Eingangshalle stehen einige Bewohner in ihren Rollis beisammen.
Einige in sich zusammengesunken, den wirren Kopf auf der Brust, die meisten mit leerem Blick.
Einige sprechen, mehr oder weniger sinnvoll, leise mit anderen.
Oder psalmodierend mit sich selbst.
Ich begrüße Eddie, einer unserer Jüngsten.
Er ist erst Anfang fünfzig.
Ein Schlaganfall hatte ihn aus seinem Leben katapultiert, außer seiner Halbseitenlähmung leidet er seitdem an einem bösartigen Krampfleiden, das kaum auf Medikamente anspricht.
Da er ständig Anfälle erleidet und oft stürzt, trägt er einen riesigen, beinahe medizinballgroßen Sturzhelm in einem spezialangefertigten Rollstuhl mit allerlei Polsterungen.
Es schaut aus, als sei Eddie der waghalsige Pilot eines abenteuerlichen Höllengefährts.
Julian meldet uns drei bei der Pförtnerin zum Spaziergang ab.
Wie junge Pennäler bei ihrem Klassenlehrer.
„Warum tun Sie das?“, fragt Herr Arndt neugierig. „Ist das Vorschrift?“
„Ja.“
„Das ist ja fast wie im Gefängnis …“ Frieder Arndt lacht lauthals.
„Es ist ein Gefängnis.“ Meine Replik ist schärfer als beabsichtigt. „Mein Freund und ich haben das große Glück, Freigänger zu sein. Dieses Privileg haben bei weitem nicht alle hier.“
„Das ist jetzt nicht Ihr Ernst ...“ Herr Arndt lacht immer noch. „Das wäre ja Freiheitsberaubung. Das können sie ja nicht machen!“
Sie können es.
Sie machen es.
Und sie machen noch ganz anderes hier.
„Es kam vor, dass geistig verwirrte, aber körperlich noch behände Bewohner unkontrolliert in die Stadt ausbüxten. Die Suche durch Personal und Polizei war zum Teil sehr aufwändig. Daher diese Regelung.“ Julian hat einen ruhigeren Ton angeschlagen, Herr Arndt blickt verstehend und scheinbar etwas erleichtert.
Wir gehen zu dritt nebeneinander, jungen Backfischen gleich, über den mit Unkraut durchsetzten und mit Hundekot übersäten Kiesweg. Auf dem schäbigen Rasen liegen massenhaft Kippen und Bierflaschen, hier und da auch Spritzen.
Die Vormittagssonne wärmt angenehm, es scheint ein schöner Frühlingstag zu werden.
Aus der nahen Innenstadt brandet Verkehrslärm.
„Hatten Sie eine ernsthafte Erkrankung, wenn Sie mir die Frage gestatten?
Und: Sind Sie wieder genesen?“
Mann Julian … Mit fast Hundert ist jede Erkrankung ernsthaft und jeder Klinikaufenthalt ein Himmelfahrtskommando.
„Ich hatte eine schwere Lungenentzündung. Die Antibiotika griffen zunächst nicht und mussten mehrfach gewechselt werden. Ich war fast drei Wochen stationär.“
Glück, dass du noch mal raus kamst.
Und sogar stehenden Fußes.
Aber wieso bist du hier gelandet?
Hier in dieser Vorhölle.
„Jetzt geht es wieder. Zumindest körperlich …“ Über Herrn Arndts Augen legt sich ein Schatten.
Wir setzen wortlos unseren Gang fort.
Unseren Gang über die verdreckten Wege, noch immer zu dritt nebeneinander, beinahe im Gleichschritt.
Aber nur beinahe.
Denn immer wieder muss einer von uns einem Scheißhaufen ausweichen.
Auf einer der wenigen noch intakten Bänke sitzen zwei tuschelnde Halbwüchsige.
Wahrscheinlich Schulschwänzer.
„Darf ich fragen“, hakt Julian behutsam nach, „weshalb Sie in unsere Einrichtung kommen? Sie wirken körperlich und geistig recht rüstig. War es Ihr eigener Entschluss?“
Wohl kaum!
Mensch Julian, was für eine naive Frage …
Er wäre der erste hier, der freiwillig hier einzieht.
Herr Arndt zuckt zusammen.
Sein Schritt stockt.
„Verzeihen Sie bitte diese sehr persönliche Frage …“ Ich versuche, Sanftheit in meine Worte zu legen. „Jeder hier hat seine Geschichte. Aber bis auf einige Ausnahmen haben wir wenige Geheimnisse voreinander. Wir sind eine Gemeinschaft hier. Eine Schicksalsgemeinschaft.“
„Ja, verzeihen Sie bitte“, ergänzt jetzt auch Julian. „Sie müssen uns nicht antworten. Es geht uns im Grunde genommen nichts an.“
Herr Arndt ist merklich durcheinander, er findet keine Worte.
Wir spazieren weiter, immer im Kreis um die trostlose Grünfläche mit ihrem Unrat und den verlotterten, kranken Bäumen.
Die beiden Jugendlichen auf dem Bänkchen mustern uns, widmen sich dann aber ihren Smartphones.
In Herrn Arndt arbeitet es, ich sehe es in seinem Gesicht, er beginnt, kurzatmig zu keuchen.
Mensch, Julian … Du warst auch schon feinfühliger …
Der Mann ist in letzter Not dem Sensenmann entronnen und jetzt gerade mal eine Stunde in diesem grandiosen Etablissement.
Und du bombardierst in gleich mit schwerstem Geschoss.
Frieder Arndt beginnt zu sprechen.
Mit harter Stimme presst er seine Worte heraus.
Schleudert sie gesenkten Hauptes dem verdrecken Boden entgegen.
„Ich bin im 89. Lebensjahr. Vierzig Jahre lang habe ich Autos verkauft und redlich und auch nicht wenig Geld verdient. Vor sechs Jahren hat mich meine Frau verlassen. Sie ist erheblich jünger als ich, wollte nicht mehr bei einem Greis bleiben. Sie ist mit einem Jüngeren durchgebrannt. Ihr Recht und mein Pech. Ich hätte es vorher wissen müssen: Der große Altersunterschied …“
Herr Arndt atmet schwer.
Aber das brachte dich noch nicht ins Heim …
„Ich habe das Haus verkauft, eine kleinere, nette Wohnung bezogen und allein gelebt. Ich habe mich selbst versorgt und bin gut zurecht gekommen.
Ich war mein Leben lang gesund. Bis vor drei Wochen …“ Er macht wieder ein Pause.
„Nach über einem halben Jahrhundert kam ich das erste Mal wieder in ein Krankenhaus. Eine zugegeben ziemlich neue Welt für mich …“
Das wird es hier in dieser Einrichtung auch noch sein für dich ...
Herrn Arndts Antlitz wird verhärmt.
Seine Augen blitzen.
„Ich habe einen Sohn. Er ist Geschäftsführer eines gut gehenden Unternehmens, weit weg, in Hamburg. Immer sehr beschäftig. Kaum je zu Besuch. Unsere wenigen Telefonate hastig und wie eine Last für ihn. Der Kontakt war in den letzten Jahren recht spärlich. Nicht einmal an Weihnachten sahen wir uns, da jettete er mit seiner eigenen Familie immer um den Globus. Manchmal vergaß er sogar meinen Geburtstag.“
Willkommen im Club.
„Nun ja, als es nicht so gut mit mir stand, opferte er ein wenig seiner kostbaren Zeit und kam zu einem einzigen, knappen Besuch zu mir in die Klinik.
Eine lächerliche halbe Stunde …“
Herr Arndt senkt den Kopf noch tiefer.
„Er konferierte kurz mit den behandelnden Ärzten, die ihm wohl unter anderem sagten, sie hätten den Eindruck, mit meiner Ernährung stehe es möglicherweise nicht zum Besten. Sie hatten Vitamin- und Eisenmangel bei mir festgestellt.“
Das muss nicht vom Speiseplan herrühren. Es kann auch ein Problem der Verdauung sein, eine Malresorption zum Beispiel.
„Nun ja, ich hatte mir ab und an Konserven zubereitet oder Fertiggerichte.
Ich bin kein so großer Koch und wenn man allein lebt, macht man sich kein Festmahl.“
Nachvollziehbar.
Auch aus eigener Anschauung.
„Ich erfuhr es erst hinterher, aber die Ärzte führten gegenüber meinem Sohn auch aus, ich sei 'umtriebig' und ab und zu 'etwas durcheinander'.“
Bei einer schweren Pneumonie und hohem Fieber mit 89 Jahren darf man auch mal etwas durcheinander sein ...
„Aber Sie müssen wissen, meine Herren, ich konnte in der Klink des Nachts kaum schlafen. Schon tagsüber lag ich ja schon die ganze Zeit im Bett und war infolgedessen kaum ermüdet. Daher brachte ich in dem Vierbett-Zimmer mit den teils sehr unruhigen Mitpatienten in der Nacht kaum ein Auge zu. Da bin ich bisweilen nachts ein wenig aus dem Zimmer und auf dem Klinikflur auf und ab gegangen. Ich dachte, das störe keinen …“
Herr Arnd hält inne und bleibt stehen.
Er blickt nach oben, in den diesig blauen Himmel.
In seinen Augenwinkeln sehe ich Tränen.
Dann schaut er wieder zu Boden. „Tat es aber doch. Die Nachtschwester störte es offensichtlich sehr und sie echauffierte sich darüber. Ich zog mir wohl ihren Unbill zu, sie verständigte den Dienstarzt, der mich rüde anherrschte.“
Business as usual, nachts in deutschen Kliniken.
Ich weiß es.
Nicht nur aus Erzählungen.
„Daraufhin verabreichten sie mir, ohne mir davon was zu sagen, starke Beruhigungsmittel. Ich wusste nichts davon, ich nahm regelmäßig und folgsam die Tabletten, die sie mir in meinem Schälchen auf den Nachttisch stellten.“
Klasse ...
„Ich wurde davon ziemlich dämmrig und döste nur noch in meinem Bett vor mich hin. Die Nachtschwester war zufrieden.“ Herr Arndt bleibt wieder stehen und schaut wieder gen Himmel.
Seine Stimme wird schwerer, seine Worte langsamer. „Dann, eines Morgens, ich weiß nicht mehr genau an welchem Tag, es war jedenfalls noch recht früh, tauchte ein Oberarzt an meinem Bett auf. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen, er war nicht aus der Inneren Abteilung. Ich hatte noch in meinem Dämmer tief geschlafen und wurde von ihm geweckt. Der Oberarzt hatte sich einen Stuhl genommen und saß wie ein Besucher neben meinem Bett.“
Herr Arndt hustet trocken. „Ich war noch kaum richtig wach, da saß dieser Mensch da … Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis mir klar war, aus welcher Fachabteilung er kam. Aus der Psychiatrie …“
Frieder Arndt bleibt wieder stehen. Tränen laufen ihm die zerfurchten Wangen herab. „Und ich habe viel zu spät erkannt, was der Zweck seines Besuchs war.“
Wir drei gehen wieder langsam weiter.
Julian und ich halten Herrn Arndt zwischen uns sanft am Arm.
„Sie haben ihn geschickt, um mich zu begutachten.“ Er zieht ein Stofftaschentuch aus der Hose und schnäuzt sich. „Um zu prüfen, ob ich denn noch alleine leben könnte. Wo ich mich doch so mangelhaft ernähren würde und hier auf Station zeitweilig so durcheinander sei. Ich vermag mich nicht mehr exakt zu erinnern, aber ich glaube, der Oberarzt war keine Viertelstunde bei mir am Bett.“
Eine Viertelstunde, in der sich alles entschieden hat.
„Sie müssen verstehen, ich war von den vielen Beruhigungsmitteln, die ich tagsüber, aber vor allem am Vorabend bekommen hatte, noch recht verhangen und dämmrig, so dass meine Antworten in den kurzen Gespräch wohl nicht zu seiner Zufriedenheit ausfielen.“
Wir verstehen.
„Er verabschiedete sich dann recht förmlich. Und empfahl in meinem Kasus die Heimunterbringung.“ Frieder Arndt kickt überraschend vehement gegen eine leere Bierflasche auf dem Kiesweg.
Erstaunt sehen wir, wie weit sie über den Rasen rast, um dann in einem Gestrüpp zu verschwinden.
Die Halbwüchsigen schauen auf.
„Mir war zunächst nicht klar, was es mit dieser Visite in aller Herrgottsfrüh auf sich hatte. Mir war nicht klar, welches Schicksal es für mich implizierte …“
Wir verstehen es.
Wir verstehen es sehr gut.
„Wie gesagt, ich war ja noch völlig dämmrig von den vielen Beruhigungsmitteln. Wie ich hinterher erfuhr, gaben sie mir die auch tagsüber. ’War ja auch viel bequemer für das Klinikpersonal mit dem dauerdösenden Herrn Arndt, der nicht viel fragt, nichts verlangt, nicht mehr herumgeht, der nur noch brav in seinem Bettchen liegt …“
Julian und ich drücken Herrn Arnd fester zwischen uns.
„Irgendwann tauchte dann eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes der Klinik auf. Eine recht garstige Person. An Details unseres kurzen Gesprächs erinnere ich mich nicht mehr, ich war ja weiterhin benebelt. Nur eines blieb mir in Erinnerung …“ Frieder Arndt bleibt wieder stehen. „Wie sie beim Gehen einer Krankenschwester zurief: ‚Der Fall ist klar! Der Vadder da muss ins Heim!’“
Bin ich erschrocken, erschüttert?
Nein.
Ich habe mich an diese Form der Rhetorik seit geraumer Zeit gewöhnen müssen.
Aber es tut weh.
Jedes Mal.
Es ist eine Form der Schäbigkeit, der Respektlosigkeit, des Raubs jeglicher Menschenwürde, für die ich keine Worte mehr finde.
„Was sagte denn ihr Sohn zu all dem?“, fragt Julian.
Frieder Arndt macht eine resignierende, wegwerfende Handbewegung. „Ich vermute, dass er sogar die ganze Idee ins Rollen gebracht, dass er die Begutachtung initiiert hat. ’Ist ja auch bequem für ihn. Er sitzt fett in seiner Villa in Blankenese, beteiligt sich finanziell an den Kosten und muss sich ansonsten um nichts kümmern.“ Er schüttelt sein Haupt. „Als ich irgendwann merkte, wohin meine Reise gehen würde, war das Kind schon im Brunnen. Da war schon alles zu spät, der Heimplatz bereits organisiert, alle Formalitäten bearbeitet, mein toller Sohn hat sogar bereits meine Wohnung gekündigt und ein Umzugsunternehmen bestellt. Ich hatte natürlich versucht, noch gegenzusteuern, habe mehrmals das Gespräch mit der überarbeiteten Stationsärztin gesucht, aber das war völlig zwecklos. Sie war Inderin und konnte kaum Deutsch.“ Herr Arndt schnieft, Julian reicht ihm ein Taschentuch.
„Sie sagten, das Umzugsunternehmen kommt heute Mittag. Können Sie denn das Gros aus ihrer Wohnung hierher mitnehmen?“
„Ja, wo denken Sie hin! Natürlich nicht!“
Julian, was soll die Frage … Wer von uns hier konnte das schon?
„Ich konnte nicht einmal selbst bestimmen. Noch während ich in der Klinik lag, marschierte mein Sohn durch meine Wohnung und verfügte, was wegkommt.“ Herr Arndt tritt gegen einen großen Kiesel.
Wie eben gegen die leere Bierflasche.
Auch der Stein rast weit über den schäbigen Rasen.
„‚Was wegkommt’ – so hatte er sich ausgedrückt. Stellen Sie sich vor: Zwei Drittel meiner ganzen Habe hat er durch ein Unternehmen für Wohnungsauflösungen abtransportieren lassen. ‚Trödel’ nannte er es! ‚Trödel‘!“
Laut hat Herr Arndt seine letzten Worte in den Park geschrien. Die Schulschwänzer schauen wieder auf.
„‚Trödel’! Wissen Sie, was für Erinnerungen daran hingen?“
Wir nicken.
Uns ging es ja nicht anders.
„‚Das Zeug kommt weg!‘ so sagte er. Er bezog es auf meine Habe und meinte wohl genauso auch mich.“
Eine traurige Geschichte.
Aber fürwahr keine neue.
Fast jeder hier kann sie erzählen.
Von sich.
Vielleicht mit einigen kleinen Abwandlungen, hier und da.
„Solche Erlebnisse, solche Schicksale … sind uns hier wohlbekannt. Leider auch aus eigener Anschauung, aus eigener Vita. Nahezu niemand hier kommt freiwillig hierher. Und jeder Weg hierher ist für fast jeden ein schmerz- und leidvoller. Das mag für Sie kein Trost sein. Aber wir, wo wir nun hier sind, können versuchen, das Beste daraus zu machen. Auch wenn es nicht viel sein mag, aber das muss unser Ziel sein. Und wir müssen zusammenhalten. Wir müssen den Austausch pflegen, uns gegenseitig zuhören, Vertrauen schenken und Halt geben. Ja, das gegenseitige Haltgeben ist eminent wichtig! Mit den Armen wie gleichsam mit Herz und Verstand.“
Wir umarmen uns zu dritt, in einem Kreis, fast pathetisch Die beiden Jugendlichen zünden sich einen Joint an uns begaffen uns.
„Herr Arndt, Sie haben viel verloren, sehr viel. Das verstehen wir beide sehr gut. Aber Sie haben sich Eines gerettet, Eines haben sie sich bewahrt. Und das ist etwas extrem Wichtiges.“
Frieder Arndt blickt fragend.
„Ihren Verstand. Ihren Geist. Eines der wertvollsten Dinge, die Sie besitzen können. Man spürt und wertschätzt dies erst, wenn man Menschen sieht, die das verloren haben. Und das sind nicht eben wenige hier.“
Wir umarmen uns wieder.
„Danke an Sie beide. Das tut so gut, so sehr gut … Wissen Sie, es ist heute einer der schwersten Tage meines Lebens. Und ich habe schon einige erlebt.“
Wir wissen es und haben auch schon einige erlebt.
„Da ich der Ältere bin, gebührt mir das Vorschlagsrecht. Sollen wir uns nicht beim Vornamen nennen? Das ist Julian, ich bin der Herbert.“
Frieder nickt erfreut und besiegelt es mit einem Handschlag.
Er ist ungewöhnlich kräftig.
Angenehm kräftig.
Wir gehen zurück.
Vor der Pforte steht ein Krankenwagen.
Wie so oft hier.
Zwei junge Rettungsassistenten hantieren fluchend an einem Transportstuhl.
Ihre Mienen sind misslaunig.
Wie so oft, wenn sie hierher zu uns kommen.
Eine Schar von Bewohnern und zwei Pflegerinnen umringen das Geschehen.
Ich dränge mich sachte nach vorn.
Auf dem Stuhl erkenne ich Herrn Wilzius, mit mehreren Gurten festgeschnallt, als wäre er ein verhafteter Amokläufer.
Seine Nase blutet stark, sein rechtes Auge ist blau.
Ich kämpfe mich zwischen zwei Rollis durch und greife ihn vorsichtig am Arm. „Was ist passiert?“
Er blickt mich kurz an, dann schüttelt er langsam den Kopf.
Alles kann in diesem Kopfschütteln liegen.
Herr Wilzius ist hochbetagt, auch ein ‚Neunziger’.
Seine Demenz ist von mittelgradiger Ausprägung und schwankend.
Es gibt Tage, da kann man sich recht ordentlich mit ihm unterhalten.
An anderen ist er in seiner eigenen Welt.
Einer Welt, von der ich nicht weiß, ob sie hell ist.
„Gute Besserung und alles Gute …“
„Guter Mann, treten Sie jetzt mal zur Seite und lassen Sie unsre Arbeit machen! Wir haben’s eilig!“ Der Rettungsassistent herrscht mich an wie einen ungezogenen Schulbuben.
„Üblicherweise haben Sie es aber nie eilig, hierher zu kommen!“ Wut hat mich auf die Burschen erfasst. „Man sieht es Ihnen auf einen Kilometer an, wie es Sie ankotzt, hier bei uns einen Patienten abzuholen!“
Die beiden Sanitäter schauen sich kurz abwägend an, die Runde harrt gespannt. „Ich sag euch mal was, Freunde: An den Transportfahrten hierher und von hier weg verdient Ihr ein Heidengeld! Aber Ihr behandelt uns wie Tiere! Wie Vieh, das abzutransportieren ist!“
Hinter mir höre ich zustimmendes Gemurmel und vereinzeltes Klatschen.
„Immer mit der Ruhe, mein Guter …“, antwortet der Größere der beiden sichtlich verunsichert. „Wir …“ Er versucht sich an verteidigenden Worten und gibt auf. „Ach vergiss es einfach, Alter!“
„Das tut er sowieso!“, kichert der kleine Dickliche. „Die vergessen immer gleich alles …“
„Bitte schau dir einmal das Auge an. Kommt das von einem Sturz?“, fragt mich Julian kritisch.
„Halt!“, rufe ich.
Die Sanitäter unterbrechen überrascht ihren Einladevorgang.
Die Vehemenz meines Rufs und mein Gesichtsausdruck scheinen zu beeindrucken.
Ich beuge mich zu Herrn Wilzius herunter und inspiziere seine Verletzungen.
Er schaut mich nicht an.
Er schaut niemanden an.
Niemanden in der Runde.
Sein Blick geht nach nirgends.
Mit einem Taschentuch tupfe ich ihm das Blut von der Oberlippe.
Es wäre Aufgabe der Rettungsassistenten gewesen.
„Herbert war Arzt“, höre ich hinter mir Julian Frieder zuflüstern. „Chirurg!“
Ich drehe mich kurz um und sehe Frieder in ehrfürchtiger Erstarrung.
„Das heißt, er ‚war’ es nicht nur sondern er ist es natürlich noch immer“, ergänzt Julian.
Ich betrachte mir genauer Herrn Wilzius’ Veilchen.
„Und Herbert war zudem Landwirt mit einem Einsiedlerhof und eigenem Vieh!“
In diesem Fall ist das Präteritum richtig.
Die abgeschlossene Vergangenheit.
Das ist passé.
„Es sieht nicht nach einem Sturz aus“, konstatiere ich.
Es war auch keiner, das ist mir völlig klar.
Wir wünschen Herrn Wilzius nochmals alles Gute und bewegen uns mit der Meute zurück in den trostlosen Eingangsbereich.
Die Menschenherde zerstreut sich, der Krankenwagen fährt ab.
An einem Wasserspender entdecke ich Phoebe.
Phoebe, unser Liebling.
Die beste Kraft in dieser Einrichtung.
Ein heller Stern in tiefem Dunkel.
Phoebe, Ende Zwanzig, hat etwas, was kaum jemand vom Personal besitzt. Ein Herz.
Ich gehe zu ihr.
„Ich frage nicht, was passiert ist. Ich frage nur, wer es war.“
Phoebe trinkt in Ruhe Wasser aus ihrem Pappbecher.
Frieder blickt entsetzt angesichts meiner Frage.
Julian und ich vermuten bereits die Antwort.
Wir warten lediglich auf die Bestätigung.
Phoebe schaut mich traurig an.
Ihre Augen sind so tief.
Dann nickt sie.
„Also war es wieder Gregor?“
Phoebe nickt erneut.
„Ich habe nichts gesagt“, flüstert sie leise.
„Hast du… es mitbekommen? Es selber gesehen, wie es passierte?“
„Nein. Aber Gregor war allein auf seiner Etage und dann allein in seinem Zimmer. Als es passierte …“
„Sie wollen damit nicht ernsthaft behaupten, dass eine Pflegekraft dieses Hauses diesen hilflosen Menschen so zugerichtet hat?“, entrüstet sich Frieder lauthals.
Phoebe gibt keine Antwort.
„Pssssst …“, beschwichtigt Julian.
„Warum?“, frage ich. „Wir wissen doch, dass es so ist.“
„Das ist jetzt nicht euer Ernst!“ Frieder ringt um Fassung. „Ein prügelnder Pfleger! Das gibt’s doch nur im schlechten Film!“
Wir stehen betreten.
„Frieder …“, setze ich an. „Beide Sätze von dir sind leider unrichtig.“
Er schaut völlig entsetzt.
„‚Der Satz mit dem 'schlechten Film' ist falsch, leider“
Er wird noch bleicher. „Und … der erste Satz? Über den prügelnden Pfleger? Was ist daran falsch?“
„Es ist nicht nur ein Pfleger.“
„Wenn du was Näheres in Erfahrung bringen solltest, lass es mich wissen“, wispere ich Phoebe zum Abschied zu.
Sie nickt.
Sie wirkt sehr erschöpft.
Gezeichnet.
Ich mag sie sehr.
Ein wunderbarer Mensch.
Wir steigen in den Aufzug, er riecht nach Kohl, nach Urin, nach Tod.
„Ich bin müde. Ich geh’ auf mein Zimmer.“ Julians Worte wirken auf Frieder schroff, er schaut mich verdutzt an.
Ich zucke nur mir den Achseln.
Gelegentlich überfallen Julian plötzliche und unerklärliche Stimmungsschwankungen, er kann gerade eben noch agil sein und innerhalb weniger Augenblicke aus dem Nichts heraus völlig matt und lethargisch.
Als wäre plötzlich die Batterie leer.
Wir sind halt nicht mehr die Jüngsten.
„Dann schlage ich vor, wir treffen uns zum Mittagessen. Oder bräuchtest du noch Hilfe bei den Möbeln?“
„Nein, nein das schaffen die Möbelmänner bestimmt sehr gut. Ich bräuchte eher Hilfe bei …bei diesen Dingen hier, bei diesen Dingen, die man hier zu ertragen hat. Ich weiß gar nicht, wie ich…sie benennen soll, diese Zustände …“
Es gibt keine Worte dafür.
Frieder verabschiedet sich auf dem Gang. „Da bräuchte ich wohl wirklich etwas Hilfe …“, wiederholt er leise.
Die bräuchten wir alle …
Ich bin nicht sehr unglücklich über die Auflösung unserer Menage á trois.
Denn ich fahre jetzt ein Stockwerk höher und besuche Anna.
Zu Anna möchte ich immer alleine gehen.
Heute Vormittag ist sie auf die rechte Seite gelagert.
Ich gebe ihr einen Kuss auf die Stirn.
Ich begrüße ihre Mitbewohnerin in ihrem Zimmer, Frau Frank.
Ich erkundige mich nach ihrem Befinden und habe einige Worte für sie.
Das tue ich immer.
Obgleich sie nicht zu antworten vermag.
Weder durch Worte noch durch Gesten.
Sie kann weder sprechen noch sich bewegen.
Kontrakt liegt sie in ihrem Bett, tagaus, tagein, sommers wie winters.
Manchen Tags war ich mir nicht mehr sicher, ob sie noch lebt.
Aber ich spreche sie immer an und drücke ihr die Hand.
Es ist nicht allein eine Frage der Höflichkeit oder des Anstandes.
Es ist, weil sie ein Mensch ist.
Manche hier haben das vergessen.
Ich nehme mir einen Stuhl und setze mich an Annas Bett.
Meinen Bewegungen folgt sie mit ihren Augen.
Sie sind blau und hell.
Ich beuge mich zu ihr und gebe ihr einen weiteren Kuss.
Auf ihren Mund.
Ihre Lippen sind warm und weich.
Es ist schön, Anna zu küssen.
Tag für Tag.
Wie oft mag ich im Leben geküsst haben?
Wie viele verschiedene Frauen?
Anna zu küssen ist nicht weniger schön als alle Küsse zuvor, die ungezählten.
Annas Küsse sind besonders.
Anna brummt.
Sie mag sie, die Küsse.
Das weiß ich.
Ich lächle sie an.
Ihre Augen, die blauen, hellen, schauen mich aufmerksam an.
Anna lächelt zurück.
Mit ihren Augen.
Die anderen Menschen merken das gar nicht, wissen es nicht.
Aber ich sehe es und weiß es.
Ich streichle Anna sanft über ihre Wange.
Sie brummt wieder.
Weil sie es sehr mag.
Auch für mich ist es sehr schön.
Ein Erfahren von körperlicher Nähe, wie ich es früher nie erlebt, nie gekannt, nie erahnt.
Ich streiche immer über ihre linke Wange.
Ihre rechte ist ohne Gefühl.
Wie ihre gesamte rechte Körperseite.
Vor zwei Jahren hat sie begonnen, unsere Liebe.
Hier, in dieser absonderlichen Welt.
Sie ist ein Wunder, diese Liebe.
Dass etwas so Helles an diesem dunklen Ort entstehen kann.
Dass an so einem kalten, traurigen Ort eine so wunderbare Blume erwachsen kann.
Und erblühen.
Anna war schon vor mir hier gewesen, am Ort der Finsternis.
Schon seit Jahrzehnten leidet sie an Rheumatoider Arthritis.
In den letzten Jahren wurde es schlimmer und schlimmer, auch die aggressiveren Medikamente zeigten kaum noch Wirkung.
Schon immer litt Anna Schmerzen, aber sie wurden stärker und stärker und sie selbst immer immobiler.
Ich fasse ihre Hand und streichle sie.
Sie ist schwer deformiert durch das schlimme Rheuma.
Ihre Gelenke knollig aufgetrieben, ihre Finger weichen alle nach außen ab.
Schwanenhalsdeformität nennt man es in den Lehrbüchern.
Und dennoch ist es eine schöne Hand.
Denn es ist Annas Hand.
Meine Gedanken tragen mich zurück.
Wie ich Anna kennen lernte.
Sie saß damals im Rollstuhl.
Wie wir uns näher kamen, langsam und sanft.
Mit unseren Worten.
Mit unseren Augen.
Mit unseren Gesten.
Mit unseren Körpern.
Unseren alten, geschundenen, kranken Körpern.
Ich spüre Tränen in meinen Augen.
Dass man sich mit 96 Jahren noch verlieben kann…
Eigentlich unvorstellbar.
Aber ist es nicht etwas Wunderbares?
Und ist die Liebe nicht überhaupt das Wunderbarste in unserem Leben?
Sagt mir, was ihr wunderbarer, was ihr größer, was ihr schöner findet!
Mit 96 Jahren eine Liebe erfahren.
Und diese Liebe leben.
Trotz aller Widrigkeiten.
Es ist kein Quäntchen weniger schön als mit 16, 26, mit 46 oder 66.
„Ich liebe dich, Anna.“
Ich sage es immer, wenn ich bei ihr bin.
Und manchmal auch allein in meinem eigenen Zimmer.
Weil es so ist.
Ich sage es mit lauter, mit fester Stimme.
Nicht mit Theatralik, sondern mit Überzeugung.
Denn es ist mir wichtig.
Wichtig, es Anna zu sagen, wichtig, es Anna zu zeigen.
Ich möchte, dass sie es spürt, dass sie es weiß.
Für jeden Geliebten ist das wichtig.
Aber für Anna besonders, weit mehr als für viele andere Menschen.
Es ist ganz wichtig für Anna.
Denn sie kann mir nicht mehr mit Worten antworten.
Vor acht Monaten erlitt sie ein schweres Schicksal.
Wir beide erlitten es.
Anna bekam einen großen Schlaganfall.
In der Nacht, im Schlaf.
Sie wachte morgens auf und ihre gesamte rechte Körperhälfte war sowohl gefühllos als auch vollständig gelähmt.
Auch ihre Sprache war ihr genommen.
Der Schlaganfall war sehr gierig.
Er begnügte sich nicht allein damit.
Anna kann auch nicht mehr schlucken.
Nie mehr essen, nie mehr trinken.
Könnt ihr euch es vorstellen, wie das ist?
Ansatzweise, vielleicht.
Anna wurde anfangs über Infusionen, dann über eine Magensonde durch die Nase ernährt.
Dann bekam sie eine PEG-Sonde.
Ein Schlauch durch ihre Bauchdecke direkt in den Magen
„Schlafe gut, mein Liebling. Träume nichts Böses, nichts Schlimmes. Ich freue mich auf dich, wenn du morgen wieder da bist.“
Das waren die letzten Worte, die Anna in ihrem Leben gesprochen hat.
Zu mir.
Abends bevor sie ins Bett ging, abends bevor der Schlaganfall zuschlug.
Anna habe eine komplette Aphasie, konstatierten die Neurologen.
Das heißt, Worte weder sprechen noch verstehen zu können.
Motorische und sensorische Aphasie.
Beides.
Aber das stimmt nicht.
Das weiß ich.
Denn natürlich versteht Anna.
Das sehe ich doch, das spüre ich doch!
Deshalb erzähle ich auch so viel, wenn ich bei ihr bin.
Das mag sie so sehr.
Das fühle ich.
Sie irren, die Neurologen.
Und alle anderen.
Ich besuche Anna jeden Tag.
Manchmal gibt es viele, manchmal wenige Neuigkeiten zu erzählen.
Es ist ja immer der gleiche Trott hier.
Dann erzähle ich Anna etwas aus meinem früheren Leben.
Dinge, die mich bewegt haben.
Und es hat mich vieles bewegt.
Anna weiß sehr viel von mir.
Mehr als jeder andere Mensch auf der Erde.
Auch meine Geheimnisse.
Derer gibt es viele.
Es sind keine schönen.
Anna hört so liebevoll, so aufmerksam zu.
An manchen Tagen, wenn ich zu Ende erzählt habe, lege ich mich zu ihr ins Bett.
Ich kuschle mich unter ihre Decke und an sie, an ihren Körper.
Das ist sehr schön.
Für uns beide.
Anfangs hatte es das Pflegepersonal befremdet.
Aber mittlerweile scheren sie sich nicht mehr darum.
Manchmal machen sie anzügliche Witze darüber und lachen über uns.
Es ist schmerzhaft, Ziel von Spott zu sein und ausgelacht zu werden.
Aber mit 96 muss man das häufiger ertragen als mit 46.
Und doch tut es immer noch gleich weh.
Ich liege bei ihr, ihr Atem geht ruhig und gleichmäßig.
Ich erzähle ihr von meinem letzten Traum der Nacht.
Von dem mit dem Jungen. In Russland. 1943.
Oft, sehr oft träume ich von Russland und diesem Jungen.
Arme Anna …
Wie oft mag sie sich meinen Traum immer wieder hat anhören müssen …
Aber immer tut sie es geduldig, verstehend, liebevoll.
Leider träume ich oft sehr schlecht.
Wahrscheinlich weil es sehr viel Schlechtes in meinem Leben gab.
Die Wirkung der Träume ist immer ein wenig anders.
Heute zum Beispiel hielt sie nicht lange vor, da der Tag Neuigkeiten erbrachte.
Frieder Arndt.
„Ich glaube, Frieder ist sehr bereichernd. Ich freue mich, dass er hier bei uns ist!“
Ich beiße mir auf die Lippe.
Das war einigermaßen egozentrisch.
Frieder wird diese Ansicht wohl kaum teilen.
„Er passt ganz gut zu Julian und mir. Wir könnten ein ganz unterhaltsames Trio werden.“
Anna gurrt.
„Er wird natürlich noch einiges hier lernen müssen …“Ich erzähle von Herrn Wilzius und der Prügel.
Anna gurrt vehementer.
Gregor.
Das tätowierte Arschloch.
Er ist ein gewalttätiger Neonazi.
Ja. Das ist er.
Ein Mensch, der hilflose Greise prügelt.
Anfangs wunderte ich mich, warum er hier beschäftigt bleibt.
Es gab zwar nie handfeste Beweise, aber Indizien, Verdachtsmomente.
Die Heimleitung muss Kenntnis davon haben.
Und trotzdem halten sie ihn.
Warum?
Mindestens ein Grund ist mir klar geworden.
Beim aktuellen Personalschlüssel dieser Einrichtung ist die Arbeit ein Sklavendienst mit miserabler Bezahlung.
Es finden sich kaum Menschen, die diese Arbeit unter den hier bestehenden Verhältnissen verrichten wollen.
Sicherlich gibt es viele Motivierte, die gerne als Altenpfleger betagten Menschen helfen möchten.
Aber nicht unter solchen Bedingungen.
Unser Heim rekrutiert über Headhunter eine Armada an Pflegekräften aus Osteuropa und Russland.
Sie stellen mittlerweile das Gros des Personals.
Die Außenwirkung dieses Umstands ist der obersten Heeresleitung bekannt.
Das macht sich nicht so elegant.
‚In der ‚Residenz’ sind nur russische Schwestern …
Wirkt nicht so gut wie ihre farbenprächtigen Hochglanzprospekte.
Daher sind sie erpicht, jeden deutschen Mitarbeiter zu halten.
Und Gregor kann sich viel erlauben.
So, wie sich viele hier viel erlauben können.
Und es tun.
Ludmilla kommt ins Zimmer.
Eine Pflegerin, schon Anfang sechzig.
Sie ist aus Smolensk, wenige Kilometer westlich von Moskau.
Da war ich schon einmal. 1941.
Aber das erzähle ich Ludmilla nicht.
Ludmilla klopft weder an noch spricht sie.
Wortlos wechselt sie bei den Damen die am Bett hängenden Urinbeutel.
Anna brummt guttural.
Ich halte sie fester.
Ich erschrecke, weil ich erwache.
Schaue auf die Uhr. Schon halb zwölf.
Ich war bei Anna eingedöst.
Ich habe schon wieder, selbst in diesem kurzen Schläfchen, geträumt.
Wieder von Russland.
Die Bilder verschwimmen, erkenne nichts mehr.
Gut so.
Vom Krieg zu träumen ist schlimm.
Allerdings gibt es für mich noch einen anderen, einen noch viel schlimmeren Traum.
Nur von Zeit zu Zeit sucht er mich heim.
Dann aber mit Wucht. Mit voller Macht.
Er ist entsetzlich, dieser andere Traum, nach ihm wache ich schweißgebadet auf, in mancher Nacht habe ich auch schon geschrien und die Nachtschwester auf den Plan gerufen.
Die drohte mir dann mit medikamentöser Ruhigstellung.
„Ich bin ein bisschen eingenickt bei dir …“ Ich lächle Anna an.
Zum Glück hatte ich nicht den anderen, den entsetzlichen Traum, in dem ich schreie.
Den Traum mit den Schweinen.
Die Schweine …
Nein…
Das absolute Grauen…
Wer oder was bestimmt, was man im Schlaf träumt?
Ich weiß es nicht.
Ich habe nur eine Ahnung, warum man etwas träumt.
Zumindest weiß ich das bei meinem entsetzlichen Traum.
Bei dem von den Schweinen.
Ja. Bei dem weiß ich es genau.
Anna schnaubt und beginnt mit ihrem nicht gelähmten Arme fahrig zu nesteln.
Sie streift sich die Bettdecke ab und grunzt lautstark.
„Brrrrrrrrrr!“ Ihre Augen sind schreckhaft geweitet.
Ihre Hand fährt über ihren Unterleib.
„Anna! Hast du Schmerzen?“ Besorgt verfolge ich ihre Hand.
Hektisch vollführt sie unkoordiniert erscheinende Bewegungen zwischen ihrer Ernährungssonde in Nabelhöhe und ihrem Urindauerkatheter, der suprapubisch, oberhalb des Schambeins durch die Bauchdecke in ihre Harnblase verläuft.
„Brrrrrrrr!“ Ihre Laute werden lauter.
„Hm.“ Auf der Stelle überfällt mich Sorge und ich denke angestrengt nach.
Vorsichtig taste ich ihren Bauch ab.
Anna schaut mir zu, ihre Augen bleiben ruhig.
Die Bauchdecken sind weich, es findet sich keine Abwehrspannung.
Das ist schon mal gut … Das spricht gegen ein hochakutes, schwerwiegendes Problem im Abdomen.
Vorsichtig entferne ich die flächigen Hautpflaster der Magensonde und des Urinkatheters.
Die Durchtrittsstellen durch die Bauchdecke sehen reizlos aus.
Keine Rötung, kein Eiter.
Damit scheidet das auch aus.