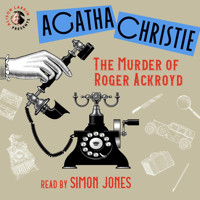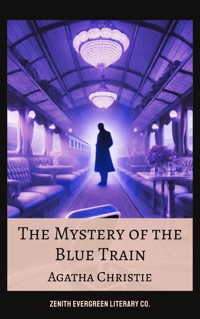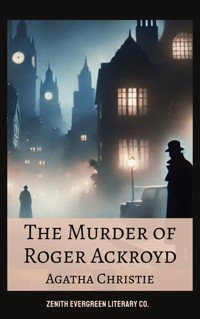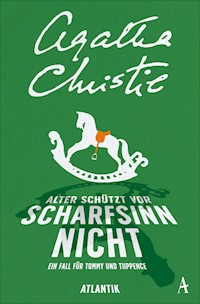
9,99 €
Mehr erfahren.
Krönendes Finale: Christies letztes Werk Nach vielen Jahren im Dienst des Secret Service wollen sich Tommy und Tuppence Beresford in einem Haus an der Küste zur Ruhe setzen. Doch dann findet Tuppence dort in einem alten Kinderbuch eine verschlüsselte – und unwiderstehliche – Botschaft. Bald sind die Beresfords statt im Ruhestand mitten in der Aufklärung einer Spionageaffäre, die vor dem Ersten Weltkrieg ihren Anfang nahm. Agatha Christies letztes Werk ist "ein eindrucksvolles Ineinander von Vergangenheit und Gegenwart" ( The Observer ).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Agatha Christie
Alter schützt vor Scharfsinn nicht
Ein Fall für Tommy und Tuppence
Aus dem Englischen von Edda Janus
Atlantik
1
Bücher!«, sagte Tuppence.
Sie sprach das Wort so empört aus, dass es fast wie eine kleine Explosion klang.
»Was hast du gesagt?«, fragte ihr Mann.
Tuppence sah ihn über die ganze Länge des Zimmers hinweg an.
»Ich habe nur ›Bücher‹ gesagt.«
»Soso!«
Vor Tuppence standen drei große Umzugskisten. Aus allen hatte sie schon Bücher herausgenommen, trotzdem waren sie zum größten Teil noch voll.
»Es ist unglaublich«, seufzte sie.
»Weil sie so viel Platz brauchen?«
»Ja.«
»Willst du sie denn alle aufstellen?«
»Ich weiß es nicht genau, Tommy«, antwortete Tuppence. »Das ist ja gerade das Problem. Man weiß nie genau, was man eigentlich will. Ach, du meine Güte.« Sie seufzte wieder.
»Na, hör mal!«, sagte ihr Mann, »das passt ganz und gar nicht zu dir. Die Schwierigkeit bei dir ist doch, dass du viel zu genau weißt, was du willst.«
»Ich meine das so«, erklärte Tuppence. »Da sitzen wir nun, werden älter und kriegen Rheuma – um das Kind beim Namen zu nennen. Das merken wir vor allem, wenn wir uns ungewohnt bewegen. Du weißt schon, man streckt sich, um Bücher einzuordnen oder um etwas aus einem hohen Regal zu nehmen, oder man kniet sich hin, weil man in den unteren Fächern etwas sucht, und dann kommt man nicht mehr so leicht auf die Füße.«
»Ja«, gab Tommy zu, »das liegt an den Beschwerden des Alters. Wolltest du das sagen?«
»Nein, ganz bestimmt nicht. Ich wollte damit sagen, dass es wunderbar ist, ein Haus kaufen zu können und genau das richtige zu finden. Mit ein paar kleinen Veränderungen natürlich.«
»Wenn man zum Beispiel aus zwei Zimmern eines macht«, stellte Tommy fest, »und etwas anbaut, das du Veranda nennst; dein Bauunternehmer bezeichnet es als Wintergarten und ich finde, es ist eine Loggia.«
»Es wird ausgesprochen hübsch werden«, erklärte Tuppence entschieden.
»Wenn es fertig ist, werde ich’s nicht wiedererkennen. Meinst du das?«
»Aber nicht doch! Ich wollte nur andeuten, dass du am Ende entzückt sein und behaupten wirst, eine einfallsreiche und künstlerisch sehr begabte Frau zu haben.«
»Also gut. Ich werde es mir merken.«
»Das brauchst du gar nicht«, antwortete Tuppence. »Die Worte werden nur so aus dir hervorsprudeln.«
»Und was hat das mit den Büchern zu tun?«
»Wir sind mit zwei oder drei Bücherkisten eingezogen. Wir haben vorher alle Bücher verkauft, die uns nicht mehr wichtig waren, und nur die mitgenommen, von denen wir uns nicht trennen konnten. Und dann sagten die – wie heißen sie noch? Die Leute, die uns das Haus verkauften, sagten, sie wollten nicht alles mitnehmen, und wenn wir ihnen ein gutes Angebot machten, würden sie ein paar Sachen dalassen, vor allem Bücher. Dann sind wir hergefahren, haben sie uns angesehen … «
» … und ein Angebot gemacht«, ergänzte Tommy.
»Ja. Wahrscheinlich haben wir nicht so viel gekauft, wie sie gehofft hatten. Aber einige Möbel waren auch zu abscheulich. Na, die brauchten wir glücklicherweise nicht zu nehmen. Doch als ich die Bücher sah, die Kinderbücher, die im Wohnzimmer standen – es waren sogar ein paar meiner Lieblingsbücher dabei – , da wollte ich sie unbedingt haben. Weißt du, die Geschichte von Androklus und dem Löwen zum Beispiel, von Andrew Lang. Ich kann mich erinnern, dass ich sie gelesen habe, als ich acht war.«
»Konntest du mit acht Jahren schon so gut lesen?«
»Ja. Ich habe es mit fünf gelernt. Damals war das so üblich. Ich wusste nicht mal, dass man es richtig lernen musste. Weißt du, jemand hat eine Geschichte vorgelesen und wenn man sie schön fand, merkte man sich, wo das Buch im Regal stand; man durfte es auch herausnehmen und sich ansehen. Und plötzlich entdeckte man, dass man es las, ohne sich viel um die Orthographie zu kümmern. Später war das dann weniger gut«, fügte sie hinzu.
»Ich habe immer Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung gehabt. Wenn sie mir jemand mit vier Jahren genau beigebracht hätte, wäre das vernünftiger gewesen. Mein Vater hat mir natürlich addieren und subtrahieren und multiplizieren beigebracht; er fand, das kleine und große Einmaleins wären das Wichtigste, was man im Leben lernen könnte. Dividieren habe ich selbstverständlich auch von ihm gelernt.«
»Was für ein kluger Mann er gewesen sein muss!«
»Ich weiß nicht, ob er so besonders klug war«, erwiderte Tuppence, »jedenfalls war er sehr, sehr nett.«
»Sind wir nicht ein wenig vom Thema abgekommen?«
»Ja.« Tuppence nickte. »Also: Als ich mich an Androklus und den Löwen erinnerte … es war ein Buch mit Tiergeschichten, ja, von Andrew Lang. Ach, habe ich das geliebt! Dann gab es da eine Geschichte, die hieß Ein Tag meines Lebens in Eton, von einem Schüler aus Eton. Warum ich das lesen wollte, weiß ich nicht mehr, aber ich wollte es unbedingt. Es war eines meiner Lieblingsbücher. Dann die klassischen Heldensagen und die Bücher von der Molesworth, Die Kuckucksuhr, Die Farm zu den vier Winden … «
»Nun, das reicht wohl«, sagte Tommy. »Ich brauche keine genaue Aufstellung deiner literarischen Freuden in frühester Jugend.«
»Ich meine ja nur, dass die Bücher heute nicht mehr zu bekommen sind. Es gibt zwar hin und wieder Neuauflagen, aber dann sind sie oft verändert und haben andere Bilder. Stell dir vor, neulich hätte ich Alice im Wunderland beinahe nicht wiedererkannt. Die Illustrationen sahen so merkwürdig aus. Gewisse Kinderbücher sind immer noch zu haben, die von der Molesworth, alte Märchenbücher oder Stanley Weyman. Von ihm sind übrigens viele Bände hiergeblieben.«
»Na schön, es war für dich eine große Versuchung. Und du hieltest es für einen guten Kauf.«
»Nicht nur gut, sondern auch billig, wirklich. Ja, und da sind sie nun, zusätzlich zu unseren eigenen Büchern. Es sind so schrecklich viele, dass sie kaum alle in die Regale passen werden, die wir uns haben machen lassen. Was ist mit deinem Privatheiligtum? Ist dort noch Platz?«
»Nein, keinesfalls«, sagte Tommy. »Es reicht nicht mal für meine eigenen.«
»Oje! Das sieht uns wieder ähnlich. Ob wir noch ein Zimmer anbauen sollten?«
»Nein. Wir wollten anfangen zu sparen. Darüber haben wir vorgestern noch gesprochen. Erinnerst du dich nicht?«
»Ach, das war vorgestern«, sagte Tuppence. »Fürs Erste werde ich alle Bücher, von denen ich mich nicht trennen kann, hier in die Regale stellen. Und dann – dann sortieren wir die übrigen durch. Vielleicht gibt es in der Nähe ein Kinderkrankenhaus, oder wir finden irgendeinen Ort, wo sie sich über Bücher freuen.«
»Wir könnten sie verkaufen«, sagte Tommy.
»Ich fürchte, diese Art Bücher wird keiner kaufen wollen. Ich glaube, es ist kein einziges wertvolles darunter.«
»Sei nicht so sicher. Du kannst Glück haben, Tuppence. Vielleicht ist ein vergriffenes Buch dabei, der lang gehegte Wunschtraum eines Buchhändlers.«
»Inzwischen müssen wir sie aufstellen und sie uns genau ansehen. Wie soll ich sonst wissen, was ich behalten möchte und an welche ich mich erinnere. Ich werde versuchen, sie wenigstens oberflächlich etwas zu sortieren – zum Beispiel: Abenteuerbücher, Märchen, Kindergeschichten und -reime und Erzählungen aus Internatsschulen, in denen alle Kinder immer so reich sind. Dann sind Bücher dabei, die wir Deborah vorgelesen haben, als sie klein war. Was haben wir alle Pu der Bär geliebt!«
»Ich fürchte, du überanstrengst dich«, meinte Tommy. »Du solltest jetzt lieber aufhören.«
»Ja, vielleicht«, gab Tuppence zu. »Aber ich würde gern diese Wand noch fertig machen, wenigstens die Bücher noch hineinstellen … «
»Ich helfe dir.«
Tommy trat zu ihr, kippte eine Kiste so schräg, dass die Bücher hinausglitten, lud sich die Arme voll und stellte sie in die Fächer. »Ich richte sie nach der Größe aus. Es sieht ordentlicher aus.«
»Na, so was kannst du nicht sortieren nennen«, wandte Tuppence ein.
»Das reicht, wenn man fertig werden will. Später können wir es gründlicher machen. An einem Regentag, an dem wir sonst nichts zu tun haben.«
»Der Ärger ist, dass wir immer was zu tun haben.«
»So, jetzt sind wieder sieben Stück untergebracht. Nun bleibt nur noch die Ecke dort oben. Würdest du mir mal eben den Holzstuhl rüberbringen? Hält er mein Gewicht aus? Dann könnte ich nämlich auch das oberste Regal vollstellen.«
Vorsichtig kletterte er auf den Stuhl. Tuppence reichte ihm einen Stapel Bücher. Er stellte sie sorgfältig ins oberste Fach, nur die letzten drei glitten ihm aus der Hand und landeten knapp neben Tuppence auf dem Fußboden.
»Au!«, sagte Tuppence. »Das tut einem geradezu weh.«
»Entschuldige. Du hast mir zu viele auf einmal gegeben.«
»Das sieht sehr schön aus!« Tuppence trat einen Schritt zurück. »Die hier brauchst du nur noch ins zweitunterste Fach zu stellen. Da ist eine Lücke. Dann wäre auch diese Kiste leer. Großartig! Damit ist ein Teil der gekauften Bücher ausgepackt. Vielleicht finden wir beim Sortieren Schätze.«
»Möglich«, sagte Tommy.
»Ich bin überzeugt. Vielleicht ist so ein Buch viel Geld wert.«
»Und was machen wir dann? Verkaufen wir es?«
»Das sollten wir wohl. Wir könnten es natürlich auch behalten und herumzeigen. Weißt du, nicht zum Angeben, aber wir könnten erzählen, dass wir eine Entdeckung gemacht haben. Übrigens glaube ich im Ernst, dass wir was Interessantes finden werden.«
»Was denn – ein altes Lieblingsbuch, das du vergessen hast?«
»Nein, so hab ich es nicht gemeint. Ich dachte an etwas Aufregendes, Überraschendes. An etwas, das unser Leben verändert.«
»Ach, Tuppence«, sagte Tommy, »was für eine blühende Phantasie du hast! Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass wir was Unangenehmes finden.«
»Unsinn, Tommy! Man darf nie die Hoffnung aufgeben. Sie ist das Wichtigste im Leben: Hoffnung. Vergiss nicht, ich bin immer voller Hoffnung.«
»Das weiß ich.« Tommy seufzte. »Ich habe es schon oft bedauert.«
2
Mrs Beresford stellte Die Kuckucksuhr wieder ins Bücherregal; sie wählte einen freien Platz im drittuntersten Fach. Alle Molesworth-Bücher standen dort. Sie zog Das Gobelinzimmer heraus und hielt es nachdenklich in der Hand. Oder sollte sie lieber Die Farm zu den vier Winden lesen? Daran konnte sie sich weniger gut erinnern als an Die Kuckucksuhr und Das Gobelinzimmer. Ihre Finger wanderten die Reihe entlang …
Sie kam voran. Ja, sie kam sogar sehr gut voran. Wenn sie nur nicht immer wieder bei ihren alten Lieblingen hängen bliebe und läse. Das war sehr reizvoll, aber sie vertrödelte so viel Zeit. Und wenn Tommy abends beim Nachhausekommen fragte, wie es ihr ergangen war, brauchte sie viel Takt und Geschick, ihn daran zu hindern, nach oben zu gehen und nachzusehen, wie die Bücherregale in Wirklichkeit aussahen. Es dauerte eben alles seine Zeit. Der Einzug in ein Haus dauerte immer lange, viel länger, als man glaubte. Und die vielen störenden Leute, wie zum Beispiel die Elektriker, die offenbar nie mit dem zufrieden waren, was sie beim letzten Mal gemacht hatten, die Fußbodenflächen aufrissen und mit fröhlichem Gesicht neue Fallgruben für die nichts ahnende Hausfrau legten, die dann einen Fuß falsch setzte und gerade noch rechtzeitig von dem unsichtbaren Elektriker gerettet wurde, der unter dem Fußboden herumkroch.
»Manchmal«, sagte Tuppence laut, »wünschte ich mir, wir wären nie aus Bartons Acre ausgezogen.«
»Erinnere dich an die Esszimmerdecke«, hatte Tommy gesagt, »und denk an den Dachboden und was mit der Garage los war. Beinahe wäre das Auto draufgegangen, weißt du noch?«
»Ach, die hätten wir sicherlich zusammenflicken lassen können.«
»Nein«, erwiderte Tommy. »Wir hätten das ganze verkommene Haus renovieren oder eben ausziehen müssen. Und eines Tages wird dieses hier sehr schön sein, davon bin ich überzeugt. Auf jeden Fall haben wir genug Platz und können tun, was wir wollen.«
»Du willst also damit sagen, dass wir alles unterbringen und behalten können?«
»Ja, ich weiß«, hatte Tommy geantwortet, »man hebt immer viel zu viel auf. Ich bin ganz deiner Meinung.«
Und nun, im Augenblick, dachte Tuppence darüber nach, ob sie wohl jemals mit diesem Haus viel anfangen könnten, abgesehen von der Tatsache des Einziehens. Anfangs hatte alles so einfach ausgesehen, aber es war immer schwieriger geworden – vor allem wegen der vielen Bücher.
»Wenn ich ein nettes, normales Kind von heute wäre«, sagte Tuppence laut, »hätte ich nicht schon so früh Lesen gelernt. Die Kinder, die jetzt fünf oder sechs sind, scheinen nicht lesen zu können; viele können es nicht mal mit zehn oder elf. Ich weiß gar nicht, warum es uns so leicht fiel. Wir konnten alle lesen. Ich und Martin von nebenan und Jennifer unten an der Straße und Cyril und Winifred. Ich will nicht behaupten, dass wir gut buchstabieren konnten, aber wir konnten lesen, was wir wollten. Ich weiß nicht, wie wir es gelernt haben. Wahrscheinlich haben wir immer gefragt. Was auf den Plakaten stand und auf der Reklame für Carters kleine Leberpillen. Das haben wir immer gelesen, wenn der Zug in London einfuhr. Es war so aufregend. Mein Gott, ich muss weitermachen!«
Sie stellte einige Bücher um. Dann verstrich eine Dreiviertelstunde, während sie sich in Alice hinter den Spiegeln vertiefte und später in Charlotte Yonges Unbekanntes aus der Geschichte. Ihre Hände glitten über den dicken, schäbigen Band Der Gänseblümchenkranz.
»Ach, das sollte ich mal wieder lesen«, sagte sie und seufzte. »Wenn ich an die vielen Jahre denke, die verstrichen sind, seit ich es nicht mehr in der Hand hatte. Was war es spannend, wenn man noch nicht wusste, ob Norman die Erlaubnis bekam, konfirmiert zu werden oder nicht. Und Ethel und – wie hieß der Ort noch? Coxwell oder so ähnlich – und dann Flora, die weltlich war. Ich möchte wissen, warum damals alles ›weltlich‹ war. Was sind wir eigentlich heute? Sind wir weltlich oder nicht?«
»Wie bitte, Madam?«
»Ach, nichts«, sagte Tuppence und sah ihr treues Faktotum Albert an, der gerade unter der Tür aufgetaucht war.
»Ich dachte, Sie wünschten etwas, Madam. Sie haben doch geklingelt, nicht wahr?«
»Eigentlich nicht«, antwortete Tuppence. »Ich hab zufällig die Klingel erwischt, als ich auf den Stuhl kletterte, um ein Buch herauszunehmen.«
»Kann ich etwas für Sie herunterholen?«
»Das wäre nett. Ich falle immer vom Stuhl. Ein paar haben so wackelige Beine.«
»Wünschen Sie ein bestimmtes Buch?«
»Mit dem dritten Fach von oben bin ich noch nicht weit gekommen. Ich weiß nicht, was da für Bücher stehen.«
Albert stieg auf einen Stuhl, klopfte die Bücher gegeneinander, um den Staub zu entfernen, und reichte sie der Reihe nach hinunter. Tuppence nahm sie mit Entzückensrufen in Empfang.
»Nein, so was! Alle sind sie da! Wie viele hatte ich vergessen! Da sind Das Amulett und Der Psamayad und Die neuen Schatzsucher. Großartig! Nein, noch nicht hineinstellen, Albert. Die muss ich erst lesen. Na ja, ein oder zwei wenigstens. Was ist denn das? Lassen Sie sehen. Die rote Kokarde, eine historische Erzählung. Sehr spannend. Und hier ist auch Unter der roten Robe. So viele Bücher von Stanley Weyman. Natürlich habe ich sie erst gelesen, als ich zehn oder elf war. Es würde mich gar nicht wundern, wenn jetzt auch noch Der Gefangene von Zenda auftauchte.« Sie seufzte bei der Erinnerung glücklich auf. »Der Gefangene von Zenda war mein erster Liebesroman. Die Liebesgeschichte der Prinzessin Flavia. Der König von Ruritanien. Und Rudolph Rassendyll. So ein Name! Davon hat man nachts geträumt.«
Albert reichte eine neue Auswahl hinunter.
»Oh!«, rief Tuppence. »Die sind noch besser, noch älter. Ich muss die ältesten Bücher zusammenstellen. Mal sehen, was wir haben: Die Schatzinsel. Die habe ich mehrmals gelesen und zwei Filme darüber gesehen. Obwohl ich Filme über Bücher nicht mag; sie stimmen nicht. Aha, da ist auch Entführt. Ja, das habe ich sehr geliebt.«
Albert reckte sich, kam aus dem Gleichgewicht, und Catriona fiel hinunter und hätte Tuppence beinahe getroffen.
»Oh, entschuldigen Sie, Madam. Es tut mir sehr leid.«
»Macht nichts«, sagte Tuppence. »Es ist nichts passiert. Catriona, ja. Sind noch mehr Geschichten von Stevenson da?«
Albert reichte ihr die Bücher nun sehr viel vorsichtiger zu. Gleich darauf stieß Tuppence einen Freudenschrei aus.
»Der schwarze Pfeil. Großartig! Der schwarze Pfeil! Eins meiner ersten Bücher, die ich besessen und gelesen habe. Sie kennen es vermutlich nicht, Albert. Ich meine, da waren Sie noch nicht geboren. Oder doch? Lassen Sie mich nachdenken. Ja, natürlich, es ging um das Bild an der Wand mit den Augen – echten Augen – , die durch die Augen auf dem Bild blickten. Man bekam solche Angst! Der schwarze Pfeil. Die Katze, die Ratte und Lovell, der Hund, regierten England unter dem Schwein. Das Schwein war natürlich Richard III. Heute werden andauernd Bücher darüber geschrieben, dass er gar kein Schurke gewesen ist. Das glaube ich nicht, ebenso wenig wie Shakespeare. Schließlich lässt er in seinem Stück Richard gleich am Anfang sagen: ›Bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden.‹ Ach, ja. Der schwarze Pfeil!«
»Wollen Sie noch mehr Bücher, Madam?«
»Nein, danke, Albert. Ich glaube, jetzt bin ich müde.«
»Ja, natürlich. Übrigens hat der Herr angerufen, er käme eine halbe Stunde später.«
»Macht nichts«, sagte Tuppence.
Sie setzte sich in einen Sessel, griff nach dem Schwarzen Pfeil, schlug ihn auf und versank darin.
»Meine Güte«, sagte sie dann, »wie schön es ist. Ich habe tatsächlich so viel vergessen, dass ich es noch einmal lesen kann.«
Die Stille senkte sich über sie. Albert kehrte in die Küche zurück. Die Zeit verstrich. In dem ziemlich schäbigen Sessel zusammengekauert, versuchte Tuppence, die Freuden ihrer Kindheit wiederauferstehen zu lassen.
Auch in der Küche verstrich die Zeit. Albert widmete sich ganz den Tücken des Herdes. Draußen fuhr ein Wagen vor. Albert ging zur Seitentür.
»Soll ich den Wagen in die Garage fahren, Sir?«
»Das mache ich schon«, sagte Tommy. »Sie haben sicher noch mit dem Abendessen zu tun. Bin ich sehr spät dran?«
»Nein, gar nicht, Sir. Sie sind genau zur angekündigten Zeit gekommen, sogar ein bisschen zu früh.«
»Hm.« Tommy brachte den Wagen weg und kam dann, sich die Hände reibend, in die Küche. »Kühl, draußen. Wo ist meine Frau?«
»Madam ist oben bei den Büchern.«
»Was, immer noch?«
»Ja. Sie hat heute wieder eine Menge eingeräumt, aber die meiste Zeit hat sie gelesen.«
»Aha! Was gibt es zu essen?«
»Seezungenfilet mit Zitrone, Sir. Es dauert nicht mehr lange.«
»Fein. Gönnen Sie mir noch eine Viertelstunde, Albert. Ich möchte mich noch etwas waschen.«
Oben im ersten Stock saß Tuppence immer noch in dem etwas schäbigen Sessel, in den Schwarzen Pfeil vertieft. Sie war auf etwas Merkwürdiges gestoßen, etwas Fremdes, das sich in das Buch eingeschlichen zu haben schien. Die Seite, bis zu der sie gekommen war – Seite 46 oder 47? Sie konnte die Zahl nicht genau erkennen – also, auf jeden Fall hatte dort jemand angefangen, Wörter zu unterstreichen. Sie verstand nicht, warum. Sie folgten nicht aufeinander und konnten daher auch kein Zitat sein. Es schienen willkürlich ausgewählte Wörter zu sein, die mit roter Tinte unterstrichen worden waren. Sie murmelte vor sich hin: » ›Matcham entfuhr ein schwacher Schreckensruf, auch Richard zuckte zusammen, sodass der Bogenspanner seiner Hand entglitt. Aufspringend, zogen sie ihre Gürtel stramm, prüften ihre Bogensehnen und vergewisserten sich, dass ihre Dolche und Schwerter leicht aus der Scheide glitten. Ellis hob seine Hand, mit flammendem Blick rief er: Harry Shelton, ermordet von Sir Daniel und seinem Geschmeiß. Simon Marmsby, gleichfalls von ihnen umgebracht, und Ellis Duckworth.‹ « Sie las noch die nächste Seite und schüttelte den Kopf. Es ergab keinen Sinn.
Sie ging zu dem Tisch, auf dem ihr Schreibzeug lag, und nahm ein paar Probebogen auf, die ihnen kürzlich eine Druckerei zur Auswahl geschickt hatte, weil sie einen neuen Briefkopf machen lassen mussten. Für das Lorbeerhaus.
»Was für ein dummer Name«, sagte Tuppence, »aber wenn man ihn dauernd ändert, kommt die Post nie mehr an.«
Sie schrieb die unterstrichenen Worte ab. Nun fiel ihr etwas auf, das sie vorher nicht bemerkt hatte.
»Na, das ist ganz was andres.«
Sie malte Buchstaben auf das Blatt.
»Ach, hier bist du!«, sagte plötzlich Tommy hinter ihr. »Das Essen steht so gut wie auf dem Tisch. Was machen deine Bücher?«
»Es ist furchtbar spannend«, sagte Tuppence. »Sehr merkwürdig.«
»Was ist spannend und merkwürdig?«
»Es geht um Den schwarzen Pfeil von Stevenson, ich wollte es wieder lesen und habe auch angefangen. Plötzlich hatte ich ein ganz seltsames Gefühl, weil so viele Worte mit roter Tinte unterstrichen waren.«
»Ach, das tun doch die Leute manchmal«, meinte Tommy. »Nicht immer mit roter Tinte, aber jeder unterstreicht doch mal was. Etwas, an das man sich erinnern möchte, ein Zitat oder so was.«
»Darum geht es eben nicht. Es sind eigentlich nur einzelne Buchstaben, verstehst du?«
»Nein«, sagte Tommy. »Was heißt, nur Buchstaben?«
»Sieh’s dir an!«
Tommy setzte sich auf die Armlehne und warf einen Blick auf das Blatt. »Verrückt«, sagte er.
»Ja, das habe ich anfangs auch geglaubt. Aber es stimmt nicht, Tommy.«
Unten wurde eine Kuhglocke geläutet.
»Das Essen ist fertig.«
»Es kann warten«, sagte Tuppence. »Erst muss ich es dir erklären. Wir können uns nachher gründlicher damit befassen, es ist wirklich zu merkwürdig. Ich muss es dir einfach erzählen.«
»Na, schön! Phantasierst du dir mal wieder was zusammen?«
»Überhaupt nicht! Ich habe nur die Buchstaben notiert. Pass auf, hier steht das M von ›Matcham‹. Das ist das erste Wort. Das M ist unterstrichen und dann das a, danach kommen noch mehr Wörter. Im Buch stehen sie nicht hintereinander. Sie sind einfach herausgepickt worden, wenigstens scheint es so. Man hat sie unterstrichen, vielmehr einzelne Buchstaben, weil jemand bestimmte Buchstaben brauchte. Das nächste ist dann ein r, dann kommt das y aus ›Marmsby‹, und so geht es immer weiter … «
»Um Gottes willen!«, rief Tommy. »Hör auf!«
»Warte! Ich muss es herausbekommen. Siehst du, was ich aufgeschrieben habe? Erkennst du es? Wenn man sie der Reihe nach liest, ergibt es einen Sinn: M-a-r-y. Diese Buchstaben waren unterstrichen.«
»Und was soll das heißen?«
»Einfach: Mary.«
»Na schön, es heißt also Mary. Ein Kind mit Phantasie, vermutlich. Sie wollte zeigen, dass es ihr Buch war. Die Menschen schreiben nun mal ihre Namen in Bücher.«
»Jawohl, Mary«, sagte Tuppence. »Und die nächsten unterstrichenen Buchstaben ergeben J-o-r-d-a-n.«
»Na, bitte: Mary Jordan. Absolut natürlich. Jetzt kennst du ihren Namen. Sie hieß Mary Jordan.«
»Aber das Buch hat ihr gar nicht gehört. Vorn steht in einer krakeligen Kinderschrift: Alexander. Alexander Parkinson, glaube ich.«
»Hm. Spielt das wirklich eine Rolle?«, fragte Tommy.
»Natürlich spielt es eine Rolle.«
»Ach, komm schon! Ich habe Hunger.«
»Beherrsch dich!«, sagte Tuppence. »Ich lese dir nur noch den Rest vor, bis das Unterstrichene aufhört – oder vielmehr nach vier fortlaufenden Seiten aufhört. Die Buchstaben sind wahllos herausgenommen, mit dem Text kann es nichts zu tun haben. Es geht allein um die Buchstaben. Warte mal. Wir hatten M-a-r-y J-o-r-d-a-n. Stimmt. Und jetzt rate, wie es weitergeht? I-s-t k-e-i-n-e-s n-a-t-ü-r-l-i-c-h-e-n T-o-d-e-s g-e-s-t-o-r-b-e-n. Was sagst du nun? ›Mary Jordan ist keines natürlichen Todes gestorben.‹ Aber pass auf, es kommt noch besser: ›Es war einer von uns. Ich glaube, ich weiß, wer.‹ Das ist alles. Mehr kann ich nicht finden. Was sagst du nun? Ist das nicht aufregend?«
»Hör mal, Tuppence«, erwiderte Tommy, »du wirst hoffentlich keine große Sache daraus machen?«
»Was soll das heißen – keine große Sache?«
»Na, dass du ein Geheimnis witterst.«
»Selbstverständlich ist es ein Geheimnis!«, sagte Tuppence.
» ›Mary Jordan ist keines natürlichen Todes gestorben. Es war einer von uns. Ich glaube, ich weiß, wer.‹ Ach, Tommy, gib zu, dass es unerhört geheimnisvoll klingt.«
3
Tuppence!«, rief Tommy, als er ins Haus kam.
Keine Antwort. Ein wenig ärgerlich rannte er die Treppe hinauf und durch den Flur im ersten Stock. Um ein Haar wäre er dabei in ein Loch im Fußboden getreten. Er begann prompt zu fluchen.
»Schon wieder einer dieser verdammten leichtsinnigen Elektriker!«
Vor ein paar Tagen war es ihm schon einmal passiert. Die Elektriker, guter Dinge und voll Zuversicht, hatten mit der Arbeit begonnen. »Jetzt klappt es großartig, wir sind bald fertig«, hatten sie behauptet. »Wir kommen heute Nachmittag wieder.« Aber sie waren am Nachmittag nicht wiedergekommen. Tommy war nicht gerade erstaunt darüber. Er hatte sich inzwischen an die Art, wie die Maurer, Elektriker, die Männer vom Gaswerk und andere Handwerker arbeiteten, gewöhnt. Sie kamen, sie wirkten tüchtig, sie stellten optimistische Prognosen, sie gingen weg, um etwas zu holen – und kehrten nicht zurück. Man telefonierte, schien aber immer die falsche Nummer zu haben. Wenn die Nummer stimmte, war der betreffende Mann nicht bei der Firma beschäftigt. Es gab nur eins: Man musste aufpassen, sich nicht den Knöchel zu brechen, nicht in ein Loch zu fallen oder sich in irgendeiner Weise zu verletzen. Er hatte auch viel mehr Angst um Tuppence als um sich selbst. Er passte besser auf. Wo war sie eigentlich? Er rief wieder. »Tuppence! Tuppence!«
Er machte sich Sorgen. Tuppence gehörte zu den Menschen, um die man sich immer Sorgen machen musste. Ehe man das Haus verließ, sprach man letzte weise Worte zu ihr, und sie beteuerte, sich so zu verhalten, wie man es ihr geraten hatte. Nein, sie würde nicht weggehen, höchstens, um ein halbes Pfund Butter zu kaufen, und das war schließlich nicht gefährlich.
»Es könnte gefährlich werden, wenn du es bist, die ein halbes Pfund Butter kaufen will«, hatte Tommy gesagt.
»Ach, sei nicht blöd!«
»Ich bin nicht blöd. Ich bin nur ein liebevoller Ehemann, der sich um eins seiner kostbarsten Besitztümer sorgt. Ich weiß zwar nicht, warum … «
»Weil ich«, hatte Tuppence geantwortet, »so charmant bin, so hübsch, eine gute Ehefrau und mich so rührend um dich kümmere.«
»Ja, das vielleicht auch, aber ich könnte dir noch eine ganz andere Liste zusammenstellen.«
»Die würde ich sicher nicht gern hören. Ich vermute, es hat sich zu viel Ärger in dir angestaut. Beruhige dich. Es wird schon nichts passieren. Du brauchst nur zu rufen, wenn du zur Haustür reinkommst.«
So, und wo war Tuppence nun?
»Diese kleine Hexe«, sagte Tommy. »Sie ist irgendwohin gegangen.«
Er trat in das Zimmer, in dem er sie schon öfter angetroffen hatte. Sicher sieht sie sich ein Kinderbuch an, dachte er, und wird sich wieder über ein paar dumme Wörter aufregen, die ein blödes Kind mit roter Tinte unterstrichen hat. Auf der Spur von Mary Jordan, wer immer sie gewesen war. Mary Jordan, die keines natürlichen Todes gestorben war. Trotzdem: Er machte sich allmählich Gedanken darüber. Vermutlich war es schon sehr lange her, denn die Leute, die ihnen das Haus verkauft hatten, hießen Jones. Sie hatten es nicht sehr lange bewohnt, nur drei oder vier Jahre. Nein, das Kind mit dem Buch von Stevenson gehörte in eine weiter zurückliegende Zeit. Na ja, Tuppence war zumindest nicht hier in diesem Zimmer. Und es lagen auch keine aufgeschlagenen Bücher herum, in denen sie möglicherweise gelesen hatte.
»Wo zum Teufel steckt sie?«, rief Tommy.
Er lief wieder nach unten und rief ein paarmal ihren Namen. Keine Antwort. Prüfend betrachtete er einen Garderobenhaken in der Diele. Keine Spur von Tuppence’ Regenmantel. Dann war sie also ausgegangen. Wohin? Und wo war Hannibal? Er rief laut nach Hannibal.
»Hannibal – Hannibal! Komm schon, Hannibal!«
Auch kein Hannibal.
Na, wenigstens ist Hannibal dabei, dachte er.
Allerdings wusste er nicht, ob es gut oder schlecht war, wenn Tuppence Hannibal mitnahm. Hannibal würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr nichts geschah. Die Frage war nur: Würde Hannibal anderen Leuten etwas tun? Er war sehr freundlich, wenn er zu Besuch mitgenommen wurde, aber jemand, der das Haus betreten wollte, in dem er der Herr war, erweckte immer seinen größten Argwohn. Er war, ungeachtet jeder Gefahr, immer auf dem Sprung, nicht nur zu bellen, sondern auch zu beißen, wenn er es für nötig hielt. Also, wo waren die beiden?
Er ging ein Stück die Straße entlang, entdeckte keine Spur eines kleinen schwarzen Hundes und einer mittelgroßen Frau in einem leuchtend roten Regenmantel, die irgendwo in Sichtweite spazieren gingen. Schließlich kehrte er ziemlich verärgert ins Haus zurück.
Dort duftete es sehr verlockend. Er lief in die Küche, wo Tuppence am Herd stand. Sie drehte sich um und lächelte.
»Du bist spät dran«, sagte sie. »Das ist ein Braten. Riecht es nicht gut? Ich habe alle möglichen Gewürze dran getan und Kräuter aus dem Garten. Wenigstens hoffe ich, dass es welche waren.«
»Wenn es keine sind, handelt es sich vermutlich um Belladonna und Digitalisblätter, was sich fein anhört, in Wirklichkeit aber Tollkirsche und Fingerhut sind. Wo um alles in der Welt hast du gesteckt?«
»Ich bin mit Hannibal spazieren gegangen.«
Hannibal hatte in diesem Augenblick seinen großen Auftritt. Er stürzte sich auf sein Herrchen und begrüßte ihn so überaus stürmisch, dass Tommy fast umfiel. Hannibal war ein kleiner schwarzer Hund, mit glänzendem Fell und interessanten braunen Flecken auf dem Hinterteil und an der Schnauze. Er war ein Manchester-Terrier edelster Rasse und fühlte sich jedem anderen Hund seiner Bekanntschaft an Klugheit und Vornehmheit weit überlegen.
»Ich habe dich gesucht«, sagte Tommy. »Wo bist du gewesen? Das Wetter war nicht sehr einladend.«
»Ja, es war etwas neblig und feucht. Puh, ich bin ziemlich müde.«
»Wohin bist du gegangen? Nur bis zu den Geschäften?«
»Nein, heute schließen die Läden früher. Ich war auf dem Friedhof.«
»Das hört sich seltsam an. Was wolltest du denn dort?«
»Ich habe nach bestimmten Gräbern gesucht.«
»Du klingst immer düsterer«, stellte Tommy fest. »Hat es Hannibal wenigstens Spaß gemacht?«
»Nein, den musste ich draußen anbinden. Ein Mann, der wie der Küster aussah, kam immer wieder aus der Kirche. Und ich dachte, er hätte es sicher nicht gern, wenn Hannibal … na, du weißt schon, falls Hannibal ihn nicht leiden konnte. Ich wollte die Leute nicht gleich gegen uns aufbringen, kaum dass wir eingezogen sind.«
»Und was hast du auf dem Friedhof tatsächlich gesucht?«
»Ich wollte nur wissen, wer da alles beerdigt ist. Viele Leute übrigens; er ist ziemlich voll, viele alte Gräber, auch aus dem vorigen Jahrhundert. Manche Steine waren so verwittert, dass sich die genaue Jahreszahl nicht feststellen ließ.«
»Ich begreife immer noch nicht, was du dort wolltest.«
»Ich habe Ermittlungen angestellt.«
»Ermittlungen?«
»Ich wollte nachsehen, ob die Jordans dort beerdigt sind.«
»Du meine Güte! Hast du diese Geschichte immer noch im Kopf?«
»Immerhin, Mary Jordan ist gestorben. Das wissen wir genau. In dem Buch steht, dass es kein natürlicher Tod war. Und deswegen muss sie irgendwo begraben sein, oder etwa nicht?«
»Zweifellos«, meinte Tommy, »es sei denn, sie liegt hier im Garten.«
»Das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, weil ich glaube, dass nur der Junge, dieser Alexander, Bescheid wusste. Er muss sich für sehr schlau gehalten haben. Aber wenn er der Einzige war, der sich das überlegt hatte – also, ich meine, niemand sonst ist vermutlich darauf gekommen. Sie ist demnach einfach gestorben, normal beerdigt worden und kein Mensch hat ein Wort darüber … «
»Keiner hat behauptet, es wäre nicht mit rechten Dingen zugegangen?«, schlug Tommy vor.
»Ja, irgend so etwas – vergiftet, oder ein Schlag auf den Kopf, ein Sturz über eine Klippe, vielleicht ein Autozusammenstoß. Da gibt es viele Möglichkeiten.«
»Die dir alle sofort einfallen«, sagte Tommy. »Ein Glück, dass du ein weiches Herz hast, Tuppence, und nicht zum Spaß diese Möglichkeiten durchprobierst.«
»Auf dem Friedhof liegt keine Mary Jordan. Es waren überhaupt keine Jordans da.«
»Wie bedauerlich. Sag mal, ist dein Braten bald fertig? Ich habe schrecklichen Hunger, und es riecht köstlich.«
»Du brauchst dir nur noch die Hände zu waschen, dann können wir essen.«
4
Viele Parkinsons liegen auf dem Friedhof«, sagte Tuppence beim Essen. »Mehrere Generationen; die Zahl ist beachtlich. Alte, junge, verheiratete – es wimmelt von Parkinsons. Und Capes und Griffins und Underwoods und Overwoods. Komisch, dass beide Sorten von Woods vertreten sind, was?«
»Ich hatte einen Freund namens George Underwood«, stellte Tommy fest.
»Ja, Underwoods habe ich auch gekannt, aber keine Overwoods.«
»Männliche oder weibliche?«, fragte Tommy etwas interessierter.
»Ein Mädchen, Rose Underwood.«
»Rose Underwood.« Tommy lauschte dem Klang des Namens nach. »Das passt nicht besonders gut zusammen.« Einen Augenblick später fügte er hinzu: »Nach dem Essen muss ich den Elektriker wieder anrufen. Pass oben auf dem Treppenabsatz auf, Tuppence, sonst brichst du ein!«
»Dann sterbe ich eines natürlichen oder auch eines unnatürlichen Todes. Eins von beiden.«
»Tod aus Neugier«, sagte Tommy. »Neugier ist gefährlich.«
»Bist du nie neugierig, Tommy?«
»Ich sehe einfach keinen Anlass zur Neugier. Was gibt es zum Nachtisch?«
»Sirupkuchen.«
»Mein Kompliment, Tuppence, es war ein köstliches Essen.«
»Ich freue mich, wenn es dir geschmeckt hat.«
»Was ist mit dem Paket vor der Hintertür? Ist es etwa der Wein, den wir bestellt haben?«
»Nein, es sind Blumenzwiebeln.«
»So?«
»Tulpenzwiebeln. Ich muss gleich mal mit dem alten Isaac sprechen.«
»Wo willst du sie denn einpflanzen?«
»Ich dachte rechts und links vom Mittelweg.«
»Der arme alte Kerl. Ich habe immer Angst, er fällt im nächsten Augenblick tot um«, sagte Tommy.
»Nicht die Spur. Isaac ist zäh. Übrigens scheint das eine Eigenschaft von Gärtnern zu sein. Sehr gute Gärtner, habe ich festgestellt, laufen erst zu Hochform auf, wenn sie über achtzig sind. Aber wenn ein blühend aussehender junger Mann von etwa Mitte dreißig sagt, er wollte immer schon gern im Garten arbeiten, kannst du sicher sein, dass er nicht viel tut. Die wollen immer nur ein paar Blätter zusammenrechen. Wenn man von ihnen mehr verlangt, behaupten sie einfach, es wäre nicht die richtige Jahreszeit. Und da man meistens nicht weiß, wann die richtige Jahreszeit ist – ich wenigstens nicht – , kommt man nie gegen sie an. Aber Isaac ist großartig! Er weiß einfach alles. Es müssten übrigens auch Krokusse dabei sein. Am besten sehe ich mal nach. Isaac kommt gleich. Er wird es mir erklären.«
»In Ordnung«, sagte Tommy. »Ich leiste dir später Gesellschaft.«
Tuppence und Isaac verstanden sich glänzend. Die Blumenzwiebeln wurden ausgepackt und Beratungen abgehalten, wo die Pflanzen am besten zur Geltung kämen; erst die frühen Tulpen, die schon Ende Februar das Herz erfreuen würden, dann die hübschen Papageientulpen mit den ausgefransten Blütenblättern, dann eine Sorte, die, so viel Tuppence verstand, Viridiflora hieß, besonders schön und langstielig war und Ende Mai bis Anfang Juni blühte. Da sie nur grün blühte, sollte sie in einem hinteren Teil des Gartens gepflanzt werden, um dann für interessante Sträuße im Wohnzimmer verwendet zu werden. Vielleicht konnte man die Zwiebeln auch neben dem Weg vom Gartentor zum Haus stecken, wo die Blüten dann den Neid und die Eifersucht aller Besucher erregen würden.
Um vier Uhr machte Tuppence in der Küche guten, starken Tee in einer braunen Tonkanne. Sie stellte eine Schale Würfelzucker und ein Kännchen Milch dazu und rief Isaac, damit er sich vor dem Nachhauseweg stärkte. Danach machte sie sich auf die Suche nach Tommy.
Wahrscheinlich schläft er irgendwo, dachte sie, während sie von einem Zimmer ins andere ging. Erfreut stellte sie fest, dass aus dem tiefen Loch beim Treppenabsatz ein Kopf hervorschaute.
»Ma’am, jetzt ist es in Ordnung«, sagte der Elektriker. »Sie brauchen nicht länger vorsichtig zu sein. Wir sind fertig.« Leider fügte er hinzu, dass er am nächsten Morgen in einer anderen Ecke von vorn beginnen wollte.
»Hoffentlich kommen Sie auch«, sagte Tuppence. »Haben Sie übrigens Mr Beresford gesehen?«
»Ihren Mann, meinen Sie? Ja, der ist oben, glaube ich. Er hat was runtergeworfen. Es war was Schweres. Bücher zum Beispiel.«
»Bücher!«, seufzte Tuppence. »Nein, so was!«
Der Elektriker kehrte in seine Unterwelt zurück, und Tuppence stieg zum Dachboden hinauf, der als Bibliothek für die Kinderbücher eingerichtet worden war.
Tommy saß auf einer Trittleiter. Um ihn herum lagen mehrere Bücher auf dem Fußboden, in den Regalen waren auffallende Lücken.
»Aha, da bist du ja«, sagte Tuppence. »Und dabei hast du so getan, als interessierst du dich gar nicht dafür. Du hast eine schöne Unordnung gemacht.«
»Tut mir leid. Ich hatte mich nur mal umsehen wollen.«
»Hast du noch mehr Bücher gefunden, in denen was mit roter Tinte unterstrichen wurde?«
»Nein.«
»Wie schade!«
»Ich glaube, dass es Alexander war. Master Alexander Parkinson.«
»Ja, sicher. Einer von den Parkinsons, den zahllosen Parkinsons.«
»Ich vermute, dass er ein ziemlich fauler Knabe war«, sagte Tommy. »Obwohl es mühsam war, die Buchstaben zu unterstreichen. Aber über den Fall Jordan hat er keine weiteren Informationen hinterlassen.«
»Ich habe den alten Isaac gefragt. Der kennt Gott und die Welt. Er kann sich an keine Jordans erinnern.«
»Was willst du mit der Messinglampe, die du neben die Eingangstür gestellt hast?«, fragte Tommy, als er mit ihr nach unten ging.
»Die bringe ich zum Raritätenbasar.«
»Warum?«
»Weil sie so hässlich ist. Wir haben sie auf irgendeiner Reise gekauft, weißt du noch?«
»Ja, da müssen wir verrückt gewesen sein. Du hast sie nie leiden können. Ich kann dir nur beipflichten. Außerdem ist sie sehr schwer, viel zu schwer.«
»Dabei hat Miss Sanderson sich sehr gefreut, als ich sie ihr anbot. Sie wollte sie abholen, aber ich habe gesagt, ich würde sie hinbringen. Heute müssen wir sie abliefern.«
»Wenn du möchtest, erledige ich es.«
»Nein, ich würde lieber selbst fahren.«
»Dann komme ich mit und trage sie dir rein.«
»Ach, ich finde bestimmt jemand, der mir hilft.«
»So sicher ist das nicht. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst.«
»Selbstverständlich.«
»Du hast doch einen bestimmten Grund, warum du hinfährst?«
»Ich wollte eigentlich nur ein bisschen mit den Leuten reden.«
»Ich weiß nie genau, was du ausheckst, Tuppence, aber ich weiß genau, wie du aussiehst, wenn du was ausheckst.«
»Geh inzwischen mit Hannibal spazieren, Tommy. Ich kann ihn nicht mitnehmen, denn ich möchte nicht in eine Hundebeißerei geraten.«
»Na schön. Gehen wir, Hannibal!«
Hannibal gab wie stets sofort seine Zustimmung. Zustimmung und Ablehnung waren bei ihm nicht zu verkennen. Er wackelte, wedelte, hob die Pfote, senkte sie wieder und rieb heftig den Kopf gegen Tommys Bein.
So ist’s gut, schien er sagen zu wollen, dazu bist du da. Wir machen einen herrlichen Spaziergang mit vielen schönen Gerüchen.
»Los!«, sagte Tommy. »Ich nehme die Leine mit. Lauf nicht gleich auf die Straße wie beim letzten Mal. Einer von diesen riesigen Lastwagen hätte dich fast überfahren.«
Hannibal sah zu seinem Herrchen auf. Sein Gesichtsausdruck sagte: Ich bin ein braver Hund, tue immer, was du willst. So falsch diese Miene auch war, sie täuschte sehr oft sogar die Menschen, die im engsten Kontakt mit Hannibal lebten.