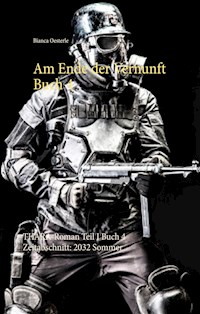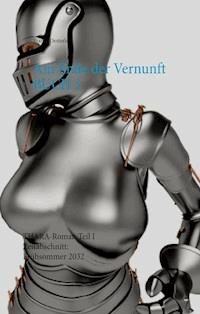
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Thara-Roman Teil I
- Sprache: Deutsch
Im Frühsommer des Jahres 2032 sieht sich die SAG-Ten-Einheit der Euro-US-Army durch einen Biowaffenangriff der WOMEN-Force zunächst als ausgebremst. Aber die Lage zwingt sie bald, sich von der Krankenstation ins nächste Einsatzgebiet zu begeben. Der Transport von etwa zwei Dutzend Frauen in eine Sterilisationsklinik in Österreich soll von der SAG-Ten sicher eskortiert werden. Am Hauptbahnhof im Zentrum von Ulm steht ein Zug bereit, der die Frauen unter Begleitung aufnehmen und transportieren soll, aber der zwar kurze, dennoch beschwerliche Weg bis dorthin ist von Hindernissen im Trümmerfeld der zerbombten Stadt Ulm gesäumt - und das Alpha-One-Team der WOMEN-Force, sowie eine Fliegerstaffel der Frauenarmee aus Günzburg sitzen ihnen permanent im Nacken, der von außergewöhnlicher Hitze schweißnass überströmt ist. Taylor, Smith, Wallace und Methews geraten ordentlich ins Schwitzen, während Romana (im Panzer), Jennifer (im Heli) und ihr Team kühl bleiben. Unter Einsatz ihres Lebens retten Leroy, Sam-Peter, Alexander und Frederick ein deutsches Mädchen, das ihre Familie verloren hatte, und sie suchen einen Ausweg, die kleine Julia in Sicherheit zu bringen. Dabei stellt sich ihnen ein Spezialkommando der WOMEN-Force in die Quere. Ob es den Männern gelingt, Julia wohlbehalten aus der Gefahrenzone der zerstörten Stadt Ulm zu bringen? Captain Taylors Entscheidungen zur Einsatzeinteilung sind für Sergeant-Major Smith nicht immer schlüssig nachvollziehbar, so schweigt er zwar darüber, nicht einverstanden zu sein, dass sich in einem einzigen Radpanzer alle wichtigsten Unteroffiziere befinden, die den Deportationskonvoi sichernd begleiten, aber er schiebt einen Trümmerberg an Groll vor sich her. Der Teniente ist ihnen allmählich ein Dorn im Auge, dennoch müssen sie auf den spanischen Leutnant bauen, obwohl er sie vermutlich mit untergejubelten Drogen leichter beeinflussbar machen will. Sie wollen nur eins: den Einsatz schleunigst hinter sich bringen. Prompt geraten sie in eine missliche Lage ... Panzerkommandantin Perkins vermutet unter den eigenen Kameradinnen den Verrat an die Euro-US-Army, denn sie kämpft mit Kommunikationsproblemen zwischen ihrem Panzer, dem Helikopter von First Lieutenant Gordon, dem Späh-Jeep von Captain Jadszcek und dem Divisionscamp der Mutter-Basis. Ein medizinischer Notfall gefährdet ihre Mission zudem, am Hauptbahnhof Ulm die Deportation zu verhindern, während die eigene Fliegerstaffel aus Günzburg unaufhaltsam daherfliegt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1101
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Historiker fanden über die verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte jede Menge Beweismaterial, das die Kenntnisse über unser früheres Dasein untermauert und verdichtet, wie wir einst lebten, arbeiteten, aßen und liebten, aber über das Mittelalter wissen wir kaum mehr als über unsere Zukunft.
B. Oe.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Zwischen den Welten
Kettenhemden
Kapitel 14 – Truppen-Druck
Im Flak-Visier I
Im Flak-Visier II
Kapitel 15 – Gas geben!
Im Flak-Visier III
Im Flak-Visier IV
Kapitel 16 – Opfern oder retten?
Im Flak-Visier V
PROLOG
Erwachen
In zerschlissene, lehmbraune Lumpen gehüllt, die wie ein zerrissener Jutesack mit Erdenstaub und Kartoffelschalenresten verschmutzt an ihm hingen, schlenderte der kleinwüchsige, gebeugte Mann durch eine mittelalterliche, belebte Innenstadt. Sein struppiges, langes, viel zu früh ergrautes, silber-weißes Haar verbarg er unter einer filzig-speckigen Kapuze seines löchrigen, schmutzigen, dünnen, absolut heruntergekommenen Leinenmantels, der ihm zudem auch noch viel zu groß war und um seine schmächtige Gestalt beim leichtesten Windhauch schlotterte, als ob er ständig zittern würde. Er drängte sich durch die Menschenmasse, die ihn entweder missachtete oder ihn schleunigst von sich stieß, um den bettelarmen Rinnsteinsammler augenblicklich wieder loszuwerden – solch einer war ein Tunichtgut, der als Beutelabschneider gefürchtet wurde, ein Dieb, der sich mit einem zackig ausgeführten Messerschnitt die Münzsäckchen der Bürger und Kaufleute stahl.
Heute war Markttag in den engen kopfsteingepflasterten Straßen, die vor feilbietenden Händlern, lauthals ihre Waren anpreisenden Marktfrauen, sich tummelnden Gauklern und wagemutigen Akrobaten, sowie feilschenden Käufern und ausgelassen kreischenden Kindern überzuquellen schienen.
Die Kinder rannten ihm nach und riefen ihm gemeine Beschimpfungen hinterher, die er mit gesenktem Kopf zu ignorieren versuchte, aber ihre Worte trafen ihn jedes Mal trotzdem hart, wenn er sich zu sputen versuchte und sie wieder einmal schneller als er waren, zu ihm mühelos aufschlossen und ihn „Furzhut!“ riefen, weil sein engelsweißes Haar verfilzt war und er gegen den Wind säuerlich-ranzig muffelte, wie abgestandener Wildbret-Furz.
Hier war immer was los. Hier tanzte der mittelalterliche Bär. Der Markttag war einmal in der Woche vorm Rathaus der ausgerufene Ausnahmezustand, der die gesamte normannische Stadt umtrieb, fast alle - von Jung bis Alt - den ganzen Tag auf den Beinen hielt, um zu kaufen, zu verkaufen, zu tauschen – und zu stehlen.
Man kannte sich und man lernte sich kennen.
Der alte gebrechliche Bettler bahnte sich hier seinen beschwerlichen Weg durch die dichtgedrängte Menschenmenge. Der Lärm war ohrenbetäubend, es stank nach Schweiß und anderen säuerlichen, penetrant übelriechenden Körperausdünstungen unzählig schmuddeliger Leute des Abendlandes im 9. Jahrhundert nach Christi Geburt, die hier an den vielen Marktständen und Plätzen mit teilweise zwielichtigen Angeboten etwas erwerben, tauschen, verscherbeln oder schlichtweg klauen wollten. Hierbei war auch der Mensch die feilgebotene Ware, die sich sogar selbst anbot, um eine Fronarbeit anzunehmen, die jemand anderes aus Adelskreisen vergab.
Auch das kannte der gebeugte Mann schon längst, der selbst stets im Dienst eines Burgbesitzers für schmale Kost und zugige Unterkunft gearbeitet hatte. Die Armut war groß; es gab nur wenige Gelegenheiten, gutes Geld zu verdienen, wenn man keiner Gilde angehörte und für einen gutwilligen Fürsten arbeitete. Beides war ihm bislang nicht gelungen, und wenn ihre Stadt auch noch in die näher rückenden Kampfhandlungen mit den aus dem hohen Norden einmarschierenden Wikingern zu tun bekamen, sah er nur noch einen Ausweg darin, sein Leben retten und verbessern zu können, indem er die Flucht ergreifen und woanders neu anfangen würde. Doch das bedeutete eine noch viel größere Anstrengung, als sein bisheriges Leben zu fristen, das andere in den Freitod durch Hängen oder Gift längstens getrieben hätte.
Kinder rempelten ihn mehrmals achtlos über den Haufen. Immer wieder musste er sich mühsam aufrappeln, niemand half dem armen Greis auf die dünnen Beine. Er hob drohend seine faltig abgemagerte Faust und riss den Mund mit den trocken eingerissenen Lippen auf, wollte den kleinen frechen Lauseknaben empört Schimpfwörter hinterher brüllen, wie sie es dauernd mit ihm machten, ihn verhöhnten und verspotteten, weil er so mager und kraftlos war, aber seine heftige Klage blieb vollkommen tonlos in seiner Kehle stecken.
Mon Dieu! Warum brachte er kein einziges Wort heraus? Wo war seine einst kraftvolle Knabenchor-Gesangsstimme geblieben? Er hörte sich nicht, selbst wenn er lauthals schrie. Diese Machtlosigkeit, sich kein Gehör verschaffen zu können, trieb ihn in die Enge.
Die schäumende Menschenwoge trug ihn bereits ein Stückchen in der brodelnden Menge weiter, an Haushaltswaren, aus Holz und Metallen gefertigt, einheimischen Kräutern und Gewürzen und am blutbesudelten Fleischermann vorbei, da blieb ihm keine Zeit, sich weiter über die oberfrechen Mädchen und Buben zu ärgern und über seinen seltsamen Stimmverlust nachzugrübeln.
Oder war es hier nur so schrecklich laut, dass er seine eigene, vom Alter und Leid brüchig gewordene Stimme hatte nicht hören können?
Grau war für ihn diese Stadt, die eigentlich ein bunt wirbelnder Kessel war, in dem sich die schmutzige Wäsche der Menschheit sammelte, aber es gab weit und breit keinen Seifenmacher, der sie von der Verderbnis reingewaschen hätte, die sich in sichtbaren Schlieren im Wasser im Trog der Bürger-Menge sammelte.
Egal! Eine närrisch geschminkte Gauklerin in einem weiten, knallbunten Flickenkleid trudelte auf ihn zu, zerrte dem kleinen, stinkenden Bettelmann die Kapuze vom Kopf. Das silberblonde Haar fiel dem Mann strähnig ins verwitterte Gesicht. Die aufgeputzte Schaustellerin knallte ihm eine schallende Ohrfeige ins Gesicht und riss ihm fast einen Büschel seiner fettigen Haare aus, als sie ihn daran packte und zog, um ihn für seinen Ungehorsam zu bestrafen, den er ihr gegenüber begangen hatte. „Immer muss man dich suchen!“, keifte sie ihn an.
Er schrie stumm und ging gequält in die spitzen Knie runter und sank aufs speckig glänzende Kopfsteinpflaster nieder. Alle lachten ihn aus, verhöhnten ihn und rechneten damit, dass er zu weinen anfing, aber das tat er nicht. Tränen hatte er schon lange keine mehr, die er hätte weinen können. Er war in der Vergangenheit bereits zu oft bestraft worden, mit groben Schlägen und verletzenden Erniedrigungen, was für ihn alltäglich geworden war.
Die nahe stehenden Leute, zumeist niederer Herkunft, Fronarbeiter und Tagelöhner, lachten höhnisch, bogen sich amüsiert über die Pein des fremden Gammlers. „Wo bist du so lange gewesen, du missratener Kerl von einem Sohn?“, belferte das Weibsstück ohne sich am Gelächter, Johlen und Brüllen der überkochenden Menschenmenge zu stören. Für sie war es die Gunst des Augenblicks, um sich besser in den Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit zu stellen, denn die Leute waren derart leichtgläubig zu meinen, dies garstige Getue gehöre zu ihrer eingeübten Schau. Sie sah ihm in die sternenblauen Augen und erkannte ihren jüngeren Zwillingssohn: „Ach, Yorel, du Taugenichts! In der Schwangerschaft hätte ich besser keine Pflaumen essen sollen! Früchte des doppelköpfigen Teufels seid ihr zwei! Weiber, so merkt euch – esst keine Pflaumen, wenn ihr nützliche Buben und Mädchen gebären wollt! Yaron taugt wenigstens zum Glöckner!“ Das war für den Mob, den gemeinen Pöbel, Unterhaltung pur. Jeden Ort konnte sie zu einer Bühne erwachsen lassen; sie brauchte die zusammengezimmerten Bretter nicht unter den tanzenden Füßen, um ihr ureigenes Theater aufzuführen. Das konnte sie überall und immer.
Mutter! Oh, Himmel! Das war seine abergläubische Mutter, die in jeder verspäteten Schwalbe, die sich am Ende des Sommers nicht sofort auf den Zug nach Süden begab und durch ein offenes Fenster ins Haus verirrte, eine Unheilbringerin sah. Was machte sie nur hier? Sie sollte heute nicht hier sein!
„Hole deinen versoffenen Vater endlich nach Hause!“, schlug ihm Fabienne, seine Mutter, um die Ohren. Yorel war nicht alt. Er war ein verwahrloster Junge, der verwirrt um sich starrte.
Jetzt wusste er wo er war. In Frankreich, auf einem Markt. Mittelalter, 877 nach Christi. Die Vertreibung der Wikinger, die im Jahre 874 eine bislang unbesiedelte Insel vor der Eishölle des Nordens sich einverleibt hatten, war noch nicht lange genug her, als dass es von den Bewohnern des Abendlandes vergessen worden war.
Er erfuhr einen vorausschauenden Blick in die Zukunft: Oder war er im modernen Computerzeitalter, 2007 nach Christus? Da war eine sorgenvoll klingende Stimme ohne Geschlecht, die ihn rief, ihn zu sich locken wollte, wie die Sirenen, die dem in Suchtrausch verfallenen Seelen-Kämpfer den Willen heulend brechen wollen, bis man ihnen in die gasenden Sümpfe hirnlos folgt: „Leroy…“
Seine französische Mutter – Jaqueline Fabienne Smith de la Tour. Sie hatte ihm den ganzen Ärger eingebrockt, und er musste allein für die ganze Familie die versalzene Suppe auslöffeln.
Fabienne schubste ihn hart rückwärts. Er stolperte, die Leute stoben kreischend hastig zur Seite, und er wandte sich im Stolpern um, knallte der Länge nach auf den verschmutzten Boden hin, landete auf Bauch und Brust. Endlich flennte er doch! Stumm weinend krümmte er sich vor Schmerzen zu einem Kringel zusammen. Der blutdürstige Pöbel grölte begeistert. Wie ein geprügelter Hund rappelte er sich aus dem Unrat am Boden auf und zog sich überstürzt in die rasende, lachende Menge zurück – ihr schallender Hohn trommelte wie eiskalter Platzregen auf seinen gebeugten Rücken nieder, den er niemals gerade halten durfte. Verzweifelt flüchtete der stumme Junge vom wogenden Markt in eine der verzwickt verzweigten Nebengassen dieses rattenverseuchten Molochs aus der fraglich übelsten Zeit der Menschheitsgeschichte. Die wenige Kraft, die er in seinen dünnen Gliedern hatte, schwand mit einem Mal dahin. Vom Rennen war ihm heiß und übel, so glaubte er, sich sogleich in den schmutzübersäten Rinnstein des ausgetretenen Kopfsteinpflasters der engen Gasse übergeben zu müssen, aber ohne Essen war sein Magen gähnend leer, dass er keinen Mageninhalt mehr hatte, den sein ausgemergelter Kinderkörper nach drei Tagen ohne einen einzigen Happen hätte hergeben können. Deshalb rannte er weiter, einfach fort. Er konnte nicht mehr weiter, verlor fast vor Schwäche das Bewusstsein und musste sich erst einmal in einem verlassenen Hauseingang auf die unterste Stufe der Treppe hinsetzen, um neuen Atem zu schöpfen. Das böse Lachen klang noch immer in seinen Ohren nach, das er auf dem Marktplatz zu seiner Schande und zu seiner Mutter Belustigung zu hören bekommen hatte. Mit dem schmutzverklebten Lumpenärmel wischte er sich den Dreck aus dem Gesicht. Trotzig hob er den Kopf und stülpte sich die Kapuze wieder über das silberblonde Haar. Aus weiter Ferne vernahm er das leise Hämmern einer Schmiedewerkstatt – die Werkstatt seines Vaters. Er war unbewusst den ihm bekannten Weg zum Arbeitsplatz seines bärbeißig-barschen Vaters gelaufen, der ihm genauso wenig Schutz oder gar Zuneigung bot, die ihn in seinem endlosen Hunger nach Essen und Liebe wohl genährt hätten. Ein Hauch von einem Seufzen entrang sich seiner Kehle. Müde erhob sich der gebrechliche Junge, der höchstens zehn Jahre alt sein mochte, obwohl sein schmales Gesicht das eines uralten gramzerfressenen Mannes hätte sein können, der nur Härte im Leben kennengelernt hatte. Er trottete und wankte kraftlos zum Eingang der Schmiede, in der Alltagsgegenstände und - früher einmal mehr - Waffen gefertigt wurden.
In der Schmiede seines Vaters, wo das Feuer in der angefeuerten Esse schnaufte, stank es nach Schwefel, geschmolzenem Metall, das er still bei sich das Höllenblut nannte, weil es rot und zähflüssig wie gerinnendes Schweineblut war, wenn es in eine Form gegossen wurde und am Erkalten war, und ranzigem Schweiß, der tagein, tagaus die dicke Lederschürze seines übermuskulösen Herren tränkte und das natürlich anschmiegsame Material mit den Jahren der harten, ewig heißen Arbeit fast schwarz gegerbt hatte. Er starrte auf die Glut und hörte eine Blasebalg-Stimme, die einen Namen schnaufend hauchte: „Leroy.“
„Übernimm den Blasebalg, Nichtsnutz!“, schnauzte ihn sein Vater sogleich an - zwischen zwei schrill metallisch klingenden Hammerschlägen auf den Amboss, auf dem er mit einer hässlichen, langgriffigen Eisenzange ein schmales, an der Spitze rotglühendes Schmiedestück in seiner handwerklichen Kontrolle gefangen hielt. Die prallen Oberarme seines Vaters – er war bullig, breit in den Schultern, riesig, immer von verdünntem Nachwein, dem Burgunder-Piquette, betrunken - waren stets schweißüberströmt. Die angefeuerte Esse war nur wenige Schritte hinter ihm in der nach vorne hin offenen Schmiede untergebracht, die mehr einem Stall als einem Handwerkerhaus glich. Kein großer Auftrag für die Waffen- und Rüstungsschmiede war für den Schmied greifbar. Er musste sich mit den Schmiedearbeiten für alltägliche Gegenstände und Werkzeuge und dem gelegentlichen Reparieren von solchen zufrieden geben. Schlechter waren die Zeiten geworden. Es gab wochenlang nur mehr schlechtes als rechtes Wurzelgemüse, Emmer- oder Einkorn-Grütze, die sich manchmal mit Buchweizen und Roggen oder Dinkel abwechselte, wenn der Marktpreis jener Getreide gut war, dass sie es sich als fünfköpfige Familie leisten konnten. Frisches Brot und Früchteplunder oder gar in der Pfanne mit Schmalzfett ausgebackene Omeletts bekamen nur die Reichen der Stadt gebacken. Brunnenwasser durften sie aus dem Sickerschacht am Domplatz nach Belieben schöpfen, aber es war im Sommer oftmals eine Brackbrühe, die faulig ungenießbar war, und im Winter schmolzen sie bei der Esse in Tiegeln und Töpfen den reichlich fallenden Schnee, was Yarons und Yorels älterer Schwester Yolanthe ihre tägliche Aufgabe war.
Er näherte sich, hielt allerdings respektvollen Abstand, da er die wiederkehrenden Zornesausbrüche seines Vaters kannte. „Mutter hat gesagt“, setzte der vollkommen verstörte Junge – hörbar war er für sich selbst und für andere, was ihn verwunderte - schüchtern mit leiser Stimme an, aber sein Vater unterbrach ihn mit einem herrisch barbarischen Brüllen, das ihn beinahe von seinen dünnen Füßchen gefegt hätte. Der Schmied war das Wesen eines harsch reinigenden Stahlbesens.
„MUTTER!“ Yorels Vater schmiedete das allmählich erkaltende Stück Eisen mit inbrünstiger Wut und unbändiger Kraft seines rechten muskelbepackten Oberarmes zu Ende, wobei seine Rückenmuskeln sichtbar arbeiteten, als er das entstehende Werkzeug geschickt drehte und wendete, ihm mit gezielten Schlägen die gewünschte Form verlieh. Jeder einzelne Hammerschlag auf den Amboss dröhnte schmerzhaft in Yorels Schädel, hallte bebend nach, und das Prasseln und Fauchen des Feuers in der Esse flößten ihm eine zusätzliche Portion an Angst ein, die ihm den nötigen Respekt gegenüber einem Erwachsenen vermitteln wollten. Er schrak zusammen und wollte sich die Ohren zuhalten, wagte es aber nicht, diese Schwäche vor seinem bärbeißigen Vater jemals zu zeigen. Sein Vater hatte wieder einmal getrunken. Das wusste er genau. Sein teutonischer Vater – Johann Wolfger Leonhard Schmidt. Ein brutaler Kerl, so hart, wie der Eisenamboss, auf dem er arbeitete. Diesem Mann konnte nur eine der Naturgewalten Einhalt gebieten. Vielleicht reichte sogar dies nicht aus, um ihn in seinem Irrtum zur Weisheit zu belehren.
Yorel wusste, wo er war. In Frankreich, in der Schmiede. Mittelalter, 877 nach Christi. Ganz bestimmt!
Etwas stimmte nicht, Störfeldrauschen überlagerte sein Dasein.
Oder war er im modernen Computerzeitalter, 2007 nach Christus? Er wusste nicht, wohin sich wenden: Vergangenheit - Zukunft. Die Stimme, die weder Er noch Sie, sondern Ersie war, rief ihn zu sich ins Licht, wo er sich erlöst wiederfinden wollte: „Leroy!“
„Hörst du denn nicht, was ich gesagt habe?“, dröhnte Leonhard, den großen Schlägel drohend in Yorels Richtung erhoben. „Geh zum Balg und schaff was!“ Von draußen drang das helle Läuten zur Mittagsstunde in die Schmiede herein, wo es immer heiß und laut war. „Yaron ist längst am Seilzug der Mittagsglocke! Tu was!“
„Aber...“ Der Junge duckte sich rasch, als sein Vater noch wütender wurde, das soeben geschmiedete Werkzeug an der großen Zange haltend mit brutaler Wucht in die gluthaltige Esse hinter sich pfefferte. Ein rotglühender Funkenregen stob empört auf, regnete knisternd in der Schmiede nieder, wo sie auf dem gestampften Lehmboden nach und nach verglommen.
„Du willst deinem Herrn widersprechen?“, donnerte er ungehalten. Mit dem schweren Hammer in der riesigen Faust hechtete er um den klotzigen Amboss herum und stürmte auf seinen verschüchterten, ungehorsamen Jungen zu, der sich nicht zu rühren wagte.
„Vater! Nein, nicht!“, kreischte Yorel ohne wirklich stimmähnliche Geräusche aus seinem aufgerissenen Mund hervorzubringen. Seine sanften stahlblauen Augen weiteten sich vor Entsetzen und Panik. Er wollte weglaufen, aber eine unsichtbare Kraft hielt ihn in ihrer Macht auf der Stelle stehend gefangen, wie die schweren Eisenschellen und Fesselketten an den eitrig-blutig wundkrustig aufgescheuerten Knöcheln eines Hühnerdiebes im nachtdunklen, feuchten Loch des modrigen Schlossverlies, wo einem der Gestank der Exkremente den Atem raubte.
„Ich werde dir Gehorsam einhämmern!“ Der Schmiedehammer sauste mit roher Gewalt auf Yorels Schädel unter der Kapuze nieder. In seinen Ohren schrillte die Todesglocke. Dann wurde es hell und grell um ihn herum ...
Zwischen den Welten
Sonntag, 30. Mai 2032
… Die frühmorgens zum evangelischen Gottesdienst läutenden Glocken der alten Backsteinbau-Stadtkirche weckten ihn, als das göttliche Klingen und Rufen zum gemeinsamen christlichen Gebet ihm aus der Ferne ins Gehör drang. Besonders religiös war er nicht, aber es war ihm nicht unangenehm, das leise Glockenläuten zu hören. Es zauberte ihm ein Lächeln auf die eingerissenen Mundwinkel, denn er dachte an seinen älteren Zwilling Yaron, der im Domturm der Glöckner war und fleißig seine Arbeit verrichtete.
Nein, halt … da stimmte etwas nicht in seiner Erinnerung … John war sein Zwillingsbruder. Auch nicht ganz richtig, teilte ihm sein wiedererwachendes, bewusstes Gedächtnis mit. John und Yaron sind richtig – ihr hattet schon viele Namen, du und dein Zwilling. Reden konnte er nicht, denn die Dürre in seiner Kehle war von schmerzhafter Trockenheit, so versuchte er nicht zu sprechen. Es kostete ihn Kraft genug, die von langem Fieberschlaf verklebten Augenlider soweit zu öffnen, dass er sie zu Sehschlitze, wie im geschmiedeten Ritterhelm, offen halten konnte, doch das gelang ihm nicht auf Anhieb, denn das grelle Licht, das seinen Sehnerv traf, ließ Tränen in seinen Augen aufsteigen, die sein Sichtfeld so sehr verschwimmen ließen, dass er gar nichts erkennen konnte. Immer wieder blinzelte er und zwang sich, ins Licht zu schauen, wo er zumindest einen Umriss, einen Schatten sich erhoffte zu erkennen, doch es waren nicht seine Augen, die ihm die erste, seit langen Tagen klare Sinneswahrnehmung einfingen. Er war so sehr müde und fühlte sich schwer in den Gliedern, die er wie in der Rüstung gefangen wahrnahm. Mühsam wollte er sich aufrichten, um an sich hinab blicken zu können, aber da waren Widerstände und Kräfte am Werk, die ihn (am Boden?) gefesselt hielten. Einen kurzen Blick von nur einem Sekundenbruchteil lang – er steckte in seiner Rüstung, das Langarm-Kettenhemd und die Kettengliederhose hingen so schwer an ihm, dass er den starken linken Waffenarm, der seine Lanze im Distanz- oder sein Schwert im mittleren Nahkampf geschickt führte, nicht heben konnte, aber … schwerfällig realisierte er, dass er wahrscheinlich durch einen Schwertstreich am Oberarm verletzt worden war. Hatte das geschmiedete Kettenhemd an dieser Stelle nicht gehalten? Waren die einzelnen, Zigtausende von Stahlringe nicht richtig ineinander mit der Zange verhakt worden und in sich geschlossen geschmiedet gewesen? Sein Vater, der Waffen-Schmied von Gellertsheim, hatte diese mittelschwer bewehrenden Hemden für die Ritter von Gellenstein hergestellt gehabt – niemals zuvor hatten sie versagt und waren gerissen, von einem Schwerthieb aufgeschlitzt oder durch einen geradeausgeführten Lanzenstich durchbohrt worden, denn nur sein Vater hatte mit geschmolzenem Engelserz Schwerter und Hemden aus Sternenstahl geschmiedet! Er wandte seinen Kopf, der unter der Hundsgugel sich nur beschwerlich im Liegen in eine Richtung wenden ließ, um etwas zu sehen, und plötzlich wurde es leichter, denn da zog ihm jemand den Helm herunter, und es war nicht mehr so schrecklich heiß und stickig. Eine Hand wischte ihm trostvoll über die schweißbedeckte Stirn. Ein kühlender Lufthauch streifte seine verschwitzten Wangen. „Eva …?“, fragte er tonlos an die Frau gewandt, die aus der Sonne direkt zu ihm zu kommen schien. „Evanthia? Geh nicht fort! Bitte …“ War es wallender Getreidestaub von der Ernte, der ihre kornblonden Haare darstellte, oder war es tatsächlich ihr langes Haar, das ihn mit waberndem Nebelstaub einhüllen und sich einverleiben wollte? Eine Sehnsucht flammte in ihm auf, die ihm den Unterleib verbrennen wollte, dass er glaubte, das Metall seiner Rüstungsteile an den Schenkeln glühe in gleißender Weißglut und verbrenne ihm die Haut unter der dicht gewebten Leinenschutzhose.
„Ich bin hier, Geliebter!“ Sie blieb bei ihm und berührte seinen linken Oberarm, durch den ein glühend heißer Schmerz stechend fuhr, der ihn an den Rand der Burgschlossmauer brachte, auf dem er taumelnd in die Endlostiefe des Wassergrabens starrte, der das Monument in voller Umfassung umgab. Wollte diese Frau ihn von der Mauer ins Burggrabenwasser stoßen? Nein, sie wollte ihm nichts tun, obwohl sie selbst in einer ähnlichen Rüstung steckte, wie er auch am Leib trug, der seinem willentlichen Gehorsam sich widersetzte und scheinbar grundlos hilflos war, denn er lag wieder und drehte den Kopf nach links, wo die ineinander geschmiedeten Kettenglieder des Rüstungshemdes am Oberarm zerrissen waren, und eine klebrig rote Flüssigkeit hatte das darüber getragene Wappenwams und das darunter angezogene helle Langarmleinenhemd satt getränkt. Das hatte er noch nie an sich gesehen, das wollte er nicht an sich sehen! Neben sich sah er einen anderen Männerkörper liegen, der vom Kampf um die Burg von den Erstürmenden geschunden und von einem Pferd mit dem Fuß an einer Kette gefesselt an dessen Sattel zu Tode geschleift worden war. Sein Gesicht war von Schürfwunden entstellt. Aber er erkannte ihn daran, dass er ihm selbst bis aufs silberhelle Haar glich, sich von ihm nur darin unterschied, dass er grüne Augen hatte. Yorel hatte blaue Augen. Es war sein älterer Zwillingsbruder. „Yaron“, stammelte er, dann schrie er: „EVA!“
„Nicht! Sei ganz ruhig! Du wirst wieder heil werden!“, versprach sie ihm und strich sanft über seine Wange, auf der Tränen perlten. „Eva …“, bettelte er um Erlösung aus diesem Alp, der sein Leben war - und Yarons Tod. Zugleich wusste er jedoch, dass es ihn wieder und wieder in die Tiefen der Verschleierung hinabzerren wollte – Es: die schleimig an ihm hängende Erinnerung an Erniedrigung, Verlust und Dauerprovokation von Aggressoren, gegen die er als Soldat der Klarheit seit Jahrtausenden mit permanent gezücktem Schwert der Wahrheit und erhobenem Schild der Liebe in stahlblau leuchtender Rüstung ankämpfen musste.
„Es wird wieder gut werden! So lieg still, dann können wir helfen!“
Hände waren da, hoben ihn auf und trugen seinen verwundeten Körper vom Schlachtfeld fort, das von der Hitze des vergangenen Nachmittags schwärend nach vergossenem Blut und den Exkrementen hunderter sterbender Männer bestialisch nach dem Erststadium der Verwesung stank, an der sich Krähen und Wölfe und die Aasfliegen zu einem Festmahl treffen und sich an den Überresten der Schlacht um Gellenstein laben und weiden würden.
„Alles wird gut!“ Jemand mit ölschwarzem Haar, ein kleiner, drahtiger Mann streifte ihm etwas übers Gesicht, das er nicht kannte, noch nie in seinem Leben gesehen hatte, aber es half ihm, besser atmen zu können und den fürchterlichen Schlachtfeldgestank aus den Nasennebenhöhlen zu vertreiben; das olivbraune Gesicht des Mannes war ihm bekannt, doch seine Kehle konnte keinen Laut formen, um ihn bei seinem Namen zu rufen, den er klar im Gehirngewölbe geschrieben stehen sah: Antonas, der Abbeter.
Eine andere Frau mit kastanienroten Haaren und wie vom Morgentau benetzten moosgrünen Augen kam aus dem Sonnennebel aus den Lichtstrahlen auf ihn zu und lächelte ihn an. „Hab keine Angst!“ Sie zog ihm den klarsichtigen Gegenstand, der sich ihm über Mund und Nase schmiegte und ihm das Atmen erleichterte, wieder herunter und tupfte ihm mit einem feuchten Tuch über die von brennender Sonne blutig aufgeplatzten Lippen, dann gab sie ihm die Atemhilfe zurück, was ihn seine Schmerzen fast vergessen ließ, und sie legte den Lappen einmal gefaltet zusammen und platzierte ihn auf seiner heißen Stirn, was ihn sogleich beruhigte.
„Yo-lan-the …“, keuchte er und wollte nach ihr tasten, da hielt sie seine zitternde Hand in ihren Händen. Ihr Griff war männlich fest, und er sah sie plötzlich nicht mehr, was einen verwirrten Ausdruck auf seinem schweißgebadeten Gesicht erscheinen ließ. „Schwester, geh nicht fort!“, bettelte er, verzweifelt um sich fuchtelnd.
„Ja, ich bin hier! Wir lassen dich nicht allein!“, tröstete sie ihn.
„Eva!“, schrie er nach seiner Gattin, die in ihrer Ritterrüstung nahe zu ihm ans Verwundetenlager heraneilte. Unter Schmerzen wandte er sich im Bett. „Wo ist Wolfgangus? Hroswitha … wo ist sie?“ Er suchte mit fiebrigem Blick im Raum herum und fand sie nicht.
„So lieg still, Lee-Liebster!“, befahl Evanthia ihm, die eine merkwürdigen, ihm ebenfalls unbekannten Gegenstand in den Händen hielt, der aus einem seltsamen Knisterstoff bestand. Sie gab den Gegenstand an Antonas weiter und zerrte sich den Waffenhandschuh aus dickem Leder, Kettengliedern und zusammengenieteten Schuppenpanzerplatten von der rechten Hand, die ihr Waffenarm war, und strich ihm sanft über die linke Wange. Ihr langes blondes Haar fiel offen über ihre Schultern. Den Helm hatte sie abgelegt. „Lieg still! Ansonsten können Aquillon und Kasimir dich nicht ausziehen – sie schneiden dir versehentlich in den Leib - und Antonas muss deine Wunden versorgen! Lee, mein Liebster, so liege still und atme ruhiger!“ Er konnte nicht still liegen, da kannte sie nur noch ein einziges Mittel, ihn körperlich einmal derart zu fordern, dass er im Anschluss nach ihrer Maßnahme der Liebe tief in den Schlaf sank, der ihn vor dem Sterben rettete, und Antonas zerschnitt mit einer Blechschere seine Rüstung, Aquillon sprengte mit bloßen Holzfällerhänden die ihn schützenden Kettenpanzerglieder, und Kasimir riss ihm die Reste von Stofffetzen seiner verschmutzten Leinenkleidung vom verletzten Leib, den Eva in vollbusiger Nacktheit wie den Ur-Hengst in die Schmerzlosigkeit ritt und ihn in die höheren Hallen des Lichts führte …
Welten in Welten
Nur das Zusammenspiel der drei Körperwelten –
Seele, Geist und Fleisch –
bringt uns in völligen Einklang
mit unserem höheren Vater-Mutter-Gott –
Ersie.
Lassen wir diese Welten sanft ineinander fließen!
Burgschloss Gellenstein; Krankenstation der SAG-Einheit „Ah … jetzt gehen die Positionslichter wieder an“, sagte eine leise Stimme ganz nah bei seinen Ohren, die ihm einen Eindruck von körperlosem Dasein im Zwischenraum aller Zeiten verschafften, das sich nur auf die geistige Ebene beschränkte.
Das war schon genug der Anstrengung für ihn, aber er wollte sich Gewissheit darüber verschaffen, was die Quelle des gleißenden Lichts war, das er einerseits hasste und mit zusammengekniffenen Augen mied, weil es ihm wie tausende Blitzschwerter in die von überlangem Schlaf empfindlichen stahlblauen Iriden stach, andererseits spürte er einen inneren Drang, sich aus der bleiernen Dunkelheit und den wirren Träumen herauszuwinden, um den Weg des Lebens an klarer Oberfläche weiter zu beschreiten. Wo? Jenseits oder Diesseits?
„Gute Frage, Jason. Du warst eine Woche lang mehr im Jenseits als im Diesseits“, klärte ihn eine weitere Stimme neben sich auf. Sofort hatte er wieder vergessen, was man zu ihm gesagt hatte. Es neigte sich jemand über ihn und nahm ihm die Atemmaske ab, unter der seine Stimme gedämpft klang, kaum mehr zu verstehen war als ein heiseres Nuscheln. Sprechen wollte er nicht müssen, denn seine Kehle war so rau, dass jedes einzelne Schlucken höllisch brannte, wenn er den eigenen Speichel herunterschluckte, von welchem sich nur wenig in seiner ausgedörrten Mundhöhle sammelte.
War das Antonas? Äh … Anthony? Er blinzelte verwirrt. Hatte er doch gesprochen? Hals und Zunge schmerzten ihn, da spürte er einen leichten Druck im Nacken und dann einen weiteren an seinen aufgesprungenen Lippen. Eine stützende Hand richtete ihn auf, und etwas Feuchtes traf seine Zungenspitze, da begann er gierig zu saugen und zu trinken, aber nach drei Schlucken nahm ihm die körperlose Stimme das Gefäß mit dem wohlschmeckenden warmen Wasser wieder weg. „Mehr Tee bekommst du in ein paar Minuten“, gab die Stimme ein Versprechen, das er glauben musste, denn seine Schwäche verdammte ihn in die Machtlosigkeit, sich nicht selbst helfen zu können. Ermattet blinzelte er ins Licht, worin sich ein dunklerer Fleck in sein Gesichtsfeld schob, der von grellen Scheinwerfern angestrahlt zu sein schien. Oh, er hatte wohl wieder etwas gesagt, denn die Person antwortete ihm.
„Nein, du bist nicht tot, und ich bin weder Kasimir, der an deiner Seite dienende Kettenhemd-Kämpfer noch der Engel Nathaniel, der Feinstoffliche, der die Heilung bringt, aber von Spontanheilung könnte man fast bei dir reden, Jass!“, lachte Anthony leise. „Zumal ich dachte, ohne Impfung würdest du diese Krankheit nicht überleben. Aber dein deutsch-französischer Sturkopf hat dich scheinbar wieder einmal gerettet.“
Da war ein Männergesicht, gerahmt von Flutlicht, das seine kurzen blonden Locken zum Leuchten brachte, und die indigoblauen Augen des Mannes glänzten erfreut als sehe er einen seit Jahren auf See verschollen geglaubten Freund wieder. Seine Hand zitterte so sehr, als er sie zu heben versuchte, aber da war sofort die Hand des Mannes an seiner Seite, die sie packte und festhielt und immer wieder drückte, damit er nicht zurück in den beinahe komatösen Fieberschlaf voller Alpträume und Schreckensmomente zurückgleiten konnte. „Jason, wir lassen dich nicht allein!“, sagte der Mann, der bereits zuvor in Seemannsbegriffen etwas Aufmunterndes zu ihm gesagt hatte. „Ich lasse uns mitsamt der Argo nicht sinken!“ Seine grinsenden Mundwinkel waren Ankerhakenenden.
„Auf keinen Fall!“, stimmte der andere Mann zu. „Da haben wir im Adamskostüm schon andere Schiffbrüche überstanden, stimmt ´s Hannibal?“ Ein raues Holzfäller-Lachen folgte kurz.
War das ein Witz, ein aufmunternder Scherz oder war es ernst?
Die Zeitebenen verschwammen für ihn, ließen ihn in seine eigene mysteriöse Vergangenheit blicken, in der er als Jason mit Kapitän Idas und mit seinem … seinem Schwager (?) Askalaphos auf der schwer mit Mann und Schild gerüsteten Argo in See gestochen war, um für Jasons Onkel Pelias, dem König von Iolkos, das seit Jahrhunderten verloren geglaubte Goldene Vlies zurück zu holen. „Verluste sind der Antrieb zum Weitermachen“, murmelte jemand, der die tiefe Stimme von Askalaphos besaß, aber auch Hamilkar Barkas, karthagischer Feldherr und Vater von Hannibal, hätte sein können. Sein Vater? Hitzewellen ließen ihn fiebrig schwitzen.
Wer war er selbst? Adam? Hannibal? Jason? Yorel? Leroy …?
Fetzen der Erinnerung blitzten auf seiner geistigen Leinwand auf – sie waren eindringliche Eindrücke von einschlagenden Granaten und schreienden Verwundeten, Blutspritzer, die ihn an der Wange trafen; Blut, das aus seinem sterbenden Nebenmann im Unterholz aus dessen getroffenem Körper durch den pulsierenden Blutdruck herausgeschleudert worden war. „ALEX!“, schrie er heiser, wollte aus dem Liegen hochfahren, doch da waren starke Hände, mindestens tausend an der Zahl, die ihn festhielten – nur vier waren es in Wahrheit, aber er fühlte sich von einem urzeitlichen Kraken mit zahllosen Armen und haltenden Saugnäpfen gepackt - und sanft bestimmend in die Kissen zurückdrückten. Das Tageslicht ließ seine gereizten Augen brennend tränen. Er blinzelte träge.
„Ich bin hier, Lee-Jay! Du hast zwar zehn Pfund abgenommen, aber du bist auf dem Weg der Besserung! Der Doc sagt, dass du in einer Woche schon wieder fit genug bist, um mir eine weitere Kugel aus den Rippen heraus zu puhlen!“, sagte eine, tief im Bass schwingende Männerstimme auf der anderen Seite zu ihm. War das Askalaphos-Alex? Oder Hamilkar? Nein, Aquillon …
Mühsam wandte er den Kopf auf dem Kissen und blinzelte ins Licht, das den breiten Brustkorb des Holzfällerhünen noch breiter in seiner verzerrten Wahrnehmung erscheinen ließ. Er formte eine Frage kaum gehaucht, die nicht der große Soldat beantwortete, sondern der schlanke Offizier mit den jeansblauen Augen.
„Was los war?“, schnaubte der Mann mit den blonden Locken auf der anderen Feldbettseite fassungslos, aber er grinste ihn aufmunternd an, als er ihn anblinzelte. „Das fragt er ernsthaft.“
„Du hast eine Woche lang zwangsgefastet, Lee-Jay“, erklärte ihm der Bass-Mann. „Du warst die reinste Einbahnstraße. Wenn der Zwieback reinfuhr, legte er kurz darauf den Rückwärtsgang ein.“
„Wir sind bei dir geblieben, damit du überhaupt einen Tropfen bei dir behalten konntest.“ Frederick deutete auf die Infusionsflaschen mit Medikamente und einen Beutel mit Kochsalzlösungsinfusion, die an einem Galgen aufgehängt neben seinem Bett hingen und ihn über einen Venenzugang mit Flüssigkeit und Nährstoffe versorgten. Dr. Anthony Ramirez regelte die Tropfgeschwindigkeit.
„Meine Wunde hast du bestens verarztet“, bedankte sich Alexander. „Ich war nach zwei Tagen wieder auf den Beinen und habe aufgepasst, dass du brav im Bett bleibst, weil du dauernd bloß in Unterhosen und -hemd im Fieberwahn losziehen und mich erneut da draußen im Wald vor den Carla-Kugeln retten wolltest.“
Beruhigt sank er nieder und stammelte erstaunt, als er seine bei ihm am Krankenbett sitzenden beiden Freunde wiedererkannte: „Ian … Alex … ihr lebt …“ Erleichtert schlief er ein, doch diesmal war es der wirklich erholsame Schlaf, nicht das schweißgebadete Leibwinden und Krampfen, das ihn eine Woche lang unter Fieberschüben geplagt und auf die Lazarettfeldliege niedergezwungen hatte. Selbst jetzt, da er fest schlief, ließen Captain Frederick Ian Steven Taylor und Gunnery Sergeant Alexander Wallace ihren im Krieg neu gefundenen Freund Staff Sergeant-Major Leroy Jason Adam Smith nicht allein.
„Unglaublich“, murmelte Frederick erstaunt und blickte verwundert aus der einfachen Arbeitsuniform, die er trug, auf den Schlafenden nieder. „Um uns macht er sich zuerst Sorgen, nicht um seine eigene Gesundheit, obwohl er hier liegt und auf sterbenden Aal unter letzten Zuckungen macht.“
„Ja, so ist Jass eben. Er denkt stets zuerst an andere. Ich kenne ihn gar nicht anders.“ Dr. Ramirez verließ zufrieden den Raum.
Stunden später
Langsam richtete er sich im Feldbett auf und sah sich um. Leroy lag auf der Krankenstation im … ja, wo war er eigentlich? Wo hatten sie ihn hingebracht? Über sich erblickte er eine massive Zimmerdecke, die den Saal in drei Metern Höhe überspannte und mit kunsthandwerklich vollendetem Stuck und üppiger Malerei, einem lebendig erzählenden Bild des mittelalterlichen Handwerkeralltags, verziert war. Vom neugierigen Blick nach oben wurde ihm plötzlich schwindlig, was ihn zwang, den Kopf aus der Nackenlage in die gerade Haltung zurück zu nehmen. Er sah sich um und bemerkte, dass er ganz und gar nicht allein in dem großen Raum war. Auf den ersten Blick zählte er zwanzig Betten, die allesamt belegt waren. Er war demnach nicht der einzige gewesen, der aufgrund der Verweigerung, sich gegen eine Magen-Darm-Infektion impfen zu lassen, mit dieser mysteriös fiebrigen Krankheit eine Woche lang auf der Plauze gelegen war. Das Versagen der Impfung zeigte sich ihm hier, denn er erkannte neben sich einen Soldat aus der SAG-Ten-Einheit, von dem er sich genau erinnern konnte, dass er sich von Dr. Anthony Ramirez hatte das Serum spritzen lassen: Private Lane Paula. Der Soldat war blass und murmelte im Fieberschlaf wirre Fantasien, die er kaum in ganze, deutlich verständliche Sätze formulierte.
Hatte er selbst auch so herumgestammelt? Offensichtlich ja.
Topfit war Leroy noch lange nicht, aber es ging ihm so gut, dass er sich nicht länger ans Bett gefesselt fühlte und im Krankensaal für ein paar Schritte auf und ab gehen wollte, um die eingerosteten Glieder wieder in Bewegung zu bringen. Lange hatte er geschlafen, wie lange, konnte er nicht abschätzen, denn ihm war das sonst gut ausgeprägte Zeitgefühl durch die Fieberschübe und die schweren Alpträume, die ihn geplagt und verfolgt hatten, in den letzten Tagen abhandengekommen. Abenddämmerung ließ die letzten Sonnenstrahlen durch zwei hohe Fenster herein, die ihn anlockten hinzugehen, um einen Blick nach draußen zu werfen. Vorsichtig setzte er sich auf die Kante seiner Liege, die kein richtiges Bett, aber immerhin besser als eine übliche Feldliege war. „Verdammte Axt!“, murmelte er matt. Wo war nur seine ganze Kraft geblieben? Leroy fuhr sich mit der linken Hand, an der er keine Bandage mehr trug, mit gespreizten Fingern, die vor Energiemangel leicht zitterten, durch die kurzen, allmählich nachwachsenden platinhellen Haare. Das Schwindelgefühl unter seiner Schädeldecke schwand erst nach einigen weiteren Atemzügen, die er kontrolliert ruhig einsog und wieder aus den Lungen entweichen ließ. Blinzelnd kniff er die Augen zu und öffnete sie wieder, ehe er entschlossen aus dem Sitzen aufstand. Prompt setzte der Drehschwindel wieder ein und wollte ihn in die Knie zwingen, die nackt aus seiner kurzen Schlafanzughose herausblickten. Nein, Macht über seine Körperfunktionen wollte er nicht schon wieder an die Kräfte des Unbewussten abgeben, weshalb er sich zusammenzureißen versuchte und den ersten Schritt mit leicht vom Körper abgespreizten Armen und Händen ausbalancierte, dann den zweiten und dritten Schritt vom Bett weg in den Mittelgang wagte. Er wankte zwar, aber Leroys Sturheit hielt ihn aufrecht und trieb ihn zu den großen Fenstern vorwärts, wo er sich einen Überblick verschaffen wollte, um zu sehen, wo sie hier stationiert waren. Er hatte eine entfernte Erinnerung daran, dass sie kürzlich nach dem Einsatz in Ulm aufs Schlossmonument nach Gellenstein zu Gellertsheim verlegt worden waren, aber mit endgültiger Sicherheit konnte er das nicht sagen.
Leicht fiel ihm das Gehen nicht. Verbissen kontrollierte er sich bei jedem Schritt, das von einem seltsamen Knistergeräusch begleitet wurde, aber die Schwäche in seinen Beinen und das ansteigende Rauschen seines Blutes, das er in den Ohren hörte und am Hals pochen spürte, wollten ihn in die wackligen Knie niederzwingen. Nein, das ließ Leroy nicht zu und tappte weiter vor zur Fensterfront, wo er sich auf den Sockel davor niederließ, ehe es ihm die Füße unter den schwachen Beinen wegzog. Die drohende Ohnmacht betäubte Leroy halb und ließ seinen Sichtkreis schwinden.
Durchatmen und keine Panik!, befahl Leroy sich sitzend, mit dem Rücken zum Bogenfenster. Dann wurde ihm schwarz vor Augen, und er neigte sich im Sitzen mit dem Kopf tief zwischen die Knie, bis das Blut in seinen Kopf zurückkehrte. Dabei stöhnte er laut, und nicht einmal das nahm er wahr, denn die schreckliche Übelkeit zwang ihn zum konzentrierten Gegenschlucken, das sich mit dem Rauschen in seinem Gehör mischte und alles überlagerte. Fetzen einer unglaublichen Erinnerung strömten sein Gehirn.
„Ohne Hilfe sollst du nicht aufstehen!“, hörte er Anthonys ersten strengen Tadel neben sich.
Er hatte Anthonys Schritte nicht gehört, als der Arzt sich ihm eilig durch den Krankensaal genähert hatte, um nach seinem Wohlbefinden zu sehen. Leroy richtete sich langsam wieder auf, da kam das Schwächegefühl erneut über ihn, und er kippte nach vorn, aber da war plötzlich ein heftiger, brennender Schmerz auf seiner linken Wange, der ihn in die Wachheit schlug.
„Jass!“, rief ihn Anthony an und der zierliche, zähe Kompaniearzt klatschte ihm eine deftige Ohrfeige ins mehlfahle Gesicht. „Komm zu dir!“
Leroy griff sich ans Kinn und kratzte sich den frei wild sprießenden Bart. „Doc …““
„Ja?“ Anthony beäugte ihn sorgenvoll.
„Wo bin ich hier?“ Die Bartstoppeln waren länger als drei Tage alt. Er konnte nicht realisieren, wie lange er nicht in der bewussten Welt existiert hatte und wo er in dieser unbestimmten Zeitspanne gewesen war. Hier oder sonst wo? Er hatte keine Ahnung.
„Wir sind auf Gellenstein.“ Anthony ließ Leroy nicht aus den prüfend beobachtenden, immerzu analysierenden, onyxschwarzen Augen und deutete kurz nach draußen, wo man vom hoch gelegenen Burg-Berg auf die Stadt Gellertsheim herabblicken konnte.
Still sah Leroy aus dem Fenster, ehe er sich zu Anthony wandte und fragte, während er sich im Bart kratzte: „Wie lange …?“
„Eine Woche.“ Anthony deutete mit seinem sauber rasierten Kinn in eine unbestimmte Richtung mitten in den Patienten-Saal. „Du bist hier mit einigen anderen isoliert. Ihr habt eine Magen-Darm-Grippe, sonders gleichen nicht zu finden. Nur wenige unter uns sind gesund geblieben. Die meisten – die Ränge rauf und runter – wurden nach und nach krank. Wir sind noch immer im Ausnahmezustand. Die WOMEN-Force schlug offenbar mit einer Bio-Waffe zu. Männer sind die einzigen Opfer. Ich weiß von keinen erkrankten Frauen im gesamten Umland von fünfzig Kilometern.“
„Ein modifizierter Virus?“, fragte Leroy, dessen vitale Denkleistung allmählich wiederkehrte und seine Lebensgeister belebte.
Knapp nickend teilte Anthony Leroys Vermutung: „Modifizierter Virus, der im Labor derart manipuliert worden ist, nur auf Männer zu inkubieren und zu einem Infektionsausbruch zu reifen. Verheerend und eine unmoralische Waffe, die einem atomaren Angriff oder einem Gas-Krieg gleichkommt im Rang aller Gemeinheiten.“
Zittrig erschöpft griff sich Leroy an die Stirn. „Ich erinnere mich an nichts – lag ich im Koma?“ Müde ließ er den Arm sinken. Dass er sich an gar nichts erinnerte, stimmte nicht, aber Leroy schwieg.
„Nein, glücklicherweise nicht. Aber sei froh, dass du dich kaum entsinnen kannst, was mit dir los war. Schlimm genug, dass ich die Erinnerung daran, wie du dich hast plagen müssen, wahrscheinlich nie wieder loswerde.“ Zuerst huschte ein sehr ernster Ausdruck über Anthonys Miene, dann lächelte er trostvoll, als er Leroys ängstlich werdenden Blick sah, der sich selten aus seiner zumeist verschlossenen Seele an die Oberfläche der Sichtbarkeit verirrte, wo andere seine Gedanken und Gefühle enträtseln konnten. „Der Captain hat dich nicht hängen lassen.“
„Ian?“, wunderte sich Leroy mit erstaunter Miene, dann erinnerte er sich daran, wie sehr sie sich während der Ausbildungszeit und bei den ersten Einsätzen unter Kriegsbedingungen beharkt hatten, um einander die Schwachpunkte aufzuzeigen, die sie selbst und das SAG-Team ernsthaft in Gefahr bringen könnten. Es hatte die beiden, charakterlich vollkommen ungleichen Männer letztendlich zur Freundschaft geführt, die eine verschworene Bruderschaft zwischen ihnen geworden war. Dass sie sich blind aufeinander verlassen konnten, war der größte Wert an der Sache, sich trauen zu können. In der Kulisse der Schlossburg und an der schiffbaren Krenz, die durch Gellertsheim floss, war es schon fast verträumte Romantik zu nennen, wenn nicht die Tatsache des Krieges im Hintergrund gestanden wäre, die sie daran hinderte, eine lustige Flussfahrt auf einem selbstgezimmerten Floß mit einem Bierfass und einer Kühlbox voll Sandwiches und Butterbrezeln zu unternehmen. „Hat etwa Ian nach mir suchen lassen?“
„Ja, Frederick hat mich solange bekniet, bis ich mit ihm in einem geklauten Jeep vom Sammelverbandsplatz erneut in den Wald von Sangen, Richtung diesem vermaledeiten Sendeturm, der da sein soll, rausgerast bin, um dich verdammten Sturkopf mitten in einer frisch umkämpften Zone zu suchen.“
Dass es riskant, nahezu dumm von ihm gewesen war, allein in die Kampfzone zurückzukehren, um auf eigene Faust nach weiteren Verletzten zu suchen, war ihm längst klar, aber er wollte es nicht laut vor Anthony eingestehen.
„Die anderen waren alle geimpft, oder?“, wollte Leroy wissen.
„Ja. Das Serum hat bei den meisten versagt. Leider. Die Entwicklungszeit war zu kurz, um ein wirksames Serum herzustellen und das auch noch in rauen Mengen. Viele von uns wurden krank und sind es teils noch immer. Die Lage hier auf der Krankenstation war zwischenzeitlich sehr angespannt.“
„Tote?“, fragte Leroy beklommen, der einmal nach draußen blickte und dann seinen Freund ansah, der vor ihm stand und in Sorge ihn abmusterte, weil er meisterhaft von sich selbst ablenkte.
„Ja und nein.“
„Ja und nein?“
„Keine Toten wegen dem Virus. Wir hatten Verluste beim Angriff im Sangener Wald. Dreizehn Leute am Ende des Einsatzes.“
„Verdammt …“, murmelte Leroy, der sich wieder mit linker Hand durch die fettigen Haare strich. Am Oberarm merkte er ein leichtes Ziehen, doch es war kein Schmerz, den er wahrnahm.
„Der General meinte nur, wir müssten mit solchen Kollateralschäden leben – es hätte die Bilanz schlimmer ausfallen können.“
„Kollateralschäden. Bilanz“, schnaubte Leroy kopfschüttelnd. „Und – schlimmer? Echt jetzt? Das ist nicht dem Wilson sein Ernst!?“
Anthony nahm neutrale Haltung ein: „Ja, man weiß nicht, ob man ihn verachten oder ihm zustimmen soll, dem General Köhler. Mir oder dir würde der sicherlich am allerwenigsten zuhören, wenn wir unseren Unmut über diese Situation kundtun würden.“
Mit vorsichtig tastenden Fingern berührte Leroy den Verband an seinem linken Oberarm. Es kribbelte und juckte darunter fies, da wollte er sich kratzen, aber Anthony nahm seine rechte Hand fort.
„Nicht kratzen! Der Streifschuss verheilt gut. Hunger?“
Leroy wagte es erstmals bewusst die Fühler innerlich misstrauisch Richtung Magen auszustrecken, der sich gähnend leer anfühlte und ihn tatsächlich anfunkte, er wolle etwas zum Verdauen haben. „Hunger … ein bisschen.“ Sein Magen grollte lauter, verlangte Aufmerksamkeit – und endlich eine ordentliche Portion Essen, denn er hatte offensichtlich seit ein paar Tagen gar nichts mehr gegessen. Er war ein leergeräumtes Kellergewölbe.
„Prima! Dann beschleunigen wir zurück zum Bett, und ich lasse dir was zum Essen bringen.“ Anthony fasste Leroy am rechten, unverletzten Arm, half ihm hoch und begleitete ihn zu seiner Liege. „Ein schönes, blutiges Steak? Wie wäre es damit, Jass?“, bot ihm Anthony verlockend an. Er wollte seinen Patienten auf Herz und Nieren prüfen.
„Um Gottes Willen, nein!“, lehnte Leroy sofort ab. „Zwieback.“
„Wenn du nach Gott rufst … Zwieback und Hühnerbrühe?“
„Ja, von mir aus. Was raschelt da so?“ Sein Bett war noch weit weg, erschien es ihm, aber er schritt tapfer weiter.
Anthony grinste leichthin. „Du raschelst.“
„Ich raschle?“ Leroy versuchte verzweifelt, seine Körperwahrnehmung zu schärfen. „Warum? Der sprießende Bart ist es nicht.“
„Das ist nur die Windel“, gab Anthony die Geräuschursache mit einem nebensächlich klingenden Tonfall bekannt. Beim letzten Wechsel des Hygieneartikels an Leroys Unterleib war er selbst dabei gewesen. Leroy schien sich nicht zu entsinnen, was sein Freund und ein Pfleger mit ihm angestellt hatten.
„Ich hab ´ne Windel an?“, regte Leroy sich beschämt auf. Peinlich berührt war er, blieb stehen und seine Hand fuhr in die Hosen, wo er Netzhose und Windel ertastete, die ihn anschmiegsam angelegt nach außen hin vor unbemerkten Missgeschicken von Blase und After sauber hielten. „Ist nicht wahr jetzt, echt nicht, Doc!“, beklagte er sich, doch dann wurde ihm klar, wie schwer erkrankt er und die anderen auf der Isolierstation tatsächlich waren.
„Doch, musste sein! Wegen dir musste ich zusätzlich den Captain und Alex als Krankenschwestern an deine Bettseite beordern! Du wurdest von Frederick zum Jeep getragen, und hier ließ er dich in der ersten kritischen Nacht nicht eine Minute allein.“ Anthony sah Zweifel in Leroys Augen. „Er hat alles wieder gutgemacht, falls er dir zuvor nicht dankbar genug für deine Hilfe bei all seinen Kollaps-Notlagen gewesen sein sollte.“
„Der Captain?“, fragte Leroy verwundert. „Fist? Echt jetzt?“ Konnte es tatsächlich sein, dass Frederick seinen Ego-Tripp überwunden hatte und ein Kamerad geworden war?
Anthony seufzte kurz, da er sich gezwungen sah, sich zu wiederholen, damit Leroy ihm glaubte: „Ja, er hat Blut und Wasser vor Angst um dich geschwitzt, als wir dich im Wald halb tot fanden. Captain Taylor hat deine jammernden Überreste eingesammelt und trug dich zum Jeep, mit dem wir uns schleunigst davon machten. Und er war hier bei dir. Tagelang wich er kaum von deiner Liege und half, dich zu versorgen. Alex war ebenso oft hier. Fred und Alex - du hast neue Freunde gefunden.“
„Neue Freunde? Ja …“ Leroy sah sich um und deutete in keine bestimmte Richtung, einfach irgendwohin im Isolationsraum, der zur Krankenstation gehörte. „Hier erscheint mir nichts als neu.“
Anthony legte den Kopf leicht schief, was ihm hinter seiner Brille ein eulenhaftes Aussehen verlieh, denn er dachte scharf nach, ob er bei Leroys Diagnose eine mittelschwere Gehirnerschütterung übersehen hatte. „Klärst du mich über deine Flashbacks auf?“
„Ist nur so ein … ein …“ Leroy zuckte hilflos wirkend die Schultern – er wusste nicht, wie und wenn doch, ob er vor Anthony ausdrücken sollte, was er im Fieberwahn so intensiv erlebt hatte, dass er längst nach dem Aufwachen und fieberfrei sich noch immer an die Szenen in den Alpträumen plastisch überdeutlich erinnern konnte. „Nur so ein Gefühl?“, hakte Anthony psychologisch kitzelnd nach.
Er wollte mehr darüber wissen, was Leroy im Fieber gesehen und erlebt hatte. Schon vorhin hatte er ihm nicht ganz geglaubt gehabt, er würde sich nicht daran erinnern, was geschehen war.
„Kann man so nennen.“ Mit Äußerungen zu seinen Gefühlen hielt Leroy meistens hinter dem Berg, der diesmal die knapp 75 Meter hohe Anhöhe der Burg von Gellertsheim war, auf der sie nach dem Einsatzdesaster von Ulm versetzt worden waren.
Damit er sich wirklich wieder hinlegte, half Anthony Leroy fürsorglich unter die Bettdecke. „Dir kommt hier etwas bekannt vor?“
Leroy deutete um sich herum. „Nicht nur etwas – alles.“
„Flashbacks in frühere Leben?“, vermutete Anthony ernsthaft. War Leroy durch das Fieber in die Welten der Erinnerung an frühere Leben abgetaucht gewesen, um sie nun bei Genesung mit an die bewusste Oberfläche zu bringen? Hatte er den Kriegskoller?
Knapp schüttelte Leroy den Kopf, was er sofort sein ließ. „Weiß nicht … möglich … oder? Colonel, ich war schon mal hier.“
„Du bist nicht irre.“ Beruhigend lächelte Anthony, der einen panischen Augenausdruck an Leroy wahrnahm, dessen Angst er im nächsten Augenblick zerstreute: „Hier ist keine Nervenheilanstalt.“
„Kann es sein, dass ich mich an ein früheres Leben erinnert habe, als ich im Fieber lag? Hab ich geredet?“
Grinsend gab Anthony preis: „So heftig, wie du geträumt und im Fieber erzählt hast, waren das mindestens drei frühere Leben, aus denen du lebhaft geplaudert hast! Hannibal. Adam. Jason.“
Laut grummelte und knurrte Leroys Magen. „Drei Leben? Könnte sein … dem Hunger nach, den ich jetzt echt kriege, könnte es sein, dass ich drei Leben lang nichts zum Essen hatte.“
„Ich bring dir Essen, dann erzählst du mir, woher wir uns kennen!“
„Jetzt könnte ich einen LKW verdrücken.“
„Was?“, wunderte sich Anthony und starrte Leroy musternd an. Er war wohl wieder am Fiebern und redete wirr. „Du willst ein Transportfahrzeug essen?“, fragte der Arzt amüsiert nach.
„Transportfahrzeug? Ach, nein! Mit LKW meine ich einen Leberkäsewecken – süddeutsches Lieblingsfrühstück von Zimmermännern und ähnlichen Handwerkern.“
Dr. Anthony Nicholás Ramirez, Colonel im Sanitätscorps, welches dem SAG-Ten-Trupp und der 43. Infanterie zugeordnet worden war, beeilte sich in die Schlossburgkantine, wo er auch außerhalb der regulären Esszeiten für die Verwundeten und Patienten seiner Sanitätsstation Verpflegung ordern konnte. Dem Küchenbullen in der Dauerküche war die Bestellung von einer Suppentasse voll heißer Hühnerbrühe und drei Scheiben Zwieback schon frustrierende Unterforderung, welcher er mit einem kurzen Brummen des Zustimmens des Arzt-Orders rasch nachkam und Ramirez beides auf einem kleinen Tablett über den Ausgabetresen zuschob.
„Danke!“, verabschiedete sich Anthony wortkarg und nickte dem Koch dankbar zu, der für diese geringfügige Dienstleistung für die erkrankten Kameraden kein Lob hören wollte. Anthony balancierte das Essen in den Krankensaal, eilte durch den Mittelgang, der die Feldbettliegen voneinander trennte, hörte und sah, wie es den ihm anvertrauten Patienten ging, registrierte im Vorbeigehen, wer eine frisch aufgefüllte Kanne Tee oder etwas Zwieback zum Knabbern oder eine saubere Nierenschale brauchte, und kam bei Leroy an, dem er die mitgebrachte Schonkost auf den Beistelltisch stellte.
„So! Hier mal was für deine quietschende Darmflöte – so sagen das raue Zimmermänner auf der Walz doch, oder Jass?“ Anthony schob die Utensilien auf dem Beistelltisch zusammen, aber der Platz reichte nicht aus, um das Tablett abzustellen, da klappte er die zusätzliche Tischplatte einhändig aus, hielt in der anderen flachen Hand das Tablett wie ein geschickter Kellner, und stellte das Essen ab. „Einmal Hühnersuppe mit Zwieback für den Herrn.“ Er blickte zu Leroy, der im Bett bis zum Hals hoch zugedeckt auf dem Rücken lag und fest schlief. Erfreut schmunzelte Anthony, denn es war kein weiterer Fieberschlaf, in welchem Leroy gebeutelt wurde. „Na, dann bleibt wohl mir die Suppe und dir der Zwieback“, murmelte der Arzt leise lächelnd. Er hatte damit gerechnet, dass Leroy zum Essen zu müde sei, aber er wollte ihn nicht gleich wieder allein lassen, so setzte er sich auf dessen Bettkante und aß die Suppe langsam löffelnd auf. Die leere Suppenschale stellte er auf das Tablett zurück, wobei er einen besorgten Blick auf Leroy warf, der im Schlaf murmelte und seufzte. Allerdings war er in diesem Moment nicht mehr überbesorgt, denn er wusste seinen erkrankten Freund auf dem Weg der Besserung.
Anthony wandte sich anderen Patienten zu, versorgte den einen und anderen, während Sergeant-Major Leroy Smith tief schlief. Er stand bei ihm am Bett und sah seine Miene träumend arbeiten.
Im Traum erlebte der ehemalige THARA-Feuerwehrmann einen Zeitsprung in die Vergangenheit, die er als seine eigene in einem früheren Leben kannte, ein Alptraum, der ihn seit seiner Kindheit in unregelmäßigen Abständen heimsuchte, wenn er selten, dafür heftig kränkelte …
Kettenhemden
Mitten im Mittelalter, mitten im Abendland; Frühsommer 877, Gellertsheim; ein halbes Jahr nach der Schlacht von Andernach
Sieger im Kriege waren sie gewesen, doch Jubel und Taumel vor Freude darüber waren längst verebbt. Andauernde Trockenheit in der Heide und das vorangegangene Ausbleiben eines schneereichen Winters hatten den Grundwasserspiegel in diesem regenarmen, dafür mild-sonnigen Frühjahr im Tal der Krenz, die der überlebenswichtige Fluss der Region um den Gellenstein war, so sehr gesenkt, dass der in der ursprünglichen Dorfmitte von Gellertsheim, das zur Stadt erhoben worden war, angelegte Trinkbrunnenschacht bis zum schlammigen Bodensatz hinab ausgeschöpft und am Verlanden war. Nur noch lehmgelber Schlamm war im Eimer, wenn man ihn am Seil in den Brunnen hinabwarf und anschließend mit der Winde nach oben kurbelte; bestialisch stinkender Faulschlamm es war, von dem keiner trinken konnte ohne kurz darauf an krampfenden Leibschmerzen und schwerem Durchfall zu leiden, doch kaum einer der zumeist einfachen Menschengemüter in jener Zeit des königlichen Gehorsams begriff, woher diese Beschwerden wirklich kamen. Land und Leute und Nutzvieh und das Getreide auf den Feldern waren am Darben und Dursten. Keine Erleichterung war in Aussicht.
Jung-Graf Georg Gellert trieb sein böses Spielchen auf der Einfassung des Brunnenschachtes mit einer halb verhungerten Katze. „Krallenkratzerlein, tanz auf einem Bein!“
„Lass es sein, Georg! Das ist nur eine kleine Katze!“, flehte der verlotterte Junge, an dem ein altes Leinenhemd wie ein Kartoffelsack hing, denn es war ihm als Halbwüchsiger viel zu groß. Reinwachsen würde er irgendwann. Er hatte das gebrauchte Hemd von seinem Ritter, einem Bär von einem gestandenen Hauptmann und Kämpfer für die Familie der adeligen Gellerts zu Gellenstein und deren hehrer Ritterschaft bekommen, der ihn vor seinem brutalen Vater, seiner närrischen Mutter und dem Hungertod gerettet hatte, weil er ihm immer wieder kleine Botengänge verschaffte, wofür er eigenes Geld und Versorgung mit Lebensmitteln bekam.
Georg, der Grafensohn Gellert, lachte hämisch und trällerte: „Franzosen-Pack - stopf ´s in den Sack!“ Herausgeputzt im Sonntagsstaat konnte er sich das herablassende Necken erlauben; ganz besonders heute zum Pfingstfest.
Yorel, der Schmied-Sohn, war ein Reingeschmeckter, der den Spott der eingeborenen Anwohner täglich erdulden musste, und fluchte im aquitanischen Dialekt, mit dem er seit seiner Geburt in Frankreich vertraut gewesen war, denn die Deutsche Zunge war ihm manchmal in Augenblicken der mündlichen Gegenwehr nicht schnell genug. Er war schmutzig von anstrengender Stallburschenarbeit auf dem Schloss für den Ritter Michaelus, dem er als Knappe diente, und dessen Pferd, das er jeden Tag mit frischem Futter und Wasser aus dem Dorfbrunnen versorgen musste.
Für die alteingesessenen Dörflinger, die Leute rund um den gepflasterten Domplatz, gab es in ihrer überschaubaren Welt nichts von höherer Wichtigkeit als den Brunnen. Hier sprudelte nicht nur die Wasserversorgung empor, hier trafen sich die Ortschaft und ihr Volk an jedem Tag der Woche und auch am heiligen Ruhetag, dem Sonntag, der den meisten einfachen Einwohnern von Gellertsheim zu Gellenstein genauso viel Arbeit und Anstrengung wie an allen anderen Tagen bedeutete. Das Vieh in den Stallungen, der Bauern und Pferdezüchter, für welches das frische Wasser aus weiterer Entfernung herangeschleppt werden musste, da die ausgetrockneten Regenläufe keinen Tropfen mehr hergaben, wo es keinen weiteren Zugang zum Fluss der Krenz fürs Wasserableiten gab, und auf den von ungewöhnlicher, wochenlanger Trockenheit gelb ausgedörrten Weiden wollte immerzu versorgt werden, ganz egal, ob es ein gewöhnlicher oder ein Tag zum Feiern war.
Tier und Mensch hat sich dem Durst unterzuordnen, so, wie es der Herr einst in der Geschichte der Schöpfung für alle Lebewesen bestimmt hatte.
Georg konnte das Tier nicht in Frieden lassen und traktierte die Katze munter weiter.
„Hör auf, die kleine Katze zu ärgern!“, verlangte Yorel.
„Garstiges Vieh!“, kreischte der andere Junge, der die von der Katzenkralle zerkratze Hand schnell zurückzog und in nobler Sonntagsrobe für den Gottesdienst gekleidet war.
„Bitte, Schorsch, lass sie! Sie ist nur eine kleine Katze!“, versuchte Yorel diesmal auf Deutsch, das Kätzchen vor der nächsten Neckerei des gleichaltrigen Jungen zu schützen.
„Nenne mich niemals Schorsch, du Nichts!“, herrschte Georg Yorel an, was die Katze in aller tierlieber Freundschaft zu dem Schmied-Jungen nicht leiden mochte.
Die Katze fauchte und fuhr die Krallen nach Georg aus, der mit einem Schritt und einem erschrockenen Ausruf nach hinten vor ihr auswich, aber er straffte sofort seine Haltung in Kragen und Mantel, den er mit dem Familienwappen darauf stolz zur Schau trug als sei er der Held, der die grölenden Wikinger ganz allein vertrieben hatte, die von seinem Vater und seinem Großvater in die Flucht geschlagen worden waren. „Es kann dir doch egal sein, das Kratzbürstchen – oder ist es deine Katze, Yorel?“
„Nein, sie gehört sich selbst, aber ich mag sie!“, legte Yorel früh Weisheit an den Tag, der heuer für das Erwachen des Bewusstseins aller Menschen zum Pfingstfest stand.
„Pah! Du redest weibisch wie mein Kindermädchen! Du kannst kaum unsere Sprache, du Franzmann, willst aber mir sagen, was ich tun und was ich lassen soll! Bürgerliche Fronarbeiter haben mir nichts zu sagen! Hast keine Kleider an, wie ein richtiger Bürger, ein guter Handwerker sie am Leibe hätte. Scher dich weg!“ Der Adelsjunge bekümmerte sich nicht um die Bitten eines armen Dörflinger-Jungen, der zudem hier nicht geboren worden war und ihre Sprache erst nach und nach verstehen und sprechen lernte, und versetzte der Katze einen Stoß, der sie über den mit geschmiedeten Metallringen und Bolzennägeln gesicherten Holzrand jaulend in den gemauerten Brunnenschacht hinab beförderte. „Hinfort, du Vieh!“
Das maunzende Wimmern verklang, je tiefer die Katze fiel. Ein platschender Aufprall - Stille.
„Nein! Nein! Nein!“, schrie Yorel entsetzt und hing sich über den Rand der Brunneneinfassung, starrte ins dunkle Loch hinab, als die Bauernkatze im finsteren Schacht verschwand und irgendwann am verschlammten Boden, dutzende Meter weiter unten – der Brunnen war beinahe versiegt - hörbar platschend aufschlug. Es erklang kein Miauen mehr von ihr zu ihnen herauf. Sie war tot.
Yorels stahlblauer Blick drang in Georgs grüne Augen. „Du bist ein Unmensch!“
„Kein Adeliger hört auf einen schmutzigen Hufschmied-Sohn, dessen Vater ein gefallener Trunkenbold ist?!“, setzte Georg Yorel als Mensch und dessen ärmliche Handwerker-Herkunft herab. „War er nicht früher Rüstschmied? Und nun flickt er Kessel und schlägt lose Hufeisen fest.“
„Wie der Graf angibt!“ Yorel kämpfte seine Tränen nieder.
„So schert euch davon, Lausbuben!“, kannte die Besenbinderin auf dem Weg zum Kirchenportal keinen Unterschied zwischen dem verlottert gekleideten Yorel Schmidt de La Tour und dem fein herausgeputzten Georg Gellert.
Dieser Sonntag sollte ein besonderer zum Feiern sein, denn es war das Fest zu Pfingsten, aber die bürgerlichen Sorgen hatten die bunte Zeremonie um den Glauben der Dorfgemeinschaft in den Hintergrund rücken lassen. Die eben erst in den Brunnen gefallene Katze, die absichtlich voll Boshaftigkeit vom jüngsten Sohn des Fürsten, der Stadt und Land einst von den raubenden, mordenden, schändenden Wikingern in einer dreckigen Schlacht vor den Stadtpalisaden Mann gegen Mann befreit hatte, gestoßen worden war, war in diesem Augenblick nur noch der winzige letzte Tropfen, der das Fass des menschlichen Unmutes der längst über die angespannte Situation aufgebrachten Dörflinger zum Überlaufen brachte. Ihr Überleben als Stadt, um das sich ihre Ängste rankten, war vom frischen Wasser aus dem Brunnen abhängig, und das zu jeder Zeit.
„So gib Obacht, Yorel!“, rief Yolanthe ihm zu. Angst hatte sie, dass ihr kleiner Bruder auch noch in den Brunnen fallen und sterben könnte. Heute sollte es keinen weiteren Verlust geben. Aus der sich zum Gottesdienst sammelnden Menge Leute vor der Kirche trat mutig eine auffällig groß gewachsene, junge Frau mit grünen Augen in einem bodenlangen schwarzen Wollwebmantel hervor, die zum Wasserschacht eilte, wo sie Yorel um die ausgemergelte Taille fasste, von der Brunneneinfassung herunter zerrte und sich dann neben die mit den Jungen lauthals schimpfende Besenbinderin gesellte, die beiden Prügel mit einem ihrer fest gebundenen Reisig-Feger vor allen anderen androhte. „Sey nicht närrisch!", mahnte Yolanthe. Yorel gab sie einen Wink, sich am Festtag zu benehmen; ihren ungehorsamen Bruder schlagen konnte sie nicht. Der Schmied hatte nach Ende des letzten Krieges kein einziges Schwert mehr geschmiedet und verkauft, so war er auf das Schmieden von Ketten, Hufbeschlageisen, Schlösser und Nägel umgestiegen, weil es ihm in der neuen Heimat eine notwendige Arbeit war, die ihm das täglich Brot einbrachte. Yorel litt unter den zornigen Ausbrüchen seines immerzu trunkenen Vaters, so behandelte Yolanthe ihn milde. Zu oft wurde er vom eigenen Vater gezüchtigt, wenn der eisenharte Pferdeschmied, trunken von verdünntem Wein, sich vergaß und Yorel in seinem Anfall von Zorn zumeist unschuldig bestrafte, ihm mit der aus schmalen Lederriemen selbst geschnürten neunschwänzigen Katze Gehorsam einprügelte. Grün glühende Katzenaugen waren ihre Blicke in die uninteressierten Gesichter der ihr gegenüberstehenden Bürger, unter denen sich kein einziger rührte, um die tote Katze aus dem Brunnen heraufzuholen. „Verwesen lasst ihr sie? Holt die tote Katze herauf!“ Keiner rührte sich. Sie klappte die Kapuze zurück.
„Was will sie?“, fragte der Köhler, der von einfältiger Natur war, weil er wenig menschlichen Kontakt hatte, nur selten aus dem Wald von Sangen nach Gellertsheim kam.
„Kaum tränken können wir dürstendes Vieh und unsereins!
Ein totes Tier im Brunnen vergiftet auch noch den letzten Tropfen!“, erzürnte sie sich, eine junge Frau von beispiellosem Mut zum offen gesprochenen Wort, deren flammendrotes Haar in der aufsteigenden Vormittagssonne wie ein funkelnder Kupferhelm, der keinerlei Grünspan angesetzt hatte und vom matten Patinabelag glänzend poliert worden war, weithin sichtbar leuchtete. „Aberglaube und Zweifel in euren kleinen Herzen bestimmen euren Alltag, wenn ihr nicht dem Ruf der Glocke folgt und der Priester euch lammbrav auf die geistig saftigen Weiden zurückführt, aber uns wissende Kräuterfrauen nennt ihr in einem Wort die teuflischen Wiederkehrer aus dem Hades, die einen Besen reiten, und schimpft uns als den Grund von ackerweiter Korn-Verderbnis, stinkender Mundfäule und Kindsverlust! Seid ihr am Ende der Vernunft? Rappelt euch auf!“
Niemand sprach ein Wort aus staunendem Mund, der den Dörflingern allesamt offen stand.
„Was redet sie?“, fragte eine gebrechlich klingende, ältere Frauenstimme, denn sie hörte sehr schlecht. Sie hielt sich die rechte Hand hinter die Ohrmuschel, um besser zu verstehen, was die anderen redeten.