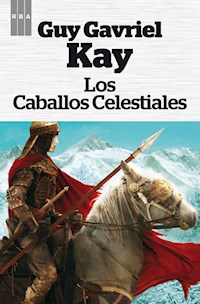12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Reich Kitai
- Sprache: Deutsch
»Am Fluss der Sterne« ist nach »Im Schatten des Himmels« der zweite epische Fantasy-Roman von Guy Gavriel Kay, der in Kitai spielt, dem magischen Reich der Mitte. Einst galt Xi'an als schönste Stadt der zivilisierten Welt, der Kaiserhof als Hort des Luxus und der Kultur. Doch seit Kitai in weiten Teilen an die Barbaren aus dem Norden gefallen ist, herrscht Angst auf den Straßen, und das Heulen der Wölfe hallt durch verfallene Gemäuer. Nur einem Mann scheint es möglich, das Reich der Mitte wieder zu neuer Größe zu führen: Ren Daiyan, Heerführer, ehemaliger Geächteter, Bogenschütze von fast mythischer Gestalt. An seiner Seite: die geheimnisvolle Lin Shan, vielleicht die klügste, auf jeden Fall aber die faszinierendste Frau ihrer Zeit ... »Das Werk eines Meisters auf der Höhe seiner Kunst!« The Washington Post
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 965
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Guy Gavriel Kay
Am Fluss der Sterne
Roman
Über dieses Buch
Ren Daiyan ist kaum dem Kindesalter entwachsen, als er im Dienste eines kaiserlichen Magistrats sieben Männer tötete und zum Geächteten wurde. Niemand ahnt, dass er einmal zu einem der mächtigsten Männer des Reiches werden soll.
Lin Shan ist die Tochter eines Gelehrten, und sie lernt Dinge, die anderen Frauen verwehrt bleiben. Der Kaiser ist von ihrem Intellekt fasziniert, die anderen Damen bei Hofe sind neidisch. Und als das Leben ihres Vaters gefährdet ist, muss sie allen Mut und all ihr Wissen einsetzen, um ihn zu retten.
In dem gespaltenen Land herrscht ein Kaiser, der sich mehr für die Künste interessiert als für das Regieren. Bis eine neue Gefahr alles unter dem Fluss der Sterne auszulöschen droht ...
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER digiBook
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »River of Stars« im Verlag Roc Books, an imprint of Penguin Random House, New York.
© 2013 Guy Gavriel Kay
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung mehrerer Bilder von shutterstock/caramelina/baoyan/Feaspb
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403713-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Die wichtigsten Personen
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Zweiter Teil
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Dritter Teil
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Vierter Teil
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Fünfter Teil
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Nachwort
Für Leonard und Alice Cohen
Die wichtigsten Personen
Kaiser Wenzong von Kitai
Chizu, sein Sohn und Erbe
Zhizeng (Prinz »Jen«), sein neunter Sohn
Hang Dejin, erster Minister von Kitai
Hang Hsien, sein Sohn
Kai Zhen, stellvertretender erster Minister von Kitai
Yu-lan, seine Frau
Tan Ming, eine seiner Konkubinen
Wu Tong, ein Eunuch, Kai Zhens Verbündeter, ein Militärkommandant
Sun Shiwei, ein Auftragsmörder
Ren Yuan, ein Beamter in der westlich gelegenen Stadt Shengdu
Ren Daiyan, sein jüngster Sohn
Wang Fuyin, Unterpräfekt in Shengdu
Tuan Lung (»Lehrer Tuan«), Gründer einer Lehranstalt in Shengdu
Zhao Ziji, ein Offizier
Lin Kuo, ein Ehrenmann zu Hofe
Lin Shan, seine Tochter und einziges Kind
Qi Wai, Shans Ehemann
Xi Wengao (»Meister Xi«), ehemaliger erster Minister, ein Historiker
Lu Chen, Freund von Xi Wengao, ein Dichter, verbannt
Lu Chao, Chens Bruder, ebenfalls verbannt
Lu Mah, Chens Sohn
Shao Bian, eine junge Frau in der am Großen Fluss gelegenen Stadt Chunyu
Shao Pan, ihr jüngerer Bruder
Sima Peng, eine Frau in Gonzhu, einem Dorf nahe dem Großen Fluss
Zhi-li, ihre Tochter
Ming Dun, ein Soldat
Kang Junwen, ein Soldat, aus besetztem Gebiet geflohen
Shenwei Huang, ein Militärkommandant
Kaiser Te-kuan der Xiaolu
Yao-kan, sein Cousin und oberster Berater
Yan’po, Kaghan des Altai-Stammes
Wan’yen, Kriegsführer der Altai
Bai’ji, Wan’yens Bruder
Paiya, Kaghan des Khanshin-Stammes
O-Pang, Kaghan des Jeni-Stammes
O-Yan, sein jüngster Bruder
Erster Teil
Kapitel 1
Später Herbst, früher Morgen. Es ist kalt, Nebel steigt vom Waldboden auf, umfängt die grünen Bambusstäbe des Hains, dämpft die Geräusche und verbirgt die Zwölf Gipfel im Osten. Die Ahornblätter auf dem Weg sind rot und gelb, und es fallen weitere. Das Läuten der Tempelglocken am Rande der Stadt wirkt weit entfernt, wie von einer anderen Welt.
Es gibt Tiger in diesen Wäldern, aber sie jagen nachts und werden jetzt nicht hungrig sein, außerdem ist es ein kleiner Hain. Die Bewohner von Shengdu, obschon sie die Tiere fürchten und die älteren dem Tigergott Opfer darbringen, gehen dennoch bei Tag zum Holzsammeln oder Jagen in die Wälder, es sei denn, es ist gewiss, dass der Menschenfresser umherstreift. Dann legte eine Urangst alles lahm, Felder werden nicht mehr bestellt, Tee wird nicht mehr geerntet, bis das Untier getötet ist, was immer große Mühe kostet und manchmal ein paar Leben.
Der Junge war allein an diesem Morgen im Bambushain, umgeben von Nebel, schwache, blasse Sonnenstrahlen zwängten sich durch die Blätter: Licht, das sich ankündigt, aber noch nicht recht da ist. Er schwang ein selbstgemachtes Bambusschwert, und er war wütend.
Schon seit zwei Wochen war er unglücklich und betrübt, denn sein Leben lag in Trümmern wie eine Stadt, die von Barbaren überrannt worden war.
Im Moment versuchte er zu entscheiden, ob ihn die Wut besser oder schlechter im Umgang mit dem Bambusschwert machte. Und wie würde es sich beim Bogen verhalten?
Die Übung, die er gerade durchführte und sich selbst ausgedacht hatte, war kein kurzweiliges Kinderspiel (er war kein Kind mehr). Und soweit er das beurteilen konnte, wusste niemand, dass er in diesen Hain kam. Sein Bruder ganz sicher nicht, sonst wäre er ihm gefolgt, um ihn aufzuziehen – und hätte höchstwahrscheinlich die Bambusschwerter zerbrochen.
Er übte schnelle Wendungen und vollführte mit dem zu langen und zugleich zu leichten Schwert einige nach unten gerichtete Schläge und Stöße – ohne dabei einen der Bäume zu treffen, die ihn im Nebel umgaben.
Zu diesem Zweck kam er schon seit zwei Jahren her, eine Zeit, in der er bereits unzählige Holzschwerter abgenutzt oder zerbrochen hatte. Letztere lagen verstreut um ihn herum. Er ließ sie auf dem unebenen Boden, um die Schwierigkeit noch einmal zu erhöhen. Das Gelände eines echten Kampfes böte ähnliche Hindernisse.
Der Junge war groß für sein Alter, zu selbstsicher und darüber hinaus wild entschlossen, einer der größten Männer seiner Zeit zu werden und mit seiner Tugendhaftigkeit den Ruhm des darniederliegenden Reiches wiederherzustellen.
Aber er war auch der zweite Sohn eines Urkundensekretärs der Unterpräfektur Shengdus, einer kleinen Stadt, die am westlichen Rande des Kitanischen Kaiserreichs der Zwölften Dynastie lag – ein Umstand, der die Verwirklichung seiner Pläne nicht unerheblich erschwerte.
Dazu gesellte sich aktuell die einfache und nicht unbedeutende Tatsache, dass der einzige Lehrer dieser Unterpräfektur seine private Lehranstalt, die Yingtan Bergakademie, geschlossen hatte und vor zwei Wochen abgereist war. Nach Osten (denn weiter nach Westen zu gehen war unmöglich), um dort sein Glück zu finden oder zumindest eine Arbeit, die ihn ernährte.
Seinen Schülern hatte er eröffnet, er wolle vielleicht Ritenmeister werden, um durch geheime Rituale des Heiligen Pfades mit Geistern und Gespenstern in Kontakt treten. Hatte gesagt, es gäbe entsprechende Lehren, es wäre eine Zukunft für Examinierte, die noch nicht den Grad des Jinshi erreicht hatten. Lehrer Tuan hatte abweisend und verbittert ausgesehen, als er ihnen dies erklärte. Er hatte in diesen letzten Wochen ununterbrochen getrunken.
Der Junge hatte mit dieser Information nichts anzufangen gewusst. Ihm war selbstverständlich bekannt, dass es Geister und Gespenster gab, aber nicht, dass sein Lehrer etwas davon verstand. Er war sich nicht sicher, ob es stimmte oder Tuan Lung gescherzt hatte oder einfach nur wütend gewesen war.
Er wusste nur, dass es mit seiner Ausbildung vorbei war, denn ohne Unterricht und einen guten Lehrer konnte er sich nicht auf die Prüfungen zum öffentlichen Dienst vorbereiten. Und ohne diese ersten Prüfungen war an die Jinshi-Prüfungen in der Hauptstadt nicht einmal zu denken.
Und was das Training im Wald betraf, seinen leidenschaftlichen, glänzenden Traum davon, Kitai wieder zu neuer Größe zu führen … tja, man träumte eben nur, wenn man schlief. Wie sollte er denn allein mit einem Holzschwert die Kunst des Kämpfens erlernen, um dann Männer zu führen und für Kitai zu leben oder zu sterben?
Es herrschten schlechte Zeiten, überall. Am Frühjahrshimmel hatte sich eine Sternschnuppe gezeigt, und im Sommer war im Norden eine Dürre gefolgt. Nachrichten gelangten nur langsam in die Provinz Szechen, den Großen Fluss hinauf oder die Berge hinunter. Der Winter war trocken gewesen. Dabei war Szechen berüchtigt für seinen Regen. Im Sommer dampfte das Land wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, endlos tropfte Regenwasser von den Blättern, Kleidung und Bettzeug konnten nie durchtrocknen. Für gewöhnlich ließ der Regen in Herbst und Winter nach, aber er blieb nie gänzlich aus – in einem normalen Jahr.
Dieses war jedoch kein solches gewesen. Die Frühlingstee-Ernte war erbärmlich ausgefallen, die Reis- und Gemüsefelder vertrockneten, so dass die die Herbsternte ebenfalls nichts einbrachte. Trotzdem war eine Steuererleichterung ausgeblieben. Der Kaiser brauchte Geld, schließlich herrschte Krieg. Lehrer Tuan hatte auch dazu einiges zu sagen gehabt, manchmal Gewagtes.
Lehrer Tuan hatte stets gemahnt, sie sollten die Geschichtswerke lesen, aber sich davon nicht knechten lassen. Er sagte, dass sie von jemandem geschrieben wurden, der Gründe dafür hatte, die Dinge so und nicht anders festzuhalten.
Er hatte ihnen erzählt, dass Xi’an, Hauptstadt ruhmreicher Dynastien, einst zwei Millionen Einwohner gezählt hatte und dass heute nur noch um die hunderttausend dort in den Trümmern wohnen würden. Er hatte gesagt, dass Tagur, jenseits mehrerer Pässe im Westen gelegen, einst ein rivalisierendes Reich gewesen sei, erbittert und gefährlich mit prächtigen Pferden, heute jedoch nicht mehr als ein Zusammenschluss vor sich hin krepelnder Provinzen und befestigter religiöser Rückzugsorte.
Manchmal saß er nach dem Unterricht mit den älteren Schülern zusammen, trank Wein, den sie ihm voller Hochachtung einschenkten, und sang: »Königreiche kamen, Königreiche gingen / Kitai überdauert alles …«
Der Junge hatte seinen Vater ein- oder zweimal nach diesen Dingen gefragt, doch sein Vater war ein vorsichtiger, bedachtsamer Mann und behielt seine Meinung dazu für sich.
Ohne die Erträge der Tee-Ernte, die sie gewöhnlich bei den Regierungsstellen gegen Salz, Reis oder Getreide von flussabwärts tauschten, würden in diesem Winter viele Bewohner der Unterpräfektur verhungern. Der Staat war dazu verpflichtet, die Kornspeicher zu füllen, in schweren Zeiten Rationen auszugeben und geschuldete Steuern zu erlassen, trotzdem reichte es nie oder geschah zu spät.
Also gab es in diesem Herbst weder auf Schnüre aufgezogene Münzen noch vor dem Regierungsmonopol verborgene Teeblätter, mit denen man an den Bergpässen für den Unterricht des Sohnes bezahlen konnte, ganz egal, wie pfiffig er war und wie schnell er lernte, ganz egal, wie wichtig seinem Vater das Lernen war.
Lesefähigkeit und die kalligraphische Pinselführung, Lyrik, das Auswendiglernen der Klassiker Meister Chos und seiner Anhänger waren schön und gut, doch all das trat in den Hintergrund, wenn der Hungertod drohte.
Das wiederum kostete die Gelehrten die Existenzgrundlage. Tuan Lung hatte sich zweimal an den Jinshi-Prüfungen in Hanjin versucht, bevor er aufgab und in die Heimat im Westen zurückkehrte, wo er seine eigene Lehranstalt für Jungen gründete, die Beamte werden wollten, um vielleicht unter den überdurchschnittlich Begabten sogar einen Jinshi-Kandidaten zu finden.
Mit einer Lehranstalt war es zumindest möglich, dass jemand die hiesige Prüfung und sogar das kaiserliche Examen ablegte, an dem Lung gescheitert war. Vielleicht schaffte es einer seiner Schüler, »Teil des Stroms« zu werden, Teil der großartigen Welt von Hof und Amt, die ihm verwehrt geblieben war.
Wut und Verzweiflung hatten den Jungen fest im Griff, seit dem Tag, an dem er seinem Lehrer Lebewohl gesagt und dabei zugesehen hatte, wie er Shengdu auf dem Rücken eines schwarzen Esels mit weißen Füßen verließ. Sein Lehrer hatte die staubige Straße gewählt, die ihn hinaus in die Welt führen würde.
Der Junge hieß Ren Daiyan. Den überwiegenden Teil seines Lebens war er Kleiner Dai gerufen worden, und er versuchte, den Menschen diesen Namen abzugewöhnen. Sein Bruder wehrte seine Bitte lachend ab. So waren ältere Brüder, das war zumindest Daiyans Sicht der Dinge.
Diese Woche hatte es zu regnen begonnen. Viel zu spät, aber wenn der Regen nicht nachließ, konnte, wer den nahenden Winter überlebte, auf den Frühling hoffen.
Man munkelte, dass in den ländlichen Gebieten Mädchen sofort nach der Geburt ertränkt wurden. Man nannte es das Kind baden. Es war gesetzwidrig (das war nicht immer so gewesen, wie Lehrer Tuan ihnen erklärt hatte), trotzdem wurde es getan und war einer der sichersten Vorboten für das, was ihnen noch bevorstand.
Daiyans Vater hatte ihm erzählt, dass es richtig schlimm stand, wenn selbst die Jungen direkt nach der Entbindung dem Fluss übergeben wurden. Und in den allerschlimmsten Zeiten, hatte er hinzugefügt, wenn es gar nichts mehr zu essen gab … es folgte nur eine Geste mit den Händen, er sprach den Satz nicht zu Ende.
Daiyan glaubte zu wissen, was sein Vater damit meinte, aber er fragte nicht nach. Er mochte darüber nicht einmal nachdenken.
In Dunst und Bodennebel, morgendlicher Kälte und Feuchte wirbelte der Junge durch den Bambuswald. Erst stellte er sich vor, dass sein Bruder die Hiebe abbekam, dann die barbarischen Kislik im Norden mit ihren bis auf lange, wilde Fransen an den Seiten geschorenen Köpfen.
Sein Urteil bezüglich der Frage, wie sich die Wut auf seine Kampfkünste auswirkte, war: Sie machte ihn schneller, aber ungenauer.
Wie alles im Leben besaß der Zorn Vor- und Nachteile. Die Schnelligkeit ging zu Lasten der Präzision, was sich jedoch ausgleichen ließ. Zumindest beim Schwert, beim Bogen sähe das anders aus, schätzte er. Dort war Präzision unerlässlich, obwohl Schnelligkeit ebenfalls eine Rolle spielte, wenn der Schütze vielen Gegnern gegenüberstand. Daiyan war außerordentlich gut am Bogen, wenngleich das Schwert bei weitem die angesehenere Waffe in Kitai gewesen war, als die Kampfkünste noch etwas bedeuteten (was schon lange nicht mehr der Fall war). Barbaren wie die Kislik oder Xiaolu töteten mit Pfeilen vom Pferderücken aus und galoppierten dann davon, feige, wie sie waren.
Sein Bruder wusste nicht, dass er einen Bogen hatte, sonst hätte er ihn für sich beansprucht – was der Bogen nicht überstanden hätte. Entweder wäre er längst zerbrochen oder unbrauchbar geworden, weil man ihn pflegen musste. Ren Tzu gehörte nicht zu dem Schlag Mensch, der etwas pflegte.
Sein Lehrer hatte ihm den Bogen gegeben.
An einem Sommertag nach dem Unterricht hatte Tuan Lung ihn aus einem ungefärbten Hanftuch gewickelt.
Außerdem hatte er Daiyan ein Buch geschenkt, das erläuterte, wie man ihn bespannte, ihn pflegte, Pfeilschäfte und Pfeilspitzen erstellte. Die Existenz von Büchern war eins der Zeichen von Veränderungen in der Zwölften Dynastie. Lehrer Tuan hatte es oft gesagt: Durch den Blockdruck standen selbst einer so abgelegenen Unterpräfektur wie ihrer gedruckte Gedichte und die Werke des Meisters zur Verfügung, so man denn lesen konnte.
Erst der Blockdruck hatte eine Lehranstalt wie die seine ermöglicht.
Es war ein persönliches Geschenk gewesen: der Bogen, das Dutzend eherner Pfeilspitzen, das Buch. Daiyan war gescheit genug, den Bogen und die Pfeile, die er nach der Lektüre des Buchs anfertigte, gründlich zu verstecken. Keine ehrenwerte Familie der Zwölften Dynastie erlaubte es ihrem Sohn, Soldat zu werden. Das war ihm bewusst; das war ihm bei jedem einzelnen Atemzug bewusst.
Allein der Gedanke war eine Schande. Die kitanische Armee bestand aus Kleinbauern, die keine andere Wahl hatten. Drei Männer in einem Bauernhaushalt? Einer musste zur Armee. Es mochte eine Million Soldaten geben, sogar mehr (schließlich führte das Kaiserreich wieder Krieg), aber seit der blutigen Lektion, die dem Reich vor über dreihundert Jahren erteilt worden war, wurde die Armee vom Hof befehligt, und der Aufstieg einer Familie zu Rang und Namen war einzig durch die Jinshi-Prüfungen und den öffentlichen Dienst möglich. Allein der Gedanke, der Armee beizutreten, kam, wenn man auch nur ein Fünkchen Familienehre empfand, einer Schande für die Vorfahren gleich.
So war es nun schon seit einer geraumen Zeit in Kitai.
Ein Militäraufstand hatte den Tod von vierzig Millionen Menschen zur Folge gehabt, ihre glanzvollste Dynastie zerstört und zum Verlust großer Teile des Kaiserreichs geführt … kein Wunder, dass sich auch die Werte änderten.
Xi’an, einst funkelnder Stolz der Welt, war nicht mehr als eine traurige, bröckelnde Ruine. Lehrer Tuan hatte ihnen von zerfallenen Mauern, aufgebrochenen Straßen, verstopften und übelriechenden Kanälen, ausgebrannten Häusern, verlassenen Villen, überwucherten Gärten und Marktplätzen, von Parks mit Unkraut und von Wölfen erzählt, die nachts durch die Straßen streifen.
Die kaiserlichen Grabstätten waren längst geplündert worden.
Tuan Lung war dort gewesen. Ein Besuch reichte aus, hatte er gesagt. Wütende Geister trieben in Xi’an ihr Unwesen, die Menschen lebten zusammengekauert in einer Stadt, die einmal den strahlendsten Hof der Welt beherbergt hatte.
Zahlreiche Probleme, hatte Lehrer Tuan ihnen erklärt, gingen auf die mittlerweile viele Jahrzehnte zurückliegende Rebellion zurück, zum Beispiel der Verlust der Seidenstraßen.
Keine westlichen Luxusgüter kamen mehr nach Kitai, zu den Handelszentren oder an den Hof in Hanjin. Keine legendären, grünäugigen und gelbhaarigen Tänzerinnen, die verführerische Musik brachten. Kein Jade, kein Elfenbein, kein exotisches Obst, kein Reichtum in Form von Silbermünzen, das die Händler gegen die begehrte kitanische Seide tauschen und auf Kamelen durch die Wüsten in den Westen bringen konnten.
Diese Zwölfte Dynastie von Kitai unter der Führung ihres strahlenden und herrlichen Kaisers hatte keinen prägenden Einfluss auf die bekannte Welt. Nicht mehr.
Das hatte Tuan Lung der immer gleichen Handvoll Schüler gelehrt (jedoch nie im Klassenzimmer). Am Hofe in Hanjin behauptete man noch, die Welt zu regieren, hatte er gesagt, und auf die Prüfungsfragen wurden Antworten erwartet, die genau das bestätigten. Wie nutzt ein besonnener Minister Barbaren, um andere Barbaren zu lenken?
Aber selbst wenn sie Kriege mit den Kislik begannen, schienen sie diese nie für sich entscheiden zu können. Die rekrutierten Bauern bedeuteten zwar eine zahlenmäßig überlegene Streitmacht, aber schwach war sie trotzdem. Zudem reichte die Zahl der Pferde nie.
Der zweimal jährlich gezahlte Tribut an die viel gefährlicheren Xiaolu im Norden wurde zwar offiziell als Geschenk bezeichnet, was aber nichts an der Tatsache änderte, hatte ihr Lehrer über seinem abendlichen Wein sinniert, dass sich das geschrumpfte Reich mit Silber und Seide den Frieden erkaufte.
Gefährliche Worte. Seine Schüler schenkten ihm Wein nach. »Wir haben unsere Flüsse und Berge verloren«, sang er.
Ren Daiyan, fünfzehn Jahre alt, träumte des Nachts vom Ruhm, schwang am Morgen ein Bambusschwert in einem Wald und stellte sich vor, ein Kommandant zu sein, der die verlorenen Gebiete zurückeroberte.
Niemand, so Lehrer Tuan, spielte am Hof oder in den Parks in Hanjin noch Polo, um seine Reitkünste zu perfektionieren, so wie es einst im ummauerten Palastpark oder auf den Wiesen Xi’ans der Fall gewesen war. Beamte mit roten oder zinnoberroten Gürteln übten sich nicht mehr am Schwert oder Bogen. Stattdessen ließen sie sich den Nagel am kleinen Finger wachsen, um der Welt zu zeigen, wie groß ihre Verachtung für selbige Tätigkeiten war, und sie hielten nachdrücklich den Daumen auf alle höheren Stellen in der Armee. Militärische Führungspositionen wurden ausschließlich aus ihren eigenen, kultivierten Rängen besetzt.
Nachdem er zum ersten Mal davon gehört hatte, war Daiyan in dieses Wäldchen gekommen und hatte sich Schwerter geschnitzt. Er hatte sich selbst geschworen, dass er, sollte er die Prüfungen bestehen und an den Hof gelangen, sich niemals den Nagel des kleinen Fingers wachsen lassen würde.
Er las Lyrik, prägte sich die Klassiker ein und sprach mit seinem Vater darüber, der sanftmütig und weise und vorsichtig war und niemals überhaupt nur davon hatte träumen können, die Prüfungen abzulegen.
Der Junge wusste, dass Lehrer Tuan ein verbitterter Mann war. Das hatte er gleich zu Beginn seiner Ausbildung bemerkt. Der kluge jüngste Sohn eines Beamten, dem das richtige Schreiben und die Lehren des Meisters beigebracht wurden. Klug, fleißig, bereits ein guter Pinselstrich. Möglicherweise ein geborener Kandidat für die Prüfungen. Das erträumte sein Vater für ihn. Auch seine Mutter. Unbändiger Stolz, wenn dem Sohn einer Familie dies gelang. Es ebnete den Weg zu einem Vermögen.
Das wusste Daiyan. Er war ein aufmerksames Kind gewesen. War es noch, selbst jetzt, wo er so kurz davorstand, seine Kindheit hinter sich zu lassen. Später an diesem Tag würde sie tatsächlich enden.
Nach drei oder vier Bechern Reiswein hatte ihr ehrenwerter Lehrer manchmal Gedichte rezitiert oder traurige Lieder darüber gesungen, wie die Xiaolu die Vierzehn Präfekturen vor zweihundert Jahren erobert hatten – die verlorenen Vierzehn –, die Ländereien diesseits der Langen Mauer im Norden. Die Mauer war heute bedeutungslos, eine Ruine, hatte er seinen Schülern erzählt. Wölfe querten sie, und Schafe grasten bald dies-, bald jenseitig. Seine Lieder waren Kondensate einer herzzerreißenden Sehnsucht. Denn dort, in diesen Ländereien, hatte die Seele Kitais kapituliert.
Es waren gefährliche Lieder.
Wang Fuyin, Unterpräfekt in derselben Stadt Shengdu, Präfektur Honglin, Provinz Szechen, im siebenundzwanzigsten Jahr der Regentschaft des Kaisers Wenzong der Zwölften Dynastie, fühlte sich – etwas später an diesem Morgen – unglücklicher, als er in Worte fassen konnte.
Gewöhnlich war er nicht um Worte verlegen (außer er musste dem Präfekten Rede und Antwort stehen, der aus gutem Hause stammte und ihn einschüchterte). Aber die Nachricht, die ihn gerade ereilt hatte, war so unerwünscht, dass es ihn sprachlos machte. Es war niemand in der Nähe, den er anschreien konnte – worin in gewisser Hinsicht der Kern des Problems bestand.
Kam ein Bürger mit einer Mordanschuldigung an einen beliebigen Yamen in Kitai – aus jedem beliebigen Dorf –, gab es eine Reihe sehr detaillierter Vorschriften, die von der Verwaltung des betreffenden Yamen befolgt werden mussten.
Der Vollzugsbeamte der Unterpräfektur musste in das betreffende Dorf aufbrechen, zu seinem Schutz von fünf Bogenschützen begleitet, um an einem möglicherweise gefährlichen Ort für Recht und Ordnung zu sorgen. Erreichte die Nachricht den Yamen vor Mittag, war er dazu verpflichtet, noch am selben Tag aufzubrechen, kam sie nach Mittag, dann am Morgen des Folgetages. Leichen faulten schnell, Verdächtige flohen, Beweise konnten verschwinden.
Wenn der Vollzugsbeamte bei Eintreffen einer solchen Botschaft verhindert war (was heute zutraf), musste der Richter selbst mit fünf Bogenschützen aufbrechen. Es galten dieselben Zeitvorgaben.
War der Richter, aus welchem Grunde auch immer, ebenfalls abwesend oder verhindert (was heute zutraf), fiel diese Aufgabe an den Unterpräfekten, der sofort zu Ermittlungen aufbrechen und jede erforderliche Untersuchung vornehmen musste.
Und das war in diesem Fall – leider – Wang Fuyin.
Den Vorschriften mangelte es in diesem Punkt nicht an Deutlichkeit. Wer ihnen nicht nachkam, riskierte Schläge mit dem schweren Stab, Degradierung in einen niedrigeren Rang oder sogar Entlassung aus dem Beamtenstand.
Und ein Posten bei der Behörde war der Traum eines jeden, der die Jinshi-Prüfungen bestand. Mit der Position eines Unterpräfekten betraut zu werden, selbst so tief in der westlichen Wildnis, war schließlich ein Schritt – ein wichtiger Schritt – auf dem Weg, der eines Tages zurück nach Hanjin und damit an die Macht führen konnte.
Man wollte an einer solchen Anforderung nicht scheitern, was jedoch gar nicht so leicht war. Es reichte, sich dem falschen Lager anzuschließen oder an einem zutiefst zerstrittenen Hof die falschen Freunde zu haben. (Tatsache war, dass Unterpräfekt Wang Fuyin noch überhaupt keine Freunde am Hof hatte.)
Drei Beamte waren an diesem Morgen im Yamen. Legten Akten ab, lasen die Korrespondenz, verzeichneten die Steuereinnahmen. Einheimische Männer, alle drei. Und alle drei hatten den ärmlichen und verängstigten Bauern gesehen, der nass und lehmverdreckt vor Mittag auf seinem Esel ankam, wie er erzählte, dass ein Mann im Dorf der Familie Guan getötet worden war – ein langer, unbequemer, gefährlicher, fast einen ganzen Tag währender Ritt nach Osten in Richtung der Zwölf Gipfel.
Wahrscheinlich dauerte er sogar länger als einen Tag, dachte Wang Fuyin: Das bedeutete eine Übernachtung in einer dieser feuchten, mit Flöhen und Ratten verseuchten Hütten ohne befestigten Boden, wo auch die Tiere unterm selben Dach unterkamen, man nichts als eine Handvoll schlechten Reis, dünnen Tee und verdorbenen oder gar keinen Wein serviert bekam, während Tiger und Banditen durch die kalte Nacht brüllten.
Nun, es war unwahrscheinlich, dass Banditen brüllten, korrigierte sich Fuyin, dennoch …
Er betrachtete die blasse, aufgehende Sonne. In der Nacht hatte es leicht geregnet, die dritte Nacht in Folge, den Göttern sei Dank, trotzdem entfaltete sich ein milder Herbsttag. Wenngleich es noch immer, zweifellos, Morgen war.
Der Vollzugsbeamte war vor zwei Tagen in den Norden aufgebrochen, um an den Pässen Steuerschulden einzutreiben. Mitunter ein riskantes Unterfangen. Er hatte acht Bogenschützen mitgenommen. Eigentlich standen ihm fünf zu, aber er war ein feiger Mann (nach Wang Fuyins Ansicht), und obwohl er behauptete, die jüngeren nur zum Zweck der Ausbildung mitgenommen zu haben, dienten sie dennoch seinem erweiterten Schutz. Zusätzlich zu den Bauern, die über die Steuern klagten, waren in den westlichen Gebieten Räuber sehr verbreitet. Die gab es zwar in ganz Kitai, aber in schwierigen Zeiten wuchs ihre Zahl stetig. In den Schriften stand, wie man mit Gesetzlosen zu verfahren hatte, seit seiner Ankunft war er jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass die Schriften in diesem Punkt nutzlos waren. Man brauchte Soldaten, Pferde und zuverlässige Informationen. Nichts davon war je verfügbar.
Genauso wenig der Richter.
Mit seiner eigenen Eskorte von fünf Bogenschützen war ihr ehrenwerter Richter wie jeden Monat für drei Tage in der nahe gelegenen Abtei Fünf Donner des Heiligen Pfades verschwunden, um spirituelle Erleuchtung zu suchen.
Offenbar hatte er dieses Privileg mit dem Präfekten bereits Jahre zuvor ausgehandelt (Wang Fuyin hatte keine Ahnung, wie). Fuyin wusste jedoch aus sicherer Quelle, dass des Richters Pfad zur Erleuchtung zum Großteil daraus bestand, Zeit mit einer Frau aus dem Kloster zu verbringen, das direkt neben der Abtei lag.
Fuyins Eifersucht war maßlos. Seine Frau, die aus besserem Hause stammte als er und nicht müde wurde, das zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zu betonen, war über die Versetzung an diesen Ort zutiefst unglücklich gewesen. Und sie hatte ihn seit ihrer Ankunft vor einem Jahr tagtäglich daran erinnert. Ihre Worte glichen dem nervtötenden, gleichmäßigen Tropfen des Regenwassers von der Traufe ihres kleinen Hauses.
Das einzige Lokal mit singenden Mädchen in Shengdu war absolut unerträglich für einen Mann, der die besten Häuser des Vergnügungsviertels in der Hauptstadt kannte. Wang Fuyin verdiente nicht im Entferntesten genug Geld, um sich eine Konkubine leisten zu können, und er hatte auch noch keinen Weg gefunden, wie er selbst seine spirituelle Einkehr in dem Kloster nahe der Fünf Donner Abtei arrangieren konnte.
Das Leben war hart.
Der Bote aus dem Dorf hatte seinen Esel zum Wassertrog auf dem Platz vor dem Yamen geführt und ließ ihn dort trinken. Er selbst trank ebenfalls, sein Kopf neben dem des Esels. Wang Fuyin setzte eine ungerührte Miene auf, richtete penibel die Ärmel und den Kragen seines Gewands und betrat das Hauptgebäude.
»Wie viele Bogenschützen sind noch vor Ort?«, fragte er den leitenden Beamten.
Ren Yuan stand auf und verbeugte sich, bevor er antwortete. Die einheimischen Beamten waren nicht »Teil des Stroms«, keine echten Staatsbeamten. Noch vor zwanzig Jahren, vor den Reformen, waren sie für ihre Dienste nicht einmal bezahlt worden, sondern mussten zwei Jahre währende Amtszeiten ableisten.
Dies hatte sich mit Einführung der »Neuen Regeln«, die Premierminister Hang Dejin gegen beträchtlichen Widerstand eingeführt hatte, geändert. Und dies war nur Teil eines Konflikts am Hof gewesen, der noch immer zahllose Leben zerstörte oder Menschen ins Exil zwang. In mancherlei Hinsicht – solche subversiven Gedanken kamen Wang Fuyin mitunter – war es gar nicht so ungünstig, gerade so weit im Westen zu weilen. Man konnte dieser Tage nur allzu leicht im Strom von Hanjin ertrinken.
»Derzeit verfügen wir über drei Bogenschützen, werter Herr«, sagte sein leitender Beamter.
»Ich werde aber fünf brauchen«, erwiderte der Unterpräfekt kühl.
»Es ist Euch gestattet, mit nur vieren zu reisen. So steht es in den Vorschriften. Wenn es unerlässlich ist. Ihr müsst es nur offiziell in den Akten vermerken.«
Das kam von seinem Steuergehilfen. Er war nicht einmal aufgestanden. Fuyin konnte ihn nicht leiden.
»Das ist mir bewusst«, sagte er (dabei war es ihm genau genommen entfallen). »Wir verfügen aber nur über drei, insofern hilft uns das auch nicht wirklich weiter, Lo Fong, nicht wahr?«
Die drei Beamten schauten ihn nur an. Schwaches Sonnenlicht fiel durch die offenen Fenster und Türen in den Yamen. Es war ein wunderschöner Herbstmorgen. Wang Fuyin hatte das Bedürfnis, jemanden mit dem Stock zu schlagen.
Da kam ihm eine Idee.
Sie formte sich aus seiner Wut und den gegebenen Umständen und aus der Tatsache, dass Ren Yuan direkt vor ihm am Tisch stand, die Hände gefaltet, den Kopf schüchtern gesenkt, so dass man sein graues Haar, die abgenutzte schwarze Kappe und die einfachen Hutnadeln sehen konnte.
»Ren Yuan«, sagte er. »Wo ist dein Sohn?«
Sein Angestellter schaute auf, bevor er schnell den Blick wieder senkte, jedoch nicht ohne dass der Unterpräfekt Wang erfreulicherweise Sorge auf dessen Gesicht erkennen konnte. »Ren Tzu begleitet Richter Lao, ehrenwerter Herr.«
»Das ist mir bewusst.« Der älteste Sohn des Beamten wurde zum Wachmann ausgebildet. Man brauchte starke, junge Männer, wenn man zum Einsammeln der Steuern aufbrach. Die Entscheidung, ob Tzu angestellt würde oder nicht, oblag sogar Fuyin selbst. Der junge Mann war nicht sonderlich intelligent, aber für manche Aufgaben war Intelligenz auch nicht vonnöten. Der Lohn, den die Beamten dank der Neuen Regeln bekamen, war trotz allem gering. Ein Vorteil bestand allerdings darin, dass man den eigenen Söhnen mitunter das Tor zum Yamen öffnete.
»Nein«, sagte Fuyin nachdenklich. »Ich meine deinen jüngeren Sohn. Ich hätte Verwendung für ihn. Wie war sein Name …?«
»Daiyan? Er ist erst fünfzehn, ehrenwerter Unterpräfekt. Noch ein Schüler.«
»Nicht mehr«, sagte Fuyin verdrossen.
Der Lehrer des Ortes, Tuan Lung, würde ihm fehlen. Er war kein Freund gewesen, aber von seiner Anwesenheit hatte Shengdu … profitiert. Selbst Fuyins Frau hatte ihn gemocht. Lung war gebildet, manierlich (wenn er auch ein wenig schnell zur Ironie griff). Er war belesen, hatte eine Zeitlang in Hanjin gewohnt und musste sich zudem dem Unterpräfekten gegenüber angenehm ehrerbietig verhalten, schließlich war er bei den Prüfungen zweimal durchgefallen, während Fuyin sie gleich beim ersten Versuch bestanden hatte.
»Meister Wang«, sagte sein leitender Beamter und verneigte sich erneut, »zwar hatte ich gehofft, dass mein unwürdiger, jüngerer Sohn eines Tages Bote oder sogar Beamter des Yamen werden würde, ja. Allerdings hätte ich es erst gewagt, mit dieser Bitte an Euch zu treten, wenn er ein wenig älter ist … vielleicht in zwei oder sogar drei Jahren.«
Die anderen Angestellten lauschten gebannt. Die Ereignisse des Morgens hatten den gewohnten Gang der Dinge unterbrochen. Ein Mord im Dorf der Familie Guan und jetzt das.
Sie beschäftigten vier, manchmal fünf Boten am Yamen – zwei standen vor der Tür bereit, um mit Nachrichten durch den Ort zu laufen. Ren Yuans Pläne für seinen Sohn waren durchaus vernünftig, genauso wie deren zeitliche Umsetzung, was dem Unterpräfekten jedoch an diesem unglücklichen Morgen, an dem ihm ein trister Ritt zu einem Dorf mit einer Leiche bevorstand, herzlich egal war.
»All das liegt natürlich im Bereich des Möglichen«, sagte Fuyin in seinem besonnensten Ton, »gerade brauche ich ihn jedoch für etwas anderes. Kann sich der Junge auf einem Pferd halten?«
Ren Yuan blinzelte. Er hatte ein langes, faltiges Gesicht, auf dem sich Besorgnis abzeichnete. »Auf einem Pferd?«, wiederholte er.
Der Unterpräfekt schüttelte schwach den Kopf. »Ja. Schickt einen Boten nach dem Jungen. Ich benötige ihn sofort, er soll mitbringen, was er für die Reise braucht. Und seinen Bogen«, fügte er mit Schärfe hinzu. »Er soll seinen Bogen mitbringen.«
»Seinen Bogen?«, wiederholte der unglückliche Vater.
Doch seine Stimme verriet zweierlei. Erstens, dass er genau wusste, was dem Unterpräfekt vorschwebte. Und zweitens, dass er über den Bogen informiert war.
Wang Fuyin hatte Kenntnis davon, weil es seine Aufgabe war, über solcherlei Dinge Kenntnis zu haben. Wissen war entscheidend. Der Vater verfügte offenbar ebenfalls über eigene Quellen und war über das informiert, was sein Sohn zweifellos für ein Geheimnis hielt.
Wäre es dem Unterpräfekten möglich gewesen, ein schiefes Grinsen zuwege zu bringen, eines, das sowohl Heiterkeit als auch Überlegenheit vermittelte, er hätte es an dieser Stelle gezeigt. Seine Frau hatte ihn jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei dem Versuch, einen solchen Gesichtsausdruck aufzusetzen, aussah, als leide er an Unterleibsschmerzen. Also begnügte er sich mit einem weiteren schwachen Kopfschütteln.
»Er übt sich fleißig am Bogen. Ich bin mir sicher, dass du davon weißt.« Ein Gedanke kam ihm. »Lehrer Tuan wird dich ja seinerzeit darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass er dem Jungen dieses Geschenk machen wollte.«
Eine weitere, gerissen formulierte Vermutung, sofort bestätigt vom Gesichtsausdruck des Vaters. Das änderte zwar nichts an den Kümmernissen, die dieser Tag mit sich brachte, trotzdem bot die Besorgnis seines Angestellten kurzzeitig Anlass zu Erheiterung. Denn mit Verlaub! Wenn Ren Yuan die Reise für seinen Sohn zu gefährlich fand, war sie das dann nicht auch für seinen Vorgesetzten? Man könnte sich aufregen!
Wang Fuyin zeigte sich aber nachsichtig. »Nun komm«, sagte er. »Das wird eine durchaus nützliche Erfahrung für ihn, und ich brauche schließlich einen vierten Bogenschützen.« Er wandte sich an den dritten Beamten. »Schick einen Boten nach dem Jungen. Wie hieß er noch gleich?«
»Daiyan«, antwortete der Vater leise.
»Such Ren Daiyan, wo immer er sich aufhalten mag. Sag ihm, er wird am Yamen erwartet und dass er den Bogen mitbringen soll, den Lehrer Tuan ihm gegeben hat.« Und dann erlaubte sich der Unterpräfekt doch ein schiefes Grinsen. »Und Pfeile, versteht sich.«
Sein Herz hatte in dem Moment zu hämmern angefangen, in dem der Bote des Yamen ihn auf den Feldern erreicht hatte, kaum dass er aus dem Bambushain getreten war.
Dabei ängstigte ihn nicht die bevorstehende Reise. Mit fünfzehn fürchtete man sich nicht davor, als vorübergehender Bogenschütze des ehrenwerten Unterpräfekten den Ort zu Pferd zu verlassen, um im Namen des Kaisers für Ordnung zu sorgen.
Nein, seine Furcht war die eines Kindes: Würden seine Eltern verurteilen, womit er sich beschäftigt hatte, würde es sie wütend machen, dass er so viel vor ihnen geheim gehalten hatte – all die Zeit mit dem Bogen, all die Morgen mit Bambusschwertern.
Wie sich herausstellte, hatten sie von Anfang an davon gewusst. Lehrer Tuan hatte vorab mit ihnen über das Geschenk gesprochen. Ihnen erklärt, dass dies ein Weg war, Daiyans Selbständigkeit und Kraft zu fördern, die Ausgeglichenheit seines Geists, sein Selbstvertrauen aufzubauen … dass all dies wichtig war als Vorbereitung auf die Prüfungen, vielleicht sogar auf Hanjin, den Hof.
Das hatte seine Mutter ihm erzählt, als er mit dem Boten nach Hause geeilt kam, der dann draußen vor der Hütte wartete. Sie sprach so schnell, dass Daiyan kaum Zeit blieb, all das zu verarbeiten. Seine Eltern wussten von seinen morgendlichen Ritualen im Wald? Und selbst der Unterpräfekt schien davon gewusst zu haben. Er hatte Daiyan – namentlich! – herbeizitiert, damit er ihn in eines der Dörfer begleitete. Um dort einen Mord aufzuklären!
Wandte die Königinmutter des Westens ihm das Antlitz zu? Verdiente er wirklich eine solch positive Wendung seines Schicksals?
Seine Mutter war so tüchtig wie eh und je. Sie versteckte ihre Gefühle hinter flinken Bewegungen. Sie packte ihm eine Tasche mit Essen, kaltem Tee und Wechselkleidung (die genau genommen seinem Vater gehörte, sie waren mittlerweile gleich groß), damit er sie nicht vor Fremden und dem Unterpräfekten in Verlegenheit brachte. Ihr Gesichtsausdruck änderte sich nicht – nicht vor dem wartenden Boten –, als Daiyan mit Bogen und Köcher aus der Scheune zurückkehrte, wo sie versteckt gewesen waren. Er nahm ihr die Tasche aus der Hand. Verbeugte sich zweimal. Sie erwiderte die Verbeugung, zügig. Er verabschiedete sich.
»Mach deiner Familie Ehre«, sagte sie, wie es ihre Gewohnheit war.
Er zögerte, betrachtete sie. Da griff sie hinauf und tat etwas, das sie oft getan hatte, als er noch jünger gewesen war: Sie zog an seinem Haar. Nicht so fest, dass es weh tat oder sich die Haarnadeln lösten, aber die Geste berührte ihn. Er verließ die Hütte. Als er sich umsah, stand seine Mutter im Türrahmen und schaute ihm und dem Boten nach.
Sein Vater, der sie am Yamen erwartete, wirkte besorgt.
Daiyan wusste nicht, warum. So weit würden sie nicht reisen, nur ins Dorf der Familie Guan. Sie erreichten es vermutlich sogar noch vor Sonnenuntergang. Aber Daiyans Vater war schon immer ein Mann gewesen, der in Momenten zufrieden oder besorgt aussehen konnte, in denen die Menschen um ihn herum ganz andere Regungen zeigten.
Der Unterpräfekt war nicht glücklich. Er war sogar sichtlich wütend. Wang Fuyin war, wie jeder wusste, ein dicklicher und fauler Mann, sein Ärger ging sicher darauf zurück, dass er dazu gezwungen war, diese Reise selbst anzutreten, statt den Vollzugsbeamten oder Richter schicken zu können und bequem auf deren Berichte zu warten.
Trotzdem war dies sicher nicht der Anlass für seinen Vater, so bekümmert auszusehen – oder sich solch große Mühe zu geben, seine Sorge zu verbergen. Ren Yuan war nicht gut darin, seine Gefühle oder Gedanken zu überspielen. Trotzdem war seine Sanftmut nicht immer von Vorteil, wie sein Sohn vor langer Zeit entschieden hatte.
Er liebte ihn dennoch dafür.
Am Nachmittag Vorboten eines kühleren Winds. Sie ritten geradewegs hinein, als sie Shengdu in Richtung Osten verließen. Der Fluss lag außer Sicht zu ihrer Rechten, er war jedoch jenseits des Waldes zu spüren, dort sangen und flogen andere Vögel. Von den steilen Hängen nördlich der Straße drang das stetige Kreischen von Gibbons zu ihnen herüber.
In diesen Wäldern gab es Nachtigallen. Daiyans Bruder war manchmal hergekommen, um welche zu fangen. In Hanjin, am Hof, waren sie eine Zeitlang sehr begehrt gewesen. Man bekam eine beträchtliche Summe dafür, obwohl das ziemlichem Unsinn gleichkam. Wie sollte ein in einem Käfig gefangener Vogel die weite Reise aus Szechen überleben? Flussabwärts durch die Schluchten, dann mit kaiserlichen Boten nach Norden. Ritten die Boten schnell … die Vorstellung eines Vogelkäfigs, der an einem Sattel baumelte, war gleichzeitig traurig und amüsant. Daiyan mochte Nachtigallen. Manch einer beklagte, dass sie einen des Nachts wach hielten, aber ihm machte das nichts aus.
Am Horizont zeichneten sich nun, da der Nebel sich gelichtet hatte und dem strahlenden Tag gewichen war, die Zwölf Gipfel ab. In Wirklichkeit waren es nur elf. Daiyan hatte vor langer Zeit aufgehört, die vielen Erklärungen dafür zu zählen. Die Gipfel waren heilig, sowohl in den Lehren des Meisters Cho als auch denen des Heiligen Pfads. Daiyan war ihnen noch nie so nah gewesen. Und noch nie so weit weg von Shengdu – und war das kein trauriger Gedanke? Mit fünfzehn noch nicht mehr als ein paar Stunden auf dem Pferderücken zwischen sich und seine Heimatstadt gebracht zu haben? Geritten war er ebenfalls noch nie so weit. Allein das schon ein Abenteuer.
Sie waren schneller unterwegs, als er erwartet hatte. Aber der Unterpräfekt schien sein Pferd zu hassen. Höchstwahrscheinlich hasste er jedes Reittier, denn obwohl er eine sanfte Stute mit breitem Rücken für sich gewählt hatte, war er seit ihrem Aufbruch sogar noch unglücklicher geworden. Er war ein Mann, der die Gassen der Städte den staubigen Landstraßen vorzog, wie man so schön sagte.
Wang Fuyin schaute sich permanent um, nach links, nach rechts, nach hinten. Er erschrak, wenn die Gibbons laut wurden, aber da sie fast unaufhörlich kreischten, hätte ihn das Geräusch längst nicht mehr überraschen dürfen. Die Schreie klangen traurig und unheimlich, das musste Daiyan zugeben. Aber Gibbons konnten vor einem Tiger warnen. Das machte sie nützlich. Darüber hinaus konnte man sie in Zeiten des Hungers essen, wenn es einem denn gelang, sie zu fangen.
Der Unterpräfekt bestand in regelmäßigen Abständen darauf, anzuhalten, damit er absitzen und sich strecken konnte. Doch dann schien ihm plötzlich wieder bewusstzuwerden, dass sie sich in der Wildnis befanden: er allein, mit nur vier Wachmännern und dem Bauern aus dem Dorf der Familie Guan, der ihnen in unbestimmbarer Entfernung auf seinem Esel folgte. Und so befahl er eilig einem der Schützen, ihm wieder auf das Pferd zu helfen (gelenkig war er nicht), und schon ritten sie weiter.
Es war unverkennbar: Er war nicht gern hier draußen, und er wollte nicht länger bleiben als absolut notwendig. Sie waren in hohem Tempo unterwegs. Zwar hatte das Dorf der Familie Guan vermutlich wenig zu bieten, aber es war sicher besser als ein einsamer Feldweg im Herbst, flankiert von Felswänden und Wald, an einem Tag, der sich dem Abend zuneigte.
Der Bauer war weit zurückgefallen. Aber da sie wussten, wo das Dorf lag, und sich nicht von einem Dorfbewohner auf einem Esel das Tempo diktieren lassen wollten, scherte sie das nicht weiter. Auf sie wartete ein toter Mann – und wer vermochte schon zu sagen, was da noch zwischen ihnen und dieser Leiche lag?
Vor ihnen machte der Pfad einen Bogen, und mit der Sonne im Rücken sahen sie, was vor ihnen lag. Oder besser gesagt stand.
Vier Männer traten aus dem Wald am rechten Wegesrand. Dort gab es keinen Weg, sie tauchten einfach aus dem Unterholz auf und blockierten den Pfad.
Drei von ihnen hatten Schwerter gezogen. Einer trug einen Stab, dick wie eine Faust. Sie waren primitiv gekleidet, in Hosen und Röcken mit Kordelzug, einer war barfuß. Zwei waren sehr groß. Alle machten den Eindruck, geübte Kämpfer zu sein. Keiner sagte ein Wort.
Es bestand nicht der geringste Zweifel daran, was sie waren.
Interessanterweise schlug Daiyans Herz nicht schneller. Stattdessen verspürte er eine rätselhafte Ruhe. Er hörte die Gibbons in den Bäumen über ihnen. Sie wirkten lauter, fast aufgeregt. Vielleicht waren sie das sogar. Die Vögel schwiegen.
Der Unterpräfekt schrie verängstigt und wütend auf und riss eine Hand hoch, woraufhin die Gruppe, vielleicht zwanzig Schritte vor den Gesetzlosen, abrupt zum Stehen kam. Denn es handelte sich fraglos um Gesetzlose. Um waghalsige Gesetzlose, schließlich nahmen sie es mit fünf Männern auf, noch dazu berittenen. Dieser Gedanke veranlasste Daiyan, sich umzuschauen.
Auf dem Weg hinter ihnen standen drei weitere. In der gleichen Entfernung. Alle mit gezogenen Schwertern.
Sie konnten versuchen, die Reihe vor ihnen zu durchbrechen, dachte er. Die Männer waren schließlich zu Fuß.
Nein, das war nicht möglich. Nicht mit Unterpräfekt Wang Fuyin. Seinetwegen waren die Banditen hier, dachte Daiyan: Ein Unterpräfekt konnte ein beachtliches Lösegeld einbringen. Daiyan und die anderen Wachen zählten nicht.
Es lohnte nicht, sie am Leben zu lassen.
Soweit er das Geschehene zu rekonstruieren imstande war, war dies der Gedanke, der ihn handeln ließ.
Er nahm den Bogen, legte einen Pfeil ein und tötete den zuvorderst stehenden Mann, bevor ihm überhaupt bewusst gewesen war, was er da tat. Der erste Tote, der erste Mann, den er durch das hohe Tor in die Nacht schickte. Der erste Geist.
Der zweite Pfeil flog, ein zweiter Mann starb, bevor überhaupt jemand auf den ersten Tod reagiert hatte. In diesem Moment schrie einer der Gesetzlosen auf. Daiyans dritter Pfeil war bereits in der Luft, zielte ebenfalls nach vorn. (Schnelligkeit spielte eine Rolle für Bogenschützen. Er erinnerte sich an diesen Gedanken im Wald an diesem Morgen, er schien ewig her.)
Nachdem auch dieser Pfeil getroffen hatte, stand nur noch ein Mann vor ihnen. Erst später entwickelte Daiyan Regeln dafür, wie man verfuhr, wenn sich Feinde aus mehreren Richtungen näherten, aber an diesem Tag machte er instinktiv alles richtig.
Ein weiterer Schrei, diesmal hinter ihm. Er tötete jedoch erst den vierten Mann, bevor er das Pferd einzig mit dem Druck der Schenkel wendete, einen weiteren Pfeil zog und den vordersten der Männer erschoss, die nun auf sie zustürmten. Tötet als Erstes den, der euch am nächsten steht, würde er später lehren.
Dieser Mann starb ungefähr zehn Schritte entfernt, das Schwert noch einen Moment in der Hand, ehe er zu Boden sackte. Der Pfeil steckte ihm in der Brust. Sie trugen keine Rüstung, diese Gesetzlosen. Daiyan konnte sich nicht daran erinnern, dass er das wirklich wahrgenommen hatte, aber das musste er, denn sonst hätte er auf ihre Gesichter gezielt.
Die anderen beiden Banditen zögerten, das Blatt hatte sich so plötzlich gewendet. Zögern war eine schlechte Strategie. Daiyan erschoss den sechsten Mann, als er gerade die Richtung wechselte, um in den Wald zu laufen. Kein präziser Schuss, er traf den Gesetzlosen im Oberschenkel. Er fiel schreiend hin, ein hoher Ton, sonderbar schrill.
Der Letzte rannte ebenfalls zum Wald. Er starb am äußersten Rand.
Das Ganze dauerte nur wenige Augenblicke, war so schnell vorbei wie ein Blitzschlag. Die Gibbons kreischten fortwährend. Wie sonderbar, dass die Zeit es vermochte, sich so zu verlangsamen, dass er sogar einzelne Gesten und Gesichtsausdrücke sehen (und sich daran erinnern) konnte, und trotzdem so unfassbar schnell verflog.
Daiyan nahm an, er hatte geatmet – atmen war wichtig beim Bogenschießen –, aber sicher sein konnte er sich nicht. Weder der Unterpräfekt noch die anderen Wachen hatten sich geregt, seit Wang Fuyin seinen wütenden, verängstigten Schrei ausgestoßen hatte. Er allein hatte Pfeile in sieben Männern versenkt. Aber das war viel zu leichtfertig dahergesagt. Diese Männer hatten gelebt und waren nun tot. Er hatte sie getötet. So etwas konnte ein Leben in ein Vorher und ein Nachher teilen, dachte Ren Daiyan.
Man hatte nicht getötet. Und dann hatte man es.
Es ist bekannt, ja unvermeidbar, dass Legenden mit der Schilderung der Kindheit ansetzen, lange bevor der Mensch berühmt wurde. Die Geschichten entspringen oft einer blühenden Phantasie und werden angereichert mit wundersam übertriebenen Details: Das ist es, was Legenden ausmacht. Eigenhändig einhundert Männer getötet. Eine feindliche Stadt, umgeben von Mauern dreimal so hoch wie ein Mann, allein des Nachts eingenommen. Ein immerwährendes Gedicht, geschrieben von einem übernatürlich begabten Kind mit des Vaters Pinsel und Tinte. Eine kaiserliche Prinzessin, verführt am Brunnen auf dem Hof des Palasts, die sich daraufhin vor unerfüllter Liebe verzehrt.
Im Falle von Ren Daiyan und seiner ersten Begegnung mit Gesetzlosen an einem Herbsttag auf einem Pfad östlich von Shengdu war die Legende erstaunlich wahrheitsgetreu.
Was mit daran lag, dass der Unterpräfekt Wang Fuyin den Vorfall in einem offiziellen Bericht festhielt, der darüber hinaus seine erfolgreichen Ermittlungen, die Festnahme und Hinrichtung eines Mörders in einem nahe gelegenen Dorf beschrieb.
Unterpräfekt Wang gab im Detail wieder, wie er bei seinen Ermittlungen vorgegangen war. Und zwar äußerst raffiniert, weshalb er dafür belobigt wurde. Diese erfolgreiche Aufklärung eines Mordes würde auch Wang Fuyins Lebensweg erheblich verändern. Laut seinen eigenen Worten machte diese Erfahrung ihn zu einem neuen Mann, gab ihm neuen Sinn und Zweck.
Als er im fortgeschrittenen Alter die Geschichte von den Gesetzlosen und Ren Daiyan erneut erzählte, bezog er sich auf seine frühen Schriften (Kopien davon hatte er sorgfältig verwahrt) aus jenen Tagen, als er noch ganz am Anfang seiner Karriere stand.
Er war im Alter noch genauso präzise wie als junger Mann, und er brüstete sich sein Leben lang mit seiner überlegenen Schriftkunst und Kalligraphie. Die Zahl der Gesetzlosen betrug auch in seinen Memoiren sieben. Ren Daiyan war noch immer fünfzehn Jahre alt (nicht zwölf, wie auch behauptet wurde). Wang Fuyin beschrieb sogar, dass Daiyan einen der Banditen nur verletzt hatte. Ein anderer der Bogenschützen war – höchst dramatisch – von seinem Pferd gesprungen, um auch den siebten Mann zu töten, der am Boden lag.
Fuyin, beim Verfassen bereits ergraut, bediente sich ein wenig der Ironie, als er diese letzte »mutige« Tat beschrieb. Zu diesem Zeitpunkt war er längst für seinen Witz bekannt, für seine klare Darstellungsweise, für seine Bücher über richterliche Ermittlungen (die allen Gerichten in Kitai als Grundlage dienten) und dafür, das Chaos dieser Zeit lebendig überstanden zu haben.
Das konnten nicht viele behaupten, die sich seinerzeit im oder am Zentrum der Macht befanden. Es hatte Geschick, Fingerspitzengefühl, der Fähigkeit, die richtigen Freunde zu wählen, und einer großen Portion Glück bedurft.
Glück war beteiligt, auf die eine oder andere Art.
Daiyan war sich sofort darüber im Klaren, dass sich sein Leben verändert hatte. Was auf dem einsamen Pfad zwischen Wald und Felswand geschehen war, fühlte sich vorherbestimmt an, notwendig, nicht, als hätte er wirklich eine Wahl gehabt. Eher, als hätte jemand anderes die Wahl für ihn getroffen und er sie nur ausgeführt.
Er stieg von seinem Pferd. Er ging zu den Leichen und zog seine Pfeile aus den toten Männern. Die Sonne stand im Westen, beschien den Pfad, beleuchtete die Wolken von unten. Ein Wind blies. Daiyan erinnerte sich daran, dass ihm kalt war und er sich fragte, ob das eine Reaktion auf das soeben Geschehene war.
Man hatte nicht getötet. Und dann hatte man es.
Er holte zunächst die Pfeile von den Männern, die hinter ihnen gewesen waren. Einer lag direkt bei den Baumwurzeln am Waldrand. Dann ging er und zog die anderen vier aus den Männern auf der Straße vor ihnen, den Männern, die sie als Erste gesehen hatten. Ohne weiter darüber nachzudenken, drehte er den größten der Männer um, löste die beiden gekreuzten Lederscheiden von seinem Rücken und nahm die Schwerter an sich.
Sie lagen schwer in der Hand. Aber er hatte bislang auch nur mit Bambus gekämpft. Noch vor ein paar Stunden. An diesem Morgen. Ein Junge in einem Hain. Er platzierte die gekreuzten Lederscheiden auf seinem Rücken, wozu er den Köcher kurzzeitig abnahm und dann anpasste, genau wie seinen Bogen. Suchte die optimale Position, testete, wie sich das Gewicht der Schwerter auf sein Gleichgewicht auswirkte. Es würde dauern, sich daran zu gewöhnen, dachte er bei sich, dort auf dem Pfad im Wind, während die Sonne sich allmählich senkte.
Rückblickend konnte er sagen, dass er schon in diesem Moment verstanden hatte, was mit ihm geschehen war.
Es war so einfach gewesen. So mühelos, intuitiv: die getroffenen Entscheidungen, die Abfolge von Bewegungen. Das Wissen, wohin er zuerst schießen musste, und danach und danach. Dies – diese Welt der Bogen und Schwerter – war das Element, für das er auserkoren war. Diese Augenblicke hatten ihm das gezeigt, und er musste an einen Ort, an dem er seine Fähigkeiten nicht nur erweitern, sondern perfektionieren konnte. Am Anfang standen die Träume eines Jungen, und dann …
Die Vögel fingen wieder an zu singen. Die Gibbons hatten nie mit ihrem Geschrei aufgehört.
Er schaute sich einmal nach Shengdu um, daran erinnerte er sich. Ein Blick zu dem Ort, an dem seine Eltern wohnten, dann ließ er sein Leben hinter sich und ging in den Wald, trat zwischen die dunklen Bäume (wo es dunkler war als in seinem Bambushain), genau an der Stelle, an der die Gesetzlosen vor so kurzer Zeit herausgetreten waren.
Kapitel 2
Die kitanische Armee zählte viele Männer, aber sie waren keine guten Soldaten, und es mangelte an guter Führung. Die meisten von ihnen waren Bauern – oder Söhne von Bauern –, unglücklich bis zur Verzweiflung darüber, so weit von zu Hause fort zu sein und noch dazu in den nördlichen Gebieten kämpfen zu müssen.
Sie kannten Hirse und Weizen, Reis aus Mischanbau, Gemüsefelder, Obstplantagen, Seidenraupenzucht sowie Anbau und Ernte von Tee. Eine Vielzahl von ihnen hatte in der Salzwüste oder in den Salzminen gearbeitet. Für sie bot die Armee ein besseres Leben als die Beinahe-Leibeigenschaft und der frühe Tod, die sie sonst erwartet hätten.
Fast keiner von ihnen konnte erklären, warum sie gegen die Kislik-Barbaren kämpften, durch gelbe Sturmluft und wirbelnden Sand marschierten, der biss und schnitt, sobald der Wind an Stärke gewann. Zelte und Zeltpflöcke flogen in diesem Sturm davon. Die Kislik hatten Pferde, und sie kannten sich aus, kannten das Gelände und Wetter, konnten angreifen und sich zurückziehen, konnten töten und im nächsten Moment auf und davon sein.
Wäre es nach der Mehrheit der zweihunderttausend Mann starken Kaiserlichen Befriedungsarmee gegangen, hätten die Barbaren diesen rauen Flecken Erde gern behalten können.
Aber ihr weiser und glorreicher Kaiser, der in Hanjing mit dem Mandat des Himmels regierte, fand die Kislik überheblich und arrogant, fand, ihnen müsse eine harte Lektion erteilt werden. Seine Ratgeber hatten Chancen gewittert: Ruhm und Macht, Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Hierarchie des Hofs. Für manche von ihnen glich dieser Krieg einem Test, war er eine Vorbereitung auf den wahren Feind, das noch viel überheblichere Reich der Xiaolu im Norden Kitais.
Es gab ein Abkommen mit den Xiaolu, das bereits seit zweihundert Jahren bestand (in der Zeit zwar wiederholt gebrochen wurde, aber nie irreparabel). Ihm zufolge gehörten die Vierzehn Präfekturen, die sie diesseits der Langen Mauer Kitais erobert hatten, zum Steppenvolk.
Vater und Großvater des ruhmreichen Kaisers hatten sie nicht zurückgewinnen können, weder durch Diplomatie noch die Androhung von Waffengewalt, obwohl sie beides durchaus versucht hatten. Nicht einmal eine dargebotene Prinzessin hatte den gewünschten Effekt erzielt. Die Xiaolu wussten nämlich, was sie hatten: Indem sie die hügelige Landschaft mit ihren engen Pässen in ihrer Gewalt hielten, stellten sie sicher, dass die nördlichen Städte Kitais allen Reitern offen standen, die in wildem Galopp über die weite Ebene jagten. Genau genommen gehörten die Überreste der Langen Mauer ihnen. Sie bedeutete nichts mehr, war nur noch bröckelndes Denkmal der längst vergangenen Größe Kitais.
All dies zurückgeben für eine Prinzessin?
Wer genau hinsah und darüber nachdachte, erkannte in all dem Vorboten für das, was bevorstand. Nicht nur in den großen Irrungen und Wirrungen der Zeit, sondern ganz explizit an den Soldaten im Nordwesten, die beharrlich durch den wirbelnden, wandernden Sand nach Norden marschierten, nach Erighaya, der Hauptstadt der Kislik am äußersten Ende der Wüste, die westlich der Biegung des Goldenen Flusses begann.
Diese Truppen hatten den Befehl, Erighaya zu belagern, zu zerstören und die Anführer der Kislik in Ketten nach Hanjin zu bringen. Sie sollten die Frauen und Töchter der Steppe versklaven und den Barbaren des Nordwestens Demut vor der versammelten und glorreichen Macht Kitais und seines Kaisers lehren.
Sie hatten jedoch etwas vergessen auf ihrem Weg in den Norden. Sie hatten in der Tat etwas vergessen.
Im Frühling begleitete ein Mädchen seinen Vater durch das Chaos und die Aufregung in einer überfüllten Stadt.
Man konnte es Wahnsinn nennen oder kollektives Fieber, was Yenling, zweitgrößte Stadt des Kaiserreichs, während des Pfingstrosenfests befiel.
Jeden Frühling, zwei Wochen lang, wenn der König der Blumen in Blüte stand, war es fast unmöglich, sich in Yenling durch die Straßen oder Gassen zu bewegen oder ein freies Zimmer in einem der Gasthäuser zu finden.
In großen und kleinen Häusern drängten sich Gäste von fern und nah, die zum Fest angereist waren. Menschen boten ihren Wohnraum, ein Bett oder eine Pritsche am Boden für drei bis vier Fremde für beträchtliche Summen feil.
Die Straße zum Tempel des Langen Lebens bis hinunter zum westlichen Haupttor und beide Seiten der Straße des Monddeichs quollen über vor eilig errichteten Zelten und Pavillons, wo Pfingstrosen dargeboten wurden.
Einzelne, makellose Blüten der Gelben Yao (liebevoll auch »Die Palastdame« genannt) und der Roten Wei kosteten mehrere tausend Münzen. Dies waren die edelsten Prachtstücke, die gefeierten, denn nur die Reichsten konnten sie sich leisten.
Aber es gab auch weniger kostspielige Sorten. Die Violette Zuo und die Scharlachrote Rose des Verborgenen Flusses, die Kastanienbraune Schärpe, die Neunblättrige Perle, die exquisiten, winzigen Blätter der Shuoun. Neunzig verschiedene Arten von Pfingstrosen konnte man in Yenling entdecken, sobald die Sonne im Frühling zurückkehrte, ihre Blüte ein Grund zur Freude, was immer sich auch sonst gerade im Kaiserreich, an seinen Grenzen oder im Rest der Welt zutrug.
Kaum zeigten sich die ersten Blütenblätter, wurden die Eilboten ausgeschickt, die jeden Morgen auf dem für sie reservierten Mittelstreifen der kaiserlichen Straße Richtung Osten galoppierten. Es gab sechs Poststationen zwischen Yenling und Hanjin. Eine schnelle Staffel von Reitern und Pferden konnte die Strecke in einem Tag und einer Nacht bewältigen, um Blumen nach Hanjin zu bringen, damit der Sohn des Himmels an dem herrlichen Spektakel Anteil nehmen konnte.
Yenling wurde seit über vierhundert Jahren für seine Pfingstrosen gefeiert, und sie war schon viel länger die kaiserliche Blume.
Asketische Philosophen verhöhnten sie, erklärten sie für künstlich – Pfingstrosen wurden von Menschenhand veredelt. Sie nannten sie kitschig und sinnlich, zu weiblich, um die Begeisterung zu rechtfertigen, ganz besonders im Vergleich zum kargen, maskulinen Bambus oder der Pflaumenblüte.
Diese Ansichten waren bekannt, aber sie zeigten keine Wirkung, nicht einmal am Hof. Die Besessenheit mit Pfingstrosen war zu einem gewichtigen Fall populärer Weisheit (oder populären Wahnsinns) herangewachsen, der sich selbst über die gedanklichen Ergüsse der Weisen hinwegsetzte.
Jeder, dem es möglich war, kam zum Pfingstrosenfest nach Yenling.
Die Menschen auf den Straßen hatten sich Blumen an die Hüte gesteckt. Aristokraten wurden in ihren Sänften getragen, ebenso hochrangige Beamte in ihren langen Gewändern. Einfache Händler drängten sich in den Gassen, und zahlreiche Bauern zog es in die Stadt, um sich die Blüten und die Darbietungen anzusehen.
Die größeren Gärten bescherten ihren Besitzern nicht gerade geringe Geldmengen durch den Verkauf von Pfingstrosen vor ihren Toren oder entlang der Straßen.
Die Wei-Familie, begabte Züchter dieser Blumen, verlangten zehn Käsch Eintritt für ihren ummauerten Garten und die Fahrt mit dem Kahn zu der kleinen Insel im Teich, wo ihre schönsten Pfingstrosen wuchsen. Die Familie hatte Wachpersonal eingestellt; wer eine Blüte berührte, bekam Schläge.
Die Zucht dieser makellosen, duftenden Blüten erforderte unermessliches Geschick. Gäste zahlten, um die sich schlängelnden Wege betreten und den betörenden Luxus schnuppern zu dürfen. Sie standen über Stunden an und kehrten tags darauf zurück, um ja keine Veränderung zu verpassen.
Selbst Frauen waren unter ihnen, helle Blüten im Haar. Zu dieser Zeit und an diesem Ort – in Yenling während des Pfingstrosenfests – wurden die immer strengeren Beschränkungen weiblicher Freiheit gelockert, einfach, weil sie in diesen Wochen nicht durchgesetzt werden konnten.
Es herrschte Frühling. Laute, erregte Menschenmengen und der berauschende Duft übertrieben bunter Blüten. Es gab Flötenmusik, Gesang, Tanz auf den Straßen, Jongleure, Geschichtenerzähler, Männer mit dressierten Tieren. In Buden wurde Brot und Wein verkauft, Menschenmassen durften sich zweifellos unmoralischem Verhalten in den Höfen, Gassen und Schlafsälen hingeben, sobald sich die Dämmerung senkte.
Ein weiterer Grund für die Philosophen, die Torheit der Massen und die Blume zu beklagen.
Shan hält sich dicht neben ihrem Vater, ihr ist ganz schwindelig vor Aufregung, aber das will sie sich unter keinen Umständen anmerken lassen. Das wäre würdelos, kindisch.
Sie konzentriert sich darauf, wirklich alles zu sehen, auf sich wirken zu lassen, auch die kleinen Dinge zu bemerken. Lieder glücken (oder missglücken) im Detail, davon ist sie überzeugt. Sie sind mehr als nur Wörter und Musik. Erst die Schärfe des Blicks macht eine Arbeit zu etwas Besonderem …
In diesem Frühling ist sie siebzehn Jahre alt. Kommendes Jahr um diese Zeit wird sie bereits verheiratet sein. Noch immer ein entfernter Gedanke, jedoch kein unangenehmer.
Gerade aber ist sie mit ihrem Vater in Yenling und Teil der morgendlichen Menschenmassen des Fests. Gewusel, Geräusche, Gerüche (Blumen über Blumen, dazu das Gedränge vieler Körper; die Pracht und das Übel, denkt sie). Sie ist hier wahrlich nicht die einzige Frau, trotzdem schaut man ihr nach, während sie mit ihrem Vater die Straße zum Tempel des Langen Lebens hinaufgeht und die Stadtmauer hinter sich lässt.
Vor ungefähr zwei Jahren hat es angefangen. Man müsste schon verliebt oder ein Dichter sein, um sie schön zu nennen, aber da ist wohl etwas an ihrer Art zu stehen oder zu gehen, der Art, wie ihr Blick wandert und dann auf einem Gegenstand oder einem Menschen verharrt, was die Aufmerksamkeit anderer auf sie zieht. Sie hat weit auseinanderliegende Augen, eine lange Nase und lange Finger. Sie ist groß für eine Frau. Das hat sie von ihrem Vater.
Lin Kuo ist ein Mann mit sehr langen Gliedmaßen, aber sehr bescheiden – seit seine Tochter zurückdenken kann, steht er leicht gebückt, als wolle er die Bereitschaft signalisieren, sich jederzeit respektvoll zu verneigen.
Er hat die Jinshi-Prüfungen beim dritten Versuch bestanden, aber nie einen Posten bekommen, nicht einmal in der Provinz. Es gibt viele Männer wie ihn, Absolventen ohne Anstellung. Er trägt das Gewand und den Gürtel eines Beamten, dazu den Titel Ehrenmann, der jedoch nichts weiter heißt, als dass er kein Amt trägt. Er lässt sich den monatlichen Lohn zahlen, zu dem ihn dieser Titel berechtigt. Seine Kalligraphie ist durchaus akzeptabel, und er hat gerade ein kleines Buch über die Gärten Yenlings fertiggestellt, deshalb sind sie hier.
Er hat keine offensichtlichen Feinde – wichtig in diesen Zeiten –, und er scheint nichts davon zu ahnen, dass man sich gelegentlich über ihn lustig macht. Seiner Tochter, womöglich etwas aufmerksamer, ist das jedoch nicht entgangen.
Er ist instinktiv freundlich, wenngleich er ein wenig Angst vor der Welt hat. Wenn etwas an ihm ganz und gar außergewöhnlich ist, dann die Tatsache, dass er seine Tochter, sein einziges, noch lebendes Kind, aufgezogen hat, als wäre sie ein Junge.
Shan hat die Klassiker gelesen, die großen und kleinen Dichter bis zu den Anfängen der Schriftlichkeit in Kitai. Sie hat eine sehr gute informelle und sogar noch bessere formelle Handschrift. Natürlich singt sie, kann die Pipa spielen – das können die meisten Frauen aus gutem Hause –, aber sie schreibt darüber hinaus selbst Lieder, nach der neuen Ci-Form, die sich in dieser Zwölften Dynastie herausgebildet hat. Dabei unterlegte man wohlbekannte Melodien der Landbevölkerung oder aus den Vergnügungsvierteln mit neuen Wörtern.