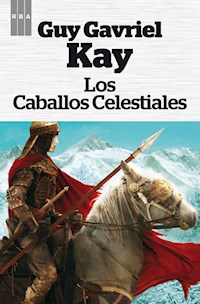9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jetzt als Doppelroman erhältlich: Guy Gavriel Kays große Fantasy-Geschichte um Kitai, das Reich der Mitte! Buch 1: Im Schatten des Himmels Buch 2: Am Fluss der Sterne Guy Gavriel Kay ist der Großmeister der historischen Fantasy. Mit dem Doppelroman »Im Schatten des Himmels« und »Am Fluss der Sterne« hat er ein bildgewaltiges Epos geschrieben, das in einem phantastischen Reich der Mitte spielt. Kay beschwört das China der Tang-Dynastie herauf und erzählt eine grandiose Fantasy-Geschichte voller Abenteuer und Magie. Im Schatten des Himmels »250 sardianische Pferde, Geschöpfe von unvergleichlicher Schönheit und Seltenheit!« Als der Kriegermönch und Gelehrte Shen Tai für seine Heldentaten von der Jadeprinzessin des Nachbarreiches belohnt wird, macht ihn das überaus großzügige Geschenk auf einen Schlag zu einem der mächtigsten Männer im Reich der Mitte – und damit gerät er mitten hinein in ein gefährliches Spiel aus Mord und Intrigen, das das Reich Kitai in einen alles zerstörenden Krieg zu reißen droht. Am Fluss der Sterne Einst galt Xinan als schönste Stadt der zivilisierten Welt, der Kaiserhof als Hort des Luxus und der Kultur. Doch seit Kitai in weiten Teilen an die Barbaren aus dem Norden gefallen ist, herrscht Angst auf den Straßen, und das Heulen der Wölfe hallt durch verfallene Gemäuer. Nur einem Mann scheint es möglich, Kitai wieder zu neuer Größe zu führen: Ren Daiyan, Heerführer, ehemaliger Geächteter, Bogenschütze von fast mythischer Gestalt. »Das Werk eines Meisters auf der Höhe seiner Kunst!« The Washington Post
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1927
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Guy Gavriel Kay
Das Reich Kitai
Im Schatten des Himmels / Am Fluss der Sterne
Über dieses Buch
Guy Gavriel Kay ist der Großmeister der historischen Fantasy. Mit dem Doppelroman »Im Schatten des Himmels« und »Am Fluss der Sterne« hat er ein bildgewaltiges Epos geschrieben, das in einem phantastischen Reich der Mitte spielt. Kay beschwört das China der Tang-Dynastie herauf und erzählt eine grandiose Fantasy-Geschichte voller Abenteuer und Magie.
Im Schatten des Himmels
»250 sardianische Pferde, Geschöpfe von unvergleichlicher Schönheit und Seltenheit!« Als der Kriegermönch und Gelehrte Shen Tai für seine Heldentaten von der Jadeprinzessin des Nachbarreiches belohnt wird, macht ihn das überaus großzügige Geschenk auf einen Schlag zu einem der mächtigsten Männer im Reich der Mitte – und damit gerät er mitten hinein in ein gefährliches Spiel aus Mord und Intrigen, das das Reich Kitai in einen alles zerstörenden Krieg zu reißen droht.
Am Fluss der Sterne
Einst galt Xinan als schönste Stadt der zivilisierten Welt, der Kaiserhof als Hort des Luxus und der Kultur. Doch seit Kitai in weiten Teilen an die Barbaren aus dem Norden gefallen ist, herrscht Angst auf den Straßen, und das Heulen der Wölfe hallt durch verfallene Gemäuer. Nur einem Mann scheint es möglich, Kitai wieder zu neuer Größe zu führen: Ren Daiyan, Heerführer, ehemaliger Geächteter, Bogenschütze von fast mythischer Gestalt.
»Das Werk eines Meisters auf der Höhe seiner Kunst!« The Washington Post
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Guy Gavriel Kay ist der erfolgreichste Fantasy-Autor Kanadas. Er wurde in über 25 Sprachen übersetzt und hat drei Mal den World Fantasy Award verliehen bekommen. Zusammen mit Christopher Tolkien hat er das »Silmarillion« herausgegeben. »Im Schatten des Himmels« wurde mit dem Sunburst Award als »Bester Roman des Jahres« sowie mit dem Prix Elbakin als »Bester Fantasy-Roman des Jahres« ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe von »Im Schatten des Himmels« erschien 2010 unter dem Titel »Under Heaven« im Verlag Roc Books, an imprint of Penguin Random House, New York.
© 2010 Guy Gavriel Kay
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die Originalausgabe von »Am Fluss der Sterne« erschien 2013 unter dem Titel »River of Stars« im Verlag Roc Books, an imprint of Penguin Random House, New York.
© 2013 Guy Gavriel Kay
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung mehrerer Bilder von shutterstock/caramelina/baoyan/Feaspb
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490705-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Buch 1 - Im Schatten des Himmels
Widmung
Die wichtigsten Personen
Motto
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Zweiter Teil
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Dritter Teil
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Vierter Teil
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Danksagung
Anmerkung des Autors
Buch 2 - Am Fluss der Sterne
Widmung
Die wichtigsten Personen
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Zweiter Teil
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Dritter Teil
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Vierter Teil
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Fünfter Teil
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Nachwort
Für Sybil, in Liebe
Die wichtigsten Personen
Taizu, der Sohn des Himmels, Kaiser von Kitai
Shinzu, sein drittgeborener Sohn und Erbe
Xue, seine einunddreißigste Tochter
Wen Jian, die edle Konkubine, auch die geliebte Gefährtin genannt
Chin Hai, früherer erster Minister, inzwischen verstorben
Wen Zhou, erster Minister von Kitai, Wen Jians Cousin
General Shen Gao, verstorben, früherer linker Kommandant des befriedeten Westens
Shen Liu, sein ältester Sohn, oberster Berater des ersten Ministers
Shen Tai, sein zweitgeborener Sohn
Shen Chao, sein drittgeborener Sohn
Shen Li-Mei, seine Tochter
An Li (»Roshan«), Militärgouverneur des Siebten, Achten und Neunten Distrikts
An Rong, sein ältester Sohn
An Tsao, ein jüngerer Sohn
Xu Bihai, Militärgouverneur des Zweiten und Dritten Distrikts, in Chenyao
Xu Liang, seine älteste Tochter
Lin Fong, Kommandant der Festung Eisentor
Wujen Ning, in Eisentor stationierter Soldat
Tazek Karad, an der Langen Mauer stationierter Offizier
Wan-si
Wei Song
Lu Chen
Ssu Tan
Zhong Ma
Sima Zian, ein Dichter, der »Verbannte Unsterbliche«
Chan Du, ein Dichter
Frühlingsregen, eine Kurtisane im Norddistrikt, später Lin Chang genannt
Chou Yan und Xin Lun, Studenten und Freunde von Shen Tai
Feng, eine Wache im Dienste Wen Zhous
Hwan, ein Diener Wen Zhous
Pei Qin, ein Bettler
Ye Lao, ein Verwalter
Sangrama der Löwe, König des tagurischen Reiches
Cheng-wan, die Weiße Jadeprinzessin, eine seiner Frauen, die siebzehnte Tochter von Kaiser Taizu
Bytsan sri Nespo, ein Offizier der tagurischen Armee
Nespo sri Mgar, sein Vater, der ranghöchste Offizier
Gnam und Adar, tagurische Soldaten
Dulan, Kaghan des Steppenvolks der Bogü
Hurok, der Mann seiner Schwester, späterer Kaghan
Meshag, Huroks ältester Sohn
Tarduk, Huroks zweitgeborener Sohn
Nimmt man Bronze als Spiegel,
so kann man das eigene Erscheinungsbild verbessern;
nimmt man die Geschichte als Spiegel,
so kann man Aufstieg und Fall eines Landes begreifen;
nimmt man gute Menschen als Spiegel,
so kann man richtig und falsch unterscheiden.
Li Shimin, Tang-Kaiser Taizong
Erster Teil
Kapitel 1
Inmitten der unzähligen Geräusche, der jadegoldenen Pracht und dem wirbelnden Staub von Xi’an hatte er oft die ganze Nacht unter Freunden im Norddistrikt verbracht und mit den Kurtisanen Gewürzwein getrunken.
Für gewöhnlich lauschten sie dann der Flöte oder der Pipa, trugen Gedichte vor und forderten einander mit spöttischen Bemerkungen und Zitaten heraus. Manchmal zogen sie sich auch mit einer duftenden, zärtlichen Frau auf ein Zimmer zurück, ehe sie nach dem Ertönen der Morgentrommeln, die das Ende der Ausgangssperre verkündeten, auf unsicheren Beinen nach Hause schwankten, wo sie, anstatt zu lernen, den Tag verschliefen.
Doch hier in den Bergen, allein, in der rauen, klaren Luft am Ufer von Kuala Nor, weit im Westen der kaiserlichen Hauptstadt, sogar noch jenseits der Grenzen des Kaiserreiches, lag Tai bereits bei Einbruch der Dunkelheit, beim Leuchten der ersten Sterne in seinem schmalen Bett und war bei Sonnenaufgang wieder wach.
Im Frühling und Sommer wurde er von den Vögeln geweckt. Hier in der Gegend nisteten sie lautstark und zu Tausenden: Fischadler und Kormorane, Wildgänse und Kraniche. Die Gänse ließen ihn an seine Freunde in der Ferne denken. Wildgänse symbolisierten Abwesenheit – in der Dichtung wie auch im Leben. Kraniche hingegen standen für Treue, etwas ganz anderes.
Im Winter war es so eisig, dass ihm die Kälte bisweilen den Atem raubte. Wenn der Nordwind blies, kam er einem Überfall gleich, draußen vor der Hütte und selbst noch durch die Wände hindurch. Nachts schlief Tai unter mehreren Schichten aus Pelz und Schafsfell, und keine Vögel weckten ihn am Morgen von den nunmehr gefrorenen Nistplätzen am anderen Ufer.
Die Geister waren zu jeder Jahreszeit dort draußen, in mondbeschienenen Nächten ebenso wie in lichtlosen. Kamen hervor, kaum dass die Sonne untergegangen war.
Inzwischen kannte Tai ihre Stimmen: die wütenden und die verlorenen und die, aus deren dünnen, langgezogenen Klagelauten nichts als Schmerz sprach.
Sie jagten ihm keine Angst ein – nicht mehr. Anfangs hatte er noch geglaubt, er müsse vor Furcht umkommen, in jenen ersten Nächten, die er allein mit den Toten verbracht hatte.
Im Frühling, Sommer und Herbst blickte er manchmal durch die geöffneten Fensterläden in die Dunkelheit, hinaus trat er jedoch nie. Unter dem Mond und den Sternen gehörte die Welt am See den Geistern. Zumindest war er im Laufe der Zeit zu diesem Verständnis gelangt.
Von Anfang an hatte er einen festen Tagesablauf eingehalten, um nicht von Einsamkeit oder Angst überwältigt zu werden. Oder von der Ungeheuerlichkeit dieses Ortes. Mancher Heilige oder Einsiedler mochte sich bewusst wie ein Blatt im Wind durch den Tag treiben lassen, sich über das Fehlen von Willen und Verlangen definieren, doch entsprach dies nicht Tais Natur. Er war kein Heiliger.
Nach dem Aufstehen sprach er zunächst die Gebete für seinen Vater. Tai befand sich noch in der traditionellen Trauerzeit, und die Aufgabe, die er sich gestellt und die ihn an diesen abgelegenen See geführt hatte, galt allein dem Gedenken an den Verstorbenen.
Nach der Anrufung der Götter, die – wie Tai annahm – in gleicher Weise von seinen Brüdern daheim durchgeführt wurde, ging er hinaus auf die Bergwiese (verschiedene Grüntöne, die mit Wildblumen gespickt waren, oder Eis und Schnee, die bei jedem Schritt knirschten), und sofern es nicht stürmte, machte er dort seine Kanlin-Übungen. Erst ohne, dann mit einem und schließlich mit beiden Schwertern.
Er blickte auf das kalte Wasser des Sees, zu der kleinen Insel in der Mitte und hinauf zu den umliegenden Bergen, die sich schneebedeckt und ehrfurchtgebietend übereinander erhoben. Jenseits der nördlichen Gipfel fiel das Land Hunderte Li ab, ging über in die langen Dünen der Todeswüsten, links und rechts flankiert von den Seidenstraßen, denen der Hof, das Kaiserreich und die Einwohner Kitais ihren Reichtum verdankten. Sein Volk.
Im Winter fütterte und tränkte Tai sein kleines, zotteliges Pferd in dem Stall, der an seine Hütte anschloss. Wenn das Wetter sich wandelte und das Gras zurückkehrte, ließ er das Tier tagsüber draußen weiden. Es war ausgesprochen friedfertig und machte keine Anstalten davonzulaufen. Wohin auch?
Nach seinen Übungen bemühte Tai sich, Stille einkehren zu lassen. Sich von den Wirren des Lebens, von Ehrgeiz und dem Streben nach mehr zu lösen, um der Aufgabe, die er gewählt hatte, würdig zu sein.
Und dann machte er sich daran, die Toten zu begraben.
Seit seiner Ankunft hier hatte er nie versucht, kitanische von tagurischen Soldaten zu unterscheiden. Sie lagen durcheinander, verstreut oder aufgetürmt, nur mehr Schädel und weiße Knochen. Ihr Fleisch war längst oder – wenn es sich um Streiter des letzten Feldzugs handelte – erst unlängst zu Staub geworden, wilden Tieren oder Aasvögeln zum Opfer gefallen.
Dieser letzte Kampf war zu einem Triumph geworden, wenn auch zu einem teuer bezahlten: In einer einzigen Schlacht waren vierzigtausend Mann umgekommen, beinahe so viele Kitaner wie Taguren.
Tais Vater hatte als General in diesem Krieg gedient und war anschließend mit einem stolzen Titel geehrt worden: linker Kommandant des befriedeten Westens. Der Sohn des Himmels hatte ihn großzügig für den Sieg belohnt. Nach seiner Rückkehr in den Osten war Shen Gao zu einer Privataudienz in die Halle des Glanzes im Ta-Ming-Palast geladen worden, hatte die purpurne Schärpe erhalten, anerkennenden Worten aus dem Mund des Kaisers gelauscht und aus seiner Hand ein Jadegeschenk entgegengenommen – nur von einem einzigen Mittelsmann übereicht.
Die Familie des Generals profitierte ohne Zweifel von dem, was sich an diesem See zugetragen hatte. Tais Mutter und seine Zweite Mutter hatten gemeinsam Weihrauch verbrannt und Kerzen entzündet, um den Ahnen und Göttern für ihre Gnade zu danken.
Bis zu General Shen Gaos Tod vor zwei Jahren war die Erinnerung an diese Schlacht jedoch nicht nur ein Quell des Stolzes, sondern auch des Leides gewesen und hatte ihn gezeichnet.
Zu viele Männer hatten im Kampf um einen See an der Grenze zum Nirgendwo ihr Leben gelassen, und letzten Endes fiel er keinem der beiden Reiche zu.
So wurde es anschließend in einem Vertrag geregelt, mittels komplizierter Abläufe und Rituale. Zum ersten Mal seit Menschengedenken erhielt der König der Taguren eine kitanische Prinzessin zur Frau.
Als Tai noch ein Knabe war, hatte er sich von der Zahl der Toten dieser Schlacht – vierzigtausend – keine Vorstellung machen können. Heute war das anders.
Der See und die Wiese lagen zwischen einsamen Zitadellen, wurden von beiden Reichen aus mehrere Tagesreisen währender Entfernung bewacht – im Süden von Tagur, im Osten von Kitai. Jetzt herrschte hier stets Stille. Abgesehen vom Pfeifen des Windes, den Schreien der Vögel und den Geistern.
General Shen hatte nur seinen jüngeren Söhnen – nicht aber dem ältesten – von seinem Leid und der Schuld erzählt. Derlei Gefühle ziemten sich nicht für einen Mann seines Standes und konnten ihm als Verrat ausgelegt werden, als Leugnen der Weisheit des Kaisers, welcher im Auftrag des Himmels regierte, unfehlbar war, nicht fehlen konnte, denn sonst wären sein Thron und das Kaiserreich in Gefahr.
Und doch waren diese Gedanken geäußert worden – und nicht nur einmal –, nachdem Shen Gao sich auf das Familienanwesen am südlichen Wasserlauf nahe dem Wai zurückgezogen hatte. Üblicherweise nach einem ruhigen Tag und etwas Wein, während Blätter oder Lotusblüten von den Bäumen fielen und flussabwärts trieben. Und die Erinnerung an die Worte seines Vaters war der Hauptgrund dafür, dass sein zweitältester Sohn die Trauerzeit hier verbrachte anstatt zu Hause.
Gewiss könnte man behaupten, die stille Trauer des Generals sei falsch und unangebracht, diese Schlacht für die Verteidigung des Reiches notwendig gewesen. Man musste bedenken, dass die Kitaner nicht immer über die Taguren triumphiert hatten. Die Könige von Tagur, auf ihrem fernen, uneinnehmbaren Plateau, waren überaus ehrgeizig. Kuala Nor jenseits des Eisentorpasses – die einsamste Festung des gesamten Kaiserreichs – war hundertfünfzig Jahre lang immer wieder umkämpft worden, und in dieser Zeit hatte es auf beiden Seiten Siege und Schandtaten gegeben.
»Tausend Meilen fällt das Mondlicht, östlich von Eisentor«, hatte Sima Zian, der Verbannte Unsterbliche, geschrieben. Das entsprach zwar nicht ganz der Wahrheit, doch jeder, der die Festung Eisentor einmal besucht hatte, wusste, was der Dichter meinte.
Und Tai befand sich mehrere Tagesritte westlich des Forts, jenseits dieses letzten Außenpostens des Kaiserreiches, bei den Toten: bei den Verlorenen, die des Nachts weinten, und den Knochen von mehr als hunderttausend Soldaten, die im fallenden Mondlicht oder unter der Sonne weiß schimmerten. Manchmal, wenn er in seinem Bett lag und die Berge im Dunkeln, stellte Tai fest, dass eine Stimme, die er kannte, schon seit einiger Zeit verstummt war. Dann wusste er, dass er die zugehörigen Knochen zur Ruhe gebettet hatte.
Aber es waren einfach zu viele. Es bestand keinerlei Hoffnung, je fertig zu werden: Das war eine Aufgabe für Götter, herabgestiegen aus den neun Himmeln, nicht für einen einzelnen Menschen. Aber wenn man nicht alles schaffen konnte, bedeutete das, dass man nichts geschafft hatte?
Seit zwei Jahren beantwortete Tai diese Frage nun schon auf seine Weise, im Andenken an seinen Vater, der ihn mit leiser Stimme um ein weiteres Glas Wein bat, während er dabei zusah, wie die großen, trägen Goldfische im Teich und die Blüten auf dem Wasser trieben.
Die Toten waren überall – selbst auf der Insel. Dort hatte es ein Fort gegeben, ein kleines, das jetzt in Trümmern lag. Tai hatte sich vorgestellt, wie sich die Kampfhandlungen dorthin verlagert hatten. Wie in Windeseile Boote auf dem kiesigen Ufergrund gezimmert wurden und die verzweifelten Verteidiger der einen oder anderen Armee – je nachdem um welches Jahr es sich handelte – in der Falle saßen und letzte Pfeile auf ihre unerbittlichen Gegner abfeuerten, die ihnen über den See den Tod brachten.
Bei seiner Ankunft vor zwei Jahren hatte Tai beschlossen, dort anzufangen, und war mit dem kleinen Boot, das er gefunden und repariert hatte, hinübergerudert. Das war im Frühling gewesen, und der See hatte den blauen Himmel und die Berge gespiegelt. Die Insel war ein festumrissenes Gebiet, klar begrenzt, die Aufgabe nicht ganz so überwältigend. Am Festland lagen die Toten von der Wiese bis tief hinein in die Kiefernwälder, so weit, wie Tai an einem langen Tag laufen konnte.
Etwas mehr als die Hälfte des Jahres konnte er unter diesem hohen, unerbittlichen Himmel graben und zerbrochene, verrostete Waffen zusammen mit den Knochen verscharren. Die Arbeit war furchtbar anstrengend. Tais Haut wurde ledrig, er bekam Muskeln und Schwielen und fiel abends, nachdem er Wasser über dem Feuer erhitzt und sich gewaschen hatte, erschöpft und mit Schmerzen ins Bett.
Von Spätherbst bis Anfang Frühling war der Boden gefroren, Tais Aufgabe unmöglich. Es konnte einem das Herz brechen, wenn man versuchte, ein Grab zu schaufeln.
Im ersten Jahr fror der See zu, und für ein paar Wochen konnte Tai über das Eis auf die Insel laufen. Der zweite Winter war milder, ließ den See nicht gefrieren. Und so ruderte Tai, wann immer die Wellen und das Wetter es erlaubten, in Pelze gehüllt, mit Kapuze und Handschuhen, hinaus in die weiße, leere Stille, betrachtete die Wolken seines Atems – Zeichen seiner Sterblichkeit – und fühlte sich winzig inmitten der gewaltigen, feindseligen Weite, die ihn umgab. Mit einem Gebet überantwortete er die Toten dem dunklen Wasser, damit sie nicht länger verloren und verdammt auf dem windgepeitschten, kalten Ufer von Kuala Nor liegen mussten, zwischen wilden Tieren und fern der Heimat.
Der Krieg war nicht ohne Unterbrechungen gewesen. Das war er nie, nirgends, und vor allem nicht in einem so abgelegenen Talkessel, der den Bestrebungen und der Kriegslust von Königen und Kaisern zum Trotz für die Versorgungslinien beider Länder so schwer zugänglich war.
Aus diesem Grund gab es mehrere Hütten, errichtet von Fischern oder Hirten, die ihre Schafe und Ziegen auf den Wiesen weiden ließen, wenn hier nicht gerade Soldaten den Tod fanden. Die meisten dieser Hütten waren zerstört, ein paar jedoch hatten überdauert, und in einer davon lebte Tai. Sie war rund hundert Jahre alt und grenzte im Norden an einen mit Kiefern bewaldeten Hang, der sie vor den schlimmsten Stürmen schützte. Bei seiner Ankunft hatte Tai sie so gut wie möglich instandgesetzt: das Dach, die Tür- und Fensterrahmen, die Läden sowie den steinernen Kamin.
Und dann hatte er Hilfe bekommen, unerwartet und ungefragt. Das Leben konnte mit Gift in einem juwelenbesetzten Kelch aufwarten oder mit überraschenden Geschenken. Manchmal ließ sich unmöglich sagen, um welches von beiden es sich handelte. Ein Bekannter von Tai hatte ein Gedicht geschrieben, das sich mit dieser Frage befasste.
Jetzt lag Tai wach, in einer Frühlingsnacht. Draußen schien der Vollmond, was bedeutete, dass morgen am späten Vormittag die Taguren erscheinen würden, ein halbes Dutzend von ihnen mit einem Ochsenkarren voller Vorräte. Sie kamen über einen Hang im Süden und folgten dem flachen Seeufer zu Tais Hütte. Seine eigenen Leute trafen jeden Morgen nach Neumond ein – aus dem Osten, durch die Schlucht, die von Eisentor herführte.
Nach Tais Auftauchen in Kuala Nor hatte es eine Weile gedauert, bis man sich auf eine Vorgehensweise geeinigt hatte, die es beiden Völkern erlaubte, Tai aufzusuchen, ohne den anderen zu begegnen. Tai wollte nicht, dass aufgrund seiner Anwesenheit Männer starben. Zwar herrschte Frieden, besiegelt mit Gaben und einer Prinzessin, doch erinnerten sich junge, streitbare Soldaten nicht immer an derlei Tatsachen, wenn sie an entlegenen Orten aufeinandertrafen – und junge Männer konnten Kriege auslösen.
Die Besatzungen beider Festungen behandelten Tai wie einen heiligen Einsiedler oder einen Narren, der freiwillig unter Geistern lebte. Sie führten einen stillen, fast schon komischen Krieg gegeneinander, in dem sie versuchten, sich gegenseitig mit ihren Geschenken und ihrer Hilfe zu übertrumpfen.
Tais eigene Leute hatten seine Hütte im ersten Sommer mit einem Fußboden ausgestattet und eigens dafür zurechtgeschnittene und abgeschliffene Bretter angekarrt. Die Taguren hatten die Reparatur des Kamins übernommen. Aus Eisentor kamen (auf Tais Bitte hin) Tinte, Schreibfedern und Papier, Wein traf zunächst aus dem Süden ein. Die Kommandanten beider Festungen hießen ihre Männer bei jedem Besuch Holz hacken. Als Bettzeug und Kleidung hatte man Tai Winterpelze und Schafsfelle gebracht. Im ersten Herbst kam eine Ziege zum Melken dazu, es folgte eine weitere von der gegnerischen Seite, außerdem eine exzentrische, aber ausgesprochen warme tagurische Mütze mit Ohrenklappen und Schnüren zum Zusammenbinden. Die Eisentor-Soldaten hatten einen kleinen Schuppen für sein kleines Pferd gebaut.
Tai hatte versucht, dem Einhalt zu gebieten, war jedoch nur auf taube Ohren gestoßen, bis er schließlich begriffen hatte: Es ging weder darum, einem Verrückten einen Gefallen zu tun, noch allein darum, der gegnerischen Seite den Rang abzulaufen. Je weniger Zeit Tai aufwenden musste, um Essen zu beschaffen, Feuerholz zu machen und seine Hütte instandzuhalten, desto länger konnte er sich seiner Aufgabe widmen. Einer Aufgabe, die vor ihm noch niemand auf sich genommen hatte und die – sobald sie den Grund für seine Anwesenheit akzeptiert hatten – den Taguren ebenso am Herzen zu liegen schien wie Tais eigenen Leuten.
Es hat etwas Ironisches, dachte er oft. Selbst jetzt würden sie einander aufwiegeln und sich die Köpfe einschlagen, wenn sie zufällig hier aufeinanderträfen. Wer glaubte, der Friede im Westen sei von Dauer, musste ein ausgesprochener Narr sein. Und doch würdigten beide Reiche, dass Tai die Toten hier zur letzten Ruhe bettete – bis es neue gab.
Es war eine milde Nacht, und Tai lauschte von seinem Bett aus dem Wind und den Geistern. Weder das eine noch das andere hatte ihn geweckt (das tat es schon lange nicht mehr), sondern das weiße Leuchten des Mondes. Der Stern der Weberin, durch den Himmelsfluss von ihrem sterblichen Geliebten getrennt, war nicht mehr zu sehen. Dabei hatte er noch vor einer Weile so hell geleuchtet, dass er trotz des Vollmondes gut durchs Fenster zu erkennen gewesen war. Tai musste an ein Gedicht denken, das er als Junge gemocht hatte. Es handelte davon, dass der Mond die Botschaften der beiden Liebenden über den Fluss brachte.
Rückblickend erschien es ihm künstlich, eine selbstgefällige Täuschung. Viele gefeierte Verse der frühen Neunten Dynastie waren so, wenn man ihre verschnörkelten Formulierungen näher betrachtete. Eigentlich war es traurig, dass das passieren konnte, dachte Tai. Dass man einfach aufhören konnte, etwas zu lieben, das einen geprägt hatte. Oder jemanden. Aber wie sollte man sich weiterentwickeln, wenn man sich nicht wenigstens ein bisschen veränderte? Und war es nicht so, dass man sich manchmal von einer vermeintlichen Wahrheit verabschieden musste, um zu lernen und sich zu entwickeln?
Es war sehr hell im Zimmer. So hell, dass Tai fast versucht war, aufzustehen und ans Fenster zu gehen, auf das lange Gras zu blicken und nachzusehen, wie das silberne Licht sich auf dem Grün ausnahm. Doch er war zu müde. Am Ende des Tages war er immer müde, und nach Einbruch der Dunkelheit verließ er nie die Hütte. Zwar fürchtete er die Geister jetzt nicht mehr – er hatte beschlossen, dass sie ihn nicht länger als Eindringling betrachteten, sondern als Abgesandten der Lebenden –, doch überließ er ihnen nach Sonnenuntergang die Welt.
Im Winter musste Tai die ausgebesserten Fensterläden schließen und sämtliche Ritzen in den Wänden so gut es ging mit Lumpen und Schafsfell stopfen, um den Wind und die Kälte abzuhalten. Die Hütte füllte sich mit dem Rauch des Feuers und der Kerzen oder – wenn Tai versuchte, Gedichte zu schreiben – einer seiner beiden Lampen. Er erhitzte Wein in einer Feuerschale (ebenfalls ein Geschenk der Taguren).
Wenn der Frühling kam, öffnete Tai die Fensterläden und ließ die Sonne herein oder das Licht der Sterne und des Mondes, und bei Morgengrauen das Vogelgezwitscher.
Als er in dieser Nacht aufgewacht war, hatte er sich zunächst desorientiert gefühlt, war verwirrt und noch in seinen letzten Traum verstrickt gewesen. Er dachte, es sei Winter und das silberne Leuchten stamme von Eis oder Reif. Doch als er wieder klar denken konnte, musste er über sich selbst lächeln. Er hatte einen Freund in Xi’an, der diesen Moment zu schätzen gewusst hätte. Man fand sich nicht oft in einer Situation wieder, die man aus einem berühmten Gedicht kannte.
Vor meinem Bett das Licht so hell,
es gleicht einer Decke aus Reif.
Den Kopf erhoben, betracht’ ich den Mond,
den Kopf gesenkt, denk ich an Zuhaus’.
Aber vielleicht irrte Tai sich auch. Vielleicht musste ein Gedicht nur genug Wahrheit enthalten, damit sich früher oder später jemand darin wiederfand, so wie er jetzt. Oder war es nicht vielmehr so, dass jemand eine Situation bereits erlebt hatte und dann auf das passende Gedicht stieß, es wartend vorfand – als eine Art Bestätigung? Fasste der Dichter nicht einfach nur in Worte, was ein anderer bereits gedacht hatte?
Manchmal vermochten Gedichte es auch, einem neue, gefährliche Ideen in den Kopf zu setzen. Manchmal wurden Männer für etwas, das sie geschrieben hatten, verbannt oder hingerichtet. Man konnte eine gefährliche Bemerkung verstecken, indem man ein Gedicht in der Ersten oder Dritten Dynastie, vor Hunderten von Jahren, ansiedelte. Manchmal kam man mit dieser Taktik durch, aber nicht immer. Die hohen Beamten waren nicht dumm.
Den Kopf gesenkt, denk ich an Zuhaus’. Tais Zuhause war das Anwesen in der Nähe des Wai-Flusses, wo im Obstgarten sein Vater begraben lag, Seite an Seite mit seinen Eltern und den drei Kindern, die das Erwachsenenalter nicht erreicht hatten. Wo Tais Mutter und Shen Gaos Konkubine – die Frau, die sie Zweite Mutter nannten – noch lebten und sich für Tais beide Brüder ebenfalls das Ende der Trauerzeit näherte, was bedeutete, dass der Ältere schon bald in die Hauptstadt zurückkehren würde.
Den Aufenthaltsort seiner Schwester kannte Tai nicht. Für Frauen betrug die Trauerzeit nur neunzig Tage. Wahrscheinlich war Li-Mei wieder bei der Kaiserin, wo auch immer diese sich aufhalten mochte. Es war gut möglich, dass die Kaiserin sich nicht bei Hofe befand. Bereits vor zwei Jahren hatte es Gerüchte gegeben, dass ihre Zeit im Ta-Ming-Palast sich dem Ende zuneigte. Eine andere leistete Kaiser Taizu jetzt Gesellschaft. Eine, die funkelte wie ein Edelstein.
Es gab viele, die das missbilligten. Doch hatte sich – soweit Tai wusste – niemand offen dazu geäußert, bevor er von zu Hause aufgebrochen und hierhergekommen war.
Seine Gedanken schweiften zurück nach Xi’an, fort von den Erinnerungen an das Familienanwesen am Wasserlauf, wo die Blauglockenbäume, die den Weg vom Haupttor säumten, jedes Jahr in einer einzigen Herbstnacht all ihre Blätter verloren. Wo im Obstgarten Pfirsiche, Pflaumen und Aprikosen wuchsen (und im Frühling rote Blumen), wo vom Waldrand der Geruch nach brennender Kohle herüberdrang und über den Kastanien- und Maulbeerbäumen der Rauch der Kamine im Dorf aufstieg.
Stattdessen dachte er jetzt an die Hauptstadt – in all ihrem Glanz, ihrer Farbenpracht und ihrem Lärm –, wo sich das ungestüme Leben im Schmutz und Trubel der Welt entfaltete, sich entlud, und selbst jetzt, mitten in der Nacht, in jedem Augenblick einen Angriff auf die Sinne darstellte. Zwei Millionen Menschen. Das Zentrum der Welt, im Schatten des Himmels.
Dort war es jetzt nicht dunkel. Nicht in Xi’an. Die Lichter der Menschen konnten das Licht des Mondes beinahe zum Verschwinden bringen. In Xi’an brannten jetzt überall Fackeln und Laternen – gleich, ob sie irgendwo befestigt waren, in Bambusvorrichtungen getragen wurden oder an den Sänften schaukelten, in denen die Hochgeborenen und Mächtigen saßen und durch die Straßen geschleppt wurden. Im Norddistrikt flackerten in den Fenstern der oberen Stockwerke rote Kerzen, und Lampen hingen von den blumengeschmückten Balkonen. Die Lichter im Palast leuchteten weiß, und auf den Säulen im Hof, die einen Menschen um das Doppelte überragten, standen Öllichter in bauchigen, niederen Gefäßen und brannten die ganze Nacht hindurch.
Es gab Musik und Herrlichkeit, Liebesglück und Liebesleid, und manchmal wurden in den Straßen und Gassen Messer und Schwerter gezückt. Und am nächsten Morgen wiederum aufs Neue Macht und Leidenschaft und Tod, dicht an dicht auf den beiden großen, lärmenden Märkten, in Weinläden und Lernsälen, auf verwinkelten Straßen (wie gemacht für heimliche Stelldicheins oder Morde) oder breiten Boulevards. In Schlafzimmern und Gerichtssälen, kunstvoll gestalteten Privatgärten und blühenden öffentlichen Parks, wo Trauerweiden sich über Flüsse und künstliche Seen neigten.
Tai musste an den Langer-See-Park südlich der Stadtmauern aus gestampftem Lehm denken und daran, mit wem er zuletzt dort gewesen war. Zur Zeit der Pfirsichblüte, vor dem Tod seines Vaters, an einem der drei Tage im Monat, an denen sie die Erlaubnis hatte, den Norddistrikt zu verlassen. Am achten, achtzehnten und achtundzwanzigsten. Sie war weit fort.
Wildgänse waren das Symbol für Trennung.
Er dachte an Ta-Ming, den Palastkomplex im Norden der Stadtmauer, an den Sohn des Himmels, der nicht mehr jung war, und all jene, die diesen dort umgaben: Eunuchen und neun Ränge von Mandarinen – darunter Tais älterer Bruder –, Prinzen und Alchemisten und Heerführer und diejenige, die mit größter Wahrscheinlichkeit heute Nacht beim Kaiser lag und im Gegensatz zu diesem jung war und von beinahe unerträglicher Schönheit, und die das Kaiserreich verändert hatte.
Tai hatte ebenfalls einer dieser Beamten mit Zugang zum Palast und zum Hof werden wollen, war »mit dem Strom« geschwommen, wie man so schön sagte. Er hatte ein Jahr lang in der Hauptstadt studiert (wenn er nicht gerade Kurtisanen traf oder Trinkkumpane) und kurz vor dem dreitägigen Examen für den kaiserlichen Dienst gestanden – der Prüfung, die über eines Mannes Zukunft entschied.
Dann war sein Vater auf ihrem Anwesen am Wasserlauf gestorben, und zweieinhalb Jahre offizielle Trauerzeit waren gekommen und gegangen wie ein Regensturm, der flussabwärts zieht.
Wer sich nicht aus der Gesellschaft zurückzog und die Rituale befolgte, die der Tod eines Elternteils erforderte, wurde ausgepeitscht – zwanzig Schläge mit der Rute.
Man konnte sagen (und manch einer würde es), dass Tai den Bräuchen nicht Genüge tat, weil er hier in den Bergen war anstatt zu Hause. Jedoch hatte er sich die Erlaubnis des Unterpräfekten eingeholt, ehe er sich auf den langen Ritt nach Westen begeben hatte. Und außerdem befand er sich hier – über die Maßen – fern der Gesellschaft, fernab aller Ambitionen und alles Weltlichen.
Natürlich ging er ein gewisses Risiko ein. Man wusste nie, was im Ministerium der Riten, das die Prüfungen beaufsichtigte, geflüstert wurde. Einen Rivalen auszuschalten – auf welche Art auch immer – war gang und gäbe, doch Tai vertraute darauf, dass er sich abgesichert hatte.
Völlige Gewissheit gab es jedoch nie. Nicht in Xi’an. Minister wurden berufen und ins Exil geschickt, Generäle und Militärgouverneure befördert und später degradiert oder zum Selbstmord gezwungen. Und vor Tais Abreise hatte es am Hof innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Veränderungen gegeben. Allerdings hatte Tai keine Position innegehabt. Somit riskierte er weder Amt noch Rang. Und die Auspeitschung würde er schon überleben, falls es so weit kommen sollte.
Als er jetzt in seiner vom Mondlicht erhellten Hütte lag, in Einsamkeit gehüllt wie eine Seidenraupe in ihren Kokon, versuchte er sich klarzuwerden, wie sehr die Hauptstadt ihm wirklich fehlte. Ob er bereit war, dorthin zurückzukehren und weiterzumachen, wo er aufgehört hatte. Oder ob es wieder einmal Zeit für eine Veränderung war.
Er wusste, was die Leute sagen würden, wenn er sich für die Veränderung entschied, was ohnehin schon über General Shens zweiten Sohn gesagt wurde. Den Erstgeborenen, Liu, kannte und verstand man, sein Streben und seine Errungenschaften waren musterhaft. Der dritte Sohn war noch jung, kaum mehr als ein Kind. Doch Tai, der Zweitgeborene, warf vor allem Fragen auf.
Mit Vollmond des siebten Monats endete seine Trauerzeit. Dann hatte er den Ritualen Genüge getan – auf seine Art. Er konnte zurückgehen, sein Studium fortsetzen und sich auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereiten. So war es üblich. Manche Studenten legten die Beamtenprüfung fünfmal, zehnmal und noch öfter ab. Manche starben, ohne je bestanden zu haben. Erfolgreich waren jedes Jahr nur vierzig bis sechzig Männer – von den Tausenden, die an den Vorprüfungen in den einzelnen Präfekturen teilgenommen hatten. Zu Beginn der letzten Prüfung war der Kaiser persönlich anwesend, in seiner weißen Robe, dem schwarzen Hut und dem gelben Gürtel, die den höchsten Zeremonien vorbehalten waren: ein aufwendiger Initiationsprozess – begleitet von Bestechung und Korruption. Wie alles in Xi’an. Wie sollte es auch anders sein?
Es war, als hätte die Hauptstadt Einzug in Tais silberne Hütte gehalten, und die Erinnerung an das Gedränge und Geschrei, das zu keiner Stunde ganz erstarb, vertrieb den Schlaf noch weiter. Schreiende Händler und Kunden auf den Märkten, Bettler und Akrobaten und Wahrsager, bezahlte Trauergäste, die mit offenem Haar einen Trauerzug begleiteten, Pferde und Fuhrwerke, die bei Tag und Nacht durch die Straßen rumpelten, muskelbepackte Sänftenträger, die Fußgänger aus dem Weg schrien oder sie mit ihren Bambusstäben vertrieben. Die Goldvogelwachen, die, ebenfalls mit Schlagstöcken bewaffnet, an jeder größeren Kreuzung standen und bei Einbruch der Dunkelheit dafür sorgten, dass die Straßen sich leerten.
In jedem Viertel kleine Läden, die die ganze Nacht hindurch geöffnet hatten. Fäkaliensammler mit ihren klagenden Warnschreien. Baumstämme, die polternd durch die Tore der äußeren Stadtmauer in den großen Teich beim Ostmarkt gewälzt und dort bei Sonnenaufgang zum Verkauf feilgeboten wurden. Morgendliche Auspeitschungen und Hinrichtungen auf beiden Marktplätzen. Anschließend, solange noch ein großes Publikum versammelt war, mehr Straßenkünstler als sonst. Glocken, die tagsüber wie nachts zur vollen Stunde schlugen, und die langen Trommelwirbel, die das Schließen der Stadttore bei Sonnenuntergang und ihr Öffnen bei Sonnenaufgang verkündeten. Frühlingsblumen in den Parks, Sommerfrüchte, Herbstblätter, überall gelber Staub, der aus der Steppe angeweht wurde. Der Staub der Welt. Jadegoldene Pracht. Xi’an.
Tai konnte sie hören und sehen und beinahe riechen, die Erinnerungen an das Chaos und die Kakophonie der Seele. Dann schob er sie von sich, fort in den Mondschein, und lauschte erneut den Geistern, den Klagelauten, an die er sich hatte gewöhnen müssen, um nicht verrückt zu werden.
Im silbernen Licht sah er seinen niedrigen Schreibtisch, die Stangentusche, das Papier und die gewebte Matte davor. Der Nachtwind trug den Geruch der Kiefern durch das offene Fenster. Zikaden zirpten, ein Duett mit den Toten.
Tai war einem Impuls folgend nach Kuala Nor gekommen, eingedenk der Vorwürfe, die sein Vater sich gemacht hatte. Er war so gut es ging für sich geblieben, hatte jeden Tag gearbeitet, um wenigstens einer kleinen Anzahl derer, die unbegraben hier lagen, Erlösung zu bringen. Die Arbeit eines Mannes. Keines Unsterblichen. Keines Heiligen.
Seitdem waren zwei Jahre vergangen, die Jahreszeiten hatten ihren Kreis zweimal geschlossen, und die Sterne ebenfalls. Tai wusste nicht, wie es ihm ergehen würde, sollte er in den Lärm und Tumult der Hauptstadt zurückkehren. Wenn er ehrlich zu sich war.
Aber er wusste, welche Menschen ihm fehlten. Eine Frau tauchte jetzt vor seinem geistigen Auge auf. Beinahe konnte er ihre Stimme hören, so lebhaft war die Erinnerung an das letzte Mal, als er bei ihr gelegen hatte. An Schlaf war nicht zu denken.
»Und wenn mich jemand von hier fortholt, während du weg bist? Wenn mich jemand fragt … mir das Angebot macht, seine persönliche Kurtisane zu werden oder gar eine Konkubine?«
Natürlich hatte Tai genau gewusst, wer dieser Jemand war.
Er hatte ihre Hand mit den langen, golden lackierten Fingernägeln und den edelsteinbesetzten Ringen genommen und auf seine nackte Brust gelegt, damit sie seinen Herzschlag spüren konnte.
Sie hatte gelacht, ein wenig bitter. »Nein! Nicht schon wieder, Tai. Das machst du immer. Dein Herz schlägt immer gleich. Es verrät mir gar nichts.«
Im Norddistrikt, wo sie sich befanden – in einem Zimmer im Obergeschoss des Freudenhauses Mondschein-Pavillon –, wurde sie Frühlingsregen genannt. Ihren richtigen Namen kannte Tai nicht. Man fragte nicht danach. Das gehörte sich nicht.
Langsam, denn das hier war schwierig, sagte er: »Zwei Jahre sind eine lange Zeit, Regen. Das weiß ich. Im Leben eines Mannes oder einer Frau kann viel passieren. Es ist …«
An dieser Stelle hatte sie ihm den Mund zugehalten, nicht gerade sanft. Sie war nicht immer sanft zu ihm. »Und noch einmal nein. Hör mir zu. Wenn du mir jetzt wieder etwas vom Pfad erzählst oder davon, dass alles im Leben ein Gleichgewicht hat, dann macht deine Männlichkeit Bekanntschaft mit meinem Obstmesser. Das solltest du wissen, ehe du weitersprichst.«
Er erinnerte sich an ihre zärtliche Stimme, die verheerende Anmut, mit der sie so etwas sagen konnte. Tai hatte die Handfläche geküsst, die sie auf seinen Mund presste, und dann, als Frühlingsregen ein Stück wegrutschte, sanft gesagt: »Du musst tun, was das Beste für dich ist. Für dein Leben. Ich möchte nicht, dass du eine dieser Frauen wirst, die nachts am Fenster über einer Jadetreppe stehen und warten. Diese Gedichte soll jemand anders leben. Ich habe die Absicht, zum Anwesen meiner Familie zu reisen, die mir vorgeschriebenen Rituale für meinen Vater zu befolgen und zurückzukehren. Das kann ich dir versichern.«
Das war keine Lüge gewesen. Er hatte es wirklich vorgehabt.
Doch es war anders gekommen. Es war vermessen, zu glauben, dass immer alles so eintraf, wie man es geplant hatte. Nicht einmal der Kaiser, der mit dem Mandat des Himmels regierte, konnte sich darauf verlassen.
Tai wusste nicht, was aus Frühlingsregen geworden war, ob sie tatsächlich jemand aus dem Kurtisanenviertel geholt, für sich beansprucht und hinter steinernen Mauern in einem Aristokratenanwesen in der Stadt untergebracht hatte, wo sie höchstwahrscheinlich ein besseres Leben führte als zuvor. Er bekam keine Briefe von westlich des Eisentor-Passes, weil er keine geschrieben hatte.
Schließlich gelangte er zu dem Schluss, dass er sich nicht für eines der beiden Extreme entscheiden musste: weder für Xi’an noch für die absolute Einsamkeit jenseits aller Grenzen. Schließlich besagte die Lehre des Pfads, dass es im Leben um Ausgewogenheit ging. Zwischen den beiden Hälften der Seele eines Menschen, seines Innenlebens. In der Dichtung glich man zwei Zeilen aus, in der Malerei einzelne Elemente eines Gemäldes – Fluss, Felswand, Reiher, Fischerboot –, in der Kalligraphie dünne und dicke Pinselstriche, in einem Garten Steine, Bäume und Wasser, im eigenen Alltag wechselnde Muster.
Wenn Tai diesen Ort hier verließ, konnte er statt in die Hauptstadt auch in sein Zuhause am Wasserlauf zurückkehren. Dort leben und schreiben, eine Frau heiraten, die seine Mutter und seine Zweite Mutter für ihn aussuchten, den Garten bestellen – Frühlingsblumen, Sommerfrüchte –, Besucher empfangen und selbst Besuche abstatten, in Frieden – aber nicht in Einsamkeit – alt und weißbärtig werden. Den Blättern der Maulbeerbäume beim Fallen zusehen. Den Goldfischen im Teich. An seinen Vater denken, der genauso dagesessen hatte. Vielleicht würde man ihn eines Tages sogar für einen Weisen halten. Bei dem Gedanken musste Tai lächeln. Im Mondschein.
Er konnte reisen. Auf dem Wai nach Osten, oder sogar auf dem Großen Fluss durch die Schluchten bis ans Meer und wieder zurück: erleben, wie die Schiffer gegen die Strömung stakten oder die Boote mithilfe dicker Taue über rutschige, in die Felswände gehauene Pfade westwärts zogen, wenn sie auf der Rückreise wieder zu den wilden Schluchten gelangten.
Er könnte auch weiter nach Süden gehen, wo sich das Kaiserreich anders und sonderbar ausnahm: in Länder, in denen Reis in Wasser angebaut wurde und es Elefanten und Gibbons gab, Mandrills, Palisanderwälder und Kampferbäume, wo das Meer Perlen bereithielt für jene, die danach tauchten, und wo Tiger mit gelben Augen im dunklen Dschungel Menschen töteten.
Tai stammte aus einer angesehenen Familie. Der Name seines Vaters öffnete ihm eine Tür, hinter der Präfekten und Steuerbeamte, ja sogar Militärgouverneure aus ganz Kitai ihn mit offenen Armen empfangen würden. Recht betrachtet war der Name seines ältesten Bruders inzwischen wohl von noch größerem Nutzen, doch das war nicht ganz unproblematisch.
All diese Möglichkeiten lagen Tai zu Füßen. Er konnte reisen und denken, Tempel und Pavillons besuchen, Pagoden auf nebelverhangenen Hügeln und Bergschreine. Seine Eindrücke niederschreiben. Er konnte tun, was der Dichtermeister, dessen Zeilen ihm beim Aufwachen in den Sinn gekommen waren, getan hatte und vermutlich immer noch irgendwo tat. Obschon Tai, wenn er ehrlich zu sich war, zugeben musste (und dieser Gedanke entbehrte nicht einer gewissen Ironie), dass Sima Zian während seiner Jahre auf Booten und Straßen, in den Bergen, in Tempeln und Bambushainen dem Alkohol wohl genauso gehuldigt hatte wie allem anderen.
Diese Möglichkeit gab es natürlich ebenfalls: guter Wein, nächtliche Zusammenkünfte. Musik. Auch das war nicht von der Hand zu weisen oder zu verachten.
Mit diesem Gedanken schlief Tai ein und mit der plötzlichen, sehnlichen Hoffnung, dass die Taguren daran dachten, Wein mitzubringen. Die Vorräte, die seine eigenen Leute ihm vor zwei Wochen geliefert hatten, waren so gut wie aufgebraucht. In den langen Sommernächten hatte man mehr Zeit zu trinken, ehe man mit der Sonne zu Bett ging.
Tai schlief und träumte von der Frau, die ihm in jener letzten Nacht die Hand auf die Brust und dann auf den Mund gelegt hatte. Von ihren zurechtgezupften und geschminkten Augenbrauen, ihren grünen Augen, dem roten Mund, Kerzenschein, Jadenadeln, die eine nach der anderen aus goldenem Haar gezupft wurden, und dem Duft, den sie verströmte.
Die Vögel am anderen Seeufer weckten ihn.
Vor ein paar Nächten hatte er sich an einem sechszeiligen Regelgedicht versucht, in dem er ihr morgendliches Kreischen mit der Öffnungsstunde der beiden Märkte in Xi’an verglich, war jedoch an der Parallelkonstruktion im letzten Vers gescheitert. Was seine technischen Fähigkeiten als Dichter anbelangte, war er wahrscheinlich besser als der Durchschnitt; zumindest reichten sie aus, um die Lyrikprüfung zu bestehen, allerdings nicht – so dachte Tai –, um ein Gedicht zu verfassen, das die Zeit überdauern würde.
Das war eines der Dinge, die er nach zwei Jahren in der Einsamkeit zu wissen glaubte, meistens jedenfalls.
Er kleidete sich an und entfachte ein Feuer. Während er Teewasser kochte, wusch er sich und band sich das Haar zurück. Er blickte in den Bronzespiegel, den er geschenkt bekommen hatte, und überlegte, ob er das Messer an Wangen und Kinn ansetzen sollte, befand eine derartige Selbstverstümmelung heute Morgen jedoch für unnötig. Den Taguren konnte er auch unrasiert gegenübertreten. Eigentlich bestand nicht einmal ein Grund, sich die Haare zusammenzubinden. Doch wenn er sie offen trug, kam er sich wie ein Barbar von der Steppe vor. Er hatte Erinnerungen daran, an sie.
Vor dem Frühstück, während der Tee zog, stand er am Fenster, das nach Osten ging, blickte in die Richtung der aufgehenden Sonne und sprach das Gebet für den Geist seines Vaters.
Dabei beschwor er jedes Mal das Bild herauf, wie Shen Gao die Wildenten im Wasserlauf seines Anwesens mit Brot fütterte. Tai wusste nicht, warum ausgerechnet diese Erinnerung. Vielleicht, weil sie so friedlich war – was man vom Leben seines Vaters ansonsten nicht behaupten konnte.
Nach dem Beten trank er seinen Tee, aß Pökelfleisch und mit heißem Wasser übergossene und mit Kleehonig gesüßte Getreideflocken, ehe er seinen Strohhut von dem Nagel neben der Tür nahm und sich die Stiefel anzog. Seine Sommerstiefel waren so gut wie neu, ein Geschenk aus Eisentor, das sein altes, abgetragenes Paar ersetzt hatte.
Der Zustand seiner Schuhe war ihnen nicht entgangen. Tai hatte bemerkt, dass sie ihn bei jedem Besuch gründlich in Augenschein nahmen. Außerdem war ihm im ersten harten Winter klargeworden, dass er ohne die Unterstützung der beiden Festungen wahrscheinlich hier draußen gestorben wäre. In manchen Bergen konnte man zu manchen Jahreszeiten völlig auf sich allein gestellt leben – den legendären Traum vom Einsiedlerdichter in die Tat umsetzen –, doch nicht im Winter in Kuala Nor. Nicht so weit oben und fernab von allem. Nicht, wenn der Schnee kam und der Nordwind blies.
Die Vorräte, die zuverlässig bei jedem Neu- und Vollmond eintrafen, hatten sein Überleben gesichert – und waren mehrmals unter größten Mühen zu ihm gebracht worden, wenn wilde Stürme über die gefrorene Wiese und den vereisten See peitschten.
Tai molk die beiden Ziegen und brachte den Eimer nach drinnen, wo er ihn abdeckte und für später stehen ließ. Dann nahm er die beiden Schwerter mit hinaus, um seine Kanlin-Übungen zu machen.
Als er damit fertig war und die Waffen weggeräumt hatte, verließ er erneut die Hütte, verharrte einen Augenblick im fast schon sommerlichen Sonnenschein und lauschte dem lauten Kreischen der Vögel. Sah ihnen zu, wie sie schreiend ihre Kreise über dem See zogen, der im Morgenlicht blau und wunderschön dalag und nicht die geringste Spur vom Eis des Winters oder den unzähligen Toten an seinen Ufern erkennen ließ.
Bis man den Blick vom Wasser und den Vögeln löste und dem hohen Gras zuwandte. Dann sah man die Knochen, überall. Tai konnte die Grabhügel ausmachen, wo er die Toten verscharrte, westlich der Hütte, nach Norden von den Kiefern begrenzt. Drei lange Reihen mit tiefen Gräbern.
Er drehte sich um und nahm die Schaufel, um sich an die Arbeit zu machen. Denn darum war er hier.
Ein Funkeln im Süden erregte seine Aufmerksamkeit: In der letzten Biegung am untersten Hang traf das Sonnenlicht auf Rüstung. Mit zusammengekniffenen Augen stellte Tai fest, dass die Taguren heute früh dran waren, oder vielmehr – Tai prüfte den Stand der Sonne –, dass er, nach mondweißer, durchwachter Nacht, heute spät dran war.
Er sah zu, wie sie, begleitet von dem schweren Ochsenkarren, den Hügel herabstiegen, und überlegte, ob der heutige Versorgungstrupp wohl von Bytsan angeführt wurde. Genauer gesagt hoffte er das.
War es falsch, sich auf das Eintreffen eines Mannes zu freuen, dessen Soldaten bei einem Angriff auf Kitai seine Schwester und seine beiden Mütter vergewaltigen und mit Freuden das Anwesen seiner Familie niederbrennen würden?
Kriege und Konflikte veränderten einen Menschen, manchmal so sehr, dass er nicht wiederzuerkennen war. Tai hatte das an sich selbst gesehen, auf den Steppen jenseits der Langen Mauer, unter den Nomaden. Menschen veränderten sich und taten mitunter Dinge, die man lieber aus seinem Gedächtnis streichen wollte, obschon manch mutige Tat es wert war, nicht in Vergessenheit zu geraten.
Tai glaubte zwar nicht, dass Bytsan sich in einen Wilden verwandeln würde, doch konnte er es unmöglich wissen. Und was einige der anderen Taguren anging, die seit zwei Jahren zu ihm kamen – bewaffnet und gepanzert, als zögen sie in die Schlacht und nicht los, um einem einsamen Narren Lebensmittel zu bringen –, so würde er für sie nicht die Hand ins Feuer legen.
Das Aufeinandertreffen mit den Kriegern aus dem Königreich auf dem Plateau verlief nie einfach oder reibungslos.
Als die Männer die Wiese erreicht hatten und sich daranmachten, den See zu umrunden, sah Tai, dass Bytsan sich tatsächlich unter ihnen befand. Der Hauptmann ließ seinen kastanienbraunen Sardianer vornweg traben. Das Tier war von atemberaubender Schönheit – wie alle Pferde aus dem Fernen Westen. Der Hauptmann war der Einzige aus seiner Kompanie, der eines der edlen Tiere ritt. Himmlische Pferde. So wurden sie in Tais Heimat genannt. Legenden zufolge schwitzten sie Blut.
Die Taguren hatten sie ihrem Handel mit Sardia – wo die geteilten Seidenstraßen sich wieder vereinten, im Westen hinter den Wüsten – zu verdanken. Dort, mehrere unwirtliche Bergpässe entfernt, lag die grüne, üppige Gegend, in der die Pferde gezüchtet wurden. Tais Volk verlangte so sehr nach diesen Tieren, dass es bereits seit Jahrhunderten die Politik, Kriegsführung und Dichtung des Kaiserreichs beeinflusste.
Pferde waren wichtig. Überaus wichtig. Deswegen war der Kaiser, der durchlauchte Gebieter über die fünf Richtungen und fünf heiligen Berge, in stetem Kontakt mit den Bogü-Nomaden und ließ auserwählten Anführern dieser Kumiss trinkenden und in Jurten hausenden Steppenbewohner seine Unterstützung zuteilwerden. Im Austausch dafür versorgten sie ihn mit Pferden, wenngleich ihre Tiere denen aus Sardia bei weitem nicht das Wasser reichen konnten. Weder die lössigen Böden im Norden von Kitai noch die Dschungel und Reisanbaugebiete im Süden waren geeignet, um wirklich gute Pferde zu züchten.
Darin bestand die Tragödie des Landes. Bereits seit tausend Jahren.
Viele Dinge gelangten über die bewachten Seidenstraßen dieser Neunten Dynastie nach Xi’an und machten die Stadt über die Maßen reich, doch sardianische Pferde zählten nicht dazu. Sie überstanden den weiten Weg durch die Wüste nicht. Frauen gelangten nach Osten, Musikerinnen und Tänzerinnen. Jade, Alabaster und Juwelen. Bernstein, Duftstoffe, gemahlenes Rhinozeroshorn für die Alchemisten. Sprechende Vögel, Gewürze und Lebensmittel, Schwerter, Elfenbein und noch vieles mehr. Nur keine Himmlischen Pferde.
Aus diesem Grund musste Kitai andere Wege finden, um an die bestmöglichen Pferde zu kommen. Denn mit der richtigen Kavallerie ließen sich Kriege gewinnen, wenn die Umstände ansonsten gleich waren. Wenn die Taguren jedoch zu viele dieser Pferde besaßen (wie jetzt, da Frieden mit den Sardianern herrschte und sie Handel mit ihnen trieben), waren die Umstände ansonsten nicht gleich.
Als Bytsan sein Pferd vor ihm zügelte, ballte Tai die rechte Hand zur Faust, umschloss sie mit der linken und verbeugte sich zweimal. Er hatte Freunde – und einen älteren Bruder –, die es als demütigend empfunden hätten, dass er einen Taguren derart förmlich begrüßte. Andererseits hatten sie nicht zwei Jahre lang unter dem Schutz dieses Mannes gestanden und ihm ihr Leben und die pünktlich zu jedem Vollmond eintreffenden Vorräte zu verdanken.
Im Sonnenlicht waren Bytsans blaue Tätowierungen deutlich zu sehen: auf beiden Wangen und auf der linken Halsseite über dem Kragen seines Waffenrocks. Er stieg ab und verneigte sich – ebenfalls zweimal, die Hand um die Faust gelegt, nach Sitte der Kitaner.
Dabei schenkte er Tai ein knappes Lächeln. »Bevor Ihr fragt: Ja, ich habe Wein mitgebracht.«
Wie die meisten Taguren war er des Kitanischen mächtig. Wenn die Menschen sich nicht gerade gegenseitig die Köpfe einschlugen, war es die allerorten gängige Handelssprache. In Kitai glaubte man, dass die Götter in den neun Himmeln Kitanisch sprachen und es dem ersten Vater der Kaiser beigebracht hatten, als dieser vor lang vergangener Zeit mit gesenktem Kopf auf dem Drachenberg gestanden hatte.
»Ihr wusstet, dass ich fragen würde?« Tai fühlte sich ein wenig bloßgestellt.
»Die langen Tage. Was soll ein Mann sonst tun? Der Kelch ist ein Gefährte, sagt man bei uns. Geht es gut?«
»Ja. Aber das Mondlicht hat mich wachgehalten, deshalb bin ich heute Morgen spät dran.«
Bytsans Frage war nicht rhetorisch gemeint; die Taguren kannten Tais Tagesablauf.
»Nur der Mond?«
Seine eigenen Leute stellten ihm ähnliche Fragen, wann immer sie ihn besuchten. Aus Neugier – und Angst. Überaus mutige Männer wie dieser hatten ihm gestanden, dass sie nicht tun könnten, was er tat. Nicht angesichts der unbegrabenen, wütenden Toten.
Tai nickte. »Der Mond. Und die eine oder andere Erinnerung.«
Hinter dem Hauptmann kam jetzt ein junger Soldat in voller Rüstung herangeritten, den Tai noch nie gesehen hatte. Der Mann stieg nicht ab, sondern starrte vom Rücken seines Pferdes auf ihn hinunter. Er hatte nur eine Tätowierung, trug einen überflüssigen Helm und lächelte nicht.
»Gnam, hol dir neben der Hütte eine Axt und hilf Adar, Feuerholz machen.«
»Warum?«
Tai kniff die Augen zusammen. Dann sah er Bytsan an.
Der Gesichtsausdruck des tagurischen Hauptmanns blieb unverändert, er drehte sich auch nicht zu dem Soldaten um. »Weil wir deswegen hier sind. Und weil ich dir, wenn du es nicht tust, das Pferd und die Waffen wegnehme, dich die Stiefel ausziehen und den ganzen Weg über alle Pässe und inmitten der Bergkatzen allein zurücklaufen lasse.«
Er sagte das ganz ruhig. Dann herrschte Schweigen. Fast schon bestürzt stellte Tai fest, dass er derlei Wortwechsel nicht mehr gewohnt war, und fühlte eine plötzliche Anspannung in sich aufsteigen. So ist die Welt, sagte er sich. Das musst du wieder lernen. Fang gleich damit an. Das ist es, was dich bei deiner Rückkehr erwartet.
Beiläufig, um weder den Hauptmann noch den jungen Soldaten in eine unangenehme Situation zu bringen, wandte er sich zum See um und blickte zu den Vögeln am anderen Ufer. Graureiher, Seeschwalben, hoch oben ein Goldadler.
Der junge Mann – er war groß und gutgebaut – saß immer noch auf seinem Pferd. Er sagte: »Kann der da kein Holz hacken?«
»Ich glaube schon. Schließlich schaufelt er seit zwei Jahren Gräber für unsere Toten.«
»Unsere Toten oder nur die seinen? Während er die Knochen der unseren schändet?«
Bytsan lachte.
Jetzt fuhr Tai herum, er konnte nicht anders. Er merkte, wie ihn ein Gefühl überkam, das er lange nicht mehr gehabt hatte. Dennoch erkannte er es sofort: Zorn. Er war schon immer aufbrausend gewesen. Solange er denken konnte. Das Los des Zweitgeborenen? Manch einer würde das vielleicht sagen.
Um einen ruhigen Tonfall bemüht erwiderte er: »Ich wäre Euch ausgesprochen dankbar, wenn Ihr mir sagen könntet, welche dieser Knochen von Euren Leuten stammen. Für den Fall, dass ich den Wunsch verspüre, sie zu schänden.«
Wieder Schweigen, doch dieses war anderer Natur. Es gibt viele verschiedene Arten der Stille, dachte Tai.
»Du bist ein unglaublicher Dummkopf, Gnam. Hol dir eine Axt und geh Holz hacken. Und zwar sofort.«
Diesmal blickte Bytsan seinen Soldaten an, und diesmal schwang dieser sich aus dem Sattel – ohne Eile zwar, doch auch ohne den Gehorsam zu verweigern.
Inzwischen war auch der Ochsenwagen eingetroffen. Und vier weitere Männer. Drei davon kannte Tai, und sie nickten einander zur Begrüßung zu.
Der namens Adar trug einen gegürteten, dunkelroten Waffenrock über einer weiten braunen Hose und keine Rüstung. Gemeinsam mit Gnam ging er zur Hütte, die Pferde führten sie hinter sich her. Die anderen, die bereits wussten, was sie zu tun hatten, stellten den Ochsenwagen ab und luden die Vorräte aus. Sie arbeiteten schnell, wie immer. Sie kamen, luden ab, räumten ein, wandten sich anderen Aufgaben – wie dem Ausmisten des kleinen Stalls – zu und traten den Rückweg an, hangaufwärts, fort von hier.
Die Angst, nach Einbruch der Dunkelheit noch an diesem Ort zu sein.
»Passt mit seinem Wein auf!«, rief Bytsan den Männern zu. »Nicht, dass der Kitaner in Tränen ausbricht. Die Töne, die sie von sich geben, wenn sie weinen, tun in den Ohren weh.«
Tai lächelte schief, die Soldaten lachten.
Die Bergluft trug das dumpfe Geräusch der Äxte heran. Bytsan bedeutete Tai, ihm zu folgen. Sie gingen durch das hohe Gras, stiegen über Knochen hinweg oder schlugen einen Bogen darum. Tai wich einem Schädel aus. Mittlerweile tat er das ganz instinktiv.
Überall wimmelte es von Schmetterlingen in allen Farben. Zu den Füßen der Männer stoben Heuschrecken auf, sprangen hoch und in alle Richtungen davon. Zwischen den Wiesenblumen summten Bienen. Hier und da war das rostige Metall eines Schwertes zu erkennen, sogar im grauen Ufersand. Man musste aufpassen, wohin man trat. Am Rand des Sees lagen rosafarbene Steine. Die Vögel lärmten, zogen ihre Kreise und stießen hinab, durchbrachen die Wasseroberfläche, um nach Fischen zu schnappen.
»Ist das Wasser noch kalt?«, fragte Bytsan nach einer Weile.
Sie standen am Ufer. Die Luft war ganz klar, und sie konnten die steilen Berghänge, die Kraniche auf der Insel und die zerfallene Festung sehen.
»Das ist es immer.«
»Auf dem Pass gab es vor fünf Tagen einen Sturm. Hier unten auch?«
Tai schüttelte den Kopf. »Etwas Regen. Das Unwetter muss wohl nach Osten gezogen sein.«
Bytsan beugte sich hinunter, nahm eine Handvoll Steine und warf sie nach den Vögeln.
»Die Sonne ist stark«, sagte er schließlich. »Ich kann verstehen, dass Ihr dieses Ding auf dem Kopf tragt, auch wenn Ihr damit ausseht wie ein alter Zausel und Landmann.«
»Gleich beides auf einmal?«
Der Tagure grinste. »Gleich beides auf einmal.« Er warf noch einen Stein. Dann sagte er. »Ihr reist ab?«
»Bald. Unsere Trauerzeit endet mit dem Mittsommermond.«
Bytsan nickte. »Das habe ich ihnen geschrieben.«
»Ihnen?«
»Dem Hof. In Rygyal.«
Tai starrte ihn an. »Sie wissen von mir?«
Bytsan nickte erneut. »Ich habe ihnen Bericht erstattet. Natürlich wissen sie von Euch.«
Tai dachte nach. »Ich glaube nicht, dass die Festung Eisentor Botschaft in die Hauptstadt schickt, dass jemand die Toten von Kuala Nor begräbt. Aber ich kann mich auch irren.«
Der andere Mann zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich tut Ihr das. Heutzutage wird alles nachverfolgt und abgewogen. In Friedenszeiten kommen berechnende Gemüter auf ihre Kosten, an jedem Hof. In Rygyal wurde es von manchen als kitanische Anmaßung empfunden, dass Ihr hierhergekommen seid. Sie wollten Euch tot sehen.«
Auch das hatte Tai nicht gewusst. »Wie der Kerl da hinten?«
Immer noch war das gleichmäßige Hacken der beiden Äxte zu hören, als dünner, klarer Ton in der Ferne. »Gnam? Er ist jung. Will sich einen Namen machen.«
»Indem er schnell eben einen Feind tötet?«
»Es geht darum, es hinter sich zu haben. So wie das erste Mal mit einer Frau.«
Sie lächelten sich kurz an. Beide Männer waren noch relativ jung. Doch keiner von ihnen fühlte sich so.
Dann sagte Bytsan: »Meine Anweisung lautet, dass Ihr nicht getötet werden sollt.«
Tai schnaubte. »Das freut mich.«
Bytsan räusperte sich. Plötzlich schien ihm etwas unangenehm zu sein. »Stattdessen sollt Ihr ein Geschenk erhalten, ein Zeichen der Anerkennung.«
Tai starrte ihn erneut an. »Ein Geschenk? Vom tagurischen Hof?«
»Nein, vom Hasen im Mond.« Bytsan zog eine Grimasse. »Natürlich vom Hof. Genauer gesagt von einer Person dort, mit Erlaubnis.«
»Erlaubnis?«
Jetzt grinste der Tagure. Er war braungebrannt, hatte ein kantiges Gesicht, und in der unteren Reihe fehlte ihm ein Zahn. »Heute seid Ihr wirklich langsam.«
»Das kommt einfach unerwartet. Wer ist diese Person?«
»Findet es selbst heraus. Ich habe einen Brief für Euch.«
Bytsan griff in die Tasche seines Waffenrocks und zog eine blassgelbe Schriftrolle hervor. Tai erkannte das königliche Siegel von Tagur: einen roten Löwenkopf. Er brach es und öffnete den Brief, las den knappen Inhalt und erfuhr so, was sie ihm zum Dank dafür, dass er Zeit bei den Toten verbracht hatte, schenkten und in welch missliche Lage sie ihn damit brachten.
Plötzlich fiel ihm das Atmen schwer.
Gedanken brachen über ihn herein, wirbelten unkontrolliert und unzusammenhängend durcheinander wie ein Sandsturm. Dieses Geschenk könnte sein Leben bestimmen – oder seinen Tod bedeuten, noch bevor er das Anwesen seiner Familie – geschweige denn Xi’an – wiedersah.
Er schluckte. Blickte zu den Bergen, die sie umgaben, höher und höher über ihnen aufragten und den blauen See majestätisch umringten. In der Lehre des Pfades standen Berge für Barmherzigkeit und Wasser für Weisheit. Die Gipfel blieben immer gleich, überlegte Tai.
Was die Menschen unter ihrem Blick taten, konnte sich unbegreiflich schnell ändern.
Er sprach aus, was er dachte: »Ich begreife nicht ganz.«
Als Bytsan schwieg, blickte Tai auf den Brief in seiner Hand und las die Unterschrift noch einmal.
Eine Person dort, mit Erlaubnis.
Eine Person. Die Weiße Jadeprinzessin Cheng-wan: die siebzehnte Tochter des verehrten und erhabenen Kaisers Taizu. Vor zwanzig Jahren war sie nach Westen in die Fremde geschickt worden, fort aus ihrer prachtvollen, glänzenden Welt. Mit ihrer Pipa und ihrer Flöte, einer Handvoll Diener und Leibwächter sowie einer tagurischen Ehrengarde. Fortgeschickt, um als erste Frau kaiserlichen Geblüts einem Taguren gewährt zu werden und als eine der Frauen von Sangrama dem Löwen in dessen hoher, heiliger Stadt Rygyal zu leben.
Sie war Teil des Abkommens, das nach dem letzten Feldzug hier in Kuala Nor geschlossen worden war. Ihre Jugend (sie war damals vierzehn Jahre alt) ein Sinnbild dafür, wie grausam – und fruchtlos – die Kämpfe gewesen waren und wie wichtig es war, dass sie endeten. Ein zartes, anmutiges Symbol für den dauerhaften Frieden zwischen zwei Reichen. Als wäre er von Dauer, als wäre er das je gewesen, als könnten der Körper und das Leben eines Mädchens derlei gewährleisten.
In jenem Herbst waren Gedichte wie Blütenblätter auf Kitai herabgeschneit und hatten in Parallelversen und Reimen Mitleid mit der Prinzessin bekundet: an einen fernen Horizont verheiratet, aus dem Himmel gestürzt, der zivilisierten Welt (der Parallelverse und Reime) abhanden gekommen, hinter schneebedeckten Bergketten, unter Barbaren, auf ihrem unwirtlichen Plateau.
Es war eine Mode der damaligen Literatur gewesen, ein einfaches Thema. Bis ein Dichter festgenommen und auf dem Platz vor dem Palast ausgepeitscht worden war – und beinahe an seinen Verletzungen gestorben wäre –, weil einer seiner Verse nahegelegt hatte, dass die Prinzessin nicht nur beklagenswert, sondern ihr ein Unrecht widerfahren war.
Derlei sagte man nicht.
Mitleid war eine Sache – höfliches, kultiviertes Bedauern für ein junges Mädchen, dessen Leben sich gänzlich wandelte, als sie die Pracht der Welt verließ –, doch das Tun des Ta-Ming-Palasts stellte man nicht in Frage, niemals. Denn das hieße zu bezweifeln, dass das Mandat des Himmels richtig und allumfassend erfüllt wurde. Prinzessinnen dienten in der Welt als Währung. Wozu wären sie sonst gut, was wäre sonst ihre Daseinsberechtigung?
Tai starrte immer noch auf das blassgelbe Blatt, bemühte sich, seine durcheinanderwirbelnden Gedanken einigermaßen zu ordnen. Bytsan schwieg, ließ ihm Zeit, die Information zu verdauen, oder es zumindest zu versuchen.
Man gab einem Mann einen Sardianer, wenn man ihn reich belohnen wollte. Man gab ihm vier oder fünf dieser prachtvollen Tiere, wenn man ihn über seine Kameraden erheben und auf einen höheren Rang befördern wollte – wodurch man ihm den (mitunter tödlichen) Neid all derer einbrachte, die auf den kleineren Steppenpferden ritten.
Die Prinzessin Cheng-wan, seit nunmehr zwanzig Friedensjahren königliche Gemahlin am Hof von Tagur, hatte Tai soeben mit Erlaubnis zweihundertfünfzig Drachenpferde zuteilwerden lassen.
Das war die Zahl. Tai las sie ein weiteres Mal.
So stand es auf der Schriftrolle, die er in der Hand hielt, niedergeschrieben auf Kitanisch, in der dünnen, aber sorgfältigen Schrift eines tagurischen Gelehrten. Zweihundertfünfzig Himmlische Pferde. Als Geschenk an ihn und keinen anderen. Nicht an den Ta-Ming-Palast, nicht an den Kaiser. Nein. An Shen Tai, den zweitgeborenen Sohn von General Shen Gao, dem ehemaligen linken Kommandanten des befriedeten Westens.