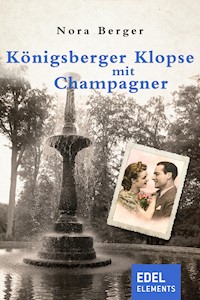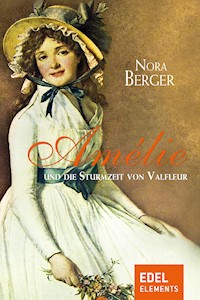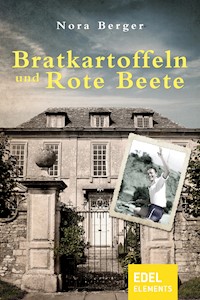7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Gesamtausgabe der beliebten Amélie Reihe. Amélie und die Sturmzeit von Valfleur Frankreich, im Sommer 1787: Amélie d' Emprenvil ist eine schöne, lebenshungrige junge Frau. Doch die Revolution bricht in die Idylle ihres Landschlosses Valfleur ein und raubt Amélie alle Menschen, die sie liebt – ihre Eltern und ihren Ehemann. In größter Gefahr rettet sie Fabre d'Eglantine. An seiner Seite kämpft sie fortan mutig um ihr Glück. Amélie und die Botschaft des Medaillons Frankreich 1793: Ist der Gatte Amélies, der Graf de Montalembert, wirklich im Gefängnis ums Leben gekommen? Oder gehört er zu den Verschwörern, die eine Entführung der Königin Marie Antoinette aus dem Kerker der Concièrgerie planen? Die geheime Botschaft eines Medaillons führt Amélie auf eine ungewöhnliche Spur, die bis in die Verliese von Paris reicht...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1596
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Das ist die Gesamtausgabe der beliebten "Amélie"-Reihe!
Amélie und die Sturmzeit von Valfleur:
Frankreich, im Sommer 1787: Amélie d' Emprenvil ist eine schöne, lebenshungrige junge Frau. Doch die Revolution bricht in die Idylle ihres Landschlosses Valfleur ein und raubt Amélie alle Menschen, die sie liebt – ihre Eltern und ihren Ehemann. In größter Gefahr rettet sie Fabre d'Eglantine. An seiner Seite kämpft sie fortan mutig um ihr Glück.
Amélie und die Botschaft des Medaillons:
Frankreich 1793: Ist der Gatte Amélies, der Graf de Montalembert, wirklich im Gefängnis ums Leben gekommen? Oder gehört er zu den Verschwörern, die eine Entführung der Königin Marie Antoinette aus dem Kerker der Concièrgerie planen? Die geheime Botschaft eines Medaillons führt Amélie auf eine ungewöhnliche Spur, die bis in die Verliese von Paris reicht...
Nora Berger
Amélie Gesamtausgabe
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2020 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2020 by Nora BergerDieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, MünchenKonvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-364-9
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Inhalt
Amélie und die Sturmzeit von Valfleur
Titelseite
Impressum
I Mädchenjahre
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
II Schicksalsjahre
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
III Zeit der Prüfungen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Amélie und die Botschaft des Medaillons
Titelseite
Impressum
Personenliste
1 Das Medaillon
2 Ein unerwarteter Gast
3 In der Conciergerie
4 Gefährliche Liebschaft
5 Rettet die Königin!
6 Das Mädchen Sheba
7 Verschwörung gegen die Republik
8 Ein rätselhafter Brief
9 Der Friedhof von Montmartre
10 Verhängnisvolle Leidenschaft
11 Heldenhafte Briganten
12 Ein fast unfehlbarer Plan
13 Der geheimnisvolle Unbekannte
14 Rendezvous mit einem Bettler
15 Entscheidung über Leben und Tod
16 Zerreißprobe
17 Es lebe die Monarchie!
18 Verrat aus Liebe
19 Ein seltsamer Abbé
20 Flucht
21 Saxa loquuntur – Die Steine sprechen
22 Die »Blumenkönigin« in der Rue du Four
23 In den Verliesen von Paris
24 Ein feiger Mord
25 Die Drohung der Guillotine
26 Triumph der Tugend?
27 Das Schicksal wendet sich
Nora Berger
Amélie und die Sturmzeit von Valfleur
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2005 by Nora Berger
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-160-6
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
I
Mädchenjahre
1
Valfleur – Sommer 1787
»Amélie... Amélie!« Die hohe, in der heißen Mittagsglut gedämpft klingende Stimme durchtönte weich die Luft, in der jedes Geräusch verstummt war. Sogar die Vögel hatten vor Hitze ermattet unter den Bäumen die Flügel sinken lassen. Mit raschen Schritten und suchendem Blick eilte eine schmale Gestalt über den Kiesweg, der sich zwischen Büschen und Bäumen durchschlängelte. Das blasse Gesicht der jungen Frau, umrahmt von dichtem, braunem, zu einem Knoten geschlungenen Haar, wandte sich besorgt nach rechts und nach links; ihr Blick versuchte, durch die Brombeersträucher zu dringen, und ging aufmerksam über die blühenden Rosenstöcke und duftenden Jasminsträucher hinweg. In dem dichten Gewirr verfing sich ihr Rock immer wieder an einem der Sträucher; dann befreite sie sich mit kleinen, ärgerlichen Ausrufen vorsichtig von den Hindernissen. Der Park, der das Schloss von Valfleur umgab, war zwar wohl gepflegt, aber in seiner augenscheinlichen Wildnis entsprach er ganz und gar nicht der Mode seiner Zeit, die einer geordneten Sanftheit und symmetrischen Übersichtlichkeit den Vorzug gab.
Erleichtert trat die junge Frau endlich aus den Sträuchern heraus auf die schattige Allee, die an dieser Stelle einen kleinen Teich einfasste. Aus dessen Mitte ergoss sich das Wasser über terrassenförmige Steinschalen kaskadenförmig hinab.
Vom Brunnen aus konnte man am Ende der fächerförmigen, leicht ansteigenden Wege das helle Schlossgebäude erkennen. Die breiten Türme stammten aus dem 14. Jahrhundert und bildeten mit den Anbauten aus anderen Epochen ein reizvolles Ensemble. Errichtet auf der höchsten Erhebung des Anwesens, bot sich dem Auge ein zauberhafter Blick über das malerische Tal. Die pappelgesäumte Allee führte zu den Feldern und in das kleine Dorf, dessen steiler Backsteinkirchturm sich über die wenigen Häuser reckte.
»Amélie... so antworte doch!«, rief die Gouvernante erneut und ließ sich erschöpft von Hitze und Anstrengung auf einem Stein nieder. Dann tauchte sie ihr Taschentuch in das kühle Nass und presste es an die Stirn. Es war wirklich keine einfache Aufgabe, die Kinder des Barons d’Emprenvil zu beaufsichtigen. »Amélie...« Der letzte Ton erstarb in einem Seufzer. Mademoiselle Dernier wusste sehr wohl, dass das widerspenstige Mädchen sich irgendwo hinter einem Strauch versteckt hielt, um sie ein wenig zu necken. Für einige Augenblicke ließ sie versonnen das Handgelenk von dem kühlen, rinnenden Wasser umspielen, ehe sie sich langsam erhob, um zum Schloss zurückzugehen. Es war sinnlos, weiter nach Amélie zu suchen, wahrscheinlich beobachtete sie das kleine Biest und amüsierte sich auf ihre Kosten. Nun gut, man würde sich ohne sie zum Essen setzen – mochte Madame d’Emprenvil das Unmögliche fertigbringen und ihre Tochter zum Gehorsam erziehen.
In der Lauheit des friedlich scheinenden Sommertags war nichts zu spüren von der Missernte, dem Hunger des vergangenen Jahres, der die Bauern revoltieren ließ. Das Land war seit Ludwig XV. hoffnungslos verschuldet, und das veraltete Finanzsystem bot keinerlei Aussicht auf Besserung. Als der Finanzminister Necker bei einer öffentlichen Bilanz offengelegt hatte, dass der Hofstaat des amtierenden Königs Ludwig XVI. jährlich 62 Millionen Livres verschlang, hatten die geknechteten, von Abgaben erdrückten Bürger zum ersten Mal öffentlich protestiert. Seitdem gärte es im Lande, die Preise stiegen, aber die Löhne reichten nicht mehr zum Leben. Die Bauern, denen auch noch das Letzte genommen wurde, schielten auf die Besitztümer der Adeligen, die auf ihre alten Rechte pochten.
Doch an diesem Tag trübte in Valfleur kein Misston die scheinbar friedliche Stille des viel zu trockenen Sommers. Im Schloss, dem Sommersitz des Barons Charles d’Emprenvil, Rat im Parlament von Paris, und seiner Familie ging das Leben seinen Gang wie eh und je.
Amélie beobachtete, wie Mademoiselle Dernier im Schloss verschwand. Dann dehnte und streckte sie sich und klappte das Buch zu, in das sie sich den ganzen Vormittag über vertieft hatte. Es war eines jener erotischen Werke der Zeit, die man im hintersten Winkel der Bibliothek verschämt vor unliebsamen Lesern verbarg. Doch das junge Mädchen, eine Leseratte, brannte darauf, das Leben in all seinen Facetten kennenzulernen, und fühlte sich gerade von dieser Art Lektüre magisch angezogen. Um ganz ungestört zu sein, hatte sie sich an ihrem Lieblingsplatz, einer von blühenden Sträuchern nahezu überwachsenen Lichtung verkrochen. Immer wieder legte sie das Buch beiseite und beobachtete versonnen das Leben der Insekten; eine Ameise, die geschäftig umherkrabbelte, einen Käfer, der sich emsig mit dem Bau einer Höhle abmühte, und die Bienen, die an den süß duftenden Blüten sogen. Ach, wie herrlich war es, im Sommer diese Freiheit zu genießen, statt bei trüben Lehrstunden in der Stube zu sitzen. Das Knurren ihres Magens erinnerte sie an das Mittagessen, das sie gerade dabei war zu versäumen. Sie erhob sich, schüttelte ihr langes, kastanienbraunes Haar, in dem helle Reflexe spielten, zurück und strich das weiße Baumwollkleid glatt. Das Buch verbarg sie unter ihrem Rockbund, dann bog sie die Zweige auseinander, die hinter ihr zusammenschlugen, und trat auf den Kiesweg, der zum Schloss führte.
Amélie gelang es, ungesehen ins Haus zu schlüpfen und das verbotene Buch unauffällig an seinen Platz in der Bibliothek zu stellen. Mit gespielter Gelassenheit, den schnellen Atem mit einer unschuldigen Miene überspielend, trat sie ins Esszimmer, in dem die Familie sich zum Mittagessen versammelt hatte. Man nahm kaum Notiz von ihr, nur Mademoiselle Dernier, die Gouvernante, sah sie überrascht an, während sie dem kleinen Christoph in seinem Babystühlchen einen Löffel Suppe einflößte.
»Wo hast du denn gesteckt, Amélie? Ich habe dich überall gesucht. Du warst wie vom Erdboden verschluckt.«
Das Mädchen lächelte ihr komplizenhaft zu und wandte sich an ihre Mutter. »Entschuldige Mama, ich habe über dem Lesen die Zeit ganz vergessen...«
Laura d’Emprenvil warf ihr einen zerstreuten, missbilligenden Blick zu. »Wie siehst du nur wieder aus! Wie eine zerzauste Straßenkatze. Wo, um Himmels willen, treibst du dich eigentlich immer herum, statt dass du deine Klavierübungen machst oder dich mit anderen nützlichen Dingen beschäftigst...«
»Ja, Mama«, murmelte Amélie.
Während ihre Gedanken in andere Richtungen gingen, floss die leise Stimme ihrer Mutter an ihrem Ohr vorüber: »... nicht einmal kannst du pünktlich zu den Mahlzeiten erscheinen, wo du weißt, dass gerade heute...«
»Ja, Mama«, wiederholte Amélie und begann, hastig die Suppe zu löffeln.
Laura schüttelte den Kopf und tupfte sich mit der Serviette die Lippen ab. Selbst an diesem heißen Sommertag strahlte sie die perfekte, kühle Schönheit einer Porzellanpuppe aus. Ihr elfenbeinfarbener Teint und die dunklen, unergründlichen Augen unter zart geschwungenen Brauen bildeten einen reizvollen Kontrast zu der roten Haarfülle, die im Nacken zu einem Chignon geschlungen war. Ihr Dekolleté umgab ein Kranz von weißen Seidenrosen, und das weiße Chiffonkleid schmeichelte ihrer zierlichen Figur, der man die vier Kinder nicht ansah.
»Patrick, bitte!«, rügte sie ihren ältesten Sohn, der unter dem Tisch seiner vierzehnjährigen Schwester Isabelle einen Fußtritt verpasste, weil sie ihm den Rest des Kirschsafts weggetrunken hatte. Isabelle schrie leise auf, rieb sich den Knöchel und setzte dann ihre Märtyrerinnenmiene auf. Sie war ein überschlankes Mädchen mit anämischem Teint, blassgrauen Augen und aschblonden Haaren, die ihr bis über den Rücken reichten.
Christoph schrie aus Leibeskräften und spuckte den Pudding aus, weil er lieber nach dem glitzernden Kristall eines Glases greifen wollte. Die Gouvernante, seit einigen Jahren in der Familie d’Emprenvil, nahm ihn aus seinem Stühlchen und versuchte, ihn zu beruhigen. Sie stammte mütterlicherseits aus einer verarmten Landadelfamilie. Zunächst hatte sie die Rolle einer Erzieherin als unabwendbaren Zwang empfunden, doch mit der Zeit gewann sie ihre Aufgabe lieb, sodass sie nunmehr ganz darin aufging. Mademoiselle Dernier war von schlichtem, wenngleich nicht unschönem Äußeren. Sie verzichtete auf jede Art Schnörkel und Schmuck und entsprach mit ihrem blassen Teint, den großen, dunklen Augen und der ausgeprägten Nase eher dem klassizistischen Schönheitsideal.
»Amélie«, begann Laura erneut mit vorwurfsvollem Blick, »du bist alt genug, um zu wissen, was sich gehört, aber du führst dich auf, als seiest du...« Ihr spitzer Aufschrei galt Christoph, der es fertiggebracht hatte, die Saucière umzustoßen, deren Inhalt sich dunkel über die weiße Tischdecke ergoss. Entzückt tunkte er den Zeigefinger hinein und begann, ein hübsches Muster darauf zu malen. Mademoiselle Dernier, deren Kleid ebenfalls ruiniert war, hielt seine kleine Hand fest, und Christoph, seines schönen Spiels beraubt, schrie aus Leibeskräften.
Amélie, die froh war, der gewohnten Strafpredigt entronnen zu sein, widmete sich mit gutem Appetit ihrem Huhn in Zitronensauce. Aus der Küche roch sie schon das Schokoladensoufflé, ihre Lieblingsspeise, die sie keinesfalls versäumen wollte. »Ist Papa nicht da?«, fragte sie mit vollem Mund, als auch schon die Tür aufgerissen wurde und im hereinflutenden Sonnenlicht der Hausherr, Baron d’Emprenvil, eintrat.
Im offenen weißen Hemd, in Reitstiefeln und mit vom Wind zerzausten Haaren, die er ohne Perücke im Nacken zusammengebunden trug, durchquerte er mit wenigen Schritten den Raum. Augenblicklich nahm er der Gouvernante den schreienden Christoph aus den Armen, schwenkte ihn stürmisch in der Luft und drückte ihm schmatzende Küsse auf die roten Bäckchen. »Habt ihr mir noch etwas übrig gelassen?«, fragte er, noch ganz außer Atem, und umarmte seine Frau flüchtig. »Beinahe hätte ich es nicht mehr geschafft!«
Lauras Blick war eine einzige Anklage, doch sie hielt sich zurück. »Du bist spät zum Essen, mein Lieber, ich wollte gerade abräumen lassen.«
»Ich weiß«, seufzte d’Emprenvil mit gespielter Zerknirschung und warf ihr einen zärtlichen Blick zu, »aber es war mir unmöglich, eher zu kommen; ich hoffe, du entschuldigst mich.« Er kitzelte den Kleinen, bis der vor Vergnügen quietschte, setzte ihn dann wieder auf den Schoß der Gouvernante und erkundigte sich mit kumpelhaftem Augenzwinkern bei ihr: »Na, was hat der kleine Quälgeist denn heute wieder angestellt? Ich hoffe, er hat Sie nicht allzu sehr tyrannisiert!« Seine letzten Worte waren schon halb über die Schulter gesprochen; der Braten und die Wahl des Weines erforderten seine ganze Aufmerksamkeit.
Das scheue Lächeln, das Mademoiselle ihm sandte, ging ins Leere. Hastig senkte sie die Augen und beschäftigte sich mit dem Kleinen, in der Hoffnung, dass die Glut, die ihr heiß ins Gesicht gestiegen war und auf ihren Wangen brannte, unauffällig verblassen würde. Doch die Verwirrung, die sie immer verspürte, sobald der Hausherr ihr seine Aufmerksamkeit schenkte, ging in den Fragen und dem Lachen der Kinder unter, die ihren allzu oft abwesenden Vater voll Begeisterung begrüßten. Und wie immer, wenn er wie ein frischer Windstoß hereingeweht wurde, war er bester Laune und wusste allerlei zu erzählen, während er lachend und plaudernd den Speisen und dem Wein zusprach.
»... und stellt euch vor, als ich Jean, dem neuen Gärtnergehilfen, die Sense wegnahm, um ihm zu zeigen, wie man im Rhythmus von oben nach unten mäht, kam doch mit einem Mal dieser aufgeblasene de Platier mit seinem Wagen vorbeigefahren, ein Spitzentuch vor dem Mund wegen der Landluft, mit wackelndem Hut und gekleidet wie zum Hofball. Sein Gesicht verzog sich nicht schlecht, als ich ihm meinen Gruß zurief, so...« Er machte eine drollige Grimasse, worüber die ganze Familie in Lachen ausbrach. Jeder wusste, dass Graf Eugen de Platier, der sich auf seinem Gut Pélissier nicht den kleinen Finger schmutzig machte, es nicht verstand, dass Charles d’Emprenvil, Magistrat des Parlaments von Paris, hin und wieder eine Sense in die Hand nahm und wie ein Knecht seine Wiese mähte.
Die Miene des achtzehnjährigen Patrick blieb angesichts des Lachens der anderen ernst, er betrachtete mit blasiertem Ausdruck die angeschmutzte Hose, das zerknitterte Hemd und die ausladenden Gesten, mit denen der Vater seine Erzählung untermalte. Seine Mundwinkel zogen sich verächtlich nach unten, und er fühlte sich so unendlich verschieden von ihm, von seiner nachlässigen Kleidung, seinen Manieren und seiner derben Sprache. Wie recht doch de Platier hatte, mit dessen Sohn Auguste er befreundet war, wenn er sich vom Pöbel distanzierte!
»Papa«, Amélie schluckte schnell den letzten Löffel ihres Soufflés hinunter, »reiten wir heute Nachmittag gemeinsam aus?«
»Heute nicht, meine Süße«, sagte d’Emprenvil bedauernd und fuhr sich durch die dichten schwarzen Locken. »In Paris verlangt man nach mir. Im Parlament kann man doch nicht ohne mich tagen.« Er lachte, und seine blauen, eindringlichen Augen zwinkerten ihr schelmisch zu.
Amélie, die ihren Schmollmund aufgesetzt hatte, murrte: »Du hast es mir aber schon so lange versprochen!«
»Reite doch mit Patrick, er kann dich begleiten, nicht wahr, mein Junge?«
»Da wüsste ich aber etwas Besseres«, antwortete Patrick mit einem arroganten Seitenblick auf seine Schwester und fügte dann hastig hinzu: »Ich würde lieber mit dir nach Paris fahren. Ich ersticke hier auf dem Land. Alles ist so gewöhnlich – so langweilig und ordinär! Nimm mich doch mit, nur dies eine Mal! Ich werde dir auch ganz sicher nicht lästig fallen!«
Der Baron blickte seinen Sohn erstaunt an. »Aber Patrick, sei vernünftig, du weißt doch, dass es jetzt nicht geht. Ich fahre schließlich nicht zum Vergnügen nach Paris.«
»Ich auch nicht!« Die Stimme Patricks, die schon einen tiefen, männlichen Klang hatte, drohte in der Erregung zu kippen. »Ich will einfach wissen, was in Paris vor sich geht! Wir verschlafen hier unser Leben und tun, als ob nichts sei, während in Wirklichkeit große Veränderungen bevorstehen und alles drunter und drüber geht. Du meinst wohl, ich sei zu jung und zu dumm... aber nur weil ich Rousseau und Voltaire lese, bin ich keineswegs wirklichkeitsfremd, ich kann ihre Schwächen wohl erkennen...«
»Mein Lieber«, unterbrach der Baron ihn in ernstem Ton.
Wenn man sie beide so dasitzen sah, bemerkte man die auffallenden Ähnlichkeiten zwischen Vater und Sohn: das gleiche, fast griechische Profil, der schön geschnittene Mund mit einem ungeduldigen Zug darum und sogar die in die Stirn fallende, widerspenstige Locke, die Patrick in seiner Eitelkeit mit Pasten und Salben in Form zu halten versuchte.
»Ich verstehe dich natürlich. Ein anderes Mal bin ich gerne bereit... aber jetzt ist es zu unsicher, und außerdem werde ich für dich gar keine Zeit haben. Ich brauche Voltaire nicht, um zu wissen, dass unser Staat vor dem Bankrott steht. Und das Schlimme ist, dass der König glaubt, die Adeligen seien in der Lage, alle seine Schulden zu finanzieren. Doch was rede ich... das führt alles zu weit. Ich bin wirklich in Eile, und es muss dir vorerst genügen, dass du einfach nicht mitkommen kannst. Ich werde dir bei meiner Rückkehr alles erklären, aber heute... heute ist es unmöglich.« Er hielt inne, als hätte er bereits zu viel gesagt, doch nach einem Blick in Patricks finstere und unzufriedene Miene fuhr er fort: »Sieh mich nicht so vorwurfsvoll an, Junge! Nur so viel, es geht darum, dass das Parlament gezwungen werden soll, Steueredikte zu genehmigen, die uns alle in den Ruin führen. Das muss ich mit allen Kräften zu verhindern suchen! Ich werde dich ein anderes Mal mitnehmen. Aber mach nicht solch ein Gesicht!« Seine Stimme war laut geworden, ärgerlich, und er schlug mit der Hand auf den Tisch.
Patrick beugte sich vor, seine Augen glommen wütend, und sein Gesicht wurde bleich. »Ein anderes Mal... das muss dir genügen – die Zeiten sind unsicher... ich habe keine Zeit«, äffte er den Vater nach, »das sagst du immer. Aber wieso störe ich dich ständig? Du denkst, nur du allein kannst etwas bewirken, seiest sogar fähig, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen! Glaubst du, ich bin noch ein kleines Kind, das man mit Ausreden abspeist? Warum kann ich dich nicht begleiten, wie Auguste, wenn sein Vater in die Hauptstadt fährt? Meinst du, ich bin zu dumm, die Probleme zu erkennen, die in unserem Lande gären?« Patrick beugte sich vor und stieß mit dem Ellbogen sein Glas Wein um. »Aber vielleicht hast du etwas zu verbergen«, sagte er herausfordernd. »Glaubst du, ich merke nicht, was du in Paris vorhast? Dass du gegen den König opponierst, ist kein Geheimnis für mich! Du sträubst dich doch gegen wichtige Reformen und hetzt andere auf. Du denkst doch nur an deine eigenen Vorteile...«
»Jetzt reicht es aber!«, schrie d’Emprenvil, der mit zornig gerötetem Gesicht aufgesprungen war. »Schweig! Ich verbiete dir, von Sachen zu sprechen, von denen du nicht das Geringste verstehst.« Er tat ein paar Schritte auf seinen Sohn zu, und es sah so aus, als wollte er ihn am Kragen packen. Patrick erhob sich langsam, und Vater und Sohn standen sich Auge in Auge gegenüber wie zwei Feinde, wütend der eine, bleich und voll aufgestauter Gefühle der andere.
Am Tisch war eine lähmende Stille eingetreten, und Laura sah erstaunt auf ihren Sohn, das einstmals so friedfertige Kind. Verwundert fragte sie sich, wie dieser junge Mann, der ihr mit einem Mal wie ein fremdes Wesen aus einer anderen Welt vorkam, sich so verändern konnte, wann er so widerspenstig und laut geworden war.
Der Baron holte tief Luft und fasste sich als Erster, sich zur Ruhe zwingend: »Schluss jetzt, mein Sohn! Diesen Ton kann ich nicht dulden! Eines Tages wirst du meinen Platz im Parlament einnehmen. Aber bis dahin musst du noch viel reifer und erwachsener werden. Jetzt treffe ich noch die Entscheidungen – aber, wenn du willst, werden wir in einer ruhigen Stunde über alles reden, und dann erkläre ich dir meinen Standpunkt. Ich wusste ja nicht, dass du... dass du dich plötzlich für Politik interessierst. Du warst immer so gleichgültig... aber du hast recht, du bist wirklich kein Kind mehr! Ein anderes Mal...«
Patrick unterbrach ihn heftig: »Ein anderes Mal! Ja, das habe ich jetzt schon zu oft gehört. Wann reden wir einmal über mich, über meine Zukunft? Immer weichst du mir aus. Und ein anderes Mal geht es wieder nicht, weil Mama einen Gesellschaftsabend gibt oder du andere wichtige Dinge zu erledigen hast, bei denen ich doch nur störe. Lass mich jetzt mitfahren oder erkläre mir auf der Stelle, warum es nicht geht!«
Der Baron schwankte, gerade an diesem Tag konnte er Patrick nicht gebrauchen, er würde seine Pläne gründlich durchkreuzen. Sollte er sich dieser lächerlichen Auseinandersetzung entziehen, indem er mit Entschlossenheit den Raum verließ, oder war es besser, ihm zu erklären, warum er ihn unmöglich mitnehmen konnte? Er atmete noch einmal tief durch und rückte seinen Stuhl näher an den seines Sohnes, ehe er sich wieder setzte. »Deine Zukunft ist gesichert, das weißt du! Das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber hüte dich, noch einmal zu sagen, dass ich irgendjemanden aufhetze! Es ist wahr, dass ich es als Parlamentsmitglied einfach nicht zulassen kann, dass die Steuer- und Finanzgesetze durch Leute bestimmt werden, die darin nur ihren eigenen Vorteil sehen. Das Gleiche gilt für die Handlungsfreiheit der Polizei. Es ist nun einmal so, dass der König sich nicht genügend mit diesen Problemen beschäftigt. Er ist ein guter Mann, aber schwach, schlecht beraten, was weiß ich... Jedenfalls steht er unter dem Einfluss seiner verschwenderischen Frau und zu vieler Höflinge. Eine Besteuerung, die nur die Amtsträger zahlen sollen, wird uns viele Nachteile bringen. Und sie wird das Loch der Staatskasse auch nicht stopfen – aber uns in den Ruin treiben. Ich nehme das Risiko auf mich, eine falsche Entscheidung zu boykottieren, begreifst du das?«
»Du wirst daran auch nichts ändern können«, widersprach Patrick trotzig, »es wird dich nur deinen Kopf kosten, wenn du nicht aufpasst!«
Der Baron sah in das vor Leidenschaft glühende Antlitz seines Sohnes und tupfte sich die Schweißperlen von der Stirn.
Es war sinnlos, Patrick wollte ihn nicht verstehen; er suchte, ganz wie er in seiner Jugend, Auseinandersetzung und Widerspruch; aber gerade dazu war er nicht in der richtigen Stimmung.
Laura, die bisher geschwiegen hatte, meldete sich zu Wort: »Patrick, du gehst wirklich zu weit und zerstörst unsere friedliche Stimmung bei Tisch.«
Der junge Mann sprang auf. »Ja, ich zerstöre die Stimmung, indem ich meine Meinung äußere. Aber einmal werdet ihr sie anhören müssen!« Er stieß den Stuhl zurück, lief hinaus und knallte die Tür hinter sich zu.
»Dieser Hitzkopf«, murmelte d’Emprenvil, froh, dass Patrick nicht weiter darauf bestanden hatte, mitzukommen, »er hätte mir gerade noch gefehlt!«
Isabelle und Amélie, die an ähnliche Szenen gewöhnt waren, hatten die Auseinandersetzung mit Gleichmut beobachtet. Jetzt tuschelten und kicherten sie und versuchten, Christoph den Löffel zu entwenden, mit dem er, in der allgemeinen Aufregung unbeachtet, Linien mit den Resten der Mahlzeit auf dem Tischtuch zog. Mademoiselle Dernier saß betreten und mit gesenkten Augen auf ihrem Platz, und es war ihr wie immer peinlich, Zeuge einer solchen Diskussion geworden zu sein.
»Mon Dieu, Charles«, begann Laura verärgert, »du weißt, wie ich diese Streitereien bei Tisch hasse. Hättest du ihn denn nicht mitnehmen können? Er ist in einem schwierigen Alter, und du solltest dich wirklich mehr um ihn kümmern.«
»Ist das vielleicht meine Schuld? Ich denke nicht daran!«, brauste der Baron auf »Ich habe im Augenblick einfach nicht die Geduld für pubertäre Auseinandersetzungen angesichts der Belastungen, denen ich im Parlament ausgesetzt bin. Er hat doch keine Ahnung, was im Lande wirklich vorgeht!« Er blickte entnervt zur Decke. »Soll ich ihm denn meine Pläne und Ideen darlegen und ihn fragen, ob er sie billigt?« Er sprang auf und ging unruhig hin und her. »Er ist einfach noch zu sehr Kind, als dass ich ihn mit diesen Dingen belasten möchte. Außerdem kann ich ihn nicht ins Vertrauen ziehen, was meine Pläne anbelangt, dafür ist die politische Situation einfach zu heikel.«
»Was hast du denn vor?«, fragte Laura misstrauisch, denn sie kannte das unbesonnene Temperament ihres Mannes. »Was sind denn deine Pläne? Ich bitte dich, Charles, nichts Unvorsichtiges zu tun!«
»Ahhh«, sagte der Baron gereizt, »so ist das hier im Hause, man wird verhört, man findet nie die Ruhe, die man nötig brauchte...« Das Weitere ging in undeutlichem Gemurmel unter, denn er schlug, wie sein Sohn kurz zuvor, unsanft die Tür hinter sich zu.
Laura seufzte, zuckte die Schultern und schenkte sich ein weiteres Glas der eisgekühlten Zitronenlimonade ein. Er war nicht zu ändern. So war es immer, sie kannte ihren Mann aufs Beste, seine Schwächen, die Art, allen Schwierigkeiten kurzerhand aus dem Wege zu gehen. Wenn es für ihn ungemütlich wurde, dann verschwand er einfach, machte sich unsichtbar oder reiste ab, weil er irgendwelche wichtigen Dinge erledigen musste. »Ich glaube, es ist Zeit für Christophs Mittagsschlaf«, wandte sie sich an Mademoiselle Dernier, die den Kleinen mit Schokoladensoufflé fütterte. »Isabelle, du solltest noch ein wenig an deinen mathematischen Aufgaben arbeiten. Es ist wirklich eine dumme Ausrede, wenn du behauptest, nichts zu verstehen. Du hast nur keine Lust.«
Isabelle ließ einen Klagelaut vernehmen. »Und Amélie? Sie braucht wohl nichts zu tun?« Widerstrebend ließ sie sich von der Gouvernante, die den quengeligen Christoph auf dem Arm trug, aus dem Zimmer ziehen.
Laura erhob sich ebenfalls, unschlüssig, wie sie den Nachmittag verbringen sollte. Der Gedanke an Patrick ließ ihr keine Ruhe, und sie beschloss, noch einmal mit ihm zu reden. Als sie sein Zimmer betrat, stand Patrick am Fenster und starrte blicklos in den blühenden Garten. Er wandte sich nicht einmal um, und sein bleiches, schmales Gesicht mit den feinen Zügen und verächtlich nach unten gezogenen Mundwinkeln wirkte hochmütig. Laura blieb eine Weile reglos stehen und betrachtete ihren Sohn, so als ob ihr erst in diesem Augenblick bewusst wurde, wie sehr er in vielen Dingen auch ihr selbst glich. Wie sie war er stets mit äußerster Sorgfalt gekleidet, die Spitzen an den Manschetten tadellos weiß und duftig, sein dunkles Haar straff nach hinten gebürstet und mit einem Samtband zusammengefasst, das farblich mit seinem Rock harmonierte. Er war ein auffallend hübscher Junge, dessen Profil den Statuen jener griechischen Jünglinge glich, die man in ewiger Jugend in Museen bewunderte. Sanft legte sie ihm die Hand auf die Schulter, doch Patrick machte sich unwillig los und warf ihr einen zornigen Blick zu.
»Lass mich bitte allein, Mama«, sagte er, »ihr behandelt mich immer noch wie ein Kind – aber ich bin keins mehr. Und ihr könnt oder wollt nicht verstehen, was mich bewegt.«
»Aber was ist es denn, mein Liebling?«, fragte Laura, die nicht begreifen konnte, was in ihrem Sohn vorging. »Du hast doch alles, was du brauchst, jeder Wunsch wird dir erfüllt, sofern es in meiner Macht steht...«
»Ja, jeder Wunsch... und doch nicht jeder! Valfleur erstickt mich! Diese spießige Idylle, die Ländlichkeit und immer dieselben Leute, derselbe Tagesablauf... ich halte es nicht mehr länger aus. Und wenn ich einmal nach Paris möchte, wenn ich Vater begleiten, mit ihm reden will, dann hat er keine Zeit für mich. Ich bin im Wege, ich störe ihn.«
»Nein, so ist es nicht, nur... du kennst ihn doch...« Sie stockte, wusste nicht, was sie sagen sollte. Erst während der Szene bei Tisch hatte sie erkannt, dass Patrick tatsächlich nicht mehr zu jung für solche Unternehmungen war, wie ihr Gatte es behauptete. »Es kommt alles so plötzlich, mein Lieber, du bist so ungestüm. Solche Dinge müssen sorgfältig geplant werden. Dein Vater und ich, wir werden es uns überlegen und das nächste Mal... schließlich wirst du eines Tages sowieso das Amt deines Vaters übernehmen...«
»Eines Tages! Ich hasse dieses Wort!«, brach es aus Patrick hervor. »Ich will an den Hof, meinetwegen auch in die Armee! All das hier langweilt mich!« Er ging mit aufgeregten Schritten im Zimmer auf und ab und untermalte seine Erklärungen mit großen Gebärden. »Soll ich mich bis dahin mit einem ungewaschenen Pferdeknecht unterhalten, der mir mit verschmiertem Mund und Strohhalmen in den strubbeligen Haaren einen guten Morgen wünscht? Oder mit Monsieur Moreau, dessen Lateinkenntnisse zugegebenermaßen nicht schlecht sind, der aber mit seinen fettigen Haaren und dem speckigen Rock einen solch üblen Geruch verbreitet, dass ich mich unmöglich auf die Konjugation der Verben konzentrieren kann?«
»Patrick!«, rief Laura empört aus, »du gehst zu weit! Niemand verlangt, dass du mit dem Stallknecht oder Hauslehrer Konversation machst. Du hast doch Freunde... Auguste de Platier zum Beispiel.«
»Ja, ja, Auguste, das ist auch der Einzige. Auguste geht es übrigens genauso wie mir.« Eine Pause entstand, in der beide schwiegen. Patrick war wieder ans Fenster getreten und sah hinaus, um sich zu beruhigen. Noch nie war er so aufgeregt gewesen, und im Grunde war ihm sein eigenes Verhalten zuwider.
Laura fasste sich als Erste; sie sah den Widerspenstigen kühl an. »Ich versuche durchaus, dich zu verstehen und mich in deine Lage zu versetzen, aber andererseits solltest auch du dir über gewisse Dinge klar werden, darüber, dass dein Platz hier ist. Das Gut braucht dich, und es wäre so schön, wenn du dich – im Gegensatz zu deinem Vater – um die Verwaltung kümmern würdest. Was könntest du aus Valfleur nicht alles machen! Stattdessen liegt es in der Hand eines Verwalters, der schalten und walten kann, wie er will.«
Patrick antwortete nicht. Im Stillen knirschte er mit den Zähnen: Diese Antwort hatte er erwartet. Doch das, was seine Mutter von ihm erwartete, seit er ein Kind war, war genau das, was er keinesfalls tun wollte. Er starrte in den Park und auf die von Blumenrabatten umsäumte Wiese, ohne die Schönheit der in voller Blüte stehenden Rosen, Lilien und Nelken zu sehen.
Laura, in Erwartung einer Antwort, stand noch eine Weile reglos im Zimmer, bis sie es kopfschüttelnd verließ. Woher kamen diese eigensinnigen Allüren bei Patrick so plötzlich, dachte sie, aber sicherlich war es nur eine vorübergehende Laune, und schon morgen würde er ihr wieder um den Hals fallen und sie um Entschuldigung bitten. Als Kind ertrug er es nie, wenn sie seinetwegen schmollte.
Nachdem Amélie die Reste des Schokoladensoufflés aus der großen Schüssel gekratzt hatte, setzte sie sich zufrieden wie ein sattes Kätzchen auf die Fensterbank des Erkers, einen ihrer Lieblingsplätze. Sie genoss das herrliche Gefühl, den Nachmittag frei und ungezwungen vor sich zu haben. Eine wohlige Müdigkeit und Trägheit überkam sie, und sie blickte versunken auf das Grün der weiß getupften blühenden Büsche, die den Rasen bis hinunter zu dem plätschernden Brunnen säumten. Eine Fliege summte träge gegen das geschlossene Fenster, statt ihren Weg durch die weit geöffneten Flügeltüren in den Garten zu nehmen. Das Klirren des Geschirrs und die leisen Worte des Personals beim Abräumen der Tafel weckten das junge Mädchen aus ihren Träumereien. Höchste Zeit, sich unsichtbar zu machen! Mama würde sicherlich gleich erscheinen, um ihr ein Programm für den Nachmittag vorzulegen. Sie schlich über den kühlen Marmorgang und betrat leise die im Dämmerlicht liegende Bibliothek. Liebevoll ließ sie ihre Blicke über die zahlreichen Schriften und Folianten schweifen, in Leder gebundene Werke, kleine, in bescheidenen Pappkarton gehüllte Bücher, die sie genauso aufmerksam betrachtete wie die goldgeprägten Buchrücken, die nicht verrieten, wer schon alles in ihnen geblättert hatte. Aus einer sorgsam zwischen anderen Büchern versteckten Buchattrappe zog sie ein schön gebundenes und üppig illustriertes Büchlein heraus und verbarg es mit erhitzten Wangen unter ihrer Bluse.
Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, huschte sie hinaus und rannte über den Kiesweg bis zu einem kleinen Graspfad, der verborgen hinter einem Baum abzweigte. Sie folgte ihm bis zu einer winzigen Lichtung, die halbwegs von einem in voller Blüte stehenden Jasminstrauch beschattet war. Atemlos warf sie sich in das weiche Gras – über sich den blauen, fast wolkenlosen Himmel und um sich das Zwitschern der Vögel und das leise Summen und Zirpen der Insekten. Sie nahm das Büchlein aus ihrer Bluse und betrachtete es lächelnd. Durch Zufall war es ihr beim Stöbern in der Bibliothek in die Hand gefallen. Beim ersten Blättern darin fühlte sie sich zuerst schockiert, doch dann ungemein angezogen von den eigenartigen Illustrationen, die Frauen und Männer in verschiedenen pikanten und unzweideutigen Situationen und Stellungen zeigten. Noch unerhörter waren die Geschichten des Autors, eines gewissen Michel Pierrombeau, die mit schamloser Offenheit das Thema Liebe beleuchteten, so ausführlich, dass Amélie das Buch nach den ersten Worten erschreckt wieder an seinen Platz gelegt hatte. Doch der Gedanke daran hatte sie nicht losgelassen, eine brennende Neugier, mehr von diesen seltsamen Geheimnissen zu erfahren, peinigte sie, und so hatte sie sich vorgenommen, doch noch einmal einen Blick in diese verbotene Welt zu werfen.
Mit klopfendem Herzen schlug sie jetzt unwillkürlich eine Seite auf und machte sich mit einem nervösen Kribbeln im Magen an die Lektüre des freizügigen Werkes, das sicher nicht für ihre Augen bestimmt war. Der Text fesselte sie so, dass sie vor den glühender werdenden Sonnenstrahlen nur noch ein wenig tiefer unter den Strauch kroch, wobei sie ihre Jacke als Polster benutzte, und selbst auf das Sirren der Mücken, die sie umkreisten, nicht achtete. Erst ein tiefes Donnergrollen aus der Ferne schreckte sie hoch. Der Himmel hatte sich bewölkt und hinter der Allee eine bleigraue Färbung angenommen. Amélie reckte die eingeschlafenen Glieder und klopfte sich, wie aus einem Traum erwacht, Gräser und herabgefallene Blüten von ihrer Bluse. Das Buch verstaute sie wieder unter ihrem Rockbund. Ein Blitz, der den Himmel zerriss, und der knapp darauf folgende Donnerschlag ließen sie zusammenzucken. In rascher Folge verdunkelten dicht sich zusammenballende Wolken die Luft, in der die Natur plötzlich den Atem anhielt und in der nicht mehr das geringste Geräusch zu hören war.
Auch als Kind hatte sie sich nie vor einem Gewitter gefürchtet, aber der Gedanke, dass man sie suchen würde, ließ sie an den Heimweg denken. Ohne Eile folgte Amélie dem Pfad bis zum unschuldig plätschernden Brunnen, von dem sich die Allee in beide Richtungen erstreckte. Das junge Mädchen hatte plötzlich Lust, die Stimmung über den Feldern zu erleben. Wenn sie doch nur ihre Malsachen mitgenommen hätte! Seit einiger Zeit aquarellierte sie nicht ohne Talent – ein Freund ihrer Mutter, ein junger Maler, der von Zeit zu Zeit zu ihren Soireen kam, gab ihr Unterricht. Durch die Allee zum Tor war es nicht mehr weit, sie schlüpfte hinaus und lief ein Stück die Landstraße entlang. Genießerisch sog sie den starken Duft der Felder und des Grases ein, der in die schwüle Luft emporstieg. Am düster gefärbten Himmel regte sich noch immer kein Lüftchen, und mit einem Mal wurde ihr das Atmen unerklärlich schwer. Plötzlich ging ein Rauschen durch die Luft, dann ein leichtes Grollen, ehe ein neuer Blitz das Gewölk durchzuckte, dem der Donner auf dem Fuß folgte. Amélie fuhr zusammen. Die Mahnungen und Geschichten ihrer Mutter, welche von unglaublichen Unfällen berichteten, die auf freiem Felde, unter Bäumen und im Wasser geschehen konnten, kamen ihr in den Sinn, und sie ergriff die Flucht. Hufgetrappel hinter ihr ließ sie zurückblicken, und sie war fast erleichtert, als sie in einer Staubwolke ihren Bruder Patrick und seinen Freund Auguste de Platier, den Nachbarssohn, erblickte.
Knapp vor ihr zügelten sie ihre Pferde, die wegen des Gewitters kaum noch zu halten waren und unruhig die Köpfe hin und her warfen. »Hallo, Schwesterlein, was machst du bei diesem Wetter hier draußen? Du willst doch nicht ausreißen?«
Auguste, in Amélies Augen ein eingebildeter Bursche, den sie nicht ausstehen konnte, verzog sein rundliches Gesicht zu einem angedeuteten Lächeln und grüßte zu ihr hinunter. »Es wird gleich losgehen, Mädchen«, schrie er von oben herab, »willst du nicht mit uns kommen? Ich hätte noch Platz auf Dakkar!« Er tätschelte seinem Pferd den Hals und warf Patrick einen fragenden Blick zu.
Amélie trat beiseite und sah ihn spöttisch von unten herauf an. »Nein, danke, Auguste, da ziehe ich doch einen Fußmarsch im Gewitter vor!«
Die Pausbacken des Jungen verfärbten sich eine Spur dunkler, und er wandte sich mit gekränkter Miene ab, um nach Adonis zu rufen, seinem schwarz-weiß gefleckten Jagdhund. Japsend kam er aus dem Gebüsch hervor und stürzte sich zur Begrüßung auf Amélie, die ihm schon manchen Leckerbissen zugesteckt hatte. Ein weiterer Blitz am Horizont tauchte die Landschaft in blendende Helligkeit. Die Pferde scheuten, und Auguste rutschte von seinem Rappen und landete recht unsanft auf dem Boden. Amélie sprang hinzu und hielt das sich aufbäumende Pferd am Zügel fest, während sie herzhaft lachend wartete, bis der ungelenke Reiter sich fluchend aufgerappelt hatte. Mit rot angelaufenem Gesicht klopfte er sich, den Blick gesenkt, die Samthosen ab. Es war ihm jedoch nicht entgangen, dass Amélie ein Gegenstand entglitten war. Er bückte sich schnell und hielt das kleine Büchlein in der Hand, in dem Amélie den Nachmittag über gelesen hatte.
Neugierig warf er einen Blick auf den Einband und las langsam und deutlich vor: »Variationen der Liebe.«
Mit einem Schreckensschrei fuhr Amélie herum, doch Auguste versteckte seinen Fund hinter dem Rücken. »Ich wusste gar nicht, dass Sie sich für diese Art Literatur interessieren, Mademoiselle!«, rief er ihr spöttisch zu. »Ich hielt Sie noch für ein kleines Mädchen.«
Amélie warf die Zügel des Rappen ihrem Bruder zu und versuchte mit aller Kraft, Augustes Arm zu erreichen, mit dem der junge Mann triumphierend das Büchlein in die Höhe hielt. Patrick sah der Szene amüsiert zu und dachte nicht daran, seiner Schwester zu Hilfe zu kommen. Wütend begann Amélie nach dem Widersacher zu treten und mit beiden Fäusten auf ihn einzuhämmern, doch jener streckte den Arm nach ihr aus und zog das zappelnde Mädchen ganz dicht an sich, sodass sie sich kaum rühren konnte. Amélie empfand einen so starken Widerwillen gegen den jungen Mann, der ihr vor Anstrengung ins Gesicht atmete, dass sie blindlings um sich schlug, um sich aus der eisernen Umklammerung zu befreien.
Schließlich hörte sie Patrick unwillig rufen: »Lass sie los, Auguste, du gehst zu weit!«
Ein tiefes Rauschen fuhr in diesem Moment durch die Bäume und der Himmel öffnete weit die Schleusen, begleitet von einer raschen Serie von Blitzen.
Amélie wand sich mit einem Ruck aus dem gelockerten Griff Augustes und flüchtete, wie von Furien gejagt, den Weg entlang, dem großen Tor des Parks zu. Noch aus der Ferne hörte sie durch das Toben des Wetters das Lachen der beiden Burschen. »Das zahle ich dir heim«, sagte Amélie leise zwischen zusammengebissenen Zähnen, »dir und deinem netten Freund!«
War ein Bruder nicht verpflichtet, seine Schwester vor einem solchen Laffen zu schützen, statt sich über sie lustig zu machen?
Während der herabströmende Regen ihre Kleidung durchnässte und ihr die Haare in Strähnen ins Gesicht peitschte, bog sie in das kleine Waldstück ein, um den Weg zum Haus abzukürzen. Mit keuchendem Atem sprang sie über Äste und Baumwurzeln, und als sie die kleine Natursteinmauer erreichte, lehnte sie sich kurz daran und presste die Hand an ihr wild klopfendes Herz. Wie sie diesen eingebildeten Auguste hasste! Sicher würde er überall herumerzählen, was sie las. Die gewaltsame Berührung seines Körpers, als er sie so heftig an sich gedrückt hielt, sein merkwürdiger, glasiger Blick, der Anblick seines rot gefärbten Gesichts, all das flößte ihr selbst noch in der Erinnerung Ekel ein.
Mit einem Mal empfand sie eine Abneigung gegen die pikanten Situationen zwischen Mann und Frau, so wie sie in dem Büchlein beschrieben waren. Wie abscheulich musste es sein, zu küssen, sich einem Mann hinzugeben, wie es dort illustriert war!
Schmutzig, zerkratzt und mit aufgeweichten Kleidern lief sie geradewegs Mademoiselle Dernier in die Arme, die sie schon vermisst hatte.
Kopfschüttelnd, aber erleichtert betrachtete die Gouvernante das zerzauste Wesen, aus dem sie eigentlich eine Dame machen sollte. »Amélie«, sagte sie entrüstet, »wie siehst du nur aus!«
Dann, als schien sie über ihre eigene Stimme erschreckt, blickte sie über die Schulter zurück, ob sie auch niemand gehört hatte, zog Amélie ins Haus und scheuchte sie rasch die Treppe hinauf und in ihr eigenes Zimmer. Keineswegs wünschte sie eine Begegnung mit Madame, die ihr sicherlich die Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht vorgeworfen hätte.
Während sie Amélie half, sich aus ihren triefenden Kleidern zu schälen, sagte sie: »Ich möchte nur wissen, wo du dich wieder herumgetrieben hast. Du bist doch schlimmer als ein Junge. Anstatt in der Nähe des Hauses zu bleiben, verschwindest du einfach! Und ich, die ich für dich verantwortlich bin, mache mir die größten Sorgen. Wenn das deine Mutter wüsste, wäre ich die letzte Zeit in diesem Hause gewesen!«
Amélie setzte bei diesen Worten ihren Schmollmund auf und schwieg. In Wahrheit genoss sie aber das Gefühl der Wärme und der Geborgenheit, das sie nach einem solchen Abenteuer umso stärker empfand. Fröstelnd kuschelte sie sich tiefer in den weichen Morgenrock, »...und du solltest mehr lernen, jeden Tag etwas dazu, dich fürs Leben bilden!«, hörte sie wie in Trance die Worte von Mademoiselle Dernier an ihrem Ohr vorbeiplätschern. »Ich weiß doch, dass du gern liest! Aber doch nicht alles, was dir zufällig in die Finger kommt.«
Wenn du wüsstest, was ich gerade gelesen habe!, dachte Amélie und kicherte leise in sich hinein. Doch im selben Moment durchfuhr sie ein Schreck. Auguste besaß ja noch das Buch... Siedend heiß stieg ihr das Blut in die Wangen, und sie war plötzlich hellwach. Er würde es lesen... er würde es Patrick zeigen... vielleicht gar ihren Eltern! Sie war auf jeden Fall bloßgestellt, erniedrigt, lächerlich gemacht, in ihrer Neugier, alles wissen zu wollen!
»Wenn du einmal heiratest...«, fuhr Mademoiselle Dernier fort, »... dann...«
Amélie fiel ihr ins Wort: »Ich heirate niemals!«
»Nur nicht so voreilig, das hat schon manches Mädchen gesagt.«
»Niemals!«, bekräftigte Amélie. »Sie sagten doch selbst, man solle sich bilden... lieber beschäftige ich mich mit Politik, wie Papa, ich werde reisen... und ich werde frei sein. Vielleicht werde ich sogar Schauspielerin...«
Die Gouvernante schüttelte den Kopf und legte ihr lächelnd den Arm um die Schultern. »Das würden deine Eltern wohl zu verhindern wissen, und es bewahre Gott dich davor, eine solche Kokotte zu werden... Aber als ich in deinem Alter war, fühlte ich genauso, nur hatte ich nicht wie du die Wahl – doch jetzt komm, ich hole dir trockene Sachen, und du kannst hinuntergehen. Man hat dich sicherlich bereits vermisst.«
Amélie zögerte. Sollte sie Mademoiselle Dernier um Rat bitten? Doch im gleichen Moment verwarf sie den Gedanken wieder. Wie sollte sie die Situation erklären?
Ihre Blicke schweiften zu dem schmalen Bücherbord, wo sich die Werke von Corneille, Racine und den griechischen Philosophen reihten. Auf dem Nachttisch duftete eine Schale mit Rosenblättern neben einem aufgeschlagenen Band Gedichte.
Jemand, der das las, würde für verbotene Schundliteratur kaum Verständnis aufbringen.
2
Bagatellen
Schnell beseitigte Amélie in ihrem Zimmer die restlichen Spuren ihres Ausflugs. Dann zog sie ihre weißseidene, an Ärmeln und Kragen gerüschte Bluse mit den rosa Seidenbändern an und bürstete sorgfältig das sich von der Feuchtigkeit ein wenig kräuselnde Haar. Auf der Schwelle stieß sie fast mit ihrer Mutter zusammen, die gerade auf dem Weg nach unten war. Madame d’Emprenvil, in großer Seidentafttoilette, blass gepudertem Gesicht und kunstvoll nach der Mode hoch aufgetürmten Locken, war wie immer eine elegante Erscheinung. Doch ihre Miene, als sie Amélies ansichtig wurde, verhieß nichts Gutes.
»Amélie!« Ihre sonst so sanfte Stimme hatte einen schrillen Unterton. »Wo steckst du nur die ganze Zeit! Anstatt mir zu helfen, muss ich dich auch noch suchen und mir Sorgen machen, wo du dich bei diesem Sturm herumtreibst!« Theatralisch presste sie die Hand gegen die Stirn. »Ausgerechnet heute habe ich Migräne! Dein Vater reist Hals über Kopf ab, du kümmerst dich um nichts, obwohl du allmählich in dem Alter wärst...«
Amélie unterbrach sie in ruhigem Ton: »Ich bin ja jetzt da, Mama, und wenn du dich weiter aufregst, wird sich deine Migräne nur noch verschlimmern. Lass uns gehen...«
Schnell schlüpfte sie durch die Tür, bevor die Mutter noch irgendetwas sagen konnte. Der Ablauf dieser Gesellschaften war immer der gleiche – es gab die alten Freunde und die neuen –, zumeist mehr oder weniger talentierte Verehrer ihrer Mutter, denen sie vorgestellt wurde und mit denen sie immer die gleiche, langweilige Konversation führte, zerstreut und gleichgültig und in dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.
Der Salon war mit lautem Stimmengewirr erfüllt, man stand in Grüppchen beisammen. Amélie ließ den Blick über die Gesellschaft schweifen, um sich ein wenig zu orientieren. Wie magnetisch angezogen, nahm sie als Erstes Auguste de Platier wahr, der mit einem mokanten und triumphierenden Grinsen zu ihr herüberstarrte. Sie spürte eine rote Welle ihr Gesicht überfluten und senkte verlegen den Kopf. Wie sie diesen Schnösel hasste, der ihr Geheimnis kannte und sich darüber lustig machte.
Rasch ließ sie den Blick weiterschweifen, bis sie seine Eltern erkannte, das Ehepaar de Platier – ein beleibter, bieder wirkender Landedelmann mit seiner Frau Charlotte, die ebenso hässlich wie schlecht angezogen war –, das sich angeregt mit ihren Nachbarn aus dem nicht weit entfernten Landsitz Jardinbleu unterhielt. Die de Platiers hatten ihre Tochter Cécile, Amélies Freundin aus Kinderzeiten, mitgebracht. Cécile, ein noch sehr kindlich scheinendes Wesen, pummelig und in ein enges rosa Seidenkleidchen gepresst, winkte ihr aufgeregt zu. Doch Amélie schenkte ihr nur ein zurückhaltendes Lächeln; sie selbst fühlte sich in ihrer Entwicklung meilenweit von Cécile entfernt. Die ehemalige Freundin zeigte in letzter Zeit großes Interesse an Haushaltsführung, Heiratskandidaten und Handarbeiten – Themen, die Amélie verabscheute. Sie fragte sich, wie sie jemals Cécile ununterbrochenes Geschwätz und ihr albernes Kichern ertragen konnte.
Rasch folgte Amélie ihrer Mutter, die zielstrebig auf eine andere Personengruppe zusteuerte, die aus ihrem Bruder Patrick, dem Maler Jean Jaques Arombert und einem unbekannten, düster dreinblickenden Menschen mit dunklem Teint und schwarzen langen Haaren bestand, der nervös auf den Lippen kaute. Arombert war es vergönnt, im Sommer jeweils einige Wochen auf dem Schloss zu verbringen, und Amélie bewunderte seine wunderschönen, zarten Aquarelle mit Blumen, ätherisch schönen Frauen und pausbäckigen Engeln, die das Füllhorn der Freude über alles ausschütteten. Zutraulich ließ sie sich von Arombert, der ihr Malunterricht erteilte, auf die Wange küssen und strahlte ihn an. Doch noch bevor sie das Wort an ihn richten konnte, hörte sie die unerbittliche Stimme ihrer Mutter rufen: »Amélie, mein Liebes, darf ich dir Monsieur Camille Desmoulins vorstellen? Er ist ein sehr begabter Dichter und steht als Journalist außerdem mitten im Leben. Eine Seltenheit, aber bei ihm ergänzen sich diese beiden Talente auf das Vortrefflichste.«
Desmoulins‘ finstere, gedankenvolle Miene erhellte sich, und er verneigte sich leicht. Flüchtig warf er Laura D’Emprenvil einen anbetungsvollen Blick zu und murmelte: »Sie geben mir zu viel Ehre, Madame, denn meine Dichtung steht jetzt nur noch im Dienste des Vaterlandes.«
Patrick lächelte spöttisch und erhob sein Glas: »Diesen Dienst versteht jeder ein wenig anders.«
Ein kurzes Schweigen trat ein, und man blickte erstaunt auf den sonst so wohlerzogenen jungen Mann, der sein Glas auf einen Zug leerte. Desmoulins zog die dunklen Brauen hoch und sah sich nach dem Herausforderer um, der ihm das Stichwort für einen Disput über Politik geliefert hatte, etwas, das er über alles liebte. Als er jedoch den jungen Mann sah, noch minderjährig, zögerte er ein wenig, und unter dem strengen und abwartenden Blick Lauras überkam ihn sogar etwas wie Verlegenheit. Und als die Hausherrin seinen Arm nahm, ließ er sich willig hinausführen, um eine Kostprobe ihres neuesten Romans, Clorinde, zu lesen.
Amélie näherte sich Patrick, der erneut sein Glas füllte und ihr einen trotzigen Blick zuwarf. »Ich gestehe, du hast Courage, Brüderchen«, flüsterte sie ihm zu, »das mit heute Nachmittag wirst du mir aber büßen, du und dein netter Freund Auguste!« Patrick antwortete nicht; er starrte sie mit glasigen Augen an, während er aufs Neue sein Glas leerte. »Um Himmels willen, du bist ja völlig betrunken!«, stellte Amélie entsetzt fest. »Wie kannst du nur! Komm hinaus, ich begleite dich.« Sie zerrte ihn am Arm, doch Patrick hatte nicht die Absicht, ihr zu folgen; er schob sie unsanft von sich und ging mit unsicheren Schritten, doch so aufrecht wie möglich auf seinen Freund Auguste zu.
Kurz darauf wurde zu Tisch gebeten, und Amélie nahm ihren Platz neben der kichernden und verschwörerisch tuschelnden Cécile ein. Das Mädchen, froh, endlich seine Freundin ganz für sich zu haben, plauderte in einem unablässig sich ergießenden Wortschwall auf Amélie ein. Sie wurde ihrer geschwätzigen Mutter, der jeder wegen dieser Eigenschaft tunlichst aus dem Weg ging, immer ähnlicher. Im Flüsterton vertraute sie ihr zwischen Suppe und Hauptgericht alle Details und Stufen der Liebe zu ihrem Hauslehrer Leon an. Amélie ahnte dunkel die Enthüllungen, die Cécile kaum abwarten konnte ihr anzuvertrauen, und verbarg ihren Widerwillen hinter einer höflich interessierten Miene.
Zu ihrer Linken saß schweigsam und gedankenverloren Camille Desmoulins und zerkrümelte mit nervösen Fingern eine Brotkruste auf der Tischdecke. Verstohlen blickte sie hin und wieder zu ihm hinüber, doch er schien von ihrer Anwesenheit keinerlei Notiz zu nehmen, stattdessen schweiften seine Blicke unablässig zur anderen Seite des Tisches, zu seiner Gönnerin Laura d’Emprenvil. Amélie überlegte, ob sie es wagen sollte, ihn einfach anzusprechen; in seiner geheimnisvollen Düsternis schien er ihr interessant. Céciles Getuschel übergehend, nahm sie ihren Mut zusammen, um sich nach der Art seiner Dichtung zu erkundigen.
Sein Blick kam von weit her, als er seine schwarzen, ein wenig matt wirkenden Augen, die sie vorher leidenschaftlich hatte aufglühen sehen, auf sie richtete, erstaunt, dass sie überhaupt existierte. »Ich dichte jetzt weniger, Mademoiselle, die Geschicke unseres Landes und des verschuldeten Staates nehmen meine Gedanken weit mehr in Anspruch. Kurz gesagt, ich habe vor, eine Zeitung zu gründen, um die Stimme des Volkes ertönen zu lassen. Jeder sollte das Recht haben, seine freie Meinung zu äußern und die unverfälschte Wahrheit zu erfahren – nicht die Wahrheit des Hofes oder die eines schmutzigen Flugblatts, nein Wahrheiten, die unterzeichnet sind mit meinem Namen.«
Amélie lauschte fasziniert, während sie ihre Suppe kalt werden ließ.
Doch bevor Desmoulins, der in Fahrt gekommen war, sie gänzlich in seinen Bann ziehen konnte, erklang die mahnende Stimme ihrer Mutter: »Amélie, mein Liebes, sieh doch bitte kurz nach Christoph, der mit Mademoiselle Dernier zu Abend isst. Er hatte ein wenig Schnupfen, und wenn alles in Ordnung und der Kleine im Bett ist, bitte doch Mademoiselle zu uns.«
Das Mädchen erhob sich gehorsam, denn es wusste, dass sich hinter der liebenswürdigen Art der Mutter ein eigensinniger Wille verbarg und dass es ihr nicht ganz recht war, wenn sie sich zu sehr mit den Ideen Desmoulins beschäftigte. Auf der Treppe begegnete sie der Gouvernante, die das Kind, das beim Essen schon fast eingeschlafen war, zu Bett gebracht hatte. Täuschte sie sich, oder schienen die Augen Madeleines traurig und verweint? Nachdem Amélie ihr Sprüchlein aufgesagt hatte, fasste sie spontan nach ihrer Hand und fragte teilnehmend: »Fehlt Ihnen etwas, Mademoiselle? Sind Sie vielleicht krank?«
Die Angesprochene straffte die Schultern und erwiderte mit einem gezwungenen Lächeln: »Sehe ich so aus? Nun, ich glaube, ich habe ein wenig Kopfschmerzen. Die Hitze, das Gewitter... nichts Besonderes eigentlich. Ich werde zeitig zu Bett gehen und danke deiner Mutter herzlich für die Einladung.«
»Sie Ärmste« – teilnahmsvoll legte ihr das Mädchen den Arm um die Schultern –, »ich weiß, Kopfschmerzen sind abscheulich. Hoffentlich ist morgen wieder alles in Ordnung. Ich muss wieder zu den Gästen. Mama möchte, dass ich die vollendete Tochter der vollendeten Gastgeberin spiele.« Sie kicherte und hüpfte wie ein übermütiges Fohlen die Treppe hinunter, um unten angekommen in einen übertrieben gezierten Gang zu fallen.
Nach dem Diner war die Gesellschaft in der heitersten Stimmung dazu übergegangen, Aromberts ausgestellte Bilder zu bewundern. Gesättigt und vom Champagner beschwingt, unterhielt man sich wohlwollend über das Talent des jungen Malers.
»Meine liebe Amélie, mein liebes Kind!«, durchriss eine schrille Stimme Amélies Versunkenheit, mit der sie einen Schmetterling betrachtete, wie die Natur ihn nicht schöner hatte hervorbringen können. »Was sind Sie nur für ein großes Mädchen geworden! Dabei spielten Sie doch gestern erst noch mit Ihren Puppen«, hörte sie Madame de Platier flöten.
Amélie sandte ein honigsüßes Lächeln in ihre Richtung und wollte gerade den Mund zu einer belanglosen Floskel öffnen, als sie mit betretenem Gesicht Auguste hinter dem Rücken seiner Mutter auftauchen sah. Röte überflutete ihre Wangen, und sie biss sich auf die Lippen, während sie stotterte: »Natürlich sind es heute andere Dinge, die mich interessieren... aber...«
Madame de Platier deutete ihre Verlegenheit anders, sie lachte gekünstelt und schob ihren Sohn ein wenig näher heran. »Sie müssen uns bald wieder besuchen kommen, Liebes! Nicht wahr, Auguste, diesmal wirst du ihr nicht wieder Frösche in die Tasche stecken! Oh, wenn ich daran denke, wie ihr euch geneckt habt! Auguste, du warst wirklich schlimm. Das wird dir Amélie vielleicht nie vergessen!« Mit zusammengebissenen Zähnen dachte Amélie: Wenn du wüsstest, wie recht du hast! »Ich lasse euch ein wenig allein, dann könnt ihr euch mit den alten Zeiten aussöhnen!«, sagte Madame de Platier mit vielsagendem Blick und ergriff den Arm ihres Mannes, der gerade herangetreten war und sich höflich verneigte. »Komm Eugen, lassen wir die Kinder allein, wir sollten ein Wort mit den Ribonpierres wechseln, man sieht ja die armen Leute kaum, so sehr sind sie beschäftigt!«
Mit einem Mal mit Amélie allein gelassen, hatte Auguste seine ganze gespielte Arroganz verloren. Er wusste wohl, dass sie böse auf ihn war, und hatte vor, ihr mit großzügiger Geste, die er zuvor im Spiegel geübt hatte, das Buch zurückzugeben. Jetzt aber, da er Amélie unvermittelt gegenüberstand, fühlte er sich so unbehaglich, dass er nach Worten suchen musste, während sein Gesicht die Farbe einer überreifen Tomate annahm. Amélie ließ ihn zappeln, sie schwieg und blitzte ihn mit halb zugekniffenen Augen an. Dieser Laffe! Sie würde es ihm zeigen!
Auguste, der nach Worten suchte, wurde es in seiner eleganten Kleidung zu eng und zu heiß, und er wischte sich mit einem Spitzentuch mehrmals über die Stirn. Schließlich griff er in die Rocktasche und zog das Büchlein heraus. Er bemühte sich, seiner Stimme einen unbeteiligten Klang zu geben, als er sagte: »Ein kleiner Spaß, liebe Amélie...«, er räusperte sich umständlich, »...ich gebe zu, ein etwas übertriebener Spaß... den Sie mir sicher nicht nachtragen werden. Niemand wird natürlich davon erfahren... keine Sorge...« Er verstummte und knetete sein Taschentuch. »Wir kennen uns doch schon so lange, und Mama lässt fragen, ob Sie nicht zu unserem Sommerball kommen möchten, auch wenn ich Sie vielleicht etwas verstimmt haben sollte...« Er brach ab und hielt ihr wie beschwörend das Buch hin. »Hier, bitte, ich habe es gar nicht angesehen, ich...«
Amélie blies vor Zorn die Backen auf, ihr Gesicht war feuerrot, als sie mit einem Ruck das Büchlein an sich riss und es in einer Rockfalte verschwinden ließ. »Ich denke gar nicht daran, mit dir irgendwo hinzugehen, du eingebildeter Schnösel, geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr sehen, du...du...«
In Ermangelung eines treffenden Ausdrucks drehte sie sich auf dem Absatz um, stürzte davon und ließ den verdatterten jungen Mann wie einen gemaßregelten Schuljungen stehen. Erst als sie das Büchlein wieder in seinem Versteck in der Bibliothek verstaut hatte, fühlte sie sich erleichtert. Das unangenehme Gefühl von Scham und Erniedrigung blieb jedoch, und sie verspürte nicht die geringste Lust, zur Gesellschaft zurückzukehren und das hilflose, dümmlichhämische Grinsen Augustes länger zu ertragen. Doch ihre Mutter würde es ihr verübeln, wenn sie sich jetzt schon zurückzog. Also schlenderte sie abermals zu den Gemälden Aromberts, um sich in den Anblick der hübschen Aquarelle und zartfarbigen Porträts zu vertiefen. Selbstverständlich befand sich auch das Bildnis der Hausherrin darunter, wie sie, mit seelenvollem Blick, die Feder in der Hand, sinnend den Betrachter ansah.
Laura fand es außerordentlich gelungen, und Arombert durfte später, bei der Lesung von Desmoulins‘ Gedichten, auf einem Kissen zu ihren Füßen sitzen. Er fühlte sich sehr glücklich, Aufmerksamkeit erregt zu haben, auch waren einige seiner Bilder verkauft worden. Der Abend schien dem armen Künstler wie ein schöner Traum – die erlesenen Speisen, die Gespräche über seine Malerei am flackernden Kamin und die Nähe und Zuneigung der schönen Laura, die diesen Abend für ihn gestaltet hatte. Durch die süße Betäubung, die der Wein und die freundliche Anerkennung in ihm hervorriefen, sah er seine Zukunft in rosigem Licht. Und doch drohte schon ein düsterer Schatten am Horizont, der die heitere Leichtigkeit und Lebensfreude dieser Salonabende bald trüben sollte.
3
Rede mit Folgen
Die Kutsche holperte durch den strömenden Regen über die aufgeweichten Wege, und die Pferde kämpften gegen den in Böen heranfegenden Wind. Das Gewitter hatte nachgelassen, nur hin und wieder zuckten Blitze in der Ferne auf. Die Feuchtigkeit tat dem Boden gut, denn die monatelange Trockenheit ließ erneut eine Missernte befürchten. Baron d’Emprenvil lehnte sich auf dem unbequemen Sitz der Kutsche zurück. Unterwegs waren ihm trotz des schlechten Wetters Gruppen von Bauern begegnet, Menschen, die ihre Heimat verlassen hatten und hofften, in der Hauptstadt oder an einem anderen Ort ihr Auskommen zu finden.
Ja, die wirtschaftliche Not war groß, und ganz besonders bekam sie die Landbevölkerung zu spüren, denn ihr fehlte es am Notwendigsten. Aber auch um den kleinen Landadel stand es nicht zum Besten. Und jetzt noch das Edikt über die Stempel- und Bodensteuer, das der König gegen den Willen des Parlaments durchsetzen wollte! D’Emprenvil beugte sich wieder vor und blickte ungeduldig aus dem Fenster des Wagens, als wenn er damit die Fahrt beschleunigen könnte. Seine Gedanken kreisten um die Rede, die er am nächsten Tag im Parlament zu halten gedachte; er suchte nach eindringlicheren Formulierungen und murmelte ganze Passagen laut vor sich hin. Natürlich waren die Zeiten schlecht, und der Staat war über alle Maßen verschuldet. Doch auch de Brienne, der neu einberufene Finanzminister, hatte kein Rezept, um die Misere zu beheben. Es war unmöglich, sich gegen die Privilegien des Adels und der Kirche durchzusetzen, die sich einmütig weigerten, Steuern zu entrichten.
D’Emprenvil ballte die Fäuste wie gegen einen unsichtbaren Gegner. Das Edikt würde wieder die Falschen treffen. Warum war der König so schwach? Er lieh sein Ohr den Einflüsterungen der alten Geschlechter wie der Lamballe, Lauzun und Montmorency, die auf ihren Rechten beharrten. Doch es war den Bürgern und Bauern einfach nicht länger zuzumuten, dass sie die ins Unermessliche wachsende Finanzlast allein trugen. Sie spürten die Ungerechtigkeit am eigenen Leibe, und ihr Groll richtete sich vor allem gegen die Königin, die verhasste Österreicherin. Mit ihrem glanzvollen Lebensstil und den üppigen Festen war sie für die Bauern und kleinen Bürger der Inbegriff von sinnloser Verschwendung.
Die Vororte von Paris schälten sich trist und trüb wie Schatten aus der Dämmerung. Der Baron ordnete im Zwielicht des Abends seine Papiere. Es war beinahe acht Uhr, als er die Porte de Clichy durchfuhr, und er freute sich auf die lebendige, pulsierende Stadt. Das Landleben langweilte ihn, selten war er auf seinem Gut; sein Herz gehörte der Politik, und er hatte den Ehrgeiz, eine bedeutende Rolle darin zu spielen und die Geschicke des Landes zu beeinflussen.
Am Abend war in der Hauptstadt von der allgemeinen Krise wenig zu spüren. Die Straßen waren belebt von eleganten Menschen, eilig dahinrollenden Kutschen und Läden, in denen die Schätze des Luxus ausgebreitet lagen. In unzähligen Theatern der Stadt fanden Aufführungen statt, die Cafés waren erleuchtet, und aus den Fenstern der Wohnungen schimmerte Kerzenglanz.
Der Kutscher bog in eine breite, dunklere und ruhige Straße und hielt vor einem kleinen, schmalen Palais. Es war die Stadtwohnung der d’Emprenvils in der Rue Dauphine, die Laura so gut wie niemals bewohnte. Sie hasste die Ansammlung von Menschen in der Stadt, den Schmutz und die schlechte Luft, und der Baron hatte sie in den letzten Jahren, da die Kinder heranwuchsen, nicht mehr dazu bewegen können, das Pflaster von Paris zu betreten. D’Emprenvil musterte von der Kutsche aus die Fassade des vertrauten Gebäudes, die Marmorfiguren, die den Balkon mit den schmiedeeisernen Ranken trugen, und das aufwendig geschnitzte Portal, durch das man in den kleinen Innenhof fuhr.
Jean, sein vom Alter gebeugter, langjähriger Diener, erwartete ihn schon in freudiger Aufregung. Er hatte alles vorbereitet: Ein wärmendes Feuer flackerte anheimelnd im Kamin, denn nach dem Gewitter war die Luft abgekühlt. Eine kleine kalte Mahlzeit war auf dem Tablett neben dem Lieblingssessel des Barons angerichtet – ein Stückchen zarter Fasan, seine Lieblingspastete mit Pilzen und Kräutern, umrahmt von eingelegtem Gemüse in Aspik, sowie eine Flasche alter Bordeaux.
D’Emprenvil aß mechanisch, nicht recht bei der Sache, den Blick zerstreut auf die Ahnenporträts geheftet, die rechts und links vom Kamin hingen und seinen Vater zeigten, einen beleibten Lebemann mit weiß gepuderter, gelockter Perücke und beringten Händen im Stil Ludwigs des XIV., sowie seine jugendliche Mutter, schmal und ernst unter ihren natürlichen, rabenschwarzen Locken, mit dunklen Augen und alabasterfarbenem Teint. Er hatte sie kaum gekannt; sie starb schon in jungen Jahren an der Schwindsucht, und der Vater, ein lebenslustiger Hofmann, wie er im Buche stand, erlag eines Tages sehr plötzlich einer Magenverstimmung; man munkelte, eine seiner Mätressen habe sich mit einer Dosis Gift an ihm gerächt.
Das Klopfen Jeans unterbrach seine Gedanken. »Graf de Montalembert möchte Sie sprechen, er sagt, es sei dringend.«