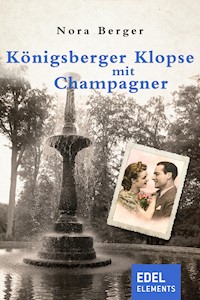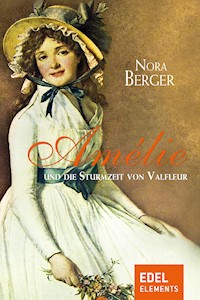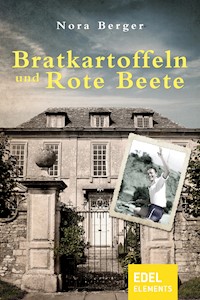4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein heißer Sommer in Venedig, 1640: Julien de Rochebonne, ein Pariser Adeliger mit einer hohen Meinung von sich und noch höheren Spielschulden, hält um die Hand von Gabriella di Montadori an. Mit dem Vermögen der schwerreichen Familie, aus der die junge Frau stammt, lockt schließlich ein Ausweg aus seiner Misere. Doch Gabriella wehrt sich mit Kräften gegen die Heirat, denn sie hat ihr Herz bereits verschenkt – an Angelo, einen Hirtenjungen … Da belauscht sie ein Gespräch zwischen Julien und dem Marquis de Cinq-Mars, seinem besten Freund und einem ehrgeizigen Günstling König Ludwigs XIII. Gabriella ist schockiert: Kardinal Richelieu soll aus dem Weg geräumt werden! Als sie Nachforschungen anstellt, stößt die junge Frau auf ein streng gehütetes Geheimnis des Kardinals – und gerät in Lebensgefahr, denn Mademoiselle Praslin, die dem Kardinal bedingungslos ergebene Gouvernante, setzt alles daran, Gabriella zum Schweigen zu bringen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 770
Ähnliche
Nora Berger
Die gefährlichen Intrigen des Marquis de Cinq-Mars
Roman
Bookspot
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.
Alle Akteure dieses Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind von der Autorin nicht beabsichtigt.
Copyright © 2017 by Edition Carat, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH
1. Auflage 2017
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Covergestaltung: Nele Schütz, München
Lektorat: Dr. Karin Sagner
Korrektorat: Thilo Fahrtmann
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Made in Germany
ISBN: 978-3-95669-078-5
www.bookspot.de
Personen
Die Figuren dieses Romans basieren auf folgenden historischen Personen:
König Ludwig XIII. von Frankreich (1601–1643)
Er kam mit neun Jahren auf den Thron; Marie de’ Medici, seine Mutter, regierte bis zu seiner Volljährigkeit. Er war der Vater von Ludwig XIV., des späteren »Sonnenkönigs«.
Anna von Österreich (Anne d’Autriche) (1601–1666)
Gemahlin Ludwig XIII. Sie war spanisch-portugiesische Infantin und Erzherzogin von Österreich aus dem Hause Habsburg. Der spanische König Philipp IV. war ihr jüngerer Bruder.
Marquis de Cinq-Mars/Henri Coiffier de Ruzé (1620–1642)
Favorit König Ludwig XIII., Grand-Maître de la Garde-robe und Grand Écuyer (Großstallmeister von Frankreich). Er strebte ein hohes militärisches Kommando an, doch sein Mentor Kardinal Richelieu durchkreuzte seine Pläne. Cinq-Mars ließ sich in eine Verschwörung verwickeln, die Richelieu aufdeckte. Cinq-Mars wurde 22-jährig zum Tode verurteilt und in Lyon hingerichtet.
Kardinal Richelieu/Armand-Jean du Plessis, Premier Duc de Richelieu (1585–1642)
Auf Betreiben der Königinmutter Marie de’ Medici wurde er 1622 Kardinal. König Ludwig XIII. ernannte ihn 1624 zum Ersten Minister von Frankreich. Er protegierte den jungen Cinq-Mars und brachte ihn an den Hof des Königs.
Gaston de Bourbon, Duc d’Orléans (1608–1660)
Jüngerer Bruder König Ludwigs XIII. Er war Thronanwärter bis zur Geburt des künftigen Ludwig XIV. und entschiedener Gegner Kardinal Richelieus.
Marion Delorme (1613–1650)
Tochter aus einer einflussreichen und wohlhabenden französischen Familie; berühmte Kurtisane und Geliebte von Cinq-Mars.
Duchesse de Chevreuse/Herzogin von Chevreuse/Marie de Rohan-Montbazon (1600–1679)
Freundin Annas von Österreich; berühmt für ihre Liebesaffären und Intrigen.
Mère Angélique/Angélique Arnauld (1591–1661)
Äbtissin des Klosters Port-Royal des Champs und dessen Haus in Paris, Port-Royal de Paris.
Prinzessin von Gonzaga/Marie-Louise de Gonzaga (1611–1667)
Verlobte von Gaston d’Orléans, spätere Königin von Polen.
Conde de Olivares, Gaspar de Guzmán (1587–1645)
Führender Minister König Philipps IV. von Spanien.
Beteiligte an der Verschwörung des Cinq-Mars:
Marquis de Fontrailles/Louis d’Astarac (1605–1677)
Nach dem Scheitern des Komplotts mit Cinq-Mars konnte er nach England flüchten.
Duc de Bouillon/Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne (1605–1652)
Nach Aufdeckung der Verschwörung wurde er zunächst verhaftet, später begnadigt.
François-Auguste de Thou (1607–1642)
Französischer Staatsrat; wurde zusammen mit Cinq-Mars in Lyon enthauptet.
Duc de Bellegarde/Roger de Saint-Lary (1563–1646)
***
Nicht-historische Personen:
Baronesse Gabriella di Montadori
Baron Alfonso di Montadori, Senator, Vater
Baronin Lucia di Montadori, Mutter
Angelo Cavolo, Hirtenjunge und Stallbursche
Julien de Rochebonne, Gatte Gabriellas
Marquise Marie-Hélène de Rochebonne, Mutter Juliens
Marquis de Rochebonne, Vater Juliens
Lukas de Rochebonne, jüngerer Bruder Juliens
Mademoiselle Clarisse Praslin, ehemalige Gouvernante von Cinq-Mars und Hausverwalterin auf Schloss Effiat
Pater Liverzani, junger Priester in der Gemeinde Effiat
Juan, Conde de Almansas, Angelos Zwillingsbruder
Graf Chavignac, Unterstützer der Konspiration, Doppelagent
Maurizio Pirelli, ehemaliger Zisterziensermönch
Rosanne, ehemalige Schwester Benedicte im Kloster Port-Royal de Paris
Adrienne (Sœur Dominique), Nonne im Kloster Port-Royal
Prolog
Der Karren mit dem Priester und den Delinquenten rumpelte über das Kopfsteinpflaster und näherte sich langsam dem großen Platz im Zentrum von Lyon. Es war der 12. September 1642 und die ganze Stadt schien auf den Beinen. Ein Summen, vergleichbar mit dem eines riesigen Bienenschwarms, erfüllte die Luft, unterbrochen vom Lachen und Schwatzen der dort versammelten Menschenmenge, die sich um das aufgestellte Gerüst scharte, auf dem der Henker mit schwarzer Kapuze das Beil schon bereithielt.
Als der Wagen den Place des Terreaux erreichte, ging ein erstauntes Raunen durch die Menge. Er war es wirklich: Cinq-Mars, der vergötterte Liebling König Ludwigs XIII., der dort oben auf dem Karren stand. Sein Gnadengesuch war abgelehnt worden.
Auf dem Balkon eines der den Platz umgebenden Herrenhäuser stand eine junge Frau, Marion Delorme. Fröstelnd zog sie ihren dunkelgrünen, mit Brokatborten besetzten Mantel enger um die Schultern. Ihr dunkles Haar, das seitlich mit geflochtenen Strähnen zurückgehalten wurde, floss in reicher Fülle über ihren Rücken. Nur über der blassen Stirn kringelten sich einige verlorene Locken. Ihr Gesicht zeigte einen unverkennbar traurigen Zug. Wer hätte das gedacht? Der junge, elegante Schönling, dem Frauen und Männer gleichermaßen zu Füßen lagen, der mit seinem Charme nicht nur den König, sondern auch alle Welt bezauberte, wurde hier tatsächlich zum Schafott geführt. Schmerzlich berührt schloss die berühmteste Kurtisane von Paris die Augen. Sie hatte ihn geliebt und die ganze Tragödie, seinen unaufhaltsamen Aufstieg, seine leichtsinnigen Intrigen, die ihn ins Unglück gestürzt hatten, miterlebt. Jetzt erschauderte sie bei dem Gedanken, wie nahe sie dabei selbst dem Rand des Abgrundes gekommen war.
Schmähreden ertönten. Ein grinsender Geselle mit ungepflegtem Zottelhaar sprang aus der Menge auf: »Na, Monsieur Le Grand – hast wohl beim König ausgespielt?«, schrie er höhnisch. »Lässt er sich deine Faxen nicht mehr gefallen?«
Cinq-Mars streifte ihn mit einem verächtlichen Blick und grüßte dann mit erhobenem Haupt nach allen Seiten seine zahlreichen Freunde, die ihn ungläubig anstarrten. Schließlich erkannte er auch Marion, die sich an das schmiedeeiserne Geländer lehnte, hob lächelnd die Hand und sandte ihr eine Kusshand. Was hätte sie tun können, um ihm zu helfen? Nichts. Es gab keine Entschuldigung für sein Tun. Der König hatte nicht anders handeln können nach den schwerwiegenden Fakten, die Kardinal Richelieu gegen ihn vorgebracht hatte. Trotzdem wirkten Cinq-Mars heitere Miene, seine Allüren so gelassen, als ginge er nicht in den Tod, sondern, wie üblich, zu einem Ball. Nur seine extreme Blässe und die Schatten unter den Augen verrieten die Haft im Kerker, seine schlaflosen Nächte. Als er das sorgfältig frisierte, kastanienbraune Haar zurückstrich, das bis auf den weißen, gestärkten Spitzenkragen fiel, blitzten an seiner Hand mit kostbaren Steinen besetzte Ringe auf. Seine Weste aus grüner Seide mit Knöpfen aus reinen Brillanten passte perfekt zu der dunkelblauen Hose mit hellen Bändern. Auch die braunen Lederstiefel, an denen silberne Schnallen und ziselierte Sporen prangten, waren nach der letzten Mode gearbeitet. Elegant, jung und schön wirkte er auf die anwesenden Frauen wie ein Magnet. Seufzer wurden laut, sie winkten ihm mit ihren Taschentüchern zu. Seine letzte Geliebte, die Prinzessin von Gonzaga, war jedoch nirgendwo zu sehen. Cinq-Mars straffte seinen Rücken, er wirkte unangreifbar, ein Denkmal, der Gott Mars in Person.
Konnten die Gerüchte überhaupt wahr sein, dass dieser so unschuldig wirkende Marquis mit dem größten Feind Frankreichs, dem spanischen König, verhandelt hatte? Dass er seinen Souverän betrogen, mit kapriziösen Launen gequält – ja ihn sogar gehasst hatte? War dieser sanfte Jüngling zu einem so gefährlichen Spiel überhaupt fähig? Hatte er denn nicht alles gehabt, was sich ein Mensch nur wünschen konnte, Titel, Macht, Ruhm und zahlreiche Anhänger? Zwar war es kein Geheimnis, dass sein Betragen dem Ersten Minister Ludwigs, Kardinal Richelieu, schon länger missfiel – aber darauf gab man im Volke nichts. Richelieu war nicht beliebt – seine Strenge, seine Macht über den König hatten ihm überall Widersacher eingebracht.
Cinq-Mars bedachte auch den Henker mit einem abschätzigen Blick, doch als er das blitzende Beil sah, das dieser in der erhobenen Hand hielt, schwankte er einen kurzen Augenblick – was für ein Szenario! So viel Aufwand für nichts! Er holte tief Luft und versuchte, sich zu beruhigen. Kaltes Blut bewahren! Der König wollte ein Exempel statuieren – aber in letzter Minute würde er ihm verzeihen, ihn begnadigen und in seine Arme schließen. Dies bewies doch das kleine zerknitterte Billet, das er von ihm erhalten hatte: Fliehen Sie – sofort! Ich befehle es. Ludwig. Doch dafür war es nun zu spät – er hatte hoch gespielt und verloren. Wenn, dann sollte ihn der König öffentlich begnadigen, zeigen, dass er nicht an seinen Verrat glaubte. Er wandte sich um und zwang sich dazu, seinem Freund, Staatsrat de Thou, verwegen zuzuzwinkern, der totenbleich, die Hände zum Gebet verkrampft, hinter ihm stand. »Nur Mut …«, flüsterte er ihm aufmunternd zu. »Es ist bald vorbei.«
De Thou erschrak über die Doppeldeutigkeit dieser Worte. Seit er in das versteinerte und bis auf die Knochen abgezehrte Gesicht Richelieus geblickt hatte, der sich neben dem Schafott in seiner mit rotem Samt ausgeschlagenen Sänfte nur mühsam aufrecht hielt, war ihm mit einem Schlag der Ernst der Lage klar geworden. Dies hier war kein Spiel, wie Cinq-Mars glaubte, sondern bitterer Ernst. Trotz seines schlechten Gesundheitszustandes hatte sich die rote Eminenz bis in die erste Reihe der Richtstätte tragen lassen. Sein leichenblasses Gesicht, seine fahl blickenden Augen spiegelten die Genugtuung eines letzten Triumphes. Er thronte, gehüllt in seinen hermelingefütterten Mantel, die Kräfte sammelnd, in seinem Sitz. In mühevollen Nachforschungen war es ihm endlich gelungen, den Beweis für das Komplott des Cinq-Mars mit dem Erzfeind Spanien zu erbringen. Er besaß den Vertrag mit der Unterschrift des Favoriten. Das hatte den König im Innersten getroffen, ihm gezeigt, dass Cinq-Mars nicht sein ergebener Seelenfreund war, sondern ein Feind, der ihm den Tod wünschte.
Lüstern vor Neugier reckten die Menschen die Köpfe. Keiner wusste so recht, was als Nächstes geschehen würde. Als der Karren anhielt, verstummte jedes Geräusch mit einem Schlag. »Adieu – wir sehen uns im Paradies!« Mit diesen Worten an Cinq-Mars stieg de Thou vom Wagen und erklomm als Erster die Holztreppe zum Schafott. Der Priester hielt ihm das Kruzifix entgegen und sprach den Segen über ihn aus, bevor de Thou mit gefalteten Händen auf die Knie fiel und den Kopf tief über den Block beugte. Grob riss ein Gehilfe an seinen Haaren und schnitt sie ihm über dem Nacken ab. Der Henker mit der schwarzen Kapuze zögerte einen Moment. Dann holte er weit aus. Cinq-Mars hob die Hand, als wolle er ihm Einhalt gebieten. Wo war der König, um diesen Wahnsinn zu stoppen?
Er unterdrückte einen Aufschrei, als das Beil heruntersauste und de Thous Blut nach allen Seiten spritzte. Mit offenen Mündern und angehaltenem Atem starrten die Menschen auf das blutige Schauspiel. Cinq-Mars fühlte sein Herz rasen, bewahrte jedoch Haltung. Niemand sollte sagen können, er sei feige gewesen. Wie versteinert verließ auch er den Karren und stieg langsam, einen Fuß bedächtig vor den anderen setzend, die Richtstätte empor. Er hatte begriffen. Der König würde nicht kommen, ihn zu befreien. Er war verloren. Jetzt ging es nur noch darum, seine Ehre zu retten. Wenn es so sein sollte, wollte er wie ein Held sterben, Richelieu keine Gelegenheit geben, ihn zu verspotten. Er hob die Augen zum Himmel und lächelte. Was für ein großartiges Leben hatte er gehabt! Kurz, aber voller Leidenschaft und Glut. Er klammerte sich an diesen Gedanken. Niemand bemerkte, mit welcher Gewalt er die Kiefer aufeinanderpresste, um zu verhindern, dass seine Zähne aufeinanderschlugen. Seine Augen schweiften ein letztes Mal in fiebriger Suche über die Menge. Ein letzter Rest Hoffnung flammte auf. Wo war Ludwig? Wenn er ihn in letzter Sekunde begnadigte, wäre alles nur ein schrecklicher Albtraum gewesen. Sie würden zusammen dinieren und er würde ihm erklären … ja, was eigentlich? Dass er in seiner Gier nach Macht den Bogen überspannt hatte? Kalter Schweiß trat auf seine Stirn. Er warf mit hochmütiger Miene den Kopf zurück und nahm langsam den federbesetzen Hut ab. Sein sorgfältig gelocktes Haar wehte seidig im Wind. Noch wagte niemand, ihn anzurühren. Die Trommler wirbelten mit ihren Stöcken durch die Luft. Auf dem Schafott angekommen, zögerte er und verzog angewidert das Gesicht. Die Plattform war übersät mit dem Blut seines Freundes de Thou. Panik ergriff ihn für einen Moment – doch es wäre unwürdig, jetzt Schwäche zu zeigen. Was geschehen musste, sollte geschehen. Eine große Ruhe überkam ihn. Demütig küsste er das diamantenbesetzte Kreuz auf seiner Brust und sprach mit dem Beichtvater ein letztes Vaterunser. Der Segen des Priesters, ein beinahe triumphierender Blick über die Menge, eine letzte Suche nach der Gestalt des Königs – dann legte er freiwillig den Kopf auf den Block. Wenn er jetzt sterben musste, dann sollte der Tod eine Zeremonie sein, über die man noch lange sprechen würde.
Der Henker hob diesmal das Beil mit beiden Händen. Bebten seine Arme? Ein schrecklicher Schrei stieg nach dem ersten Schlag aus Cinq-Mars’ Kehle in den Himmel. Dumpfes Gemurmel erhob sich aus der Menge. Auch Marion war ein entsetztes Aufstöhnen entfahren, sie schloss die Augen und presste das Spitzentaschentuch auf den Mund. Ihre Knie knickten ein, Tränen drangen mit einem bitteren Schluchzen durch ihre Finger und sie flüchtete ins Innere des Hauses. Oben auf dem Schafott hieb der Henker erneut zu, einmal, zweimal, immer wieder, hastig und ohne den Kopf des Delinquenten dabei vollständig vom Körper zu trennen. Seine Schläge wurden vom Gurgeln des gequälten Opfers begleitet, einem halb erstickten »Jesus Maria«, mit dem sich Cinq-Mars ein letztes Mal aufbäumte. Empörte Rufe schallten aus dem Publikum, das sich, getrieben von den zahlreichen Soldaten des Königs, nur widerwillig zerstreute.
Kardinal Richelieu hatte schon nach dem ersten Beilhieb des Henkers den Kopf gesenkt. Er fühlte würgende Übelkeit in sich aufsteigen und musste sich abwenden. Hatte man keinen anderen Henker finden können als diesen Schlächter, der nicht einmal sein Metzgerhandwerk verstand? Schuld an dem Desaster waren nur die Freunde von Cinq-Mars, die den besoldeten Henker der Stadt entführt hatten, weil sie glaubten, damit die Hinrichtung verzögern zu können. Er selbst hatte mit allen Mitteln zur Eile gedrängt, weil es dringend notwendig war, das Urteil so schnell wie möglich zu vollstrecken, bevor der König es sich anders überlegte und in seiner kindischen Affenliebe den eitlen Stutzer Cinq-Mars doch noch begnadigte! Dann hätte alles wieder von vorne angefangen, und das Staatsgebäude, so mühevoll in vielen Jahren errichtet, wäre erneut ins Wanken geraten. Für einen kurzen Moment fühlte sich Richelieu einer Ohnmacht nahe. Trotz des Fiebers, an dem er litt, der Schmerzen im Magen, in seinem Arm und seinen Gliedern, spürte er eine große Erleichterung. Die Gefahr war vorüber. Den Marquis de Cinq-Mars gab es nicht mehr – und der König war endlich von dessen schädlichem Einfluss befreit. Er gab den Trägern der Sänfte ein Zeichen zum Aufbruch.
1. Kapitel
Vergebliche Weigerung
Laut hallten die Schritte über den kühlen Marmorboden der Villa. Mit auf dem Rücken verschränkten Armen und finsterer Miene blieb der Baron di Montadori vor seiner Tochter stehen, die er in den großen Salon zitiert hatte. »Du weigerst dich also, den Marquis de Rochebonne zu heiraten?«, grollte er unheilverkündend. »Nenn mir den Grund!«
»Ich will ihn nicht!« Trotzig und zugleich empört funkelte Gabriella den Vater aus ihren sonst so sanft blickenden Augen an. Sie war ein hübsches Mädchen, zart, mit rotblonden, dichten Locken und ausdrucksvollen, dunklen Augen und Brauen. »Niemand kann mich zwingen, seine Frau zu werden!«
»Ich kann es, ungehorsames Kind.« Montadori erhob seine Stimme zu ungewohnt drohendem Klang. »Und du wirst tun, was deine Eltern wünschen. Wir haben diese Entscheidung nach genauer Prüfung getroffen. Julien de Rochebonne ist aus bester Familie und ein ernst zu nehmender Anwärter.«
»Dio mio! Jedes andere Mädchen würde Gott auf Knien danken«, jammerte die Baronin di Montadori aus dem Hintergrund, »wenn ein solcher Mann um sie anhielte …« Eine ungeduldige Handbewegung ihres Gatten ließ sie wieder verstummen.
»Sei doch vernünftig, Kind«, versuchte es der Vater in ruhigerem Ton und mit jener Diplomatie, die man im Senat von Venedig so an ihm schätzte. »Julien ist eine glänzende Partie, wie sie sich dir nie wieder bieten wird, Träger eines alten französischen Namens, gebildet und gutaussehend! Er wird einst das Amt seines Vaters im Parlament erben! Dazu hat er sich bereit erklärt, persönlich und in aller Form um deine Hand anzuhalten. Lerne ihn doch erst einmal richtig kennen …«
»Ich kenne ihn gut genug«, fiel ihm Gabriella heftig ins Wort, »diesen eingebildeten Lackaffen!« Eine Strähne ihres im Licht wie Gold schimmernden Haares hatte sich aus dem Zopf gelöst und fiel ihr wild ins Gesicht. »Ihr habt wohl schon vergessen, wie er sich aufgeführt hat, damals, als er mit seinen Eltern bei uns zu Besuch war.«
»Aber Gabriella!«, versuchte der Vater, sie zu beschwichtigen. »Da war er ja fast noch ein Kind! Inzwischen ist er ein junger Mann geworden, der …«, er suchte nach positiven Eigenschaften, die sein zukünftiger Schwiegersohn, abgesehen von seinem Titel, aufweisen könnte, und fügte hinzu, »der ganz sicher seinen Weg machen wird.« Er wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Erst vor einer Stunde war er nach anstrengenden Staatsgeschäften in Venedig auf dem Wasserweg über den Brentakanal angekommen und hatte gehofft, etwas Ruhe zu finden. Doch seine Frau bestand darauf, dass er seiner widerspenstigen Tochter einmal gehörig ins Gewissen redete. Im Grunde seines Herzens verabscheute er unerfreuliche Szenen wie diese. Gabriella war immer sein besonderer Liebling gewesen. Aber für ihn und seine Gattin war es eine Standesfrage, sich mit einem der ältesten Häuser Frankreichs zu verbinden. Die Handelsgeschäfte Montadoris in Venedig gingen gut und er hatte Einfluss im Senat – was wünschte man mehr? Der noble Name der Rochebonnes käme zu einem nicht unbeträchtlichen Vermögen. Eine bessere Partie konnte Gabriella nicht machen!
»Julien und ich passen nicht zusammen«, beharrte Gabriella eigensinnig. »Er ist oberflächlich und eingebildet.«
»Unsinn!« Die Mutter hielt es in ihrer stummen Rolle nicht mehr aus. Rote Flecken zeichneten sich auf ihren Wangen ab. »Du heiratest ihn – und damit basta!«
»Nein!« Gabriella brach in Tränen aus und stampfte heftig mit dem Fuß auf den Boden.
Die Eltern sahen einander einen Augenblick lang fassungslos an. War das noch ihr braves, stets folgsames Kind? Ein Sonnenstrahl, der sich in diesem Moment durch das geöffnete Fenster stahl, brach sich mit glitzernden Facetten im Kristall des riesigen Lüsters. Licht glitt über die Figuren der opulenten Fresken an den Wänden, ließ sie hervortreten und erweckte sie zu farbigem Leben. Es schien, als beobachteten sie amüsiert die Szene im Salon.
»Es ist doch nicht zu fassen!« Die Baronin di Montadori fand als Erste die Sprache wieder. »Alfonso, sagen Sie doch etwas!« Sie durchbohrte ihren Gatten förmlich mit Blicken. »Das kommt davon, dass Sie Ihrer Tochter immer alles durchgehen ließen.« Der Baron zuckte unter ihrem vorwurfsvollen Blick hilflos mit den Schultern.
Gabriella wandte sich mit blitzenden Augen an die Mutter. »Haben Sie denn ganz vergessen, wie sich die Rochebonnes damals benommen haben? Wie sehr Sie sich über ihre herablassende und arrogante Art geärgert haben? Sie nannten Julien damals einen verschwendungssüchtigen Nichtsnutz und seine Mutter eine eingebildete Klatschbase.«
»Ich verbitte mir deinen respektlosen Ton, Kind!« Die Baronin schnappte nach Luft. Ihre Wangen färbten sich feuerrot. »Nie habe ich dergleichen gesagt oder auch nur gedacht!«
Gabriella senkte entmutigt den Kopf. Die Mutter wollte sich schlicht nicht mehr daran erinnern, wie sehr der Sommeraufenthalt der französischen Verwandten am Riviera del Brenta an ihren Nerven gezerrt hatte. Vor allem, weil der Marquis de Rochebonne die weite Reise von Paris nicht ohne Hintergedanken unternommen hatte. Er steckte zu jener Zeit in Geldverlegenheiten und brauchte dringend ein größeres Darlehen. Das hoffte er, von seinem weitläufigen Verwandten, dem Senator, zu erhalten. Die Formalitäten zogen sich in die Länge und so harrten er und seine Familie ein paar Wochen in der Sommerresidenz der Montadoris aus. Doch das Landleben behagte ihnen gar nicht. Der Wind, der den Geruch von Dung und Stallmist in die Gemächer des Palazzo wehte, störte Madame, während ihr Gatte die Hitze unerträglich fand. Beide ließen ständig durchblicken, wie viel besser doch alles in Paris sei. Am schlimmsten hatte sich jedoch ihr Sohn Julien benommen, der sich, ganz im Gegensatz zu seinem jüngeren und ruhigeren Bruder Lukas, ständig mit dummen Streichen hervortat.
»Wir wollen diese alten Geschichten vergessen. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation«, wehrte der Senator ab. Er wünschte sich, dass dieses unsinnige Streitgespräch endlich ein Ende nahm. Vielleicht hatte er Gabriella tatsächlich zu sehr verwöhnt. Von ihren vier Kindern war sie die Einzige, die die große Pest im Jahre 1629 in Venedig überlebt hatte. »Sprechen Sie doch endlich ein Machtwort, Alfonso!«, drängte seine Gattin.
Montadori versuchte, seiner Stimme einen gewichtigen Klang zu geben. »Gabriella! Wir wollen nicht länger herumreden. Deine Heirat mit Julien de Rochebonne ist beschlossene Sache! Du wirst dich fügen müssen.«
Gabriella brach erneut in Tränen aus. Wenn sie diesen Julien heiratete, würde sie Angelo nie im Leben wiedersehen! Niemand ahnte, was der bescheidene Hirtenjunge ihr bedeutete – was sie heimlich mit ihm verband! Sie liebte ihn mehr als irgendetwas in der Welt. Als Kind war sie einmal vom Anlegesteg der Villa in den Hochwasser führenden Fluss gefallen und Angelo hatte sie herausgezogen. Anfangs war es wohl nur Neugier und ein wenig Abenteuerlust gewesen, sich von zu Hause wegzustehlen, um sich ihren Lebensretter ein wenig genauer anzusehen. Sie fand es aufregend, im Schatten der Eiche bei ihm zu sitzen, auf das Zwitschern der Vögel, das Rauschen des Flusses zu hören und die Ruhe der Natur um sich herum zu spüren. Angelos Gelassenheit, die Art, wie er sich um die Tiere kümmerte, imponierten ihr. Und plötzlich war es um sie geschehen. Unerwartet wurde sie von einem Glücksgefühl überwältigt, einer unruhigen Sehnsucht, die sie nie zuvor gespürt hatte: ihm so oft wie möglich nahe zu sein, in seine Augen zu sehen. Angelo war zum Mittelpunkt ihrer Gedanken, ihrer Träume und ihrer Wünsche geworden. In seiner Nähe leuchtete die Sonne heller, das Gras duftete würziger und manchmal hatte sie fast das Gefühl, vor Glück zu schweben. Eine endgültige Trennung von ihm war das Schlimmste, was sie sich überhaupt vorstellen konnte.
»Hör mir gut zu«, die Stimme der Mutter hatte einen entschlossenen Klang. »Wenn du dich weiter weigerst, Julien de Rochebonne zu heiraten, dann …« Sie machte eine Pause und warf einen prüfenden Blick zu ihrem Gatten hinüber, der den Kopf senkte, »wirst du den Schleier nehmen und in den Dienst der Kirche treten. Die Nonnen im Kloster Santa Maria di Vicenza können dich dann lehren, was Demut ist. Ich habe schon mit der ehrwürdigen Schwester Innocentia gesprochen. Sie freut sich darauf, dich bald unter ihre Fittiche nehmen zu können. Die Tore des Kloster stehen dir jederzeit offen.«
Gabriella zuckte zusammen. Die Vorstellung, hinter den düsteren Mauern des Klosters von Vicenza begraben zu sein, ihr Leben unter den bleich und traurig aussehenden Nonnen verbringen zu müssen, jagte ihr einen Schauder über den Rücken. »Ich gehe weder ins Kloster«, stieß sie wütend hervor, »noch heirate ich Julien de Rochebonne. Lieber nehme ich den erstbesten Mann von der Straße!« Hastig rannte sie die schmale Wendeltreppe hinauf, die zu ihrem Zimmer führte. Minna, die behäbige Amme Gabriellas, die abwartend mit einer Stickerei in der Ecke gesessen hatte, erhob sich so rasch, wie es ihr schwerer Körper erlaubte, um ihr zu folgen.
»Alfonso«, hauchte die Baronin mit ersterbender Stimme und presste die Hand auf ihr Herz. »Haben Sie gehört, was dieses ungezogene Kind gesagt hat? Den erstbesten Mann von der Straße …« Sie schwankte und sank in die Arme ihres Mannes, der sie geschickt auffing und vorsichtig zu einem Sessel geleitete.
***
Paris, Palais Cardinal
»Wer da?« Das Zufallen der Kellertür und die schweren Schritte, die sich von oben näherten, zwangen Ruggiero Gianoni, den beleibten Mundschenk Kardinal Richelieus, auf der steilen Steintreppe stehen zu bleiben. »Wer da?« In seiner Stimme, die von den feuchten Wänden hallte, schwang ein leises Zittern. Den gefüllten Weinkrug im Arm, blinzelte er schwer atmend nach oben. Wahrscheinlich hatte er beim Hinuntergehen nicht hinter sich abgeschlossen. In seinem Alter vergaß man das manchmal. Richelieu hatte Fremden das Betreten seines Weinkellers strengstens untersagt. Nur mit besonderer Erlaubnis durfte ihm bei größeren Banketten Bruder Hieronymus helfen. Mit der Zeit war es nämlich immer beschwerlicher für Gianoni geworden, die schweren Krüge aus dem Weinkeller zu holen und sie hinauf zur Tafel des Kardinals zu schleppen. Doch er beklagte sich nicht über sein Amt, es war eine Vertrauensposition und er war noch nicht gewillt, den Schlüssel zum Weinkeller einem anderen zu übergeben.
Er kniff die Augen zusammen und versuchte, im Schein der flackernden Öllichter an den Wänden den Mann in der Mönchskutte, der Stufe für Stufe hinabschritt, zu erkennen. Die hagere Gestalt warf einen langen Schatten an die Mauer. »Bist du es, Bruder Hieronymus?« Gianoni hob die Kerze höher. Seine feisten Züge verzerrten sich im selben Moment zu einer Fratze. »Ihr? Schert Euch hinaus!«, stieß er mit erstickter Stimme hervor. »Es ist Euch nicht erlaubt, des Kardinals Weinkeller zu betreten!« Der Mann in der Kutte schob die Kapuze vom Kopf und streckte die Hand aus. »Lasst mich zufrieden«, schrie Gianoni zurückweichend. Der Ton seiner dumpf hallenden Stimme scheuchte eine fette Ratte auf, die zwischen seinen Beinen in einem Schlupfloch der Mauer verschwand. »Geht … macht Euch freiwillig fort … der Kardinal versteht in dieser Hinsicht keinen Spaß. Ich bitte Euch«, stammelte er jetzt, den silbernen Krug mit dem edlen Burgunder auf die Treppenstufe hinter sich stellend, so als wollte er den kostbaren Wein vor dem Mönch schützen. »Wir haben nichts mehr miteinander zu schaffen! Verschwindet … bevor Euch jemand von der Garde des Kardinals sieht. Ich komme in große Schwierigkeiten. Niemand außer mir hat hier Zugang!«
»Ihr könntet doch mal eine Ausnahme machen!« Der Mönch grinste höhnisch und rückte näher. »Es soll Euer Schaden nicht sein.«
»Nein«, stöhnte Gianoni auf, »nicht für alles Gold der Welt, das habe ich Euch doch schon gesagt. Was wollt Ihr von mir?«
»Euch tragen helfen, Bruder – nichts weiter«, die sanfte Stimme klang ein wenig maliziös. Sie war das Letzte, was der Mundschenk hörte, bevor ihn ein heftiger Stoß gegen die Brust den Halt verlieren ließ und er rückwärts die steile Treppe hinunterstürzte. Den stechenden Schmerz, der seinen Schädel auf der Kante eines Steins am Fuße der Treppe spaltete, spürte er nur kurz.
***
Kardinal Richelieu, mit dem Rücken zum Kamin an der Tafel sitzend, sah verwundert auf und schob seinen Teller mit dem getrüffelten Bresse-Hähnchen in Armagnac beiseite. »Wer bist du? Und wo ist Gianoni, mein Mundschenk?« Er tupfte sich den Mund mit der Serviette ab und musterte den dunkelhaarigen Mann in der schlichten Kutte, der den silbernen Weinkrug trug, prüfend. Der Eintretende verbeugte sich devot. »Exzellenz geruhen gnädigst, heute mit mir Vorlieb nehmen zu wollen. Mein Vetter Ruggiero Gianoni ist unpässlich und bat mich, ihn heute zu vertreten. Ich besitze sein volles Vertrauen – und hoffe, mir auch das Eurer Eminenz zu erwerben. Hier, er hat mir ein paar Zeilen für Euch mitgegeben.« Er reichte ihm ein Schriftstück.
»Gianoni ist unpässlich? So plötzlich?« Der Kardinal nahm den Brief, las ihn und sah ihn dann fragend an. »Wie ist dein Name?«
»Pirelli, Maurizio Pirelli, Mönch im Zisterzienserkloster zu Paris. Mein Vetter war besorgt. Man sagt, die Pocken gingen um – und deshalb wollte er Eure Exzellenz nicht unnötig in Gefahr bringen. Und da meine Weinkenntnisse nicht unbeträchtlich sind …«
»Ich verstehe«, unterbrach ihn der Kardinal kühl. »Walte deines Amtes. Ich hoffe, du hast einen guten Tropfen ausgewählt. Meine Arbeit wird mich noch bis nach Mitternacht hier festhalten. Und vergiss nicht, die Probe zu nehmen – wie gewöhnlich.« Er sah den Mönch mit leichtem Misstrauen an. »Hat dir das dein Vetter nicht gesagt?«
»Selbstverständlich.« Diensteifrig füllte der neue Mundschenk mit leisem Gluckern zwei Gläser. Richelieu lehnte sich zurück. Die weiße Angorakatze unter dem Tisch hatte nur auf diese Gelegenheit gewartet. Sie sprang auf seinen Schoß und schmiegte sich in die Falten der roten Samtsoutane. Mit seiner feingliedrigen, nervösen Hand strich Richelieu über das weiche Fell. Die Wärme des Tieres, sein behagliches Schnurren beruhigten ihn. Der Burgunder in der schweren Kristallkaraffe schimmerte blutrot wie ein kostbarer Edelstein. Wein zum Abendessen war dem Kardinal eine gute Gewohnheit geworden, trank er doch tagsüber nur Wasser. Er regte seine Gedanken an. Unter den Augen des Kardinals leerte der Mönch gewissenhaft eines der Gläser in einem Zug.
»Monseigneur!« Ein junger Page im blassblauen Wams eilte ohne anzuklopfen herbei und verneigte sich ehrerbietig. »Verzeiht die späte Störung. Aber ich habe eine dringende Nachricht. Sie kam gerade durch einen Eilboten aus Saint-Germain.« Der Kardinal verzog das Gesicht, als er die Schriftrolle erblickte, die das Siegel des Königs trug und nahm sie entgegen. In diesem kurzen Augenblick der Unachtsamkeit Richelieus berührte der Mönch eine Öse seines auffallenden Rubin-Ringes, den er an der linken Hand trug. Der Stein klappte auf, ein weißes Pulver fiel aus seiner Höhlung in das Glas des Kardinals und löste sich sofort im Wein auf.
Richelieu nestelte ungeduldig am Siegel der Schriftrolle, nachdem er kurz mit dem Gedanken gespielt hatte, die Nachricht bis zum nächsten Morgen zu ignorieren. Sein Diener könnte ausrichten, ihm sei unwohl und er habe sich schon zu Bett begeben. Er holte tief Luft. Es war besser, dem König zu gehorchen, auch wenn es manchmal nur um banale Streitereien zwischen ihm und seinem launischen Favoriten Henri de Cinq-Mars ging. Er legte den Brief beiseite. Statt ihn zu lesen, hob er das edel geschliffene Kristallglas und hielt es gegen das Licht. Der rote Wein schimmerte wie das Blut der halsstarrigen Hugenotten aus La Rochelle, die sich Ludwig XIII. damals nicht hatten unterwerfen wollen. Es hatte sich gelohnt, an der Seite des Königs für den Frieden Frankreichs zu kämpfen – und er würde es auch weiter tun.
Der Mönch beobachtete ihn gespannt. Seine Hand, die die Kristallkaraffe hielt, zitterte plötzlich. Doch ohne mit den Lippen das Glas berührt zu haben, stellte Richelieu es mit einem Seufzer des Bedauerns wieder zurück. Es war besser, einen klaren Kopf zu behalten, denn vor dem König musste er jedes seiner Worte genau abwägen. »Geh! Lass mich allein!«, fuhr er den Mundschenk scharf an, der versuchte, seine Bestürzung zu verbergen. Konnte es möglich sein, dass Gott diesen Mann schützte? Warum trank er nicht? Würde auch dieser Anschlag wieder ins Leere laufen? Er zwang sich zur Geduld. »Ich brauche dich nicht mehr und bediene mich selbst. Lass den Krug hier stehen«, milderte Richelieu seine Schroffheit leicht ab, und dem Mönch blieb nichts anderes übrig, als sich tief zu verbeugen und die Tür hinter sich zuzuziehen.
Richelieu straffte seinen Rücken, während seine Gedanken nach dem Grund der unerwarteten Order des Königs suchten. Er betrachtete die Schriftrolle wie ein abstoßendes Objekt. Hatte er einen Fehler gemacht? Er fühlte, wie sein Pulsschlag sich beschleunigte. Immer lebte er in der Angst, der König könnte etwas an ihm auszusetzen haben, ihn eines Tages ohne großes Bedauern fallen lassen oder auch ohne Skrupel ins Jenseits befördern, wie vor Jahren Concini, den Marschall d’Ancre. Obwohl ihm jede Arbeitsunterbrechung um diese abendliche, ihm so kostbare Zeit zutiefst zuwider war, entrollte er schließlich das Schriftstück. Stirnrunzelnd las er die mit unsicherer Hand hingeworfenen Zeilen, die wie ein Hilfeschrei und ein Befehl zugleich wirkten: Mon Cardinal! Ich erwarte Euch noch heute Abend, da ich Euren Rat brauche! Der Marquis de Cinq-Mars hat mich gerade verlassen, im Zorn ohne ein Wort der Entschuldigung. Er war ausser sich und schwor mir, nie wiederzukommen! Ihr müsst ihn aufhalten, ihn mir zurückbringen. Auf der Stelle …
Er … er … er! Der Kardinal presste peinlich berührt die Lippen zusammen. Immer war es er, Henri de Cinq-Mars, der Favorit, der das Denken und die Gefühle des Königs in Anspruch nahm und für ständige Skandale sorgte. Diese Art Nachrichten waren unerträglich, eines Monarchen nicht würdig! Alles drehte sich um diesen kleinen, eitlen Niemand, der mit seinen Launen den König terrorisierte und in Zustände schwarzer Melancholie stürzte. Manchmal gab sich Richelieu selbst die Schuld. Warum hatte er damals die ganze Sache eingefädelt und den hübschen jungen Mann, den Sohn seines besten Freundes, des Marquis d’Effiat, Marschall von Frankreich, dem König vorgestellt? Es war ein Fehler gewesen. Henri schien ihm geeignet, gut erzogen, manipulierbar und gehorsam, der ideale Spion, den er in der Umgebung des Königs einsetzen konnte. Doch sein sorgfältig ausgeklügelter Plan war nicht aufgegangen. Der schwermütige, durch seine Krankheit frühzeitig gealterte König hatte schon nach kurzer Zeit einen Narren an dem neuen Höfling gefressen. Der charmante und vor Lebenslust sprühende Cinq-Mars schien ihm seine Jugend zurückzubringen. Jeder in Paris, bis auf den letzten Gassenjungen, amüsierte sich mittlerweile über die Abhängigkeit des Königs von seinem »Cher Henri«. Und diesem war die Favoritenrolle ganz gehörig zu Kopf gestiegen. Im Staatsrat beklagte man seine unersättliche Verschwendungssucht, die prunkvolle Kleidung und seinen Ehrgeiz, die begehrtesten Posten und Schenkungen zu erhalten. Erster Rittmeister, Grand Écuyer von Frankreich – nichts schien für ihn unerreichbar zu sein. Der Kardinal zog die Mundwinkel herab. Macht und Glanz – dieser vergnügungssüchtige Bursche ohne besondere Talente griff nach den Sternen.
Ärgerlich zerknüllte Richelieu das Papier in seiner Hand. Als wenn er nichts anderes zu tun hätte, als seine Abende damit zu verbringen, die beiden Streithähne wieder zu versöhnen! Im Land gab es ganz andere Probleme zu lösen! Er schob das Weinglas weit von sich, als der fruchtige Duft seines Inhalts allzu verlockend in seine Nase stieg. Nach einem solchen Brief war ihm nicht mehr danach, sich diesen Genuss zu gönnen. Im Gegenteil, jetzt galt es, hellwach zu sein. »Du kannst abräumen«, er winkte dem Pagen Jacques, der sich beeilte, seiner Aufforderung nachzukommen. Der Junge hatte erst vor Kurzem seinen Dienst beim Kardinal angetreten und war noch ein wenig unsicher in der Erfüllung seiner Aufgaben. Sorgsam stellte er das gefüllte Glas und den Weinkrug auf ein Tablett. Auf dem Weg durch das Servierzimmer sah Jacques sich nach allen Seiten um. »Schade drum«, dachte er und kostete vorsichtig etwas aus dem Glas mit dem edlen Tropfen. Der Wein schmeckte mild, er war von köstlichem Beeren-aroma mit einem leicht bitteren Akzent. Bevor er alles auf der Anrichte abstellte, nahm er hastig noch einen weiteren Schluck. Eigentlich würde es ja niemand merken, wenn er es ganz austrank! Ah, das ging direkt ins Blut! Was für einen feinen Geschmack die hohen Herren hatten! So ein Trank, der machte leicht, frei und heiter! Er spürte, wie der Wein ihm in den Kopf stieg. Doch zugleich wurden seine Beine eigentümlich schwer, so schwer, dass er sie kaum mehr heben konnte. Der Page hörte die Klingel, mit der der Kardinal ihn rief, jetzt wie durch einen Watteschleier und drehte sich um. Warum waren seine Füße plötzlich so taub? Er konnte kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen, sie schienen aus Blei und brachten ihn nicht vom Fleck. Er taumelte, von einem seltsamen Schwindel ergriffen, in den Salon und öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Mitten im Satz wurde ihm übel, Schaum trat auf seine Lippen, er rang nach Luft und sackte direkt vor Richelieus Füße.
Der Kardinal warf einen entsetzten Blick auf das verzerrte Gesicht des Pagen und wich zurück. Dann ergriff er noch einmal die silberne Klingel, deren lauter, anhaltender Ton jetzt wie ein Warnsignal durch die Räume des Palais Cardinal schrillte. »Ruft meinen Leibarzt – er soll sich um ihn kümmern«, befahl er den Bediensteten, die herbeistürzten und den Pagen forttrugen. Richelieu ging in sein Arbeitszimmer und nahm hinter seinem Schreibtisch Platz. Schweiß stand auf seiner Stirn und er stützte den Kopf in die Hand. Was bedeutete das? Als er aufsah, stand Pater Joseph, sein Adlatus vor ihm. »Der Knabe ist tot«, sagte der mit trockener Stimme. »Man hat ihn vergiftet!« Er hielt das leere Glas des Kardinals in der Hand, auf dessen Grund ein feiner weißer Satz schimmerte. »Eure Eminenz, ich hoffe, Ihr habt nicht aus diesem Glas getrunken!«
Richelieu schüttelte angewidert den Kopf. »Durch Zufall nicht. Ich befahl dem Pagen, es fortzutragen. Vielleicht hat er ja davon getrunken. Ruft mir diesen Mönch … diesen Pirelli her, der mich bedient hat.«
»Pirelli?« Unsichere Blicke und Schulterzucken der umstehenden Diener antworteten ihm. »Wir kennen keinen Pirelli – haben ihn nie zuvor gesehen. Der Mann, der heute Abend serviert hat, behauptete, Eure Exzellenz habe ihn persönlich zu seiner Bedienung bestellt.«
»Unsinn!« Der Ton des Kardinals wurde schärfer. »Er sagte, Gianoni sei sein Vetter und der wäre erkrankt. Wo ist Gianoni? Sucht ihn. Er soll mir Rede und Antwort stehen. Und schafft diesen sogenannten Pirelli herbei! Lebend oder tot! Ich setze eine Belohnung von tausend Livre auf sein Ergreifen aus.«
***
Die Kutsche rumpelte in vollem Tempo durch die dunkle Nacht. Die beidseitigen Fackeln erhellten den Weg nur spärlich. Henri de Cinq-Mars hatte dem Kutscher Anweisung gegeben, die Pferde den ganzen Weg nach Paris galoppieren zu lassen. Die Sehnsucht trieb ihn, jede Minute der kostbaren Zeit des Zusammenseins mit seiner Geliebten Marion Delorme zu nutzen. Schon im Morgengrauen musste er wieder zurück in Saint-Germain sein. Um überhaupt fortzukommen, hatte er einen kleinen Streit mit dem König inszeniert. Aber Ludwig würde ihn sicher wie üblich wieder zur Morgenmesse erwarten und den ganzen Tag über nicht aus den Augen lassen. Eine gewagte Abkürzung nehmend, jagte er das Gefährt jetzt gefährlich schwankend durch die engen Gassen des Marais direkt zur Place Royal. Marion erwartete ihn heute zwar nicht, aber er hoffte, dass sie sich freuen würde, ihn zu sehen. Das luxuriöse Palais, das der Herzog von Bellegarde, dessen offizielle Geliebte sie für eine Weile gewesen war, ihr als Abschiedsgeschenk überlassen hatte, war hell erleuchtet. Heute war Dienstag, einer der Tage, an denen die schöne Kurtisane regelmäßig ausgewählte Freunde und Verehrer aus dem Adel empfing, die sich um die Spieltische drängten und um hohe Summen spielten. Cinq-Mars atmete auf. In dieser lockeren Gesellschaft würde der Druck von ihm abfallen, könnte er seine Sorgen, das Misstrauen des Königs und die Strafpredigten seines sogenannten Wohltäters, Kardinal Richelieu, vergessen.
Bereits in der Vorhalle hörte er gedämpftes Lachen und Schwatzen der Gäste, die sich in den mit wertvollen Antiquitäten ausgestatteten Räumen drängten. Er trat ein und sein Blick schweifte suchend umher. Marion stand, umringt von anderen Kavalieren, am Spieltisch. Sie sah bezaubernd aus. Ihr perfekt geschnittenes Gesicht leuchtete heiter und in ihren dunklen, kunstvoll aufgesteckten Haaren glitzerte ein Diadem. Wie eine Königin, dachte Cinq-Mars, überflutet von einer Welle heißer Sehnsucht. Er blieb am Eingang stehen, nahm das Glas Champagner, das der Diener ihm reichte, und wartete ungeduldig darauf, dass sie ihn bemerkte. Und wirklich, als spüre sie seine Anwesenheit, sah sie zu ihm hinüber. Er fand sie begehrenswert wie nie, in einem transparenten, mit Glitzerfäden durchwirkten Gewand, das Hüften und Brüste durchschimmern ließ. Unmerklich erhob er sein Glas, um ihr zuzutrinken und spürte, wie sein Blut schon durch ihren Anblick heftig in Wallung geriet. Jedes Mal wirkte sie anders, verzauberte ihn mit der unnachahmlichen Grazie ihres sinnlichen Körpers und der Schönheit ihres makellosen Gesichtes. Sie kam auf ihn zu und Henri legte sanft, aber besitzergreifend seinen Arm um ihre schmale Taille. »Komm!«, flüsterte er ihr mit vor Begehren rauer Stimme ins Ohr. »Ich sehne mich so sehr nach dir, dass ich keine Sekunde mehr warten kann!«
»Oh, Henri! Die ganze Woche hoffte ich, dass du kommen würdest.« Ein schmerzlich fragender Zug war plötzlich in ihr Gesicht getreten. »Ich habe schon an deiner Liebe gezweifelt.«
Henri verzog das Gesicht. »Unsinn! Ich habe dir doch erzählt, wie der König mich schikaniert! Mir jede Minute vorschreibt. Diesmal war er krank und verlangte, ich müsse bei ihm schlafen. Es war sehr schwierig, ihm endlich zu entwischen.«
»Dann bin ich froh, dass du jetzt bei mir bist, Liebster. Nichts und niemand kann uns trennen. Kein König und kein Kardinal.« Sie beugte sich näher zu ihm und flüsterte mit schmachtender Stimme: »Ich liebe dich so sehr!« Mit leichtem Druck schob sie ihre Hand in die seine. Zwischen seinen Fingern fühlte Henri das kalte Eisen eines Schlüssels.
Ohne Zeit zu verlieren, verließ er den Saal und stürmte erwartungsvoll die kleine enge Treppe empor, die hinter einer Tapetentür des Vorraums direkt in die Privaträume Marions führte. In einem von Silberkandelabern matt erhellten Raum, in dem ein loderndes Kaminfeuer eine geradezu erstickende Wärme verbreitete, waren die schweren Brokatvorhänge zugezogen. Unsichtbare Hände hatten kristallene Karaffen mit rotem Wein bereitgestellt, süßes Konfekt und Früchte. Felle und weiche Kissen lagen wie zufällig verstreut auf einem orientalischen Teppich und einem luxuriösen Canapé. Es war das übliche Bild und Henri verdrängte den Gedanken, dass diese Vorbereitungen nicht nur für ihn allein getroffen waren, sondern allen Verehrern Marions zur Verfügung standen. Seine Geliebte war die gefragteste Kurtisane von Paris – das hatte er immer gewusst –, und er war stolz darauf, ihr Herz erobert zu haben. Er legte Wams und Gürtel ab, nahm eine Karaffe, goss rubinroten Wein in ein Glas und trank es in einem Zug leer. Es war schwerer Tokaier, der ihm sofort in den Kopf stieg und seine Lust anfachte.
Endlich war draußen Marions leichter, federnder Schritt zu vernehmen und er riss die Tür auf. Sekunden später hielt er ihren biegsamen Körper in seinen Armen, bedeckte ihren Hals und ihre Schultern mit heißen Küssen und verbarg sein Gesicht in ihren duftenden Locken. Der leichte, durchsichtige Stoff ihres Kleides raschelte, als seine Hände über ihren Körper glitten und er darunter ihre nackten Hüften und Brüste ertastete. Ungeduldig streifte er das Kleid von ihren Schultern und zog sie mit sich auf das flauschige Fell vor dem Kamin. Seine Augen glitten genießerisch über ihren perfekt gepflegten, duftenden Leib. Es war der Körper eines jungen Mädchens mit kleinen, wohlproportionierten Brüsten und der Grazie einer Tänzerin. Alles an ihr schien von perfekter Harmonie zu sein: ihr zartes Gesicht, um das sich ein paar aufgelöste Locken ringelten, darin die dunkel umrandeten Augen und der herzförmige Mund und auch die kleinste Geste ihrer Gesten, vom Augenaufschlag bis zum verführerischen Blick, ihrem Lächeln und sanftem Neigen des Kopfes. Dem lockenden Glanz ihrer Ausstrahlung waren schon viele Männer erlegen und manch einen hatte sie dabei sogar in den Ruin getrieben. Marion begann, die mit Brillanten besetzten Knöpfe seines Hemdes zu lösen und ließ dabei ihre Hand zärtlich und wie mit einem Hauch über seine Brust gleiten. Cinq-Mars erschauerte, als sie langsam tiefer glitt. Die Nähe der im Kamin züngelnden Flammen erhitzte seinen Körper und der Sturm der Sinne, der ihn bei Marions Liebkosungen packte, ließ ihn jegliches Gefühl für Zeit und Raum vergessen. Es gab nur noch die Geliebte, die er jetzt mit glühender Innigkeit an sich presste.
»Ich habe dich so unendlich vermisst«, stöhnte sie, berauscht von jener sinnlichen Verzückung, die auch sie nur in den Armen Henris empfand. Er verschloss ihr den Mund mit seinen Küssen und liebte sie mit einer Wildheit, die sie noch nie zuvor an ihm erlebt hatte. Erschöpft sank er schließlich neben ihr nieder. Mattigkeit legte sich auf seine Augenlider wie ein schweres Gewicht und ließ die Flamme der Erregung für kurze Zeit erlöschen. »Liebst du mich?«, flüsterte Marion die ewige Frage. Sie legte den Kopf zurück und sah ihn unter gesenkten Lidern an.
»Wäre ich sonst hier?« Henri versuchte ein Lächeln und beugte sich über sie, um ihren Atem zu spüren. »Kein Weg ist mir zu weit – wenn ich dich nur wenige Minuten in den Armen halten kann.« Er küsste sie innig auf den Mund. »Ich bin süchtig – nach deinem Körper, nach deinem Duft – nach dir!« Marion lächelte. Das flackernde Feuer tauchte ihre hell schimmernde Nacktheit in ein warmes Licht und verlieh ihrem offenen Haar schwarzglänzende Reflexe. »Wie schön du bist«, murmelte er versonnen und sog den Duft des sinnlichen Lilienparfüms ein, der ihrem Körper entströmte.
»Ich fürchtete schon, du hättest mich satt«, seufzte Marion, »es gibt Gerüchte, dass du eine andere liebst.« Sie stützte sich auf die Ellenbogen, um ihn anzusehen. Das Kerzenlicht verlieh ihren Augen Glanz und eine beinahe hypnotische, bläuliche Tiefe.
»Gerüchten soll man niemals glauben«, wich Henri aus, »das weißt du doch!« Marions Worte hatten den Zauber des Augenblicks kurz durchbrochen. Er unterdrückte ein Gähnen.
»Aber was ist mit deinem Versprechen, mich zu heiraten?«, fragte sie leise. »Wirst du wirklich den Mut haben, zu mir zu stehen – gegen alle Widerstände? Mich zu deiner Frau machen?«
»Reden wir doch jetzt nicht davon«, Cinq-Mars wandte den Blick ab. »Wir haben so wenig Zeit.«
»Aber ich möchte die Wahrheit wissen. Seit Langem haben wir dieses Thema nicht mehr berührt …«
Henri rückte ein wenig von ihr ab. Er atmete tief ein, bevor er ansetzte: »Ich hätte es dir längst sagen sollen, Liebste! Aber ich wollte dich schonen. Denn die Wahrheit ist bitter. Glaub mir, ich habe alles versucht – aber es war umsonst. Der Kardinal hat alle Hebel in Bewegung gesetzt – den König über unsere Pläne informiert.« Hastig fügte er hinzu. »Und er hat mir gedroht, mich vom Hof zu jagen, wenn ich darauf bestünde …« Er machte eine Kunstpause. »Es war ein schöner Traum …«
»Wohl zu schön, um wahr zu sein«, seufzte Marion enttäuscht. »Der Kardinal ist eifersüchtig …«
»Ja, aber er hat ein eisernes Herz und eine blutige Faust.«
»Dieser Ränkeschmied denkt nur an sich«, fuhr Marion auf. »Wenn ich nur dir gehörte, könnte er mich nicht mehr besitzen. Oft genug schickt er nach mir. Dann muss ich ihm zu Willen sein.« Betrübt ließ sie sich wieder zurücksinken und starrte gegen die Decke. »Eine Frau wie mich heiratet man eben nicht; man schläft mit ihr und …« Sie konnte nicht weitersprechen, ihre Stimme brach und ihre Mundwinkel zuckten.
»Aber ich liebe dich doch trotz allem, meine süße Marion«, sagte Henri tröstend. »Ich begehre dich mehr als jede Frau, die ich jemals gekannt habe. Das wird sich nie ändern!« Leise aufschluchzend schmiegte sie sich an ihn. Henri fühlte, wie ihre weichen nackten Brüste sich gegen ihn pressten, und die Lust, sie erneut zu besitzen, flammte in ihm auf. Er küsste sie und seine Hände glitten wieder so zärtlich über ihren Körper, als habe er noch nicht jede Einzelheit erforscht. Die fast erloschenen Kerzen, das heruntergebrannte, von Zeit zu Zeit leise zischende Kaminfeuer tauchten den von betörenden Blumendüften durchtränkten Raum in ein sinnliches Halbdunkel. Trunken vor Liebe sanken sie gemeinsam auf das weiche Pantherfell, das der einstige Geliebte Marions, der Marschall de Balbes, ihr von einer Asienreise mitgebracht hatte. Ihr Liebesspiel begann aufs Neue, wurde zu einem leidenschaftlichen Tanz, bei dem man nicht wusste, wer eigentlich führte. Wieder zu Atem gekommen, bettete Henri den Kopf an ihre Brust.
»Du verstehst es, zu verführen, Chéri«, flüsterte sie ihm zu. »Man kann dir einfach nicht widerstehen. Du hast die Gabe, Menschen zu bezaubern. Sogar den König.«
»Den König?« Cinq-Mars schloss erschöpft die Augen. »Du solltest seinen Namen in diesem Augenblick nicht nennen. Er glaubt, dass man Liebe erzwingen kann. Aber das ist unmöglich«, murmelte er schläfrig. Eine ganze Weile herrschte Ruhe, man hörte nur das Knistern der Holzes im Kamin.
»Sind wir uns nicht irgendwie ähnlich?« Henri öffnete die Augen und sah Marion fragend an. »Wir haben den gleichen, mitleidlosen Lebenshunger – und zugleich eine unerklärliche Anziehung auf Menschen, die uns besitzen wollen.« Sie lachte leise auf.
»Niemand kann einen anderen besitzen«, murmelte Henri. Er streckte und reckte sich. »Wir sind frei! Und wir lieben uns! Darauf sollten wir ein Glas trinken.« Marion nickte, erhob sich geschmeidig und langsam wie eine schläfrige Katze und ging mit wiegenden Hüften zu dem kleinen Tischchen, auf dessen Brokatdecke zwei Kristallgläser und der Pokal mit Wein standen. Sie füllte sie bis zum Rand und reichte Henri eines davon.
»Hat es dich jemals gerührt, wenn Männer zu deinen Füßen schmachteten«, fragte Henri und leerte sein Glas in einem Zug, »wenn sie sich deinetwegen duellierten oder finanziell ruinierten?« Marion sah träumerisch in die Kerzenflamme.
»Warum sollte es mich rühren? Die Liebe ist für mich eine Kunst, die mir Luxus und Abwechslung verschafft. Ich habe meinen Preis und ich biete etwas dafür.« Sie legte sich neben Henri. »Etwas, das so sorgfältig aufgebaut ist wie ein Theaterstück – das alte Spiel von Sinnlichkeit und Wollust. Meine Freier sollen bei mir spüren, dass es eine schönere Welt jenseits des Alltags gibt, ein erotisches Reich, in das sie jederzeit eintauchen können.« Die Arme hinter den Kopf schiebend, räkelte sie ihren Körper auf den orientalischen Kissen. »Nur mit dir ist es anders – da spüre ich mein Herz pochen und meine Seele vor Sehnsucht vergehen …«
Sie schwieg, als sie bemerkte, dass Cinq-Mars nicht mehr zuhörte, weil er von einer Minute auf die andere in das Reich der Träume hinübergewechselt war. Es klang so einfach, die Liebe wie eine Kunst zu zelebrieren. Aber was war mit der dunklen Seite dieser Kunst? Den abgebrochenen Schwangerschaften am Rande des Todes, der Angst vor Krankheiten und vor dem Alter? So etwas konnte man nur mit starken Mitteln und Drogen von sich fernhalten. Sie betäubten Kummer und Schmerz und ließen eine Welt erstehen, in der Traum und Wirklichkeit miteinander verschmolzen. Sie verjagten die trüben Gedanken, die grauen Gespenster der Gegenwart. Sie erhob sich behutsam, um Cinq-Mars nicht zu wecken, und zog an der Schnur an der Wand, die ein Signal im Vorzimmer auslöste. Eine Dienerin eilte geräuschlos mit einem Tablett herbei und reichte ihr einen Kelch, aus dem sie einige Schlucke nahm. Es war eine Mischung aus frischen Säften und einem Schuss Opium, der das Zittern ihrer Nerven und die Beklemmung ihres Herzens beschwichtigte. »Ich bin für niemanden zu sprechen!«, murmelte sie schläfrig und hüllte sich in eine bereitliegende Felldecke. Die Dienerin legte neue Holzscheite in den Kamin, nahm das leere Tablett und verließ auf Zehenspitzen den von schwüler Sinnlichkeit erfüllten Raum. Unsere Liebe ist einzigartig, dachte Marion, ihren Kopf an der Brust Henris bettend. Niemand kann uns jemals trennen. Keine andere Frau – nicht einmal der König.
***
Der mysteriöse Mönch, der sich Pirelli genannt hatte, war weder im Palais noch im Kloster der Zisterzienser zu finden und schien wie vom Erdboden verschluckt. Am Fuße der Treppe zum Weinkeller fand man stattdessen den verunglückten Mundschenk Gianoni in einer Blutlache liegend. Der herbeigeeilte Leibarzt des Kardinals konnte nur seinen Tod feststellen. Der junge Page Jacques wurde aber eindeutig mit einer schnell wirkenden Substanz vergiftet.
Unruhe breitete sich im Palais aus. Richelieu war der Einzige, der gelassen blieb, wiewohl ihn der Tod Gianonis und des armen Jungen hilflos und zugleich wütend machte. Wieder ein Attentat auf ihn, bei dem Unschuldige die Opfer waren. Eines von Dutzenden in den letzten Jahren, in denen man versuchte, ihn auf irgendeine Weise vom Leben zum Tod zu befördern. Sein Kopf schmerzte und er versuchte, seine Feinde und deren Handlanger in Gedanken durchzugehen. War es wieder der Herzog von Orléans gewesen? Oder ein anderer der renitenten Fürsten, denen es nicht passte, sich seinen Verordnungen und strengem Diktat zu beugen? Viele waren gegen ihn, wollten ihn von seinem Posten des Ersten Ministers und engsten Vertrauten des Königs drängen. Sie dachten sich die unsinnigsten Vorwürfe aus. Dass er den König manipulierte und nur selbst regieren wollte. Dabei würde er es niemals wagen, auch nur eine einzige Entscheidung ohne die Zustimmung des Königs zu treffen! Aber der launische Monarch war unsicher und man wusste nie, was wirklich in ihm vorging. Er schien aber genau zu wissen, wie unentbehrlich sein Erster Minister für ihn war – auch wenn ihn das manchmal verdross. Richelieu grübelte weiter. Angst – das war etwas, was er nicht zuließ. Aber er wollte wenigstens wissen, woran er war.
»Es ist eingespannt, Monseigneur!«, meldete der Diener. Die Leibwache der Musketiere saß bereits zu Pferd und die Kutsche fuhr vor. Fröstelnd schlug Richelieu den Pelz um seine Schultern und stieg ein. »Nach Saint-Germain«, befahl er kurz angebunden und der Wagen rollte los.
»Wo bleibt Ihr denn so lange, mon Cousin?« Der König eilte auf ihn zu und ergriff seine Hand. Ohne eine Antwort abzuwarten, stieß er, von heftigen Empfindungen bewegt, hervor: »Ich habe überall nach Cinq-Mars gesucht, doch er ist nicht da. Ich befürchte, er ist nach Paris gefahren.« Vorwurfsvoll starrte er Richelieu an. »Ich dachte, Ihr lasst ihn überwachen!«
»Eure Majestät – selbstverständlich wird er beobachtet. Aber man kann ihn ja nicht zwingen …« Hilflos brach er ab.
»Nicht zu dieser Hure zu gehen?«, unterbrach ihn der König und drückte das Taschentuch in seinen Händen zusammen. »Ich weiß es – er ist bei ihr. Er meint, er kann mich täuschen. Aber meine Ahnung hat mir sofort gesagt, dass diese Kurtisane dahintersteckt.« Gequält hielt er inne. »Er wagt es, sich mit einer solchen Frau zu beschmutzen! Betrügt mich – mich, seinen König!«
Richelieu senkte den Kopf und der König lamentierte weiter: »Er weiß genau, dass ich früh schlafen gehe, und nutzt das aus. Bei Einbruch der Nacht verschwindet er und kehrt erst am Morgen zurück. Und dann dieser Streit – ich kann es nicht ertragen, wenn er mit mir schmollt!« Er öffnete mit einem Ruck das Fenster und sah hinaus, als könne die zurückkehrende Kutsche von Cinq-Mars jeden Moment in den Hof einfahren. Doch dort und auf der entfernten Allee war es ruhig. Pechfackeln brannten und die Wache patrouillierte mit regelmäßigen Schritten vor dem düsteren, altmodischen Bau des Schlosses von Saint-Germain-en Laye. Den König befiel ein Schauder. Richelieu trat neben ihn. »Ihr werdet Euch erkälten, Majestät. Bedenkt, Cinq-Mars ist ein junger Mann und …«
»Da!«, unterbrach ihn Ludwig und lauschte fiebrig. »Hört Ihr?« Von irgendwoher ertönten Räderrollen und Schnauben der Pferde. »Das ist er … es ist sein Wagen! Er jagt die Pferde.« Die Stimme des Königs wurde beinahe schrill, seine Augen weiteten sich und er zitterte in seinem seidenen Hemd, das er zur Nacht trug. Ein scharfer Luftzug blähte die Vorhänge. »Er hat es sich überlegt. Er kommt zurück. Führt ihn gleich zu mir! Ich befehle es!« Die Geräusche verloren sich in der Ferne und es wurde wieder still. Die Schultern des Königs fielen nach vorne und seine Mundwinkel zogen sich verbittert nach unten. »Sucht ihn, Kardinal, in ganz Paris, wenn es sein muss. Und bringt ihn zu mir!«, befahl er.
»Majestät«, Richelieu erhob sich, schloss das Fenster und zog sorgsam die Vorhänge zu. »Ihr werdet Euch den Tod holen! Beruhigt Euch. Es wäre unklug, meine Leute in nächtlicher Stunde auszuschicken, um den Marquis de Cinq-Mars mit Gewalt herzubringen. Ich werde bei passender Gelegenheit ein ernstes Wort mit ihm reden. Bedenkt seine Jugend – er ist stürmisch, aufbrausend und muss erst noch geformt und erzogen werden.«
»Ich nehme ihm seinen Titel Grand Écuyer und lasse ihn in den Kerker werfen! Bei Wasser und Brot – wenn er nicht gehorcht«, klagte der König weiter. »Er ist ein Nichts ohne mich, ein Niemand! Ich entziehe ihm meine Gunst!« Er ballte die Fäuste mit einer hilflosen Geste. »Und die Delorme werde ich des Landes verweisen. Diese Kurtisane ist an allem schuld.« Atemlos hielt er inne. Auf Richelieu gestützt, taumelte er an allen Gliedern schlotternd zum Bett und kroch unter die Decke. Der Kardinal klingelte Sturm nach dem Diener, der mit einer heißen Bettflasche erschien.
»Ihr spielt mit Eurer Gesundheit, Majestät. Der Arzt hat Euch Ruhe verordnet!« Er raffte die scharlachrote Soutane und rückte besorgt seinen Stuhl näher ans Bett. »Stattdessen echauffiert Ihr Euch nur unnütz.«
Der König wischte den Einwand mit einer Handbewegung zur Seite. »Wenn ich nur schlafen könnte!«, stöhnte er. »Die ganze Nacht grübele ich, horche, ob die Kutsche zurückkehrt. Sagt mir, was ich tun soll, Kardinal? Gebt mir einen guten Rat!«
Richelieu sah peinlich berührt vor sich hin. Wie konnte er ahnen, dass die Dinge diesen Lauf nehmen würden? Er hatte sich alles ganz anders vorgestellt. Cinq-Mars sollte am Hof die Rolle des Spions spielen, Berichte verfassen, über das, was der König über ihn, seinen Ersten Minister, dachte und sagte. Dann wäre er rechtzeitig gewarnt, wenn ihm Gefahr drohte. Aber dass sich die Sympathie des Königs für den jungen Mann zu einer solchen Leidenschaft, ja geradezu Besessenheit entwickeln würde, hätte er niemals für möglich gehalten. Die königliche Gunst war Cinq-Mars natürlich zu Kopf gestiegen. Er wurde mit Geschenken und Ehrenämtern überhäuft und alle Welt buckelte vor ihm. Und seit seiner vor Kurzem erfolgten Ernennung zum Grand Écuyer, zum Großoffizier der Krone, nannte man ihn nur noch »Monsieur Le Grand«. Cinq-Mars hielt es daher auch nicht mehr für nötig, die vom Kardinal verlangten Berichte zu verfassen. Richelieu wollte sich diesen Ungehorsam jedoch nicht gefallen lassen. »Majestät!«, begann er nach einiger Überlegung mit gesenktem Blick. »Es gibt nur ein Mittel: Trennt Cinq-Mars von der Kurtisane Marion Delorme – und er wird sie vergessen.« Der König sah ihn verständnislos an und er fügte hinzu: »Schickt Cinq-Mars für eine Weile auf Reisen, das wird ihn ablenken, seine Vergnügungssucht dämpfen und …«
»Niemals«, fiel der König ihm ins Wort und schüttelte ablehnend den Kopf: »Ich kann Henri nicht vom Hof entfernen – aus meiner Gegenwart verbannen! Das würde ich niemals ertragen.«
»Es wäre ja nur für einen begrenzten Zeitraum«, beharrte Richelieu. »Wenn er zurückkäme, wäre er von seiner Liebe geheilt und wird sich Euch wieder voller Dankbarkeit zuwenden. Überlegt es in Ruhe, Majestät. Wir müssen den Boden für Friedensverhandlungen mit dem spanischen Minister vorbereiten. Dafür wäre Cinq-Mars der geeignete Mann. Als vertraulicher Kurier könnte er gleichzeitig Eure Briefe mit neuen Anordnungen zu Eurer Schwester Chrétienne nach Savoyen bringen. Seit dem Tod ihres Gatten ist die Lage dort sehr angespannt. Ich habe bereits ein Dossier angefertigt …«
Der König tupfte sich unschlüssig die Schweißperlen von der Stirn. »Ich werde es mir überlegen. Glaubt Ihr wirklich, dass Cinq-Mars die Delorme nach dieser Zeit vergessen hat? Dass nach einer kurzen Trennung alles anders wäre?«
Richelieu sah ihn fest an. »Ich bin davon überzeugt, Majestät! So eine Reise bringt unzählige Zerstreuungen mit sich – und auch gewisse Anstrengungen. Er wird froh sein, wenn Ihr ihn danach wieder in Gnaden aufnehmt. Der Vorteil für Euch ist: Ihr könntet in seiner Abwesenheit eine Wasserkur machen, damit Ihr bei seiner Rückkehr wieder ganz bei Kräften seid.«
Der König antwortete eine Weile nicht und biss auf seiner Unterlippe herum. Dann hob er den Kopf. »Euer Vorschlag ist nicht unrecht, Kardinal«, murmelte er mit schwacher Stimme. »So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Meine Gesundheit ist angeschlagen. Die ständigen Attacken und hochfahrenden Streitgespräche mit Monsieur Le Grand erregen mich zu sehr.« Eine Pause trat ein, in der der König sich zu fassen suchte. »Ich zermürbe mich mit unnützen Kleinigkeiten, an die ich dauernd denken muss. Das ist demütigend.«
»Der Staat braucht Euch, Majestät, vergesst das nicht!« Richelieu erhob sich erleichtert. »Darf ich also alles veranlassen? Ich schicke zwei meiner Musketiere mit. Sie werden unterwegs ein Auge auf Cinq-Mars haben. Macht Euch also keine Sorgen um ihn.« Er stutzte einen Augenblick. »Noch etwas – ich dachte noch an eine weitere Begleitung, mit der ihm die Reise mehr Freude machen würde. Seinen guten Freund …«, er schien zu überlegen, »den Marquis Julien de Rochebonne.«
Der König runzelte die Stirn und sah ihn fragend an. »Julien de Rochebonne? Der Name sagt mir irgendetwas. Eine alte Familie, nicht wahr?«
»De Rochebonnes Großvater hat sich Verdienste unter unserem guten König Henri IV. erworben, doch jetzt ist die Familie verarmt. Sein Enkel Julien ist nur ein unbedeutender Jüngling«, fuhr Richelieu mit spöttischem Unterton fort, »unter den vielen, die Euch am Hof noch nicht weiter aufgefallen sind. Er sitzt gerne am Spieltisch und glänzt eher mit modischen Extravaganzen als mit Geist. Ich hörte, dass er Schulden hat, die er durch eine reiche Heirat in Venetien ausgleichen will.«
»Cinq-Mars hat leider eine Vorliebe für oberflächliche Leute, die mir zuwider sind«, sagte der König bitter. »Und wer ist die Braut?«
Richelieu lächelte vielsagend. »Die Tochter des Senators von Venedig, eines gewissen Baron di Montadori. Bedingung des Vaters der Zukünftigen ist allerdings, dass der junge Mann persönlich und vor Ort um die Hand der Tochter anhält. Das fügt sich sehr gut in meinen Plan.«
Der König richtete sich auf. Seine Augen glänzten unnatürlich. »Tut, was Ihr für richtig haltet, Kardinal. Aber lasst Cinq-Mars’ Abreise so schnell wie möglich vorbereiten, bevor ich es mir anders überlege. Er soll nicht denken, dass er mit mir machen kann, was er will!« Er seufzte tief auf und ließ sich wieder auf die mit weißem Damast bezogenen Kissen gleiten. »Während seiner Abwesenheit werde ich die Kur über mich ergehen lassen, gesunden und zu Kräften kommen. Ihr werdet mich vertreten, wenn es nötig ist, mon Kardinal«, seufzte er mit halb geschlossenen Augen. »Gleich morgen setzen wir die Briefe mit den Ratschlägen an meine Schwester Chrétienne auf, die Cinq-Mars überbringen soll. Und vergesst das Dossier für die Friedensverhandlungen mit dem spanischen Minister nicht. Ich verlasse mich auf Euch.« Er hob noch einmal den Kopf, als der Kardinal nicht gleich antwortete. »Was ist mit Euch? Ihr seid bleich – ich werde Euch eine kräftigende Suppe schicken lassen.«
»Majestät …«, begann der Kardinal zögernd, »heute Abend wurde erneut ein Mordanschlag auf mich verübt … durch Gift. Der Zufall hat es gefügt, dass einer meiner Pagen unglücklicherweise aus dem für mich bestimmten Glas trank. Der arme Kerl – er war noch sehr jung …« Er hielt enttäuscht ein, denn der König hatte ermüdet seine Augen geschlossen und schien gar nicht zugehört zu haben. »Was sagtet Ihr soeben – von diesem Pagen?«, murmelte er, als Richelieu schon eine ganze Weile verstummt war. Er schüttelte den Kopf. »Nichts, es ist wohl nicht weiter von Bedeutung, Majestät …«