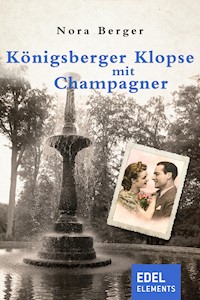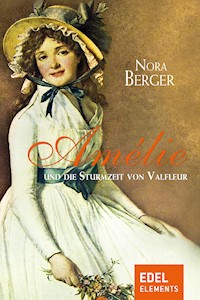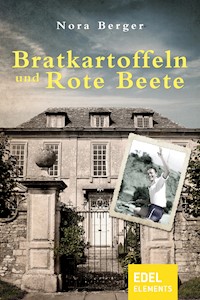4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Zauber der Karibik, ein hinterhältiger Mord und ein geheimnisvolles Amulett. Paris, 1840: Seit ihrer Reise zur Karibikinsel Guadeloupe trägt die junge Julie de Percault das schillernde Amulett, das ihr einst eine Wahrsagerin in Le Havre schenkte. Sie kann sich nicht davon trennen, doch es hat ihr bisher kein Glück gebracht: Ihre Plantage "Jardin de Fleurs" scheint für immer verloren und der Tod ihres Vaters ist weiter ungeklärt. Auch das Verschwinden ihres Bruders lässt nur einen Schluss zu: Gabriel de Percault lebt nicht mehr. Julie ist ganz auf sich gestellt und spürt, dass die Magie - und der Schrecken - Guadeloupes sie nie ganz losgelassen haben und dass sie herausfinden muss, was dort wirklich geschehen ist. Sie fasst einen mutigen Entschluss …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Nora Berger
Der Ruf der magischen Insel
Das Buch
Der Zauber der Karibik, ein hinterhältiger Mord und ein geheimnisvolles Amulett.
Paris, 1840: Seit ihrer Reise zur Karibikinsel Guadeloupe trägt die junge Julie de Percault das schillernde Amulett, dass ihr einst eine Wahrsagerin in Le Havre schenkte. Sie kann sich nicht davon trennen, doch es hat ihr bisher kein Glück gebracht: Ihre Plantage „Jardin de Fleurs“ scheint für immer verloren und der Tod ihres Vaters ist weiter ungeklärt. Auch das Verschwinden ihres Bruders lässt nur einen Schluss zu: Gabriel de Percault lebt nicht mehr.
Julie ist ganz auf sich gestellt und spürt, dass die Magie – und der Schrecken – Guadeloupes sie nie ganz losgelassen haben und dass sie herausfinden muss, was dort wirklich geschehen ist. Sie fasst einen mutigen Entschluss …
Die Autorin
Nora Berger wohnt bei München und studierte Philosophie und Literatur an der Sorbonne in Paris. Sie wurde für den Walter-Scott-Preis und den Homer-Preis nominiert und ist mit ihren Romanen regelmäßig auf den Bestsellerlisten zu finden. Ihre Vorliebe für französische Geschichte spiegelt sich vor allem in ihren historischen Romanen mit Schwerpunkt Frankreich wider.
NORA BERGER
DerRUF derMAGISCHENINSEL
DIE FORTSETZUNG VONIM BANN DER MA GISCHEN INSEL
ROMAN
Copyright: © 2021 Nora Berger
Lektorat: Susanne Zeyse – www.lektorat-zeyse.de
Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Umschlag: Mascha Vanessa
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-24115-2 (Paperback)
978-3-347-24117-6 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Kapitel 1
Der Regen trommelte rhythmisch gegen die Fensterscheibe. Grau und trist zeigte sich der Pariser Frühlingstag, obwohl draußen schon junge Triebe an Bäumen und Pflanzen sprossen und sich das helle Grün vorsichtig hinauswagte. Julie schloss das Tintenfass und legte die Feder zur Seite. Stirnrunzelnd überprüfte sie noch einmal das bereits Geschriebene. Meine Reise zur Sklaveninsel Guadeloupe lautete die Überschrift des mit engen Zeilen beschriebenen Papiers. Sie strich den Titel aus und ersetzte ihn durch Sklavenaufstand unter brennender Sonne.
„Julie!“ Das war die klagende Stimme der Mutter. „Julie!“
Die junge Frau klappte den Deckel ihres Sekretärs zu, erhob sich und ging mit einem gequälten Lächeln in den Nebenraum, wo die Mutter auf dem Kanapee ruhte.
„Was gibt es, Maman?“
Manon de Percault blickte ihr mit großen, fragenden Augen entgegen. Früher eine bemerkenswerte Schönheit, war sie seit der Rückkehr aus Guadeloupe abgemagert und nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Julie hob die Decke auf, die von Manons Füßen geglitten war.
„Wann kommen Vater und Gabriel endlich zurück?“
Wie oft hatte die Mutter diese Frage schon gestellt? Julie sog hörbar die Luft ein. Sie müsste ihr endlich die Wahrheit sagen, doch sie hatte es einfach noch nicht übers Herz gebracht. Zuviel war auf sie eingestürmt, seit sie von der Insel Guadeloupe zurückgekehrt war. Zusammen mit der kranken Mutter hatte sie die Verantwortung übernehmen und ihr Leben ganz neu ordnen müssen. Die klassizistische Villa, in der sie aufgewachsen war, war monatelang unbewohnt gewesen. Aufständische gegen das Regime König Louis-Philippe hatten den Garten verwüstet und einige Fensterscheiben zerschlagen, bevor sie von Soldaten verjagt wurden. Nur mühsam war es Julie gelungen, mit den Dienstboten eine gewisse Ordnung wiederherzustellen.
Die Mutter war ihr keine Hilfe gewesen. Sie verstand nicht mehr, was um sie herum vor sich ging, und lebte inzwischen ganz in der Vergangenheit. Teile ihres Gedächtnisses schienen wie ausgelöscht. Aber trotzdem musste Julie ihr endlich die Wahrheit sagen. Jeden Tag hatte sie es sich aufs Neue vorgenommen, doch sie war immer wieder davor zurückgeschreckt, aus Angst, dass dies für die Mutter ein zu großer Schock sein würde.
„Maman, du musst jetzt sehr stark sein“, begann sie mit zitternder Stimme. „Papa und Gabriel…“ Sie zögerte erneut. „Sie … sie kommen nicht mehr zurück.“
Die Mutter starrte sie entsetzt an. Das weiß gewordene Haar fiel der einst so gepflegten Frau strähnig und wirr ins Gesicht. „Was … meinst du damit, Kind?“ Auf den hervortretenden Wangenknochen, über die sich ihre welk gewordene Haut spannte, zeichneten sich rote Flecken ab.
„Vater lebt wahrscheinlich nicht mehr“, platzte Julie schließlich ungeschickt heraus. „Wir müssen davon ausgehen, dass Verbrecher ihn getötet haben, um die Plantage ‚Jardin de fleurs‘ an sich zu bringen. Es gibt keine Spur von ihm. Und was Gabriel betrifft – ihm ist bei der Suche nach Vater leider ein Unglück geschehen.“ Tränen traten in ihre Augen.
„Ich wusste es“, murmelte ihre Mutter mit ersterbender Stimme. Julie sah sie überrascht an. „Ich wusste es!“ Ihr Blick glitt über ihre Tochter ins Wesenlose, bevor sie in die Kissen zurücksank. „Du hättest mich nicht belügen müssen“, hauchte sie kaum verständlich, während ein Strom von Tränen aus ihren halb erloschenen Augen rann. „Gott hat mich gestraft.“
Julie beugte sich über sie. „Was meinst du damit, Maman?“
„Es ist meine Schuld. Die Voodoo-Zeremonie auf dem Friedhof … ich hätte es nicht tun dürfen…“
„Was hättest du nicht tun dürfen?“
„Ich hätte nicht hingehen dürfen!“ Ein tiefer Seufzer entrang sich ihrer Brust. „Es war eine Sünde! Ich habe die fremden Götter angerufen, in meiner Not. Der Baron Samedi … er hat mir großes Leid geschickt.“
„Nein, Maman, es ist nicht deine Schuld. Mach dir keine Vorwürfe. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände.“ Julie tastete nach dem Amulett um ihren Hals. Damit hatte alles angefangen. Eine Wahrsagerin aus Le Havre hatte behauptet, es würde ihr helfen, den Vater zu finden, der von der Insel Guadeloupe nicht mehr nach Paris zurückgekommen war. Er hatte sich vor Ort um das Erbe seines plötzlich verstorbenen Bruders, die Plantage „Jardin de fleurs“, kümmern wollen. Julie, ihre Mutter und ihr Bruder Gabriel hatten sich voller Unruhe und nach längerem Warten auf die Suche nach ihm gemacht und die Schiffsreise auf die ferne Insel angetreten. Doch dort war alles schnell außer Kontrolle geraten.
„Gott hat gesagt: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! Wo ist mein Sohn?“ Die Stimme der Mutter klang atemlos, brüchig, als hätte sie Angst vor der Antwort. „Was ist mit ihm geschehen?“
„Er ist ertrunken.“ Julie wunderte sich, wie leicht ihr dieser Satz über die Lippen kam, über ein Geschehen, das ihr schon so lange wie eine schwere Last auf der Seele lag. „Bei einer Seereise zu einer Insel, auf der er hoffte, Vater zu finden.“
Manon de Percault, bleich wie eine Tote, stieß einen Laut tiefen Schmerzes aus.
„Maman, bitte bleib ruhig! Du darfst dich nicht aufregen, hat der Doktor gesagt!“ Mit zitternden Händen nahm Julie das Fläschchen mit Laudanum, das griffbereit neben einem Wasserglas auf einem kleinen Tischchen stand, tropfte die doppelte Dosis der Medizin auf einen Löffel und flößte der Mutter die Flüssigkeit ein. Ihr Stöhnen und ihr lautes Schluchzen gingen nach und nach in ein ersticktes Wimmern über, das nur langsam verebbte. Manon tastete nach Julies Hand, als das Mittel zu wirken begann, das sie in eine dumpfe Lethargie versetzte.
„Wir Percaults sind vom Unglück verfolgt. Pass auf dich auf, mein Kind!“, murmelte sie. „Ich werde dich bald verlassen, das fühle ich. Nur der Gedanke, dass du verlobt bist und Marcel heiraten wirst, hält mich noch aufrecht. Er ist ein guter Junge mit solidem finanziellem Hintergrund. Er und seine Familie werden dir sicher zur Seite stehen. Er wird für dich sorgen. Versprich mir, dass die Hochzeit bald stattfinden wird…“ Sie sandte ihrer Tochter einen flehenden Blick. „Damit ich es noch erlebe! Vater hätte es auch gewollt. Er schätzte Marcel sehr. Bitte versprich es mir! Dann kann ich ruhig sein.“ Zitternd streckte sie ihr die Hand entgegen.
Julie nickte und drückte vorsichtig die schmalen, weißen Finger der Mutter. „Ich … ich verspreche es“, kam es tonlos über ihre Lippen.
„Du brauchst jetzt einen Halt, mein Kind…“ Ihre Stimme verlor sich in einem unhörbaren Gemurmel und Manon schloss die Augen. Julie zog sorgsam die Decke über ihre Schultern, verließ auf Zehenspitzen das Zimmer und sagte der Pflegerin Bescheid, die sich seit ihrer Ankunft in Paris um die Mutter kümmerte.
Endlich hatte sie der Mutter die Wahrheit über Gabriels Tod gestanden. Der Druck auf ihrer Brust schwand, aber trotzdem spürte sie ein tiefes Unbehagen, wenn sie an Marcel dachte, den sie so lange nicht gesehen hatte und der ihr fremd geworden war. Bisher hatte sie die Begegnung mit ihrem Verlobten immer wieder hinausgeschoben – er wusste nicht einmal, dass sie bereits nach Paris zurückgekehrt war. Eine seltsame Scheu hinderte sie, ihm nach der langen Trennung gegenüberzutreten oder ihm wenigstens eine Nachricht zu senden. So viel war inzwischen geschehen. Sie war nicht mehr das junge, unerfahrene Mädchen, von dem er sich vor einem Jahr verabschiedet hatte. In den letzten Monaten ihrer Reise hatten sie nicht einmal mehr Briefe miteinander gewechselt, vor allem sie selbst hatte es versäumt, auf Marcels Briefe zu antworten. Sein Bild war auf Guadeloupe zu einem unbedeutenden Schatten geworden, verdrängt von ihrer leidenschaftlichen Liebe zu Charles. Marcels Verlobungsring hatte sie längst abgelegt.
Ihr wurde plötzlich bewusst, wie allein sie sein würde, wenn die Mutter nicht mehr da wäre, wenn sie stürbe. Und dass sie wahrscheinlich Recht damit hatte, ihr einen verlässlichen Partner zu wünschen, der bei all dem erlittenen Unglück fest an ihrer Seite stand. Die Geborgenheit in einer etablierten Familie konnte über vieles hinweghelfen. Doch sie versuchte sich vergeblich vorzustellen, dass Marcel sie schon sehnsüchtig erwartete, dass er ihr im Kreis seiner Familie freudig entgegentrat und sie umarmte. Es gelang ihr nicht, ein Gefühl dumpfen Schuldbewusstseins über ihren Fehltritt, von dem er nichts wissen durfte, behielt die Oberhand. Und die traurige Gewissheit, dass Marcel ihr inzwischen gleichgültig geworden war. Aber vielleicht kam ja doch alles ganz anders, wenn sie sich wiedersahen!
Denn im Grunde sehnte sie sich ja nach einer starken Schulter, an die sie sich lehnen konnte. Nach jemanden, der zuhörte, wenn sie ihm ihr Herz ausschüttete, der sie tröstete, wenn sie verzweifelt war, der ihr half, ihr Leid zu tragen und sie bei Entscheidungen beriet, die sie treffen musste.
Vielleicht war Marcel wirklich ihr Halt im Sturm, der Fels in der Brandung, nach dem sie sich sehnte.
Sie würde zu ihm gehen, nicht jetzt, aber gleich morgen.
In Gedanken kehrte sie wieder auf die Insel Guadeloupe zurück, die ihr im kalten Paris mit all ihren Farben und ihrer Wärme wie ein Zufluchtsort erschien. Sie nahm am Schreibtisch ihres Vaters Platz, schlug seine Schreibmappe auf und tauchte die Feder in die Tinte. Aufschreiben, was sie erlebt, was sie dort gesehen hatte und das Ganze in eine romanhafte Form zu bringen, das war im Augenblick das einzige Mittel, das quälende Gedankenkarussell in ihrem Kopf auszuschalten, Krankheit und Tod zu vergessen.
Ihre Geschichte drehte sich um das Tagebuch einer jungen Frau namens Louise, die einen Plantagenbesitzer geheiratet hatte und ihm auf die Insel gefolgt war. Julie flocht geschickt das Sklavenproblem mit ein und schilderte die Methoden der brutalen Aufseher, wie sie sie bei Hagman und Gutierrez selbst erlebt hatte. Die Wahrheit sollte auch dem härtesten Befürworter der Sklaverei endlich die Augen öffnen und ihn von der Abschaffung dieser unmenschlichen Tradition überzeugen.
„Mademoiselle Julie?“ André hatte diskret geklopft und war dann mit gewohnter Bescheidenheit eingetreten. „Störe ich? Haben Sie unsere Klavierstunde vergessen?“
Julie sah mit müdem Blick von ihrem Manuskript auf. Sie hatte dem ehemaligen Hauslehrer, der sie auf der Reise nach Guadeloupe begleitet und dort ihrer Mutter und ihr durch sein beherztes Eingreifen das Leben gerettet hatte, zum Dank eine Wohnung in ihrer Villa und eine Dauerstellung, die unterschiedliche Dienste beinhaltete, versprochen. Und der mittellose André hatte dieses Angebot freudig angenommen. Diskret und zurückhaltend, war er inzwischen der Einzige, mit dem sie zumindest das Notwendigste besprechen konnte.
„Ach, André!“ Sie ließ die Feder sinken. „Das habe ich ganz vergessen. Ich wollte eigentlich noch schnell den Absatz des neuen Kapitels beenden. Bitte seien Sie nicht böse, aber ich denke, wir werden die Stunde heute ausfallen lassen müssen. Schon allein wegen meiner Kopfschmerzen.“ Sie legte die Hand an die Stirn.
André lächelte. „So etwas habe ich mir schon gedacht. Wenn Sie das neue Kapitel fertig haben, könnte ich es gleich zur Revue des deux Mondes bringen. Sie warten schon darauf, es in der nächsten Ausgabe zu bringen…“
Julie schüttelte abwehrend den Kopf. „Nein, nein! Nicht heute. Ich bin noch nicht soweit. Ich muss es unbedingt noch einmal überlesen! Es ist besser, wenn Sie es morgen hinbringen.“
André nickte und verbeugte sich zustimmend. „Wie Sie meinen, Mademoiselle Julie!“ Eigentlich war er es gewesen, der ihr nach dem Lesen einer Probe geraten hatte, Teile ihrer Aufzeichnungen über die Erlebnisse auf der Sklaveninsel Guadeloupe romanhaft auszuschmücken und sie einigen Zeitungen, auch der Revue des deux Mondes anzubieten. Wenn sie Glück hatte, würden sie ihre Niederschrift annehmen und vielleicht im Feuilleton publizieren. Er riet ihr auch, ein männliches Pseudonym zu verwenden. Nach einigem Zögern hatte Julie, die ihren Text nicht gut genug fand, eingewilligt und André war gleich losgelaufen, um das erste Kapitel in die Redaktion der Revue des deux Mondes zu bringen. Der Direktor hatte das Manuskript des unbekannten Jules Potin, wie sich Julie nannte, erst mit Misstrauen beäugt, aber da der Sklavenhandel zurzeit das Aufregerthema in Paris war, ließ er sich dazu herab, es genauer zu überprüfen.
Im Grunde hatte Julie wenig Hoffnung auf eine Veröffentlichung gesetzt. Aber als dann die erste Folge in der Revue erschien, war sie sehr stolz. Ihre Arbeit würde bei der engen Finanzlage und solange das Erbe noch nicht geklärt war, ein gutes Zubrot sein.
„Haben Sie noch einen Wunsch, Mademoiselle Julie?“, fragte André beflissen. „Ansonsten ziehe ich mich zurück!“
„Warten Sie, André.“ Julie stützte den Kopf in die Hände. „Und setzen Sie sich bitte. Ich muss mit Ihnen reden.“
André nahm lächelnd auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch Platz und sah sie erwartungsvoll an.
„Maman geht es nicht gut“, begann Julie. „Ich habe … ihr heute die Wahrheit über Papa und Gabriel gesagt.“ Sie schluckte. „Ihre dauernden Fragen waren nicht mehr zu ertragen. Ich konnte sie nicht länger belügen.“
André schlug die Hand vor den Mund, um einen entsetzten Ausruf zu unterdrücken. „Und? Wie hat Madame reagiert?“
Julie zuckte die Schultern. „Es war furchtbar für sie. Ich habe ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Aber sie ist in einem solch schlechten Zustand, dass es eigentlich nicht mehr schlimmer werden kann.“
„Vielleicht ist es wirklich das Beste, dass sie Bescheid weiß. Sie mussten es ihr ja irgendwann einmal sagen.“ André wich ihrem Blick aus.
„Ich hoffe, dass ihr Zustand sich nicht weiter verschlechtert.“ Julie seufzte tief auf. „Und dann noch etwas … Maman hat mir das Versprechen abgenommen, meinen Verlobten Marcel aufzusuchen. Sie will unbedingt, dass ich ihn heirate.“
„Und Sie?“ Andrés Stimme klang unsicher, da er die Wahrheit ahnte. „Sie wollen das nicht?“
Julie kam ins Stottern. „Ja … nein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht hat meine Mutter ja Recht. In meiner Situation brauche ich Jemanden, an dem ich Halt finde – eine Schulter zum Anlehnen.“
André senkte den Kopf. Mit Bitterkeit dachte er daran, dass ihm diese Rolle, so sehr er sie sich in seinen Träumen auch wünschte, niemals zuteilwerden würde. Er liebte und verehrte Julie seit langem, aber sie würde in ihm immer nur den wenig attraktiven Hauslehrer sehen – und im besten Fall den guten Freund, der sie in der Not beriet. Damit musste er sich begnügen. „Ich kann Ihnen da nicht raten“, sagte er schließlich. „Das muss ganz allein ihr Herz entscheiden.“ Er erhob sich mit einem gezwungenen Lächeln und verbeugte sich erneut. „Gute Nacht, Mademoiselle Julie. Ich bin sicher, Sie werden die richtige Entscheidung treffen.“
„Ja, ich versuche es. Gleich Morgen. Gute Nacht, André!“
Die Tür schloss sich hinter dem Hauslehrer und Julie wandte sich wieder ihrem Manuskript zu.
***
Fest entschlossen, aber voller Herzklopfen machte sich Julie am nächsten Tag in die Rue Saint Honoré auf, zu dem kleinen, hinter Büschen und Bäumen versteckten Palais Valdevert, in dem Marcel mit seinen Eltern wohnte. Sie kannte den Weg nur zu gut, aber diesmal wäre sie am liebsten auf halber Strecke umgekehrt. Mit einem bangen Gefühl läutete sie die Glocke am großen Portal im Hof. Babette, das Dienstmädchen, das ihr in weißer Schürze öffnete, sah ihr mit reservierter Miene entgegen. Hatte sie sich wirklich so verändert? In ihrem schwarzen Kostüm mit Fuchskragen, dessen Gürtel ihre schmale Taille betonte, den hochgesteckten rotblonden Locken, das Gesicht unter einem schwarzgetupften Gazeschleier ihres Hütchens verborgen, erinnerte nicht mehr viel an die jungmädchenhafte Julie in Rüschenkleidern, die unbeschwert die Stufen der Freitreppe hinaufgesprungen war, um Marcel, der sie oben erwartete, um den Hals zu fallen. Auch ihr Teint wies nach dem Aufenthalt in der Sonne Guadeloupes nicht mehr die elfenhafte Blässe von einst auf.
„Was starrst du mich so an, Babette?“, fuhr sie das Mädchen an und hob den Schleier etwas an. „Kennst du mich nicht mehr? Ich bin Julie de Percault! Und ich möchte Marcel sprechen.“
Babette zögerte kurz, dann knickste sie verlegen. „Verzeihung Mademoiselle. Warten Sie, ich sehe nach, ob Monsieur zu Hause ist.“
Julie fühlte sich bei diesem Bescheid ein bisschen wie eine Bettlerin, die um Einlass bittet. Alles war anders wie früher und ihr schien, als blicke die Fassade des hellgrauen Sandsteinbaus mit ihren dunklen Fenstern feindlich auf sie herab. Ungeduldig machte sie einen Schritt nach vorn und schob das Mädchen, das gerade das Portal bis auf einen Spalt schließen wollte, beiseite. Energisch drängte sie sich trotz ihrer Proteste an ihr vorbei. Schließlich kannte sie den Weg zum Salon genau.
Marcel saß mit dem Rücken zu ihr mit einem Glas Calvados vor dem Kamin, blätterte in einer Zeitung und murmelte, als er die Tür knarren hörte, ohne sich umzuwenden: „Babette, ich habe dir doch gesagt, ich möchte nicht gestört werden!“
Erst beim Geräusch von Julies klappernden Absätzen und dem Duft ihres frischen Maiglöckchenparfüms, der ihr vorauswehte, blickte er sich um. Sein Gesicht verzog sich in ungläubigem Erstaunen und er sprang auf. „Julie!“
Irgendetwas in seinem Wesen hinderte Julie, noch einen Schritt näher zu treten oder ihm gar um den Hals zu fallen. Sie blieb in einigem Abstand vor Marcel stehen.
„Sie sind aus Guadeloupe zurück?“ Es klang überrascht, aber keineswegs freudig. Doch was Julie am meisten erstaunte: Er war auf einmal wieder zum förmlichen Sie übergegangen.
„Bonjour Marcel! Ja, eine Weile schon. Ich bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen…“ Sie zögerte, ihn mit dem ungewohnten Sie anzusprechen und fuhr beherzt fort: „…dich zu verständigen. Es ist so viel geschehen.“
Ein peinliches Schweigen entstand, das Marcel als Erster brach. „Ich hatte Sie, äh dich, eigentlich schon eher erwartet. Und war erstaunt und auch etwas befremdet, so lange nichts von Ihnen zu hören.“ Seine Stimme klang trocken, ein wenig vorwurfsvoll. „Auch brieflich haben Sie seit langem versäumt, mich einigermaßen auf dem Laufenden zu halten.“ Er betonte diesmal das Sie als eine Anrede, die automatisch eine gewisse Distanz schuf.
„Das war nicht so einfach. Es gab Schwierigkeiten mit der Post“, log Julie mit niedergeschlagenem Blick.
„Seit wann sind Sie zurück? Und wie … wie ist es Ihnen auf der Insel ergangen? Ich hoffe, Sie befinden sich wohl.“
„Ich hatte sehr viel zu erledigen. Sie wissen ja gar nicht, was inzwischen alles geschehen ist. Ich wollte es nicht in einem Brief erwähnen.“ Sie presste die Lippen zusammen, entmutigt durch den kühlen Empfang.
„Aber nehmen Sie doch erst einmal Platz, Julie“, sagte Marcel mit einer höflichen Geste zum Sessel ihm gegenüber. „Möchten Sie vielleicht eine Tasse heiße Schokolade?
Das Wetter draußen ist wirklich scheußlich. Sie werden so etwas von Guadeloupe nicht gewohnt sein.“
„Danke Marcel, sehr gern.“ Zögernd setzte sich Julie in den Sessel ihm gegenüber, aber am liebsten hätte sie sich umgedreht und wäre gleich wieder hinausgegangen. Marcel frostiger Blick, sein merkwürdiges, zurückhaltendes Benehmen und seine Anrede sagten ihr, dass von seiner angeblich ewigen Liebe, die er ihr vor einem knappen Jahr beteuert hatte, nicht mehr viel übrig war. Dass es ihn auch nicht besonders interessierte, was geschehen war. Sie schob das in ihren feuchten Händen ein wenig zerknitterte Päckchen Briefe und das Tagebuch, die sie für ihn verfasst, aber nicht abgeschickt hatte, unauffällig zurück in ihre Handtasche.
„Und?“, fragte Marcel kühl und setzte sich ihr gegenüber. „Konnten Sie das Verschwinden Ihres Vaters auf Guadeloupe aufklären?“
Julie schüttelte den Kopf. „Leider nein. Es gab keine Spur. Und auf der Suche nach ihm … auf einer Seereise zu einer Insel, auf der Vater sich angeblich als Geisel befinden sollte, ist … Gabriel leider verunglückt.“ Sie schluckte.
„Mein Beileid!“ Marcel schien sichtlich erschüttert. „Das muss Sie und ihre Mutter sehr getroffen haben.“
Babette erschien und servierte die dampfende Schokolade in kleinen, dünnwandigen Porzellantassen und stellte etwas Gebäck in einer Silberschale hinzu.
„Ja“, fuhr Julie fort und nahm einen kleinen Schluck. „Sie ist seitdem leidend und hat ein wenig ihren Verstand verloren. Ich muss mich selbst um alles kümmern.“
„Oh, das bedauere ich zutiefst. Ich habe Ihren Bruder – und natürlich auch Ihre Frau Maman – immer sehr geschätzt.“
Es entstand eine längere Pause, in der Marcel ihrem Blick auswich.
„Julie, wir müssen reden“, begann er schließlich. „Über uns. Sie haben mir lange nicht geschrieben, nicht ein Wort. Ich war eine Weile sehr traurig darüber … aber dann…“ Er holte tief Luft, als müsste er sich zwingen, weiterzusprechen. „Dann haben mich meine Eltern ermutigt, wieder in Gesellschaft zu gehen.“ Er trank seine Schokolade aus, stellte die Tasse vorsichtig wieder auf den Teller und tupfte sich mit der Serviette leicht den Mund ab.
„Ich verstehe“, sagte Julie und setzte sich ganz gerade hin. „Und das haben Sie dann getan?“
Marcel runzelte die Stirn. „Ja. Es war nicht mein Fehler, sondern Ihrer! Das müssen Sie doch zugeben. Ich wollte, dass Sie hierbleiben, dass wir heiraten. Sie haben sich aber anders entschieden. Diese lange Trennung hat unserer Beziehung nicht gutgetan.“ Er räusperte sich vernehmlich. „Um ganz ehrlich zu sein, Julie – in der Zeit, in der Sie mir fern waren, hat sich vieles geändert. Auch meine Gefühle für Sie sind nicht mehr dieselben.“
Julie schwieg. Sie betrachtete Marcel, als sähe sie ihn zum ersten Mal. Sein feines, blasses Gesicht mit den graubraunen Augen, die dunklen, sorgfältig zurückgebürsteten Haare, das nervöse Zucken seiner Lider, die etwas gezierte Bewegung seiner schmalen Hände, mit der er ihr jetzt Gebäck aus der Silberschale anbot. War das wirklich derselbe Mann, der sie vor fast einem Jahr nach einer Soirée geküsst und um ihre Hand angehalten hatte? In den sie geglaubt hatte, verliebt zu sein? Der eine Weile all ihre Gedanken beherrscht hatte? Den sie hatte heiraten wollen? Nichts regte sich mehr für ihn in ihrem Herzen, ja es stieg sogar eine gewisse Abneigung gegen ihn in ihr auf, über die Affektiertheit in seinem Blick, die Art, mit der er jetzt seinen steifen Hemdkragen zurechtrückte, wie er sein Glas bis zum Rand mit Calvados füllte und es dann so rasch leerte, als müsste er sich Mut antrinken.
Marcel verzog das Gesicht zu einem gezwungenen Lächeln. „Sie wissen sicher, dass meine Mutter“, er verbesserte sich, „das heißt, meine Eltern – mit unserer Verbindung ohnehin nicht ganz einverstanden waren. Sie hatten von Anfang an eine andere Frau für mich vorgesehen – eine Jugendfreundin.“ Er senkte den Blick und vermied es, sie anzusehen.
„Und dieser Jugendfreundin sind Sie während meiner Abwesenheit wieder nähergekommen?“, fragte Julie mit hochgezogenen Augenbrauen.
„In der Tat.“ Marcel nickte erleichtert. „Ich gestehe es nicht ohne Bedauern. Aber nach längerer Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass meine Eltern vielleicht nicht so unrecht hatten. Clara und ich – wir lieben uns. Es tut mir leid Julie.“ Er biss sich auf die Lippen und sah aus wie ein Schuljunge, der etwas Dummes angestellt hatte. „Aber … ich hoffe, Sie sind einverstanden, dass wir unsere Verlobung lösen.“
Julie saß eine Weile stumm da. Sie war nicht einmal überrascht. Und unwillkürlich schob sich plötzlich Charles’ Bild vor ihr inneres Auge, wie er am Klavier saß und aufwühlend spielte, wie er sie angesehen hatte in der Bucht, in der die Wellen gegen die Felsen rauschten. Und wie er sie so leidenschaftlich an sich gezogen und geküsst hatte, dass sie ihm nicht hatte widerstehen können. Eine heiße Welle überflutete ihr Herz und sie wunderte sich, dass sie diesen Mann, der da so verlegen vor ihr saß, auch nur eine einzige Minute hatte attraktiv finden können!
Verlegen schnippte Marcel ein paar Brösel des Gebäcks von seiner Samtweste, unter der sich das blütenweiße Hemd bauschte. „Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass … dass ich von meinem Heiratsversprechen ab sofort zurücktreten möchte!“ Er stand abrupt auf, verschränkte die Arme hinter dem Rücken und ging ohne sie anzusehen zum Fenster. „Es ist mir sehr schwergefallen, Ihnen das zu sagen, Julie! Ich hoffe, wir bleiben trotzdem Freunde. Ich wünsche Ihnen alles Gute!“
„Alles Gute?“ Julie sprang auf. „Ich brauche deine guten Wünsche nicht, Marcel! Und es muss dir auch nicht leidtun.“
Ihr aufbrausendes Temperament gewann plötzlich die Oberhand – gepaart mit einer Erleichterung, die sich fast anfühlte wie eine Befreiung. Sie brach plötzlich in ein nervöses, hysterisch klingendes Lachen aus.
Marcel wandte sich um und sah sie verwirrt an. Nach seiner offenherzigen Beichte hatte er wohl eher Tränen, Vorwürfe und Klagen erwartet.
„Ich liebe dich auch nicht mehr – wenn ich das überhaupt jemals getan habe.“ Sie riss ihren Verlobungsring vom Finger, den sie extra an diesem Tag angelegt hatte, und warf ihn Marcel vor die Füße. „Und ich möchte auch ehrlich zu dir sein. Mein Herz gehört einem anderen Mann. Und der ist keineswegs ein so verweichlichtes Muttersöhnchen wie du.“
„Julie! Sie vergessen sich!“ Marcels Gesicht lief rot an und verzerrte sich wütend. Sie hatte ihn mit diesen Worten an seiner schwächsten Stelle getroffen.
„Meine besten Grüße auch an die Frau Mama und den Herrn Papa! Und natürlich an die Jugendfreundin.“ Sie stieß ihre Tasse mit der Schokolade, an der sie nur genippt hatte, so heftig von sich, dass sie umkippte und ihr dunkelbrauner Inhalt sich auf die schneeweiße Spitzendecke ergoss, bevor sie scheppernd auf dem glänzend gebohnerten Parkettboden zerbrach.
„Was geht denn hier vor?“ Die raue Stimme von Marcels Vater, dem Comte de Valdevert, mischte sich in das aufgeregte Zetern seiner Frau, die hinter ihm in den Salon stürzte, um zu sehen, was da vor sich ging. Doch als sie Julie erkannten, versteinerten sich beider Mienen und sie schienen nicht zu wissen, was sie sagen sollten.
Julie stieß die Scherben mit dem Fuß beiseite und rauschte grußlos an ihnen vorbei. Sie durchquerte im Laufschritt die Halle, an dem Stubenmädchen Babette vorbei, die ihr kopfschüttelnd nachsah. Als sie das schwere Portal aufriss, stieß sie beinahe mit einer jungen, sehr hübschen Dame in einem mit kostbaren Nerzen besetzten Cape zusammen.
„Bonjour, Mademoiselle! Sie sind sicher Clara, die Jugendfreundin! Grüßen Sie Marcel recht schön von mir“, stieß Julie mit einem mokanten Lächeln hervor. „Und sagen Sie ihm, dass ich Sie ihm mit dem größten Vergnügen überlasse!“
Und dann lief sie mit großen Sätzen, fast beschwingt, die Freitreppe hinunter.
Eine Weile spazierte Julie ziellos kreuz und quer durch die Stadt. Sie hatte nicht die geringste Lust, gleich nach Hause zurückzukehren. Marcels Verhalten hatte sie gekränkt, obwohl sie nichts mehr für ihn empfand und an der Lage der Dinge ja nicht ganz unschuldig war. Aber es hatte ihr auch gezeigt, was sie im tiefsten Innern schon geahnt hatte. Nämlich wie wenig Marcel zu ihr passte und sie zu ihm. Es wäre ein Fehler gewesen, ihn zu heiraten, nur um ihrer Mutter einen Gefallen zu tun, die ihre Tochter in Sicherheit und in einem guten Hafen wissen wollte.
Das Gefühl einer neuen Freiheit breitete sich in ihr aus. Mit schnellen Schritten ging sie den Boulevard Saint Michel hinauf bis zum Jardin du Luxembourg. Die Wolken hatten sich auseinandergeschoben, ein frischer Wind wehte die grauen Schleier fort, die einem Stück blauen Himmel Platz machten und einen Sonnenstrahl hervorlugen ließen. Julie streckte ihr Gesicht der Sonne entgegen. Letztendlich hatte sie das Schicksal vor der Heirat mit einem Mann bewahrt, den sie geglaubt hatte, zu lieben, als sie noch gar nicht wusste, was Liebe überhaupt war. Fast hätte sie sich dem Wunsch der Mutter nach einer Heirat gefügt, wenn Marcel nicht einer anderen Frau wegen Abstand davon genommen hätte.
Erst als sie im noch winterlich wirkenden Park des Jardin de Luxembourg angelangt war, beruhigte sie sich ein wenig. Sie spazierte gemächlicher über die geharkten Wege des majestätischen Gartens mit seinen noch kahlen Bäumen und Büschen, von denen der Wind einen erdigen Hauch von Frühling herbeiwehte und an seinen jedem Wetter trotzenden, mit Moos bedeckten, steinernen Statuen vorbei. Vorsichtig setzte sie sich auf eine Bank, von der sie zuerst mit ihrem Taschentuch ein paar Regentropfen abgewischt hatte. Sie war fast allein, denn nur wenige Spaziergänger hatten sich bei dem regnerischen Wetter in den Park gewagt.
Was auch immer geschah, sie würde sich niemals von einem Mann abhängig machen! Lieber nahm sie ihr Leben selbst in die Hand, auch wenn sie vorläufig für die kranke Mutter sorgen musste. Als Erstes galt es, die unsichere Finanzlage zu ordnen, die durch die Abwesenheit des Vaters und die Unkosten in Guadeloupe einen Teil des Familienvermögens verschlungen hatten. Gleich morgen würde sie sich bei dem Notar melden, bei dem der Vater sein Testament hinterlegt hatte.
Ein Frösteln überlief sie plötzlich, es begann zu nieseln und sie erhob sich und zog den schwarzen Fuchspelz enger um die Schulter. Sie raffte ihren feucht gewordenen Rock, spannte den Schirm auf und schlenderte langsam weiter.
Am Ausgang des Parks erregte ein auffallend gelbes Plakat an einer Litfaßsäule ihre Aufmerksamkeit. Interessiert blieb sie stehen und las die Ankündigung in verschlungenen, golden schimmernden Lettern: Beethoven und Paganini. Es war ein groß angekündigtes Konzert im Salle Pleyel in der Rue de Rochechouart, direkt gegenüber der berühmten Manufaktur des Klavierbauers Pleyel. Namhafte Pianisten, unter ihnen auch Frédérik Chopin, waren dort schon aufgetreten. Ihr Herz begann wie wild zu klopfen, als ihr die Namen der Solisten ins Auge sprangen: Solange de Rochefort, Geige und Charles Meunier, Klavier.
Kapitel 2
Auf der isolierten Leprosenstation der Insel La Désirade, auf die Kapitän Rico Sauvage Gabriel und Tom gebracht hatte, weil im Bereich des unterhalb liegenden, alten Gefängnisses kein Platz mehr war, verlief das Leben im immer gleichen Rhythmus. Die beiden Gefangenen verbrachten die Nächte in einem abgesperrten Raum des Hauptgebäudes, dessen Nebentrakt als Hospital diente. Tagsüber konnten sie sich dank Pater Daniel nach einer gewissen Prüfungszeit frei bewegen und sich unter Bewachung bei verschiedenen Arbeiten nützlich machen. Eine Flucht vom steilen Tafelberg über die rau zerklüfteten Felsen, die steil ins Meer abfielen, das unten hoch aufschäumend gegen die Klippen schlug, schien völlig unmöglich. Das Gelände war zusätzlich noch mit einem mannshohen Eisengeflecht versehen.
An den abschreckenden Anblick der Leprakranken, denen Mund und Nase fehlten und bei denen sich andere Extremitäten des Körpers förmlich zersetzten, hatten sie sich mittlerweile gewöhnt. Es waren eher scheue Menschen, die ihre Krankheit als eine Strafe der Götter ansahen und die sich als Aussätzige fühlten. Pater Daniel, der hier als Arzt und Geistlicher tätig war, hatte einige von ihnen bereits zum christlichen Glauben bekehrt und sie getauft.
Auch Gabriel und Tom nahmen regelmäßig an der Messe teil. Pater Daniel war ein gutmütiger Mensch mit rundem Gesicht, Backenbart und untersetztem Körperbau. Er war nicht nur Priester, sondern auch Arzt. In seiner abgenutzten, mit einer Kapuze versehenen Soutane aus beigem Leinen arbeitete er unermüdlich im Hospital. Er ließ seinen neuen Gefangenen, die ihm wenig gefährlich schienen, tagsüber immer mehr Freiheiten. Aber er erfüllte auch gewissenhaft seine Pflicht, die ihm anvertrauten Gefangenen vom Abend bis zum Morgen in einen stickigen, mit einer Eisentür versehenen Raum zu sperren, wo sie in einfachen Etagenbetten Schlaf zu finden versuchten.
Außer ihm und den hilfreichen Schwestern befanden sich noch drei weitere Mönche des Lazarus-Ordens ständig auf der Insel: Bruder Jacob, Bruder Benedict, Bruder Eusebius, Bruder Martin und Bruder Gregorius, einfache Mönche mittleren Alters. Sie alle hatten das Gelübde abgelegt, in friedlichem Miteinander ihren Dienst an Christus und damit an den Leprakranken zu erfüllen.
Insgesamt gesehen hatte das Leben auf dem Hochplateau der Insel La Désirade etwas von einer Dorfgemeinschaft. Es gab eine Kirche, ein Hospital, in dem die schweren Fälle behandelt wurden, die von den freiwilligen Schwestern betreut wurden. Die Kranken, bei denen der Verlauf der Lepra langsam vor sich ging und denen man oft die Krankheit noch gar nicht ansah, lebten im hinteren Bereich in separaten Hütten aus Holz und Lehm, die sie selbst errichten mussten. Die Dächer waren aus einer Art Sisalgeflecht hergestellt, einer Agavenpflanze, die sie anbauten und die im warm-feuchten Klima der Kalkfelsen, die nur mit einer dünnen Humusschicht bedeckt waren, gedieh. Diese Menschen, noch im Anfangsstadium der entsetzlichen Krankheit, führten ein beinahe normales Leben, kochten, bauten etwas Gemüse an und versuchten, sich mit ihrem Schicksal abzufinden. Weil sie sich nicht anstecken wollten, wagten sich Gabriel und Tom anfangs nicht in das kleine Dorf und zu den Hütten. Doch allmählich verloren sie ihre Furcht – es schien ja auch gleichgültig, ob sie an der Lepra starben, oder als Gefangene auf der Insel alt wurden.
Tom litt am meisten unter der Isolation, der Eintönigkeit einer Lebensgemeinschaft todgeweihter Kranker. Sein unerschütterlicher Optimismus wurde nach und nach zu einer dumpfen Schwermut, weil er sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, auf welche Weise sie diese Insel im Leben noch einmal verlassen sollten. Gabriel dagegen ließ sich nicht entmutigen, er schmiedete ständig neue Fluchtpläne, auch wenn es unmöglich schien, aus dieser vom Meer umgebenen Einöde mit den kahlen, steilen Kalkfelsen zu entkommen.
Gleich unten, neben der Steilküste, lag das alte heruntergekommene Gefängnis, in das aufständische Franzosen gebracht wurden, die nach einer Weile dem Vergessen anheimfielen. Es wurde von einem versoffenen Kommandanten, den die beiden schon kennengelernt hatten, und einigen Soldaten bewacht. Gabriels Gehirn arbeitete unablässig an einer Möglichkeit zum Entkommen. Am Anfang hatte es seine Aufmerksamkeit erregt, dass die Toten, da man sie schlecht auf dem Felsengelände beerdigen konnte, in einen Sack genäht und durch eine Klappe einfach ins Meer geworfen wurden. Aber wie sollte man sich anstelle einer Leiche in diesen Sack schmuggeln? Den Sturz von oben würde sowieso niemand überleben, denn die Felsen waren scharfkantig und auch unten im Meer lauerten Klippen, auf die man bei der großen Höhe aufschlagen konnte. Hinunterklettern schien auch so gut wie unmöglich, außerdem war die Klappe immer versperrt. Selbst wenn es gelingen sollte, den Schlüssel an sich zu bringen, war das gefährliche Gelände zu steil und die Felsen an manchen Stellen tückisch, weil sie entweder zu spitz oder zu glatt waren, um Halt zu bieten.
Nach solchen Erwägungen übermannte auch Gabriel manchmal die Verzweiflung. Doch sein Überlebenswille gewann meist schnell wieder die Oberhand. Irgendwie würde es eines Tages doch klappen. Man musste einfach abwarten.
***
Von Zeit zu Zeit wurden die Schwestern auf La Désirade abgelöst und es kamen neue freiwillige christliche Pflegerinnen des Lazarus Ordens aus Frankreich, die Bonnes Soeurs et Fréres. Das geschah allerdings unter streng geregelten Bedingungen. Man sperrte Gabriel und Tom an diesen Tagen in das Gelass, in dem sie üblicherweise nur die Nacht verbrachten. Neugierig spähten sie durch das vergitterte kleine Fenster, das in die dicken Mauern eingelassen war, um die Neuankömmlinge, die einen solch opfervollen Dienst taten, zu beobachten.
Tom war es nicht entgangen, dass diesmal eine junge, blonde Schwester unter ihnen war, die sein Interesse weckte; ein feingliedriges Wesen mit hübschen, regelmäßigen Zügen, das sich von seinen robusteren Kolleginnen angenehm abhob. Ihr Name war Schwester Adela und Tom konnte nicht aufhören, sie anzusehen, wenn sie in seiner Nähe auftauchte. Ihm schien, als würde sie es bemerken und erröten, doch er wagte nicht, sie anzusprechen. Der einstige Schiffsjunge Tom hatte sich von einem mageren, hochaufgeschossenen und kindlichen Burschen zu einem stattlichen und gutaussehenden jungen Mann gewandelt. Sein wild gelocktes, dunkles Haar war im Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden, und die Arbeit an den Hütten mit ihren Strohdächern, die er mit nacktem Oberkörper ausführte, hatte seine Muskeln und seinen Oberkörper gekräftigt.
Irgendwann fasste er sich ein Herz und fragte Schwester Adela mit scheuer Verlegenheit, aus welchem Gebiet Frankreichs man sie hierhergeschickt habe. Mit niedergeschlagenen Augen antwortete sie, sie käme aus dem Kloster der „Filles de la Croix“ in Paris. Tom sagte der Orden der „Filles de la Croix“ nicht das Geringste, und als er nachfragte, erklärte sie ihm, er sei eine mit dem Lazarus Orden verbundene, dominikanische Gemeinschaft der Nonnen, die sich nach den Wirren der Französischen Revolution wieder neu in Paris gruppiert hätten.
Nach diesen Worten verschwand sie eilig wieder im Trakt des Hospitals, um ihrer Pflicht nachzugehen. Tom sah ihrer schmalen Gestalt lange nach. Ihm schien als hätte er noch nie so seelenvolle helle Augen gesehen, eine so weiße Stirn, auf die sich aus der Haube kleine Löckchen gestohlen hatten, einen so zart geschwungenen Mund, der weiße, regelmäßige Zähne sehen ließ, wenn sie sprach.
Gabriel hatte die kleine Szene wohl bemerkt. Er beschloss, Tom irgendwann einmal darauf anzusprechen und ihm zu erklären, dass er sich keine Hoffnungen machen solle. Nonnen wie sie hatten sich ganz Gott geweiht und durften keinen Mann ansehen. Doch er schob diese Aussprache immer wieder hinaus, wenn er sah, wie Tom durch Schwester Adela aus seiner Lethargie erwachte. Er sah die Flamme, die in seinen Augen glühte, wenn Adela in der Nähe war. Ihretwegen wagte Tom sich sogar ins Hospital, um dort Arbeiten zu verrichten, vor denen er sich bislang gescheut hatte. Auch Pater Daniel entging Toms Interesse nicht. Er schien etwas zu ahnen und beauftragte Tom und Gabriel mit der Errichtung neuer Hütten am Rande des Lepra-Dorfes.
Ein einziges Mal nur hatte Gabriel versucht, Pater Daniel davon zu überzeugen, dass er und Tom unschuldig waren. Ihm Geld zur Unterstützung und Errichtung neuer, komfortablerer Gebäude auf der Insel anzubieten, wenn er sie freiließe. Doch der Pater, pflichtbewusst wie er war, hatte ihn nur lächelnd angesehen und den Kopf geschüttelt. Er wusste zwar nicht, was die beiden genau getan hatten, aber er glaubte an die Obrigkeit und war der Meinung, dass ein Verbrecher sich gottgefällig zeigen und für seine Straftat büßen müsse.
Um nicht allzu viel über ihre verfahrene Situation nachdenken zu müssen, stürzten Gabriel und Tom sich in die Arbeit, die Errichtung weiterer Unterkünfte, die für neu angekommene Leprakranke geschaffen werden sollten. Das Holz auf dem Tafelberg war rar. Man musste das Wenige mühsam zusammenklauben, es aneinander nageln und mit Lehm vermischen, um damit Bauteile zu konstruieren, die auf simple Art zusammengesetzt wurden. Es war eine mühselige Arbeit, die nur noch vom Binden der in der Sonne getrockneten Agavenpflanzen für die Dächer der Hütten übertroffen wurde. Die scharfen Stränge der Pflanze schnitten in die Hände, wenn man sie ernten und danach mit Hilfe von Wasser in die gewünschte Form bringen wollte. Aber Gabriel und Tom war es lieber, in der heißen Sonne zu arbeiten, als trübsinnig im Schatten auf das die Augen blendende Blau des Meeres zu starren und auf die in nicht allzu großer Ferne liegende Küste, deren nebelhafte Umrisse man vom einem bestimmten Punkt aus erkennen konnte.
Die beiden Gefangenen sprachen wenig, während ihnen vor Anstrengung der Schweiß den Rücken hinunterlief. Doch plötzlich ließ Tom das Gewerke, das er in Händen hielt, fallen, stieß einen Schrei aus, sprang auf und fasste sich an die Stirn. Gabriel sah ihn erstaunt an. Hatte Tom jetzt den Verstand verloren? Doch dieser wirbelte lachend einen Strunk der eingeweichten Pflanze um seine Taille. „Sehen Sie das, Patron?“
Gabriel runzelte die Stirn. „Ein Stück Sisal. Na und?“
„Das ist unsere Rettung!“, rief Tom freudig erregt aus. Er sah sich nach allen Seiten um und dämpfte seine Stimme. „Ein Seil. Das Material ist unglaublich zäh, aber mit Wasser wird es geschmeidig! Wir könnten ein Seil daraus flechten! Müssten täglich nur ein Stück an das andere knüpfen und irgendwann wäre es lang genug, um…“
Gabriel schüttelte den Kopf. „Tom! Nimm Vernunft an! Wie soll das gehen, bei einer Länge von mindestens dreihundert Metern? Das schaffen wir nie – unbemerkt von unseren Bewachern! Und würde das Material überhaupt halten? Du denkst doch nicht wirklich, dass wir uns damit bis ans Meer abseilen könnten?“
„Wieso nicht?“ Toms Augen leuchteten in dem früheren, optimistischen Glanz, den Gabriel schon lange nicht mehr bei ihm gesehen hatte. „Und wenn es Jahre dauern sollte! Wir werden jeden Tag ein Stück daransetzen und dann, wenn es lang genug ist, befestigen wir es oben und lassen uns mit seiner Hilfe Stück für Stück die Felsen hinunter.“
„Und wenn es sich als zu kurz erweist? Was dann?“ Gabriel sah ihn fragend an, bevor er die Antwort selbst gab. „Dann stürzen wir in die Tiefe, in den Tod, ins Meer!“
„Das wird nicht geschehen, Patron! Es kann gehen – es muss gehen, egal, wie lange es dauern wird. Wir werden das Seil jeden Tag um weitere Meter verlängern. Dann brauchen wir nur noch den Zugang durch die Klappe, durch die die Leichen geworfen werden. Wir machen das Seil dort fest…“
„Hör auf, Tom! Wann sollten wir an dem Seil arbeiten? Wo es lagern? Schau dir mal Schwester Eutymea an, die dort drüben im Schatten sitzt. Sie beobachtet uns die ganze Zeit. Und Pater Daniel ist auch nicht gerade dumm. Er hat die Verantwortung für uns und trägt den Schlüssel für die Leichenklappe mit allen anderen an seinem Gürtel. Der Schlüssel ist unerreichbar für uns. Ich habe ihn bei meiner wöchentlichen Beichte niemals davon überzeugen können, dass man uns hier unschuldig gefangen hält.“
„Wir könnten ihm den Schlüssel stehlen oder durch einen falschen austauschen!“
Gabriel schüttelte den Kopf. „Als wenn das so einfach wäre. Hast du eigentlich mal daran gedacht, was passiert, wenn dieses brüchige Seil reißt? Wenn es uns nicht trägt?“
„Mir ist es lieber, kopfüber ins Meer zu stürzen, als hier lebendig begraben zu sein“, gab Tom mürrisch zurück. „Wir müssen nur sorgfältig genug arbeiten. Jedes Stück mit Wasser anfeuchten, es kneten, damit es geschmeidiger wird und es dann so fest wie möglich flechten. Vielleicht finden wir auch etwas Baumharz, damit wir die Ansatzstücke noch fester verkleben können. Warum sollten wir es nicht einfach versuchen?“ Das Blut stieg ihm ins Gesicht und er sprang auf. „Ich will weg aus dieser Einöde, von der Insel der Verdammten, der Leprakranken! Mein ganzes Leben liegt noch vor mir! Ich halte es einfach nicht länger aus, nur von Todgeweihten umgeben zu sein!“
„Leise!“ Gabriel sah zu Schwester Eutymea hinüber, die in ihrem strengen, weißen Kleid mit der dunklen Haube unter einem aufgespannten Tuch saß, das sie gegen die Sonne schützte und mit ernster Miene an einer Näharbeit stichelte. Ab und zu ließ sie ihre wachsamen Blicke über die Gefangenen schweifen.
„Ich verstehe dich ja, Tom!“, fuhr Gabriel mit gedämpfter Stimme fort. „Aber es wird ewig dauern, bis so ein Seil lang genug ist, das sage ich dir schon jetzt.“
„Na und?“, stieß Tom unbeherrscht hervor. „Eines Tages wird es soweit sein. Das gibt Hoffnung.“
„Jetzt halt endlich den Mund!“, fuhr Gabriel ihn an. „Kapier doch endlich, dass wir kein Aufsehen erregen dürfen! Sonst scheitert der Plan schon im Vorfeld.“
Tom verzog das Gesicht und machte sich wieder an die Arbeit. „Diese vertrocknete Ziege! Die mag mich sowieso nicht und ich sie auch nicht. Die niederen Arbeiten lässt sie immer von den jüngeren Schwestern verrichten. Ich habe noch nie gesehen, dass sie einen Kranken mit offenen Wunden verbunden hat.“
„Deshalb müssen wir uns vor ihr ganz besonders in Acht nehmen“, warnte Gabriel erneut.
„Ich wüsste jemanden, der sanfter und uns viel gewogener wäre… “ Tom grinste geheimnisvoll.
Gabriel schüttelte den Kopf. Er wusste, worauf der Junge anspielte. „Mach dir nur keine falschen Hoffnungen, mein Lieber! Eine Nonne ist ausschließlich mit Jesus verheiratet.“
„Vielleicht muss man es darauf ankommen lassen, Patron“, flüsterte Tom mit träumerischem Blick.
„Sei still! Du redest uns noch um Kopf und Kragen.“ Gabriel warf einen erneuten Blick zu Euthymea hinüber. Man konnte nicht wissen, was sie sah und hörte.
„Die falsche Schlange. Sie mag uns nicht“, murmelte Tom „Wie sie uns ansieht. Als wären wir die schlimmsten Verbrecher.“
„So schlecht kann sie doch nicht sein. Immerhin hat sie sich freiwillig für ihren Dienst auf der Leprainsel entschieden“, gab Gabriel im Flüsterton zurück, während er ein Stück trockenes Holz mit einer Säge bearbeitete.
„Ach was, hinter ihrem Rücken sagt man, sie wäre nur hier, weil sie vor vielen Jahren von ihrem Verlobten verlassen wurde. Wahrscheinlich hasst sie alle Männer und damit auch uns.“
„Du hörst mal wieder die Flöhe husten, Tom. Aber mir ist gleichgültig, was sie von uns denkt“, sagte Gabriel, der sich langsam für die Fluchtidee zu erwärmen begann. „Halten wir mal fest: Wir werden versuchen, täglich ein paar Bündel der zusammengedrehten Fasern dieser Pflanze an eine bestimmte Stelle zu bringen, wo wir sie unauffällig bearbeiten können.“
Tom nickte. „Und wo sollen wir die Teile des Seils dann verstecken?“ Er ließ seine Blicke über die karge Landschaft schweifen. Es war in der Tat nicht so einfach, dafür ein Plätzchen zu finden. Das Gelände war abgeschirmt und ziemlich übersichtlich.
„Das ist dein Problem“, sagte Gabriel und legte die Säge beiseite. „Es war ganz allein deine Idee.“ Er nahm das gesammelte und zugeschnittene Holz und machte sich auf den Weg zu den neu zu erbauenden Hütten, die ein wenig außerhalb lagen.
Tom folgte ihm mit einem Armvoll Strünke der Agavenpflanze. Überrascht raffte Schwester Eutymea rasch ihre Handarbeit und das schützende Sonnensegel zusammen und eilte ihnen, so schnell es der Weg über die Felsen erlaubte, nach.
Kaum war der Plan mit dem Seil geboren, machte sich Tom schon mit Feuereifer an die Umsetzung. Während Gabriel Holz sammelte und sich weiter mit dem Hüttenbau beschäftigte, ging Tom seiner Aufgabe nach, die Dächer zu decken, die er zum Schutz gegen Wind und Regen mit der zu Bündeln gefassten, strohartigen Faser der Agave versah. Einen Teil des Materials schaffte er ab jetzt heimlich beiseite. Er sammelte die Strünke in einem Loch in einer Felsspalte, die er mit einem Stein verschloss. Unermüdlich flocht, drehte und wand er in unbeobachteten Momenten unter Einsatz von Wasser die strohigen und widerspenstigen Fasern zu einem stabilen Strick, den er nach dem Trocknen locker zusammenrollte, in die breite Felsspalte schob und den Stein davor rollte. Langsam, aber sicher wuchs der Strick weiter, jeden Tag kam ein gutes Stück Länge hinzu.
Alles ging gut, nur Toms Hände wurden von der Arbeit ganz rissig und wund. Er nutzte die Gelegenheit, um sich von der sanften und ahnungslosen Schwester Adela Salbe zu holen und gleichzeitig ein paar Worte mit ihr zu plaudern. Die hübsche Schwester ging ihm nicht mehr aus dem Sinn und der Gedanke betrübte ihn, dass er sie im Falle einer Flucht niemals wiedersehen würde.
Gabriel versuchte, Toms Beschäftigung mit dem Seil zu decken und gleichzeitig seine eigene Arbeit so zu machen, dass niemand Verdacht schöpfte. Die Leprösen waren zu sehr mit sich selbst, ihrer Krankheit, dem täglichen Leben, etlichen Handwerkertätigkeiten und ihrem Gemüseanbau in ihren bescheidenen Gärtchen beschäftigt, als dass sie sich noch um etwas anderes hätten kümmern können. Die christlichen Brüder, einschließlich Pater Daniel, hatten alle Hände voll im Hospital zu tun, und Schwester Eumythea hatte zum Glück noch keinen Verdacht geschöpft. Je länger das Seils wurde, umso stärker wurde in Gabriel und Tom die Hoffnung, dass das kühne Vorhaben eines Tages doch gelingen könnte. Wie sie allerdings an den Schlüssel für die Leichenklappe kommen sollten, war ihnen bisher noch schleierhaft. Pater Daniel trug ihn sichtbar am Gürtel seiner Kutte, die er nur zum Schlafen ablegte.
Eines Tages begegnete Tom unvermutet Schwester Adela, die mit einem Tablett, beladen mit Verbandszeug, Salben und Fläschchen mit Ölen vom Hüttendorf zurückkehrte. Adela errötete, senkte den Kopf und wollte vorübergehen.
„Kommen Sie Schwester, das ist doch viel zu schwer für Sie!“, sagte er schnell. Schon hatte er das Fasernbündel, das er auf dem Arm trug, zu Boden geworfen und nahm ihr trotz ihres Protestes das schwere Tablett ab.
„Danke“, sagte sie verlegen, ihn mit einem scheuen Blick aus ihren großen graublauen Augen streifend. „Das ist sehr freundlich von Ihnen.“
„Nicht der Rede wert.“ Tom lächelte sie an, während seine Augen Funken sprühten. „Ich … ich wollte Sie schon lange einmal etwas fragen…“
„Ja?“, sagte Adela und senkte die Augen. „Sprechen Sie nur.“
Tom wusste nicht recht, wie er beginnen sollte. „Ich hoffe, meine Frage beleidigt Sie nicht, aber wieso wird ein so hübsches und zartes Mädchen wie Sie Nonne? Und nimmt auf dieser einsamen Insel einen so anstrengenden und nicht ungefährlichen Dienst auf sich?“
„Oh!“, Adelas Wangen färbten sich purpurrot. „Wenn man Jesus dienen will, sollte es ganz selbstverständlich sein, dass man sich der Ärmsten der Armen annimmt. Ich habe mich dazu berufen gefühlt, das Schwerste zu wählen und die Lepra-Kranken zu pflegen. Es war ganz allein meine Entscheidung, Nonne zu werden.“
„Das ist wirklich großartig“, stammelte Tom. „Ich bewundere Ihren Mut.“
Adela nickte, sah sich um und fuhr mit leiser Stimme fort. „Ich muss gestehen, dass mir das einfache Klosterleben zu eintönig war. Ich wollte mehr tun. Hier kann ich wirklich helfen, etwas bewirken. Pater Daniel ist ein leuchtendes Beispiel für mich.“
Tom nickte gedankenvoll, während sie ein Stück schweigend nebeneinander hergingen. „Und was sagt Ihre Familie dazu?“
Adela schüttelte den Kopf. „Nichts! Ich habe keine Familie. Meine Eltern waren Bauern. Sie sind früh gestorben und dann musste ich mit meinem Bruder Louis in ein Waisenhaus. Leider kam Louis auf die falsche Bahn…“ Sie seufzte fast unhörbar. „Er hat sich Menschen angeschlossen, die einen schlechten Einfluss auf ihn haben. Ich konnte ihm nicht helfen.“
„Das hört sich nicht gut an“, erwiderte Tom. „Aber trösten Sie sich, ich kann das verstehen. Ich bin auch eine Waise. Meine Mutter kenne ich nicht – sie hat mich einfach ausgesetzt. Ich war ihr wohl lästig. Im Waisenhaus hat es mir überhaupt nicht gefallen und so bin ich eines Tages einfach abgehauen. Ich musste mich schon sehr früh alleine durchschlagen…“
„Aber warum sind Sie dann … kriminell geworden?“ Adela betonte das Wort und sah ihm neugierig ins Gesicht.
Tom traf dieser Blick mitten ins Herz. „Kriminell? Nein … nein“, stotterte er. „Ich bin nicht kriminell, wenn man von kleinen Diebereien absieht, mit denen ich mich manchmal über Wasser gehalten habe, um essen zu können.
Ich schwöre Ihnen, ich bin völlig unschuldig hier. Genau wie mein Patron. Er ist ein vermögender Mann aus Paris, der auf der Suche nach seinem auf Guadeloupe verschwundenen Vater war. Verbrecher wollten seine ererbte Plantage an sich bringen und haben uns beide gefangen genommen und hierher verschleppt. Diese Männer müssen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden! Aber wie sollen wir die Tat aufklären, wenn wir hier auf dieser Insel sind?“
Schwester Adela machte eine abwehrende Geste. „Nein, schweigen Sie. Jeder Verbrecher behauptet, er sei unschuldig. Ich will das nicht hören!“
Tom sah sie zerknirscht an. „Sie glauben mir nicht, oder? Aber ich schwöre Ihnen beim Herzen Ihres Herrn Jesu, dass ich die Wahrheit spreche. Ich habe nichts Böses getan – genauso wenig wie mein Patron.“
Er sah sie so offen und frei an, dass sich auf Schwester Adelas Gesicht leichte Zweifel malten.
„Ich möchte Ihnen ja gerne glauben…“ Sie blieben stehen und ihre Augen tauchten für eine ganze Weile ineinander, ohne dass sie etwas sagte. Adela spürte auf einmal eine seltsame Verbundenheit mit dem jungen Mann, dessen bernsteinfarbene Augen im Licht der Sonne so eindringlich und ehrlich leuchteten.
Tom versuchte, sein ganzes Herz in seinen Blick zu legen. Er war plötzlich wie berauscht und ihm war, als bliebe die Zeit für einen kurzen Moment stehen. „Schwester Adela!“, stammelte er. „Ich würde Ihnen gerne die ganze Geschichte erzählen, damit Sie mich verstehen und sich selbst ein Urteil bilden können. Mein grausames Schicksal und das meines Patrons, eines wahrhaftigen, edlen Mannes, den ich über alles verehre.“
Adela schüttelte verwirrt den Kopf. „Nein, es tut mir leid. Aber das geht nicht. Das ist gegen die Ordensregel.“ Sie machte ein paar schnelle Schritte voran.
Tom hielt sie mit der freien Hand am Arm fest, während das Tablett bedrohlich schwankte. „Denken Sie darüber nach, was ich Ihnen gesagt habe. Ich spüre, dass Sie ein mitfühlendes Herz haben. Verweilen Sie heute Abend nach der Messe noch eine Weile oben in der Kapelle, um zu beten … bitte!“
„Nein!“ Adela entriss ihm so brüsk das Tablett, dass eines der Tinkturfläschchen hinunterfiel. Ohne es aufzuheben, eilte sie verwirrt und ohne sich noch einmal umzusehen, dem Hospital zu.
Doch Tom lief ihr nach, das Fläschchen in der Hand. „Schwester Adela, bitte warten Sie!“
Der farbige Pförtner am Eingang sah ihn missbilligend an und Tom übergab ihm die Medizin. „Schwester Adela hat wohl nicht gemerkt, dass etwas von ihrem Tablett hinuntergefallen ist“, erklärte er dem Mann.
In diesem Moment kam Pater Daniel die Treppe herunter. Er ging schleppend, und Tom fand, dass er ganz und gar nicht gut aussah, sondern ziemlich übernächtigt wirkte. Seine Augen waren rotgeädert und die Wangen bläulich und wie aufgequollen. „Was machst du hier, Tom?“, fragte er müde. „Hast du keine Arbeit?“
„Doch, doch“, versicherte Tom. „Ich … ich wollte nur fragen, ob man mich vielleicht hier im Hospital brauchen könnte. Sie wissen ja Pater, ich mache jede Arbeit.“
„Mmmh“, murmelte der Pater und sah ihn verwundert an. „Das ist wie ein Wink Gottes. Du kommst mir tatsächlich wie gerufen. Wenn du mir ein wenig im Hospital zur Hand gingst, wäre das sehr hilfreich, denn meine Mitbrüder sind voll beschäftigt. Bruder Eusebius teilt gerade die neu angekommenen Kranken nach Schweregrad ein und Bruder Martin sorgt dafür, dass die leichteren Fälle in den Hütten im Dorf untergebracht werden. Bruder Jacob ist dabei, den Sterbenden, die bald in das Reich Gottes aufgenommen werden, die Beichte abzunehmen. Ich weiß wirklich nicht, wo mir der Kopf steht!“ Er kratzte sein spärliches Haupthaar mit der Tonsur. „Leider müssen wir auch die Toten bei der Hitze sobald wie möglich dem Meer übergeben, denn der Zersetzungsprozess schreitet so rapide voran, dass eine längere Aufbewahrung der Leichen uns gefährden würde. Und dann gibt es noch diejenigen, deren Leben ich nur durch eine Amputation retten kann. Unsere Schwestern sind von der Arbeit überfordert. Ich bin froh, dass du mir assistieren kannst.“
„Und wie … soll das vor sich gehen?“ Tom schluckte. „Ich meine, was muss ich dabei machen?“
„Nichts Schlimmes. Die Kranken werden an einen Holzpflock gebunden und du hältst sie mit aller Kraft fest, während ich operiere.“ Er zuckte die Schultern, als er Toms entsetzten Blick auffing. „Nun ja, wir haben zwar ein Narkotikum, aber ich muss sparsam damit umgehen, denn so schnell kommt kein Nachschub mehr vom Festland.“
Tom überlief ein Schreckensschauer nach dem anderen. Konnte er doch kaum in ein von der Lepra zerfressenes Gesicht eines Kranken sehen, auf die von den Lippen entblößten Kiefer, in das schwärende Loch, das einmal eine Nase gewesen war, die eitrigen Wunden, in die sich mit Vorliebe die Fliegen setzten. Ihm wurde schon schlecht, wenn er auch nur einen Tropfen Blut sah. Doch dann dachte er an Schwester Adela und straffte den Rücken. Wenn die zarte Adela so etwas schaffte, dann musste er das doch erst recht können!
„Wann … brauchen Sie mich?“, murmelte er mit blutleeren Lippen.
„Gleich“, beschied ihm der Pater. „Komm mit!“
Er ging voraus und Tom folgte ihm mit einem lautlosen Würgen in der Kehle.
Kapitel 3
Julie saß am Schreibtisch und tauchte die Feder in das Tintenfass. Unzufrieden strich sie das bereits Geschriebene wieder aus. Das peinliche Zusammentreffen mit Marcel war bereits einige Tage her, aber noch hatte sie der Mutter, die weiter leidend war, nichts von der Begegnung mit ihm und seiner Familie erzählt. Im Grunde war sie heilfroh, dass Marcel von sich aus die Verlobung gelöst hatte. Er war ihr beim Wiedersehen so fremd gewesen, als sähe sie ihn zum ersten Mal. Ihre Beziehung war nichts weiter als eine Jugendschwärmerei gewesen, eine Luftblase, die längst zerplatzt war. Erst in der kleinen Bucht auf Guadeloupe hatte sie erkannt, was Liebe, was Leidenschaft überhaupt bedeutete – und wie schmerzhaft es war, wenn diese Gefühle nicht erwidert wurden.
Die Sehnsucht nach Charles quälte sie immer noch. Sie musste ständig an das Plakat denken, dass sie zufällig am Luxembourg Park gesehen hatte. Das Konzert von Charles und Solange sollte im Salle Pleyel am Freitag nächster Woche stattfinden und sie kämpfte mit sich, ob sie hingehen sollte oder nicht. Würde das Feuer in ihrem Herzen nicht noch heißer brennen, wenn sie das Konzert besuchte, Charles wieder spielen hörte? Zusehen musste, wie glücklich er mit Solange in Paris lebte? Warum konnte sie sich nicht von ihm lösen, obwohl sie wusste, dass ihre Liebe nicht erwidert wurde? Es war wie ein Zwang, in jeder Minute an ihn denken zu müssen.
Sie schrak zusammen, als es diskret an der Tür klopfte. André trat ein. Er strahlte über das ganze Gesicht und hielt ihr die Zeitung hin, die Revue des deux Mondes. „Das zweite Kapitel, Mademoiselle! Gerade im Feuilleton erschienen! Sehen Sie nur!“
Aufgeregt riss Julie ihm das Blatt aus der Hand. „Wirklich? So schnell?“
„Es hat Aufsehen erregt durch seine Aktualität, sagte mir der Verleger. Und die Kritiken sind gut. Nun will man natürlich mehr von Jules Potin lesen. Die Fortsetzung soll gleich in der nächsten Ausgabe gedruckt werden. Er sagte, die Leser wollten unbedingt wissen, ob das Amulett, das die Wahrsagerin der Heldin Louise ins Boot nachgeworfen hat, ihr geholfen hat, den Vater zu finden.“ Er hielt ihr triumphierend einen Umschlag hin, in dem ein Scheck lag. „Und das ist auch für Sie.“
„Großartig! Ich zahle Ihnen Ihren Anteil aus, wenn ich ihn eingelöst habe.“
„Aber nicht doch…“ André machte eine höflich abwehrende Bewegung, doch seine Wangen glänzten rot vor Freude.
Aufgeregt kramte Julie unter dem Wust von Papieren auf ihrem Schreibtisch ein Blatt hervor. „Ich habe bereits weitergeschrieben, muss aber noch ein bisschen am Text feilen.“
„Tun Sie das. Ich bringe ihn dann in die Redaktion, wenn Sie fertig sind!“
André verschwand hinter der Tür und auf Julies Lippen zeichnete sich ein stolzes Lächeln ab. Was für eine Überraschung – sie hatte Erfolg, dabei schrieb sie nur ihre eigene Geschichte auf, die mysteriösen Ereignisse, die sie mit ihrem Amulett und auf Guadeloupe erlebt hatte!
Sie griff nach dem Amulett, der Holzscheibe mit den silbernen Beschlägen, die sie seit einiger Zeit um den Hals trug und nie ablegte. Wieder einmal betrachtete sie die geheimnisvollen Symbole und die Steine, die in gefahrvollen Momenten einen besonderen Glanz annahmen. Seit einiger Zeit wirkten sie matt und Julie fragte sich, ob sie die früheren Veränderungen des Amuletts nicht einfach nur geträumt hatte. Nach all den Schicksalsschlägen, der tristen Rückkehr nach Paris mit der kranken Mutter und der Trennung von Marcel tat das Aufschreiben ihrer Erlebnisse auf Guadeloupe ihr gut. Es lenkte sie ab, trug sie in die andere Welt und ließ sie ihre traurigen und aufwühlenden Erlebnisse vergessen und leichter verarbeiten. Aber sie hätte nie gedacht, dass ihre Erlebnisse auf der fernen Insel das breite Pariser Publikum interessieren würden.
Leise erhob sie sich und betrat auf Zehenspitzen das Zimmer der Mutter, um nach ihr zu sehen. Sie lag die meiste Zeit apathisch in ihrem Bett oder auf dem Sofa. Lesen und Malen, alles, was sie früher mit Freude ausgeübt hatte, interessierte sie nicht mehr. Sogar die Konversation mit ihrer Tochter blieb einsilbig.
Julie hatte die Mutter in dem Glauben gelassen, sie und Marcel würden bald heiraten. Aber vielleicht ahnte die Mutter ja die Wahrheit. Sie hatte nur einmal gefragt, wann die Zeremonie denn stattfinden würde. Julies Antwort war ausweichend gewesen und danach hatten sie nie mehr darüber gesprochen. Ihr Arzt, Doktor Turbot, schüttelte manches Mal verständnislos den Kopf. Auch er versuchte alles, um sie aus dem depressiven Zustand, in den sie nach dem Tod ihres Mannes und ihres Sohnes gefallen war, herauszuholen. Schröpfgläser, Tees, Einreibungen, Klistiere und Medikamente halfen nicht. Es war, als ginge Manon das alles nichts mehr an, als wollte sie einfach nicht mehr leben.
Mit Hilfe der Pflegerin führte Julie die Mutter jeden Abend an den Esstisch im Speisezimmer, wo sie mit ihr das Dîner einnahm. Sie versuchte jedes Mal, ein Thema zu finden, das die Mutter interessieren könnte, oder mit ihr über Dinge des Haushalts und der Finanzen zu besprechen. Doch die Unterhaltungen blieben einseitig und die Mutter schien erleichtert, wenn sie mit dem gewohnten Schlafmittel versorgt zu Bett gehen konnte. Es war, als wäre die natürliche Verbindung von Mutter und Tochter auf seltsame Weise unterbrochen, so als wäre Julie plötzlich eine Fremde für sie geworden.