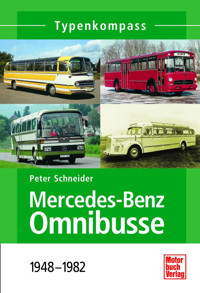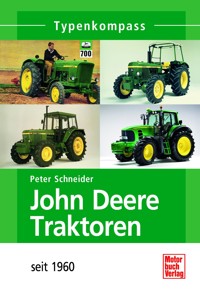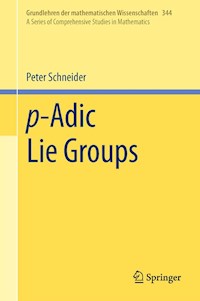10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Berlin ist das Aschenputtel unter Europas Hauptstädten – und doch will jeder dorthin Dieses Buch ist das Ergebnis einer Recherche, die Peter Schneider über seine Wahlheimat, die »ewig unfertige Stadt« Berlin angestellt hat. Kein Stadtführer, kein Loblied, das sich für die Berlin-Werbung eignet, sondern ein persönliches und poetisches Porträt, das den alten und neuen Absurditäten der Stadt nachspürt. Es ist nicht die schönste und auch nicht die älteste Hauptstadt Europas. Sie kann weder auf eine Altstadt noch auf Renaissance-Bauten noch auf ein weltberühmtes Bankenviertel verweisen. Wer nach aufregender moderner Architektur sucht, fährt lieber nach London, Paris und Barcelona. »Aber wenn ich in New York, in Tel Aviv oder in Rom auf die Frage eines Einheimischen, woher ich komme, den Namen Berlin ausspreche, tritt unversehens Neugier, ja, Begeisterung in die Augen des Fragenden. Ohne jedes Zögern wird er mir von seinem letzten oder gerade geplanten Berlin-Besuch erzählen, kann mir aber nicht so recht erklären, warum er sich ausgerechnet in diese Stadt verliebt hat.« Vergeblich sucht Peter Schneider mit Ironie und Empathie eineBalance zwischen Liebeserklärung und Wutausbruch; ziemlich verlässlich bleibt nur der scharfe Blick und der Witz seiner Darstellung. Es ist nicht das erste Mal, dass der Autor seiner Stadt den Puls nimmt. Legendär ist sein »Mauerspringer« aus dem Jahr 1982, in dem er das Wort von der »Mauer im Kopf« prägte und voraussagte, sie würde länger stehen bleiben als »das Ding aus Beton«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Peter Schneider
An der Schönheit kann’s nicht liegen
Berlin – Porträt einer ewig unfertigen Stadt
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Peter Schneider
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Peter Schneider
Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er Germanistik, Geschichte und Philosophie studierte. Im Bundestagswahlkampf von 1965 schrieb er Reden für SPD-Politiker. 1967/68 avancierte Schneider zu einem der Wortführer der 68er-Bewegung. Er beendete seine Ausbildung 1972 in Berlin. 1973 wurde ihm als Referendar Berufsverbot erteilt. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer«, (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D.C. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen bisher seine Titel »Lenz« (KiWi 1032, 2008), »Rebellion und Wahn«, 2008 (KiWi 1177, 2010), »Die Lieben meiner Mutter«, 2013.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Es ist nicht die schönste und auch nicht die älteste Hauptstadt Europas. Sie kann weder auf eine Altstadt noch auf Renaissance-Bauten noch auf ein weltberühmtes Bankenviertel verweisen. Wer nach aufregender moderner Architektur sucht, fährt lieber nach London, Paris und Barcelona.
»Aber wenn ich in New York, in Tel Aviv oder in Rom auf die Frage eines Einheimischen, woher ich komme, den Namen Berlin ausspreche, tritt unversehens Neugier, ja Begeisterung in die Augen des Fragenden. Ohne jedes Zögern wird er mir von seinem letzten oder gerade geplanten Berlin-Besuch erzählen, kann mir aber nicht so recht erklären, warum er sich ausgerechnet in diese Stadt verliebt hat.«
Vergeblich sucht Peter Schneider mit Ironie und Empathie eine Balance zwischen Liebeserklärung und Zorn; ziemlich verlässlich bleibt nur der scharfe Blick und der Witz seiner Darstellung.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Autor seiner Stadt den Puls nimmt. Legendär ist sein »Mauerspringer« aus dem Jahr 1982, in dem er das Wort von der »Mauer im Kopf« prägte und voraussagte, sie würde länger stehen bleiben als »das Ding aus Beton«.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Christian Reister / agefotostock / Avenue Images
ISBN978-3-462-30897-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Aschenputtel Berlin
Das große Erwachen
Der Streit der Architekten
Potsdamer Platz
Schloss versus Palast der Republik
City West versus Hauptstadt (Ost) – und umgekehrt
Bauen als Akt der Menschheitsbeglückung
Teil 2
Ankunft in Westberlin (aus dem Süden)
Ankunft in Westberlin (aus dem Osten)
Selbständige politische Einheit Westberlin
Was wurde eigentlich aus der Mauer?
Wo ist die Mitte?
Teil 3
Sex und Liebe in Berlin
… im geteilten Berlin
… nach dem Mauerfall
Clubs
Teil 4
Besuch in einem Hauptstadtbunker
The American sector is leaving you
Das Stasi-Erbe
Ein »Staatsfeind« wird Chef
Teil 5
Der neue Rassismus
Anetta Kahane und die Antonio Amadeu Stiftung
Lust an Gewalt gegen Schwächere
Necla Kelek und ihr Kampf für eine zweite Emanzipation
Ein Bürgermeister verstößt gegen die Political Correctness
Hilfe, die Schwaben kommen!
Teil 6
Nachgeholter Besuch auf einem Friedhof
Der Mann, der Nofretete verschenkte
»Wir waren Nachbarn«
Jüdisches Leben in Berlin
Junge Israelis in Berlin
Frühling in Berlin
Teil 1
Aschenputtel Berlin
Es ist gar nicht so leicht, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum Berlin seit einigen Jahren eine der beliebtesten Metropolen der Welt ist. An der Schönheit der Stadt kann es nicht liegen. Denn Berlin ist nicht schön, Berlin ist das Aschenputtel unter Europas Hauptstädten.
Wer hier auf einer Dachterrasse steht, blickt nicht auf die Kuppeln Roms oder auf die Zinkdächer von Paris oder in die Häuserschluchten von New York. Er sieht auch nichts Spektakuläres, irgendwie Aufregendes oder gar Monströses. Keinen Pool im 72. Stockwerk, keinen Palmengarten in schwindelnder Höhe, kein Casino hoch über den Dächern, das dem Spieler nach einem unerträglichen Verlust einen berauschenden Sturz von der Terrasse verspricht. Dem Betrachter bietet sich das Bild einer gleichförmigen Landschaft von vier- bis sechsstöckigen Häusern, deren rote Giebeldächer für Dachwohnungen und üppige Terrassen nicht vorgesehen waren. Erst vor dreißig Jahren, nicht lange vor dem Mauerfall, entdeckten die Westberliner, dass man über den Kastanien und Linden der Stadt bedeutend besser lebt als in ihrem Schatten. Zögernd begannen sie, Fenster und Terrassen in die Dächer zu schneiden. Dort sitzen sie nun in bescheidener Höhe zwischen vereinzelten Büro- und Hotelhochbauten, deren Inspirationsquelle in aller Regel der hochkant gestellte Schuhkarton gewesen ist. Im Westen ragt der Funkturm aus dem Häusermeer, im Osten blinkt der 368 Meter hohe Fernsehturm, in dessen stählerne Kugelplattform die Sonne am Nachmittag ein leuchtendes Kreuz zeichnet – zum Ärger der kommunistischen Bauherren, die mit dem Turm die »Sieghaftigkeit des Sozialismus« beweisen wollten. Die Berliner tauften das Lichtkreuz geistesgegenwärtig auf den Namen »Rache des Papstes«. Die Erscheinung war ebenso verblüffend wie unerklärlich und ließ sich nicht beseitigen. Sie kündigte die Zukunft an: das Ende der DDR.
Die Bewohner in der neuen Stadtmitte mussten mit dem Ausbau ihrer Dachwohnungen bis zur Wiedervereinigung der beiden Stadthälften warten. Und zugegeben: Sie haben eine bessere Aussicht. Sie blicken auf ein paar großstädtische Ikonen – auf die vergoldete Kuppel der wiederhergestellten Synagoge an der Oranienburger Straße, weiter weg auf das Reichstagsgebäude, das Sir Norman Foster durch die aufgesetzte Glaskuppel um Tonnen seines historischen Gewichts erleichtert hat, auf das vom Staub der DDR-Jahre befreite Brandenburger Tor mit der restaurierten Reitergruppe. Und weiter weg, auf das Zirkuszelt von Helmut Jahn und die Hochhäuser von Renzo Piano und Heinz Kollhoff an Berlins einst prominentester Leerstelle: am Potsdamer Platz.
Aber bisher hat kein Fassadenkletterer eines der neuen Hochhäuser für würdig befunden, es zu erklimmen – offenbar sind sie nicht hoch genug. Kein Philippe Petit ist auf die Idee gekommen, zwischen Berlins Bürotürmen am Potsdamer Platz ein Seil zu spannen und darauf hin und her zu laufen. Eine Großstadt, in der ein Hotelneubau mit 118,8 Meter Höhe (das Waldorf-Astoria) einen Höhenrekord melden kann, ist kein Magnet für Extremsportler. Im Vergleich zu den Skylines von Manhattan, Chicago oder auch Frankfurt wirkt der frisch bebaute Himmel von Berlin immer noch wie die Silhouette einer Provinzhauptstadt. Auch sonst fehlt Berlin, von oben gesehen, alles, was eine Metropole ausmacht. Die Stadt hat kein Bankenviertel wie Manhattan oder London, keinen in Jahrhunderten errichteten ehrwürdigen Dom wie Köln oder Paris, kein berüchtigtes Amüsierviertel wie Hamburg. Selbst Berlins Eiffelturm – der schon erwähnte Funkturm – ist eine bescheidene Kopie des Originals in Paris.
Ein Freund aus Rom, der Schriftsteller Edoardo Albinati, erzählte mir von seinem ersten Besuch in Berlin. In den neunziger Jahren stieg er am Bahnhof Zoo aus und sah sich um. Er blickte auf den trostlosen Vorplatz mit seinen Wechselstuben und Imbissständen, auf den im Krieg zerstörten Turm der Gedächtniskirche, auf das Bilka-Kaufhaus mit seinem einst für kühn gehaltenen Fassadenschmuck von schrägen, sich kreuzenden Parallelen, auf den Zoopalast, der ein gemaltes Werbeplakat für einen amerikanischen Actionfilm zeigte. Aber wohin er auch seinen Blick schweifen ließ, er entdeckte nichts, keinen Torbogen, keine Kuppel, keinen Kirchturm, keine Fassade, auf der sein verwöhntes italienisches Auge hätte Ruhe finden können. Dass ihn dieser Platz auf sich selbst zurückwarf, erschien ihm als das einzig Bemerkenswerte. Sein Urteil milderte sich ein wenig nach einigen Rundgängen, aber schlug nie in ein Wohlgefühl um. Berlin, gestand er mir mit einem höflichen Lächeln, sei mit Abstand die hässlichste Hauptstadt, die er je gesehen habe.
Aber inzwischen kommen jedes Jahr Zehntausende von Italienern und erfüllen die Straßen der nordischen Metropole mit dem Wohllaut ihrer Sprache. An Silvester, wenn die Einheimischen bei 10 Grad minus lieber zu Hause bleiben und den Fernseher anschalten, strömen die italienischen Touristen in Scharen zum Brandenburger Tor, um dort unter dem berühmten Berliner Feuerwerk – in Rom ist Derartiges verboten! – das neue Jahr zu begrüßen. Und wenn ich in New York, in Tel Aviv oder in Rom auf die Frage eines Einheimischen, woher ich komme, den Namen Berlin ausspreche, tritt unversehens Neugier, ja Begeisterung in die Augen des Fragenden. Ohne jedes Zögern wird er mir von seinem letzten oder gerade geplanten Berlinbesuch erzählen, kann mir aber nicht so recht erklären, warum er sich ausgerechnet in diese Stadt verliebt hat. Das rituelle Wort »schön« mag in seiner Beschreibung vorkommen, aber trifft nicht, was ihn anzieht. Die Namen von anderen, weit schöneren europäischen Metropolen lösen keine vergleichbaren Emotionen aus.
Wenn Schönheit nicht der Punkt ist, was ist es dann? Wenn ich einen Zwanzigjährigen, gleich welcher Nationalität, frage, ist der Fall klar. Berlin ist die einzige Großstadt weit und breit, in der es keine Polizeistunde gibt, in der man für zehn bis zwanzig Euro essen und/oder sich besaufen und mit der S-Bahn auch noch morgens um vier jeden Club erreichen kann. Ist es das? Nicht ganz! Zur Attraktivität Berlins gehört wohl auch die Geschichte der Stadt im Guten wie im Monströsen: Berlin, die »Weltmetropole der zwanziger Jahre«, in der sich eine internationale Boheme zu Hause fühlte, Berlin, die »Hauptstadt des Dritten Reiches«, in der die ungeheuerlichsten Verbrechen ausgebrütet wurden, Berlin, die »Mauerstadt«, die 29 Jahre lang geteilt und schließlich wiedervereinigt wurde. Kaum eine andere Stadt hat in den letzten hundert Jahren so extreme Wandlungen erlebt.
Es war schon eine erstaunliche Fehlleistung der Stadtväter, dass sie nach dem Fall der Mauer nicht Sorge dafür trugen, dass wenigstens ein dreißig Meter langes Stück der Grenzanlage – mitsamt Todesstreifen, Wachtürmen, Hundelaufanlagen und der zweiten hinteren Mauer – für die Nachwelt erhalten blieb. Schließlich kam der durchschnittliche Berlintourist ja nicht, um die Berliner Philharmoniker zu hören oder das Pergamonmuseum zu besuchen – er wollte die Mauer sehen. Die Mauer war nun einmal das berühmteste Bauwerk Berlins, sozusagen das deutsche Gegenstück zur Statue of Liberty.
Allerdings muss man den Regierenden zugutehalten, dass der Schutz eines noch so kleinen Teilstücks der Mauer in den wilden Tagen nach dem 9. November 1989 ein schwieriges Unterfangen gewesen wäre. Zehntausende von Einheimischen und Besuchern aus aller Welt hieben wochenlang mit Hammer und Meißel auf das Unding ein. Was hätten sie gesagt, wenn die Polizei einen Mauerabschnitt abgeriegelt hätte – im Auftrag des Denkmalschutzes? Welche Bilder und welche Schlagzeilen in der Weltpresse hätte eine solche Maßnahme ausgelöst? Etwa diese: Die Grenztruppen der DDR haben aufgegeben, nun schützt die Westberliner Polizei die Mauer!
Inzwischen haben es die Manager der Berlintouristik begriffen: Es sind nicht zuletzt die Mahnmale der Verbrechen, die Bunker und die Berliner Unterwelt, die das Interesse anziehen. Das Holocaust-Mahnmal verzeichnet Jahr für Jahr weit über eine Million Besucher, mehr als 500000 Menschen bestaunten im Jahr 2013 die neu errichtete Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße. 360000 Berlintouristen wollen Jahr für Jahr das Gefängnis Hohenschönhausen (das Spezialgefängnis des Geheimdienstes der ehemaligen DDR) sehen und lassen sich von ehemaligen Häftlingen erklären, was sie in den Zellen und den Verhören der Stasi zu erdulden hatten. Ebenso viele nehmen an den Führungen der »Berliner Unterwelten« teil, die ihren Gästen einen zweistündigen Rundgang durch das unterirdische Berlin mit seinen Bunkern, Tunneln und Fertigungsstätten für Sklavenarbeiter anbietet – nicht ohne auf die Gefahren für platzangstgefährdete Teilnehmer hinzuweisen. Die Erschließung weiterer Rundgänge durch das unterirdische Berlin ist erst am Anfang. Gerade einmal ein bis zwei Prozent der unterirdischen Anlagen, versicherte mir ein Führer der »Berliner Unterwelten«, sind bisher für touristische Besichtigungen erschlossen und gesichert.
Inzwischen kommt die Hälfte der Berlintouristen aus dem Ausland, und der jährliche Zuwachs ist enorm. Schon sagen einige Prognosen voraus, die Stadt mit ihren knapp 27 Millionen Übernachtungen könne bald Paris einholen und damit auf den zweiten Platz hinter London klettern. Ob es den Fachleuten der Berlintouristik gefällt oder nicht: Die dunkle Vergangenheit dieser Stadt gehören zu ihren Attraktionen. Man kann nur froh sein, dass der »Führerbunker« nicht begehbar ist. Wäre er noch zugänglich, er wäre – spätestens nach dem Film »Der Untergang« über Hitlers letzte Tage – womöglich zur begehrtesten von Berlins »Sehenswürdigkeiten« geworden. Zum Glück wurden die Zugänge zu der 250 Quadratmeter großen Anlage, die die Rote Armee vergeblich zu sprengen suchte, überbaut. Die Position des Führerbunkers ist heute mit einer Informationstafel gekennzeichnet, die vom Verein »Berliner Unterwelten« kurz vor der Fußballweltmeisterschaft am 8. Juni 2006 aufgestellt wurde.
Die Zerstörungen des alten Stadtbilds, die den beiden Diktaturen folgten, prägen die Architektur Berlins bis heute – trotz und wegen aller Neuanfänge. Aber dieser Mangel tut der Neugier der Besucher aus aller Welt keinen Abbruch. Was sie nach Berlin zieht, ist offenbar gerade das, was ihnen in den schönen Städten fehlt: das Schräge, ewig Unfertige, das Haarsträubende an Berlin – und die Lebendigkeit, die mit diesen Eigenschaften einhergeht. Berlin sei »dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein«, schrieb der Schriftsteller Karl Scheffler in seiner 1910 veröffentlichten Polemik »Berlin, ein Stadtschicksal«. Scheffler bezeichnete Berlin als ein traditions- und stilloses Stadtgebilde, das »von einem grundlegenden Mangel an organisch gewachsener Struktur bestimmt« sei. Scheffler hat den genetischen Code von Berlin benannt, aber dessen Attraktivität gewaltig unterschätzt. Unvollkommenheit, Unfertigkeit, ja Hässlichkeit gewähren eine Freiheit, die kompakte Schönheit niemals bieten kann. In schönen, perfekt restaurierten und teuren Städten fühlt sich der junge Besucher ausgeschlossen. Er schaut sich um und weiß: Hier sind alle Plätze schon vergeben. Berlin, das Aschenputtel, hat gegenüber den Prinzessinnen unter den Städten einen unschätzbaren Vorteil. Berlin gibt jedem Ankömmling das Gefühl, dass er hier noch eine Lücke finden und etwas auf die Beine stellen kann. Es ist diese Eigenart Berlins, die die Stadt heute zur Hauptstadt der Kreativen aus aller Welt macht.
Vor zwanzig Jahren, kurz nach dem Fall der Mauer, schrieb ich für das Wochenmagazin Der Spiegel eine kleine Serie über die Stadt und ihren bevorstehenden Umbau. Ich wollte wissen, was die Stadtplaner und Architekten mit »meiner Stadt« vorhatten. Mein wichtigster Gesprächspartner ist damals der Verleger und Publizist Wolf Jobst Siedler gewesen, einer der besten Kenner der Stadt. Ich erinnere mich an einen gemeinsamen Spaziergang auf dem Kurfürstendamm. Auf der Höhe des Lehniner Platzes liefen wir in die Cicerostraße, eine stille Seitenstraße des Kurfürstendamms. Die Wohnanlage aus den zwanziger Jahren mit ihren wellenförmig geschwungenen Fassaden war von dem großen Architekten Erich Mendelsohn erbaut worden »Kein Zweifel«, kommentierte Siedler, »es ist eine der schönsten Wohnanlagen von Berlin. Aber schauen Sie genau hin. Die ganze Anlage ist tot, ein Rentnerparadies, egal, wie viele junge Leute darin wohnen mögen. Es gibt kein Geschäft, keine Kneipe, keinen Ort für ein Leben außerhalb der Wohnungen. Nur die Tennisanlage im Inneren der Wohnanlage schafft Atemluft.«
Zufällig wusste ich genau, wovon Siedler sprach. Denn auf den neun von hohen Pappeln umstandenen Tennisplätzen, die fünf Gehminuten entfernt von meiner Wohnung lagen, hatte ich einen guten Teil meines Berliner Lebens verbracht. In der extremen Stille von Mendelsohns Anlage hatten die Aufschläge der Tennisspieler wie Schussgeräusche in einem Bürgerkrieg geklungen und immer wieder zu Protesten der Anwohner geführt. Ganz zu schweigen von den lautstark ausgetragenen Streitigkeiten der Spieler darüber, ob ein Ball aus war oder gerade noch die Linie berührt hatte.
»Sie werden sich immer wieder zwischen der Schönheit eines Ortes und seiner Lebendigkeit entscheiden müssen«, sagte Siedler, der in seinen Büchern wortgewaltig wie kaum ein anderer die vergessenen und misshandelten Schönheiten von Berlin beschworen hat.
Es muss an Berlin liegen, dass mir dieser Satz deutlicher als jeder andere, den ich bei meinen Recherchen hörte, in Erinnerung geblieben ist. Denn Schönheit und Lebendigkeit kommen in dieser Stadt selten zusammen.
Genug der Spekulationen und Reminiszenzen. Ich erzähle lieber eine Geschichte, die ich gerade hörte. Mein Sohn hatte mit zwei Berliner Freunden eine billige Dachwohnung in Berlin-Neukölln bezogen. Der Stadtteil Neukölln mit der höchsten Arbeitslosigkeit in Berlin (17 Prozent) und seiner großen muslimischen Bevölkerung galt vor Kurzem als ein zum Untergang verurteilter Stadtteil. Aber mein Sohn und seine Freunde setzten auf Neukölln – denn inzwischen waren junge Leute aus Nachbarstadtteilen, die durch den Fall der Mauer unversehens in die Mitte der Stadt geraten waren und die neuen Mieten nicht mehr bezahlen konnten, nach Neukölln gezogen. Sie hatten dort ein paar Internet-Start-up-Unternehmen, Bioläden, Galerien gegründet, ja sogar ein Restaurant für Veganer aufgemacht.
Die drei Freunde bekamen für ihre Dachwohnung in Neukölln von einem Onkel eine alte dreisitzige Ledercouch geschenkt. Sie wollten das klobige Stück unbedingt am selben Tag in ihre Wohnung schaffen. Aber inzwischen war es dunkel geworden, und die Leihwagen-Firmen waren längst geschlossen. Also wuchteten sie das Sofa hoch, trugen es aus dem Haus des Onkels auf die Straße und wanderten mit dem Möbel auf den Köpfen drei Straßenecken weiter zur nächsten S-Bahn-Station. Zwischendurch setzten sie das Sofa vor einem Brunnen ab, nahmen darin Platz, erwiderten die Grüße der Passanten und genehmigten sich ein paar Schnäpse aus einer mitgebrachten Flasche. Niemand hielt sie auf, als sie das Sofa im barrierefreien S-Bahnhof hinauf zu den Gleisen trugen. Als der Zug einfuhr und sich die automatischen Türen öffneten, schoben sie das Möbelstück in den Waggon. Wunderbarerweise passte es genau in den Freiraum hinter den automatischen Türen. Die drei setzten sich in ihre Komfortsitze und genossen so die Fahrt. Einige Passagiere lachten, andere wollten mit den dreien die Plätze tauschen, schließlich brach der ganze Waggon in Beifall aus. »Das ist Berlin!«, rief einer, andere nahmen die Losung auf. »Das ist Berlin!«, so hallte es im Waggon.
Nach der Fahrt kam der strapaziöseste Teil des Transports: Die drei mussten ihr Sofa erst ein paar Straßen weiter und dann fünf Treppen hoch in ihre Dachwohnung schleppen. Es gelang, weil es gelingen musste. Das gewaltige Möbel brachte sie in den engen Treppenkehren zur Verzweiflung, aber ein Zurück gab es nicht. In der Dachwohnung angekommen, setzten sie das Ungetüm ab, bedienten sich aus ihrer gut ausgestatteten Schnapsbar, feierten erst sich, dann Berlin und schliefen auf dem Sofa ein.
Das große Erwachen
Die Bilder von der Nacht zwischen dem 9. und 10. November sind in die Annalen der Geschichte eingegangen. Zum ersten Mal sah die Welt ausgelassen feiernde und tanzende Deutsche und feierte mit ihnen. Der blonde Hollywood-Deutsche, der die Hacken zusammenschlägt und brüllt: »Zu Befehl, Obersturmbannführer!«, verschwand für eine Weile im Archiv. Weniger bekannt, bebildert und beschrieben als der Fall der Mauer ist das allmähliche Zusammenwachsen der Stadt in den Monaten und Jahren, die dem welthistorischen Datum folgten.
Die Öffnung der Mauer hatte vor allem auf die östliche Hälfte der geteilten Stadt wie das Erwachen aus einer Schlafkrankheit gewirkt. Wie von einem Zauberstab berührt, begann sich der taube Riesenleib zu regen und sprengte mit einem gewaltigen Luftholen die Fesseln aus Stahlbeton, Stacheldraht und Eisengittern, in die er durch das kommunistische Regime gelegt worden war. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit wuchsen die abgeklemmten Adern und Glieder der geteilten Stadt zusammen. Westberliner Straßen verlängerten sich in den Osten und mussten erst einmal mit den fremden Namen ihrer wiedergefundenen anderen Hälfte leben. Verplombte S- und U-Bahnhöfe an der Grenze, durch die die Züge 28 Jahre lang hindurchgedonnert waren, wurden wieder in Betrieb genommen. Brücken, Plätze und Grundstücke suchten und fanden ihre andere Hälfte. Die Drahtgitter in den Kanälen, die nach dem Bau der Mauer angebracht worden waren, um auch alle unterirdischen Fluchtwege zu blockieren, wurden abgeräumt. Selbst das Wasser in der Spree und in Berlins Kanälen schien plötzlich freier zu fließen, die Seen schienen sich zu vergrößern, nachdem die von bewaffneten Grenzpolizisten bewachten Grenzbojen abgeräumt waren. Der Himmel, ja, auch der Himmel über Berlin kam uns plötzlich blauer und weniger grau vor, wenn es regnete. Die einst berühmte Berliner Luft – ein findiger Unternehmer hatte sie in den zwanziger Jahren in Büchsen verkauft – ließ sich ab dem 10. November wieder besser atmen. Was natürlich auf Einbildung beruhte. Aber die Realität näherte sich dieser Einbildung in den folgenden Jahren mit erstaunlicher Geschwindigkeit an. Tatsächlich hatte die Berliner Luft in den achtziger Jahren wegen der ungefilterten DDR-Industrieanlagen und der vorwiegend mit Braunkohle beheizten Öfen in Ostberlin nahezu chinesische Schmutzwerte erreicht. Nach der Vereinigung wurden die größten Dreckschleudern der DDR geschlossen oder mit Filteranlagen ausgestattet. Die Berliner Luft hatte plötzlich einen Beigeschmack von Kokain.
Die Reflexe der Bewohner hielten mit den jähen Veränderungen nicht Schritt. Ich erinnere mich, dass ich noch viele Jahre nach dem Fall der Mauer Schwierigkeiten hatte, die neuen direkten Wege nach Ostberlin zu benutzen. Mein in den Jahren der Teilung erlernter innerer Kompass lenkte mich und mein Auto automatisch zu den Transitstellen, die ich in den Jahren der Mauer genommen hatte. Immer wieder und zu meinem Ärger geriet ich auf die alten Umwege. Nichts erschien mir so schwierig wie die Aufgabe, einfach geradeaus von Westen nach Osten zu fahren.
Was die Unbelehrbarkeit meiner Reflexe betrifft, fühlte ich mich erst durch einen Beitrag des Bayerischen Fernsehens verstanden. Der Film schilderte das rätselhafte Verhalten von Rotwild an der bayerisch-tschechischen Grenze. Er zeigte, dass Hirsche und Rehe noch in den neunziger Jahren vor der längst abgeräumten Grenze aus Stacheldraht instinktiv halt- und kehrtmachten. Am merkwürdigsten sei, behauptete der Autor des Films, dass auch Jungtiere, die diesen Zaun nie gekannt hatten, dasselbe Verhalten zeigten wie ihre Eltern. Vererbten sich solche erlernten Grenzreflexe auf die nächste Generation, fragte er. Konnte es sein, dass die Grenzerfahrung der Eltern bis in die nächste und vielleicht in die übernächste Generation fortwirkte?
Man hat Berlin oft mit New York City verglichen – der Vergleich gefällt den Berlinern, den New Yorkern erscheint er leicht vermessen. Denn es springt ja ins Auge, dass der Vergleich sich nur auf den Lebensstil der beiden Städte beziehen kann, nicht auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Und was den Lebensstil von Berlin angeht, so erinnert er eher an den von Manhattan vor zwanzig Jahren – bevor Rudolph Giuliani kam.
Es gibt eine andere amerikanische Stadt, die viel mit Berlin gemein hat, allerdings ist der Vergleich nicht so schmeichelhaft wie der mit New York. Er wurde den Besuchern der Berliner Fotoausstellung »Die Ruinen von Detroit« im Frühjahr 2012 eindrucksvoll vor Augen geführt. Die französischen Fotokünstler Romain Meffre und Yves Marchand inszenierten auf riesig vergrößerten Exponaten die verfallenen Ikonen der Stadt Detroit: eine stillgelegte Wartehalle des Michigan-Bahnhofs; den prachtvollen Zuschauerraum des Filmtheaters von United Artists, das von Charlie Chaplin mitbegründet wurde; die verlassene Werkhalle einer Firma, die für Detroits Autobauer einmal Karosserien gefertigt hatte; den prachtvollen Innenraum des National Theatre, in dem – vor seiner endgültigen Schließung Mitte der siebziger Jahre – nur noch Sexfilme gezeigt wurden. Man spürte und ahnte im Staub und Schutt dieser verfallenen Räume die Träume und den Machtwillen der Erbauer von Detroit, aber auch den Schweiß und die Sehnsüchte der Abertausenden, die dort gearbeitet hatten. Nur die prachtvoll gestalteten Deckengewölbe mit ihren farbenfrohen Arabesken hatten dem Verfall getrotzt. Die Fotos zeigten eine Stadt, die das Industriezeitalter miterschaffen und den Glanz und die Macht der USA repräsentiert hatte, im Stadium des Zerfalls und der Verlassenheit – in der Phase ihrer Mumifizierung. Städte, das verkündeten die Bilder, sind weit verletzbarer und kurzlebiger als Menschen. In der Spanne eines Menschenlebens können sich Städte bis zur Unkenntlichkeit verändern – und dies sogar mehrmals. Tatsächlich habe ich in meinen Berliner Jahren drei Versionen der Stadt gesehen und habe Mühe, mich an das Berlin zu erinnern, in das ich vor einem halben Jahrhundert mit dem Zug von Westen eingefahren war.
Aber die Poesie der Bilder von Detroit kam erst durch den Ort der Ausstellung zur Geltung. Sie fand statt in einem achtstöckigen Ziegelbau am Gleisdreieck, in der ehemaligen ersten Kühlanlage Berlins, in der seit über hundert Jahren Fleisch und Gemüse gekühlt worden waren. Bereits in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts waren die Firmen, die hier ihre Waren eingelagert hatten, ausgezogen und hatten das Gebäude sich selbst überlassen. Die neuen Betreiber hatten Investoren für ihren Plan gefunden, das Kühlhaus in eine Art Auftau-Treff für die junge Berliner Szene umzuwandeln: unten Lounge, in der Mitte Galerie und Tanzboden, oben Theater. Zu diesem Zweck hatten die Betreiber einige Stockwerke des riesigen, in lauter zimmergroße Kühleinheiten gegliederten Gebäudes aufgebrochen und die Wände und Decken eingerissen, bis Luft, Licht, Höhe und Weite Einzug hielten. An den Wänden des Saals, der so entstanden war, hingen nun die fotografischen Abgesänge auf das alte Detroit. Es war ein kongenialer Ort für diese Ausstellung. Inmitten der aus der Tiefkühlphase erwachten Stadt Berlin zeigte sie die Ruinen einer amerikanischen Pionierstadt. Immer mehr junge Leute drängten in den Kühlturm, der bis eben noch ein unbekannter Ort gewesen war. Ein Discjockey übernahm die Regie und beschallte Publikum und Ausstellung. Es dauerte nicht lange, bis das Publikum zwischen den melancholischen Bildern der Schwesterstadt Detroit zu tanzen begann und seinen Lebenswillen zeigte.
Unten, vor dem Kühlhaus, stand sie plötzlich wieder vor mir, die Stadt meiner Erinnerung. Gegenüber zerschnitt die grelle Leuchtreklame eines neuen Hotels namens Mercure die Dunkelheit. Die Westseite des Hotels bestand aus einer fensterlosen, lückenlos bemalten Brandmauer. Darauf zu sehen waren die Motive der Wandmaler der achtziger Jahre: ein halb nacktes dunkles Naturkind inmitten eines Dschungels, im Hintergrund die Kulisse einer Großstadt und alles überblickend ein mächtiges Konterfei von Karl Marx. Unter der Brandmauer lag ein verwahrloster Parkplatz, begrenzt durch eine weitere Brandmauer; links auf dem Hochgleis glitt ein Zug der S-Bahn vorbei. In dem engen Stück Januarhimmel über mir entdeckte ich in unendlicher Ferne zwei blasse Sterne. Es war mir immer so vorgekommen, als wären die Sterne über Berlin Millionen Kilometer weiter entfernt als über jeder anderen Stadt. Und besonders fern waren sie im Januar.
Das Kühlhaus ist einer jener neuen Veranstaltungsorte, die ein junges Publikum aus aller Welt anziehen. Es gehört nicht zu den Sehenswürdigkeiten, die der Reiseführer angibt, und liegt nicht an der Wegstrecke der Touristenbusse, die den Lichtern der wieder glitzernden Friedrichstraße oder des Potsdamer Platzes folgen. Wenn es um Prachtboulevards geht, hat jede Großstadt in Europa Gleiches oder Besseres zu bieten. Die heimlichen Ikonen Berlins sind die Lagerhallen und Industrieruinen, aus denen sich die Stadt neu entwirft. Kein Zweifel, die besten Architekten der Welt haben in den letzten 15 Jahren in Berlin gebaut und manchmal – eher selten – Großartiges hingestellt. Aber mit Berlins zerrissener Seele und den neuen Energien, die in den Brachen der Stadt wachsen, haben diese Großbauten wenig zu tun. Die neuen Attraktionen sind alte Gasometer und Wassertürme, aufgegebene Kliniken, stillgelegte Flugplätze, ehemalige Hafenanlagen, ausrangierte Bahnhöfe, verlassene CIA-Abhöranlagen oder Stasi-Gefängnisse, verschimmelte Bunker- und Tunnelanlagen aus zwei Diktaturen und Lagerhallen aller Sorten. In ihnen nistet sich das neue Leben ein. Und das fälschungssichere Wasserzeichen der Stadt sind immer noch: dreißig Meter hohe fensterlose Brandmauern, bucklige Trottoirs aus Pflastersteinen, überwucherte Gleise, stillgelegte himmelhohe Kamine, auf deren Spitzen nachts ein rotes Warnlicht aufleuchtet, enge Hinterhöfe, in denen die eine Kastanie steht. Nein, Berlin will und wird bis auf Weiteres keine ordentliche Hauptstadt sein. Und vielleicht ist Berlin deswegen so beliebt.
Wie lange noch? Längst haben internationale Investoren, die ihre Entscheidungen vom Hubschrauber aus oder per Google Maps und Street View treffen, die neuen Höhlen und Paläste der Kreativen entdeckt und auf die To-do-Liste ihrer Portfolios gesetzt. In zehn oder 15 Jahren wird Berlin so teuer sein wie New York oder London. Banker und Hedgefonds-Manager werden in die Gasometer, in die Kühl- und Wassertürme und in die Lagerhallen einziehen, die die Pioniere des neuen Berlin mit geklauten Brettern und Stützbalken, mit gebrauchten Wasseranschlüssen und Türklinken, mit herbeigeschleppten Heizkörpern und angezapften Stromzählern bewohnbar gemacht haben. Die neuen Besitzer werden in die verlassenen Lofts Marmorbäder, Safes, elektronisch gesteuerte Küchen, private Fitness-Säle und Swimmingpools einbauen und auf den Dächern Hubschrauberlandeplätze errichten. Dann wird Berlin so prächtig, so teuer und so langweilig werden, wie es die meisten Hauptstädte der westlichen Welt heute sind. Berlins Bürgermeister werden diese Entwicklung kaum verhindern, weil ihre Weitsicht durch den Druck von Berlins immensen Schulden und die Verlockung von hohen Steuereinnahmen blockiert sein wird. Noch ist Berlin ein – allerdings weltweit bekannter – Geheimtipp für Künstler in aller Welt. Sie kommen aus Manhattan, aus San Francisco und Los Angeles, aus Hongkong, aus Tokio und Seoul. Wenn aber die Wohnungen in einer Stadt nur noch für Banker, Börsenmakler und den internationalen Jetset erschwinglich sind, ziehen die Kreativen weiter. Mein Tipp für den in zehn bis 15 Jahren bevorstehenden Massenexodus aus Berlin sind die Städte Sarajevo und Bukarest.
Laut Berlins einziger Zeitung, die man als »Hauptstadtzeitung« bezeichnen kann, laut dem Tagesspiegel also, tummeln sich derzeit rund 21000 Künstler in der Stadt. Ich halte diese Zahl für untertrieben. Die Hälfte von ihnen gibt an, dass sie »professionelle Künstler« sind. Aber können sie vom Ertrag ihrer Arbeit auch leben? Jeder halbwegs aufgeschlossene Berliner zählt den einen oder anderen Künstler zu seinem Bekanntenkreis, aber er kennt nur ausnahmsweise einen, der sich von seinen Hervorbringungen ernähren kann. Dennoch hält der Zuzug an. Im Gefolge der Künstler strömen Galerien und Sammler in die Stadt. Sie konzentrieren sich längst nicht mehr auf das Scheunenviertel rund um den Hackeschen Markt und den Prenzlauer Berg, sondern haben sich neue, rasch wechselnde Quartiere erschlossen: am Checkpoint Charlie, in der Umgebung der Jannowitzbrücke, neuerdings auch in der Potsdamer Straße, im alten Amüsierviertel Westberlins. Mit 400 Adressen ist Berlin inzwischen der größte Galeriestandort Europas, 3000 von bundesweit 6000 Ausstellungen pro Jahr entfallen auf die deutsche Hauptstadt. Bei einem geschätzten Umsatz von rund 250 Millionen (im Jahre 2012) kann die Stadt sich jedoch mit keiner der großen Kunstmetropolen Europas messen. Ungeachtet dieses bescheidenen Umsatzes steigen die Mieten für Ateliers und Studiowohnungen ständig, und schon werden viele der neu angekommenen Künstler zusammen mit alteingesessenen Kreuzberger Türken in Randlagen abgedrängt.
Der Streit der Architekten
Wer Berlin aus der Zeit vor dem Fall der Mauer kannte und in den neunziger Jahren, mit dem alten Bild der Stadt im Kopf, am Potsdamer Platz vorbeifuhr, konnte sich eines Schwindelgefühls kaum erwehren. Es war, als würden die Folgen des seismischen Bebens, das die Welt im November 1989 erschüttert hatte, jetzt sichtbare Gestalt annehmen. Im Wochen-, ja im Tagesrhythmus schossen neue Bauten aus der vormals von der Mauer beherrschten Brache. Inmitten der alten löste sich eine neue Stadt aus der Verschalung, deren Geräusche und Lichtreflexe man nur erahnen konnte und von der niemand wusste, für welche Art Leben sie die Kulisse abgeben würde. Aber war dies nicht immer das Merkmal Berlins gewesen? War Berlin nicht seit jeher ein Ort des Transits gewesen, eine Stadt, die immer mehr Vergangenheit und Zukunft gehabt hatte als eine Gegenwart?
Die Einwohner sahen dem radikalen Umbau mit einer Gelassenheit zu, die von Betäubung nicht leicht zu unterscheiden war. Wenig Enthusiasmus war zu spüren, eher eine Gereiztheit, wie man sie bei Fußballfans nach der Niederlage ihrer Mannschaft beobachten kann.
Unmittelbar nach dem Fall der Mauer waren seltsame, ja absurde Vorschläge erörtert worden. Die Partei der Grünen favorisierte eine Idee, die dieser Partei immer kommt, wenn in einer Stadt irgendwo eine Lücke entsteht. Sie wollte entlang der ehemaligen Mauer eine Grünanlage für Radfahrer, Jogger und kinderwagenschiebende Mütter und Väter anlegen. Auch ein riesiger Wochenmarkt war im Gespräch, womöglich mit Anschluss an einen Vergnügungspark mit Riesenrad, wie man ihn anderswo am Rand der Städte findet. Die Verwirklichung dieser Ideen wäre dem Vorschlag gleichgekommen, auf Ground Zero in New York lieber einen Park zu pflanzen als einen neuen Wolkenkratzer zu errichten.
Für Stadtplaner und Architekten stellte die Gestaltung der Mitte eine einzigartige Herausforderung dar. In keiner Hauptstadt der Welt stand man vor der Aufgabe, eine riesige Fläche im Zentrum einer Metropole neu zu beleben.
Allerdings nahmen die Debatten der Experten über die Zukunft der Stadt nicht selten die Gestalt von politischen Teufelsaustreibungen an. Was ihnen fehlte, war das Element der Neugier, der Spieltrieb und der Sinn für das Abenteuer. Weitreichende Entscheidungen, über die man in Würde gegensätzlicher Meinung sein konnte, wurden oft mit den Mitteln der persönlichen Verdächtigung und der politischen Verleumdung diskutiert. Unter deutschen Intellektuellen kann man nicht einmal über ein Küchenrezept streiten, ohne dass irgendein aufgeregter Gourmet darin faschistische Ingredienzien ausmacht.
So versackte denn auch die Berliner Architekturdebatte in den Untiefen des Faschismusverdachts, bevor sie recht in Gang gekommen war. Die Frage, ob man in der Stadtmitte leicht oder schwer, aus Glas oder Stein, im Zeilen- oder Blockbau bauen könne oder solle, wurde derart mit ideologischen Gewichten behängt, dass nur noch Raum für Bekenntnisse und Gegendarstellungen übrig blieb. Kaum hatte der Berliner Architekt Hans Kollhoff seine Zweifel an den Segnungen der Moderne und sein Votum für eine »steinerne Stadt« angemeldet, entdeckte der ehemalige Direktor des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt, Heinrich Klotz, in Kollhoffs Entwurf für den Alexanderplatz mit einem halben Dutzend exakt gleich hohen Wolkenkratzern »Anklänge an die faschistische Architektur«. Der amerikanische Architekt Daniel Libeskind hatte gerade mit dem Bau seines spektakulären Jüdischen Museums in Berlin begonnen, konnte sich aber mit seinem Entwurf für den Alexanderplatz nicht durchsetzen und schrieb mit Bezug auf Kollhoffs Vorschlag: »Ich verwerfe die Idee, dass totalitäres Planen im späten 20. Jahrhundert noch angewendet werden kann.« Kraft solcher Stichworte fand der Berliner Architekturstreit Eingang in die Feuilletons der Welt. Planskizzen, Grundrisse und Modelle errangen die Nachrichtenprominenz von Neonazi-Brandanschlägen. Lächerlich einfache Gegensatzpaare bildeten sich heraus: Glas, Stahl und Aluminiumfenster standen für Pluralität und Demokratie; Stein, Blockbau und Holzleiste für eine reaktionäre Gesinnung und für monolithische Gesellschaftsstrukturen. Als könne man nicht auch mit Stein leicht bauen, als wären Glas und Stahl kraft ihres Materials gefeit gegen Plumpheit und Einfallslosigkeit. Die Regel, dass man Politiker nicht an ihren Versprechen im Wahlkampf, sondern an ihren Taten messen sollte, schien bei den Architekten vergessen. Man nahm ihre Bekenntnisse für die Häuser. Es entstand ein Glaubenskrieg zwischen »neuem Historismus« und »zweiter Moderne«, in dem die Protagonisten ihre gerollten Pläne wie Speere gegeneinanderführten.
Nirgendwo wurde so heftig um die Seele der Stadt gestritten wie in der neuen Mitte Berlins. Und diese Mitte war nach dem Fall und der Beseitigung der Mauer weitgehend leer. Ein fünfzig Kilometer langes Stück Bauland von dreißig bis fünfhundert Meter Breite, das bis 1989 auf der Westseite der Mauer nur von Mäusen und Maulwürfen bewohnt war, durchzog die Hauptstadt. Die Brache, die eben noch das jeweilige Ende von zwei Stadthälften und zwei politischen Kontinenten markiert hatte, sollte nun über Nacht zum Zentrum einer Weltstadt werden.
Himmelhohe Baukräne und abgrundtiefe Baugruben wurden die neuen Wahrzeichen von Berlin. Erst angesichts dieser Baugruben wurde vielen Berlinern bewusst, dass das Zentrum der Stadt auf Sand und Sumpf gebaut ist – nur eine dünne Sandschicht trennt den Boden vom Grundwasser. Wer in der Innenstadt ein paar Meter in den Grund bohrte, stieß auf Wasser. Tatsächlich mussten ja schon vor Jahrhunderten die Fundamente mittelhoher Stadt- und Geschäftshäuser im Wasser errichtet werden. Immer wieder stießen die Bauarbeiter beim Versuch, erhaltene oder verschwundene Großbauten zu sanieren bzw. neu zu bauen, auf antike 20 Meter lange Holzpfähle, die unterhalb des Grundwasserspiegels in den Grund getrieben worden waren. So bei der Renovierung der Staatsoper, so beim Neubau des Berliner Schlosses. Die Mitte Berlins, so schien es, war wie Venedig auf Pfählen gebaut, mit dem Unterschied, dass man das Wasser über diesen Pfählen nicht sah. Nein, dies war kein idealer Boden für die Wolkenkratzer, die viele nun in der wiedergewonnenen Mitte sehen wollten. Ältere Ostberliner erinnerten sich eines gerüchteweise kolportierten Satzes des DDR-Architekten Hermann Henselmann. Der hatte den Entwurf für den Berliner Fernsehturm gezeichnet, ihn aber nicht gebaut. Er sei nie dort hinaufgefahren, soll der Architekt geäußert haben, weil er nicht sicher gewesen sei, ob sich der Turm nicht ausgerechnet dann, wenn er oben war, zur Seite neigen würde.
Zu den vielen Seen, die die Stadt umgeben, gesellten sich nun im Zentrum riesige, mit Wasser gefüllte Baugruben. Die Helden der neuen Baustellen waren die Bautaucher. Ihre Aufgabe war es, im Wasser Wannen zu errichten, damit das ständig andrängende Grundwasser anschließend abgepumpt werden konnte. Über den Bautauchern manövrierten schwimmende Baukräne, die ihnen die nötigen Teile zuführten.
Der damalige Stadtentwicklungssenator Volker Hassemer kam zusammen mit Manfred Gentz, dem Verantwortlichen für das Daimler-Projekt am Potsdamer Platz, auf die Idee, den Show-Wert der neuen Baustellen zu nutzen. Am Rand der spektakulärsten Baustellen schossen drei- und vierstöckige »Kioske« und »Info-Boxen« in die Höhe, von denen aus Einwohner wie Touristen den Fortgang der Arbeiten verfolgen konnten. Die Idee hatte einen verblüffenden Erfolg. Baustellenbesuche wurden in Berlin bald populärer als Theater-, Museums- und Konzertbesuche.
Potsdamer Platz
Die umstrittenste Baustelle war der Potsdamer Platz.
Der Platz, der in den zwanziger Jahren als der verkehrsreichste Platz Europas galt, hatte sich in den Jahren des Kalten Krieges in die größte innerstädtische Brache Berlins verwandelt. Alle Gebäude, die die Bombardements des Zweiten Weltkriegs halbwegs überlebt hatten, waren in den folgenden Jahren abgerissen worden. Aus dem Strich auf dem Asphalt, der seit dem August 1948 die Grenze zwischen den drei Westsektoren und dem sowjetischen Sektor markiert hatte, wuchs am 13. August 1961 die Mauer. Unter dem Vorwand, die Westgrenze gegen eine vermeintlich täglich bevorstehende Invasion »imperialistischer Kräfte« schützen zu müssen, rissen die DDR-Behörden fast alle der verbliebenen Gebäude nieder, die innerhalb ihres Hoheitsgebietes lagen. Sie zerstörten die Häuser an der Ebert- und Stresemannstraße und die Reste des Kaufhauses Wertheim. Mendelsohns neunstöckiges Columbushaus und das Haus Vaterland, die beide zu DDR-Zeiten noch genutzt wurden, waren bereits während des Arbeiteraufstands vom 17. Juni 1953 angezündet worden und abgebrannt.
Aber auch die Westberliner Behörden, die in den Nachkriegsjahren von einer »autogerechten Stadt« träumten, legten die Ruinen des Voxhauses, des Prinz-Albrecht-Palais, des Völkerkundemuseums und des Anhalter Bahnhofs nieder. So war der Potsdamer Platz eine Art Gebäudefriedhof ohne Grabstätten geworden. Nur noch ältere Berliner konnten sich die Geister der ehemaligen Bauten vor das innere Auge rufen.
Bis zum Anfang der neunziger Jahre war der Platz von dem Bauwerk beherrscht, das an die Stelle der verschwundenen Gebäude getreten war: von der Berliner Mauer. Auf dem Westteil der fast 500 Meter breiten innerstädtischen Wüste war ein von Imbiss- und Souvenirbuden gesäumtes Podest errichtet worden, von dem aus Schaulustige die Mauer besichtigen konnten. Sie blickten in die Ferngläser bewaffneter Grenzposten, die von ihren Postenhäusern aus in die Ferngläser der Touristen starrten.
Nur ein Haus hatte die Abrisswut überlebt: das Weinhaus Huth. Es war Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Weinhändler Willy Huth auf dem von seinem Großvater erworbenen Grundstück errichtet worden. Wegen der erwarteten Belastung des Gebäudes durch das Flaschenlager hatte Willy Huth die fünf Stockwerke des Hauses in einer damals neuartigen Stahlskelett-Konstruktion errichten lassen. Dank seiner Fürsorge für das Weinlager – und durch schieres Glück – überstand das Haus die Bombardierungen und den Artilleriebeschuss des Zweiten Weltkriegs ziemlich unbeschädigt. Die moderne Stahlkonstruktion schützte allerdings nicht gegen den Durst der eindringenden sowjetischen Truppen. Jahrzehntelang stand das Weinhaus – zusammen mit den Resten des zerbombten Hotels Esplanade – wie ein Findling aus der Vorzeit auf dem ansonsten leer geräumten Potsdamer Platz.
Wann immer ich von Charlottenburg aus Richtung Kreuzberg fuhr und das Haus dort stehen sah, konnte ich ein ungläubiges Kopfschütteln nicht unterdrücken. Solche Bilder sah man sonst nur in Wildwestfilmen, die in Arizona gedreht worden waren: ein einsames Haus inmitten einer Wüste, das dem durstigen Reiter nach einem langen Ritt wie eine Fata Morgana vor die Augen trat – und zumindest dem Namen nach halten konnte, was es versprach: a good drink. Nur dass das verlorene Haus exakt in der Mitte einer Großstadt stand. Es war ein Fixstern in der Einöde, ein verrücktes Orientierungszeichen. Wer wohnte hinter diesen beleuchteten Fenstern, wer hielt diese entlegene Stellung in der ehemaligen Mitte, die seit dem Mauerbau zum Ende der westlichen Welt geworden war?
Aus den Büchern und Artikeln über das Weinhaus erfährt man, dass Willy Huth noch lange nach dem Mauerbau eine Schoppenstube in dem Haus unterhielt. Er konnte sich nicht entschließen, das Erbstück der Familie mit den inzwischen verrosteten Eisenträgern und dem Trümmerschutt in den Weinkellern zu verkaufen. Sein Büro hatte er in einer Ecke eines holzgetäfelten Saals eingerichtet, der in den zwanziger Jahren als ein viel besuchter Festsaal gedient hatte. Einmal im Monat kassierte er dort von seinen Mietern die Miete. Manchmal wurde er auch auf dem Dach des Hauses gesehen. Er schaute auf den leeren Platz, auf dem einmal die erste Ampel der Welt den Verkehr geregelt hatte. Vielleicht sah er auch die verschwundenen Gebäude, zwischen denen er aufgewachsen war: die Bierpaläste, den Potsdamer Bahnhof, das Haus Vaterland und das Rheingold nebenan, die Zeitungsjungen, die Schuhputzer und die Blumenfrauen, vielleicht hörte er die Geräusche der Straßenbahnen, der Droschken und des Gedränges im ehemaligen Festsaal des Weinhauses Huth. Aber diese Bilder und Geräusche sah und hörte niemand außer ihm.
Ein einsamer Posaunist, so wird erzählt, blies manchmal – in den ersten Jahren nach der Errichtung der Mauer – eine traurige Melodie, die außer den Grenzpolizisten nur die Bewohner des Hauses Huth vernahmen. Niemand kannte den seltsamen Bläser. Aber als seine Soli ausblieben, vermisste man sie.
Einer von Huths ehemaligen Kellermeistern kam durch einen mit dem Haus verbundenen Weinhändler in Bedrängnis. Angeblich hatte dieser Weinhändler in der DDR für den CIA spioniert, und Huths Kellermeister hatte ihm dabei geholfen. Der Mann wurde zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt, musste aber dank eines Gnadenerlasses nur fünf Monate absitzen. Willy Huth starb kurz nach der Geburtstagsfeier zu seinem 90. Geburtstag – in seinem Haus. Der Wein, behauptete ein Nachruf, habe ihn und seine Frau jung gehalten.
Die Westberliner Behörden wussten nicht, was sie mit dem Haus anfangen sollten. Die Witwe von Willy Huth hatte es mitsamt dem dazugehörenden Grundstück 1967 zu einem Spottpreis an den Westberliner Bezirk Tiergarten verkauft. Die sozialdemokratischen Beamten entschieden sich, das Gebäude für Sozialwohnungen zu nutzen. Statt der gewünschten kinderreichen Familien zogen jedoch vorwiegend Lebenskünstler, Einzelgänger, Maler und Gestrandete ein, die eine Vorliebe für extreme Wohnlagen hatten. Was sollten kinderreiche Familien auch mit einer Wohnung anfangen, die in einer unbebauten, von einer Mauer durchtrennten Brache stand? Es gab keinen Bäckerladen in der Nähe, geschweige denn einen Einkaufsladen, keine Schule, keinen Kindergarten; zum nächsten Bus musste man zehn Minuten laufen. Das einzige – erdbebenartige – Geräusch, das man alle paar Minuten hörte, war das Donnern der U-Bahnen, die unter der Erde durch den verplombten Geisterbahnhof am Potsdamer Platz rasten. Im November 1979 wurde das Haus vom Bezirksamt Tiergarten unter Denkmalschutz gestellt als »eines der letzten Zeugnisse des modernen Geschäftshausbaus der Kaiserzeit«.[1]
Mieter, die in den achtziger Jahren in das Haus einzogen, erlebten dann, ein paar Mal im Jahr, neue Bilder und Geräusche. Der Potsdamer Platz wurde zum bevorzugten Besuchs- und Auftrittsort von Politikern und Präsidenten aus dem Westen. Die Mieter des Weinhauses Huth genossen auf ihren Balkonen und hinter offenen Fenstern ihre Logenplätze.
Die Schriftstellerin Inka Bach war in Ostberlin aufgewachsen und 1972 mit ihrer Familie aus der DDR geflohen. Im Sommer 1989 zog sie nach längeren Aufenthalten in New York und Paris mit ihrem gerade geborenen Sohn in das Haus Huth ein. So fand sich die junge Frau aus der DDR unversehens an der Nahtstelle zwischen Ost- und Westberlin wieder.
Der Vater ihres Kindes, ein Architekt, bewohnte dort eine Wohnung im zweiten Stock. Die Wohnung – ein Atelier von 240 Quadratmetern mit einem kleinen Schlafraum – war kein idealer Ort für eine junge Familie, die sich bald durch Inkas zweites Kind, eine Tochter, vergrößerte. Draußen vor dem Haus gab es zwar enorm viel Platz zum Spielen, aber keine anderen Kinder. Sicher, Inka wohnte in der alten Mitte der ehemaligen Hauptstadt Berlin und hatte, wie es zunächst schien, einen »unverbaubaren Ausblick« – zentraler in Berlin zu wohnen, war nicht möglich. Aber das Leben in dieser von Gott und aller Welt verlassenen Mitte erinnerte sie nicht an ihr geliebtes Paris oder Manhattan, sondern eher an die Randlage einer amerikanischen Provinzstadt.
Aber die seltsame Wohnlage bot auch einzigartige Vorteile. Inka hatte nie Probleme, ihren Minivan direkt vor dem Haus zu parken, Strafzettel wurden im weiten Umkreis um das Weinhaus Huth nicht geschrieben. Der Mietpreis von 2,50 DM pro Quadratmeter war paradiesisch. Zwar musste sie das Auto nehmen, wenn sie auch nur eine Tüte Milch oder einen Bleistift kaufen wollte, aber die Philharmonie, den Gropius-Bau, die Staatsbibliothek und die Neue Nationalgalerie konnte sie zu Fuß erreichen. Auf ihren täglichen Spaziergängen zu diesen Bildungsstätten, die die Kulturbeflissenen der Stadt nur mit dem Bus oder mit dem Taxi erreichten, hatte Inka ihre Kinder stets mitgenommen. Statt »Kinderspielplatz« hieß es: »Gropius-Bau«. Und was den Ausblick aus der Wohnung betraf, konnte sie sich im zweiten Stock des Hauses Huth wie im 40. Stock eines Wolkenkratzers in Manhattan fühlen. Aus den geschwungenen Fensterfronten hatte sie freie Sicht auf die beiden Berliner Halbstädte.
Ihre Mitbewohner gehörten nicht gerade zu den Mietern, die sich eine junge Familie wünschte. Der Nachbar nebenan, ein schwuler Hautarzt aus München, hatte eine Schwäche für alte Berliner Türklinken aus Messing. Einige der originalen Türklinken gab es noch im Haus Huth, das gerade erst vom Bezirksamt Tiergarten renoviert worden war. Der Nachbar schraubte diese Türklinken aus den Türen der unbewohnten Wohnungen ab und setzte sie in die Türen seiner Wohnung ein. Niemand im Haus stieß sich an dieser Schrulle des vereinsamten Mitbewohners aus dem deutschen Süden. Irgendwann wurde er in seiner Wohnung tot aufgefunden. Er hatte sich erschossen. In seiner Wohnung fanden sich – außer einem Haufen Türklinken – zahllose Naziembleme und -reliquien – eine Sammlung, die offenbar wenig oder nichts mit den Überzeugungen des psychisch gestörten Mannes zu tun hatte.
Im fünften Stock wohnte eine Schauspielerin aus der DDR – angeblich eine enge Freundin der Dissidentin und Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley –, die sich nach dem Ende ihrer Theaterkarriere als Esoterikerin versuchte. Aus ihrer Wohnung drangen fernöstliche Gerüche ins Treppenhaus und die Klänge von Meditationsmusik. Manchmal ließ Inka sich von dieser Nachbarin massieren. Später tauchte deren Name auf einer Liste von Informanten des Staatssicherheitsdienstes der DDR auf. Von da an nahm Inka die Dienste der Esoterikerin nicht mehr in Anspruch. Ihre Freunde provozierte sie gern mit dem Satz, sie sei zweimal pro Woche »in den Händen der Stasi« gewesen und habe sich dort wohlgefühlt.
Eine andere Mieterin, die bereits seit vielen Jahren in dem Haus wohnte, hatte auf der überwucherten Straße vor dem Haus einen Garten angelegt. Der Garten lag auf einem seit Jahrzehnten unbefahrenen Teilstück der alten Potsdamer Straße, die einmal eine Ader des früheren Verkehrsmittelpunkts Berlins gewesen war. Unweit dieses Gartens, hieß es, habe der Schriftsteller Theodor Fontane gewohnt. Den halben Tag verbrachte die alte Dame mit dem Jäten von Unkraut, das aus der berühmten alten Straße wucherte, und mit der Pflege ihrer Pflanzen. Nach getaner Arbeit sonnte sie sich auf einem Liegestuhl. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr kleiner Garten in den Fokus eines Weltkonzerns geraten war, der an dieser Stelle bauen wollte.
Tatsächlich veränderte sich das Idyll in der Brache des Potsdamer Platzes schon vor dem Fall der Mauer. Zu den Hasen und Maulwürfen gesellten sich plötzlich neue Grenzgänger. Es waren Polen, die an den Wochenenden im Sommer 1989 am Landwehrkanal und in der Umgebung des Potsdamer Platzes auftauchten und ihre Mitbringsel in den Händen hielten – Handwerkszeug, ein Porzellanservice, ein auf Holz gemaltes Bild der Madonna mit dem Kind. Mit den Polen, so entdeckten die an türkische Händler gewohnten Westberliner, konnte man nicht handeln. Entweder bezahlte man den verlangten Preis oder man ging leer aus. Ein Rätsel blieb, wie die ungeübten Verkäufer aus dem östlichen Nachbarland nach Westberlin gelangten. Am Samstagmorgen kamen sie, am Sonntagabend waren sie verschwunden.
Das Auftauchen der polnischen Händler in Westberlin und die immer häufigeren Berichte über Zusammenstöße zwischen DDR-Jugendlichen und der Volkspolizei bestärkten mich in der Überzeugung, dass die Mauer bereits bröselte und nicht mehr lange halten würde. Im Juni 1989 veröffentlichte ich einen Artikel im New York Times Magazine mit dem Titel »Was wäre, wenn die Mauer fällt«. Darin spekulierte ich über einen bevorstehenden Fall der Mauer. Ich beschrieb die möglichen Folgen eines solchen Ereignisses und kam zu dem Schluss, dass die Deutschen nach dem ersten Jubel mehr Differenzen zwischen sich entdecken würden als Ähnlichkeiten. »Man kann die Mauer niederreißen«, schrieb ich, »aber damit wird sie nicht verschwinden. Nur die Mauer hat ja die Illusion aufrechterhalten, dass es nur eine Mauer sei, was die Deutschen trennt.« Nach diesen Prophezeiungen ruinierte ich meinen Artikel, indem ich mit meinen letzten Sätzen in den damaligen Zeitgeist einscherte: »Nein, die Mauer wird erst fallen, wenn die Deutschen sich einer grundlegenden Wahrheit stellen: Es gibt kein Menschenrecht auf Wiedervereinigung, und es wird auch nach dem Fall der Mauer zwei deutsche Staaten geben. Statt von einer utopischen Wiedervereinigung zu träumen, sollten die Westdeutschen demokratische Rechte für ihre ostdeutschen Brüder und für alle Mittel- und Osteuropäer einfordern.«
Den Mauerfall selbst »erlebte« ich dann im Nordosten der USA – am Dartmouth College. Als ein amerikanischer Kollege in mein Büro trat und mich fragte: »Hast du NBC gesehen? Die Mauer ist gefallen!«, schüttelte ich ungläubig den Kopf. Ich rief meinen Freund Aras Ören in Berlin an, der damals unweit der Mauer wohnte, und fragte ihn, ob die Nachricht stimmte. Er hielt sie ebenso wie ich für Unsinn. Ich beschwor ihn, aus dem Haus zu gehen und bitte selbst nachzusehen. Er versprach es. Da er dann nichts mehr von sich hören ließ, kam ich zu dem Schluss, dass es wohl doch ein Jahrhundertereignis war, das ihn am Rückruf hinderte.
Aber zurück zu Inka Bach. Nach dem 9. November hörte sie monatelang das Hämmern der »Mauerspechte«, die das Ungetüm aus Stahlbeton Tag und Nacht bearbeiteten. Statt der polnischen Händler machten sich nun »Stadtindianer« mit ihren Zelten und Wagenburgen auf der Brache breit. Eine Art Jahrmarkt von Neugierigen und Reportern aus aller Herren Länder, Jägern von Mauer-Memorabilien, Verkaufsständen entstand rund um das Weinhaus Huth. Für Inka ging der Alltag weiter. Wie vorher musste sie für ihre Familie das täglich Nötige besorgen, aber es wurde schwieriger, ihren lauffreudigen Sohn zu kontrollieren. Er war es dann, der seine Mutter auf die einzige für ihn wichtige Entdeckung nach dem Fall der Mauer aufmerksam machte. Irgendwann hatte er auf der östlichen Seite der Mauer einen Kindergarten entdeckt. »Komm, wir gehen Mädchen gucken«, forderte er seine Mutter auf. Inka schrieb ihren Sohn beherzt in den Kindergarten ein, der immer noch vom Personal des Staates, aus dem sie geflüchtet war, geführt wurde. Aber mit Kindergärtnerinnen aus der DDR kannte sie sich aus; sie kannte deren Sprache, den Tonfall, das Programm und traute sich zu, es zu beeinflussen. Im Übrigen sagte ihr der Instinkt, dass der spektakuläre Ausblick aus dem zweiten Stock nicht mehr lange »unverbaubar« bleiben würde. Ihre Familie und die anderen Mieter im Weinhaus Huth würden von dem welthistorischen Ereignis eher früher als später hinweggefegt werden.
Der Vertreiber hatte einen guten Namen. Kurz vor dem Fall der Mauer hatte der damalige Chef des Daimler-Konzerns Edzard Reuter vom Westberliner Senat 61000 Quadratmeter im Südwesten des Potsdamer Platzes erworben. Der Kauf war zu einer Zeit, da kaum jemand an ein baldiges Ende der deutschen Teilung, geschweige denn an die Auflösung der Sowjetunion glaubte, eine kühne, eine prophetische Investition. Tatsächlich war sie eher von einer politischen Vision als von geschäftlichen Interessen bestimmt. Edzard Reuter, der Sohn des legendären ersten Berliner Oberbürgermeisters Ernst Reuter, wollte an diesem Ort keineswegs nur eine Daimler-Zentrale, sondern ein neues Stück Stadt bauen, das sich eines fernen Tages mit der Oststadt verbinden sollte. Selten hat ein Konzernchef mit einer Entscheidung, die von vielen Kollegen aus der Wirtschaft belächelt wurde, so richtig gelegen. Er war dann selbst überrascht, wie schnell sich seine Wette auszahlen würde. Das Areal, das Reuter für 93 Millionen DM erstanden hatte, gehört heute zu den teuersten Grundstücken von Berlin.
Als eine eher unerwünschte Mitgift hatte er auch das Weinhaus Huth eingekauft, das die Stadt gerade erst mit drei Millionen Mark renoviert hatte. Das Haus stand jedem großen Gesamtentwurf im Wege, aber es gehörte nun einmal zum Areal. Aber weder Edzard Reuter noch sein Architekt Renzo Piano, der Autor des preisgekrönten Entwurfs für den Ausbau des Daimler-Areals, ahnten damals, wie viel Kopfzerbrechen ihnen dieses Haus noch bereiten würde. Es stand seit 1989 unter Denkmalschutz.
Für die neuen Bauherren bedeutete der Denkmalschutz vor allem eines: gewaltige Kosten und die Aufgabe, ein vergleichsweise durchschnittliches Berliner Geschäftshaus von der Jahrhundertwende, das nicht gerade an das Kolosseum oder die Hadriansvilla in Rom erinnerte, in die Baupläne zu integrieren. Das Haus stand auf sumpfigem Grund und musste, wie es in der Architektensprache heißt, »unterfangen« werden. Da die Architekten wegen des Aushubs einer vierzig Meter tiefen Baugrube ein Absinken oder gar einen Einsturz des Hauses fürchteten, entschlossen sie sich, das »Kleinod« auf ein Gerüst aus Pfählen zu stellen, die achtzehn Meter tief in den Boden reichten. Die 50 Millionen DM teure Maßnahme hatte etwas Rührendes: Mit einem Aufwand, den man in Italien nicht einmal zur Sicherung der Ruinen von Pompeji treibt, musste der Bauherr Daimler das Haus eines Weinhändlers erhalten, an dem nichts bemerkenswert war außer der Tatsache, dass es den Weltkrieg und alle Abrisswellen danach überlebt hatte. Die Mieter, darunter Inka Bach, die die Stellung im Weinhaus Huth bis zum letzten Augenblick gehalten hatten, wurden mit hohen Abfindungen »entmietet«. Inka Bach hält sich mit Angaben über die Höhe der Abfindung zurück, aber die Summe dürfte dem Gewinn aus einem Bestseller entsprochen haben. Und warum auch nicht? Warum sollte nur ein Autokonzern, warum sollten nicht auch ein paar kluge Mieter vom Wunder des Mauerfalls profitieren?
Gleich zu Beginn der Bauarbeiten wehte dem Daimler-Unternehmen allerdings der Wind von Ost wie West ins Gesicht. Untergangspropheten, an denen es in Berlin nie fehlt, sagten voraus, der Umgebung werde durch den Bausee das Grundwasser entzogen;