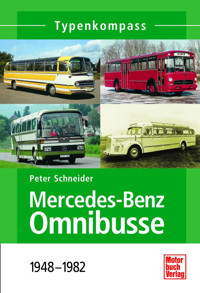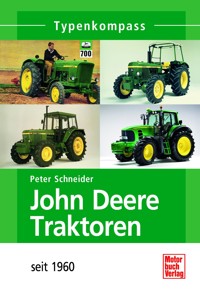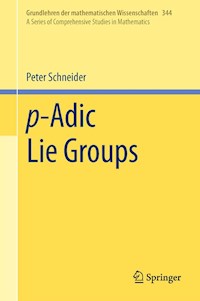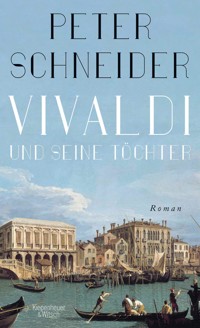18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die bedeutendsten Essays des großen politischen Denkers. Peter Schneider gehörte zu den wichtigsten Köpfen der 68er-Bewegung, sein Roman »Lenz« wurde zum Kultbuch der Studentenbewegung. Sein ganzes intellektuelles Leben lang hat er sich kritisch zu Politik und Zeitgeschehen geäußert und sich nie gescheut, sich auch mit den eigenen Irrtümern zu beschäftigen. Die hier erstmals versammelten Essays und Artikel aus den letzten 30 Jahren zeigen ihn als beeindruckend präzisen Diagnostiker des Zeitgeschehens und großen Stilisten. Der Band dokumentiert Peter Schneiders jahrzehntelanges Nachdenken über die Wendepunkte deutscher und internationaler Politik sowie seinen dauerhaften Kampf gegen die Versuchungen und Fallen ideologischer Bequemlichkeiten. Die Themen: der Mauerfall und die Wiedervereinigung. Sarajewo und die Kriege auf dem Balkan. Der 11. September und der islamische Fundamentalismus. Die Finanzkrise 2008/2009. Die Flüchtlingskrise 2015 und das Erstarken der AfD.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Peter Schneider
Denken mit dem eigenen Kopf
Essays und ein paar Notizen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Peter Schneider
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Peter Schneider
Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Der Mauerspringer« (1982), »Rebellion und Wahn« (2008), »Die Lieben meiner Mutter« (2013) und »Club der Unentwegten« (2017). Seit 1985 unterrichtete Peter Schneider viele Jahre als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton, Harvard und an der Georgetown University in Washington D.C. Zuletzt erschien sein Roman »Vivaldi und seine Töchter« (2019).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Peter Schneider gehörte zu den wichtigsten Köpfen der 68er-Bewegung, sein Roman »Lenz« wurde damals zum Kultbuch. Sein ganzes intellektuelles Leben lang hat er kritisch zu Politik und Zeitgeschehen Stellung genommen und sich nie gescheut, auch mit den eigenen Irrtümern aufzuräumen. Die hier erstmals versammelten Essays aus den letzten 30 Jahren und seine aktuellen Notizen zeigen ihn als großen Stilisten und unerschrockenen Diagnostiker. Der Band dokumentiert sein Nachdenken über die historischen Wendepunkte, die ihn nötigten, einige seiner alten Gewissheiten zu verabschieden – Wendepunkte wie der Mauerfall, die Kriege in Bosnien und im Kosovo, der islamische Fundamentalismus und die Flüchtlingskrise. Dabei leitet ihn die Frage, wieweit selbst bestimmtes Denken in einer von Gruppendenken und moralischem Narzissmus zugestellten Arena überhaupt noch möglich ist. Der Schwung, der Scharfsinn und der Witz, mit dem Schneider in diesem Buch einem Denken mit dem eigenen Kopf Raum verschafft, machen es zu einem großen Lesevergnügen.
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Der Fall der Mauer und die Folgen
Was wäre, wenn die Mauer fällt?
Der 9. November 1989, aus 10000 km Entfernung betrachtet
Der neue (alte?) Rassismus
Bitte nach Ihnen!
»Es will dich hier niemand ausgrenzen, Arno!«
Das braune Erbe der DDR
Die Sünden der Großväter
Krieg in Europa
Die serbische Barbarei und die unsere
Neujahr in Sarajevo
Handkes Ritt über die serbischen Dörfer
Bosnien – ein Kommunikationsfehler?
Eine »Friedensbewegung« namens NATO
»Ich kann über Leichen gehen, ihr könnt es nicht!«
Die Jahre zwischen Deutschland und den USA 1
Ein verwundbarer Held namens USA
[Aus meinen Aufzeichnungen]
Versuch, in den USA nicht als Deutscher aufzufallen. Und warum es nicht funktioniert
[Aus meinen Aufzeichnungen]
Die europäische Lingua franca
Die Jahre zwischen Deutschland und den USA 2
Das mutlose Land
Der schöne 27. September
Vom richtigen Umgang mit Bären
[Aus meinen Aufzeichnungen]
[Aus meinen Aufzeichnungen]
Die falsche Gewissheit
[Aus meinen Aufzeichnungen]
Der transatlantische Graben
Goodbye, Amerika?
Die Jahre zwischen Deutschland und den USA 3
Das Versprechen der Freiheit
Die Moral politischer Mörder
Warum sagst du nicht: Ich habe mich geirrt?
Die deutschen Tugenden
Die SPD und die Menschenrechte
Unser Mann bei Rosneft
Die Lehren der Geschichte
Zwischenstation: Great Britain
Beobachtungen zur britischen Mentalität
[Aus meinen Aufzeichnungen]
»Politisch Verfolgte genießen Asyl«
Besuch bei Pegida
Der lange Weg der Deutschen zur Convivenza
Moralischer Narzissmus
Schluss mit dem Massenmord in Aleppo!
Ihr seid nicht allein! Oder doch?
[Aus meinen Aufzeichnungen]
Warum ich immer noch an Europa glaube
Zum Schluss
Mit welchem Kopf denkt man, wenn nicht mit dem eigenen?
Literaturhinweise zum Schlussessay
Fotos
Vorbemerkung
Die hier versammelten Texte sind – mit Ausnahme des ersten – in den 30 Jahren nach dem Fall der Mauer entstanden. In aller Regel habe ich meine Texte gekürzt und die Auslassungszeichen weggelassen. Dabei habe ich mir nur Streichungen gestattet, keine nachträglichen Korrekturen – es sei denn, sie betreffen die Orthographie, die Grammatik und die Verständlichkeit. Die den Essays und Artikeln beigefügten Notizen wurden entweder in den letzten Monaten verfasst oder sie entstammen meinen Aufzeichnungen. In diesem Buch kam es mir darauf an, einige Denkvorstöße und Irrtümer in den letzten dreißig Jahren kenntlich zu machen – und auch, wie andere darauf reagierten. Wenn man so will, stellt dieses Buch eine Art Bildungsroman meines Verstandes dar. Dieser Vorschlag ergibt nur Sinn, wenn man bedenkt, dass der Verstand noch von ganz anderen Kräften regiert wird als vom Verstand.
Der Fall der Mauer und die Folgen
Was wäre, wenn die Mauer fällt?
(Juni 1989)
Welcher große Traum stand dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan vor Augen, als er im Frühling 1987 unter dem Beifall der Westberliner ausrief: »Mr. Gorbatschow, tear down this wall«? Oder dem Präsidenten Bush, als er ganz in der Tonart seines Vorgängers in Mainz 1987 erklärte: »the brutal wall … must come down«?
Der Vorschlag, die Mauer einzureißen, ist so alt wie die Mauer selbst und gehört seit 28 Jahren zur Rhetorik jedes alliierten Staatsbesuchers in Berlin. Niemand musste bisher fürchten, dass er beim Wort genommen würde; man konnte auf die Schwerhörigkeit der sowjetischen Adressaten zählen. Seit der Adressat Mr. Gorbatschow heißt, ist der Vorschlag riskant geworden. Was würde eigentlich passieren, wenn der Angesprochene heute oder morgen antworten würde: »Glänzende Idee, Mr. President. Packen wir’s an, weg mit dem Ding!«?
Ich glaube, nicht nur der alte und der neue amerikanische Präsident, vor allem unsere weniger entfernten westlichen Nachbarn und die Westberliner selbst wären leicht entsetzt. Seit Jahrzehnten haben Deutschlands Freunde im Westen ein pflichtschuldiges Amen zum westdeutschen Nachtgebet für die Wiedervereinigung beigetragen. Aber wer möchte im Ernst, dass sich die zwei deutschen Staaten – jeder die führende ökonomische Macht in seiner Hälfte Europas – zusammentun und eine ökonomische Supermacht werden? Wer möchte 80 Millionen Deutsche im Herzen Europas unter einem Dach vereint sehen?
Ich überlasse die Antwort auf diese Frage gern den Franzosen, den Italienern, den Engländern und den Holländern – die Polen, die Tschechoslowaken und die Ungarn nicht zu vergessen. Und kann ihnen nur raten, dieselbe Frage an die Westdeutschen weiterzureichen: Seid ihr wirklich sicher, dass ihr die Mauer weghaben wollt?
Empörte Zurufe von den Bänken des Bundestags, eilige Beteuerungen, dass solche Fragen geschmacklos seien. Dass die Deutschen die Einheit wünschen müssen, steht fest, nämlich in der Verfassung. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass deutsche Verfassungen und deutsche Wünsche weit auseinandergehen.
Seit Jahren geht mir ein Satz im Kopf herum, den ich von einem Beamten der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin hörte: »Manchmal kommt es mir so vor, als sei die Mauer nach 40 Jahren Teilung das Einzige, was die beiden Deutschlands noch verbindet.«
Wird der offizielle Glaube an die Einheit aller Deutschen womöglich nur noch durch die Mauer aufrechterhalten? Und würde folglich der Abriss der Mauer nicht auch diesen Glauben zu einem guten Teil zertrümmern?
Nach 40 Jahren, so meine ich, darf man die Teilung Deutschlands als ein gesellschaftliches Experiment bezeichnen und nach Resultaten fragen. Zweifellos hatten die Alliierten kein Experiment im Kopf, als sie sich auf jene Grenze in der Mitte Europas einigten, die später zur Mauer ausgebaut wurde. Einigen wir uns darauf, dass es sich um ein unfreiwilliges, aus der Not des Siegens geborenes Experiment gehandelt hat. Ein Experiment, in dem die Alliierten als wissenschaftliche Leiter und die Deutschen als außerordentlich kooperationswillige Labormäuse auftreten – oder, um es netter zu sagen: als Testpersonen.
Vielleicht sollte ich hier auf ein verwandtes wissenschaftliches Feld verweisen: auf die Zwillingsforschung. Nehmen wir der Einfachheit halber an, wir haben es mit Zwillingen zu tun, die eine kriminelle Vergangenheit hinter sich haben. Durch gemeinsame alliierte Anstrengungen werden sie endlich gewaltsam getrennt und in zwei extrem verschiedenen Internaten aufgezogen. Der Zwilling namens BRD wächst im Reizklima westlicher Werte auf, er lernt es, erst mit Mühe, dann mit wachsender Begeisterung, Demokratie, Kapitalismus, individuelle Freiheit als Grundwerte zu schätzen; vor allem erlernt er Respekt vor dem westlichen Versuchsleiter.
Der andere Zwilling namens DDR, der öfter geschlagen wird, paukt ebenso beflissen die Grundwerte der östlichen Kultur: »Solidarität«, »soziales Engagement«, »Leidenschaft für den Sozialismus« und »ewige Freundschaft« mit dem östlichen Versuchsleiter.
Nehmen wir weiter an, dass zwischen den Zwillingen eine Mauer errichtet und eine seltsame Besuchsregel etabliert wird: Der westliche Zwilling kann sich in jede beliebige Richtung bewegen, einschließlich Osten. Für den Zwilling im Osten gelten andere Regeln. Er hat eine gewisse Bewegungsfreiheit in Richtung Norden und Süden – im Osten steht ihm ein schier unerschöpflicher Spielraum zur Verfügung. Aber der Zugang nach Westen ist versperrt. Da gibt es die berühmte verbotene Tür von gut 1400 Kilometern Breite. Legal öffnet sie sich nur im Ausnahmefall – nach einer Wartezeit von mindestens zwei Jahren; wer nicht so lange warten will, muss unter Lebensgefahr springen oder graben.
Nehmen wir weiter an, dass der Zwilling im Westen dank des Marshallplans und der westlichen Marktwirtschaft allmählich reich wird. Sein Zwillingsbruder im Osten muss nicht nur allein die Kriegsschulden an den weit ärmeren Versuchsleiter aus dem Osten zahlen; er muss auch dessen ineffizientes Wirtschaftssystem übernehmen.
Zumindest ein Ergebnis ist vorhersehbar: Der Zwilling im Osten wird eine unstillbare Neugier für alles entwickeln, was sich hinter der verbotenen Tür abspielt. Hinzu kommt, dass sich der östliche Zwilling in der undankbaren Lage sieht, auf seinen westlichen Verwandten warten zu müssen.
Eine gewisse Vorwurfshaltung ist vorprogrammiert: »Der da drüben könnte ruhig öfter kommen. Zumindest könnte er öfter anrufen oder schreiben. Und er könnte ein bisschen großzügiger sein, da es sich herausgestellt hat, dass er, rein geografisch, das bessere Los erwischt hat. Es war einfach Glück, dass er zur richtigen Zeit auf der richtigen Seite der Elbe lebte und dort gemeldet war. Aber inzwischen ist ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen. Statt zu teilen, tut er so, als hätte er mehr Talent und würde härter arbeiten. Mir kann er nichts vormachen, ich kenne ihn, wir kommen aus demselben Elternhaus – er ist genauso faul und tüchtig wie ich!«
Inzwischen bastelt der Zwilling aus dem Westen an einem anderen Monolog. Er fühlt sich gestört durch etwas, was er »die ewige Erwartungshaltung« seines Verwandten nennt.
»Ich sehe doch, dass der Ärmste hinter seiner Mauer es nicht leicht hat. Aber seine Ansprüche, seine unausgesprochenen Vorwürfe belasten den Dialog. Weiß Gott, ich gebe gern, aber ein Geschenk zu machen, wenn ein Geschenk erwartet wird, macht keinen Spaß! Der da glaubt offenbar, dass die Autos und die Farbfernseher im Westen auf den Bäumen wachsen! Aber mit einem Mercedes wirst du nicht geboren, du musst ihn dir verdienen, musst Zinsen zahlen – ein Wort, das mein Bruder nur vom Hörensagen kennt!
Ich würde ihm das gern erklären, aber er hört ja nicht zu, er redet und redet! Natürlich ist es nicht seine Schuld, dass er immer noch nach Apfelsinen anstehen muss. Aber er soll wenigstens zugeben, dass das sozialistische Wirtschaftssystem ein Desaster ist, dass er auf das falsche Pferd gesetzt hat – niemand kritisiert ihn als Person! Manchmal bin ich regelrecht erleichtert, wenn der Besuch vorbei ist. Es gibt ein Unbehagen zwischen uns, über das man wirklich einmal reden müsste. Das nächste Mal!«
In Westdeutschland gibt es zwei nationale Feiertage: den 17. Juni und den 13. August. Es sind seltsame Feiertage: Im ersten Fall feiern wir einen Volksaufstand gegen die Diktatur, bei dem die anderen Deutschen den Kopf hinhielten; im zweiten Fall trauern wir über den Tag des Mauerbaus, unter dem vor allem unsere Brüder und Schwestern im Osten leiden – in beiden Fällen arbeiten wir mit geliehenen Gefühlen. Die westdeutschen Feiertagstränen über die Mauer haben nur noch eine ideologische Funktion. Viele Jahre lang diente uns die Mauer als der Spiegel, der uns zeigte, wer der Schönste im Lande war. Inzwischen sind es Besucher aus dem Ausland, die uns daran erinnern, dass die Mauer etwas Unnatürliches, ja Unerträgliches ist. In dem spontanen Entsetzen dieser Mauertouristen erkennen wir das Echo eines Gefühls wieder, das wir einmal hatten, als die Wunde frisch war.
Kaum eine von den Haltungen und Empfindungen, die ich hier beschrieben habe, wird von den Deutschen hinter der Mauer geteilt. Genauer gesagt, sie stellen sich dort in einer Art Spiegelverkehrung dar. 1974, kurz nach dem Amtsantritt von Erich Honecker, wurden alle Hinweise auf eine denk- oder wünschbare Wiedervereinigung aus der Verfassung der DDR gestrichen. Das geschah zu einem Zeitpunkt, als die Teilung Deutschlands bereits ein Vierteljahrhundert alt war und unwiderruflich erschien. Der westdeutsche Trauertag, der 13. August, wurde in der DDR zum Feiertag ernannt.
So findet am 13. August ein gespenstisches Schauspiel statt: Im Westfernsehen sieht man Jugendorganisationen der CDU, aggressiv Fahnen schwenkend und zu keiner Träne fähig, an den Grabsteinen erschossener Mauerspringer trauern. Im Ostsender sieht man, vier Meter weiter, die Betriebskampfgruppen der DDR Kränze an den Grabsteinen von Grenzpolizisten niederlegen, die »bei der Wahrnehmung ihrer verantwortungsvollen Aufgabe gefallen« waren.
Offenbar verhält es sich beim Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen exakt umgekehrt, wie die beiden deutschen Regierungen behaupten: Die offizielle Trauer über die Mauer findet im Westen in einem leeren Theater statt; die offiziellen Beteuerungen im Osten, es gebe keine deutsche Frage mehr, verraten nur die Allgegenwart eines Problems, auf das die DDR-Bürger täglich stoßen.
Die Prognose für den Tag, an dem die Mauer fiele, lautet also, dass die Deutschen zunächst einmal mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten entdecken würden. Man kann die Mauer abreißen, aber damit wäre sie nicht beseitigt. Nur die Mauer hält die Illusion aufrecht, dass es nur eine Mauer sei, was die Deutschen trennt.
Ich halte es für durchaus möglich, dass Mr. Gorbatschow in nicht allzu ferner Zukunft auf Mr. Reagans Vorschlag zurückkommt. Ich zweifle daran, dass der Westen darauf vorbereitet ist. Sehr rasch würden sich die im Westen gehandelten Konzepte für diesen Fall als nicht handhabbar erweisen. Alle, die da kommen, aufnehmen? Unmöglich. Die Mauer als Grenze gegen die Ankömmlinge aus dem Osten ausbauen – ein schlechter Scherz.
Nein, die Mauer wird nur wirklich fallen, wenn die Deutschen sich einer harten Wahrheit stellen: Es gibt kein »Menschenrecht« auf eine deutsche Wiedervereinigung, und es wird auch in Zukunft zwei deutsche Staaten geben. Statt von einer utopischen Wiedervereinigung zu träumen, sollten die Westdeutschen sich für die demokratischen Rechte ihrer ostdeutschen Brüder und aller Osteuropäer einsetzen. Nur wenn diese Rechte in ganz Europa durchgesetzt werden, kann es zu einer normalen Grenze zwischen den beiden Deutschlands kommen.
(Erschienen unter dem Titel »The wall came tumbling down« am 25.6.1989 im New York Times Magazine)
Ich gebe zu, ich bin ein wenig stolz auf diesen Text – wegen seiner Unerschrockenheit und des leichten Tons im Umgang mit einem belasteten Thema. Aber wie kam es, dass ich meine kühle Vorhersage mit einer derart schroffen Absage an eine Wiedervereinigung beendete – und dies, obwohl ich die baldige Öffnung der Mauer für »durchaus möglich« hielt?
Anfang des Jahres 1989 hatte mich das New York Times Magazine aufgefordert, einen Artikel zu ebenjener Frage zu schreiben. Ich hatte ihn im März und April des Jahres verfasst; am 25. Juni 1989 stand er im Blatt. Ich erinnere mich eines kleinen, am Telefon geführten Streits mit Mark Danner über die letzten Sätze des Artikels – Mark war damals mein Lektor beim NYTimes Magazine. Er wollte mich zu einer noch strikteren, zu einer endgültigen Absage an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung überreden. Gerade weil ich die Öffnung der Mauer für wahrscheinlich hielte, müsse ich die Idee der Wiedervereinigung umso energischer verwerfen. Dabei schlug er mir das Adverb »niemals« vor. Ich entgegnete, dass dieses Wort in einer Spekulation über die Zukunft grundsätzlich nichts zu suchen habe, gleichgültig ob mir die Wiedervereinigung nun ein Herzenswunsch sei oder nicht. So einigten wir uns denn auf die Kompromissformel, es gebe kein »Menschenrecht auf Wiedervereinigung«.
Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man eine historische Option wie die Wieder- beziehungsweise Neuvereinigung der beiden deutschen Staaten verneint, weil sie unrealistisch erscheint oder weil man sie nicht für wünschenswert, ja für eine falsche politische Lösung hält.
Tatsächlich war ich von einer ideologischen Ablehnung der Wiedervereinigung bestimmt, als ich den Artikel schrieb, und teilte diese Haltung mit sicherlich 90 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen in beiden Teilen Deutschlands. Außer Joachim Fest, Martin Walser, dem Filmemacher Hans-Jürgen Syberberg und ein paar Schriftstellern aus der DDR wie Günter Kunert, Rainer Kunze und Joachim Schädlich hatte sich die übergroße Mehrheit der linken Intellektuellen in beiden deutschen Staaten – genau wie ich – eindeutig gegen die Wiedervereinigung festgelegt. Grund genug, die Frage zu stellen, warum wir damals so dachten und warum sich kaum einer von den damaligen Gegnern der Wiedervereinigung, die sich inzwischen mit ihr arrangiert haben, diese Frage gestellt hat.
Der 9. November 1989, aus 10000 km Entfernung betrachtet
(November 1991)
Den Tag der Maueröffnung erlebte ich ausgerechnet im Dartmouth College in Hanover (USA), rund 10 Flugstunden vom Ort des Jahrhundertereignisses entfernt. Dabei hatte ich noch im Juni 1989 den baldigen Fall der Mauer für möglich erklärt. Aber meine prophetische Anwandlung hatte nicht dazu ausgereicht, mich mit einem Stuhl an die Mauer zu setzen und auf das Eintreffen meiner Voraussage zu warten. Stattdessen folgte ich einer Einladung ins Dartmouth-College und hielt dort Vorträge über mein Thema.
Ich war in meinem Büro im German Department gerade mit einer Überarbeitung des erwähnten New-York-Times-Artikels für den »Nouvel Observateur« beschäftigt, als jemand den Kopf zur Tür hereinsteckte und sagte: »Hast du schon gehört? Die Berliner Mauer ist offen! Es fahren Trabis auf dem Ku’damm herum!« Ich kann die Pendelschläge meiner Gefühle, die die Nachricht auslöste, hier nur andeuten: ungläubiges Lachen, gefolgt von zornigen Nachfragen, überschrien durch den Ausruf »Wahnsinn!« – kein Wort der deutschen Sprache ist an diesem Tag öfter gerufen, geflüstert und gesungen worden.
Ich will nicht verheimlichen, dass sich im Gefühlschaos auch eine egoistische Anwandlung meldete: Verdammt! Konnten sie damit (mit der Maueröffnung) nicht warten, bis mein Artikel im Nouvel Observateur erschienen ist?
Anderntags genoss ich es, auf den Gängen der Universität immer wieder mit hochgerecktem Daumen und dem Wort »Congratulations« begrüßt zu werden. Bekannte und Unbekannte schlugen mir anerkennend auf die Schulter, ganz so, als hätte ich persönlich den Befehl zur Maueröffnung gegeben.
Es machte plötzlich Spaß, ein Deutscher in den USA zu sein.
So rasch ich konnte, brach ich meine Zelte in Dartmouth ab, reiste nach Berlin zurück und fragte jeden, den ich traf, wie er den Tag der Maueröffnung erlebt hatte.
Der Weg von der Maueröffnung zur Wiedervereinigung erscheint in der Rückschau verblüffend kurz und geradlinig – bereits am 3. Oktober 1990 war sie mit dem Beitritt der DDR zur BRD vollzogen. In Wirklichkeit war diese Wieder-, genauer Neu-Vereinigung ein Wunder, das in keiner politischen Wahrscheinlichkeitsrechnung vorkam. Tatsächlich verdanken die Deutschen ihre Vereinigung einem halben Volk und vier Männern: Das halbe Volk war das Volk der DDR, die vier Männer hießen Michail Gorbatschow, George H.W. Bush, Helmut Kohl und Dietrich Genscher.
Margaret Thatcher machte keinen Hehl daraus, dass sie die Idee einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten schlicht abscheulich fand. Die Franzosen drückten sich diplomatischer aus, aber erinnerten sich hinter vorgehaltener Hand an das berühmte Bonmot ihres Landsmannes François Mauriac: »Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich lieber zwei davon habe.« François Mitterrand bestätigte offiziell das Recht der Deutschen auf Selbstbestimmung, aber tat hinter dieser rhetorischen Kulisse alles, um ein vereintes Deutschland zu verhindern. Honi soit qui mal y pense! – Die Deutschen hatten ihren Nachbarn in zwei Weltkriegen genügend Gründe für schlimmste Befürchtungen geliefert.
An dieser Stelle muss ein denkwürdiger Widerspruch festgehalten werden. In mehreren Umfragen gaben die Völker Westeuropas einschließlich der Briten – im Gegensatz zu ihren Regierungen – mit eindeutigen Mehrheiten zu erkennen, dass sie ihren deutschen Nachbarn das Recht auf eine Wiedervereinigung zugestanden. Die Polen votierten mit einer eindrucksvollen Minderheit für dieses Recht.
So machte der Fall der Mauer ein Paradox sichtbar: Die Regierungen Westeuropas und die Intellektuellen starrten angesichts der Zeitenwende alarmiert in die Vergangenheit; die Regierten blickten neugierig in die Zukunft und gönnten den Deutschen die Vereinigung – falls sie sie denn wollten.
Aber wollten die Deutschen überhaupt?
Die Regierung Helmut Kohl arbeitete mit Dietrich Genscher zunächst energisch auf das Projekt einer sogenannten deutsch-deutschen Konföderation hin. Der ökonomisch halbwegs beschlagene Oskar Lafontaine, damals Kanzlerkandidat der SPD, begründete seine Abneigung gegen eine Vereinigung durch eine Horrorzahl. Er rechnete den Deutschen vor, dass das Projekt die Westdeutschen rund 650 Milliarden DM kosten werde. Eine beachtliche Leistung Lafontaines, wenn man bedenkt, dass einige amerikanische Professoren, die ihre Informationen direkt vom Geheimdienstchef Markus Wolf bezogen, die DDR damals für die zehntstärkste Wirtschaftsmacht der Welt hielten.
Lafontaine, der den Deutschen damals einen Bruchteil der Wahrheit über die gewaltigen Kosten einer Wiedervereinigung gesagt und ihnen deswegen davon abgeraten hatte, verlor die Wahl. Helmut Kohl gewann sie, weil er den Deutschen »blühende Landschaften« in wenigen Jahren und die Währungsunion versprach.
Darf ein Politiker die Wähler täuschen, um ihnen eine einmalige historische Chance – die Chance zur Wiedervereinigung – schmackhaft zu machen? So viel steht fest: Es gab weit und breit keinen Politiker, der den Deutschen den folgenden einfachen Satz zugemutet hätte: Die Wiedervereinigung wird unendlich viel kosten, und sie ist wert, was sie kostet.
Eine nicht zu vernachlässigende Rolle im damaligen Für und Wider spielten Deutschlands Intellektuelle. Von wenigen Ausnahmen abgesehen schienen die linken Intellektuellen von dem Ehrgeiz beseelt zu sein, Margaret Thatchers Warnungen vor einer Wiedervereinigung und den Deutschen noch zu überbieten. Günter Grass schlug vor, die Deutschen sollten ganz einfach auf ihr Selbstbestimmungsrecht verzichten, um der Versuchung einer Wiedervereinigung zu entgehen. Das aus den Bürgerbewegungen in der DDR hervorgegangene NEUE FORUM trat pragmatischer auf. Es sprach sich für einen offenen Dialog mit den Westdeutschen aus, ging dabei aber ganz selbstverständlich von der Zweistaatlichkeit Deutschlands aus – die Wiedervereinigung war kein Thema. Führende Intellektuelle der DDR, darunter Christa Wolf, Volker Braun und Stefan Heym, verfassten einen Aufruf: »Für unser Land«. Darin warnten sie vor einem »Ausverkauf unserer materiellen und moralischen Werte« und riefen die DDR-Bürger auf, eine »sozialistische Alternative zur Bundesrepublik zu entwickeln«. Tatsächlich äußerten im November ’89 nur 48 Prozent der DDR-Bürger ihre Zustimmung zur Einheit; ähnlich verhalten war das Stimmungsbild im deutschen Westen.
Aber die Stimmung änderte sich von Tag zu Tag. Bis zum Februar 1990 stieg die Zustimmung in beiden Teilen Deutschlands auf 80 Prozent, in der DDR kletterte sie sogar – nach Helmut Kohls Versprechen einer Währungsunion – deutlich über diesen Wert.
Es war dann das Volk der DDR, das die Wiedervereinigung erzwang. Die Intellektuellen auf beiden Seiten der Mauer liebten dieses Volk, solange es auf den »Montagsdemonstrationen« in Leipzig rief: »Wir sind das Volk!« Sie wandten sich schaudernd ab, als dasselbe Volk im Frühjahr 1990 dem Besucher Helmut Kohl zujubelte und variierte: »Wir sind ein Volk!« und sogar drohte: »Wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, kommen wir zu ihr.«
Günter Grass erließ prompt einen Bannspruch gegen das »Wiedervereinigungsgeschrei«. Der Spötter Heiner Müller machte sich ein Wortspiel zu eigen, das er an einer Wand in der S-Bahn-Unterführung Friedrichstraße gefunden hatte:
»Wir sind ein Volk!« stand dort. Und eine Zeile weiter unten: »Und ich bin Volker!«
Nach der Wiedervereinigung allerdings verstand er keinen Spaß mehr und schlug apokalyptische Töne an: »Für Jahrzehnte wird nach dem vorläufigen Sieg des Kapitalismus, der ein System der Selektion ist (das System Auschwitz), die Kunst der einzige Ort der Utopie sein, das Museum, in dem die Utopie aufgehoben wird für bessere Zeiten.«
Der erstaunliche Konsens der meisten west- und ostdeutschen Intellektuellen gegen die Wiedervereinigung verdient einen kleinen Exkurs – nicht zuletzt deswegen, weil ich selber bis genau drei Wochen vor dem Fall der Mauer diesem Konsens anhing.
Wie Günter Grass und andere Kollegen sah ich in der deutschen Teilung eine unmittelbare Folge des Hitlerkrieges, eine historische »Strafe«, mit der die Deutschen sich nun einmal abzufinden hatten. Wer die Teilung infrage stellte, entlarvte sich nach dieser Lesart als »Revanchist« und »unverbesserlicher kalter Krieger«, der die Lehren der Geschichte ignorierte.
Dabei hätte uns doch auffallen können, dass das Denkverbot in Sachen »Deutsche Einheit« auf einer höchst einseitigen und eigensüchtigen Geschichts-Interpretation beruhte. Denn warum war eigentlich die Bereitschaft, für die deutsche Schuld in Gestalt der Teilung zu büßen, vornehmlich bei den Westdeutschen anzutreffen, die ja gar nicht büßten und mit der Teilung vergleichsweise prächtig lebten? Und warum weigerte sich das Volk der Ostdeutschen – mit Ausnahme ihrer privilegierten Intellektuellen – so beharrlich, diese angebliche »Strafe der Geschichte« anzunehmen? In Wahrheit war die Teilung Deutschlands keineswegs eine direkte Folge des Hitlerkrieges gewesen. Sie war eine Folge des Kalten Krieges und der aufbrechenden Widersprüche zwischen den Alliierten; und sie betraf keineswegs nur Deutschland, sondern ganz Europa. Und warum sollten z.B. die Polen, die schließlich auf der Seite der Sieger gekämpft hatten, gemeinsam mit den (Ost-)Deutschen hinter der Mauer für Hitlers Krieg büßen?
Die Ablehnung der deutschen Einheit durch die DDR-Intellektuellen speiste sich aus einem ähnlichen Schuldgefühl, aber es kam noch etwas anderes hinzu. Die DDR-Intellektuellen hielten bis zuletzt an der Überzeugung fest, dass sie im Prinzip im »besseren Deutschland« lebten. Wie repressiv der Alltag im »ersten antifaschistischen Staat auf deutschem Boden« auch sein mochte, am Staatsziel Sozialismus und an der Abgrenzung gegen das »korrupte« westliche System durfte nicht gerüttelt werden. Im Übrigen hatten sie die Sorge, dass mit der Einheit ihr Staat von der politischen Landkarte verschwinden würde – was dann ja auch geschah.
Ich wurde im Laufe einer dreistündigen Bahnfahrt durch Kanada von meinen Einwänden gegen die Einheit kuriert.
Mitte Oktober 1989 ergab es sich, dass ich mit 500 anderen Schriftstellern in einem Zug saß, der von Montreal nach Toronto fuhr. Vor den Fenstern war jenes farbenprächtige Schauspiel des Herbstwalds zu besichtigen, das man dort »the peak of the foliage« nennt. Davon bekam ich so gut wie nichts mit, da ich mein Abteil mit der aus der DDR stammenden Schriftstellerin Monika Maron teilte. In wenigen Minuten hatten wir uns an der deutschen Frage festgebissen. Wir hätten die Strecke ebenso gut in einer Berliner U-Bahn zurücklegen können.
Monika Maron hörte sich meine Einwände gegen eine Wiedervereinigung geduldig an und nahm sie Stück für Stück auseinander. Sie wies mir nach, dass meine Argumente Glaubensartikel waren, die sich auf einen nie überprüften Konsens stützten. Und dann legte sie los: »Ihr wollt doch nur eure Penthouse-Wohnungen, eure Autobahnen, eure Mercedesse für euch behalten. Während ihr Ferien in der Toskana macht, sollen wir hinter der Mauer für den Faschismus büßen und über den Weltfrieden wachen? Was fällt dir, was fällt euch eigentlich ein?«
Ich kann nicht behaupten, dass ich mir die Einheit wünschte, als ich in Toronto ankam. Aber plötzlich hatte ich nichts mehr dagegen. Festzuhalten bleibt: Hätten die Deutschen auf ihre Intellektuellen gehört, die Wiedervereinigung wäre wohl nie zustande gekommen. Die ostdeutschen Wähler nahmen die Chance der Wiedervereinigung mit dem Instinkt von Leuten wahr, die Erfahrungen mit einer Mangelwirtschaft haben: Greif zu, sobald ein Angebot im Fenster liegt! Schon morgen sind die Bananen ausverkauft!
»Das Volk« hat mit seiner Ungeduld und seinem Drängen recht behalten. Schon ein gutes halbes Jahr nach der Wiedervereinigung, nämlich nach dem Sturz Michail Gorbatschows im August 1991, hätten die Unterhändler aus dem Westen auf der Seite der Sowjetunion keinen Ansprechpartner mehr gehabt.
(Die erste Fassung dieses Artikels erschien am 14.11.1991 in der taz)
In meinen Aufzeichnungen über jene Zugfahrt entdecke ich noch andere Eingaben von Monika Maron: »M. findet die Argumente (gegen die Wiedervereinigung) luxuriös und ungeheuerlich. Sie liest darin nur den Versuch, die Ostdeutschen in der Scheiße allein zu lassen. Auch die Option zwei deutsche Staaten – ›demokratisch, selbstbestimmt, auf deutschem Boden‹ – erscheint ihr als Verrat. ›Gut, wenn ihr schon tauschen wollt, lasst unsere 16 Millionen zu euch und schickt 16 Millionen von euch rüber!‹«
Heute denke ich, es war nicht zuletzt die emotionale Wucht, ja die Wut, mit der Monika Maron ihre Argumente vorbrachte, die meinen Glauben an das lang gehütete Tabu »Wiedervereinigung« erschütterte. Plötzlich erschien mir ein geradezu heiliges Denkverbot, das mit Höchststrafen für Abweichler bewehrt war – »Geschichtsrevisionist«, »Revanchist«, »Antikommunist« et cetera –, als eine ziemlich egoistische Operation, die die Vorteile der deutschen Teilung für die Westdeutschen und die Deutungshoheit fragwürdiger Vereinigungsgegner wie Günter Grass und Christa Wolf festschrieb. Ich hatte das Tabu nie unter dem Aspekt eines westdeutschen Egoismus gesehen, deswegen gab mir Monika Marons Wutausbruch zu denken.
Mit neuer Aufmerksamkeit und Erbitterung notierte ich eine Äußerung von Helmut Schmidt in der ZEIT vom 22.9.1989: »Wir wollen jenes ungeliebte Regime … nicht vom Westen her zum Einsturz bringen. Wir können es nicht, wir dürfen es auch nicht wollen. Denn eine Eruption in der DDR würde den Reformprozess in Europa gefährden. Die deutsche Frage wird erst im nächsten Jahrhundert gelöst werden.«
Ähnlich hatte er sich – der Ordnungspolitiker Helmut Schmidt und neben ihm fast die gesamte linke Intelligenz der BRD – auch über die Solidarnosc-Bewegung in Polen geäußert (siehe meinen Artikel dazu im Kursbuch 68: »Warnung vor diesem Frieden«). Wer sein Selbstbestimmungsrecht jenseits der Mauer wahrnehmen wollte, gefährdete nach der Logik der Entspannungspolitiker – und der vermeintlichen Linken – den Weltfrieden.
In der letzten Oktoberwoche 1989 – vom 26. bis zum 29.10.1989, also zwei Wochen vor dem 9. November – veranstaltete das Center for European Studies an der Harvard-University zum 40-jährigen Bestehen der Bundesrepublik eine mehrtägige Konferenz über die Zukunft Osteuropas. Ich war zu dieser Konferenz eingeladen und wurde sogar zweimal auf die Bühne gebeten. Befragt zu den Demonstrationen in Leipzig und Berlin, gab ich Sätze von mir, die ich vorher nie gesagt oder geschrieben hatte. Ich stellte eine naheliegende Spekulation an: Wenn die Demonstrationen in Ostberlin weitergehen würden und Gorbatschow an seinem Versprechen festhielte, keine Panzer zu schicken, dann sei die Mauer nicht mehr zu halten. Und wenn die Mauer einmal offen wäre, wenn die Deutschen im Osten ihren Willen bekunden dürften und Gorbatschow immer noch keine Panzer schickte, dann wäre auch die Wiedervereinigung kaum mehr aufzuhalten. Nicht, weil ich mir das wünsche, betonte ich, sondern weil dies der wahrscheinliche Gang der Dinge sei! Die beiden Deutschlands befänden sich in der Lage eines stark gealterten Liebespaars, das sich vor einem halben Lebensalter einmal ein Heiratsversprechen gegeben hatte und durch den Kalten Krieg gehindert worden sei, dieses Versprechen einzulösen. Das Versprechen sei sogar in der Verfassung der BRD festgeschrieben. Deswegen könne sich der westdeutsche Bräutigam nicht darauf herausreden, er habe es sich anders überlegt, die Braut gefalle ihm nicht mehr. ›Du wolltest mich doch immer‹, werde die ostdeutsche Braut sagen, ›und jetzt kannst du mich endlich haben!‹
Ein guter Teil der Zuhörer im Saal brach in Lachen aus, nicht so die deutschen Kongressteilnehmer. Kurz nach meiner leichtfertigen Prognose ergriff Theo Sommer (DIE ZEIT) das Wort. Mit allen Zeichen der Empörung distanzierte er sich in perfektem Englisch von den »maroden« Ausführungen seines Vorredners Peter Schneider und wunderte sich darüber, dass jemand, der so weit links angefangen habe, sich jetzt mit Fantasien über eine Wiedervereinigung in Szene setze. Er werde solchen Versuchungen bis ans Lebensende! (sic) widerstehen. Als ich später die geschmeidigen Artikel Theo Sommers zur sich vollziehenden Wiedervereinigung las, konnte ich mich meinerseits nur über die kurze Verfallszeit seiner Schwüre wundern. Nicht weniger befremdet reagierte Günter Gaus, der ehemalige Chef der Ständigen Vertretung der BRD in der DDR. Als ich ihn coram publico fragte, wieso er den Westdeutschen den Vorwurf mache, dass sie die Existenz des anderen deutschen Staates »innerlich« immer noch nicht angenommen hätten, wenn doch die DDR-Bürger selber diesen Staat nicht »innerlich« annehmen würden, verschlug es ihm für einen Augenblick die Stimme. Dann breitete er seine Theorie von den »Nischen« aus, in denen es sich die DDR-Bürger inzwischen gemütlich machten.
Ein deutscher Teilnehmer ließ sich im Anschluss an die Konferenz auf ein längeres Gespräch mit mir ein – es war Joachim Fest, der Feuilletonchef der FAZ. Er interessierte sich weniger für die guten oder schlechten Gründe meiner Prognose; er wollte wissen, wie es kam, dass ausgerechnet ich eine solche, vor allem von den deutschen Teilnehmern verworfene Position vertrat. Ich fasste Vertrauen zu ihm und erzählte ihm vom größten intellektuellen Schock meines Lebens: dass ich miterlebt hatte, wie sich viele Freunde, darunter einige der besten Köpfe meiner Generation, zehn Jahre lang im Namen eines schwachsinnigen Mao-Kults einem Regime der Denkverbote und Denkzwänge ergeben hatten – und am Ende sogar den Massenmörder Pol Pot verteidigten. Ich gestand ihm, dass auch ich damals in einem Aufsatz für das Modell der chinesischen Kulturrevolution geschwärmt hätte (»Die Phantasie im Spätkapitalismus und die Kulturrevolution«, Kursbuch, 16, 1969). Seither könne ich nur noch allergisch reagieren, wenn ich einer politischen Formel wie dem Wiedervereinigungsverbot begegnete, die eher einer Vereinsregel als einem Denken mit dem eigenen Kopf folgte.
Aus diesem Gespräch entstand eine robuste Bekanntschaft. Öfter, wenn er in Berlin war, rief Fest mich an und lud mich zum Essen ein. Ich erinnere mich an einen ziemlich brutalen Satz von Fest: Er habe, sagte er, bei der Besetzung der wichtigen Posten im Feuilleton der FAZ eine ganze, genauer, meine Generation überspringen müssen, und sich für Frank Schirrmacher entschieden. Weil alle sich – mich und ein paar andere einmal ausgenommen! – ideologisch verrannt hätten.
Der neue (alte?) Rassismus
Faxbestätigung zum Flugblatt der Initiative »Courage statt Hass« (29.10.1991)
Dies war das erste Flugblatt (28.10.1991) der Initiative »Courage gegen Hass« – später »Courage gegen Fremdenhass«. Nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen und Mordaktionen in Mölln, Rostock und Hoyerswerda hatte ich diese Initiative im Oktober 1991 mit Freunden gegründet und das hier abgebildete Flugblatt verfasst. Sten Nadolny hatte mich davon überzeugt, dass das Motto »Courage gegen Hass« universeller sei als »… Fremdenhass«, aber später haben wir uns, ich weiß nicht mehr wie und warum, für das Signalwort »Fremdenhass« in unserem Logo entschieden. Das Flugblatt verteilten wir vor dem KADEWE.
In der Erwartung eines andauernden Engagements habe ich dann trotz meines vielfach erklärten Widerwillens gegen Vereine jeder Art meinen ersten Verein gegründet. Es erschien mir zwingend, dass eine Mobilisierung gegen die neue Barbarei eine Adresse und auch einen Sekretär brauchte, der die Initiativen der Aktiven koordinierte. Ich wurde dessen Vorsitzender und blieb es für zehn Jahre.
Nach verschiedenen anderen Unternehmungen schien es uns das Sinnvollste, mit der Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gezielt an Schulen zu gehen und mit den je eigenen Mitteln, die einem Journalisten, einem Künstler, einem Schauspieler zur Verfügung stehen, eine Debatte mit den Schülern über unser Thema anzustoßen. Dabei kam uns die heterogene Zusammensetzung unserer Gruppe zustatten. Denn neben prominenten deutschen Mitstreitern wie Inge Deutschkron, Inka Bach, Otto Sander, Peter Merseburger, Sten Nadolny, Peter Ensikat, F.C. Delius boten auch zahlreiche nicht deutsche, in Berlin lebende Künstler und Akademiker ihre Hilfe an – rund die Hälfte der etwa 50 bis 60 Aktivisten stammte aus dem Nahen Osten, aus Afrika, aus Lateinamerika und anderen Weltgegenden.
Bitte nach Ihnen!
Bericht über eine Diskussion mit Schülern einer Oberschule in Hohenschönhausen(Frühjahr 1994)
Im Rahmen der Initiative »Courage gegen Fremdenhass« besuchte ich vor Kurzem eine Abiturklasse in einem Ostberliner Randbezirk. Die Schule hatte den architektonischen Charme einer Verwahranstalt; die einzige Abwechslung, die sich dem Blick hinauf an den Fassaden der umliegenden Wohnwürfel bot, war die Satellitenantenne auf fast jedem Balkon. Vielleicht ist zu wenig davon die Rede, wie das Gesicht einer Stadt, eines Vororts die Gesichter und das Verhalten seiner Bewohner prägt. Die Architektur jenes Vororts teilt jedem Heranwachsenden die folgende Botschaft mit: Richte dich darauf ein, dass du eine Nummer unter anderen Nummern bist.
Ich nahm die Gelegenheit wahr, die Schüler in ein Gespräch über das Schicksal des ghanaischen Asylbewerbers Martin Agyare zu verwickeln. Während einer S-Bahn-Fahrt war er von Skinheads, so berichteten mehrere Berliner Zeitungen, halb tot gestochen und dann aus dem fahrenden Zug geworfen worden. Bei dem Gespräch über diese Untat versuchte ich die Aufmerksamkeit besonders auf das Verhalten jener angeblich anwesenden 15 Fahrgäste zu lenken, die dem Verbrechen nicht nur tatenlos zugesehen hatten, sondern anschließend nach Hause gegangen waren, als hätten sie lediglich einen unangenehmen Film gesehen. Bekanntlich hat keiner dieser Fahrgäste sich bisher als Zeuge gemeldet – trotz der Aussetzung einer hohen Belohnung und der Zusicherung von Straffreiheit. Für mein Beispiel spielt es keine Rolle, ob diese 15 Fahrgäste tatsächlich anwesend waren oder – wie manche vermuten – von dem überlebenden Opfer des Mordanschlags Martin Agyare erfunden worden sind. Ich jedenfalls unterstellte in meiner Darstellung des Falles die Anwesenheit dieser Zeugen und ihr oben beschriebenes Verhalten.
Die erste Reaktion der Schüler verblüffte mich. Diejenigen, die sich meldeten, erklärten mir, dass sich die Fahrgäste durchaus vernünftig und im Einklang mit ihren Interessen verhalten hätten. Hier einige Argumente:
Jemand, der sich während des Überfalls eingemischt hätte, habe durchaus damit rechnen müssen, dass die anderen 14 der Gewalttat mit heimlichem Beifall zuschauten.
Woher man wissen könne, ob nicht alle anderen Fahrgäste Republikaner (Anhänger der rechtsextremen republikanischen Partei) wären?
Wer sich zur Rettung eines anderen einsetze, müsse hinterher womöglich mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen, denn selbstverständlich würden sich die Angreifer als Angegriffene darstellen und die Unbeteiligten würden sich ohnehin stumm davonstehlen.
Außerdem sei es ein Unterschied, ob man seine Haut für einen Kumpel oder für einen wildfremden, noch dazu schwarzen Fahrgast riskiere.
Natürlich gebe es keine Pflicht, für einen Fremden sein Leben zu riskieren.
Nun die Kommentare zum zweiten Akt der Geschichte: zur (angenommenen) Zeugnisverweigerung sämtlicher Zeugen nach der Tat. Auch hier zeigten die ersten Schülerantworten durchaus Verständnis:
Wer sich bei der Polizei melde, handle sich vor allem Scherereien ein. Er müsse stundenlange Verhöre über sich ergehen lassen, verwickle sich womöglich in Widersprüche, zudem könne er nicht auf die anderen Zeugen zählen, da die sich ohnehin nie melden würden.
Eine Nachbarin habe sich kürzlich eine Anzeige eingehandelt, weil sie nach Meinung der Polizei überflüssigerweise die Polizei geholt habe.
Es führt nicht weiter, sich über diese Antworten zu entsetzen. Vor einer Bewertung sollte man sie als Mitteilungen über eine Einstellung und als ein vorhandenes Bild von der Wirklichkeit lesen: Wer ziviles Verhalten übt oder auf die Solidarität eines anderen zählt, ist der Dumme; die Polizei, der Staat, die Mitmenschen sind im Zweifelsfall feindliche Mächte, auf die man nicht setzen kann und mit denen man die Berührung besser meidet.
Wohlgemerkt: Ich berichte hier nicht von irgendwelchen statistischen Erhebungen über das Weltbild junger Menschen zwischen 15 und 17. Tatsächlich habe ich auch ganz und gar andere Erfahrungen mit Schülern gemacht und andere Antworten erhalten. Und auch in diesem besonderen Fall blieb es im Verlauf nicht bei den zitierten Antworten*. Sie erfuhren zunehmend Widerspruch und führten wie von selbst zu einer Debatte über Grundfragen des zivilen Zusammenlebens, zu der offenbar im bisherigen Unterricht die Zeit gefehlt hatte.
Warum eigentlich soll man einem bedrohten Mitmenschen helfen?
Verstehen sich Toleranz und Mitmenschlichkeit von selbst? Ist man mit dem Wissen darüber geboren?
Und wenn das nicht der Fall ist, wo und von wem wird dieses Wissen heutzutage weitergegeben?
Trifft die Annahme noch zu, der soziale Konsens werde in den Familien weitergegeben?
Kann man ziviles Verhalten lernen, es – z.B. in der Schule – trainieren?