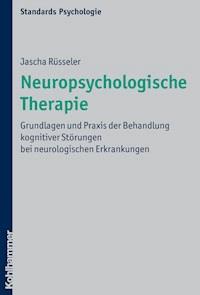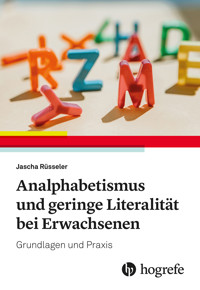
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Etwa 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben – für rund 55 Prozent dieser Menschen ist Deutsch Erstsprache. Wie lassen sich diese Zahlen erklären? Und welche Angebote braucht es in der Praxis für Betroffene? Der Neuropsychologe Jascha Rüsseler klärt in diesem kompakten Handbuch umfassend über das Phänomen geringer Literalität bei Erwachsenen auf und bietet wichtige Impulse für praktische Interventions-möglichkeiten. Im ersten Teil des Buches werden zunächst Häufigkeit und Ursachen geringer Literalität aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es werden die kognitiven und neurobiologischen Grundlagen des Leseprozesses sowie die Alpha-Levels und verschiedene Testverfahren zur Diagnostik der Lese- und Schreibkompetenzen vorgestellt. Im Praxisteil erfolgt die Zusammenfassung aktueller Studienergebnisse, die die Lebenswelt gering literalisierter Menschen charakterisieren. Daran anknüpfend werden Konzepte zur Ansprache, Lernberatung und Best-Practice-Beispiele für niederschwellige Lernangebote, z. B. das Rahmencurriculum "Lesen und Schreiben" des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV) und "AlphaPlus", präsentiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jascha Rüsseler
Analphabetismus und geringe Literalität bei Erwachsenen
Grundlagen und Praxis
Analphabetismus und geringe Literalität bei Erwachsenen
Jascha Rüsseler
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Björn Rasch, Freiburg i. Üe.; Prof. Dr. Astrid Schütz, Bamberg; Prof. Dr. Markus Wirtz, Freiburg i. Br.; Prof. Dr. Martina Zemp, Wien
Prof. Dr. J. Rüsseler, Dipl.-Psych.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Institut für Psychologie
Professur für Kognitions-, Emotions- und Neuropsychologie
Markusplatz 3
96047 Bamberg
Deutschland
E-Mail: [email protected]
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten.
Verantwortliche Person in der EU: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Merkelstraße 3,
37085 Göttingen, [email protected]
Anregungen und Zuschriften bitte an den Hersteller:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri
Bearbeitung: Tobias Gaudin, Gießen
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: GettyImages/Carol Yepes
Umschlaggestaltung: Hogrefe AG, Bern
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96317-4)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76317-0)
ISBN 978-3-456-86317-7
https://doi.org/10.1024/86317-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Grundlagenteil
1 Definition und Häufigkeit von geringer Literalisierung Erwachsener in Deutschland
1.1 Definition von funktionalem Analphabetismus
1.2 lea. Diagnostik: Alpha-Levels
1.3 leo.-Studien 2011 und 2018 sowie Folgestudien
1.4 Ein historisch-politischer Blick auf Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland und international
2 Lesen als kognitiver und neurobiologischer Prozess
2.1 Kognitive Modelle des Lesens
2.2 Die neurokognitiven Grundlagen des Lesens
2.3 Entwicklung des Lesens und der neuronalen Lesenetzwerke
3 Ursachen geringer Literalität Erwachsener
3.1 Soziologische bzw. gesellschaftliche Perspektive
3.2 Pädagogische bzw. schulische Perspektive
3.3 Kognitive Perspektive
3.4 Neurobiologische Perspektive
3.5 Fazit
Praxisteil
4 Ansprache von gering literalisierten Erwachsenen und Teilnehmendengewinnung in der Alphabetisierung und Grundbildung
4.1 Das Umfeld gering literalisierter Erwachsener
4.2 Nutzung digitaler Medien durch gering literalisierte Erwachsene
4.3 Ansprache von Zielgruppen für Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebote
4.4 Praxistipps: Worauf sollte bei der Ansprache von gering literalisierten Menschen und des mitwissenden Umfeldes geachtet werden?
5 Ein kurzer Blick in die deutschsprachigen Nachbarländer
6 Lernberatung in Alphabetisierung und Grundbildung
6.1 Grundlegende Konzepte der Lernberatung
6.2 Phasenmodell der Alphalernberatung
6.3 Lernberatung im Rahmen von Alphabetisierungskursen
7 Diagnostik von Lese- und Schreibfähigkeiten im Erwachsenenalter im Kontext von Lernberatung und Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen
8 Evaluative und klassifizierende Diagnostik von Lese- und Schreibfähigkeiten sowie kognitiven Vorläuferfunktionen des Lesens im Erwachsenenalter
8.1 Tests zur Erfassung der Leseleistungen und des Leseverständnisses
8.2 Tests zur Erfassung der Rechtschreibleistungen
8.3 Tests der kognitiven Vorläuferfähigkeiten des Lesens
8.3.1 Tests zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und des phonologischen Arbeitsgedächtnisses
8.3.2 Tests zur Erfassung von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen
9 Alphabetisierungskonzepte und Kurse für Alphabetisierung und Grundbildung
9.1 DVV-Rahmencurriculum Lesen und Schreiben
9.2 AlphaPlus – Ein Alphabetisierungsprogramm zur Förderung der Schriftsprachkompetenz Erwachsener
9.3 Weitere Lehr- und Lernkonzepte
Anhang
Literatur
Der Autor
Sachwortverzeichnis
|7|Einleitung
Etwa 6,2 Millionen Erwachsene können in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben. Davon geben ca. 55 % an, Deutsch als Erstsprache zu haben. Dieses Buch richtet sich an alle, die sich über diese Thematik informieren wollen und/oder mit gering literalisierten Menschen arbeiten.
Das Buch besteht aus zwei Teilen. Teil eins beschäftigt sich mit den Grundlagen geringer Literalität, Teil zwei mit der praktischen Alphabetisierungsarbeit. Im Grundlagenteil gehe ich zunächst auf die Definition und Häufigkeit von geringer Literalisierung ein. Das Konzept der Alpha-Levels zur Erfassung der Lese- und Schreibkompetenzen Erwachsener wird vorgestellt, bevor auf die Größenordnung geringer Literalisierung in Deutschland und den benachbarten deutschsprachigen Ländern eingegangen wird. Kapitel zwei stellt die kognitiven und neurobiologischen Grundlagen des gelingenden Leseprozesses dar, bevor in Kapitel drei Ursachen geringer Literalisierung Erwachsener aus vier sich ergänzenden Blickwinkeln betrachtet werden: der gesellschaftlichen, der schulischen, der kognitiven und der neurobiologischen Perspektive.
Teil zwei des Buches beginnt mit der Zusammenfassung von Ergebnissen mehrerer größerer Studien, die versuchen, die Gruppe der gering literalisierten Menschen zu charakterisieren. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass einerseits nur ein kleiner Teil der Betroffenen an Kursen teilnimmt, die Lese- und Schreibkenntnisse an Erwachsene vermitteln, andererseits jedoch mangelnde Schriftsprachkenntnisse sowohl von Betroffenen als auch von deren Umfeld (Arbeitgeber, Kolleginnen und Kollegen, Familie) als alltagsbeeinträchtigendes Problem angesehen werden. Informationen über die Lebenswelt gering literalisierter Erwachsener können helfen, diese zu einer Kursteilnahme zu motivieren. Es werden Konzepte zur Ansprache und zur Lernberatung sowie Materialien und Best-Practice-Beispiele für niederschwellige Lernangebote vorgestellt.
|8|In Kapitel acht wird die Diagnostik der Lese- und Schreibfertigkeiten von Erwachsenen als Grundlage für Lernberatung und die Vermittlung an entsprechende Lernangebote behandelt. Dabei wird zwischen evaluativer und klassifizierender Diagnostik unterschieden. Es werden Testverfahren zur Erfassung der Lese- und der Schreibleistungen sowie zur Erfassung der kognitiven Vorläuferfähigkeiten des Lesens besprochen.
In Kapitel neun stelle ich Kurskonzepte für die Alphabetisierungsarbeit vor. Dabei stehen das Rahmencurriculum Lesen und Schreiben des Deutschen Volkshochschulverbandes und das Kurskonzept „AlphaPlus“ im Vordergrund.
|9|Grundlagenteil
|11|1 Definition und Häufigkeit von geringer Literalisierung Erwachsener in Deutschland
Magdalena (Name vom Autor geändert) ist 51 Jahre alt, in Deutschland geboren und berufstätig. Aufgrund großer Schwierigkeiten hat sie die Schule nach der achten Klasse ohne Abschluss abgebrochen. Sie berichtet, dass ihre Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben schon in der ersten Klasse auftraten, sie aber trotzdem immer in die jeweils nächste Klassenstufe versetzt worden sei. Da auch ihre Mutter nur sehr schlecht lesen und schreiben konnte, sei in der Familie kein großer Wert auf die Schulleistungen der Kinder gelegt worden. Als Kind sei sie einmal für mehrere Wochen im Krankenhaus gewesen, wo man ihr Bücher zum Lesen gegeben habe. Sie berichtet: „Ich war so stolz, dass ich gelesen hab. Und dann hab ich das einer Schwester vorgelesen und die schaut mich an und sagt: ‚Das steht da so nicht!‘“ Auf die Frage nach den Ursachen für ihre Probleme antwortet Magdalena: „Ich denke, dass mir irgendwo dieses Lesen, so wie man es in der Grundschule macht oder wie man das beigebracht bekommt, dass ich das irgendwie übersprungen habe.“ Viele der Personen aus ihrem persönlichen Umfeld wissen nichts von ihren Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben. Weder im Beruf noch im privaten Bereich sieht sie für sich Nachteile, obwohl sie oft versucht, Situationen zu meiden, in denen sie lesen oder schreiben müsste. Im Alter von über vierzig Jahren hat sie sich dann entschlossen, an einem Volkshochschulkurs zur Alphabetisierung teilzunehmen, um ihre Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern. Eine formale Testung ergab, dass ihre Lese- und Schreibfähigkeiten zu diesem Zeitpunkt auf dem Niveau einer durchschnittlichen Schülerin Mitte der zweiten Klasse waren (Quelle: eigenes Interview im Rahmen des Forschungsprojektes „AlphaPlus“; Boltzmann et al., 2015).
David (Name vom Autor geändert) ist 19 Jahre alt und Auszubildender. Er ist in Deutschland geboren, sein Vater kommt ursprünglich aus England. Von ihm habe er Englisch sprechen gelernt, könne es aber weder lesen noch schreiben. Er gibt |12|an, dass er in Deutschland die Grundschule besucht habe, wo er von Beginn an Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben hatte. Es wurde eine Lese-Rechtschreib-Schwäche festgestellt. Die erste Klasse musste David trotz Förderunterricht wiederholen. Ab der sechsten Klasse besuchte er eine Sonderschule, die er mit dem Hauptschulabschluss beenden konnte. Zum Interviewzeitpunkt befand er sich im ersten Lehrjahr einer beruflichen Ausbildung. David nimmt an einem Kurs zur Alphabetisierung im Rahmen des Projektes „AlphaPlus“ teil. Seine Lese- und Rechtschreibfähigkeiten beschreibt er zu Beginn des Kurses folgendermaßen: „Lesen konnte ich eigentlich generell schon gut, nur habe ich die Wörter halt manchmal verdreht. Ich kann zum Teil flüssig lesen. Aber manchmal haperts dann auch mit manchen Wörtern. Das sind bei mir meistens die kleinen Wörter, die dann auf einmal ins Stocken kommen. Die man schnell mal überliest und so. Das Schreiben ist eher so, die schweren Wörter sind meistens immer alle richtig, die ich schreibe, nur die leichten Wörter, sagen wir mal, Namen oder so, die werden dann halt schwerer. Das ist einfach irgendwie komisch bei mir, irgendwie sind immer die schweren Wörter richtig und die leichten Wörter sind halt falsch.“ Die formale Testung der Lese- und Rechtschreibleistung von David zu Beginn des Kurses ergab eine mit einem Schüler bzw. einer Schülerin der dritten Klasse vergleichbare Lesegeschwindigkeit bei besserem Textverständnis und eine Rechtschreibleistung, die der vierten Klassenstufe entspricht. David erlebt eher wenig Einschränkungen durch seine Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im Alltag. Briefe beantworte er mithilfe seiner Stiefmutter, um Fehler zu vermeiden. Zudem vermeide er bestimmte Situationen, in denen er lesen oder schreiben müsste. Während der Schulzeit fühlte er sich vor allem bei Diktaten benachteiligt. In der Berufsschule fühlt er sich aktuell manchmal überfordert, erhält aber Unterstützung von seinen Betreuern und Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen. Er gibt an, vor allem in Onlinenetzwerken aufgrund seiner schlechten Rechtschreibung oft gehänselt worden zu sein (Quelle: eigenes Interview im Rahmen des Forschungsprojektes „AlphaPlus“; Boltzmann et al., 2015).
Renate (Name vom Autor geändert) ist 54 Jahre alt und berufstätig. Alltägliche Dinge wie E-Mails lesen oder eine Geburtstagskarte schreiben sind für sie wie ein Spießrutenlauf. Nur wenige Menschen wissen, dass sie Problemen mit dem Lesen und Schreiben habe. Dies liege vor allem an der Scham, als Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben zu können, sagt Renate. Über die Jahre habe sie verschiedene Wege gefunden, damit niemand von ihren Problemen erfährt. Kleinere Texte lasse sie sich oft vorlesen. „Ich habe meistens gesagt, dass ich die Brille vergessen habe“, sagt sie. Eine Freundin helfe ihr bei wichtigen Formularen, bei der Arbeit habe sie vieles auswendig gelernt. Sie berichtet, dass auch ihr Chef jahrelang |13|nichts geahnt habe. Das ständige Verheimlichen zerrte jedoch so an ihren Nerven, dass sie unter einem Burn-out litt. Sie musste offen über ihre Probleme sprechen. „Mein Chef ist aus allen Wolken gefallen, weil er gar nicht geahnt hatte, dass es mir so schwerfällt“, berichtet sie (Fallbeispiel aus RBB Abendschau, 2024).
Uwe ist mittlerweile im Ruhestand. Schon in der Schule hatte er große Probleme mit Lesen und Schreiben. Er berichtet, dass er mit 32 Kindern in einer Klasse war und daher einige „auf der Strecke“ blieben, zu denen er gehört habe. Er sei jedes Jahr versetzt worden, „aus pädagogischen Gründen“. Er vermutet, dass es an seinen mündlichen Leistungen lag. Von der Familie habe er in der Schulzeit wenig Unterstützung bekommen. Inwieweit seine Eltern ebenfalls Probleme mit Lesen und Schreiben hatten, kann er nicht sagen. Er verließ die Schule nach neun Jahren mit dem Hauptschulabschluss und machte dann eine Ausbildung im Hamburger Hafen, wo er sein komplettes Berufsleben verbrachte (48 Jahre). Als Erwachsener hat er verschiedene Alphabetisierungskurse besucht. Heute könne er einigermaßen gut lesen, mit dem Schreiben habe er jedoch noch immer große Probleme, die sich vor allem darin äußerten, dass er sehr unsicher mit der korrekten Schreibung sei. Er berichtet, dass er häufig Wörter richtig hinschreibe, diese dann durchstreiche und falsch schreibe. Das Nutzen von elektronischen Hilfen wie Diktierfunktion helfe ihm sehr dabei, Texte zu verfassen. Lesen gehe so weit gut, nur bei Fremdwörtern habe er heute noch Probleme. Das Lesen von Rechtstexten, das im Rahmen seiner Berufstätigkeit erforderlich war, habe mit großer Mühe funktioniert. Er berichtet, dass es für ihn früher (vor Besuch der Alphabetisierungskurse) schwierig war, wenn im Supermarkt die Anordnung der Ware in den Regalen geändert wurde oder wenn die Produktverpackung sich änderte. „Ich habe immer dasselbe eingekauft“, berichtet Uwe (persönliches Interview im Mai 2024). Heute ist Uwe als Botschafter für Alphabetisierung für den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e. V. ehrenamtlich tätig, um andere Betroffene dazu zu motivieren, als Erwachsene Lesen und Schreiben zu lernen.
Lesen und Schreiben haben in unserer modernen Gesellschaft als Kulturtechnik eine überragende Bedeutung. Ob Bus- oder Zugfahrpläne, das Kinoprogramm, Arbeitsanweisungen, Formulare oder Kurzinformationen im Internet – ständig stehen wir im Alltag vor Aufgaben, die die Aufnahme von schriftlichen Informationen erfordern. Menschen, die nicht ausreichend lesen oder schreiben können, stehen vor großen Herausforderungen in der Bewältigung ihres Alltags. Magdalena, Renate, David und Uwe sind mit ihren Schriftsprachproblemen nicht allein: In Deutschland können etwa 6,2 Millionen Erwachsene Menschen nicht ausreichend lesen und schreiben. Mehr als die Hälfte der Betroffenen hat Deutsch als Erstsprache gelernt. Diese Personen werden häufig als funktionale |14|Analphabetinnen und Analphabeten oder als gering literalisierte Erwachsene bezeichnet.
Im Folgenden gehe ich zunächst genauer auf die Begriffe „Analphabetismus“ und „geringe Literalisierung Erwachsener“ ein. Ich beschreibe ein Rahmenmodell, innerhalb dessen festgestellt werden kann, über welche Lesefähigkeiten ein Mensch verfügt (sogenannte Alpha-Levels). Außerdem präsentiere ich die Ergebnisse von Studien, die sich mit der Größenordnung geringer Literalisierung in Deutschland befassen.
1.1 Definition von funktionalem Analphabetismus
Unter Analphabetismus wird gemeinhin die Unfähigkeit verstanden, zu lesen und zu schreiben. Dabei werden verschiedene Formen von Analphabetismus voneinander unterschieden: Primärer Analphabetismus liegt vor, wenn wegen fehlenden Schulbesuchs keine schriftsprachlichen Kompetenzen erworben wurden. Von sekundärem Analphabetismus wird gesprochen, wenn nach mehr oder minder erfolgreichem Schulbesuch ein Prozess des Vergessens einsetzt, bei dem einmal erworbene schriftsprachliche Kompetenzen verloren gehen, bis schließlich ein Schriftsprachniveau erreicht ist, das zur Bewältigung der Alltagsanforderungen an Literalität nicht mehr ausreicht (Egloff, Grosche, Hubertus & Rüsseler, 2011). Sekundärer Analphabetismus kann infolge neurologischer Schädigungen oder Erkrankungen wie beispielsweise nach einem Schädel-Hirn-Trauma, nach Schlaganfällen oder bei demenziellen Erkrankungen entstehen.
Viele Menschen haben massive Probleme mit Lesen und Schreiben, erfüllen aber nicht das Kriterium der völligen Unfähigkeit im Umgang mit Schriftsprache. Für diese Personengruppe hat sich die Bezeichnung „funktionale Analphabeten“ bzw. „funktionale Analphabetinnen“ etabliert, wobei heute eher von gering literalisierten Erwachsenen gesprochen wird. Die Betroffenen können zumeist einzelne Wörter, aber auch kurze Sätze und einfache Texte lesen, verfügen aber nicht über die zur Bewältigung der schriftsprachlichen Alltagsanforderungen notwendigen Kompetenzen. So sind sie beispielsweise nicht in der Lage, das Fernseh- oder Kinoprogramm oder Bus- bzw. Zugfahrpläne sinnentnehmend zu lesen.
Es existieren bereits seit längerer Zeit einige Definitionen von funktionalem Analphabetismus. Nach der Positiv-Definition der UNESCO ist ein „funktionaler Alphabet … eine Person, die sich an all den zielgerichteten Aktivitäten ihrer Gruppe und Gemeinschaft, bei denen Lesen, Schreiben und Rechnen erforderlich sind, und ebenso an der weiteren Nutzung dieser Kulturtechniken für ihre eigene Ent|15|wicklung und die ihrer Gemeinschaft beteiligen kann“ (UNESCO, 1994, S. 25 f.). Eine funktionale Analphabetin oder ein funktionaler Analphabet ist folglich eine Person, die dies nicht kann. Nach Drecoll und Müller (1981, S. 31) bedeutet funktionaler Analphabetismus „die Unterschreitung der gesellschaftlichen Mindestanforderungen an die Beherrschung der Schriftsprache, deren Erfüllung Voraussetzung ist zur sozial streng kontrollierten Teilnahme an schriftlicher Kommunikation in allen Arbeits- und Lebensbereichen“. Döbert-Nauert (1985, S. 5) definiert folgendermaßen: „Als funktionale Analphabeten werden … diejenigen bezeichnet, die aufgrund unzureichender Beherrschung der Schriftsprache und/oder aufgrund der Vermeidung schriftsprachlicher Eigenaktivität nicht in der Lage sind, Schriftsprache für sich im Alltag zu nutzen.“ Und Hubertus (1991, S. 5) führt an: „Wenn die individuellen Kenntnisse niedriger sind als die erforderlichen und als selbstverständlich vorausgesetzten Kenntnisse, liegt funktionaler Analphabetismus vor.“
Alle oben referierten Definitionen versuchen, das Phänomen möglichst umfänglich zu erfassen. Allerdings liefern sie keine konkrete Operationalisierung. Das heißt, sie ermöglichen es nicht, festzustellen, wer zur Gruppe der funktionalen Analphabetinnen und Analphabeten bzw. zur Gruppe der gering literalisierten Erwachsenen hinzugezählt werden kann und wer nicht. Die folgende Definition versucht, diesen Aspekt zu berücksichtigen (Egloff et al., 2011, S. 14):
Funktionaler Analphabetismus ist gegeben, wenn die schriftsprachlichen Kompetenzen von Erwachsenen niedriger sind als diejenigen, die minimal erforderlich sind und als selbstverständlich vorausgesetzt werden, um den jeweiligen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Diese schriftsprachlichen Kompetenzen werden als notwendig erachtet, um gesellschaftliche Teilhabe und die Realisierung individueller Verwirklichungschancen zu eröffnen. …
Unter schriftsprachlicher Kompetenz ist die Fähigkeit zu verstehen, sich der Schrift als Kommunikationsmittel zu bedienen. Schriftsprachliche (literale) Kompetenzen in entfalteter Form sind: – sinnverstehendes Lesen in einem angemessenen Tempo (neben dem Lesen von Texten gehören hierzu auch das Verstehen von Tabellen, Grafiken, Listen oder quantitativen Darstellungen, ebenso das Deuten von Symbolen, Schildern, Beschriftungen etc.); – die Fähigkeit, sich schriftlich in einem angemessenen Tempo auszudrücken (neben dem Schreiben von Texten gehören hierzu auch das Ausfüllen und Beschriften von Grafiken, Tabellen, Listen, Formularen sowie das Beherrschen von Rechtschreibung, Zeichensetzung etc.).
|16|Eine sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft kritische Ausprägung literaler Kompetenzen ist gegeben, wenn die literalen Fähigkeiten nicht ausreichen, um schriftsprachliche Anforderungen des täglichen Lebens und einfachster Erwerbstätigkeiten zu bewältigen. Dies ist gegenwärtig zu erwarten, wenn eine Person nicht in der Lage ist, aus einem einfachen Text eine oder mehrere direkt enthaltene Informationen sinnerfassend zu lesen und/oder sich beim Schreiben auf einem vergleichbaren Kompetenzniveau befindet.
Aufgrund der konkreten Nennung von schriftsprachlichen Kompetenzen ist es auf Basis dieser Definition möglich, eine Operationalisierung vorzunehmen, das heißt konkrete Testverfahren der Lese- und Schreibkompetenzen zu entwickeln, um festzustellen, ob eine Person als gering literalisiert angesehen werden kann und somit zur Gruppe der funktionalen Analphabetinnen und Analphabeten gezählt werden muss.
1.2 lea. Diagnostik: Alpha-Levels
Im vom BMBF geförderten Verbundprojekt „lea. – Literalitätsentwicklung von Arbeitskräften“ wurden sogenannte Alpha-Levels und eine Förderdiagnostik entwickelt, die eine Beschreibung der vorhandenen Schriftsprachkompetenzen von Erwachsenen ermöglichen (Dessinger, 2011). Die Lese- und Schreibkompetenzen werden in sechs Alpha-Levels eingeteilt, die jeweils darstellen, welche Kompetenzen vorhanden sein müssen, damit das entsprechende Level als erreicht gilt (siehe Tabelle 1-1).
Analoge Stufen wurden auch für das Schreiben formuliert (Alpha-Levels Schreiben). Als funktionale Analphabetinnen bzw. Analphabeten bzw. gering literalisierte Erwachsene gelten Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Ende der Schulpflicht) und nicht über Alpha-Level 3 hinauskommen. In Deutschland gelten rund 6,2 Millionen Erwachsene als gering literalisiert (Grotlüschen et al., 2019; siehe Kapitel 1.3).
|17|Tabelle 1-1: Alpha-Levels Lesen
Alpha-Level 1
Buchstabenebene: prä- und paraliterales Lesen
Kann Grapheme benennen.
Kann KVK-Wörter mit bis zu 5 Graphemen phonologisch benennen.
Kann KVK-Wörter mit bis zu 5 Graphemen phonologisch synthetisieren.
Kann KVK-Wörter mit bis zu 5 Graphemen konstruierend decodieren.
Alpha-Level 2
Wortebene: überwiegend konstruierendes Lesen*
Kann Zeitpläne sinnentnehmend lesen.
Kann Wörter mit ansteigender Komplexität (Konsonantenhäufung) recodieren und decodieren.
Alpha-Level 3
Satzebene: überwiegend konstruierendes Lesen sowie lexikalisches Erlesen* von Standardwörtern
Kann einzelne Wörter im Satzkontext erlesen.
Kann orthografisch komplexere Wörter erlesen.
Kann Satz-Bild-Verbindungen vornehmen.
Kann SPO-Sätze (auch mit Einfügungen) sinnerfassend lesen.
Kann einfachen Anweisungen folgen.
Kann TV-Programm einschließlich Zeitangaben lesen.
Alpha-Level 4
Textebene 1: kurze, einfache Texte, gleichermaßen konstruierendes und lexikalisches Lesen
Kann einzelne Wörter aus einem Text heraussuchen.
Kann Strukturen einfacher Formulare erkennen.
Kann kurzen und einfachen Texten (mit erläuternden Bildern und Illustrationen) 1–2 direkt enthaltene/wörtliche Informationen entnehmen.
Kann kurzen und einfachen Texten (mit erläuternden Bildern und Illustrationen) 1–2 indirekt enthaltene Informationen entnehmen.
Textlänge: 3 bis 8 Sätze mit max. 9 Wörtern pro Satz. SPO-Sätze, wenige Erweiterungen; Präsens, Perfekt, Imperfekt.
Alpha-Level 5
Textebene 2: mittelschwere Texte mit Illustrationen, gleichermaßen konstruierendes und lexikalisches Lesen
Kann mittelschwere Texte sinnentnehmend lesen.
Kann aus mittelschweren Texten mit erläuternden Bildern 1–3 direkt enthaltene/wörtliche Informationen entnehmen.
Kann aus mittelschweren Texten mit erläuternden Bildern 1–3 indirekt enthaltene Informationen entnehmen.
Textlänge: bis 15 Sätze mit je bis zu 12 Wörtern. SPO-Sätze mit Erweiterungen, Präsens, Perfekt, Futur, Imperfekt.
|18|Alpha-Level 6
Textebene 3: mittelschwere und angrenzende Texte, Unterhaltungsliteratur; überwiegend lexikalisches Lesen mit Rückgriff auf die konstruierende Lesestrategie
Kann aus mittelschweren und angrenzenden Texten 1–3 direkt enthaltene/wörtliche Informationen entnehmen.
Kann aus mittelschweren und angrenzenden Texten 1–3 indirekt enthaltene Informationen entnehmen.
Textlänge: bis 20 Sätze mit bis zu 12 Wörtern; alle Tempi, Schachtelsätze.
*Begriffserläuterungen: Konstruierendes Lesen bedeutet, dass jedem Graphem (kleinste bedeutungstragende Einheit der Schriftsprache; z. B. einzelne Buchstaben wie e, i, g; Buchstabenkombinationen wie au, ei, sch) in einem Wort ein Lautwert bzw. Phonem zugeordnet wird. Diese komplexe lautliche Analyse bzw. das bewusste buchstabenweise Erlesen erfordert vielfach die vollständige Konzentration des Lesenden, sodass zum inhaltlichen (semantischen) Verständnis des Gelesenen häufig nicht mehr genügend kognitive Kapazität vorhanden ist. Lexikalisches Lesen bedeutet, dass das semantische System (Speichersystem für Wortbedeutungen) direkt in den Leseprozess einbezogen wird. Aufgrund der Wortform und des semantischen Kontextes, in dem das Wort innerhalb eines Satzes vorkommt, erfolgt die Aktivierung des Wortes im Gedächtnis, ohne dass eine mühevolle Decodierung der einzelnen Grapheme vorgenommen werden muss. Auf diese Weise können nur bereits bekannte Wörter gelesen werden.
1.3 leo.-Studien 2011 und 2018 sowie Folgestudien
Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) führte ein Team der Universität Hamburg um Frau Prof. Anke Grotlüschen zwei Studien durch mit Ziel, die Größenordnung geringer Literalisierung in Deutschland zu erfassen sowie möglichst viele Informationen über die Betroffenen zu bekommen, um das Problem zu adressieren. Im Folgenden fasse ich die wesentlichen Ergebnisse dieser beiden Studien zusammen.
In der Level-One-Studievon 2011 (leo.; Grotlüschen & Riekmann, 2011) wurden 7.035 Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren (Zufallsstichprobe der Wohnbevölkerung in Deutschland), deren mündliche Kenntnisse der deutschen Sprache zur Teilnahme ausreichend sein mussten, befragt bzw. deren Lese- und Schreibkompetenzen mit kurzen Tests erfasst. Zusätzlich wurden 1.401 Personen aus dem unteren Bildungsbereich eingeschlossen. Eine neue Stichprobe von 6.681 Personen wurde 2018 untersucht, zusätzlich 511 Personen aus dem unteren Bildungsbereich (Grotlüschen, Buddeberg, Dutz, Heilmann & Stammer, 2019).
Größenordnung geringer Literalisierung in Deutschland: In der leo.-Studie von 2011 erreichten 0,6 % der Teilnehmenden (also auf die Population hochgerechnet 300 000 Personen) maximal Alpha-Level 1. 3,9 % (entspricht 2 Millionen Personen) erreichten maximal Alpha-Level 2 und 10 % (hochgerechnet 5,2 Millionen |19|Personen) maximal Alpha-Level 3. Insgesamt konnten also 7,5 Millionen Erwachsene als gering literalisiert angenommen werden (Alpha-Levels 1–3: Lesekompetenz geht nicht über die Ebene einzelner, eher einfacher Sätze hinaus). In der Nachfolgestudie von 2018 wurden noch 6,2 Millionen Erwachsene als gering literalisiert angesehen (0,6 % bzw. 300 000 Personen Alpha-Level 1, 3,4 % bzw. 1,7 Millionen Personen Alpha-Level 2, 8,1 % bzw. 4,2 Millionen Personen Alpha-Level 3). Im Jahr 2018 waren 58,4 % der Betroffenen Männer. Bezogen auf das biologische Alter zeigte sich, dass der größere Teil der gering literalisierten Erwachsenen über 45 Jahre alt war (12,1 % zwischen 18 und 25 Jahren, 18,2 % zwischen 26 und 35 Jahren, 22,9 % zwischen 36 und 45 Jahren, 25,2 % zwischen 46 und 55 Jahren und 21,6 % zwischen 56 und 65 Jahren). Betroffen waren sowohl Personen mit Deutsch als Erstsprache (52,6 % in 2018) als auch mit anderen Herkunftssprachen. Somit treten geringe Lese- und Schreibkompetenzen in erheblichem Maße auch bei Personen mit Deutsch als Erstsprache auf, können also nicht nur auf eventuelle mangelnde mündliche Kenntnisse der deutschen Sprache zurückgeführt werden. 77,8 % derjenigen gering literalisierten Menschen, die andere Herkunftssprachen als Deutsch haben, können in ihrer Erstsprache nach eigenen Angaben anspruchsvolle Texte lesen und schreiben, 22,2 % können dies nicht und müssen daher auch in ihrer Erstsprache als gering literalisiert angesehen werden.
63,6 % der gering literalisierten Erwachsenen leben in einer Partnerschaft. In der Gesamtbevölkerung ist dieser Anteil mit 69,9 % höher. Immerhin etwas mehr als ein Drittel der gering literalisierten Erwachsenen kann sich daher nicht auf Hilfe bei Literalitätsanforderungen durch eine Partnerin oder einen Partner verlassen.
Von besonderer Bedeutung ist, dass die große Mehrzahl der gering literalisierten Erwachsenen über einen Schulabschuss verfügt: Nur 22,3 % haben keinen Schulabschluss. 40,6 % haben niedrige Schulabschlüsse, 18,5 % mittlere und immerhin 16,9 % der gering literalisierten Erwachsenen einen höheren Schulabschluss.
Die Mehrzahl der gering literalisierten Erwachsenen ist erwerbstätig (62,3 %; Gesamtbevölkerung: 75,5 %). 12,9 % sind arbeitslos, die übrigen Rentnerin oder Rentner bzw. im Haushalt tätig oder haben keine Angaben gemacht. Allerdings muss festgestellt werden, dass die Arbeitsverhältnisse bzw. die berufliche Stellung teilweise erheblich von der Gesamtbevölkerung abweichen (siehe Tabelle 1-2). Insbesondere bei Tätigkeiten, die keine oder eine kurze Ausbildung/Anlernen voraussetzen, sind gering literalisierte Personen überrepräsentiert. In diesen Tätigkeitsfeldern sind häufig prekäre Arbeitsbedingungen vorzufinden.
In der SAPfA-Studie (Sensibilisierung von Arbeitnehmern für das Problem des funktionalen Analphabetismus in Unternehmen; |20|Ehmig, Heymann & Seelmann, 2015) wurden im November 2013 insgesamt 1.618 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in verschiedenen Branchen befragt. Der Gesamtanteil an nach eigenen Angaben gering literalisierten Personen betrug in dieser Stichprobe 15 %. In den untersuchten Branchen finden sich unterschiedlich viele gering literalisierte Erwachsene: Garten- bzw. Landschaftspflege 21 %, Baugewerbe 19 %, Gastronomie/Hotel 18 %, Reinigungsgewerbe 17 %, Gebäudebetreuung 13 %, Lagerhaltung 13 %, produzierendes Gewerbe 11 %, sonstiges Handwerk 9 %, Transport/Frachtgewerbe 9 %. Es wird deutlich, dass einige der Branchen auch vom zunehmenden Fachkräftemangel besonders betroffen sind (Bauwesen, Transportwesen; Hickmann & Koneberg, 2022) und dass in vielen der genannten Branchen die Anforderungen an Schriftsprachkenntnisse stetig wachsen (Klein & Schöpper-Grabe, 2011). Somit rückt die Förderung der Lese- und Schreibkompetenzen auch vermehrt in den Blick der Unternehmen, die durch Alphabetisierungs- und Grundbildungsmaßnahmen die Bindung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an ihr Unternehmen stärken und sicherstellen, dass die Mitarbeitenden ihre Aufgaben auch zukünftig angemessen erfüllen können.
Tabelle 1-2: Berufliche Stellung gering literalisierter Erwachsener im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Deutschland
Berufliche Stellung
Alpha-Level 1–3
Gesamtbevölkerung
Geringfügig beschäftigt (Minijob oder kurzfristig beschäftigt mit max. 50 Arbeitstagen pro Jahr)
7,2 %
5,3 %
Arbeiterin bzw. Arbeiter
40,1 %
14,8 %
Angestellte bzw. Angestellter
45,5 %
62,1 %
Beamtin bzw. Beamter
0,4 %
7,1 %
Selbstständige
6,3 %
10,4 %
Mithelfende Familienangehörige
0,3 %
0,2 %
Keine Angabe
0,2 %
0,2 %
Quelle: Grotlüschen et al., 2019
Neben den beiden leo.-Studien geben auch internationale, multinational angelegte Untersuchungen Auskunft über Literalitätsprobleme von Erwachsenen. Das „Progamme for the International Assessment of Adult Competencies“ (PIAAC) der OECD erfasst unter anderem Lesekompetenzen Erwachsener in über 40 Ländern (OECD, 2016). Dabei haben 18,9 % der Teilnehmenden (alle Länder) niedrige Lesefähigkeiten (Level 1 oder weniger auf der in der PIAAC-Studie verwende|21|ten Leseskala, entspricht etwa Alpha-Level 3). Deutschland erreicht insgesamt mit 270 Punkten einen leicht über dem OECD-Durchschnitt von 266 Punkten liegenden Wert. Etwa 17,5 % erreichen maximal Level 1 (OECD-Durchschnitt: 15,5 %; zum Vergleich zwischen leo. und PIAAC siehe Nienkemper, Heinemann & Grotlüschen, 2014). Dies zeigt einerseits, dass geringe literale Kompetenzen Erwachsener kein auf Deutschland begrenztes Problem darstellen. Andererseits bestätigt es die von den beiden leo.-Studien vorgelegten Zahlen zur Größenordnung geringer Literalisierung Erwachsener in Deutschland.
In der internationalen Schulleistungsstudie „Program for International Student Assessment (PISA; OECD, 2023a, 2023b) wurden unter anderem die Lesekompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern erfasst. 25 % der Schülerinnen und Schüler in Deutschland erreichen in PISA maximal die Lesekompetenzstufe 2. Dabei wird vor allem das Verständnis beim Erlesen kürzerer Texte geringer bis mittlerer Komplexität erfasst. Informationen müssen ermittelt werden, indem eine bzw. mehrere Informationen in einem Text lokalisiert bzw. geschlussfolgert werden müssen, wobei im Text auch konkurrierende Informationen enthalten sind. Der Hauptgedanke und die Beziehungen in einem Text müssen erkannt und die Bedeutung des Textes auf Basis von Schlussfolgerungen erfasst werden. Weiterhin wird die Fähigkeit zum Reflektieren und Bewerten des Gelesenen mit Bezug zu über den Text hinausgehendem Wissen untersucht. Ein direkter Vergleich mit den oben beschriebenen Alpha-Levels ist schwierig, da in PISA (wie auch in PIAAC) im Bereich geringer literaler Fähigkeiten deutlich weniger differenziert wird als in den leo.-Studien. Lesekompetenzstufe 2 in PISA entspricht am ehesten den Alpha-Levels 3 und 4.
Österreich: Verglichen mit anderen europäischen Ländern wurde das Problem der unzureichenden Grundbildung Erwachsener in Österreich erst sehr spät wahrgenommen. Das erste Pilotprojekt zu diesem Thema wurde 1990 angestoßen. Institutionen in vier großen Städten, die Alphabetisierungskurse für Erwachsene deutscher Muttersprache anboten, schlossen sich zu einem Netzwerk für Alphabetisierung zusammen. Im Rahmen eines ESF-geförderten Projektes erarbeitete das Netzwerk von 2005 bis 2007 wesentliche Grundlagen, die bis heute die Grundbildungsstrukturen maßgeblich prägen.
In Österreich wird im Bereich der Erwachsenenbildung der Begriff „Basisbildung“ verwendet, der Elemente wie Lesen, Schreiben, Sprachkompetenz, Rechnen sowie den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien umfasst. Zur Größenordnung unzureichender Basisbildung liegen keine genaueren Zahlen vor. Als Anhaltspunkt dienen die verschiedenen Studien der OECD. |22|Der PISA-Erhebung aus dem Jahr 2009 zufolge haben 16 % der 15-Jährigen in allen drei erfassten Bereichen Defizite. Bezogen auf das Leseverständnis besitzen 28 % unzureichende Fähigkeiten. Diese Zahlen bleiben in der aktuellen PISA-Studie von 2023 etwa gleich (OECD, 2023a, 2023b). In der PIAAC-Studie zeigten 17,1 % der Erwachsenen unzureichende Lese- und Schreibkompetenzen (OECD, 2016). Bildungspolitisch wurde der Bereich der Basisbildung in den letzten Jahren stark gefördert, und es wurden entsprechende Kampagnen initiiert, um das Problem zu reduzieren. Ein nennenswertes Beispiel hierfür ist die 2011 veröffentlichte Strategie der österreichischen Bundesregierung für lebenslanges Lernen, die auf Angebote zum Nachholen von formalen Abschlüssen und den Erwerb von Grundkompetenzen abzielt (Doberer-Bey & Netzer, 2012; Doberer-Bey, 2016).
Schweiz: Auch in der Schweiz leben Personen, die über keine ausreichenden Grundbildungskompetenzen verfügen. Erstmals belegte das die IALS-Studie im Jahr 1998. Richtig ernst genommen wurde es aber erst durch die Studie „Adult Literacy and Lifeskills“ (ALL), die 2005 vom Bundesamt für Statistik durchgeführt wurde (Bundesamt für Statistik, 2005). Den Ergebnissen zufolge haben 16 % der Erwachsenen in der Schweiz Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben, wobei 10 % von ihnen einen Migrationshintergrund haben. Seither wird in der öffentlichen Diskussion eine Zahl von 800 000 Erwachsenen genannt, deren Lesekompetenzen so gering seien, dass sie einfache Texte nicht verstehen könnten (Märki, 2016). Aktuellere Zahlen gibt es nicht, da die Schweiz bislang an PIAAC nicht beteiligt war (bei der nächsten Erhebung aber teilnimmt). In der Schweiz zählen zu den Grundkompetenzen die Fähigkeiten, mit einfachen Texten umzugehen, mathematische Aufgaben zu lösen, Informations- und Kommunikationstechnologien zu nutzen und die Amtssprache zu verwenden. Davon abzugrenzen ist der Begriff „Illetrismus“, der sich auf das Fehlen ausreichender Lese- und Schreibfähigkeiten bezieht. In der aktuellen PISA-Studie beträgt der Anteil der leistungsschwachen Jugendlichen in der Schweiz 25 % bei insgesamt über dem EU-Durchschnitt liegenden Kompetenzen (OECD, 2023a, 2023b).
1.4 Ein historisch-politischer Blick auf Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland und international
Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 besagt: „Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.“ Dieses Prinzip machte „Bildung für alle“ im 20. Jahrhundert zu einem zentralen Ziel der internationalen Bildungspolitik. |23|Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird das Recht auf Bildung in vielen internationalen Dokumenten und Erklärungen immer wieder bestätigt, weiter ausgearbeitet und programmatisch eingefordert (Hinzen, 2021). Dennoch bleibt „Bildung für alle“ auch im 21. Jahrhundert oft ein unerreichtes Ideal, selbst in wohlhabenden und hoch technisierten Gesellschaften des globalen Nordens (vgl. leo.-Studien von 2011 und 2018; Rammstedt, 2013). Vor allem in Ländern des globalen Südens bleibt Bildung weiterhin ein Privileg für eine kleine Gruppe und Minderheiten (UIL, 2021).
Seit 1945 ist die UNESCO ein zentraler internationaler Akteur für das Recht auf „Bildung für alle“. Im 21. Jahrhundert hat sich das von der UNESCO 1990 koordinierte Programm „Education for All – Bildung für alle“ als bedeutender Meilenstein etabliert. Dieses Programm wurde auf der Weltkonferenz in Jomtien (Thailand) für einen Zeitraum von zehn Jahren beschlossen (Deutsche UNESCO-Kommission, 1991). Diese sogenannte Jomtien-Dekade (1990–2000) war das Jahrzehnt, in dem die UNESCO ihre Forderung nach „Bildung für alle“ nachhaltig umsetzen wollte. Zu diesem Zweck trafen sich 115 Staaten und 150 Organisationen, um eine Deklaration zur weltweiten Grundbildung zu verabschieden (Deutsche UNESCO-Kommission, 1991). Im Mittelpunkt stand die Idee von Bildung als Grundrecht und Schlüssel zur Innovation sowie zur Überwindung von Armut und Analphabetismus. Zur Überprüfung und Weiterentwicklung dieses Ziels fand im April 2000 eine anschließende Weltbildungskonferenz in Dakar statt, an der sich 181 Länder beteiligten (Sandhaas, 2000).
Die „Bildungsagenda 2030“, die im Rahmen der Globalen Nachhaltigkeitsagenda mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung entwickelt wurde, stellt die jüngste Erklärung für eine Bildung für alle dar. Sie wurde 2015 auf dem Weltbildungsforum im südkoreanischen Incheon verabschiedet (Deutsche UNESCO-Kommission, 2017).
Seit den 1940er-Jahren haben die Vereinten Nationen (UN) und die UNESCO die Alphabetisierung hauptsächlich mit Grundbildung gleichgesetzt, die einen schriftsprachlichen Zugang zur Kultur und zum Lebensraum ermöglicht. Im Jahr 1961 startete die UNESCO erstmals ein weltweites Alphabetisierungsprogramm, das jedoch bereits 1964 eingestellt wurde, da das Konzept einer globalen Alphabetisierung nicht erfolgreich war (Gläss, 1990). Ein nachfolgendes Projekt war zwar erfolgreicher, jedoch waren die Abbruchraten und die Rückfallquote immer noch enttäuschend hoch. Die Lage in den Ländern des globalen Südens verschlechterte sich in den 1970er- und 1980er-Jahren deutlich und wurde schließlich zu einem zentralen Thema auf der Weltbildungskonferenz in Jomtien im März 1990, die einen Zehnjahresplan zur Alphabetisierung mit dem Ziel der Hal|24|bierung von Analphabetismus formulierte. 1990 riefen auch die UN das Internationale Jahr der Alphabetisierung aus. Seitdem ist das Thema „Grundbildung für alle“ ein globales bildungspolitisches Ziel mit hoher Priorität. Bis Anfang der 1990er-Jahre gab es verschiedene mehr oder weniger erfolglose Versuche, das weltweite Alphabetisierungsproblem in den Ländern des globalen Südens zu lösen. Zu diesem Zeitpunkt schätzte man die Anzahl der Analphabetinnen und Analphabeten weltweit auf eine Milliarde (Schöfthaler, 1990), und für Deutschland wurden Anfang der 1990er-Jahre zwei bis drei Millionen betroffene Personen geschätzt (Eigler, 1990).
Das Problem der Alphabetisierung wurde seit den 1940er-Jahren in den Ländern des Südens als strukturell wahrgenommen und durch die Alphabetisierungsbewegung von Paulo Freire in den 1960er-/1970er-Jahren nicht nur als eine pädagogische, sondern auch als eine gesellschaftspolitische Herausforderung für Chancengleichheit und Gerechtigkeit betrachtet (siehe Kasten „Paulo Freires Konzept der Alphabetisierung“). Trotzdem ist es in den wohlhabenden und industrialisierten Ländern des Nordens oft vernachlässigt worden und hat selten öffentliche oder politische Aufmerksamkeit erfahren. Paulo Freires Erfahrungen in der Alphabetisierungsarbeit zeigen unter anderem, dass die Verbreitung von Grundbildungsfähigkeiten immer auch mit den Macht- und Herrschaftsstrukturen in den Ländern des globalen Südens verbunden war und mit Befreiung, politischer Emanzipation und Mündigkeit zu tun hat. Die Vorstellung, dass es in wohlhabenden Industriestaaten wie der Bundesrepublik Deutschland mit ihrer sozialen Marktwirtschaft (funktionale) Analphabeten geben könnte, wurde sowohl in der Pädagogik als auch in der Politik lange Zeit nicht akzeptiert. Das Thema wurde tabuisiert. Entsprechend gab es auch lange Zeit nur wenig erziehungs- bzw. bildungswissenschaftliche Forschung dazu, die erst Ende der 1970er-Jahre begann (Drecoll & Müller, 1979).
Internationalen Aufschwung erlangte das Thema zu Beginn der 1990er-Jahre. Die 42. Vollversammlung der Vereinten Nationen erklärte 1990 zum „Internationalen Jahr der Alphabetisierung“, und zwei wegweisende internationale Bildungskonferenzen fanden statt, die die Alphabetisierung und Grundbildung weltweit in den Fokus rückten. Die erste fand vom 5. bis 9. März 1990 in Jomtien, Thailand, statt und wurde von der UNESCO, dem UNDP, UNICEF und der Weltbank unterstützt. Die zweite Konferenz, die 42. Internationale Erziehungskonferenz, wurde vom IBE in Genf vom 3. bis 8. September 1990 ausgerichtet. Zu diesem Zeitpunkt bezeichnete die UNESCO die Situation als dramatisch und schätzte die Anzahl der Analphabeten weltweit im Jahr 1990 auf eine Milliarde, bei einer Weltbevölkerung von 5,3 Milliarden Menschen.
|25|Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erhielt die Alphabetisierung international ein deutliches Signal für das neue Jahrtausend durch die von den Vereinten Nationen ausgerufene Weltalphabetisierungsdekade für den Zeitraum 2003 bis 2012. Seit den 2000er-Jahren wird in zahlreichen Weltkonferenzen, Weltbildungsberichten und Deklarationen für dieses Anliegen gekämpft und geworben (Hinzen, 2021). Diese internationalen Diskussionen und Proklamationen, die maßgeblich von Organisationen wie den UN, der UNESCO und der OECD ausgehen, haben eine neue Dimension in der Theorie- und Praxisbildung eröffnet, die relativ unabhängig von nationalen Entwicklungen und Diskursen in Ländern des Nordens ist. Historisch gesehen lag der Fokus der Pädagogik und Erziehungswissenschaft in den letzten Jahrhunderten hauptsächlich auf nationaler Ebene, was ihren internationalen Erkenntniswert entsprechend begrenzte. Eine globale Perspektive (Lang-Wojtasik & Klemm, 2021) bringt daher auch Impulse für neue Entwicklungen einer eher national ausgerichteten Pädagogik und Erziehungswissenschaft mit sich. Diese globalen Perspektiven seit den 1940er-Jahren stehen im Zusammenhang mit einem weltweiten Demokratisierungs- und Entkolonialisierungsprozess und reflektieren eine pädagogisch geprägte postkoloniale Befreiungsbewegung (siehe Kasten zu Paulo Freire). Obwohl das Ausmaß und die Rahmenbedingungen für Analphabetismus in Ländern des globalen Südens und Nordens signifikant unterschiedlich sind, gibt es Gemeinsamkeiten bei den zugrunde liegenden Problemlagen (Schöfthaler, 1990).
Konzept
Paulo Freires Konzept der Alphabetisierung
Paulo Freire (1921–1997) war ein bedeutender brasilianischer Pädagoge. In den 1960er-Jahren entwickelte er ein Alphabetisierungsprogramm, das nicht nur Lesen und Schreiben vermitteln sollte, sondern auch der (politischen) Bewusstseinsbildung diente (Befreiungspädagogik). Zu diesem Zeitpunkt waren Analphabetinnen und Analphabeten in Brasilen nicht wahlberechtigt, sodass Alphabetisierung von hoher politischer Relevanz war und einen Beitrag zur Demokratisierung Brasiliens leisten sollte.