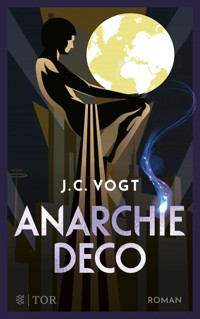
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Babylon Berlin mit Magie: ein historischer Fantasy-Roman aus der Weimarer Republik. Das Leben im Berlin der Zwanzigerjahre gleicht einem Tanz auf dem Vulkan. Zumal sich die Magie auf der Straße und im Nachtleben breitmacht. Eine Frau verschwindet und taucht wenig später als Steinstatue wieder auf. Nazis machen mit einem aus dem Nichts beschworenen Adler Jagd auf politische Gegner, und selbst das Varieté fügt den ohnehin schon abgefahrenen Nummern ein paar übernatürliche hinzu. Sogar der Reichstag berät über die Möglichkeit einer Wiederbewaffnung mit magischen Mitteln. Die junge Physikerin Nike Wehner arbeitet nicht nur wissenschaftlich daran, das neue Phänomen zu verstehen, sondern hilft auch der Berliner Polizei bei der Aufklärung magischer Verbrechen. Zur Seite stehen ihr der Bildhauer Sandor Černý und der kurz vor der Pension stehende Kommissar Seidel. Zusammen bilden sie die erste Spezialeinheit einer neuen Magiepolizei. Für Leser*innen von Neil Gaiman, Ben Aaronovitch, Volker Kutscher und Fans der "Phantastischen Tierwesen".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Ähnliche
J. C. Vogt
Anarchie Déco
Roman
FISCHER E-Books
Für Beate.
Dieses Buch wäre dein Ding gewesen.
Triggerwarnung
Mord, Verstümmelung, Sexismus (Alltags- & Universitätskontext), Referenz auf vergangene Abtreibung, antisemitischer Rassismus, Klassismus & Elendsviertel, Missbrauch und Gefangenschaft, PTSD, Militarismus, Nazis und Faschismus, Erdbeben, einstürzende Gebäude.
Prolog
Gott zaubert nicht!«, hatte Einstein gesagt. Das war der Grund, warum der angesehenste lebende Physiker heute nicht eingeladen worden war. Damit würde Einstein die erste mehr oder weniger öffentliche Demonstration einer Wechselwirkung verpassen, bei der man trotz aller Vorbehalte gegen diesen Ausdruck in der wissenschaftlichen Fachwelt leider nicht umhinkam, sie mit dem Wort »Magie« zu bezeichnen.
Nike atmete einmal tief durch und fuhr sich durchs frisch kurz geschnittene Haar. Das erhöhte ihre ohnehin schon kaum erträgliche Nervosität allerdings noch: Sie hatte mit dieser unbewussten Geste den Sitz ihres Scheitels ruiniert. Was, wenn sie jetzt eine Erscheinung bot, die man zwar männlichen Kollegen durchgehen lassen würde (schließlich war ein großer Geist mit Höherem beschäftigt als mit der Frisur), einer Frau aber keinesfalls?
Sie prüfte zum sicherlich zwölften oder dreizehnten Mal den Sitz ihres Laborkittels, dann legte sie endlich die Hand an den hölzernen Griff des Hebels. Nike hatte alles so gut vorbereitet wie möglich. Die Spannung war geprüft, die Kabel verlegt, die Feldgleichungen waren berechnet – so gut das unter diesen Umständen überhaupt möglich war. Sie hoffte, dass Alfons Mucha, der mit ihr dieses Experiment durchführen würde, ebenso gewissenhaft vorbereitet war. Er wirkte jedenfalls deutlich weniger nervös, geradezu lässig.
Künstler, dachte sie mit mehr Neid als Verdruss.
Zwar trug auch Mucha einen Kittel, der ihrem ähnelte, aber seine sonstige Erscheinung stand im krassen Kontrast zu der ihren: Der berühmte Jugendstilkünstler ging auf die siebzig zu, hatte dafür noch recht ansehnliches weißes Haupthaar, einen ebenso weißen Spitzbart, der zu seinem weißen Kittel passte, und trug eine kleine Brille. Er war mittlerweile etwas runder als auf den Fotos, die Nike von ihm kannte.
Sie beide, der Künstler und die Physikerin, standen an einem Ende des holzvertäfelten Seminarraums inmitten von Kabeln, Spulen und Staffeleien. Für den Laien musste diese Anordnung wie zufällig angesammelter Schrott auf einem Dachboden wirken – tatsächlich hatte das Chaos jedoch Methode. Nike hatte die Positionen der Apparaturen genau aufeinander abgestimmt.
Hinter dem Versuchsaufbau – in Nikes Rücken – befanden sich eine des Effekts wegen mit Formeln beschriebene Tafel und ein Pult, das ebenfalls mit elektrischen Gerätschaften vollgestellt war. Das Durcheinander wurde von zwei starken Scheinwerfern angestrahlt, wodurch sie sich in dem abgedunkelten Raum wie auf einer Theaterbühne vorkam. Sie musste gegen das Licht anblinzeln und schwitzte.
Hinter ihrer behelfsmäßigen Bühne, deren Geruch nach Holz und Kreide sie an die vertrauten Vorlesungssäle erinnerte, konnte Nike die Gesichter der Zuschauenden nur schemenhaft ausmachen. In diesem Raum versammelte sich beinahe alles, was auf der fünften Solvay-Konferenz im Jahr 1927 Rang und Namen hatte – nun ja, bis auf Einstein. Unter den etwa zwanzig Anwesenden befanden sich Namen wie Pauli und Schrödinger. Nike konnte im Gegenlicht den Glanz der Glatze und den Schnurrbart von Max Planck ausmachen, die glatt rasierten Gesichter von Nils Bohr und Werner Heisenberg, die sich flüsternd miteinander austauschten, das konzentrierte Gesicht der ganz in Schwarz gekleideten Marie Curie.
Nike suchte Curies Blick, vielleicht um ein aufmunterndes Nicken zu erhalten. Aber auch dort fand sie nur Skepsis. Was hatte sie auch erwartet? Das unverdiente Wohlwollen einer Wissenschaftlerin, die mit gleich zwei Nobelpreisen ausgezeichnet worden war, aus reiner weiblicher Solidarität heraus? Curie musste doch denken, dass Nike ihre Zeit mit abergläubischem Humbug stahl.
Worauf wartest du noch? Besser, du bringst es hinter dich, motivierte sich Nike. Das Thema der diesjährigen Solvay-Konferenz hieß »Elektronen und Photonen«, aber wenn wider Erwarten alles lief wie geplant, könnte die nächste Solvay-Konferenz das Thema »Magie« haben.
»Meine Dame, meine …«, setzte Nike an, aber dann versagte ihr die Stimme. Sie räusperte sich und versuchte es erneut. Das Murmeln im Raum dämpfte sich, verstummte aber nicht ganz, also sprach sie so laut und deutlich, wie es ihr möglich war, aber ihre Ansprache klang selbst in ihren Ohren abgehackt und auswendig gelernt. (Sie war auswendig gelernt.)
»Meine Dame, meine Herren, Anfang des Jahrhunderts haben zwei bahnbrechende Entdeckungen die Physik, die seit Newton Bestand hatte, in eine Zeit großer Unsicherheit gestürzt: die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik.«
Allseits Nicken. Planck nahm seine Brille ab und putzte sie mit wohldosierter Bescheidenheit. Nike mochte ihn nicht, sie hatte nicht vergessen, dass er Frauen, die sich auf geistigem Gebiet bewegten, als naturwidrige Amazonen bezeichnet hatte.
»Bereits diese beiden beschreiben Effekte, die im Alltag schlicht nicht erlebbar, aber deshalb nicht weniger real sind. Wenn wir ehrlich sind, haben sie, als wir uns das erste Mal damit beschäftigten, auf uns alle gewirkt wie … Wunder«, sagte Nike.
Sie atmete noch einmal durch, bevor sie sich dazu zwingen konnte, ihre gewagte Ankündigung abzugeben: »Das heutige Experiment wird sich nahtlos in diese beiden großen Entdeckungen einreihen, diese vielleicht sogar in den Schatten stellen! Denn das Phänomen, für das wir im Folgenden den Nachweis bringen wollen, wird unseren Alltag grundlegend verändern!«
Und wenn nicht, habe ich mich vor den größten Köpfen der Menschheit zum Affen gemacht, dachte Nike. Sie war angetreten, Newton herauszufordern, und natürlich würde sie sich bei einem Versagen der Lächerlichkeit preisgeben. Immerhin verstummte das Gemurmel: Endlich hatte sie die volle, äußerst skeptische Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft.
»Mein Dank gehört allen, die uns ihr Vertrauen geschenkt und dieses Experiment ermöglicht haben« – und die sich natürlich erst dann namentlich zu erkennen geben werden, wenn dieses Experiment glücken sollte, fügte Nike in Gedanken hinzu.
Nikes Blick fand unwillkürlich Bohr und Heisenberg, auf deren Einladung sie hier war. Eine einmalige Chance, besonders für eine junge Wissenschaftlerin. Wobei Heisenberg noch jünger war als sie und seit diesem Jahr bereits Professor in Leipzig sowie gefeierter Entdecker der Unschärferelation. Wenn sie selbst noch Karriere machen wollte, musste sich Nike sputen.
Sie hatte Bohr und Heisenberg während eines Besuchs bei der Berliner Professorin für Experimentelle Kernphysik, Lise Meitner, kennengelernt. Meitner hatte sie einander vorgestellt, und Nike war mit ihren Ideen auf Sympathie gestoßen. Trotzdem würden sich am Ende nicht die beiden Herren blamieren, wenn das hier schiefging.
Nike wusste, wie sie dachten: Die wissenschaftliche Reputation einer Frau war leichter aufs Spiel zu setzen als die eines Mannes. Eine Frau konnte schließlich beim Scheitern ihrer Karriere noch im schützenden Hafen der Ehe aufgefangen werden.
»Aber nicht nur die Wissenschaft ist beteiligt. Unerlässlich für das heutige Vorhaben ist mein geschätzter Kollege, der weltberühmte Maler Alfons Mucha aus Prag.«
Der Künstler deutete eine Verbeugung an, ließ sich aber immer noch nicht aus der Ruhe bringen. Immerhin hatte er es sich nicht nehmen lassen, selbst Hand anzulegen. Natürlich ruinierte ein Künstler auch nicht seinen Ruf durch Spinnereien: Spinnerei wurde schließlich geradezu von ihm erwartet.
»Was also haben wir heute vor?«, fuhr Nike fort. »Gerichtete Elektronen- sowie Röntgenstrahlen werden in präzise berechneten Trajektorien durch ein Gemälde strömen, um damit den Zustand der Wassermoleküle vor ihnen zu ändern«, sie deutete mit der freien Hand auf den inmitten der anderen Gerätschaften geradezu trivial wirkenden Wassereimer. »Laut der Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik ist die Natur auf der Ebene der Elementarteilchen selbst unbestimmt, unscharf, nicht determiniert, sondern der Herrschaft der Wahrscheinlichkeit unterworfen.« Diese Interpretation, die als Basis für ihren Vortrag diente, war erst in diesem Jahr von Bohr und Heisenberg formuliert und just auf dieser Konferenz noch diskutiert worden. Einstein beispielsweise hielt nichts davon. Der Disput zwischen Bohr und Einstein war zwar auf hohem argumentativem Niveau und stets auf der Sachebene verlaufen – was trotz aller angeblicher Objektivität auch unter Naturwissenschaftlern eine Seltenheit war –, dennoch stellte das wohl auch den Grund dar, aus dem Einstein zu dieser Vorführung nicht eingeladen worden war.
»Was ich Ihnen als Nächstes sage, scheint widersprüchlich, aber alle Indizien, die wir höchst methodisch gesammelt haben, deuten darauf hin, dass diese Wahrscheinlichkeiten gezielt manipuliert werden können. Dass Unwahrscheinliches geordnet und wahrscheinlich gemacht werden kann, und zwar durch das Einbeziehen von Symmetrie und … ästhetischen Gesichtspunkten.«
Ein kurzes, beinahe hysterisches Auflachen erklang im Publikum aus den hinteren Reihen, links gefolgt von einem »Pah!« und einem »Das kann nur von einer Frau kommen!« irgendwo im Zentrum.
Nikes Blick ging nach links. Eine stumme Frage an ihren berühmten Partner. Der rückte eine Skizze vor sich noch einmal zurecht, die den Rücken eines Mädchens zeigte, das in umschlungenen groben Tüchern ein Schauspiel beobachtete, das noch nicht abgebildet war. Nike wusste, dass es sich hierbei um eine Vorzeichnung zu Alfons Muchas aktueller Arbeit handelte, dem Slawischen Epos, das Mucha selbst als Höhepunkt seines Schaffen betrachtete. Sie mochte die Ruhe, die das Mädchen ausstrahlte, sonst sagte ihr das Bild in seiner unfertigen Form jedoch nicht viel. Das war nicht nötig: Die Kunst war Muchas Aufgabe, die Physik ihre.
Kunst und Wissenschaft – die beiden Grundpfeiler der neuen Disziplin, die sie hier demonstrieren wollten. Einer so unerlässlich wie der andere, so fremd sich diese beiden Pole auch schienen.
Sie legte den Hebel um. Das Licht der Bühnenstrahler flackerte, stabilisierte sich dann aber. Apparaturen sirrten. Eine Braunsche Kathodenstrahlröhre emittierte unsichtbare Elektronen, die durch von Spulen erzeugten Magnetfeldern auf vorberechneten Bahnen gen Staffelei geleitet wurden und dabei mit den Röntgenstrahlen aus der Röntgenröhre auf dem Pult wechselwirkten, um ein bestimmtes Streumuster zu erzeugen. Ein Effekt, für dessen Entdeckung der Amerikaner Arthur Holly Compton – wie gerade bekanntgegeben – in diesem Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden würde. Nike brachte ihn bereits zur Anwendung, aber sie bezweifelte, dass viele im Raum anerkennen würde, wie sehr sie sich damit am Puls von Zeit und Wissenschaft befand.
Mucha schien zwar etwas überrumpelt vom plötzlichen Beginn der Vorführung, ließ sich davon aber nicht irritieren. Er nahm Pinsel und Farbpalette zur Hand, nickte Nike zu und begann, sich in sein Bild zu versenken. Pinselstrich um Pinselstrich formte er die Gestalt des Mädchens aus, doch Nike riss ihren Blick los: Sie selbst musste am Steuerpult mit Drehreglern die Spannung angleichen, die an den Spulen und Kondensatoren anlag. Dieser Teil des Versuchs erforderte eher das intuitive Gespür der Experimentatorin als präzise Berechnungen; ein Gefühl für das Surren der Geräte, die Spannung in der Luft. Die Steuereinheit verlangte ihre ganze Aufmerksamkeit, so dass ihr die Reaktionen des Publikums verborgen blieben. Aber immerhin wurde sie nicht lauthals beschimpft.
Erst als der gewünschte Effekt eintrat, glaubte Nike endlich daran, dass das heute auch niemand tun würde.
Zunächst fing das Wasser im Eimer an zu dampfen.
Dann schien der Dampf von innen heraus bläulich zu leuchten.
Schließlich bewegten sich die Dampfschwaden zielgerichtet, während sie sich verdichteten: Sie nahmen die Form des Mädchens auf Muchas Gemälde an.
Das endlich entlockte dem Publikum einen Laut des Erstaunens. Dann noch einen, und während das Mädchen aus Dampf nun über dem Eimer schwebte und sogar unsichtbaren Bekannten zuwinkte, ging im ganzen Raum das Geschnatter los.
»Magie!«, kam als erste spontane Rückmeldung von hinten.
»Der künstlerische Geist erfasst die Schönheit der Natur«, sagte Heisenberg feierlich – vorher zurechtgelegte Worte, da war sich Nike sicher.
»Comment est-ce possible?«, fragte Marie Curie.
»Das muss ein Trick sein«, entgegnete Schrödinger, der mit seiner hageren Gestalt und der kleinen Brille wie ein verrückter Wissenschaftler aus einem Groschenheft wirkte.
»Jesus Christus, ist das der Gottesbeweis?«, murmelte Planck.
»Stimmt es, dass man sowohl einen Künstler als auch einen Naturwissenschaftler für diesen Hokuspokus braucht?«, fragte jemand.
»Ich gebe ja zu, dass es uns zunächst auch überrascht hat«, entgegnete Heisenberg, der sich nun als Urheber dieses Experiments zu erkennen gab. »Aber so scheint es zu sein! Genau genommen legen alle Versuche an den Universitäten in Prag, Kopenhagen und Berlin nahe, dass man sogar beiderlei Geschlecht für dieses Kunststück benötigt! Die duale Magie – ein Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft, Mann und Frau.«
Während die Diskussionen losgingen – von der Natur bisher unbekannter Kraftfelder über Experimente zur Verifizierung des Gesehenen bis hin zu philosophischen und religiösen Implikationen des Versuchs –, ignorierten die gelehrten Herrschaften Nike, die den Hebel auf seine alte Position klappte und damit das Surren zum Verstummen brachte. In der Mitte war der Dampf schlagartig resublimiert. Eine Statue eines Mädchens aus kristallklarem Eis saß da mitten im Raum und schien ihr eigenes Abbild auf Muchas Leinwand zu betrachten. Nike stiegen vor Stolz und Erleichterung Tränen in die Augen, doch sie war klug genug, sie wegzublinzeln.
1Marmortrunken
»Aber lieber Einstein, heute sagen Sie das Gegenteil von dem, was Sie beim letzten Treffen gesagt haben.«
»Was kann ich denn dafür, dass Gott die Welt anders gemacht hat, als ich vor einigen Wochen noch gemeint habe?«
Dialog zwischen Walther Nernst und Albert Einstein
Sie als Physikerin, erklären Sie mir das mal«, brummte Seidel, beugte sich ächzend hinunter und tippte vorsichtig mit seinem Finger auf das Schulterblatt der Figur. Es ist nur eine Figur, redete sich Nike ein. Eine makabre Sinnestäuschung – immerhin war es noch dunkel, da halfen auch die Scheinwerfer nicht, die zwei von Seidels Kollegen von der Eingangstreppe des Rohbaus aus auf die menschliche Gestalt richteten, die mit dem Gesicht nach unten im Fußboden zu ertrinken schien.
»Ab welcher Temperatur ändert denn Stein den Aggri…« Seidel kaute kurz auf dem Wort herum und fuhr dann fort: »Also, diesen Festigkeitszustand?«
»Genau weiß ich das leider nicht«, bemühte sich Nike um Professionalität. »Aber bei keiner Temperatur, die nachts in Berlin außerhalb eines Hochofens erreicht werden kann.«
Sie trat einen behutsamen Schritt vor, versuchte, die Vorstellung beiseitezuschieben, dass die Gestalt nach ihr packen und auch sie in eine unwägbare Tiefe ziehen würde. Ihre Fußspitze ertastete den Boden. Er schien fest. Steinern.
»Das ist entweder ein Scherz oder ein sehr lebensechtes Kunstwerk. Oder beides«, brachte sie hervor. Sie hatte schon Dinge gesehen, die unmöglich wirklich sein konnten und doch wirklich waren – aber das hier lag eindeutig jenseits von »eigentlich unmöglich, aber doch irgendwie erklärbar«.
»Dada«, murmelte Seidel. Sie wusste nicht, ob er die Kunstrichtung meinte oder sie auf etwas hinweisen wollte. Sein Finger drückte jedenfalls eine leichte Delle in das Sakko und den Körper darunter. Die Gestalt bestand nicht aus Stein.
Nike atmete knapp ein und aus und trat dann einen entschlossenen Schritt vor auf den weißen silbergeäderten Untergrund. Tau hatte sich darauf gesammelt, das Licht der Scheinwerfer spiegelte sich darin.
»Was für ein Material ist das?«, fragte sie, mehr zu sich selbst, und ging in etwa zwei Metern Abstand vor der Figur in die Hocke. »Marmor?«
»Ja, gehe ich von aus.« Auch der Kriminaloberkommissar stampfte einmal mit dem Fuß auf. Dumpf hallte der Tritt über die kirchenschiffartige Baustelle, die erstaunlich still dafür war, dass die Stadt angeblich niemals schlief.
Baustellen schlafen. Oder warten sie nur darauf, nächtliche Passanten zu verschlingen?
Nike musterte den Menschen, der dort mit Gesicht und Bauch nach unten auf dem … nein, im Fußboden lag. Er hatte die Arme nach vorn gestreckt. Auch seine Hände waren eingesunken, wenn auch nicht so tief wie der Unterkörper. Über den Beinen hatte sich der Marmor vollends geschlossen, über den Fingern und Händen jedoch eher so, als habe die Person tief in Brotteig gegriffen. Ein Spezialeffekt wie aus dem Kino. Nike schüttelte den Kopf, immer noch konnte sie das Gefühl einer Illusion, eines Traums nicht loswerden.
»Nehmen Sie die Dinge, wie sie sich Ihnen darstellen«, hatte Heisenberg gesagt. Mehr als diese Subjektivität blieb ihr nicht als Haltepunkt.
Subjektiv stellte sich ihr das Ganze wie folgt dar: In dieser Nacht war auf der abgesperrten Baustelle eines neuen Warenhauspalastes in Reinickendorf eine unidentifizierte Person im flüssigen Marmor versunken, der sich danach um sie herum verfestigt hatte. Sie war tot, das hatten die Schupos am Tatort bereits festgestellt, Gesicht und Brustkorb waren nicht mehr auszumachen.
Was Nike aus Rücken, Nacken und Hinterkopf schließen konnte, war, dass es sich vermutlich um einen Mann handelte, dunkler Wollmantel über Sakko und Hemd, keine Krawatte, unordentlicher Hemdskragen, schütteres Haar, aber keinesfalls kahl.
Er hatte seinen Hut verloren, Nike entdeckte ihn im Lichtkegel des Autos, das von der Straße in den Eingangsbereich der an sakrale Architektur erinnernden neuen Tietz-Warenhausfiliale leuchtete.
Sie rückte in der Hocke ein Stück näher und berührte mit zitternden Fingern den Nacken des Mannes. Er war weich und fleischig, nachgiebig. Eiskalt.
Verblüffend tot.
Tote gehörten bislang nicht zu Nikes Expertise – sie schrak davor zurück, von plötzlichem Ekel geschüttelt, stellten sich ihr die Nackenhaare auf, und sie wischte die Fingerspitzen an ihrem Mantel ab.
»Wir müssten ihn. Also, er muss da …« Sie sah Seidel hilflos an. Er war doch der Polizist! Was wusste sie schon, wie man diesen Mann jetzt zum Gerichtsmediziner bekam?
»Aber wie machen wir das denn wieder flüssig, oder müssen jetzt die Steinmetze kommen?«, führte der Kommissar ihren Gedanken aus.
Ihre Blicke trafen sich. Er wusste so gut wie sie, dass sie den Stein nicht verflüssigen konnte. Nicht als Physikerin. Und schon gar nicht als Schülerin des … neuen Tätigkeitsfeldes, das sie sich seit gut einem Jahr erschloss.
»Ich denke, die Steinmetze müssen kommen.«
»Ui-ui«, murmelte Seidel in den dämmernden Aprilmorgen von Reinickendorf. »Das wird teuer, Tietz hier den Marmor zu zerkloppen.«
»Falls Herr Tietz den Mann nicht zur Eröffnung als Deko behalten und mit einem Reklameaufsteller tarnen will, wird ihm wohl nichts anderes übrigbleiben, als zu dulden, dass wir diesen offensichtlich gefälschten Marmor entzweihauen und analysieren lassen. Und die Baustelle sperren, bis wir uns sicher sind, dass hier nicht die erstbeste Oma, die sich einen Mantel von der Stange kaufen will, im Boden versinkt. Herrgott, das werden die Bauherren doch wohl einsehen, hier ist ein Mensch gestorben!«
»Natürlich. Ich will nur nicht unbedingt der sein, der es ihnen erklärt«, brummte Seidel auf seine unverwechselbare Art, die Nike sofort klarmachte, dass er die unangenehme Aufgabe an sie delegieren würde. Und warum auch nicht? Technisch gesehen war sie die Expertin, und Seidel war ihr Chef.
Sie kannten einander noch nicht lange. Nike war erst vor wenigen Wochen von Professor Pfeiffer diese einzigartige Karrierechance ermöglicht worden – so hatte er es zumindest verpackt. Sie hatte nun schon ein gewisses Alter überschritten, und wenn sich ihr weiterhin die Gelegenheit zu einer Dissertation bieten solle, so der Professor, müsse sie diese Chance beim Schopfe packen und ein wenig Feldforschung auf ihrem … speziellen Gebiet betreiben.
Dabei war dieses ganze »Gebiet« ganz offensichtlich das Gegenteil einer einzigartigen Karrierechance. Seit der Solvay-Konferenz versuchte sie sich an Theorien und Experimenten, aber nichts davon machte auch nur entfernt den Anschein, dass es ihr zu einem Doktortitel verhelfen würde. Denn das, was Heisenberg so ehrfürchtig als »Magie« betitelt hatte, hatte zwar immer noch keinen besseren Namen, war jedoch vor allen Dingen ein Phänomen, das sie wieder auf eine geradezu mittelalterliche Erkenntnisstufe zurücksetzte. Ihr war es bislang nicht einmal ansatzweise gelungen, es in ein mathematisches oder naturwissenschaftliches Konzept zu fassen. Alles sah danach aus, als bewege sie sich mit rasender Geschwindigkeit auf ihre ganz persönliche Karrieresackgasse zu. Jedenfalls wollten sich weder Pfeiffer noch Heisenberg noch Bohr mit dieser Mittelalterlichkeit beschmutzen, also zogen sie es vor, Nike allein im Dunkeln tappen zu lassen.
Jetzt tappte Seidel also mit ihr zusammen im Dunkeln, doch im Gegensatz zu ihr war er als Polizist das Tappen gewohnt. Ihn konnte das nicht aus der Ruhe bringen. Sein Auftrag war herauszufinden, ob eine unwahrscheinliche Beobachtung, ein unrealistischer Unfall oder ein rätselhaftes Ereignis auf Drogenkonsum, Vandalismus oder eine profane Straftat zurückzuführen war – oder ob »Magie« dahinterstecken konnte. Denn obwohl die Experimente seit der Solvay-Konferenz kaum reproduzierbar waren, deutete alles darauf hin, dass die Büchse der Pandora geöffnet worden war.
Magie trieb in Berlin ihr Unwesen, und Pfeiffers Berliner Physikerkollegen von Weltrang wie Planck, Schrödinger, Meitner oder Nernst hielten sich bei diesem Thema bedeckt. Also hatten sie es vorgezogen, Nike an die Front zu schicken.
Seidel hatte das hintere Ende seiner eigenen beruflichen Sackgasse bereits fast erreicht: Er stand kurz vor der Pension und begegnete den neuen Unannehmlichkeiten mit dem Gleichmut desjenigen, dem alles immer auf die eine oder andere Weise lästig gewesen war, ob es sich nun um Kriminelle, Huren, Drogen, Mord oder Magie handelte. Bislang hatten sie es mit plötzlich reißenden Hausfundamenten zu tun gehabt, mit einem verschwundenen Schlussstein, der ein ganzes Gewölbe zum Einsturz gebracht hatte, und einer ganzen Menge Illusionen, von grünen Feen bis hin zu apokalyptischen Mahlströmen und babylonischer Sprachverwirrung.
Seidel bildete so etwas wie eine Einmannsonderkommission, der Nike als Hilfswissenschaftlerin zugeteilt worden war. Während ihre Aufgabe darin bestand herauszufinden, ob es bereits Leute gab, die die Phänomene absichtlich reproduzierten, hatte Seidel die Order des Polizeipräsidenten, die bislang unter dem Begriff »metaphysische Kriminalität« zusammengefassten Aktivitäten sofort zu melden, damit darüber entschieden werden konnte, wie politisch mit den neuen Phänomenen zu verfahren sei.
Bislang war ihnen allerdings kaum etwas untergekommen, das die Aufmerksamkeit des Polizeipräsidenten oder des Justizministers verdiente. Nun, ein in Marmor ertrunkener Toter mochte das ändern.
Nike ließ sich geschafft in den Stuhl fallen. Ein Anwalt des Tietz-Warenhaus-Imperiums war gerade erst abgerückt, nachdem er ein fruchtloses und entschieden zu langes Gespräch über das sogenannte Marmorereignis geführt hatte. Seidel war den größten Teil des Gesprächs hindurch nur körperlich anwesend gewesen, vornehmlich rauchend und ganz auf seine Formulare konzentriert. Und als ein Anruf aus der Gerichtsmedizin kam, war er allein hinuntergegangen.
Nike hasste die Gerichtsmedizin. Sie fand auch Seidels Büro entsetzlich, war es doch von einer eher verstörenden Altherrenmarotte gezeichnet: Kommissar Seidel mochte gern Gehäkeltes. Es umgab Nike einfach überall. Häkeldeckchen lagen auf den Aktenschränken. Häkelkissen auf dem Bürostuhl, auf den sie sich fallen ließ. Eine Häkeltasche umgab das Lederetui, in dem er seine Pfeifen aufbewahrte. Die Tabakdose. Eine gehäkelte Banderole umspannte den gottverdammten Aschenbecher. Gehäkeltes, das Jahre, vielleicht Jahrzehnte kalten Pfeifenrauchs in sich aufgesogen hatte. Nike wusste, wie schnell das ging: Sie roch selbst nach ihren Bürostunden ekelhaft nach Rauch.
Als Seidel aus der Gerichtsmedizin zurückkam, war der Tietz-Anwalt bereits verschwunden und hatte nur den schweren Duft seines Herrenparfums zurücklassen, der sich langsam mit dem Tabakgeruch verschränkte. Nike schloss kurz die Augen und versuchte, sich diese aufdringliche olfaktorische Mischung auf Molekülebene vorzustellen, doch dazu steckte nicht genug Chemikerin in ihr.
»Herrgott, Herr Kommissar, ich bin nicht einmal offiziell bei der Polizei, denken Sie wirklich, es ist angemessen, dass ich diese Art von Gespräch führen muss?«, sagte sie mit einem Blick auf die Armbanduhr. Seidel hatte sie um fünf Uhr in der Früh abgeholt, und jetzt war es beinahe halb zehn. Die Uni wartete.
»Fräulein Wehner, ich denke, es ist angemessen, dass eine Frau von ihrem Verstand sich eher mit diesen Sabbelköppen von Anwälten herumschlägt, statt sich Leichen ansehen zu gehen.« Man konnte Seidel unmöglich lange böse sein, nicht einmal Nike vermochte das. Der Kommissar – er war Anfang sechzig und besaß eine spiegelnde runde Glatze, auf der sich Sommersprossen und Leberflecken mischten und sich von dort über Nase und Wangen ergossen – hatte sich selbst als Großstadtpolizist das Lächeln und den Langmut eines Dorfschutzmanns bewahrt.
Er blinzelte über den Schreibtisch hinweg zu ihr hinüber und drückte die Zigarette aus, die er ausnahmsweise statt seiner Pfeife entzündet hatte. Den Stapel per Hand ausgefüllter Formulare legte er auf ein Spitzendeckchen an der Tischkante. Er hatte verschiedene Spitzendeckchen für verschiedene Ablagezwecke, und Nike war nicht entgangen, dass hinter der spießigen Schreibtischdekoration ein ausgeklügeltes System der Arbeitsplanung (und teils der Arbeitsvermeidung) steckte.
»Wenn Sie gleich gehen, bringen Sie die Sachen doch bitte bei einer von den Tippmamseln vorbei.« Angesichts ihrer sauertöpfischen Miene räusperte er sich und fügte hinzu: »Während Sie die … Vorgänge eben mit Ihrem Sachverstand erläutert haben, viel besser, als ich das könnte, habe ich mit Dr. Groszjansen über die Leiche geredet.«
»Ist sie schon aus dem Marmor befreit?«
»Nein, daran arbeiten sie noch. Aber Groszjansen war schon vor Ort. Es gibt bereits Fotos vom Gesicht, die wir uns angesehen haben. Und Groszjansen hat festgestellt, dass in die Nasenlöcher, in den Mundraum und vermutlich auch in die Lunge … na ja … Marmor geflossen ist.«
Er suchte so lange ihren Blick, bis sie ihm in die Augen sah. Sie wusste, dass sie Augenkontakt weitgehend vermied, und arbeitete daran, dies zu ändern.
»Identifikation steht noch aus, aber es gibt schon Gerede.«
»Kann ich mir denken.« Nike seufzte.
»Hundertprozentig konnte Groszjansen es nicht sagen, aber der Tote sieht aus wie … nun ja. Jemand aus der Politik. Wir haben also hier zweierlei Brisanz, Fräulein Wehner.«
»Zum einen ein vielleicht prominentes Opfer«, sagte Nike leise.
»Und zum anderen ein unerklärliches Phänomen.« Seidel erlaubte sich trotz der tragischen Umstände ein Lächeln.
»Sie meinen, dann sind wir für Ihre Kollegen in der Roten Burg nicht mehr die Ermittlungsgruppe ›Meisenheim‹?«, erwiderte Nike kühl. »Herzlichen Glückwunsch, Herr Kommissar. Ich freue mich dann, wenn die Albträume weg sind.«
»Manchmal frag ich mich, ob Sie besonders empfindsam sind oder besonders kaltschnäuzig.« Er zuckte mit den Achseln. »Vielleicht sorgt meine zweite Neuigkeit für ein wenig mehr Begeisterung. Groszjansen und Fuchs haben mir nahegelegt, das Momentum zu nutzen – so sagt man das doch in der Physik, oder? – und so schnell wie möglich bei Zörgiebel die Gelder für eine zweite Hilfsstelle zu beantragen. Während Sie mit dem Tietz-Anwalt beschäftigt waren, hab ich alles schon ausgefüllt und ’nen Schrieb aufgesetzt. Nehmen Sie Professor Pfeiffer doch gleich diesen Brief hier mit. Es ist zwar noch nichts niet- und nagelfest, aber vielleicht mag er sich schon nach jemandem umsehen, den Sie gebrauchen können.«
Nike stand langsam auf und nahm mit der einen Hand den Brief und mit der anderen die Formulare und Anträge. Sie nickte. »Ich komme heut Nachmittag wieder rein.«
Nike verließ den dunstigen Raum und atmete im Korridor, der nach Papier, altem Holz, noch mehr Zigaretten und nach dem Parfum des Tietz-Anwalts roch, einmal durch. Ein ungeklärtes Phänomen. Ein prominenter Toter. Ein neuer Partner. Langweilig würde es in der nächsten Zeit zumindest nicht werden.
»Die Welt besteht aus Gegensätzen. Licht und Schatten, Tag und Nacht, Liebe und Furcht, Stille und Musik, Frau und Mann, Yin und Yang. Natürlich können wir die Welt nicht begreifen, solange wir die Gegensätze nicht beherrschen. Entsprungen aus ›Art Nouveau‹ und ›Physique Moderne‹ ist durch Symmetrie und Symmetriebrechung zum ersten Mal der Funke einer neuen Zeit entstanden. Ein Funke dualer Magie – ein Leuchtfeuer ohne Quelle, eine Energie ohne Zufuhr, ein Trotzen gegen die Kräfte der Physik, ein neues Gesetz. Und das ist erst der Anfang!
Der Krieg, der alle Kriege beenden sollte, gehört der Vergangenheit an, und seitdem leben wir unser Leben intensiv wie nie zuvor. Die Gegensätze toben in einem wilden Tanz …«
Nike runzelte die Stirn und sah von dem eng bedruckten Faltblatt auf, das Erika ihr mit wildem Grinsen auf den Tisch geknallt hatte.
»Was für ein Mist ist das denn?«, fragte sie, und Erikas Lächeln wich einer geradezu maskenhaften Ruhe. Nike begriff, dass sie die Kommilitonin tödlich beleidigt hatte: Der Text stammte offenbar von ihr. Aber sie konnte die Worte nicht zurücknehmen – wie stets musste sie jetzt eben damit leben.
»Findest du, dass es Mist ist?«, fragte Erika betont neutral.
»Es ist mystisches Geschwurbel. Metaphysisches Blabla.« Nein, Nike war wirklich nicht gut darin, unbedacht Dahergesagtes abzumildern.
Um Erika nicht ins Gesicht sehen zu müssen, stand sie auf, drehte sich um und rief ins Auditorium: »Hallo, ich höre kaum etwas, kann das vielleicht hier einmal ohne Chaos ablaufen? Es heißt doch Hörsaal, also bitte …«
Füßescharren und Gelächter. Wie immer, wenn das Fräulein Wehner sich wieder nicht durchsetzen konnte. Nike war als Assistentin dafür zuständig, dass die Tafel für Professor Pfeiffer geputzt und der Raum zur Ruhe gebracht war. Die Tafel immerhin war sauber, und was den Lärm anging, na ja, sie tat eben, was sie konnte.
Erika, sechs Jahre jünger als Nike, weit weniger verbissen und dennoch mühelos so weit, dass sie als Hilfswissenschaftlerin mit an Nikes Projekten arbeitete, ließ ihren Blick kurz durch den Saal schweifen und gähnte dann wie eine Katze. Sofort hefteten sich einige begehrliche Blicke auf sie, Robert schob sich sogar durch die Bänke so nah an ihr vorbei, dass er ihr an einer kecken Locke ziehen konnte.
»Hey, Finger wech, ick bin verjeben!« Erika lachte und zwinkerte Nike dann zu. »Gestern hab ich noch die Hälfte von denen in der Stampe getroffen. Ich frag mich nur, warum ich so müde bin und die so viel Energie haben! Was sagt denn Nernsts Wärmesatz dazu?«
Nike konnte einfach nicht aus ihrer Haut: »In ihren Laboren werden sie dich niemals ernst nehmen, wenn du mit ihnen tanzt. Und wenn du solche Texte schreibst. Wofür ist das überhaupt?«
Erika lehnte sich über die Bank zu Nike herüber und versperrte damit Lenz den Weg, der sich durch den Gang zu seinem Platz neben Frentzen, diesem Gockel, durchdrängen wollte.
»Das ist für meine …« Erika senkte dramatisch die Stimme und blieb dennoch so laut, dass man es einfach hören musste. Ein Student mit kurz geschorenen Haaren spitzte denn auch für alle offensichtlich die Ohren. »… Bühnenshow. Varieté.« Und dann zwinkerte sie Lenz vielsagend zu, dem prompt die Röte ins Gesicht stieg.
»Du lässt echt keine Gelegenheit aus, dich lächerlich zu machen«, tadelte Nike die jüngere Studentin.
»Aber dass du immer in Anzug und Krawatte hier auftauchst, ist nicht lächerlich?«
»Ist mir doch egal, was diese Bengel von mir halten«, murmelte Nike.
»Seh ich genauso«, erwiderte Erika beinahe versöhnlich. »Und kommst du? Ist am Freitag in einer Woche.«
Nike schüttelte nur den Kopf und lehnte sich in ihrem Sitz zurück. Die Vorlesung musste jeden Moment beginnen, warum erlöste sie niemand vom Lärm ihrer Kommilitonen?
Sie atmete auf, als sich die schwere dunkle Tür im unteren Teil des Hörsaals endlich öffnete. Der Lärm verstummte schlagartig, als Professor Pfeiffer eintrat. Nike hielt sich bereit, um auf seinen Wink Formeln an die Tafel zu schreiben, und versuchte, alles andere zu verbannen: den Toten im Marmor, Erikas Sticheleien, die unbehagliche Wut auf sich selbst, um sich ganz der Physik zu widmen.
»Gibt es noch etwas, Fräulein Wehner?«, fragte Pfeiffer, als sie sich nach der zweiten Vorlesung des Tages noch immer im Hörsaal herumdrückte. Nike sah ertappt auf und griff dann in ihre Ledertasche, um den Brief herauszuholen.
»Ich habe einen Brief für Sie, Professor Pfeiffer. Von der Polizei.« Das klang selbst in ihren eigenen Ohren seltsam. »Es wurde eine weitere Hilfsstelle beantragt. Wenn die Gelder bewilligt werden, erbittet sich Herr Kommissar Seidel Ihre Expertise bei der Auswahl einer weiteren Person. Offenbar reichen meine Kompetenzen der Berliner Polizei nicht mehr aus.«
Sie legte ihm den Brief auf den Tisch.
»Darin also noch mal dasselbe in den Worten des Kommissars?«, fragte Pfeiffer, ohne den Brief zu öffnen, und Nike nickte.
»Was ist denn passiert, dass man Ihre Kompetenz in Zweifel zieht?«, fragte Pfeiffer. Er zog sich langsam den Mantel an, während Nike sprach.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber reden darf. Meine Position ist ja etwas … schwammig definiert. Wir haben jedenfalls wirklich eindeutige Hinweise, dass … unser neues Forschungsfeld für einen Unfall mit Todesfolge gesorgt hat. Oder für einen Mord.«
»Und nun?«
»Ich bin mir unsicher.«
»Haben Sie das Phänomen protokolliert?«
»Nun ja, die Polizei hat …«
»Fräulein Wehner«, unterbrach er sie und nahm erst seinen Hut, dann den Brief. »Sie wollen doch promoviert werden. Zeigen Sie ein wenig mehr Eigeninitiative. Enthusiasmus. Weniger Verkniffenheit. Mir kommt der Verdacht, Sie lassen sich da antriebslos herumschubsen wie eine Stenotypistin! Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wenn ich eine zweite Hilfskraft anfordere, wird das ein Mann sein, das wissen Sie.«
»Natürlich«, presste Nike durch die Zähne. Natürlich wusste sie das – die Experimente waren immer nur dann geglückt, wenn ein Mann und eine Frau sie zusammenwirkten, und das war zugleich Nikes Segen wie auch ihr Fluch. Es machte sie unersetzlich, schließlich war sie eine der wenigen diplomierten Physikerinnen, die bereits eine gewisse Erfahrung vorzuweisen hatten.
»Ich werde mich umhören und Ihnen wen Kompetentes an die Seite stellen. Aber wenn Sie sich nicht unterbuttern lassen wollen, sollten Sie vielleicht etwas energischer und zielbewusster auftreten.«
Sie nickte und schluckte ihre Wut herunter. Gleichzeitig fühlte sie sich, als müsse sie jeden Moment losheulen. Das wiederum ließ die Wut noch heller aufflammen. Pfeiffer schien das zu spüren. Er korrigierte den Sitz seines Hutes und lächelte sie noch einmal an. »Ich weiß, das hört niemand gern. Ich will Ihnen doch nur helfen. Sie haben bis zum Diplom länger gebraucht als die meisten ihrer männlichen Kommilitonen. Ich will ganz ehrlich sein: Ich hätte keine Anstellung als Doktorandin für Sie gehabt, wenn sich nicht dieser ungeahnte Forschungszweig aufgetan hätte und Professor Nernst ein gutes Wort für Sie eingelegt hätte. Wenn Sie nicht einmal ehrgeizig genug sind, diese Gelegenheit zu ergreifen, dann sind Sie vielleicht in der Physik falsch.«
Sie wollte etwas sagen, ihn an ihre exzellenten Diplomnoten erinnern, ihm entgegenschreien, was sie davon abgehalten hatte, im Vordiplom täglich zur Uni zu kommen. Aber sie tat nichts davon. Sie nickte einfach nur, flüsterte eine Verabschiedung und schlich davon.
Er nickte ebenfalls und rief ihr dann hinterher: »Um das Unmögliche zu verstehen, müssen Sie neugierig bleiben, Fräulein Wehner! Seien Sie etwas mutiger!«
Die Wut im Bauch hatte sich nicht aufgelöst. Nike hatte zu Mittag lediglich versucht, sie in drei hastig heruntergeschütteten Tassen Kaffee zu ertränken – Hunger hatte sie keinen. Es war nicht einmal so, dass ihr der Appetit vergangen war. Vielleicht wollte sie die Wut in ihrem Bauch einfach aushungern. Oder sie bestrafte sich selbst, Nike konnte es nicht sagen. Am frühen Nachmittag stand sie wieder in Seidels Häkelparadies, nervös von Kaffee und einem Morgen mit Leiche, aber ohne Frühstück.
»So, sehr gut, sehr gut, dass Sie da sind, Fräulein Wehner«, sagte der Kommissar und tupfte sich die Glatze mit einem gehäkelten Taschentuch. Nike ertappte sich bei der Vorstellung, dass er auch gehäkelte Unterhosen trug, was ihre Laune ein wenig hob.
»Der Tote wurde identifiziert. Das war … na ja, harte Arbeit da unten, und Zörgiebel, also der Polizeipräsident, war schon hier, um es sich anzugucken. Ich hatte sogar kurz die Gelegenheit, mit ihm über unsere personelle Besetzung zu sprechen. Er macht sich persönlich stark dafür, sagt er. Das wird noch Kreise ziehen, das sag ich Ihnen. Im positiven Sinne, aber sicher auch im negativen. Spätestens morgen wird die Presse Wind von der Sache bekommen, und dann stehen die hier auf der Matte. Passen Sie auf, dass sie sich nicht verplappern, es herrscht strenge Schweigepflicht.«
»Und um wen handelt es sich jetzt?«
»Paul Frölich.«
»Sagt mir nichts.«
»Mir erst auch nicht, aber er ist der Nachlassverwalter und Biograph von Rosa Luxemburg, das müssen Sie sich mal vorstellen! KPD-Politiker, vor kurzem in den Reichstag berufen. Jetzt braucht er wohl selbst einen Nachlassverwalter.« Er seufzte theatralisch, Nike setzte sich und fragte sich, ob er einen Kommentar von ihr erwartete. Was Politik anging, hielt sie sich bedeckt, auch wenn sie es bewunderte, dass jemand wie Einstein es immer wieder schaffte, so trittsicher für linke Politik und Moral einzutreten, obwohl er sich sonst in kosmischen Sphären aufzuhalten pflegte. »Das Problem ist: Der Mann hatte nicht nur Ärger mit den Regierungsparteien und den Rechten, sondern auch mit den eigenen Parteigenossen. Was den Kreis der Verdächtigen ziemlich ausweitet. Aber das übernehmen die Kollegen. Sie und ich, wir kümmern uns um die Frage, wer in dieser Stadt Marmor flüssig werden lassen kann und warum.«
»Und wo fangen wir an?«
»Das, Fräulein Wehner, muss ich mir noch überlegen.«
Nike erinnerte sich an den Nachmittag vor sieben Wochen, an dem sie Seidel, zusammen mit Professor Pfeiffer, mit Laborergebnissen und Versuchsaufbauten vertraut gemacht – oder es zumindest versucht hatte. Seidel hatte ein wenig staunend den Kopf gewiegt und wenig dazu gesagt. Genau genommen hatte er gar nichts dazu gesagt, und Nike hatte den Eindruck gewonnen, dass er nicht das geringste Interesse für die Physik oder die Ästhetik hinter den Phänomenen hatte.
Der Rat ihres Professors ging ihr durch den Kopf, seien Sie neugieriger. Mutiger. Und sie kam nicht umhin, ihm innerlich recht zu geben. »Ich möchte noch einmal hin, mir das Ganze ansehen. Kommen Sie mit?«
»Nein, ich habe hier noch zu tun, aber ich gebe Ihnen einen Wisch mit, ist ja alles abgesperrt. Haben Sie was Bestimmtes vor?«
»Ich möchte dort nach Kunst suchen«, sagte Nike. »Wissen Sie, alle magischen Experimente sind bislang immer nur in Verbindung mit Kunst geglückt, mit Pinselstrichen, Ornamentik. Wir haben das von der wissenschaftlichen Seite aus noch nicht ganz erfasst, aber ohne die Kunst und einen beteiligten Künstler oder eine Künstlerin sind die beobachteten Phänomene nicht umzusetzen.«
»Machen Sie das. Soll ich Ihnen einen Fotografen mitgeben?«
»Keine schlechte Idee.«
»Gennat hat auch alles dokumentieren und fotografieren lassen, heute Morgen schon. Aber Sie haben ein anderes Auge dafür.«
»Na, hoffen wir, dass ich Kunst erkenne, wenn ich sie sehe«, bemerkte Nike trocken.
»Was sagt denn Ihr Herr Professor? Kriegen wir auch einen magischen Künstler?«
»Ich denke schon, wenn Sie das Geld organisieren, organisiert er den Künstler.«
»Hervorragend, hervorragend. Aber noch etwas, Fräulein Wehner: Wir haben eine Vermisstenmeldung«, fuhr er fort. »Drüben in Prenzlberg wird eine Frau vermisst. Vermieterin von so einem abgeranzten Arbeiternest.«
»Warum kriegen wir eine Vermisstenmeldung?«
»Die Kollegen haben mir den Bericht auf den Tisch gelegt, weil: Einer ihrer Mieter hat behauptet, er hätte sie wie versteinert hinten auf ’nem Fuhrwerk sitzen sehen. Also. Im Sinne von … Er sagt, sie sei nicht ansprechbar gewesen. Und … hart. Wie aus Stein.«
»Bitte was? Kann man sie sich irgendwo anschauen?«
»Nee. Der Karren ist natürlich weg, genau wie die Frau. Klingt für mich wie eine dieser Suffgeschichten. Aber verschwunden ist die Frau trotzdem, Frau Glose heißt sie, hier ist ein Foto von ihr.«
Nike beugte sich über das Bild, das Seidel über den Tisch schob. Darauf war eine robuste ältere Frau im Kreise einiger Familienmitglieder zu sehen, die Haare hochgesteckt und das Gesicht grimmig. Nike versuchte, die Familie in Beziehung zueinander zu setzen. Zusammen mit Frau Glose posierte dort ein Ehepaar, er auf einem Stuhl mit nur einem Unterschenkel – kriegsversehrt, vermutete Nike –, sie daneben, vor ihnen standen zwei Kinder, und auf dem gesunden Bein saß ein weiteres. Eine ältere Frau stand zwischen der Ehefrau und Frau Glose.
»Ledig?«, fragte Nike.
»Witwe. Das da war ihre Schwester. Das Foto ist neun Jahre alt, Schwester und Schwager sind tot, Spanische Grippe. Was aus den Kindern geworden ist, weiß ich nicht, bei ihr haben sie jedenfalls nicht gelebt, sie war allein. Ihr Mann ist neunzehn-siebzehn gefallen.« Auch Seidel war Veteran, und wie immer wurde seine Stimme ganz klar und sachlich, wenn die Sprache auf den Krieg kam.
»Ich kann ja mal die Ohren aufhalten, ob jemand Vermieterinnen versteinert.«
»Wäre so was rein theoretisch denkbar?«, horchte Seidel vorsichtig nach. »Ich meine, wenn jemand Marmor verflüssigen kann, dann kann er vielleicht auch Menschen in Stein verwandeln.«
»Gestern hätte ich noch gesagt, nein. Aber heute? Ich habe keine Ahnung.«
Seidel sah sie nachdenklich an, runzelte dann die Stirn und kritzelte etwas nahezu Unleserliches auf ein Formular, auf das er auch noch Unterschrift und Stempel setzte. Sie hörte seinen Füller kratzen, während ihre Augen den kurzen, kleinen Linien der Handschrift folgten.
Dass es unter Laborbedingungen eventuell möglich war, Dinge und Menschen zu verwandeln, stellte ein Rätsel, eine intellektuelle Herausforderung dar. Dass da draußen Leute schon ganz anderes mit diesen neuen Erkenntnissen anstellten, war rundheraus besorgniserregend.
Eine halbe Stunde später stieg sie zusammen mit einem jungen Kommissar vor der Baustelle aus dem Auto. Sie half ihm bei seinen sperrigen Taschen und verharrte kurz mit einem Stativ in der Hand am Kofferraum des Wagens. Sie hatten bis in die abgesperrte Zone vorfahren dürfen, mehrere Schupos waren vor Ort und hielten Schaulustige im Zaum. Auch ein paar Jungs von der Presse belagerten die Baustelle und stellten bereits erstaunlich treffsichere Fragen.
»Hey, entschuldigen Sie mal, hey, Meister«, rief ein rothaariger Kerl mit auffallend gepflegten Haaren zu ihr herüber. Sie wandte sich um, und er korrigierte sich: »Ah, junges Frollein meinte ich natürlich. Kann ich Sie kurz was fragen?«
»Nee«, erwiderte sie. »Und det wissense och.«
»Ist hier jemand von der KPD getötet worden? Mit flüssigem Beton? Ist das richtig?« Nike wandte sich ab. »Wartense, ist es jemand aus dem Reichstag? Wer ist der Tote?«
Sie folgte Martens, dem Polizeifotografen, die Stufen hinauf in den Rohbau. Alle vier Stockwerken waren bereits fertiggestellt, mit pseudosakralen, gen Himmel strebenden Fenstern.
»Ab wann ist etwas Kunst?«, flüsterte sie und überlegte, ob es einen Unterschied zu den anderen Warenhäusern gab, die sie kannte. Die ältesten waren knapp vor dem Krieg entstanden, und sie hatte sich immer schon gefragt, was der Witz daran war, sie so prunkvoll wie Paläste oder so himmelstrebend wie Kirchen aussehen zu lassen – nur damit die Massen hineintrampelten und Kleider von der Stange kauften. Nike gehörte natürlich ebenfalls zu den Massen, aber nur ab und zu – auch ihre Hosen, Hemden und Jacken hatten unter den hohen Decken eines dieser modernen Kathedralen auf ihre Aufmerksamkeit und ihr Geld gewartet.
»Hamse was gesagt?«, fragte Martens. Das Foyer des Warenhauses war verlassen – Licht strömte durch die noch unverglasten Fenster und den Lichtschacht in der Mitte, der wohl einmal eine gläserne Decke werden sollte. Wie ein Kristall, der aus dem obersten Stockwerk hervorragte.
Sie wollte schon abwinken, aber dann siegte ihr Ehrgeiz: Sie würde nicht sonderlich weit damit kommen, wenn sie alles für sich behielt. »Ich habe mich gefragt, ob so was schon Kunst ist«, sagte sie und erntete erwartungsgemäß nur ein Schulterzucken. Sie ließ ihren Blick schweifen. Möglichst neugierig und ohne darüber nachzudenken, ob der Marmor erneut flüssig werden würde, diesmal unter ihren Füßen.
Nein, sie war bei genügend Experimenten dabei gewesen. Sie würde bemerken, wenn jemand mit dieser Art Energie spielen würde.
Das Loch im Marmorboden befand sich nicht genau in der Mitte des Foyers, sondern im Lichthof. Sie näherte sich vorsichtig, sah hinunter – es war gar nicht so tief, man konnte nur liegend darin ertrinken – und wieder hinauf in den Lichtschacht. Martens tat es ihr gleich, richtete seine Kamera aus und schoss ein Bild vom Stahlgerüst der unregelmäßigen Kuppel.
»Ob das Kunst ist, da fragen Sie mich was«, murmelte er dann. »Ist dann auch eine Fotografie davon Kunst?«
»Was definiert das denn? Also, Ihrer Meinung nach?«
Er machte eine kurze Pause und sah sich suchend um, als warte er auf den Text eines Souffleurs. Nervös leckte er sich über die Lippen. »Meine Meinung: Kunst ist etwas, das eine eigene Realität erschafft. Eine Welt neben der Welt. Und in der Welt. Aber etwas anderes als das Reale.«
»Und das kann auch eine Fotografie sein?«
»Eine Fotografie ist doch das Gegenteil, würde ich sagen. Zumindest meine Sorte, sonst hätte ich wohl den falschen Beruf. Aber … wie heißt er? Moholy-Nagy zum Beispiel, der würde aus einem Foto von diesem Rohbauschacht auch Kunst machen.«
»Sagt mir nichts«, bekannte Nike.
»Bauhaus«, sagte Martens, und sie nickte. Das war ja klar. Sie hatte sich nach den ersten Ergebnissen mit verschiedensten Kunstrichtungen zumindest theoretisch vertraut gemacht, aber fürs Bauhaus fehlte ihr offenbar das ästhetische Empfinden.
»Hat das hier irgendwas mit Bauhaus zu tun?« Sie wies nach oben.
»Nee, auf keinen Fall. Hab nicht allzu viel Ahnung davon, aber das hier ist nur ein Warenhaus.«
»Ein Warenhaus, das jemanden getötet hat.«
Martens schüttelte den Kopf. »Seltsam, nicht wahr? Was soll ich Ihnen denn fotografieren?«
Nike sah sich um. Zwei breite Treppen führten in den ersten Stock, dazwischen gähnte der noch leere Schacht eines Aufzugs.
»Vielleicht gehen wir einmal hoch, und Sie knipsen von jeder Empore einmal in den Lichthof«, schlug sie vor.
»Stimmt es, dass Sie Physikerin sind?«, fragte der Fotograf vorsichtig, als sie auf der ersten Etage ankamen. Er war selbst etwa in ihrem Alter, um die dreißig, gesetzt und gemütlich.
»Ich bin Doktorandin und außerdem fünfzig Prozent von Seidels Ermittlungsgruppe.«
»Die nach … Phänomenen sucht, die was mit der Universität und irgendwelchen Atomexperimenten zu tun haben?«
»So in etwa«, knurrte sie und wies, auf der Empore angekommen, die einmal um den Lichthof herumlief, hinab. »Knipsen Sie das mal, bitte.«
»Und das hier hat was damit zu tun?«
»Sie wissen, dass ich keine Vermutungen anstellen darf. Ich bin nur wissenschaftliche Beraterin.«
Er schoss ein Foto. »Klar«, sagte er dann. »Hoffe nur, das ist nicht gesundheitsgefährdend, was da an der Friedrich-Wilhelms gemacht wird. Hab Frau und Kinder.«
Nike musterte die Kuppel noch einmal. Das Verblüffendste daran war die Unregelmäßigkeit, wie gläserne Splitter, die aus dem Dach staken. Wann ist etwas Kunst?
»Es gibt da doch so ein Wort, oder? Für so was da, Glas und Stahl.«
Sie schlenderten in den zweiten Stock, Durchgänge in dunkle Hallen gähnten um die Empore herum, nur der Lichtschacht war hell erleuchtet. Ein verlassener, geisterhafter Tempel.
»Etwas mit Alpen. Alpin? Alpine Architektur?« Nike war Auswendiglernen immer leichtgefallen, die wichtigsten Begriffe der Kunststile der jüngeren Zeit hatte sie sich einfach eingeprägt, ohne wirklich etwas damit zu verbinden.
»Nie von gehört«, befand Martens.
»Hm, ist auch egal.« Sie lehnte sich sehr vorsichtig an die Betonbrüstung der Galerie. Unter ihr gähnende Leere. Über ihr die kristallene alpine Konstruktion.
Etwas knirschte unter ihrem Schuh, und die Vorstellung, dass das Geländer bröckelte und sie auf den Marmor herabstürzen würde, ließ ihr einen Schreck wie einen Stromschlag durch die Glieder fahren. Sie wich hastig einen Schritt zurück, und Martens sah sie alarmiert an.
»Das könnten Sie knipsen«, sagte sie und wies auf eine geschwärzte Stelle an der Brüstung. »Und danach sollten wir diese Scherben aufheben und mit aufs Präsidium nehmen.« Ihr Herz klopfte immer noch, aber sie ging in die Knie und nahm die kleinen Scherben in Augenschein. Das Glas war beschichtet, wie bei einer Glühbirne. Während Martens fotografierte, folgte sie der Empore einmal herum und sah immer wieder vorsichtig herab.
Ist er heruntergefallen, in den Marmor? Oder unten gestolpert? War das sein eigenes Experiment, oder hat er zufällig eins gestört?
»Machen Sie bitte mehrere Bilder, einmal rundherum«, forderte sie Martens auf und holte ein Taschentuch aus der Tasche, mit dem sie weitere Scherben auflas. Diese hier waren eindeutig Spiegelscherben. Mit dem Taschentuch nahm sie eine und richtete sie auf ein paar nachmittägliche Lichtstrahlen aus, die durch die Kuppel fielen. Der gespiegelte Lichtstrahl verlor sich irgendwo im dunkel atmenden Kaufhaus.
»Vielleicht hab ich da was«, rief Martens. »Kommense mal rüber.«
Sie beeilte sich. Er wies auf den Boden. »Sehen Sie das?« Sie sah es nicht, er schnalzte ungeduldig mit der Zunge. »Hier ist was hingeschleift worden. Was Schweres.« Er deutete darauf und ging weiter um den Lichthof herum. »Hier auch. Und da drüben.« Nun sah Nike, was er meinte: Kleine Steinfragmente waren abgesplittert, der noch schmucklose Boden hatte ein paar Kratzer davongetragen. Unregelmäßigkeiten, im schlechten Licht kaum sichtbar.
»Fotografieren Sie das bitte, so gut es geht. Und dann sind wir hier, glaube ich, fertig.«
2Kirschen und Erdbeeren
Es liegt eine Leiche im Landwehrkanal,
lang, lang ist’s her, drum stinkt sie auch so sehr.
Sie ist schon ganz glitschig, sie ist schon ganz schwer,
lang se mir ma rüba, aba drück ihr nich zu sehr!
Lang se mir ma her zum Dessert!
»Die Leiche im Landwehrkanal«
Herr Černý?« Eine Stimme riss Sandor aus dem Dämmerschlaf, in den er im unbequemen Holzstuhl versunken war. Was für eine Ironie – da buchte man ihm einen Nachtzug von Prag nach Berlin, und er brachte es zustande, im Bett des Abteils kein Auge zuzutun, aber hier, im zugigen Vorraum zum Büro des Professors, nickte er sofort ein. Er raffte seine Gedanken zusammen und sah, dass ihm das Schreiben von Mucha aus der Hand gefallen war. Es lag halb auf seinem schwarzen Lederschuh und halb auf dem gewachsten Boden. Er nahm es und stand dann auf, fuhr sich noch einmal rasch durchs Haar und schüttelte dem hageren Mann Mitte fünfzig die Hand, der aus dem Büro ins Vorzimmer getreten war.
»Der bin ich, ja«, sagte er und fragte sich, ob man ihn gut verstehen konnte. Er sprach passables Deutsch, zumindest glaubte er das, aber was er in Berlin bislang aufgeschnappt hatte, klang doch ein wenig anders als das, was er vor allem durch sein deutsches Kindermädchen in Prag gelernt hatte.
»Ich bin Siegfried Pfeiffer, Dozent für Angewandte Physik.«
»Danke, dass ich hier sein kann«, sagte Sandor, und diese kleine, spottende Stimme in seinem Kopf sagte: Danke, dass ich nicht verhaftet wurde.
»Na, wenn wir schon die Gelegenheit haben, mit den Kollegen von der Prager Universität zusammenzuarbeiten, dann sage ich doch nicht nein. Alfons Mucha schätze sogar ich Kunstbanause.«
Er führte ihn mit einer Hand auf der Schulter ins Büro, das sein Kunstbanausentum noch einmal nachdrücklich unterstrich. Das nüchterne Bauhaus-Mobiliar konkurrierte mit den Jagdtrophäen an den Wänden um Aufmerksamkeit. Ein Tigerkopf über den Fenstern hinter dem Schreibtisch war die Krönung, er brüllte die stuckverzierte Decke an. Aber auch rehähnliche Tiere, die Sandor nicht zuordnen konnte, blickten links und rechts aus der Tapete, als steckten sie dahinter in der Wand fest. Das neutrale Lächeln gefror zu einer Maske. Ein bisschen geltungssüchtig sind wir aber schon, nicht wahr, Herr Professor?, spottete die Kopfstimme, die immer ein wenig nach seinem Prager Freund Jiří klang.
Professor Pfeiffer wies auf einen hellgrauen Sessel mit niedriger Lehne vor dem schlichten Schreibtisch. »Nehmen Sie Platz, bitte, Kaffee kommt gleich.«
»Tee, wenn Sie haben«, sagte Sandor, doch der Professor schüttelte den Kopf.
»Leider keine Auswahl, das wird mir hier nur alt. Wir Akademiker brauchen das starke Zeug.«
Sandor nickte ebenso neutral, wie er lächelte.
»Nun, ich freue mich, dass Sie so schnell kommen konnten.«
»Mein Empfehlungsschreiben«, sagte Sandor und legte es dem Professor auf den aufgeräumten Tisch. Der öffnete es nicht, begutachtete aber die Handschrift.
»Alfons Mucha.« Er lachte. »Die Schrift kennt man ja. Selbst auf seinen Werbeplakaten war seine Unterschrift.«
»Natürlich«, sagte Sandor einfach und konnte nicht recht einordnen, was der Professor von dem Mann hielt, der wie kaum ein anderer die bildende Kunst der Jahrhundertwende geprägt hatte.
»Und Sie? Auch Maler?«
»Bildhauer.« Und Steinewerfer, ergänzte die Jiří-Stimme nicht ohne Stolz.
»Ach. Nett«, sagte der Professor und lächelte schmal. »Also, ich denke, wir haben die physikalische Grundlage mittlerweile ausgearbeitet, erste gute Ergebnisse wurden ja bereits erzielt, sowohl hier als auch in Paris, Kopenhagen und Prag. Wir haben zwei Physikerinnen, die sich in ihrer Diplomarbeit beziehungsweise ihrer Dissertation damit befassen. Woran es uns mangelt, ist die Kunst, Herr Černý. Nicht dass die in Berlin gerade Mangelware wäre, aber Sie wissen ja vermutlich, dass ebenso wie in der Physik auch gewisse … Qualifikationen und Vorkenntnisse in der Kunst vonnöten sind, und bisher hält die Kunsthochschule wenig von unseren Experimenten. Es freut mich, dass Herr Mucha Sie als qualifiziert einschätzt.«
»Ja. Mich auch. Ich wollte sehr gern hierherkommen. Ich bin neugierig auf Berlin.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte der Professor und sah dabei rasch von den eigenen langen Fingern auf, die er gemustert hatte. Ein zweifelnder, strenger Blick.
»Und die … die Wissenschaftlerinnen, die daran arbeiten, das sind Frauen?«, fragte Sandor linkisch.
»Ja«, sagte der Professor und öffnete nun doch den Brief. »Ihre Partnerin sollte jeden Moment hier eintreffen.«
»Wegen der … der Dualität?« Damit zeigte er zumindest einen Hauch von jener Qualifikation, von der Pfeiffer gesprochen hatte. Er hatte schon gehört, dass an keiner Universität so viele Frauen studierten wie an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, aber er hatte erwartet, sie eher an der Philosophischen Fakultät anzutreffen.
Mit dem Blick auf dem Papierbogen murmelte der Professor: »Exakt. Wenn Sie ein Mann sind, Herr Černý, was mich unsere bisherige Begegnung nun mal vermuten lässt, dann muss Ihre Partnerin ja eine Frau sein. Und außerdem, das sage ich Ihnen ganz ehrlich: Für Sie als Künstler mag die Faszination überwiegen. Aber ich bin als Physikprofessor in einem Zwiespalt, Herr Černý. Die Ergebnisse, die wir haben, sind revolutionär, aber bislang … na ja. Einstein hat sie als Unfug bezeichnet. Er ignoriert alles, was damit zu tun hat. Es liegen scheinbar keine Gesetzmäßigkeiten zugrunde, und momentan könnten wir es gut und gerne mit zufälligen Phänomenen zu tun haben, die einen ganz anderen Ursprung haben, als Heisenberg vermutet. Aber egal, was es ist, es hat begonnen, um sich zu greifen und den wissenschaftlichen Kontext zu verlassen. Fräulein Wehner, meine Doktorandin, arbeitet bereits mit der Polizei zusammen. Eine einmalige Chance für jemanden wie sie.«
»Mit … der Polizei? Ich arbeite dann auch mit der Polizei?« Das hatte er nicht gewusst. Das neutrale Lächeln rutschte ihm beinahe vom Gesicht.
»Genau so ist es. Die waren es, die Sie gewissermaßen beantragt haben, Herr Černý.«
Sandor nickte und wusste nicht, was er davon halten sollte. Da klopfte es an der Tür, und ohne dass der Professor etwas erwiderte, öffnete sie sich. Eine Frau um die dreißig stand darin und balancierte ein Tablett mit Kaffeetassen. Mit fest aufeinandergepressten Lippen kam sie über den dunklen Läufer auf den Schreibtisch zu und stellte das Tablett ab. Auch ein Milchkännchen und eine Zuckerdose mit Zange befanden sich darauf, um das Kännchen herum hatte sich bereits ein kleiner weißer See ausgebreitet.
»Fräulein Wehner«, sagte der Professor und lächelte. »Haben Sie etwa Kaffee mitgebracht?«
»Frau Steinert hat mir das Tablett in die Hand gedrückt«, sagte die Frau verschnupft und setzte sich, ohne einzuschenken, in den zweiten Sessel neben Sandor. Ihm wurde klar, dass es sich nicht um die Sekretärin des Professors handelte, sondern um die angekündigte Doktorandin. Sandor musterte sie aufmerksam. Sie trug einen dunkelgrauen Anzug mit Hemd und Krawatte. Die schwarzen Haare waren kurz geschnitten. Sie erwiderte seinen Blick streng aus dunklen Augen.
Er nickte ihr höflich zu.
»Fräulein Wehner, das ist Herr Černý aus Prag. Herr Černý, Nike Wehner«, stellte der Professor sie vor. »Sie ist nicht nur eine Physikerin, was sie zu so etwas wie einem seltenen Geschöpf macht, sie ist auch die erste Halbägypterin hier an der Friedrich-Wilhelms.« Er zwinkerte, und Nikes Nasenlöcher weiteten sich als einzige Reaktion. »Was sie natürlich für diese Art Arbeit geradezu prädestiniert. Sie wissen ja sicherlich, dass Kulturwissenschaftler und Historiker einen Blick oder zwei auf die alten Mysterienkulte werfen, um der Verbindung von Kunst und Physik auf die Spur zu kommen. Wird in Prag nicht in diesem Zusammenhang auch die sogenannte Alchemie ganz neu bewertet und noch einmal kritisch aufgerollt?«
»Ich muss gestehen, dass ich den Zusammenhang zwischen Ihrem … Betätigungsfeld und meinem noch nicht ganz durchdrungen habe«, gab Sandor zu. »Mein Interesse lag bislang … auf anderen Gebieten.« Und das war noch eine Untertreibung. Tatsache war, dass ihn Muchas Flirt mit der Physik bislang mehr als kaltgelassen hatte. Letztlich war alles sehr schnell gegangen: Sein Bruder hatte ihn nach einer aus dem Ruder gelaufenen Demonstration von der Polizeiwache abgeholt und gesagt, er habe als Alumnus genug Geld an die Kunsthochschule springen lassen, dass diese eingewilligt hatten, ihren Problemschüler eine Weile ins Ausland zu schicken. Daraufhin hatte Mucha ihn zwischen Tür und Angel verabschiedet und ihm gesagt, man werde ihm in Berlin alles genauer erläutern. Jetzt schien es allerdings, als setzte Pfeiffer voraus, dass er bereits über alles informiert war. Tatsächlich lächelte der Professor schmal und nickte seiner Studentin zu. »Fräulein Wehner, wären Sie so nett, Herrn Černý einen kurzen Überblick zu verschaffen?«
Wehner zog die Mundwinkel nach oben, eher eine Muskelbewegung als ein Lächeln. Dann begann sie wie auswendig gelernt: »Der Zusammenhang zwischen Kunst und Wissenschaft, ja, natürlich. Also: Selbst eine physikalische Theorie wird oft nach ihrer Schönheit bewertet, nach den Symmetrien, die sie ausnutzt, nach ihrer Natürlichkeit. Und die Sprache, in der diese Poesie niedergeschrieben ist, ist die Mathematik. Das heißt nicht, dass alle Theorien schön sind. So war Maxwell mit seinen Gleichungen zur Elektrodynamik aus ästhetischen Gesichtspunkten nicht zufrieden. Einige schöne Theorien haben sich auch schlicht als falsch herausgestellt, wie die Wirbeltheorie. Aber im Großen und Ganzen kommt man mit dem Streben nach Schönheit weiter, als gemeinhin angenommen wird. Jetzt stellen Sie sich vor, dass nicht nur die mathematische Beschreibung von Schönheit profitieren würde, sondern die Physik selbst. Warum empfinden wir Strukturen, wie sie die Natur hervorbringt – Blumen, Schneeflocken, ein nächtlicher Sternenhimmel –, als schön? Prägen die Naturgesetze nur unser Empfinden von Ästhetik, oder ist auch der umgekehrte Weg möglich: Können wir mit von uns geschaffener Schönheit – Kunst – Einfluss auf die Naturgesetze ausüben? In der Zusammenarbeit von Herrn Mucha und Professor Heisenberg hat sich zum ersten Mal herausgestellt: offenbar ja. Wie Sie zweifellos wissen, liegt Herrn Muchas Schwerpunkt dabei auf dem geschichtlichen Aspekt: Runen, Alchemie, Kabbala. Und doch stellt sich heraus, dass wir gerade mit zeitgenössischer Kunst weiterkommen. Mit Stilrichtungen, die sich aus Jugendstil und Impressionismus entwickelt haben. Was vielleicht nicht am Stil selbst liegt, sondern an unserem zeitgenössischen Ästhetikempfinden. Wir tappen da noch ziemlich im Dunkeln. Da kommen Sie dann ins Spiel.«
Sandor machte ein unbestimmtes Geräusch, von dem er hoffte, dass es sich als Zustimmung deuten ließ. Er wusste nicht, was er von all dem hielt. Sollte seine Kunst geeignet sein, Naturgesetze aus den Angeln zu heben? Das erschien ihm doch eher lachhaft.
Für Wehner schien er ein offenes Buch zu sein. Sie wandte sich an ihren Professor und sagte, als sei Sandor nicht im Raum: »Ich glaube, Sie sollten Ihr Verhältnis zu Professor Heisenberg noch einmal überdenken, Herr Professor. Es sieht mir offen gestanden nicht so aus, als habe er die Prager Uni bewegen können, auf eine ihrer künstlerischen Koryphäen zu verzichten.«
Sandor brauchte einige Sekunden, um sich sicher zu sein, dass er beleidigt worden war. Erbost wandte er sich ebenfalls an Pfeiffer. »Ich bitte um Vergebung, dass mir die … die wissenschaftliche Theorie noch fremd ist, ich habe außerdem zu wenig geschlafen und …«
»Nur die Ruhe, Černý«, sagte der Professor und lächelte. »Fräulein Wehner nimmt sich selbst etwas wichtiger als alle anderen um sie herum, daran gewöhnen Sie sich noch.«
Wehners Nasenflügel bebten.
»Was sie eben paraphrasiert hat, war übrigens mehr oder weniger die Einleitung ihrer Dissertationsschrift – und unsere Versuche hier sind beileibe noch nicht so weit gediehen, wie es vielleicht den Anschein hat. So oder so werden Sie beide zusammen mit Grundlagenstudien beginnen.«
»Darf ich kurz die Frage stellen, ob vorgesehen ist, dass ich mit Herrn Černý im Labor arbeite, oder ob wir nur in einer Beratungsfunktion bei der Polizei zusammenarbeiten werden? Falls Ersteres der Fall ist, müssten wir vielleicht über meine Laborzeiten sprechen«, sagte Wehner spröde. Ja, spröde, das war eine gute Bezeichnung, fand Sandor.
»Nun, Fräulein Wehner, ich würde sagen, der junge Mann wird erst einmal bei der Polizei benötigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Laborzeit können Sie sich darüber hinaus frei einteilen.«
»Na dann«, sagte Nike recht teilnahmslos. Sandor konnte sich nicht helfen: Der Gedanke, dass er es in Berlin beinahe sofort mit der Polizei zu tun bekommen würde, machte ihn nervös. Dann kennen sie schon mein Gesicht.
»Also gut, Sie wissen ja jetzt, wo Sie mich finden, wenn Sie etwas brauchen, kommen Sie vorbei oder machen Sie einen Termin mit meiner Sekretärin aus, Černý.«
Sandor saß Nike im Vorzimmer der Polizei gegenüber und versuchte, nicht allzu mitleiderregend auszusehen. Die Geschäftigkeit machte ihn nervös, der kalte Zigarrenrauch machte ihm bewusst, dass er seine letzte Zigarette schon vor Stunden geraucht hatte, und die Berliner Polizei machte ihm Angst. Schließlich war sie für ihre Effizienz berühmt – ein Teil von ihm wartete nur auf eine Pranke auf seiner Schulter und eine Stimme, die ihn bitten würde, ein paar Fragen zu beantworten.
»Wenn er nicht da ist – könnten wir morgen einfach wiederkommen«, schlug er Nike schließlich vor.
Sie sah auf die Uhr. Dieser Kommissar Seidel war gerade außerhalb des Büros beschäftigt. »Tut mir leid. Normalerweise ist er immer am Schreibtisch, meistens genau die vorgeschriebenen achtundvierzig Stunden die Woche und keine mehr oder weniger. Aber vielleicht haben sie ihm wegen des Toten Beine gemacht. Ja, lassen Sie uns morgen Vormittag wiederkommen.«
»Gibt’s geregelte Arbeitszeiten? Also, für mich?«
»Wenn es so läuft wie bisher, nicht wirklich. Bisher prüfe ich nur die Ermittlungsakten und kann das meiste davon schon von Anfang an als Spinnerei abtun. Ganz selten guck ich mir was genauer an, und auch davon hat sich das allermeiste nicht als das herausgestellt, was wir befürchtet haben.«
Gick, sagte sie immer. Und ick. Er grinste, aber der Dialekt machte es auch schwieriger, sie zu verstehen.
»Meistens komm ich einmal vor der Vorlesung rein und einmal danach. Aber ich hab jetzt auch ’nen Telefonapparat zu Hause. Haben Sie schon eine Unterkunft?«
»Ich bin in einem Hotel untergebracht«, sagte Sandor. Er war noch gar nicht dort gewesen, hatte aber die Adresse.
»Nobel«, kommentierte sie ohne Regung in der Stimme.
»Wie ist es so bei der Polizei? Stimmt es, dass sie hier ganz neue Methoden haben?«
»Ja, es gibt sogar ’ne weibliche Kriminalpolizei, ganz neu. Auch die ›Mordehen‹ der Mordinspektion gibt’s erst seit zwei Jahren.« Sie lachte.
»Mordehen?«
»Die von der Mordinspektion rücken immer mit einem festen Partner zu zweit aus, nennt man Mordehe. Meistens haben sie noch so ein Tippfräulein dabei, aber die hat in so ’ner Ehe nichts zu sagen. So läuft es ja überall. An der Uni, hier … Meistens darf die Frau mitschreiben, und die beiden Männer sind die, die für die Zeitung geknipst werden. Selbst die weibliche Kripo kümmert sich vor allem um Frauen- und Mädchensachen.«





























