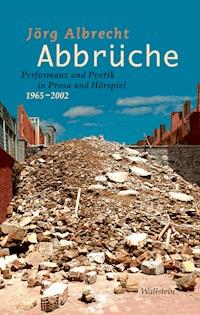Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Zukunftsvision für Arbeit und Leben, wenn aus dem Ruhrgebiet eine einzige Stadt geworden sein wird: Ruhrstadt. August 2015: NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft verkündet den Rückzug aus der Mitte ihres Landes. György Albertz, Schriftsteller und aus dem Exil zurückgekehrt, übernimmt mit einigen Gleichgesinnten das Ruder: Aus dreiundfünfzig Städten wird - auferstanden in Ruinen - eine: Ruhrstadt. Anziehungspunkt für alle Ausgestoßenen und systematisch Entrechteten. Gemeinsam versuchen sie sich an kreativer Erneuerung in den Räumen der Postindustrie. Wo einstmals Kohle gefördert und Stahl gegossen wurde, malochen jetzt Designer, Autoren und Musiker. Ihre Unternehmung ist Kunst. Und dabei treffen sie auf Menschen, für die Kunst vor allem ein Unternehmen ist. Zusammen erwirtschaftet man erste Devisen für einen ruhrstädtischen Traum. Im September 2044 suchen sich zwei in Ruhrstadt: Julieta und Rick. Getrennt voneinander taumeln sie durch eine gelebte Freakshow; von Camp Lintfort über Trans Town und durch Dschungelburg, immer dem Goldschatz von Unna hinterher! Bis sich vor ihren Augen die Utopie als Illusion entpuppt und die Welle mit ihnen zurückschlägt: It's capitalism, stupid! Jörg Albrechts Text rauscht durch eine Landschaft, die wir heute noch das »Ruhrgebiet" nennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg AlbrechtAnarchie in Ruhrstadt
Jörg AlbrechtAnarchie in Ruhrstadt
Roman
Eine kurze Geschichte der Ideologie der Geschichten 2
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetüber http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2014www.wallstein-verlag.de
Vom Verlag gesetzt aus der Stempel GaramondUmschlag und © Bildcollage: Susanne Gerhards, Düsseldorfunter Verwendung zweier Fotos vonJörg Albrecht, Berlin und Reinhard Kiehl, EssenDruck: Hubert & Co, Göttingen
ISBN (Print) 978-3-8353-1552-5ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2666-8ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2667-5
Inhalt
Prolog Vor dem Roadmovie
1.Passion Victims
2.Jeder Trend, der kommt, wird verwaltet
3.Krawallerie
4.Sensibilities, Schmensibilities!
5.Benutzerhandbuch
6.Ein moralisches Angebot
7.Gnadenlos hochgeschrieben
8.Unterhaltungskosten
9.Mein Manager gab mir diesen Terminplan für meine Keuschheit
10. Wie Liebe als Arbeit begreifen, aber nicht als Job?
11. Konzerte, die richtungsweisend sind, noch bevor sie stattgefunden haben
12. Verlustvortrag
13. Der übermäßige Drogenkonsum in meinem Leben. Und sein Fehlen
14. Die Ausdehnung der Wüste
15. Die Zuschauer haben keinen Sinn mehr für komplexe Dramen
16. Hair Growth Simulation
17. Mein Körper ist meine Welt. Und meine Welt ist Werbung
18. Ich will nur meinen Marktwert wissen
19. Du bist so geschäftsmäßig, dass es sogar mich erschreckt
20. Picture Management
21. Vor der Meditation, nach der Einweisung
22. Ich verfüge über eine gute Distanz zu dem, was ich tue
23. Brauchst du nen Schluck Wasser? Oder ne Therapie?
24. Du hast dich geweigert, ein Profil zu erstellen?
25. Unfriendly Reminder
26. Die schöpferische Zerstörung
27. Die chaotische Dunkelheit eines Films
28. Damaged Future
29. In meiner Homestory mochte ich mich viel mehr als in real
30. Mit der Zeit verlieren die Dinge an Bedeutungslosigkeit
31. Die schwindelerregende Leere
32. Blutinvasion
33. Endlich die Maske hinter der Fassade zum Vorschein bringen
34. Elfenbeinturmhaut
35. Die Revolutionen des Erdbodens
36. Ist das ein Flirt, oder rekrutierst du mich gerade für deine Partei?
37. Weder Zeit noch Raum werden mich davon abhalten, makellos zu sein
38. Ich mache die Arbeit, die ich über alles liebe, völlig ungerührt
39. Ich versuche, an den radikalen Zeiten vorbeizukommen
40. Die unterschlagene Wirklichkeit
41. Tears don’t cry
42. Donner
43. Blitz
44. Wolkenbruch
Prolog
Vor dem Roadmovie
Auf den ersten Blick liegt die Stadt einfach da, nicht friedlich und doch stumm, ein riesiges Raumschiff, das gelandet ist, um von hier aus die Welt zu erobern. Die gläsernen Hallen und weißen Monolithen, die vielen Villages und Grünflächen sehen aus, als wüssten sie von nichts. Doch Luftschlitten jagen leise zischend hin und her. Menschenmassen strömen zu Knotenpunkten. Und auch zwei, drei Rauchwolken, die sich von der Erde abstoßen, um den Himmel zu erreichen, und dabei ausfasern, stören die Ruhe. Denn wenn die Augen diesen Rauchwolken gefolgt sind, werden sie, nach unten zurückgekehrt, etwas anderes sehen als zuvor: eine Stadt, die sich über drei Jahrzehnte verausgabt hat.
Zur selben Zeit begeben sich zwei Menschen, die sich längst gefunden haben, auf die Suche nach einander.
Ich würde dir so gern etwas schenken, was du nicht von mir erwartest und ich nicht von mir erwarte. Flüstern sich die beiden zu, ohne sich zu hören. Über zweiundsechzigtausend Meter hinweg flüstern sich Julieta Morgenroth und Rick Rockatansky das zu, an jenem drückenden 12. September 2044, an dem der gigantische Moloch sein Ende finden wird, der seit ihrer Geburt ihr Leben bestimmte und der bei Menschen aus allen Ecken der Welt, allen Altersstufen und Gesellschaftsschichten, allen sexuellen Orientierungen und Desorientierungen bei Tag ein Glänzen in den Augen hervorruft und bei Nacht die Körper schwitzen lässt, bis sie den Namen dieses Molochs rufen: Ruhrstadt.
Es ist jener Tag, den Julieta und Rick herbeigesehnt haben, nicht weil sie gedacht hätten, es könnte ein großes Datum der Weltgeschichte werden, sondern weil genau heute ihr Plan sein Leben als Plan aufgeben soll, um in die Wirklichkeit einzutreten. Ihr Plan: diese Stadt zu verlassen, gemeinsam. Doch dazu wird es nicht mehr kommen, auch wenn sie das noch nicht wissen. Und da sie nicht wissen, wo der andere ist, wissen sie auch nicht, dass sie beide an den Eingangstoren der Stadt stehen, Julieta am östlichen, Rick am westlichen, beide nicht allein. Wie viele Tausende Menschen hier zusammengeströmt sind, ist wohl niemandem klar, aber an beiden Orten, in Hamm und in Camp Lintfort, sind Menschenmassen aufgetaucht, wie man sie nur von den offiziellen Jubiläumsfeiern der Ruhrstadt kennt: vom Fünfjahresfest, vom Zehn-, vom Zwanzigjahresfest, und man ahnt, dass es beim Dreißigjährigen nächstes Jahr noch schlimmer werden wird.
Es ist ein Flüstern durch die Straßen gegangen, eine Botschaft, die sich trotz des Flüsterns nicht verlaufen hat in den Sackgassen der Stillen Post. So still ist es in Ricks Fall allerdings nicht gewesen, eher im Gegenteil, eher schrill, mit Gloria Hola, die in den Schuhmacherladen gerauscht kam. Gloria als eine seiner Stammkundinnen und zugleich die Letzte, die seinen Laden für lange Zeit sehen sollte. Bevor er gehen konnte, war sie hereingeplatzt, um ihre Ultra-Plateau-Schuhe abzuholen, deren Plateau Rick noch einmal um 16,2 mm erhöht hatte. Und das Erste, was Gloria nach Begrüßung, Küsschen und den üblichen Spitznamen – von denen Rick The Dick noch eher über der Gürtellinie lag – herausgebracht hatte, war: Sie sind wieder da! Eine Band, eine der ganz uralten Bands, noch aus der Zeit vor der Ruhrstadt, eine Riot Grrrl Band namens Pristine, wird wieder spielen. Und wo? Am Gläsernen Elefanten in Hamm. Und zugleich soll dieses Reunion-Konzert auf die andere Seite der Stadt übertragen werden, auf den Platz vor dem Kloster in Camp Lintfort. Doch es ist eben keines dieser Ruhrstadtriesenevents, bei denen Lautsprecher groß wie Wolkenkratzer ihren Schall in die Ohren der Menschen, Tiere und Häuser drücken, sondern eher klein: Eine Batterie verschiedener Lautsprecherboxen, maximal siebzig Zentimenter hoch, die kleinste sogar nur zwanzig, eine Computerbox, Ende 20. Jahrhundert, vom Antiquitätenhändler, steht auf dem Klostervorplatz, um die Musik vom östlichen Ende der Stadt herüberzutragen. Rick Rockatansky, mit Gloria Hola aus dem Schuhmacherladen hierher aufgebrochen, will, kaum angekommen, weiter nach vorn. Der Weg hat viel zu lange gedauert, da Camp Lintfort auch 2044 noch keinen eigenen Bahnhof besitzt. Eine letzte Aktion für einen Bahnhof hatte in den Zwanzigern halbherzig eine Handvoll Rentner initiiert, alle anderen – vor allem die hier angesiedelten Schriftsteller – waren dafür, dass Camp Lintfort abgeschnitten blieb, nur zugänglich per Bus, weil man sich – laut den Schriftstellern – so und NUR SO eben schön einsam fühlen könne und ganz weit weg von jeglicher urbaner Grausamkeit. Davon will Rick schon lange weg, das weiß er nicht erst, seit er unter Julietas Wimpern Julietas Augen sah und in diesen Augen das Bild einer Wüste, in dieser Wüste sie beide, wie sie die Stadt verlassen. In diesem Moment beginnt das Konzert, also schiebt Rick sich durch die Menge, hebt seine Arme, damit seine breiten Schultern weniger breit werden, und auch, damit die nassen Stellen unter seinen Armen die Leute zur Seite treiben. Das funktioniert nicht. Also die Arme noch höher, und auch den Bauch einziehen, der in den vergangenen zwei Jahren ganz schön gewachsen ist. Rick Rockatansky, den Spitzbauch eingezogen, die Arme in die Luft gehoben, die Hände ungewollt hin- und herdrehend, winkend, so dass er an den Schwielen der Handflächen die Luft spürt, die oberhalb der Menschenmenge viel besser ist. Und sie ist nicht einfach besser als unten, sie ist anders. Was in dieser Luft liegt, ist nicht die gute Laune, die die Ruhrstadt in der ganzen Welt berühmt gemacht hat und die man – angesichts ihrer dunklen Vorgeschichte – als überraschend empfand, später als authentisch, viel später als aufgesetzt. Diese sensibelsten Stellen an Rick Rockatanskys Händen spüren: das Gegenteil guter Laune.
Vier Frauen betreten die rudimentär zusammengezimmerte Bühne am Gläsernen Elefanten in Hamm. Während die Frauen, alle Anfang sechzig, zu ihren Instrumenten greifen: Gitarre, Bass, Sticks und Mikrofone, sieht Julieta, wie in der Nähe des Elefanten Menschen die Scheinwerfer, die das Jumbosymbol der Stadt nachts und bei Bewölkung immer anstrahlen, auf die improvisiert wirkende Bühne umrichten. Die Bühne: zusammengezimmert aus ein paar Nägeln, Brettern, Solarzellenbehältern, Damenbindenkartons und etwas, das einer aus der Schrottpresse gezogenen Stromtanksäule verdammt ähnlich sieht. Und auf dieser Bühne beginnt die Band jetzt zu spielen. Auch Julieta nimmt die Veränderung in den Bestandteilen der Luft wahr, eine Veränderung, die sich nicht am Geruch zeigt, der hier, am Rand der Stadt, nicht gerade dezent auf das angrenzende Land hinweist. Eine Mischung aus Unmut und Aufbruchsstimmung. Immer mehr Menschen strömen auf den Gläsernen Elefanten zu, selbst von der kleinen Anhöhe, auf der sie steht, kann Julieta das Ende nicht erblicken, Menschenmassen auf flachem Land, so weit das Auge kommt. Noch vor zehn Jahren standen hier die letzten Wohnhäuser, besetzt und paramilitärisch verteidigt gegen die Regierung, die alle Wohneinheiten plattmachen wollte, um das gesamte Viertel für den Elefanten zu reservieren und es so zum Jumboviertel zu machen. Der Gesang der Band geht los: This is my decision. Was ist das? This is my choice. Eine Demonstration? I’ll make my way. Menschen sind zusammengekommen, um sich zu engagieren, wie knapp sechs Jahrzehnte zuvor, 1986, als der Thorium-Hochtemperaturreaktor Hamm-Uentrop die Proteste der Bürger auf sich zog, da ihm in ein, zwei unachtsamen Momenten – kann ja mal passieren! – etwas Radioaktivität entwichen war. Daran denkt jetzt, im September 2044, niemand mehr. Die Menschen, die Julieta hier sieht, sind nicht aus Wut gegen eine alte Zeit da, eher aus Hingabe für eine neue, von der sie noch nicht viel wissen. I’ll make my way. Und indem sie hier sind, tun sie schon etwas, sie brauchen nicht mehr zu tun, als hier zu stehen, beim Reunion-Konzert einer Band, die wiederum für eine Zeit steht, die Julieta nie erlebt hat: die Zeit vor der Gründung der Ruhrstadt, jene Jahre, in denen die Grundlagen für die Metropole des Kreativsozialismus entstanden.
Aus irgendeinem Teil ihres Gedächtnisses steigen nun die passenden Bilder auf: Das Komitee der Kreativen, sieben etwa dreißigjährige Köpfe, die damals, 2015, in einem unerhört dreisten und unerhört charmanten Akt die Übernahme einer Gesamtregierung für die Gesamtregion erklärten, die Gründung einer Stadt aus dreiundfünfzig Städten. Diese sieben Köpfe stehen in Julietas Kopf vor ihr. Oft genug hat sie deren Bilder gesehen, so dass die Neuronen-Netzwerke keine große Arbeit leisten müssen. Und wir werden, sagt einer der sieben Köpfe des Komitees, ein bärtiger Typ namens György Albertz, wir werden den Geist wiederbeleben, der diese Region groß gemacht hat: den kreativen Unternehmergeist. Jeder da draußen kann losgehen und Dinge schaffen! Jeder ist kreativ! Denn alle hier sind Künstler, und wenn alle das sind, dann ist auch diese Stadt eine Künstlerin! Julieta sieht György Albertz vor sich, wie er diesen Satz ausspricht. Und im selben Moment sieht sie ihn auf den Screens der Uhren, die die Menschen um sie herum in die Höhe halten. Denn während die alten Riot Grrrls von Pristine, die längst keine Girls mehr sind, in der Mitte ihres zweiten Songs ankommen, erscheint auf den Uhren, diesen längst Standard gewordenen Items des wearable computing, eine Eilmeldung. Die Bilder vom Komitee der Kreativen 2015 überblenden auf den Hyperwatches zu anderen, aktuellen. Auch hier steht eine Gruppe von Leuten, gesetzter wirkend, und eine Frau verliest eine Erklärung. Kann das wahr sein? Julietas Augen werden größer, noch größer, ihre Lippen öffnen sich, ziehen zur Seite und nach oben, ihre Augenbrauen heben sich. Ein Jubel geht durch die Menge, der, als habe es eine höhere Macht so gewollt, just mit dem Höhepunkt eines Solos der Pristine-Drummerin zusammenfällt. Und Julieta, der gerade ein Dutzend fremder Menschen ob dieser breaking news um den Hals gefallen ist, Julieta denkt: Ja, eine Stadt IST eine Künstlerin, und ihre Kunst ist das Zusammenleben.
Minuten zuvor hat Rick Rockatansky in Camp Lintfort sich vorgeboxt, durch die Bögen, mit Blauregen bewachsen, und steht nun am Hang, wo er auf die barocken Terrassengärten des Klosters hinabsieht, auf die Lautsprecher, die zwischen den kunstvoll geschnittenen Sträuchern und Bäumen stehen, irgendwie fehl am Platz und für Rick doch genau richtig. Die Lautsprecher stehen inmitten der Terrassengärten, inmitten dieses wiederaufgebauten Stücks Barock, rekonstruiert Ende des 20. Jahrhunderts – unschwer zu erkennen an den damals modernen blauen Metall-Einsprengseln. Zirka 1994, denkt Rick, während er zugleich eine Infotafel liest, die erklärt, dass der Originalgarten von 1740 schon 1746 in Sanssouci kopiert worden sei. Inmitten dieser kruden Mischung von Jahrhunderten, die man zirka 1994 mal als organisch ansah, denken nun auch Ricks Augen, dass gerade etwas dabei ist, sich zu ändern: Allein an den zusammengewürfelten, beliebig aufgestellten Lautsprechern, aus denen der Schluss des ersten Songs von Pristine herausdrischt, herüberdrischt aus Hamm, allein daran ist die Veränderung spürbar. Selbst die schlechtesten Eventveranstalter hätten das besser gemacht. Denn was die Ruhrstadt international zur Top-Metropole gemacht hat, war nicht nur das, was György Albertz 2015 forderte, waren nicht nur die kreativen Kinder, die sich dank ihrer Kreativität zurechtfinden in einer Welt, in der man sich nicht zurechtfinden kann. Was den harten Standortfaktor dieser Stadt formt, ist ihre Professionalität. Jedes Videospiel, das hier entsteht, jeder Musiktrack, jedes Stück Literatur ist auf höchstem Level professionell. Und die Gesichter, die die Menschen dazu machen, sind es auch. Aber die Menschenmenge, die um Rick herumsteht, und die dieser Musik aus dilettantisch arrangierten Lautsprechern lauscht, in seltsamer Weise euphorisch, ist das Gegenteil. Jeder Eventmanager würde das besser machen, würde die Zuschauer auf den Treppen der Gärten gruppieren, würde Muster in die Sträucher schneiden – thematisch auf die Veranstaltung abgestimmt: Sternenbilder für die Zauberflöte, Flammen für ein Metalkonzert oder Löwenmähnen für König der Löwen –, und das Publikum würde so was erleben können wie: Feuerwerk, Tanz und nackte Tatsachen oder nackte Fiktionen. Aber niemand [NIEMAND!] würde es so machen, wie es hier ist: Zuschauer unten und auf den Treppen und oben und auf allen Seiten. Das sei ja unglaublich, sagt in diesem Moment ein Mann, Mitte vierzig, in weißen Leinenklamotten zu der Frau neben sich, sie Mitte dreißig, in Floral-Print-Overall, ne Veranstaltung so zu machen, das sei keine Art. Nein, das sei ausnahmsweise NICHT Art, knurrt Rick hinter ihm, bereit, aus seinen zusammengekniffenen Augen Laserstrahlen abzuschießen. Doch dazu kommt es nicht. Auf der Hyperwatch der Frau neben dem Hobby- oder Profi-Eventmanager erscheint eine rötlich eingefärbte Meldung. Die Regierung!, stößt die Frau im Floral-Overall hervor. Abgedankt! Und sie ist nicht die Einzige, die das merkt. Stimmen um sie herum schwellen an, überdecken die Musik. Und Rick Rockatansky fühlt, wie sich die Erde unter seinen Füßen bewegt.
Von über den Wolken aus nimmt eine Kamera in diesem Augenblick ein Bild der Stadt auf, oder will es aufnehmen, aber kann nicht, weil sich etwas so bewegt, dass die Kamera ihren Befehl nicht ausführen kann, kein aktuelles Foto der Ruhrstadt machen kann, denn das da unten ist keine Stadt mehr, was dann? Ein Siedlungsgefüge, ohne Zentrum, ohne Zusammenhang. Und Rockatansky denkt: Das ist wie Jahre deinen Körper in Topform halten, so dass du jeden Muskel bewegen kannst. Und auf einmal verfällst du, egal, wie viel du trainierst.
1
Passion Victims
Genau neunundzwanzig Jahre, elf Monate und sieben Tage bevor die Ruhrstadt zerfallen wird, nimmt sie ihren Anfang. Und fast niemand weiß davon. Es ist der 5. Oktober 2014, und György Albertz, dreiunddreißig Jahre alt, von Beruf Schriftsteller, fährt auf diese Zukunft zu, in einer U-Bahn, vor wenigen Tagen ins Ruhrgebiet zurückgekehrt, nach fast zehn Jahren Absenz. Oder Abstinenz! Rief Bruno, einer seiner besten Freunde, vorhin am Telefon, und: Ich freu mich so aufs Wiedersehen! Es ist natürlich nicht das erste Wiedersehen seit 2006, als György Albertz sich aus dem Staub gemacht hatte. Der wirbelt jedes Mal ziemlich stark auf, wenn wieder jemand aus dem Melting Pott verschwindet. Doch ist es das erste Wiedersehen mit den alten Freunden, bei dem György wieder als Einwohner dieser riesigen Stadt gilt, die gar keine ist. Und noch weiß er nicht, dass er in eine Runde hineingeraten ist, die genau das ändern will. Bevor das Ruhrgebiet so weit schrumpft, dass nichts mehr übrig bleibt.
Lila Wolken ziehen auf. Und niemand sieht mehr irgendwas. So wie es hier früher mit dem Kohlenstaub immer war. György Albertz, in diesen lila Wolken auf der Suche nach einer dritten Zukunft für das Ruhrgebiet. György Albertz, geboren in Dortmund-Schnee, Kind des Potts, Kind eines ungarischen Kinderchirurgen und einer Politiklehrerin aus Wanne-Eickel/Herne 2. György Albertz, umherirrend, auf Industriebrachen, den ehemaligen Kathedralen der Arbeit, jetzt Kathedralen der Nicht-Arbeit, und auf einmal steht ein riesiges Monster vor ihm, halb Mensch, halb Elefant, und schreit: Ich bin das große Schrumpfen, das hier alles vernichten wird! György Albertz ist nur kurz eingenickt und weiß beim Hochzucken aus den lila Wolken nicht, wo er sich befindet: noch in Essen oder schon in Mülheim oder sogar Duisburg? Raus aus der U-Bahn, rauf auf die Rolltreppe, raus aus diesem riesigen unterirdischen Bahnhof, dessen Rolltreppen, Gänge und Ausgänge für Millionen Einwohner gebaut wurden, die nie kamen. György Albertz weiß noch, wie in den Neunzigern die Städte des Ruhrgebiets noch einmal richtig reinhauten, um trotz aller Umbrüche im Arbeitsleben weiter zu wachsen, auch wenn sie längst dabei waren, sich zu verkleinern. Wie er mit siebzehn Jahren diese Versuche, groß zu sein, mochte. Wie er sie mit einundzwanzig liebte. Und wie er mit fünfundzwanzig immer weniger verstehen konnte, warum diese Versuche, groß zu sein, so klein enden mussten. Um das doch noch zu ändern, ist er hier. Ohne etwas davon zu ahnen.
Dann steht er vor ihnen, in der Lobby dieses Hauses, das mal ein Hotel war, um jetzt einer Handvoll Künstlern als working space zu dienen, zwischen- oder endgenutzt, das ist noch nicht klar. Auf einem kaminroten Teppich mit burgunderroten Blumenranken, fancy-schmacy, steht György Albertz, und vor ihm sitzen die Daheimgebliebenen: Bruno, Hermine, Finnbar, Maria und Steven – frisch verheiratet – und noch ein paar andere. György Albertz wird umarmt. György Albertz trinkt ein Bier und wird beglückwünscht, der heimgekehrte Sohn, der sich dennoch verloren fühlt. György Albertz, der, nach zwei, drei Bier, in die Runde fragt: Ist es nicht seltsam, dass man, egal wo man ist, immer als man selbst aufwacht? – Das kann man ja ändern, sagt Bruno. Vor allem, wenn man eine riesige Region ist, die vor dem Abrutschen steht.
An jenem 5. Oktober 2014, um zirka 21.27 Uhr, beginnt die Diskussion um die Zukunft. Und damit beginnt diese Zukunft. Wir haben hier dreiundfünfzig Kommunen, und das ist euch nicht genug?, fragt György. – Exakt, sagt Hermine, so viel ist einfach nicht genug, wir brauchen noch mehr, und zwar eine einzige Stadt, die alle Städte enthält, sie umfasst, sie umarmt! – Es braucht EINE Regierung, sagt Steven, oder irgendwas Zentrales, irgendein Zentrum, das verhindert, dass hier alles auseinanderfällt. – Das haben wir vor zehn Jahren doch versucht, sagt György, damals, als wir wenigstens eine Schaltstelle für die Künstler schaffen wollten. Und niemand wollte das! Niemand wollte sich aus seiner Kommune rausbewegen. – Und dann, 2010, mutierten sie von Künstlern zu Kreativwirten, so wie wir, sagt Maria, die Malerin. Und Bruno, Grafikdesigner, Werbeagenturerfahren und -gebeutelt, ergänzt: Guck dir die Fußgängerzone da draußen an, alles verlassen, jeden Tag steht noch ein Ladenlokal mehr leer, und der Einzige, der das noch als Filmkulisse nutzen kann, ist Helge Schneider.
Rückblick: Während György Albertz sich acht Jahre in der Hauptstadt dieses großen, unbekannten Landes vergnügte, mal mehr, mal weniger, am Ende immer eher weniger, ist das Ruhrgebiet auseinandergebrochen: Auf der einen Seite höchste Pro-Kopf-Verschuldung, höchste Kinderarmut, höchster Sanierungsbedarf, höchste Einwanderungsquote aus den ungeliebten Ländern im Süden und Osten. Auf der anderen Seite Hochglanzeinkaufstempel, Hochglanzmuseen, Hochglanzseen. Und eine junge Hochglanzelite – was vor 2010, dem Jahr der Kulturhauptstadt, niemand geahnt hätte –, kreativ bis zum Bersten, gut vernetzt durch zahlreiche Initiativen und Förderinstitute wie ECCE [European Center for Creative Economies], ein Pool an Kreativen, süchtig nach Arbeit und nach Räumen für ihre Arbeit. Hier, sagt Bruno und zeigt György auf dem Phone eine kleine Diashow: Allein die Hausbesetzungen, die es jetzt gab, in fast jeder Stadt. – Das eine, sagt György, sind die Künstler, die es hier immer gab, und das andere ist das Gegenteil, eine ökonomische Kraft, die Kreativwirtschaft, die es hier fast gar nicht gibt, die nur herbeigesehnt wird. – Da hat nichts und niemand ne Chance. – Aber wieso nicht alles verbinden?, fragt Steven. Die, die Kunst machen wollen, und die, die Kunst zum Unternehmen machen wollen, und die, die das alles in einer einzigen und riesigen Stadt wollen, der einzig richtigen? – Der Ruhrstadt! – Ihr wollt unbedingt diese 54. Stadt? – Ja, und wahrscheinlich werden wir uns noch vierundfünfzig Mal treffen, bevor irgendwas zustandekommt, sagt Finnbar, geboren in Finnentrop, aufgewachsen in Waltrop. Wir werden ewig brauchen. – Bis 2054! – Die 54. Stadt: COMING 2054! Die Augen der Eventhäschen im Raum beginnen schon zu leuchten.
Es ist Oktober 2014 in diesem ehemaligen Hotel in the middle of Mülheim / Ruhr, in dem sich eine riesige Möglichkeit einquartiert hat. Die Frage ist: Bleibt diese Möglichkeit, um hier mit ihnen zu wohnen? Oder ist sie nur vorübergehend, ein Traum, den man wegblinzelt? Kaum zweimal geblinzelt, ist es November, und der Traum ist noch da. Und dann ist Dezember. Und dann Frühjahr 2015 und auch fast schon Sommer. In dieser Zeit denken die Freunde nach. Und einige gehen. Andere kommen.
2
Jeder Trend, der kommt, wird verwaltet
Am frühen Morgen des 13. September 2044 zählt eine Megastadt im Herzen des bedeutungslos gewordenen Europa herunter, wie viel Zeit ihr selbst bleibt, bis sie bedeutungslos sein wird. Parallel dazu zählt eine Frau von neunundzwanzig Jahren, wie viele Strahlgleiter und Luftschlitten auf den sechs Spuren neben ihr vorbeiziehen, wie viele auf den sieben Spuren der Gegenbahn, und rechnet hoch, wie viele Menschen unterwegs sein mögen, um sich ins Geschehen zu mischen. Oder ihm zu entgehen. Julieta Morgenroth, neben einem schlafenden Mann mit indischem Background, auf dem Rücksitz eines alten, klapprigen Flugtaxis, eines aus der ersten Generation, Baujahr ’28. Draußen klappert es, als hinge der Auspuff bis auf die Gleitbahn hinunter, während drinnen ein Videoscreen, an der Rückseite der Vordersitze angebracht, ungestört den sonnendurchfluteten Boden eines Swimmingpools zeigt, dazu leise Panflötentunes. Der Verkehr auf der anderen Seite der Bundesstraße stockt, und nur Sekunden später sieht Julieta eine Handvoll Robo-Dreibeiner der City Cops, die in die Richtung stapfen, aus der sie kommt: zum Jumboviertel. Hinter den Robo-Dreibeinern, wahrscheinlich einige Kilometer weiter weg, entfalten sich am dämmernden Himmel Blüten aus Funken, immer wieder neu, nicht nur ein Feuerwerk, mehrere auf einmal. Es wird gefeiert und gegen die Feiern eingeschritten, beides zur gleichen Zeit. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell zu Ende geht, wispert Julieta.
Ich hab mich auch grad erst dran gewöhnt, dat hier n bissken größer zu habn und nich mehr so mickrig und piefig. Und getz is et schon wieda durch, brummt von vorne die Taxilady, Mitte siebzig, mit einer elektrischen Zigarette zwischen den Lippen und einer Hand am Steuer, in den Rückspiegel schauend. Im Rückspiegel sieht Julieta neben ihrer eigenen Stirn und Augenpartie hinter ihnen zwei Hoverboards, einen Jeep mit Reifen, noch viel älter als das Taxi und inzwischen illegal, und weit hinten erahnt sie den Gläsernen Elefanten. Alle paar Sekunden aktualisiert, zeigt der Rückspiegel die jeweiligen Namen der Straßen, Automarken und Insassen an. Ich sach et Ihnen, vor dreißig Jahren hat dat Taxifahren hier regelmäßig ne persönliche Krise in mir ausgelöst, aber dann wuarden die Straßen ausgebaut, sieben Spuren, und wiar hattn den Charme, den wiar immer gewollt hatten, und unsere Motoren erst recht, sagt die Lady, deren Name jetzt dort aufleuchtet, wo ihre Stirn in den Rückspiegel hineinragt: Taximoni.
Rückblick: Am frühen Morgen nach dem Konzert, ungefähr fünfzig Meter entfernt vom Gläsernen Elefanten, traf Julieta Morgenroth auf Sharad Thaker. Sie hatte sich gerade zwischen drei Gruppen tanzender Betrunkener hindurchgeschlängelt, als vor ihr dieser Mann stand, zirka vierzig, leichter Bauch, in weißen Shorts, weißen Halbschuhen und weißem Hemd mit lilafarbenem Batikanteil, ungläubig in den Himmel starrend, wobei Julieta auf Anhieb fasziniert davon war, dass die Augenbrauen, der Mund und die Falten des Mannes eine bestürzte Skepsis zur Schau stellten, während seine Augen leuchteten, frohlockten. Das war vorbei, als die Menschen anfingen, den Gläsernen Elefanten mit herausgerissenen Straßenschildern, Äxten und kleinen Taserstrahlern von seinem Glas zu befreien. Der Elefant ist 1984 Jahre alt gebaut, sagte der Mann zu Julieta, aber eigentlich schon 1912 Jahre alt gebaut, denn Elefant war vorher Kohlenwäsche.
Sharad Thaker, Ruhrstädter mit indischem Background, sprach nicht jenes Inderdeutsch, das in den Dreißigern als Teenagerslang en vogue war – samt verschluckten oder neu eingefügten Silben, die Sprache in den vorderen Mundraum geschoben, das retroflexe R amerikanischer Art –, denn das hätte Julieta inzwischen doch gut verstanden. Sharad Thaker sprach ein akzentfreies Deutsch, dessen Satzbau eigenwillig war, aber nicht so eigen, wie in der ersten Sekunde gedacht, nein, an irgendetwas, irgendeine Sprache, an irgendjemandes Sprache erinnerte Julieta das. Doch erst später, viel später, als sie Hamm den Rücken gekehrt haben würde, um doch zurückzukehren in die Mitte der zerfallenen Megastadt, würde Julieta wissen, an was. Während sie noch über das seltsame Deutsch des Mannes nachdachte, hörte sie wieder das Glas des Elefanten, das Goodbye sagte, und gleichzeitig verabschiedete sich Julietas Gleichgewicht. Sie taumelte. Für einige Sekunden sah sie nichts mehr, hörte nur. Der Mann im Batikhemd fing sie auf und legte sie auf den Boden, und die Betrunkenen zogen Richtung Elefant. Julieta sah in den dämmernden Himmel, von dem sie gerade nicht wusste, ob er je wieder aufhören würde zu dämmern, ob er nicht immer zwischen Nacht und Tag bliebe, und ihr wurde bewusst, dass sie seit über vierzehn Stunden nichts gegessen hatte. Das Gesicht des Mannes erschien jetzt über ihr: Ich heiße Sharad.
Ein paar Minuten später waren Julieta und Sharad Thaker auf dem Weg vorbei an den Menschenmassen, an diversen ehemaligen Industriehallen, einige von ihnen umgewandelt in jenen düsteren Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, als die Spekulation die liegengebliebenen Anlagen entdeckte und dort Gastronomien einrichtete: orangefarbene Wände, mit hohen Vasen voller getrocknetem Schilf und Treppen aus Metall, die wahrscheinlich nur in Metall-Optik angestrichen und eigentlich aus Hartplastik waren. Irgendwann waren Julieta Morgenroth und Sharad Thaker an diesen Monstern der Nachnutzung vorbei und standen im Dunklen. Wohin jetzt? Da sprang ein Motor an, dazu Scheinwerfer, die auf sie zurasten, und eine Hupe sagte zu Ihnen: HONK!
Zurück im Taxi: Ich hab mich bestens mit deiner kleinen Freundin unterhalten, Sharad, knurrt Taximoni über die Schulter Sharad Thaker zu, der gerade neben Julieta Morgenroth erwacht. – Ihr euch Namen ausgetauscht?, fragt Thaker. – Ich bin Julieta. – Und ich Taximoni. – Also eigentlich: Moni?, fragt Julieta. – Nein, Mareike. Aba ich bin eben jahrzehntelang füar dieset Taxiunternehmen gefahrn, füar Taximoni. – Klingt wie Taxonomie. – Ja, die Leute, die wo dat gegründet hatten, warn Philosophiestudenten, die dann aber, als de Ruhrstadt kam, wussten, dat se zu unkreativ füar die neue Elite sein wüarden, und so wuarden se Taxifahrer. – Und seit wann fahren Sie schon? – FAHREN? FUHREN! Ich hab dat Taxi behaltn, aber ich bin seit fünfzehn Jahren Freiberuflerin, jahawoll, und seitdem hab ich auch den Künstlernamen Taximoni. Ich bin Taxidermistin. Ich mach Tierkörper haltbar, und dat vor allem füar Dekoration. Ich konserviere. Aber ich gestalte auch. Ich gestalte die Haut der Tiere. Und die Haut ganz anderer Dinge. Wie zum Beispiel konservieren wiar dat Image, dat die Ruhrstadt hat? – Sie sind Konservierungskünstlerin? – Genau. Sie kenn doch sicha Iman El-Mofty, dieset pseudoarabische Künstlerduo, dat Zeichentrickserien des 20. Jahrhunderts nachspielt, ausschließlich mit ausgestopften Tieren? Füar die mach ich allet. – Und Taximoni ist auch in unserem Haus sehr oft erschienen!, ruft Sharad Thaker. Was er mit: Haus meint, ist: sein Büro. Denn Sharad Thaker gehört zum offiziellen Planungsbüro der Ruhrstadt, und dort existiert ein Real-Time-Plan der Ruhrstadt, ein Computersystem, das eine in Echzeit erstellte Übersicht – man könnte auch sagen: Überwachungssicht – der einzelnen Stadtteile liefert. Vielleicht kann Julieta dort irgendwie herausfinden, wo Rick Rockatansky ist. Mh, sagt Thaker, schau her, großer Plan! Er zeigt nach draußen, auf den Stadtteil, in dem sie sich noch immer befanden: Hamm. Planstadt!, ruft er noch und hält, unterstützt von den Panflöten, den dröhnenden Ampelgeräuschen und vom Elektroraucherhusten der Taxidermistin, einen kleinen Vortrag über den Masterplan der Ruhrstadt, von dem er sagt: Niemand kann sagen, wann genau dieser Plan geboren wurde, und niemand weiß, ob er gerade gestorben wird.
3
Krawallerie
Wenn einer in sein vierunddreißigstes Jahr geht, wird man endgültig aufhören, ihn jung zu nennen. Es sei denn, er klotzt was ganz Großes hin. Es ist Frühsommer 2015, György Albertz’ Vierunddreißigster nähert sich mit Warpgeschwindigkeit, und das ganz große Projekt ist wenigstens in Sicht. In den Monaten zuvor haben sich die Dinge zusammengezogen, ja, die Monate selbst haben sich verdichtet, so viel ist geschehen: Das namenlose Komitee hat jede Minute darangesetzt, ein Netzwerk aufzubauen. 54 ist der Code. Und mit diesem Code hat das Komitee viel mehr als vierundfünfzig Einzelpersonen, Gruppen, Initiativen an Bord holen können, an Bord eines noch nicht flugtauglichen Space Ships, für dessen Fertigstellung noch einige Stunden bleiben, bis es hell wird. Denn es fühlt sich an, als wäre es Nacht, als könnten sie ungestört vorbereiten, was sie vorbereiten wollen, da alle anderen schlafen. Und irgendwo verrät schon ein leichter Schein am Himmel, dass die Geduld richtig war und die Nacht bald ein Ende hat.
Am 4. Juni 2015 steht György Albertz im Weißen Haus, einem Alfred-Krupp-Bau im Westen Essens, umgestaltet zum Bürospace. Aber da fast niemand sein Büro hier aufschlagen wollte, ist der Bürospace nun Living Space. Nun steht in einem Zimmer György Albertz’ Schreibtisch, in einem sein Bett, in einem seine Bücherwand und in einem ein einsamer Hocker mit drei goldenen Beinen und pinkem Floccatisitz, der aus einem anderen Jahrhundert stammt. Und etwas jünger sind die Erinnerungen, die für György an diesem Hocker hängen, Erinnerungen an die frühen Nullerjahre im Ruhrgebiet, die, als er in das Zimmer kommt, verpuffen, da er auf einmal an Dinge denkt, die in der Zukunft liegen. Wird je jemand dieses Zimmer bewohnen, um mir nachts zu sagen, vielleicht ohne es zu sagen: Wir sind alle allein, aber ab jetzt sind du und ich nicht mehr ganz so allein wie alle anderen?
György Albertz stellt neben seinen pinken Hocker sechs Stühle, auf denen bald die sechs anderen Köpfe des namenlosen Komitees thronen werden. In alphabetischer Reihenfolge: Bruno Bessi, Noy Briefman, Snorri Leifsson, Priskilla Müller, Fabía Porsche und Sandrine Sawitzki. Animiert von Bruno Bessi und György, ist Sandrine, Györgys beste Freundin Sandrine, auch wieder hergekommen, aus jenem immer noch lärmenden Berlin, das in wenigen Jahren untergegangen sein wird, heruntergewirtschaftet von Immobilienspekulanten, Touristenschwärmen und einer Einwohnerschaft, die bis zum bitteren Ende entspannt bleiben wird, militant entspannt. Und heimlich zittern alle anderen kreativen Städte schon, weil sie spüren, dass jemand kommen wird, um sie abzulösen, auf den Pole Positions dieser Welt.
Seit Monaten ist die Unruhe auch im Ruhrgebiet spürbar: Immer mehr brachliegende Gebäude werden besetzt von den kreativen Zellen, die das Komitee miteinander vernetzt hat. Immer mehr Architekten, IT-Nerds und Lyrikerinnen nehmen in Beschlag, was ihnen vorenthalten wird: einen Teil dieser Stadt. Und an fast allen Orten solidarisieren sich die Anwohner mit den Besetzern, meist vom ersten Tag an. Noy Briefman, 31, IT-Nerd, seitdem er sechs war, zeigt das anhand eines improvisierten Schaubildes. Das hier sind die Orte, erläutert er, die noch von der Polizei beobachtet werden, die hier aber sind bereits anerkannt als besetzt. Es ist ein Wahnsinn, sagt Fabía Porsche, 28, aufstrebende Choreographin, als ich vor fünf Monaten hier ankam, hatte ich nur im Kopf, was mir alle erzählt hatten, und war eingestellt auf eine kulturelle Wüste und darauf, in meinen drei Monaten Stipendium selbst zu einem Stück Wüste zu werden. Aber das hier! – Das hier, sagt Priskilla Müller, 34, Stadtplanerin, die in ihren sieben Jahren Berufserfahrung in der Branche Stadtentwicklung nur Stadtverhinderungsentwicklungen miterlebt hat, also das Ruhrgebiet war mal auf viertausend Quadratkilometern ein Versuchslabor. Eingerichtet, um zu verstehen, wie Städte schrumpfen können. Und jetzt, wo alles fertiggeschrumpft ist, stellen wir auf einmal fest, dass das ganze Ding wieder wächst. Und wächst. Immer mehr anwächst. Schaffen wir irgendwann doch noch die Zehn-Millionen-Einwohner-Grenze und werden zur Megastadt?
Die 54. Stadt sucht ihr Territorium: Seit Monaten treffen sich die sieben Köpfe des Komitees einmal in der Woche im vierten Zimmer der übertrieben großen Vierzimmerwohnung von György Albertz. An den Wänden hängen Pläne, mit dickem Tape befestigt, manche auch zugetapet, aussortiert, verbannt in die development hell, in jene höllische Zone, in der Projekte bis in alle Ewigkeit auf ihre Realisierung warten. Auf dem zentralsten und größten Plan verbindet ein lilafarbener Edding dreiundfünfzig Kommunen zu einer, und alles, was nicht dazugehört, was außen ist, liegt in einem schraffierten Schattenbereich, der nur für denjenigen, der ganz genau hinschaut, einen Namen erhält. Nur ein Sternchen ganz unten auf dem Plan verrät, wie dieses Außen heißt: ROW. Neben dem Plan lauter kleinere. Zum Beispiel einer von 1929, in dem alle Stadt- und Landgemeinden von Walsum über Buer, inclusive Lünen, Dortmund, Witten, Hattingen, Werden bis Homberg und Rheinhausen zum Stadtkreis Ruhrstadt zusammenkommen. Oder, noch früher, ein Generalsiedlungsplan von 1912, den einige Unternehmer voranbrachten. Bis, wie Priskilla Müller gerade erklärt, der Superunternehmer Fritz Thyssen himself sein Veto einlegte, da der Plan Arbeitersiedlungen dort vorsah, wo er sie auf keinen Fall wollte: in der Nähe von Schloss Landsberg, seiner Raubritterburg. Entwickelt worden war der Plan unter anderen von Robert Schmidt, ab 1920 Direktor des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk, kurz: SVR