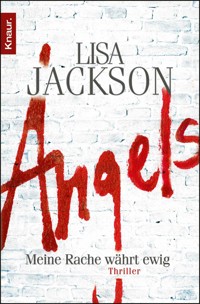
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Bentz und Montoya
- Sprache: Deutsch
Er fühlte sich leer. Hungrig. Voller Verlangen nach dem Kick des Tötens. Es gab keine Umkehr. Er wusste, welche er wollte. Sie hatte es verdient zu sterben. Als Kristi an ihr College in New Orleans zurückkehrt, ist ihr Vater, Detective Rick Bentz, beunruhigt. Vier Studentinnen sind dort spurlos verschwunden. Kristi, die unbedingt Kriminalschriftstellerin werden will, entdeckt eine Sekte, die sich einem mysteriösen Vampir-Kult verschrieben hat. Sie ermittelt auf eigene Faust. Doch bevor sie sich einen Eindruck von dieser dubiosen Gruppe verschaffen kann, ist sie auch schon in den tödlichen Fängen des Killers ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Lisa Jackson
Angels
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Kristi an ihr College in New Orleans zurückkehrt, ist ihr Vater, Detective Bentz, beunruhigt. Denn dort sind vier Studentinnen spurlos verschwunden. Kristi, die unbedingt Kriminalschriftstellerin werden will, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Als wieder eine Frau verschwindet, beschleicht sie eine fürchterliche Ahnung: Könnte es sein, dass der attraktive Professor Dominic Grotto Anführer eines mysteriösen satanischen Kults ist? Doch noch bevor sie sich einen Eindruck von der dubiosen Sekte machen kann, ist sie auch schon in den tödlichen Fängen eines perfiden Killers, der Kristi zum Herzstück seiner Jagd erkoren hat…
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Epilog
Anmerkung der Autorin
Dank
Prolog
All Saints College Baton Rouge in Louisiana Dezember
Wo bin ich?
Eisige Luft fegte über Rylees nackte Haut.
Sie bekam eine Gänsehaut.
Schaudernd blinzelte sie in die Dunkelheit, in den kalten leeren Raum, und versuchte, etwas zu erkennen. Gedämpftes rotes Licht in aufsteigendem Nebel. Sie lag halb auf einer Art Couch und fror.
O Gott, bin ich nackt?
Konnte das sein?
Auf keinen Fall!
Doch sie fühlte den weichen Samt an ihren Beinen, an den Pobacken und an den Schultern, die gegen die geschwungene Lehne der Ottomane drückten.
Stechende Angst durchzuckte sie.
Rylee gab sich alle Mühe, sich zu bewegen, aber ihre Arme und Beine gehorchten nicht. Sie konnte nicht einmal den Kopf drehen. Sie blickte nach oben an die Decke des merkwürdigen Raums mit seinem unheimlichen roten Licht.
Sie hörte ein leises Husten.
Was war das?
War sie etwa nicht allein?
Sie versuchte, in Richtung des Geräuschs zu blicken.
Vergeblich. Ihr Kopf prallte schwer gegen die Lehne der Ottomane.
Beweg dich, Rylee, steh auf und beweg dich! Noch ein Geräusch. Wie das Scharren eines Schuhs auf Beton. Raus hier, du musst hier raus! Das ist verdammt noch mal zu unheimlich!
Sie spitzte die Ohren. Sie glaubte, in der Dunkelheit ein leises Flüstern vernommen zu haben. Was zum Teufel war das?
Vor Angst zogen sich ihre Eingeweide zusammen. Warum konnte sie sich nicht bewegen? Was um alles in der Welt ging hier vor? Sie versuchte zu sprechen, aber sie brachte nicht ein einziges Wort hervor, als wären ihre Stimmbänder gelähmt. Voller Panik sah sie sich um und verdrehte unkontrolliert die Augen, doch ihr Kopf blieb reglos liegen.
Ihr Herz pochte heftig, und trotz der Kälte brach ihr der Schweiß aus.
Das war ein Traum, oder? Ein grauenhafter Albtraum, in dem sie, unfähig sich zu bewegen, auf einer Samtottomane lag – nackt. Die Ottomane war leicht erhöht positioniert, als stünde sie auf einer Bühne oder einer Art Podest.
Angst schnürte ihr die Kehle zu.
Panik durchflutete sie.
Denk dran: Das ist nur ein Traum. Du kannst nicht sprechen, du kannst dich nicht bewegen – alles typische Anzeichen eines Albtraums. Beruhige dich, komm wieder zu dir. Du wirst morgen früh aufwachen und …
Aber sie misstraute ihrer eigenen Wahrnehmung. Irgendetwas war hier faul. Noch nie hatte sie sich während eines Albtraums klarmachen müssen, dass sie offenbar träumte. Das Ganze wirkte so real, so greifbar.
Woran konnte sie sich erinnern … O Gott, war es letzte Nacht gewesen oder erst vor einigen Stunden? Sie war auf ein paar Drinks mit ihren neuen Freundinnen vom College unterwegs gewesen, dieser Gothic-Clique, diesen Vampir-Fans … nein … sie beharrten darauf, Vampyre zu sein. Sie wollten sich mit dieser Schreibweise von den der Fantasie entsprungenen Vampiren aus Büchern und Filmen unterscheiden und ihre Echtheit damit unterstreichen. Es hatte Geheimnistuereien gegeben, Mutproben und »blutrote Martinis«, die – darauf hatten die anderen beharrt – mit echtem Menschenblut gemixt worden waren. Es war eine Art Initiationsritus, einen solchen Martini zu trinken.
Rylee hatte sie nicht ernst genommen, aber sie wollte Teil ihrer Clique werden. Deshalb hatte sie die Herausforderung angenommen und einen blutroten Drink bestellt … und jetzt … jetzt war sie auf einem Trip. Sie hatten ihr irgendetwas in das Glas gemixt, kein Blut, sondern eine psychedelische Droge, die sie halluzinieren ließ – das war’s!
Dieses Aufnahmeritual – das sie für ziemlich lächerlich gehalten hatte – hatte eine unvorhergesehene, gefährliche Wendung genommen. Sie erinnerte sich vage daran, dass sie zugestimmt hatte, Teil der »Show« zu sein. Sie hatte künstliches Blut aus einem Martini-Glas getrunken, und ja, sie hatte diesen ganzen Vampirquatsch, den ihre neuen Freundinnen zelebrierten, cool gefunden. Aber sie hatte nichts von ihrem Gerede wirklich ernst genommen. Sie hatte geglaubt, sie würden ihr etwas vormachen, um zu sehen, wie weit sie ging …
Doch schon ein paar Minuten, nachdem sie das Glas geleert hatte, bekam sie ein seltsames Gefühl. Als wäre sie nicht nur betrunken, sondern völlig daneben. Zu spät wurde ihr klar, dass der Martini mit einer starken Droge versetzt gewesen war und sie kurz vor einem Zusammenbruch stand.
Sie war weg gewesen. Bis jetzt.
Wie viel Zeit war seitdem verstrichen?
Minuten?
Stunden?
Sie hatte keine Ahnung.
Ein Albtraum?
Ein Horrortrip?
Sie hoffte es. Denn wenn das hier die Realität war, lag sie wirklich auf einer Ottomane auf einem Podest, nackt und bewegungsunfähig. Es kam ihr vor, als spielte sie in einem unheimlichen, verworrenen Drama mit, das mit Sicherheit kein Happyend hatte.
Sie hörte erneut ein erwartungsvolles Flüstern.
Das rote Licht begann langsam und regelmäßig zu blinken, ganz anders als der schnelle Rhythmus ihres Herzschlags. Sie stellte sich Dutzende von Augenpaaren vor, die aus der Dunkelheit zu ihr heraufstarrten.
Sie biss die Zähne zusammen, fest entschlossen, sich zu bewegen – ohne Erfolg. Sie rührte sich kein bisschen.
Sie versuchte zu schreien, sich bemerkbar zu machen und zu verlangen, dass dieser Irrsinn aufhören solle, doch es kam nichts über ihre Lippen als ein Wimmern.
Konnte nicht jemand das Ganze hier beenden? Jemand aus dem Publikum? War es nicht offensichtlich, dass sie Angst hatte? Offensichtlich, dass dieser Scherz zu weit ging? Stumm flehte sie die unsichtbaren Zuschauer an. Plötzlich wurde die Bühne von ein paar Lichtern erhellt, die einen sanften, schummrigen Schein erzeugten. Er wurde von dem pulsierenden Rotlicht durchbrochen.
Nebelschwaden waberten über den Bühnenboden.
Ein erwartungsvolles Knistern schien durch das Publikum zu gehen. Was stand ihr bevor? War das nur ein Ritus? Oder kam etwas Schlimmeres auf sie zu, etwas unvorstellbar Schreckliches?
Sie war verloren.
Nein! Kämpf, Rylee, kämpf! Gib nicht auf! Gib auf keinen Fall auf!
Erneut bemühte sie sich mit ganzer Kraft, sich zu bewegen, und wieder gehorchten ihre Muskeln nicht. Nichts rührte sich.
Dann hörte sie ihn.
Ein eisiger Schauer durchfuhr sie, ihre Nackenhaare sträubten sich. Sofort wusste sie, dass sie nicht mehr allein auf der Bühne war. Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr. Die dunkle Silhouette eines großen, breitschultrigen Mannes kam durch den Nebel auf sie zu.
Ihr Herz krampfte sich vor Panik zusammen.
Sie starrte ihn an, sah, wie er langsam näher kam, und war vor Angst wie hypnotisiert. Das war er. Der Mann, über den die Vampyr-Fans getuschelt hatten.
Sie erwartete fast, dass er einen schwarzen, blutrot gefütterten Umhang trug und ein leichenblasses Gesicht mit glühenden Augen hatte. Wenn er die Lippen bleckte, kämen gleißende Vampirzähne zum Vorschein.
Aber das war nicht der Fall. Der Mann war zwar zum Teil schwarz gekleidet, aber er hatte keinen Umhang mit rotem Satinfutter und keine glühenden Augen. Er war schlank und wirkte athletisch. Und er war höllisch sexy. Eine Spiegelsonnenbrille, die auch an den Seiten geschlossen war, verdeckte seine Augen. Sein Haar, entweder dunkel oder nass, stieß auf den Kragen einer schwarzen Lederjacke. Seine Jeans war abgewetzt und saß tief auf der Hüfte. Er trug ein T-Shirt, das einmal schwarz gewesen war, und seine Schlangenlederstiefel waren abgetragen. Irgendetwas an ihm kam ihr bekannt vor, aber sie konnte sein Gesicht nicht einordnen.
In der Dunkelheit rings um die Bühne knisterte es vor gespannter Erwartung.
Wieder einmal dachte sie, es müsse sich um einen Albtraum oder eine Halluzination handeln.
Er blieb vor der Ottomane stehen. Das erwartungsvolle Zischen des Publikums übertönte das laute Hämmern ihres Herzens.
Er legte eine große, schwielige Hand über die Lehne, die sie voneinander trennte, und umfasste ihren Nacken, was ihre Nerven zum Beben und ihr Blut zum Kochen brachte. Die Angst wich kurz einer unerklärlichen Erregung. Seine Fingerspitzen drückten sanft gegen ihr Schlüsselbein. Ihr Puls raste.
Das unsichtbare Publikum wurde still.
»Das«, sagte er mit gebieterischer, aber leiser Stimme an die verborgenen Zuschauer gewandt, »ist eure Schwester.«
Ein Raunen ging durchs Publikum.
»Schwester Rylee.«
Das war sie, ja, aber … wovon sprach er eigentlich? Sie wollte ihn abschütteln, ihm sagen, dass alles anders war, als es aussah, dass ihre Brustwarzen allein von der Kälte aufgerichtet waren und nicht vor Erregung, dass das, was sich tief in ihrem Unterleib regte, keine körperliche Lust war.
Aber er wusste es besser.
Er konnte ihre Begierde spüren. Ihre Furcht riechen. Und er genoss es.
Tu das nicht, flehte sie stumm, doch ihr war klar, dass er ihre geweiteten Pupillen, ihren schnellen Atem und ihr Stöhnen eher als Lust und nicht als Angst interpretierte.
Seine starken Hände drückten entschlossener zu und brannten auf ihrer Haut.
»Schwester Rylee ist bereit, sich uns heute Nacht anzuschließen«, sagte er mit Überzeugung. »Sie wird das letzte, höchste Opfer bringen.«
Was für ein Opfer? Das klang gar nicht gut. Abermals versuchte Rylee, Einspruch zu erheben, zu entkommen, aber sie war wie gelähmt. Der einzige Teil ihres Körpers, der nicht völlig blockiert zu sein schien, war ihr Gehirn, und selbst das schien ihr einen Streich zu spielen.
Vertrau ihm, flüsterte es ihr zu. Du weißt, dass er dich liebt … Du spürst es … Wie lange hast du darauf gewartet, geliebt zu werden?
Nein, das war verrückt. Die Droge.
Dennoch verzehrte sie sich nach dem Druck seiner Hände, die ein wenig tiefer glitten und eine heiße Spur auf ihre Brüste zeichneten, immer näher zu ihren schon schmerzhaft harten Brustwarzen hin.
Ihr Unterleib prickelte. Schmerzte.
Irgendetwas stimmte nicht.
Er beugte sich näher zu ihr, drückte die Nase in ihr Haar. Seine Lippen streiften ihr Ohr, und er murmelte so leise, dass nur sie es hören konnte: »Ich liebe dich.« Sie schmolz dahin. Wollte ihn. Ihr Herz pochte vor Glück und Erregung. Seine Finger strichen fester über ihre Brust. Einen Augenblick lang vergaß sie, dass sie sich auf einer Bühne befand. Sie war allein mit ihm, und er berührte sie, liebte sie. Er wollte sie so, wie kein Mann sie je gewollt hatte. Und er …
Er drückte grob zu.
Ein kräftiger Finger bohrte sich in ihre Rippen.
Ein stechender Schmerz durchfuhr sie.
Ihre Augen weiteten sich.
Angst und Adrenalin jagten durch ihren Körper, ihr Herz machte wilde Sprünge.
Was hatte sie gedacht? Dass er sie verführen würde?
Nein!
Liebe? O nein, er liebte sie nicht! Rylee, fall nicht darauf rein. Tapp nicht in seine Falle.
Die verdammte Droge hatte ihr weisgemacht, dass er etwas für sie empfand, doch er – wer auch immer er war – brauchte sie nur für seine freakige Show.
Sie starrte ihn an, und er spürte ihre Wut.
Er lächelte, seine Zähne blitzten weiß.
Sie wusste, dass er ihren hilflosen Zorn genoss. Er spürte ihr rasendes Herz.
»In ihr fließt das reine Blut einer Jungfrau«, sagte er zu dem unsichtbaren Publikum.
Nein!
Ihr habt das falsche Mädchen erwischt! Ich bin keine –
Sie konzentrierte sich mit ganzer Kraft darauf zu sprechen, doch ihre Zunge weigerte sich nach wie vor, genau wie ihre Stimmbänder. Sie versuchte sich zu wehren, aber ihre Glieder blieben schlaff.
»Hab keine Angst«, flüsterte er.
Starr vor Schreck beobachtete sie, wie er sich vorbeugte, näher und näher kam. Sein Atem war heiß, seine Lippen verzogen sich und gaben seine Zähne frei.
Zwei strahlend weiße Vampirzähne blitzten auf, genau wie sie es sich vorgestellt hatte!
Bitte, lieber Gott. Bitte lass mich aufwachen!
Im nächsten Augenblick verspürte sie ein kaltes Stechen wie von einer Nadel. Seine Vampirzähne bohrten sich in ihre Haut und fanden mühelos ihre Venen.
Das Blut begann zu fließen …
1.
So weit, so gut, dachte Kristi Bentz und schleuderte ihr Lieblingskissen auf den Rücksitz des zehn Jahre alten Honda, ihr »neues« Auto mit fast hundertzwanzigtausend Kilometern auf dem Tacho. Das Kissen landete mit einem dumpfen Geräusch auf dem Rucksack, der Lampe, dem iPod, Büchern und anderen lebenswichtigen Dingen, die sie mit nach Baton Rouge nahm. Ihr Vater schaute zu, wie sie ihre Sachen ins Auto packte. Rick Bentz’ Ausdruck war frustriert, aber war das was Neues?
Zumindest lebte ihr Vater noch, zum Glück.
Sie warf noch einen raschen Blick zu ihm hinüber.
Seine Gesichtsfarbe wirkte gesund, mit den geröteten Wangen vom Wind, der durch die Zypressen und Kiefern rauschte. Vereinzelte Regentropfen glänzten auf seinem dunklen Haar. Sicher, es waren ein paar graue Strähnen zu sehen, und im letzten Jahr hatte er ein paar Pfund zugelegt, aber im Großen und Ganzen machte er einen vitalen Eindruck.
Es gab Zeiten, in denen das anders war. Zumindest für Kristi. Seit sie vor über anderthalb Jahren aus einem Koma erwacht war, hatte sie Visionen von ihm, erschreckende Bilder, die ihn als gespenstisches Abbild seiner selbst zeigten, die Haut grau, die Augen schwarze, undurchdringliche Löcher, seine Berührung kalt und klamm. Außerdem träumte sie oft von einer finsteren Nacht mit zuckenden Blitzen am dunklen Himmel. Einer der Blitze traf einen Baum, der mit einem lauten Knall zerbarst. Ihr Vater lag tot in einer Blutlache am Boden.
Unglücklicherweise hatte sie die Visionen häufiger als die Albträume, und zwar tagsüber. Sie sah die Farbe aus seinen Wangen weichen, sah seinen Körper bleich und grau werden. Sie wusste, dass er bald sterben würde. Sie hatte seinen Tod oft genug in ihren Albträumen erlebt und hatte die letzten anderthalb Jahre in dem Glauben verbracht, dass ihm genau das entsetzlich blutige Ende bevorstehen würde, das sie aus ihren Träumen kannte.
In den vergangenen achtzehn Monaten, in denen sie sich von ihren eigenen Verletzungen erholt hatte, war sie krank vor Sorge um ihn gewesen, aber heute, einen Tag nach Weihnachten, war Rick Bentz die Gesundheit in Person. Und er war genervt.
Widerwillig hatte er ihr geholfen, das Gepäck zum Wagen zu bringen. Draußen fegte der Wind durch die sumpfige Flusslandschaft, rüttelte an Ästen und Zweigen, wirbelte Blätter auf und brachte den Geruch von Regen und Morast mit sich. Sie war rückwärts in die pfützenübersäte Auffahrt zu dem kleinen Cottage gefahren, in dem ihr Vater mit seiner zweiten Frau lebte.
Olivia Benchet-Bentz tat Rick gut, daran bestand kein Zweifel. Trotzdem kamen Kristi und sie nicht wirklich gut miteinander zurecht. Während Kristi nun unter den missbilligenden Blicken ihres Vaters den Wagen belud, stand Olivia rund sechs Meter entfernt in der Haustür. Ihre glatte Stirn war gekräuselt, und sie sah besorgt aus, doch sie sagte nichts.
Gut.
Eins musste man ihr lassen: Olivia wusste, dass es besser war, sich nicht zwischen Vater und Tochter zu stellen, sie war klug genug, unliebsame Kommentare für sich zu behalten. Trotzdem ging sie diesmal nicht zurück ins Haus.
»Ich halte das einfach nicht für die beste Idee«, sagte ihr Vater. Kristi hatte ihm schon im September mitgeteilt, dass sie sich zum Wintersemester am All Saints College in Baton Rouge eingeschrieben hatte. Es war also keine große Überraschung mehr. »Du könntest bei uns bleiben und –«
»Ich kenne deine Meinung schon seit langem, und es reicht!«, sagte sie.
Warum gingen sie ständig aufeinander los? Selbst nach all dem, was sie durchgemacht hatten? Obwohl sie einander mehrere Male beinahe verloren hatten?
»Ich habe dir schon hundert Mal gesagt, dass ich hier nicht bleiben kann, Dad. Ich bin zu alt, um bei meinem Vater zu wohnen. Ich muss mein eigenes Leben führen.« Wie sollte sie ihm erklären, dass sie seinen Anblick nicht länger ertrug, es nicht länger aushielt, ihn in einer Minute gesund und munter zu sehen und in der nächsten grau und dem Sterben nahe? Sie war davon überzeugt gewesen, dass er sterben würde, und sie war bei ihm geblieben, bis sie sich von ihren eigenen Verletzungen erholt hatte. Aber zu sehen, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich, brachte sie langsam, aber sicher zu der Überzeugung, dass sie verrückt war. Bei aller Liebe: Hier zu bleiben würde die Lage allenfalls verschlechtern. Sie hatte diese Vision nun seit einer ganzen Weile nicht mehr gehabt, schon seit über einem Monat nicht, und das war gut. Sie hatte also die Zeichen möglicherweise falsch gedeutet. Trotzdem war es Zeit, ihr eigenes Leben weiterzuleben.
Sie tastete in ihrer Tasche nach dem Autoschlüssel. Kein Grund, sich noch länger mit ihm zu streiten.
»Okay, okay, du verlässt uns. Ich hab’s kapiert.« Er zog ein missmutiges Gesicht. Wolken jagten über den Himmel, machten jede Chance, dass die Sonne herauskommen würde, zunichte.
»Du hast es kapiert? Tatsächlich? Nachdem ich es dir etwa eine Million Mal erklärt habe?«, spöttelte Kristi, doch sie lächelte dabei. »Du ziehst ja messerscharfe Schlüsse. Genau wie die Zeitungen behaupten: der heldenhafte Detective Rick Bentz vom New Orleans Police Department.«
»Die Zeitungen wissen einen Dreck.«
»Eine weitere scharfsinnige Beobachtung des hiesigen Spitzenermittlers.«
»Lass mich in Ruhe«, murmelte er, aber einer seiner verkniffenen Mundwinkel verzog sich zu der Andeutung eines Lächelns. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und blickte in Olivias Richtung, zu der Frau, die sein Fels in der Brandung geworden war. »Mein Gott, Kristi«, sagte er. »Du bist vielleicht ein harter Brocken.«
»Das ist Veranlagung.« Sie fand den Schlüssel.
Seine Augen wurden schmal, sein Kiefer verkrampfte sich.
Es war klar, woran er dachte, aber keiner von ihnen erwähnte die Tatsache, dass er nicht ihr biologischer Vater war. »Du musst vor nichts davonlaufen.«
»Ich laufe nicht davon. Vor gar nichts. Aber ich laufe zu etwas hin. Zu dem, was sich ›der Rest meines Lebens‹ nennt.«
»Du könntest –«
»Ich möchte das nicht hören, Daddy«, unterbrach ihn Kristi und warf ihre Handtasche auf den Beifahrersitz, wo sich schon drei Taschen voller Bücher, DVDs und CDs befanden. »Du wusstest seit Monaten, dass ich wieder aufs College gehe, es gibt also keinen Grund, mir jetzt deswegen eine Szene zu machen. Ich bin erwachsen, und ich gehe nach Baton Rouge, an meine alte Alma Mater. Das All Saints College ist nicht am anderen Ende der Welt, sondern keine zwei Stunden entfernt.«
»Es geht nicht um die Entfernung.«
»Ich muss das tun.« Sie blickte jetzt ebenfalls in Olivias Richtung, in deren unbändigem blonden Haar sich die bunten Lichter des Weihnachtsbaums reflektierten. Das kleine Häuschen wirkte warm und gemütlich, aber es war nicht Kristis Zuhause. Es war nie ihr Zuhause gewesen. Olivia war ihre Stiefmutter, und obwohl sie miteinander ausgekommen waren, hatten sie sich einander nie wirklich nahe gefühlt. Hier fand das Leben ihres Vaters statt, und es hatte nicht viel mit Kristi zu tun.
»Es hat am All Saints College Ärger gegeben. Ein paar Studentinnen werden vermisst.«
»Du hast das bereits überprüft?«, fragte sie aufgebracht.
»Ich habe lediglich etwas von vermissten Mädchen gelesen.«
»Du meinst Ausreißerinnen?«
»Ich meine vermisst.«
»Keine Sorge«, sagte sie schnippisch. Auch sie hatte gehört, dass ein paar Studentinnen überraschend vom Campus verschwunden waren, aber es schien nichts Verdächtiges dahinterzustecken. »Mädchen pflegen nun mal das College und ihre Eltern zu verlassen.«
»Tatsächlich?«, fragte er.
Ein kalter Windstoß fuhr über die sumpfige Landschaft, ließ nasse Blätter durch die Luft fliegen und drang durch Kristis Kapuzenshirt. Der Regen hatte für einen Moment nachgelassen, aber der Himmel war grau und wolkenverhangen, der rissige Betonboden voller Pfützen.
»Es ist nicht so, dass ich dagegen bin, dass du aufs College zurückgehst«, sagte Rick Bentz und lehnte sich mit der Hüfte gegen den Wagen. »Aber diese Idee, Krimiautorin werden zu wollen …«
Kristi hob abwehrend die Hand, rückte ein paar Sachen auf dem Rücksitz zurecht und versuchte, sie so flach zu verteilen, dass sie in den Rückspiegel blicken konnte. »Ich weiß, wie du dazu stehst. Du willst nicht, dass ich über irgendwelche Fälle schreibe, die du bearbeitet hast. Keine Sorge. Ich habe nicht die Absicht, deinen heiligen Boden zu betreten.«
»Darum geht es nicht, das weißt du genau«, widersprach ihr Vater. Ein Anflug von Zorn blitzte in seinen tiefliegenden Augen auf.
Na schön. Sollte er ruhig toben. Sie war genauso verärgert. In den letzten Wochen waren sie einander wirklich auf die Nerven gegangen.
»Ich bin nur um deine Sicherheit besorgt.«
»Nun, das ist nicht nötig, okay?«
»Schließlich bist du schon einmal zur Zielscheibe geworden.« Er begegnete ihrem Blick, und sie wusste, dass er jede einzelne schreckliche Sekunde ihrer Entführung erneut durchlebte.
»Es geht mir gut.« Sie entspannte sich ein wenig. Obwohl er oft genug eine große Nervensäge war, war er doch ein guter Kerl und lediglich um sie besorgt. Wie immer. Aber genau das brauchte sie nicht.
Mit Mühe unterdrückte sie ihre Ungeduld. Hairy S., der kleine Kläffer ihrer Stiefmutter, schoss aus der Haustür und jagte ein Eichhörnchen eine Kiefer hinauf. Wie ein rot-grauer Blitz kletterte das Eichhörnchen den rauhen Stamm hinauf und ließ sich auf einem schaukelnden Ast nieder, von dem aus es höhnisch keckernd den frustrierten Terriermischling beäugte. Hairy S. buddelte winselnd unten am Stamm und umrundete ihn anschließend mehrfach.
»Schsch … nächstes Mal fängst du es«, sagte Kristi und nahm ihn hoch. Nasse Pfoten fuhren über ihr Sweatshirt, und sie spürte Hairys Zunge auf ihrer Wange. »Ich werde dich vermissen«, sagte sie zu dem Hund, der mit den Beinen ruderte, um wieder auf den Boden zu kommen und seine Jagd fortsetzen zu können. Sie setzte ihn ins Gras und zuckte leicht zusammen, als sie einen Schmerz im Nacken verspürte.
»Hairy! Komm her!«, befahl Olivia, aber der Terrier ignorierte sie.
»Du bist noch nicht völlig wiederhergestellt«, sagte Rick.
Kristi seufzte laut. »Sieh mal, Dad, sämtliche Spezialisten sagen, dass alles in Ordnung ist. Besser als je zuvor, okay? Seltsam, was so ein kurzer Krankenhausaufenthalt, ein bisschen Physiotherapie und ein paar Stunden bei einem Seelenklempner plus ein knappes Jahr intensives Personal Training alles bewirken können.«
Er schnaubte. Eine Krähe flatterte auf sie zu und ließ sich auf den nackten Zweigen einer Magnolie nieder, als wollte sie seine Sorge bestätigen. Sie stieß einen einsamen, höhnischen Schrei aus.
»Du warst ziemlich neben dir, als du im Krankenhaus aufgewacht bist«, erinnerte er sie.
»Das ist Schnee von gestern, verdammt noch mal!« Und das stimmte. Seit ihrem Aufenthalt auf der Intensivstation hatte sich die Welt verändert. Hurrikan Katrina hatte New Orleans auseinandergenommen, war dann die gesamte Golfküste entlanggefegt und hatte eine bleibende Spur der Verwüstung und Verzweiflung hinterlassen. Obwohl Katrina vor über einem Jahr über den Golf hereingebrochen war, waren die Nachwirkungen ihrer Wucht noch überall sichtbar und würden vermutlich noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zu spüren sein. Es hieß, New Orleans würde nie mehr so werden wie zuvor. Kristi wollte gar nicht darüber nachdenken.
Ihr Vater war überarbeitet. Okay, das hatte sie verstanden. Die gesamte Belegschaft des New Orleans Police Department war bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit strapaziert worden, genau wie die Stadt selbst und ihre geplagten Bewohner, von denen einige im Zuge der Evakuierung quer durchs Land geschickt worden und einfach nicht zurückgekehrt waren. Wen wunderte es, wenn sämtliche Krankenhäuser, städtischen Einrichtungen und Transportsysteme ein einziges Chaos waren? Natürlich kam alles wieder in Gang, aber langsam und nicht überall gleichzeitig. Glücklicherweise wagten sich die Touristen inzwischen wieder ins French Quarter, ein Viertel, das für das alte New Orleans stand und das den Hurrikan nahezu unversehrt überstanden hatte.
Kristi hatte die vergangenen sechs Monate damit verbracht, als Ehrenamtliche in einem der Krankenhäuser mitzuarbeiten und ihrem Vater auf der Polizeistation zu helfen. An den Wochenenden hatte sie die Aufräumarbeiten in der Stadt unterstützt, aber jetzt hatte sie das Gefühl – was ihr Psychotherapeut unterstützte –, endlich ihr eigenes Leben weiterführen zu müssen. Langsam, aber sicher fand die Stadt wieder zu sich selbst zurück, und es wurde Zeit, darüber nachzudenken, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte.
Wie gewöhnlich war Detective Bentz damit nicht einverstanden. Nach dem Hurrikan war er sofort in seine Rolle als Übervater zurückgefallen. Kristi passte das ganz und gar nicht. Schließlich war sie kein Kind und auch kein Teenager mehr. Sie war verdammt noch mal erwachsen!
»Ich muss los.« Sie blickte auf die Uhr. »Ich habe der Vermieterin gesagt, dass ich heute einziehe. Ich rufe an, wenn ich da bin, und erstatte dir einen vollständigen Bericht. Hab dich lieb.«
Rick schien erneut mit ihr streiten zu wollen, doch dann sagte er nur schroff: »Ich dich auch, Kleine.«
Sie umarmte ihn, spürte den Druck seiner Arme und war überrascht darüber, dass sie plötzlich mit den Tränen kämpfte. Sie löste sich von ihm. Wie albern! Sie warf Olivia eine Kusshand zu, dann setzte sie sich hinters Lenkrad und ließ den Motor an. Mit einem Kloß im Hals fuhr Kristi das Auto aus der langen Auffahrt.
Auf der nassen Landstraße wendete sie und warf einen letzten Blick auf ihren Vater, der den Arm zum Abschied erhoben hatte, dann atmete sie tief aus und fühlte sich plötzlich frei. Endlich hatte sie es geschafft. Endlich war sie wieder auf sich gestellt. Doch als sie den Gang einlegte, verdunkelte sich der Himmel, und im Seitenspiegel erschien das Bild ihres Vater.
Wieder einmal war alle Farbe aus seinem Gesicht gewichen, und er sah aus wie ein Geist in Schwarz, Weiß und Grau. Ihr stockte der Atem. Sie konnte noch so weit davonlaufen, der Vision von seinem Tod würde sie nicht entkommen.
Das zumindest stand fest.
Und auch, dass es bald so weit sein würde.
Jay McKnight lauschte einer alten Johnny-Cash-Ballade und starrte durch die Windschutzscheibe seines Pick-up nach draußen in den Nieselregen. Mit rund achtzig Stundenkilometern kurvte er durch den tosenden Sturm, zusammen mit seinem halbblinden Hund, der neben ihm auf dem Beifahrersitz kauerte, und fragte sich, ob er dabei war, den Verstand zu verlieren.
Warum hätte er sonst zugestimmt, ein Abendseminar für die Freundin eines Freundes zu übernehmen, die gerade ein Sabbatical nahm und sich ein Jahr lang ihren Forschungen widmen wollte? Was schuldete er Dr. Althea Monroe? Nichts. Er war der Frau ja kaum begegnet.
Vielleicht machst du das für dein eigenes geistiges Wohlbefinden. Du kannst eine Chance verdammt gut gebrauchen. Und überhaupt: Was soll ein Seminar über Forensik und Kriminologie für wissensdurstige junge Köpfe schon schaden?
Er schaltete einen Gang zurück, lenkte seinen Pick-up von der Hauptstraße in die vertrauten Seitenstraßen, wo der Regen durch die kahlen Zweige der Bäume prasselte und gerade die Straßenlaternen angingen. Wasser spritzte unter seinen Reifen auf, und nur wenige Fußgänger trotzten dem Sturm. Jay hatte das Fenster einen Spalt heruntergekurbelt, und Bruno, eine Mischung aus Pitbull, Labrador und Bloodhound, presste seine große Nase an die schmale Ritze.
Als sie die Stadtgrenze von Baton Rouge passierten, ging Jay vom Gas. Die Stimme von Johnny Cash hallte in der Fahrerkabine des Toyota wider.
»My momma told me, son …«
Jay bog in die holperige Einfahrt eines Hauses. Es war ein winziger Bungalow mit zwei Zimmern, der einst seiner Tante gehört hatte.
»… don’t ever play with guns …«
Er schaltete das Radio aus und stellte den Motor ab. Der Bungalow, ein Teil von Tante Colleens Nachlass, war von seinen dauernd miteinander streitenden Cousinen Janice und Leah zum Verkauf angeboten worden. Die Schwestern hatten ihm erlaubt, so lange dort abzusteigen. Im Gegenzug sollte er ein paar kleinere Reparaturen durchführen, zu denen Janice’ nichtsnutziger Möchtegern-Rockstar-Gatte nicht in der Lage war.
Mit gerunzelter Stirn griff Jay nach dem Matchbeutel und dem Notebook und sprang aus dem Wagen. Dann ließ er den Hund hinaus und wartete. Bruno schnupperte und hob sein Bein an einer der Lebenseichen im Vorgarten. Jay schloss den Toyota ab, klappte den Kragen hoch, um sich vor dem Regen zu schützen, und eilte über das unkrautüberwucherte Pflaster in Richtung Haustür, die in der hereinbrechenden Dunkelheit von einer Außenlampe erleuchtet wurde. Der Hund folgte ihm auf den Fersen, wie immer, seit Jay ihn vor sechs Jahren angeschafft hatte – der einzige Welpe eines Sechserwurfs, den niemand wollte. Die Mutter war die Hündin seines Bruders gewesen, ein reinrassiges Bloodhound-Weibchen, die, als sie heiß war, nicht erst auf ein ebenfalls reinrassiges Bloodhound-Männchen gewartet hatte. Stattdessen hatte sie sich kurzerhand einen Weg aus dem Zwinger gebuddelt und sich mit dem netten Köter einen halben Kilometer die Straße runter zusammengetan. Das Resultat war ein Wurf Welpen, der keinen einzigen Cent wert war. Die Hunde entpuppten sich aber alle als treue Gefährten. Vor allem Bruno mit seiner ausgezeichneten Nase und seinen schlechten Augen. Jay bückte sich und tätschelte den Hund, der seinen Kopf liebevoll gegen Jays Hand drückte. »Na komm, dann lass uns den Schaden mal ansehen.«
»Folsom Prison Blues« hallte in seinem Kopf wider, als er die Haustür aufschloss und mit der Schulter dagegendrückte.
Das Haus roch muffig. Unbewohnt. Die Luft abgestanden. Trotz des starken Regens öffnete er zwei Fenster. Die letzten drei Wochenenden hatte er hier verbracht, die Zimmer gestrichen, die Fliesen in der Küche und dem einzigen Badezimmer neu verfugt und die Terrasse von Schmutz und Schutt befreit. Nun standen Terrakottakübel voller Pflanzen auf den frisch gestrichenen Holzdielen – statt einer verrosteten Waschmaschine, in der er auf ein leeres Hornissennest gestoßen war.
Trotzdem war er noch lange nicht fertig. Es würde Monate dauern, um das Haus in Schuss zu bringen. Jay stellte seine Taschen in dem kleinen Schlafzimmer ab und ging in die Küche. Ein uralter Kühlschrank brummte auf dem brüchigen Linoleum, das er noch ersetzen musste. Im Kühlschrank lag neben etwas vertrocknetem Käse ein Sixpack Lone-Star-Bier, von dem nur noch eine Flasche übrig war. Er zog sie an ihrem langen Hals heraus. Es war seltsam, dachte er, dass ausgerechnet Baton Rouge sein Hafen außerhalb von New Orleans geworden war, die Stadt, in der er aufgewachsen war und gearbeitet hatte.
Waren es die Nachwirkungen von Katrina, die ihm den Lebenssaft entzogen hatten? Das kriminaltechnische Labor in der Tulane Avenue war von dem Sturm zerstört und die Arbeit, die dort geleistet worden war, sowohl auf verschiedene Gemeinden und private Unternehmen als auch auf das kriminaltechnische Labor der Louisiana State Police in Baton Rouge verteilt worden. Mitunter arbeiteten sie in Trailern, die die Federal Emergency Management Agency, die nationale Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten für Katastrophenhilfe – kurz FEMA –, zur Verfügung gestellt hatte. Es war ein Albtraum gewesen: die Überstunden, der Frust über die verlorengegangenen Beweismittel. Und erst die Zeit, die er als Freiwilliger damit verbrachte, den Sturmopfern zu helfen und die Aufräumarbeiten nach der Überflutung zu übernehmen! Er bezweifelte, dass es unter den Polizeibeamten jemanden gab, der nicht an Kündigung gedacht hatte. Viele hatten tatsächlich den Dienst quittiert und so für eine Unterbesetzung gesorgt, obwohl eher mehr engagierte Officers gebraucht wurden als weniger.
Jay verurteilte niemanden dafür. Viele Officers mussten selbst mit dem Verlust ihres Hauses und ihrer Familie fertig werden.
Auch er hatte eine Veränderung gebraucht. Es waren nicht nur die horrenden Überstunden gewesen, die er geschoben hatte. Den Schrecken des Hurrikans mitzuerleben, mit anzusehen, wie die Stadt darum kämpfte, wieder auf die Beine zu kommen, während die FBI-Agenten gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigten, war schlimm genug gewesen. Doch zu wissen, dass so viel mühsam über die Jahre zusammengetragenes Beweismaterial im wahrsten Sinne des Wortes hinweggespült worden war, hatte zentnerschwer auf ihm gelastet. So eine Verschwendung. So ein Aufwand, die Dinge wiederzubeschaffen.
Mit dreißig war er bereits ausgebrannt.
Und irgendetwas hatte ihn zu dieser Reise nach Baton Rouge geführt.
Waren es die Plünderer gewesen, die verzweifelt oder kriminell genug waren, um ihren Vorteil aus der Tragödie zu ziehen?
Die Opfer, die in ihren eigenen Häusern oder in Pflegeheimen in der Falle gesessen hatten?
Die zögerliche Unterstützung durch die Regierung?
Der um ein Haar erfolgte Untergang seiner geliebten Stadt?
Oder lag es daran, dass sein eigenes Zuhause dem tosenden Wind und der hereinbrechenden Flut nicht standgehalten hatte und mitsamt seinem ganzen Besitz vollständig zerstört worden war?
Konnte er die Katastrophe für seine gescheiterte Affäre mit Gayle verantwortlich machen? War er schuld daran, dass ihre Beziehung zerbrochen war?
Jay stellte dem Hund in einem alten Topf frisches Wasser hin, dann öffnete er sein Bier. Er nahm einen kräftigen Schluck aus der Flasche und starrte durch das schmutzige, regennasse Fenster in den Garten. Eine Fledermaus schoss durch die Äste einer Magnolie. Die Dunkelheit senkte sich zusehends herab und erinnerte ihn daran, dass er noch Arbeit zu erledigen hatte.
Er drehte vorsichtig den Kopf hin und her und hörte seine Wirbel knacken. Dann ging er hinüber ins zweite Zimmer, das noch in einem furchtbaren Rosaton gestrichen war. Dort hatte er einen Schreibtisch, eine Lampe und einen kleinen Aktenschrank aufgestellt. Ein Hundekorb stand in der Ecke. Bruno, der einen alten, halb zerkauten Knochen aus Rohleder gefunden hatte, begann heftig mit den Zähnen daran zu arbeiten. Jay nahm noch einen Schluck Bier, dann stellte er die Flasche ab. Er öffnete sein Notebook und drückte den Einschaltknopf. Mit einem Summen startete der PC. Sekunden später rief Jay seine E-Mails ab.
Zwischen Spam und Mails von Kollegen und Freunden entdeckte er eine Nachricht von Gayle. Sein Magen zog sich zusammen, als er sie mit einem Klick öffnete und die knappen, scherzhaft gemeinten Worte überflog. Er konnte nichts Lustiges daran finden, was ihn nicht weiter überraschte. Sie hatten sich darauf geeinigt, Freunde zu bleiben, aber wer führte hier wen an der Nase herum? Es funktionierte nicht. Ihre Beziehung war beendet. War schon lange vor Katrina am Ende gewesen.
Er antwortete nicht auf die E-Mail, denn das war genauso überflüssig wie der Diamantring, der in seiner Büroschublade in New Orleans lag. Bei dem Gedanken daran wurden seine Lippen schmal. Was Ringe betraf, hatte er nicht viel Glück. Vor Jahren hatte er seiner Angebeteten auf der Highschool eine Art Freundschaftsring geschenkt. Doch Kristi Bentz hatte sich gleich nach ihrem Wechsel aufs All Saints College mit einem Teaching Assistant zusammengetan. Was für eine Ironie! Als er Jahre später Gayle einen Ring überreichte, nahm sie ihn an und begann, ihr Leben mit Jay – sein Leben – zu planen, bis er schließlich das Gefühl hatte, eine Schlinge um den Hals zu haben, die sich jeden Tag ein bisschen fester zusammenzog, so dass er kaum noch Luft zum Atmen hatte. Seine Haltung hatte Gayle mächtig gewurmt, und sie war immer besitzergreifender geworden. Sie hatte ihn ständig angerufen, war auf seine Freunde eifersüchtig gewesen, auf seine Kollegen, sogar auf seine verdammte Karriere. Und sie hatte ihn nie vergessen lassen, dass er eigentlich einmal Kristi Bentz hatte heiraten wollen. Gayle war der festen Überzeugung gewesen, er habe nie aufgehört, sich nach seiner Highschool-Liebe zu verzehren.
Was einfach unglaublich dämlich war.
Und so hatte er sie also gebeten, ihm den Ring zurückzugeben.
Sie hatte ihm den Diamanten an die Stirn geworfen, wo er seine Haut aufritzte und eine kleine Narbe über seiner linken Augenbraue hinterließ – ein Beweis für Gayles Jähzorn.
Jay war sicher, dass er einem weitaus größeren Geschoss hätte ausweichen müssen, wenn er erst die Hochzeit abgeblasen hätte.
So viel zu wahrer Liebe.
Er griff nach der Fernbedienung für den kleinen Fernseher auf dem Aktenschrank und ging weiter seine E-Mails durch, wobei er mit einem Ohr die Nachrichten verfolgte und auf die Sportnachrichten mit dem jüngsten Tabellenstand der New Orleans Saints wartete.
»… seit der Vorweihnachtszeit vom Campus des All Saints College verschwunden. Die Studentin wurde zuletzt am achtzehnten Dezember gegen sechzehn Uhr dreißig von ihrer Mitbewohnerin hier, in Cramer Hall, gesehen«, vernahm er die Stimme des Nachrichtensprechers.
Jay richtete seine Aufmerksamkeit auf den Fernsehschirm, auf dem eine Reporterin in einem blauen Parka bei Sturm und Regen in die Kamera blickte. Der Beitrag war vor dem Backsteingebäude aufgenommen worden, in dem Kristi Bentz vor Jahren während ihrer ersten Zeit am College gewohnt hatte. Vor seinem inneren Auge erschien ein Bild von Kristi, wie sie damals ausgesehen hatte: lange, kastanienrote Haare, ein durchtrainierter Körper und tiefliegende, intelligente Augen. Er war verrückt nach ihr gewesen und sicher, dass sie die Frau fürs Leben war. Natürlich hatte er längst erkannt, wie falsch er damals damit gelegen hatte. Zum Glück hatte sie ihre Beziehung beendet und ihm eine Ehe erspart, die für sie beide eine Falle gewesen wäre.
»Seit jenem Tag, eine Woche vor Weihnachten«, fuhr die Reporterin fort, »ist Rylee Ames nicht mehr lebend gesehen worden.« Das Foto einer jungen Frau Anfang zwanzig erschien auf dem Bildschirm. Mit ihren blauen Augen, den blonden Strähnchen und dem breiten Lächeln sah Rylee Ames aus wie eine typische Cheerleaderin aus Kalifornien, obgleich die Reporterin sagte, dass sie die Highschool in Tempe, Arizona, und in Laredo im Bundesstaat Texas besucht hatte.
»Aus Baton Rouge Belinda Del Rey für WMTA.«
Rylee Ames. Der Name kam ihm bekannt vor.
Beunruhigt loggte sich Jay auf der Website des All Saints College ein und rief die Teilnehmerliste seines künftigen Seminars auf. Auf der waren nun auch die Namen jener Studenten vermerkt, die später dazugekommen waren. Der erste Name auf der Liste war Ames, Rylee. Dieser Name hatte auch bei seinem letzten Besuch der Website schon auf der Teilnehmerliste gestanden.
Jays Cop-Radar geriet in höchste Alarmbereitschaft, und er musste erst mal eine Stufe runterschalten, um nicht von einem Horrorszenario zum nächsten zu schwenken. Vergewaltigung, Folter, Mord – er hatte so viele grausame Verbrechen gesehen, aber er versuchte, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Noch nicht. Es gab keinen Hinweis darauf, dass ihr etwas zugestoßen war, sie war lediglich verschwunden.
Es kam durchaus vor, dass junge Frauen in ihrem Alter das College abbrachen, wechselten oder, ohne ein Wort darüber zu verlieren, in den Skiurlaub oder zu einem Rockkonzert fuhren. Sie konnte also einfach abgehauen sein.
Doch vielleicht auch nicht. Er hatte lange genug am kriminaltechnischen Labor in New Orleans gearbeitet, um ein mulmiges Gefühl wegen dieser Studentin, der er nie begegnet war, zu verspüren. Er nahm einen Schluck Bier und ging die Liste weiter durch.
Arnette, Jordan.
Bailey, Wister.
Braddock, Ira.
Bentz, Kristi.
Calloway, Hiram.
Crenshaw, Geoffrey.
Moment mal. Wie bitte?
Bentz, Kristi?
Mit zusammengekniffenen Augen blickte er auf den Monitor und starrte den vertrauten Namen an, der sein Herz noch immer schneller schlagen ließ.
Das musste ein Irrtum sein!
Kristi Bentz konnte nicht in seinem Seminar sein. Aber da stand ihr Name, groß und deutlich. Was für eine grausame Ironie des Schicksals war das denn? Es war sehr unwahrscheinlich, dass es sich um eine andere Studentin mit demselben Namen handelte. Deshalb blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit der Tatsache abzufinden, dass er sie von nun an jeden Montagabend für drei Stunden wiedersehen würde.
Mist!
Der Regen trommelte gegen die Fensterscheibe, während er noch immer wie gebannt auf die Seminarliste starrte. Bilder von Kristi schwirrten durch seinen Kopf: Kristi, wie sie in einem Wald vor ihm davonlief, ihr langes Haar, das hinter ihr herwehte, das Spiel von Licht und Schatten der belaubten Äste auf ihrem Körper, ihr ansteckendes Lachen … Kristi, wie sie aus einem Swimmingpool stieg, das Wasser, das von ihrem sanft gebräunten Körper perlte, ihr triumphierendes Lächeln, wenn sie den Wettkampf gewonnen hatte, ihr finsteres Stirnrunzeln, wenn sie verloren hatte … Kristi, wie sie neben ihm auf einer Decke auf der Ladefläche seines Pick-up lag und das Mondlicht auf ihrem makellosen Körper schimmerte.
»Hör damit auf!«, sagte er laut, und der stets wachsame Bruno war im selben Augenblick auf den Füßen und bellte grimmig. »Nein, mein Junge, es ist … nichts.« Jay verbannte die Bilder seiner Jugendliebe aus seinem Kopf. Er hatte Kristi seit über fünf Jahren nicht mehr gesehen und ging davon aus, dass sie sich verändert hatte. Neben all seinen romantischen Erinnerungen gab es auch noch andere, und die waren nicht ganz so nett. Kristi hatte Temperament und eine messerscharfe Zunge.
Er hatte geglaubt, dass er über sie hinweg war, doch in Wahrheit war es ihm nahegegangen, als er von ihrer Begegnung mit dem Tod hörte, als er erfuhr, dass sie Psychopathen in die Hände gefallen war und Ewigkeiten im Krankenhaus verbracht hatte, um sich von den Übergriffen zu erholen. Es war ihm so nahegegangen, dass er sogar einen Floristen angerufen hatte, der ihr Blumen bringen sollte, doch dann hatte er seine Meinung geändert. Kristi war wie eine schlechte Angewohnheit, eine Angewohnheit, die man nicht so schnell abschütteln konnte. Es ging Jay so lange gut, wie er nichts von ihr hörte, nichts über sie las oder ihr nicht begegnete. Sämtliche alten Emotionen waren sorgfältig unter Verschluss. Er hatte sich für andere Frauen interessiert. Er war sogar verlobt gewesen. Trotzdem, sie nun Woche für Woche sehen zu müssen …
Es würde ihm vielleicht guttun, entschied er plötzlich. »Das dient dazu, deinen Charakter zu bilden«, hatte seine Mutter immer gesagt, wenn er in Schwierigkeiten geraten war und seine Strafe entgegennahm, für gewöhnlich aus den Händen seines Vaters.
»Zur Hölle«, murmelte Jay, als er die wahre Bedeutung dessen, was ihm bevorstand, erfasste. Mit gerunzelter Stirn gab er sich für einen kurzen Moment der Vorstellung hin, wie er Kristi unterrichtete, wie er sie prüfte und benotete, wie sie von ihm abhängig war. O Gott! Was dachte er da nur!
Er spülte sein Bier hinunter und knallte die leere Flasche auf den Schreibtisch. Er hatte doch nicht seinen verdammten Arbeitsplan geändert, damit begonnen, Zehn-Stunden-Schichten zu schieben, und mühsam sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, nur um jede Woche Kristi gegenüberstehen zu müssen! Er presste den Kiefer so fest zusammen, dass es schmerzte.
Vielleicht würde sie das Seminar wieder verlassen. Bestimmt würde Kristi ihren Stundenplan ändern, wenn sie feststellte, dass er für Dr. Monroe einsprang. Zweifelsohne würde sie genauso ungern mit ihm zu tun haben wollen wie er mit ihr. Was für eine Vorstellung, er als ihr Dozent!
Er ging den Rest der Liste mit den fünfunddreißig Studenten durch, die sich für Kriminologie interessierten – jetzt nur noch vierunddreißig. Sein Blick heftete sich wieder auf den obersten Namen: Rylee Adams. Verwirrt kratzte Jay die Bartstoppeln auf seinem Kinn.
Was zum Teufel war mit ihr passiert?
2.
Keine laute Musik, keine Haustiere, keine Zigaretten – steht alles hier im Mietvertrag«, sagte Irene Calloway, obwohl sie selbst verdächtig nach Zigarettenqualm roch. Irene war Anfang siebzig und in ihrer ausgeblichenen Baggy Jeans und dem XXL-T-Shirt dünn wie ein Streichholz. Ein paar kurze graue Haarsträhnen lugten unter ihrer roten Baskenmütze hervor. Sie blickte Kristi durch dicke Brillengläser an. Sie saßen an einem kleinen alten Tisch in dem möblierten Ein-Zimmer-Apartment im zweiten Stock. Das Apartment mit den Mansardenfenstern, dem alten Kamin, den Holzdielen und den schlierigen Scheiben hatte etwas Besonderes. Es war gemütlich und ruhig, und Kristi konnte ihr Glück kaum fassen, eine solche Unterkunft gefunden zu haben. Irene tippte mit einem knochigen Finger auf das Kleingedruckte des Mietvertrags.
»Ich habe alles zur Kenntnis genommen«, versicherte Kristi, obwohl die Kopie, die sie ihr gefaxt hatte, unleserlich gewesen war. Ohne weitere Zeit zu verschwenden, unterschrieb sie beide Ausführungen des Vertrags und reichte eine davon ihrer neuen Vermieterin.
»Sie sind nicht verheiratet?«
»Nein.«
»Keine Kinder?«
Etwas ungehalten schüttelte Kristi den Kopf. Irenes Fragen waren ihr zu persönlich.
»Kein Freund? Im Mietvertrag ist nur eine Person für das Apartment vorgesehen.« Sie machte eine ausholende Handbewegung, die den kleinen Raum umfasste, welcher einst ein Dachboden, vielleicht ein Dienstbotenquartier gewesen war.
»Was ist, wenn ich mich dazu entschließe, einen Mitbewohner bei mir aufzunehmen?«, fragte Kristi, obwohl sich dieser Mitbewohner – wer auch immer es sein sollte – mit einem durchgesessenen Zweisitzer oder einer Luftmatratze würde begnügen müssen.
Irenes Lippen wurden schmal. »Dann muss der Mietvertrag neu aufgesetzt werden. Außerdem möchte ich jeden zukünftigen Mieter überprüfen, und es muss eine zusätzliche Kaution hinterlegt werden. Untermiete ist nicht erlaubt. Verstanden?«
»Im Moment werde nur ich hier wohnen«, sagte Kristi, bemüht, ihre Zunge im Zaum zu halten. Sie brauchte dieses Apartment. Es war schwer, während des Semesters eine Unterkunft zu finden, vor allem eine in der Nähe des Campus. Sie war zufällig im Internet darauf gestoßen. Die kleine Wohnung hatte zu den wenigen gehört, die sie sich leisten konnte und die zu Fuß vom College zu erreichen waren. Und was einen Mitbewohner anging: Kristi wohnte lieber allein, aber unter Umständen würde ihr Budget sie dazu zwingen, sich die Miete und die Nebenkosten mit jemandem zu teilen.
»Gut. Ich habe keine Zeit für Geschwätz.«
Kristi erwiderte nichts. Aber die ältere Frau fing an, ihr auf die Nerven zu gehen.
»Keine weiteren Fragen?« Irene faltete ihre Kopie des Mietvertrags geräuschvoll mit dem Fingernagel und schob sie in eine Seitentasche ihrer selbstgehäkelten Tasche.
»Im Augenblick nicht.«
Irenes dunkle Augen verengten sich hinter ihrer Brille, als würde sie Kristi abschätzig mustern.
»Wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, können Sie sich auch an meinen Enkel Hiram wenden. Er wohnt in 1 a und ist so eine Art Verwalter auf Abruf. Kann es mit der Miete verrechnen, wenn er Reparaturen erledigt oder sich um kleinere Probleme kümmert. Seine Eltern haben sich getrennt und dabei vergessen, dass sie Kinder in die Welt gesetzt haben. Verrückt.« Sie fischte eine Karte mit ihrem Namen und ihrer sowie Hirams Telefonnummer aus der Jeanstasche und schob sie über den Tisch. »Ich habe meinem Sohn gesagt, dass es ein Fehler ist, sich mit dieser Frau einzulassen, aber hat er auf mich gehört? Oh, nein … Dieser Dummkopf.«
Als hätte sie gemerkt, dass sie zu weit gegangen war, fügte Irene rasch hinzu: »Hiram ist ein guter Junge. Arbeitet hart. Wenn Sie möchten, hilft er Ihnen beim Einzug, bringt alles an und so weiter. Hat er von meinem Mann gelernt, möge er in Frieden ruhn.« Sie stand auf und fuhr fort: »Oh, ich habe Hiram aufgetragen, neue Sicherheitsschlösser an den Türen anzubringen. Und sollten Sie auf irgendwelche Fensterriegel stoßen, die nicht richtig schließen, wird er sich ebenfalls darum kümmern. Haben Sie schon das Neuste gehört?« Ihre grauen Augenbrauen schossen in die Höhe, und sie kratzte sich nervös am Kinn, als wägte sie ab, was sie preisgeben sollte. »Ein paar Studentinnen sind während des Semesters verschwunden. Leichen wurden nicht gefunden, aber die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Wenn Sie mich fragen, sind die alle auf und davon.« Sie blickte zur Seite und murmelte: »Passiert doch dauernd, aber man kann trotzdem nicht vorsichtig genug sein.« Sie nickte, als wollte sie sich selbst bestätigen, und klemmte sich ihre Tasche unter den Arm. »Zu meiner Zeit war das alles anders. Die meisten Seminare wurden von Priestern und Nonnen gehalten, und das College hatte noch einen guten Ruf, aber jetzt … ach!« Irene fuhr mit der Hand durch die Luft, als verscheuchte sie eine lästige Mücke. »Wenn Sie mich fragen: Allmählich bekommt man den Eindruck, die heuern alle möglichen … Spinner an, jeden, der einen Abschluss hat. Sie halten Seminare über Vampire und Dämonen und alles mögliche satanische Zeug … Weltreligionen, nicht nur Christentum, wohlgemerkt … und erst diese schlechten Theateraufführungen! Oh, ich will mich gar nicht erst über den Fachbereich Englisch auslassen. Er wird von einer Irren geleitet, lassen Sie sich das gesagt sein. Natalie Croft hat kein Recht darauf, ein Seminar zu leiten, und schon gar nicht einen ganzen Fachbereich!« Sie schnaubte und öffnete die Tür. »Seit Vater Anthony – oh, Verzeihung, ›Vater Tony‹ – Vater Stephen abgelöst hat, ist die Hölle los, vermutlich, weil er so hip ist und gut Freund mit jedem.«
Mit zusammengepressten Lippen schüttelte Irene den Kopf und trat über die Schwelle hinaus auf die Außentreppe. »Wo liegt denn da der Fortschritt? Sie führen Moralitäten auf – ach du Schande! Vampire? Es hat ganz den Anschein, als befände sich das All Saints College auf dem Weg zurück ins finsterste Mittelalter!« Damit umfasste sie das Geländer und eilte die Treppen hinunter.
Offenbar zählte Irene Calloway nicht zu den Menschen, die frei von Vorurteilen waren.
Kristi schloss die Tür hinter ihrer neuen Vermieterin und überprüfte die Fenster.
Sämtliche Fensterriegel in dem kleinen Apartment waren defekt. Gleich nachdem Kristi die Treppe hinuntergegangen war, um ihre Sachen zu holen, wählte sie Hirams Nummer. Irenes Enkel meldete sich nicht, aber Kristi hinterließ ihm eine Nachricht und ihre Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter und begann, ihre wenigen Besitztümer in ihr neues Zuhause zu schaffen – ein Krähennest, von dem aus man über das Gelände des All Saints College blicken konnte.
An ihrem Schreibtisch im Baton Rouge Police Department starrte Detective Portia Laurent auf die Fotos der vier vermissten Studentinnen. Keine von ihnen war wieder aufgetaucht. Sie waren wie vom Erdboden verschluckt.
Während um sie herum ihre Kollegen auf den Computertastaturen klapperten, die Drucker summten und eine alte Uhr die letzten Tage des Jahres hinwegtickte, betrachtete Portia die Fotos wohl zum tausendsten Mal. Sie waren alle so jung! Lächelnde junge Frauen mit frischen Gesichtern, Intelligenz und Hoffnung im Blick.
Oder war das nur eine Maske?
Lauerte etwas Finsteres hinter diesem strahlenden Lächeln?
Diese Mädchen waren abgeschrieben. Niemand, weder die Kollegen beim Police Department noch die College-Verwaltung, noch nicht einmal die Angehörigen der vermissten Studentinnen schienen ein Gewaltverbrechen in Erwägung zu ziehen. Keiner. Diese lächelnden Ex-College-Studentinnen waren einfach abgehauen, eigensinnige ungezähmte Mädchen, die sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden hatten zu verschwinden.
Waren sie in Drogengeschichten verwickelt?
In Prostitution?
Oder hatten sie einfach keine Lust mehr zu studieren?
Gab es irgendwelche Freunde, mit denen sie durchgebrannt waren?
Hatten sie sich entschlossen, per Anhalter durchs Land zu trampen?
Oder wollten sie nur eine kleine Auszeit nehmen und waren nicht mehr zurückgekehrt?
Portia schien die einzige Person auf dem Planeten zu sein, die sich Sorgen machte. Sie hatte sich Kopien von den Studentenausweisen der Mädchen an die Pinnwand ihres Arbeitsplatzes geheftet. Die Originale steckten in dem großen Aktenordner mit Fotos sämtlicher in jüngster Zeit vermisster Personen. Aber das hier war etwas anderes: Diese Fotos zeigten junge Frauen, die alle vier das All Saints College besucht hatten und plötzlich spurlos verschwunden waren. Es gab keine Kreditkartenabbuchungen, keine eingelösten Schecks, keine Bargeldabhebungen. Sie hatten weder ihre Handys benutzt, noch waren sie in einem der örtlichen Krankenhäuser aufgetaucht. Keine hatte ein Bus- oder Flugticket gekauft oder war im Internet gewesen.
Portia starrte auf die Fotos und fragte sich, was zum Teufel mit ihnen passiert war. Tief im Innern ging sie davon aus, dass sie tot waren, auch wenn sie gleichzeitig hoffte, dass ihr Cop-Instinkt falsch lag.
Die Studentinnen hatten kein Fahrzeug besessen und stammten auch ursprünglich nicht aus dem Bundesstaat Louisiana. Die letzten Personen, die sie lebend sahen, hatten nichts Seltsames festgestellt und konnten der Polizei nicht den geringsten Hinweis darauf liefern, was die Mädchen vorgehabt hatten, wohin sie gegangen waren, mit wem sie sich getroffen haben könnten.
Es war einfach frustrierend.
Portia fischte in ihrer Handtasche nach der Packung Zigaretten, dann rief sie sich in Erinnerung, dass sie das Rauchen aufgegeben hatte. Vor drei Monaten, vier Tagen und fünf Stunden. Sie nahm sich einen Nikotinkaugummi und verspürte beim Kauen eine leichte Befriedigung. Dann blickte sie wieder von einem Foto zum anderen.
Das erste Opfer, das nun schon fast seit einem Jahr vermisst wurde, genauer gesagt seit letztem Januar, war eine afroamerikanische Studentin mit hohen Wangenknochen und einem schönen, perlend weißen Lächeln. Dionne Harmon hatte eine Tätowierung mit dem Schriftzug LOVE, umrankt von Blumen mit flatternden Kolibris, auf dem Rücken und stammte aus New York City. Ihre Eltern waren nie verheiratet gewesen und mittlerweile beide tot. Ihre Mutter war an Krebs gestorben, ihr Vater bei einem Betriebsunfall. Ihr Bruder Desmond hatte bereits drei Kinder in die Welt gesetzt und drückte sich vor den Unterhaltszahlungen. Als Portia versucht hatte, ihn zu erreichen, hatte er ihr mitgeteilt, es interessiere ihn nicht, was aus der Hure geworden sei.
»Wie nett«, sagte Portia laut, als sie sich das Telefongespräch in Erinnerung rief. Keiner von Dionnes Freunden konnte sich erklären, was mit ihr passiert war, aber die Person, die angab, sie zuletzt gesehen zu haben, war Dr. Grotto, einer ihrer Professoren. Zumindest schien er besorgt zu sein. Grottos Spezialgebiet war der Vampyrismus mit y, was Portia ein wenig merkwürdig vorkam, aber schließlich interessierten sich die Leute manchmal für die seltsamsten Dinge. Mit Mitte dreißig hatte Grotto mehr Sexappeal, als es für einen College-Professor erlaubt sein sollte. Er war mit Sicherheit weitaus interessanter als die verstaubten alten Lehrer, mit denen sie damals in ihren zwei Jahren auf dem All Saints College zu tun gehabt hatte.
Die anderen vermissten Studentinnen stammten auch aus zerrütteten Familien, die sich einen Dreck um sie scherten und sie als verantwortungslose Ausreißerinnen abstempelten, die ständig in Schwierigkeiten steckten.
Wie merkwürdig, dass sie alle auf dem All Saints College gelandet und eine nach der anderen in den letzten achtzehn Monaten verschwunden waren!
Portia glaubte nicht an Zufall.
Die Medien hatten Wind von der Sache bekommen und machten Druck. Die Öffentlichkeit war nervös, im Police Department klingelte ständig das Telefon.
Nach Dionne waren Tara Atwater und Monique DesCartes verschwunden, Monique im Mai, Tara im Oktober. Und jetzt Rylee Ames. Alle vier hatten überwiegend dieselben Kurse besucht, so auch das Vampyr-Seminar von Dr. Dominic Grotto.
Wusch!
Ein Ordner landete auf ihren Fotos.
»Hey!«, sagte Detective Del Vernon und lehnte sich mit der Hüfte an ihren Schreibtisch. »Noch immer mit den vermissten Mädchen beschäftigt?«
Und wieder das gleiche Blabla, dachte Portia mit einem innerlichen Seufzen und stellte sich auf eine Standpauke des Ex-Militärs ein. Vernon, ein gutaussehender Schwarzer mit Glatze, hatte sich seine gestählte Figur bewahrt, obwohl er schon in den Vierzigern war. Er hatte breite Schultern, eine schmale Taille, und laut Stephanie, einer der Sekretärinnen, war sein Hintern genauso stramm wie seine militärische Haltung. Das stimmte. Vernon hatte einen großartigen Körper. Portia versuchte, nicht daran zu denken.
»Was ist das?«, fragte sie, griff nach dem Ordner und schlug den Tatortbericht mit dem Foto einer toten Frau auf.
»Jane Doe … aufgeschlitzte Kehle, Police Department Memphis. Sieht so aus, als könnte das derselbe Kerl gewesen sein, der die Frau umgebracht hat, die wir letzte Woche in der Nähe der River Road gefunden haben.«
»Beth Staples.«
»Genau. Ich will, dass du das überprüfst.«
»Alles klar«, sagte sie und wartete darauf, dass er sie daran erinnerte, die vermissten Mädchen vom All Saints College seien kein Fall für die Mordkommission und gingen sie daher nichts an.
Doch er sagte nichts. Stattdessen klingelte sein Handy. Der Detective klopfte mit den Fingern auf ihren Tisch und ging dann durch das Labyrinth der Großraumarbeitsplätze. »Vernon«, meldete er sich knapp, schritt durch die Glastür seines Büros und schloss sie mit einem Fußtritt hinter sich.
Portia riss ihre Aufmerksamkeit von den Fotos der vermissten Studentinnen los und wandte sich der Akte Jane Doe zu. Es bestand schließlich durchaus die Möglichkeit, dass sie falsch lag, die Möglichkeit, dass die Mädchen noch am Leben waren.
Aber sie würde nicht darauf wetten.
Zwei Tage nachdem Kristi ihr Apartment bezogen hatte, hatte sie auch schon einen Job als Kellnerin in einem Diner drei Blocks vom Campus entfernt an Land gezogen. Sie würde dort zwar nicht reich werden, aber sie war mit ihren Schichten flexibel, und genau das wollte sie. Leute zu bedienen war nicht gerade ihr Traumjob, aber alles war besser als die Arbeit für die Gulf Auto and Life Insurance Company, für die sie in den letzten Jahren viel zu viel gearbeitet hatte. Außerdem hatte sie ihren Wunsch, über wahre Kriminalfälle zu schreiben, noch nicht aufgegeben. Sie musste nur auf die richtige Story stoßen, dann würde sie vielleicht die nächste Ann Rule werden.
Es dämmerte, und die ersten Regentropfen fielen, als sie mit eingezogenem Kopf, den Rucksack über eine Schulter geworfen, den Campus überquerte. Es war der Tag vor Silvester. Eine eisige Böe fegte um die Ecken, rüttelte an den Zweigen der Eichen und Kiefern und streifte Kristis Nacken mit einem frostigen Kuss. Sie schauderte. Der Temperatursturz hatte sie überrascht. Sie war müde vom Umzug, und ihre Beine fühlten sich an wie Blei. Kristi bog um die Ecke hinter Cramer Hall, wo sie während ihres ersten College-Jahrs vor beinahe zehn Jahren gewohnt hatte. Das Gebäude hatte sich nicht sonderlich verändert, bestimmt nicht so sehr wie sie selbst …
Plötzlich glaubte sie, aus dem Augenwinkel eine Bewegung, einen dunklen Schatten in der dichten Hecke unweit der Bibliothek wahrzunehmen. Die Gaslaternen schimmerten bläulich und verbreiteten ein diffuses Licht. Kristi entdeckte niemanden. Offenbar hatte ihr ihre überaktive Fantasie einen Streich gespielt.
Doch konnte man ihr deswegen einen Vorwurf machen? Logisch, dass sie nervös war, wenn man daran dachte, was sie in den Händen dieser unmenschlichen Psychopathen erlebt hatte, an die Warnungen ihres Vaters und an die Bemerkungen ihrer Vermieterin. »Du musst drüber hinwegkommen«, ermahnte sie sich, als sie am Wagner House vorbeikam, einem großen Klinkerbau mit hohen dunklen Fenstern und schwarzen Eisengittern davor. Heute Abend sah das stattliche alte Haus unheilverkündend aus, sogar bedrohlich. Und du glaubst also, du könntest True Crime schreiben? Tatsachenberichte? Wie wär’s mit erfundenen Geschichten? Vielleicht Horror? Oder irgendetwas, das deiner gruseligen Fantasie entspricht. Mein Gott, Kristi, reiß dich zusammen!
Als sie ihr Tempo wegen des stärker werdenden Regens beschleunigte, hörte sie Schritte auf dem Weg hinter sich. Sie warf einen verstohlenen Blick über die Schulter, sah jedoch abermals niemanden. Nichts. Die Schritte waren nicht mehr zu hören. Es war, als würde ihr jemand folgen, der nicht entdeckt werden wollte.
Ihr Magen zog sich zusammen, und sie dachte an das Pfefferspray in ihrem Rucksack. Wenn sie die Wahl hätte zwischen Pfefferspray und ihren Fähigkeiten in Selbstverteidigung …
Du lieber Himmel, hör auf damit!
Sie setzte sich wieder in Bewegung. Angespannt lauschte sie auf ein Scharren, auf ein Geräusch wie schweres Atmen, falls Wer-auch-immer-es-sein-mochte die Verfolgung wieder aufnahm, aber alles, was sie hörte, war die lebhafte Straße, das Quietschen von Rädern auf nassem Asphalt, das Dröhnen der Motoren und ein gelegentliches Kreischen von Bremsen oder Getrieben. Nichts Unheimliches. Nichts Bedrohliches. Doch obwohl sie sich innerlich dafür schalt, hörte ihr Herz nicht auf, heftig zu klopfen, und sie öffnete den Reißverschluss ihres Lederrucksacks. Unmittelbar darauf hielt sie das Pfefferspray in der Hand.
Wieder warf sie einen Blick über die Schulter.
Wieder sah sie nichts.
Sie rannte fast, als sie sich dem Campustor näherte, das ihrem Apartment am nächsten lag. Sie hatte soeben die Straße erreicht, als ihr Handy klingelte. Leise fluchend griff sie in die Manteltasche. Auf dem Display blinkte der Name ihres Vaters. Plötzlich dankbar, dass er anrief, ging sie dran. »Hey, arbeitest du nicht?«
»Sogar Cops machen ab und zu eine Pause.«
»Und da hast du dir überlegt, in deiner Pause einen Kontrollanruf bei mir zu machen.«
»Du hast mich angerufen«, erinnerte Rick Bentz seine Tochter.
»O ja, stimmt …« Das hatte sie ganz vergessen. Ein weiterer kleiner Hinweis darauf, dass sie noch nicht wieder hundertprozentig auf dem Damm war – ihr verdammtes Gedächtnis. Immer wieder kam es vor, dass sie irgendetwas Wichtiges völlig vergaß. »Ich wollte dir meine neue Adresse mitteilen und erzählen, dass ich einen Job im Bard’s Board habe. Das ist ein Diner, und alle Gerichte sind nach Charakteren von Shakespeare benannt. Du weißt schon, Jagos eisgekühlte Latte, Romeos Reuben-Sandwich und Lady Macbeths Finger. Ich glaube, es gehört zwei ehemaligen Englischlehrern. Jedenfalls muss ich die Gerichte bis Montagmorgen auswendig lernen, dann fange ich an. Ich hoffe, es wird meinem Gedächtnis wieder ein wenig auf die Sprünge helfen.«
»Jagos eisgekühlte Latte klingt obszön.«
»Nur in deinen Ohren, Dad. Es ist ein Milchkaffee.«
Inzwischen war sie vor ihrem Haus angekommen. Lächelnd fragte sie: »Und wie geht es dir?«
»Gut. Warum?«
Sie dachte an das Bild, das sie am Vortag von ihm gesehen hatte: Ihr Vater, der langsam immer bleicher geworden war. »Nur so.«
»Du gibst mir das Gefühl, alt zu sein.«
»Du bist alt, Dad.«
»Sei nicht so frech«, sagte er, aber in seiner Stimme schwang ein Lachen mit.
Beinahe hätte sie erwidert: »Ganz der Vater«, aber sie unterdrückte ihre Worte. Rick Bentz war immer noch ein wenig empfindlich, wenn er daran erinnert wurde, dass er nicht ihr leiblicher Vater war. Stattdessen sagte sie: »Hör mal, ich muss mich beeilen. Ich ruf dich später zurück. Hab dich lieb!«
»Ich dich auch.«
Sie machte sich auf den Weg die Außentreppe hinauf und begegnete im ersten Stock einem zierlichen Mädchen. Es kämpfte mit etwas, das wie ein undichter Müllsack aussah.
Die dunkelhaarige Asiatin blickte auf und lächelte. »Du musst die neue Nachbarin sein.«
»Ja. Zweiter Stock. Ich bin Kristi Bentz.«
»Mai Kwan. Apartment 202.« Sie machte eine ausholende Handbewegung in Richtung der offenen Tür am Anfang des Flurs. »Bist du Studentin? Hey, gib mir eine Sekunde, ich bring das hier schnell in den Müllcontainer.« Mit einer geschmeidigen Bewegung schlüpfte sie um Kristi herum und eilte die Treppen hinunter. Ihre Flip-Flops klapperten laut.





























