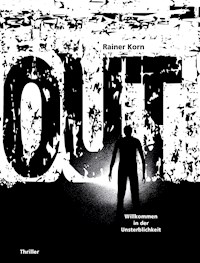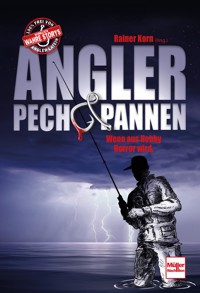
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Müller Rüschlikon
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch bietet allen, die das Angeln lieben, ein unterhaltsames Füllhorn kurioser Geschichten rund um die Jagd nach dem Schuppenwild. Allen anderen, die bisher glaubten, Angeln sei eine langweilige, unaufregende Angelegenheit, dürften sich angesichts dieser skurrilen Storys nicht nur die Nackenhaare aufstellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Einbandgestaltung:Hannes Dänekas
Titelfoto:BaranovE / Shutterstock.com
Innengestaltung und Illustration:Hannes Dänekas
Foto Seite 84:Rainer Korn
Alle Angaben in diesem Buch wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Für einen eventuellen Missbrauch der Informationen in diesem Buch können weder die Autoren noch der Verlag oder die Vertreiber des Buches zur Verantwortung gezogen werden. Eine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
ISBN 978-3-613-31301-9 (EPUB)
Copyright © by Müller Rüschlikon Verlag
Postfach 103743, 70032 Stuttgart
Ein Unternehmen der Paul Pietsch Verlage GmbH & Co. KG
Sie finden uns im Internet unter www.mueller-rueschlikon-verlag.de
Nachdruck, auch einzelner Teile, ist verboten. Das Urheberrecht und sämtliche weiteren Rechte sind dem Verlag vorbehalten. Übersetzung, Speicherung, Vervielfältigung und Verbreitung einschließlich Übernahme auf elektronische Datenträger wie DVD, CD-ROM usw. sowie Einspeicherung in elektronische Medien wie Internet usw. ist ohne vorherige Genehmigung des Verlages unzulässig und strafbar.
Lektorat:Claudia König
Innengestaltung:Hannes Dänekas
Folgen Sie uns für mehr Infos zu unseren Pferdebüchern auf:
www.instagram.com/muellerrueschlikon.pferd
www.facebook.com/muellerrueschlikonverlag
Inhalt
Wirklich wahre Angler-Storys
Vorwort
Sturmfahrt
Im Nirgendwo auf Kamtschatka
Im Tretboot in Seenot
Der Fluch des Pharaos
Eiszeit durch Russenpeitsche
Irrfahrt durch 1001 Nacht
Hurrikan auf Hitra
Des Messers Schneide
Brasilien eiskalt
Der Mönch und die Haie
Und wo bitte ist das Paradies?
Reise ohne Wiederkehr
Der Lügenbaron
Gestrandet
Der wütende Bulle
Die Buchmacher
Danke
Vorwort
Unglaubliche Geschichten ...
POSEIDON NEWS: Zahlreiche befragte Fische skandieren weltweit SKANDAL! Vom »Suckhole« auf Tobago, bis zum »Coach & Horses« in Bolton by Bowland. Rainer Korn, der von Wind und Wetter gestählte, legendäre Fischer und Chefredakteur von »Kutter & Küste«, kennt sie alle! Tricks, Kniffe und geheime Orte unseres Blauen Planeten. Wo Fische noch sie selbst sein dürfen und Status eine Handbreit Rum bedeutet, bis beide lecker im Magen landen. Wenn Sie diese erlebten, unglaublichen Geschichten lesen wollen, weil Sie »Überleben« wollen und Ihnen die lebenswichtige Frage gestellt wird, was der »Hurrikan auf Hitra« mit dem »Fluch des Pharao« zu tun hat? Wenn Sie sturmgepeitscht im »Tretboot in Seenot« auf Sturmfahrt im »Nirgendwo auf Kamtschatka« liegen und entscheiden müssen, ob Sie lieber ihr letztes Hemd verbrennen, um Hilfe zu holen, oder eine heiße, wässrige Kartoffelsuppe essen, um nicht zu erfrieren. Dann gibt es nur eine Antwort: Lesen Sie »Angler, Pech & Pannen« und halten Sie es fest! Denn der nächste Leser steht schon lachend neben Ihnen, um es sich zu gönnen. Rainer, den ich übrigens zu meinen guten Freunden zählen darf, erzählt uns mit seinen Co-Autoren in seinem neuen Buch auf herrlich kurzweilige Weise phantasievoll gesponnenes Seemannsgarn und abenteuerliche Geschichten, in und außerhalb von Fischerbooten. Von vertrockneten Bäumen, die zum letzten Rettungsanker in tosenden Sturmfluten an magischen Orten wurden. Von Stachelmakrelen, Haien, Gummistiefeln und Federjigs. Und wie schön es doch sein kann, mit einem Mönch am warmen Lagerfeuer zu sitzen, während andere sich fragen müssen, wie sie jetzt den letzten Köder aus dem Krokodil bekommen sollen, das sie eben verschmitzt anzugrinsen scheint, ohne selbst verspeist zu werden. Und wenn Sie die letzte Seite verschlungen haben, wird es auch für Sie nur noch eins geben: »Rin inne Gummistiefel, rauf uff‘n Kutter un‘ raus auf die See.« Denn das beste kommt zum Schluss! Man kann mit Rainer Korn sogar die wirklich unvergesslichsten Fischertrips buchen und mit ihm die besten Angel-Abenteuer erleben. Und wer weiß ... vielleicht ergeht es Ihnen wie mir und Sie erkennen sich selbst glatt wieder, in einer der sagenumwobenen Geschichten, auf den sieben Weltmeeren oder den Flüssen, die die Welt verbinden. Wo Fische noch die Freiheit haben, selbst über ihr Futter zu entscheiden. Und wenn doch ein leckerer Köder mit Haken und Schnur dran war, POSEIDON anzurufen und »SKANDAL« zu skandieren. Mmh, lecker!
Ihr
Francis Fulton-Smith
Mann, war ich aufgeregt. Noch keine zwei Monate beim jungen Angelmagazin Rute & Rolle und nun schon meine erste Hochsee-Angelfahrt. Und welchen Klang der Name des Reiseziels hatte: das Gelbe Riff! Angler sprachen ehrfürchtig von diesem sagenumwobenen Angelgebiet, das sich weit vor der norddänischen Küste in der Nordsee befand. Knorrige dänische Kapitäne, meist ehemalige Fischer, die mit ihren schwieligen Händen, die von jahrzehntelangem Hantieren mit Netzen und Langleinen erzählten, das hölzerne Steuerrad fest umklammerten. So stellte ich mir das vor. In diesem Angelgebiet, das berühmt für seine riesigen Dorsche war, sollte in einigen Wochen die Europameisterschaft im Bootsangeln stattfinden. Die besten Meeresangler des Kontinents sollten nach Dänemark kommen: die erfahrenen Profis aus England, die Großfischmeister aus Portugal, die vielseitigen Angler aus Frankreich – und natürlich die deutsche Mannschaft, die sich aus den erfolgreichsten nationalen Meistern zusammensetzte.
Wir waren eingeladen, das letzte Training dieses Teams zu begleiten, um über die erfolgreichen Angler zu berichten und über das legendäre Hochseeangelrevier, das regelmäßig mit Dorschen von über 20 Kilo von sich reden machte. Das waren schlanke Sommerdorsche, die schon mal 1,30 Meter in der Länge maßen. Solche Fische hatten die meisten noch nie in ihrem Leben live gesehen. Und wir sollten die Chance bekommen, das miterleben zu dürfen. Selbstverständlich würden meine beiden Kollegen aus der Redaktion und ich auch mitangeln. Wir fieberten dem Ereignis entgegnen wie Kinder dem Heiligabend.
Wir hatten uns extra für die Tour nach Hirtshals, das fast an der Nordspitze Dänemarks liegt, einen Leihwagen genommen. Mit dem sollte es dann die Autobahn 7 an Flensburg vorbei nach Dänemark gehen und weiter in den Norden des Landes. Ein sogenannter Longtörn mit dem Kutter war geplant: Die Leinen würden um zwei Uhr nachts gelöst werden, dann wurde abgelegt. Erst um 16 Uhr am nächsten Tag dann würde das Schiff wieder in den Hafen von Hirtshals einlaufen. Also 14 Stunden an Bord mitten auf der Nordsee. Wir hatten ein bisschen Proviant dabei und etwas zu trinken.
Nun hat ja bekanntlich fast alles meist einen Haken. Das perfekte Paradies gibt es nicht und irgendwas ist immer. Und es wird nicht verwundern, dass selbst das perfekte Angelrevier nicht existiert. Leider. Auch da gibt es meist einen Haken. Beim Gelben Riff hatte das nichts mit den Fischen zu tun. Die waren eigentlich immer da, weil sie sich in diesem steinigen Abhang, der Gelbes Riff genannt wurde, gern tummelten. Fischer konnten hier schlecht ihre Netze durchschleppen, zu oft blieben diese in den Steinen hängen. Das und die vielen Wracks, die sich dort vor der dänischen Küste wie die Perlen einer Kette aneinanderreihten, waren erstklassige Gründe für einen sehr reichen Fischbestand. Es gab viele und es gab große Fische – Anglerherz, was begehrst Du mehr? Nun stellt sich der kluge Leser vielleicht die Frage, warum es denn da so wahnsinnig viele Wracks gibt, die sich in den letzten Jahrhunderten dort unfreiwillig am Grund eingefunden haben. Die Nordsee trägt nicht von ungefähr den schillernden, den gefährlichen Zweitnamen Mordsee. Heftige Stürme türmen Wellen zu wahren Monstern aus kaltem Wasser auf. Und unruhig ist die Nordsee sehr oft. Ein schlafender Dämon, der plötzlich seine tausenden Schlunde aufreißt und Schiffe samt Mannschaften binnen Sekunden verschlingen kann.
Dieses Meer hat in den Jahrhunderten der Seefahrt viele tausende Leben gefordert, hat riesige Schiffe einfach zerbrochen oder gleich unter einer gewaltigen Grundsee begraben. Dummerweise befindet sich das Gelbe Riff etwa 30 Kilometer vor der dänischen Küste in der offenen Nordsee. Keine Insel weit und breit. Kein Schutz. Keine Fluchtmöglichkeit, wenn der Wind plötzlich loslegt und das Schaukeln beginnt.
Ja, und das ist der spitze, spitze Haken dieses Traumrevieres. Denn viele Touren müssen kurzfristig abgesagt werden, wenn der Wind mal wieder ein Stelldichein gibt. Andere Ausfahrten werden abgebrochen, weil die Angler nur noch wimmernd von Seekrankheit herumliegen und es schlichtweg einfach viel zu gefährlich ist, weiter in den gewaltigen Wogen wie ein kleiner Korken herum zu dümpeln.
Bei uns lag der Fall etwas anders. Denn der Wind war schon da, als wir nachts gegen 23 Uhr im Hafen von Hirtshals ankamen. Unheilverkündendes Rauschen der Luft und klappernde Leinen der im Hafen liegenden Schiffe zeigten uns ziemlich unmissverständlich, dass wir leider das schlechte Blatt gezogen hatten heute.
Wir standen am Hafenbecken und schauten sehnsüchtig auf die Angelkutter, die nervös an ihren Festmachern zurrten und zerrten, als wollten sie sich gleich allein ohne Crew auf Fahrt begeben. Das würde wohl nix werden. Ein Satz mit X. Und dafür die über 500 Kilometer hier hoch – die wir ja auch noch wieder bei der Heimfahrt zurücklegen mussten! Eine kleine Imbissbude hatte noch auf. Dort konnten wir bis 24 Uhr Kaffee trinken sowie ein paar schrumpelige Brötchen mit Käse knabbern. Doch gegen ein Uhr nachts tauchten einige bekannte Gesichter im Hafen auf. Der Präsident des Meeresangelverbandes, der uns auf diese Tour eingeladen hatte, und weitere Angler des Nationalteams, die bereits schwere Taschen und lange Futterale geschultert hatten und sich auf den Weg zu einem Holzkutter in der Nähe machten. Wie jetzt? Doch angeln? Die Tour sollte tatsächlich stattfinden, obwohl der Wind eindeutig zu stark war? Wir schauten uns verwirrt an. Der Präsident, nennen wir ihn Kurt, winkte uns heran. Ja, wir würden rausfahren. Dies war nämlich die letzte Gelegenheit des Nationalteams, für die Europameisterschaft zu trainieren. Und ohne Training konnten sie eine erhoffte Platzierung auf dem Siegertreppchen mal gleich in den Wind schreiben. Apropos Wind: Der alte Kapitän, tatsächlich ein waschechter Fischer im Ruhestand, dem die salzige Luft der Nordsee tiefe Kerben in sein Gesicht gegraben hatte, winkte nur müde ab – sein alter Kutter hätte mit dem Wind keine Probleme – seine Frage war nur, ob die Angler das aushalten würden. Kurt nickte tapfer. Ich freute mich schon wieder auf die Ausfahrt, hatte keine Ahnung, wie die See da draußen vor den schützenden Hafenmauern aussah – und das war vielleicht auch ganz gut so, denn sonst wäre ich garantiert nicht auf diesen alten Holzkahn gestiegen, der seine Glanzzeiten im wahrsten Sinne des Wortes schon lange hinter sich gelassen hatte.
Also schleppten nun auch wir unseren Kram an Bord. Der Käpt‘n brummte noch ein »Alles gut festzurren, was nicht über Bord gehen soll«, dann enterte er sein kleines Steuerhaus und ließ den Diesel scheppernd an. Auf keinem der anderen Schiffe zeigte sich Leben. Später sollte sich zeigen, dass alle übrigen Angelkutter die Fahrten für diesen Tag abgesagt hatten – wegen zu starken Windes ...
Die »Benbola« suchte sich ihren Weg durch den mit Schiffen vollgestellten Hafen. Als wir die beiden Molenköpfe mittig passierten und in die Nordsee hineinfuhren, ging ein erstes Schütteln durch das Schiff. Ein kleiner Vorgeschmack. Die Ruten waren montiert und festgezurrt an der Reling. Jeder hatte sich an Deck oder in dem kleinen Aufenthaltsraum unter Deck ein Plätzchen für ein Nickerchen gesucht. Denn die Fahrt zu den Fanggründen würde gut drei Stunden dauern und alle waren von der Anreise und der durchlebten Nacht müde. Doch das mit dem Nickerchen gestaltete sich schon mal schwierig. Der Kutter hob und senkte sich ziemlich hoch und dann wieder ziemlich tief, wenn er in ein Wellental hineintauchte. An Schlaf war da nicht zu denken. Man war schon froh, wenn man nicht wie eine Bowlingkugel übers Deck kullerte!
Die Stunden vergingen wie in Zeitlupe. Doch endlich eine gute Nachricht: Wir hatten die erste Angelstelle erreicht und konnten loslegen. Jeder sah bereits im Geiste riesige Dorsche vor sich an Deck liegen. Doch es gab auch noch eine schlechte Nachricht: Der Wind hatte noch einmal zugelegt. Das war jetzt wirklich grenzwertig, dachte ich. Ich zweifelte plötzlich an der Einschätzung des alten Skippers, dass dieses knirschende Stück blaues Holz tatsächlich diesen Wellen, die da auf uns zurollten, gewachsen sein sollte. Einer meiner Kollegen kam schon gar nicht mehr an Deck. Als ich nach ihm schaute, blickte ich in ein grünes Gesicht mit leeren Augen. Das war das erste Mal, dass ich sah, wie tatsächlich jemand, der seekrank war, vollkommen grün im Gesicht wurde! Faszinierend. Mein Kollege fand das weniger faszinierend, sondern eher ziemlich zum Kotzen. Und das tat er auch ausgiebig. Dafür bequemte er sich anfangs sogar noch an Deck an die Reling. Anfangs ...
Auch meinem anderen Kollegen ging es nicht wirklich gut. Auch er ließ sich den Kaffee und die Brötchen noch einmal anständig durch den Kopf gehen – angelte aber zeitweise noch mit und fing sogar einige schöne Dorsche. Zum Glück hatte ich mit Seekrankheit oder Übelkeit keine Probleme und angelte weiter. Ich hatte vielmehr große Schwierigkeiten zu spüren, wo sich mein verdammter Köder, immerhin ein 500 Gramm schwerer Bleipilker, denn so befand. Er musste am Grund herumtanzen, denn dort standen die Dorsche. Aber leider fühlte ich niemals, ob der Köder auf dem Grund aufschlug oder eben nicht.
Genauso gut konnte er sich irgendwo vor mir in den Wellen befinden. So ein Mist. Ich hatte erst einen kleinen Dorsch gefangen. Das durfte doch nicht wahr sein! Endlich stand ich, naja, wankte ich mit den Füßen über diesem heißesten Angelrevier Mitteleuropas und dieser blöde Wind spielte »Blinde Seekuh« mit mir. Wo war mein Köder? Wo waren die Dorsche? Mittlerweile angelten von den anfangs 12 Anglern nur noch zwei: mein Bordnachbar und ich. Die anderen hatten sich verkrümelt, um das hier irgendwie durchzustehen und zu überleben. Der größte Teil war schlichtweg seekrank. Der Käpt‘n hatte einen kurzen Zigarrenstumpen, der längst kalt geworden war, im Mund und ließ ihn dort hin- und herrollen – so wie die Wogen das schaukelnde Schiff. Seine Mimik verriet nichts. Ob er sich auch sorgte um sein Schiff, um sich, um die Gäste? Oder ob er einfach nur dachte: Verdammte Landratten, da weht mal eine Mütze voll Wind übers Meer und schon geht euch der Arsch auf Grundeis. Ganz ehrlich? Ich denke, letzteres dürfte zugetroffen haben. Er hatte vollstes Vertrauen in seinen Kutter. Einige Jahre später sollte dieses Schiff übrigens aus Sicherheitsgründen seine Zulassung als Angelkutter verloren haben. Nur mal so, als kleine Anmerkung.
Ich kämpfte mehr mit den Wellen und dem daraus resultierenden Schaukeln des Schiffes. Kurt, der Präsident, versucht verzweifelt, im Heck des Kutters seine Ranglisten mit den wenigen Fängen seiner Angler zu vervollständigen. Plötzlich stieg ein Schwarm weißer Tauben auf – nein, natürlich nicht, es waren die Blätter mit den Ranglisten, die der Wind neckisch aus Kurts Händen gerissen hatte und nun durch die salzige Luft wirbeln ließ. Doch Kurt hatte keine Zeit, sich darum zu kümmern. Er musste schnell Halt finden, als eine besonders hohe Welle unter dem Schiff hindurchrauschte und den Kutter zum wilden Tanzen brachte. Ich versuchte krampfhaft, mich gleichzeitig an die Reling zu klammern und nicht die Rute zu verlieren. In diesem Moment gab es einen Schlag! Die Rute wurde hinuntergerissen, bis aufs Metall der Reling. Hatte ich mich jetzt auch noch mit dem großen Drillingshaken im steinigen Grund verhakt? Gar ein Wrack getroffen? Ein Hänger unter diesen Bedingungen, wenn eben der Haken sich in den Boden gekrallt hatte – das war wirklich enorm blöd gelaufen. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, dass es meinem Nachbarn anscheinend genauso ging.
Auch seine Rute donnerte auf die Reling, dass es ein Wunder war, dass sie nicht in tausend Stücke zersprang. Doch mein Nachbar fing an zu pumpen. Das heißt, er hob schwer die Rute an und wenn er sie wieder Richtung Wasser absenkte, kurbelte er rasch ein, zwei Meter ein. »Der hat gar nicht den Grund gehakt« dämmerte es mir. Der hatte einen Fisch! Einen Dorsch. Und wohl keinen kleinen, wenn ich mir sein verbissenes Gesicht so anschaute. Sollte? Konnte? Durfte ich vielleicht auch das Glück haben, einen Fisch am anderen Ende der Leine zu haben? Und dann spürte ich es. Schwere Schläge in der Rute. Ich hatte in diesem rumpelnden Waschkessel tatsächlich einen Dorsch gehakt! Nun musste ich den Fisch irgendwie an Bord bekommen. Wir standen beide da – mit den Fingern um die Ruten verkrampft, kämpften verbissen mit unseren schuppigen Gegnern, denen die Wellen natürlich vollkommen egal waren. Sie wollten nur da unten bleiben, in gut 50 Metern Tiefe, am Grunde des Gelben Riffes. Und wir wollten sie von da wegzerren, hinein ins Licht der Luft, raus aus dem Meer, rauf an Deck dieses knarrenden, knarzigen Kutters. Mein einer Kollege, dem zwar zeitweise übel war, der aber nicht seekrank-grün in den Katakomben des Kutters siechte, suchte nach einem großen Landehaken, dem Gaff. Denn ohne ein solches war ein größerer Dorsch nicht an Deck zu bekommen. Endlich hatte er es gefunden und bewaffnete sich mit dem Haken. Wir starrten in das wirbelnde Meer vor uns. Ich hatte keine Ahnung, was da an meiner Leine zerrte. Ich hatte sämtliches Gefühl im Rauschen um mich herum verloren. Ich hielt nur eisern die Angel umschlossen und drehte Zentimeter für Zentimeter die Schnur ein.
Die Wellen hoben den Kutter hoch und ließen ihn wieder in ihre Täler fallen. Mein Angelnachbar und ich mussten uns immer wieder mit einer Hand an der Reling festklammern, wenn es zu sehr ruckte. Die andere Hand umfasste die Rute, um irgendwie die Spannung in der Leine aufrecht zu halten. Denn wenn die Schnur einmal durchhing, konnte es leicht passieren, dass sich der Haken aus dem Fischmaul löste und der Dorsch verloren war. Das wollte ich natürlich auf alle Fälle vermeiden. Wenn ich schon unter solchen widrigen Umständen einen kapitalen Fisch drillte, dann wollte ich ihn auch unbedingt haben. Ich mochte gar nicht daran denken, was alles schiefgehen konnte. Zum Glück ließen mir eben diese Umstände auch nur wenig Zeit und Muße, über solche Dinge weiter nachzudenken. Ich war vollkommen damit ausgelastet, nicht umgeworfen zu werden, wenn das Schiff mal wieder buckelte und dabei die Angel festzuhalten. Mein seekranker Kollege tauchte erstaunlicherweise auch mal wieder an Deck auf. Allerdings nur, um die Fische nochmal zu füttern. Er schaute nicht einmal zu uns hin, sondern verschwand nach getaner Arbeit gleich wieder unter Deck, um sehnsüchtig die Einkehr in den Hafen von Hirtshals zu erflehen. Es soll tatsächlich Fälle von Seekrankheit geben, bei denen die Leidenden lieber von Bord in die wilde See springen würden, als auch nur einen Augenblick weiter an Bord eines rollenden und stampfenden Schiffes zu bleiben. Sie haben wirklich das Gefühl, sie müssten hier und jetzt an Bord sterben. Als ich einmal für eine Reportage über Seekrankheit recherchierte, verriet mir der langjährige Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes, dass er 15 (!) Jahre lang immer wieder mal von Seekrankheit heimgesucht worden war. Sein Trick: Er verschwand in der Disko und tanzte. Das, so seine Erklärung, hätte ihn jedes Mal so abgelenkt, dass er seine Seekrankheit einfach vergaß. Er tanzte sich gewissermaßen die Übelkeit weg. Nun gab es keine Disko an Bord unseres kleinen Holzkutters, nicht einmal eine Bar. Mein seekranker Kollege musste also wohl oder übel – eher letzteres – warten, bis das Schiff wieder seinen Weg in den Hafen gefunden hatte.
Wo war eigentlich der Angel-Präsident, Kurt? Den hatte ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Auch von den übrigen Anglern war keine Spur. Es schien, als hätte sich jeder ein Loch gesucht, in dem er einigermaßen sicher diese wilde Wellentour überstehen konnte. Nur mein Nachbar und ich waren noch aktiv und kämpften mit den Fischen, den Wellen, einem bockigen Kutter und dem Regen, der mittlerweile übers Deck peitschte. Plötzlich zeigte sich etwas Großes, Weißes an der Oberfläche. Mein Nachbar hatte seinen Dorsch nach oben gekurbelt. Mein Kollege mit dem Gaff versuchte, den gewaltig großen Dorsch zu haken. Doch das war angesichts des schlingernden, buckelnden Kutters gar nicht so einfach. Immer wenn er den Haken an dessen langem Holzgriff Richtung Fisch stieß, bewegte sich das Schiff und es fehlten ein paar Zentimeter. Keiner sagte etwas. Ich nicht, weil ich noch verbissen mit meinem Dorsch kämpfte, der noch nicht Weiß gezeigt hatte; mein Nachbar, der verzweifelt versuchte, die Schnurspannung aufrechtzuhalten, aber gleichzeitig jede abrupte Bewegung zu vermeiden versuchte, denn eine solche konnte ganz leicht dazu führen, dass der Haken sich löste. Und mein Kollege mit dem Haken auch nicht, weil er sich total darauf konzentrieren musste, endlich das Gaff perfekt setzen zu können. Sonst war ja keine andere Seele zu sehen. Der Käpt‘n war schemenhaft in seinem kleinen Steuerhaus auszumachen. Allerdings erschwerte eine dichte Wolke aus Zigarrenqualm in der Kajüte die Sicht hinein. Er hatte den Stumpen gegen ein frisches Modell getauscht. Ob der Käpt‘n überhaupt irgendwas sehen konnte? Oder fuhr er nur noch nach Gefühl und Kompass? Ich hoffte nicht, denn wenn hier draußen auch nicht gerade Autobahnverkehr herrschte, so mancher riesiger Frachter und Tanker kreuzte schon mal unseren Kurs.
Vor lauter komischer Gedanken hatte ich gar nicht mitbekommen, dass unser Gaffer endlich den Haken gut gesetzt hatte. Gemeinsam wuchteten sie den Brocken über die Reling. Nun klatschte der dicke Dorsch aufs Deck. Himmel – was für ein Monster! So einen großen Dorsch hatte ich bisher nur auf Fotos gesehen. Der war bestimmt über einen Meter lang. Ich wurde ganz konfus. Sollte ein solcher Brocken auch an meiner Schnur hängen? Oh, bitte, Petrus, Schutzheiliger der Fischer und Angler, bitte, lass ihn nicht wieder abgehen. Gib mir diesen Fisch, ich will auch immer artig sein. Das war natürlich gelogen, aber ein bisschen Beschwörung konnte ja nicht schaden.
Und dann sah ich ihn. Wild drehte er sich an der Oberfläche, zeigte Weiß und dann wieder sein braun-schwarzes Leopardenmuster. Der war bestimmt genauso groß. Oha! Mein Kollege stand schon wieder Gaff bereit an der Reling und wartete auf seinen Einsatz. Wir sprachen nicht. Er wusste, was er tun musste, da hätte jedwelche hektische Einmischung von meiner Seite nur geschadet. Also biss ich mir auf die Lippen und bugsierte den Fisch Richtung Schiff. Ich würde meinen Teil der Sache so gut es eben ging zuende bringen, der Rest lag an meinem »Harpunier«, der schon wieder seine Lanze Richtung Gegner gesenkt hatte. Und dann stieß er zu! Ich schloss einen kurzen Moment die Augen. Hatte er ihn erwischt? Ja! Er zog an dem Stab, ich schleuderte die Angel zur Seite und half ihm. Einen solchen Fisch von einem schwankenden, bockenden Schiff zu haken und sicher an Bord zu bringen, ist kein Zuckerschlecken und eine Menge kann dabei schiefgehen. Doch Petrus sei Dank: Wir konnten beide Dorsche aufs Deck bringen. Wir schlugen uns gegenseitig auf die Schultern, umarmten uns so gut es das schwankende Schiff zuließ. Wir sprachen noch immer kein Wort – weil es auch durch den peitschenden Regen, die klatschenden Wellen und das rollende Schiff viel zu laut um uns herum war, um ein Gespräch zu führen. War auch nicht nötig. Vor uns lagen zwei Monsterdorsche. Wir hatten es geschafft. Ich meinte den Käpt‘n lächelnd nicken zu sehen, aber das konnte auch ein Trugbild sein – hervorgerufen durch Adrenalin, waagerechten Regen und blauen Qualm im Steuerhaus. Wir verstauten die Fische in einer Kiste, die wir noch zusätzlich mit Schnur sicherten. Nicht, dass noch eine Welle unsere mühsam erkämpfte Beute wieder ins Meer riss. Jetzt hatten wir auch keine Lust mehr zu angeln. Wie aus dem Nichts war Präsident Kurt aufgetaucht und schüttelte uns die Hände. Ganz toll hätten wir das gemacht. Ja, das fand ich auch. Mein Gaff-Kollege hatte sich wieder verkrümelt. Das durfte er auch – er hatte schließlich großen Anteil an unserem außergewöhnlichen Fang. Später sollte sich übrigens herausstellen, dass beide Dorsche exakt gleich schwer waren: 12,5 Kilo. Und beide maßen weit über einen Meter. Wow!
Der Käpt‘n hatte bereits Kurs auf Hirtshals genommen. Die Wellen wurden höher und er meinte wohl jetzt selbst, dass es an der Zeit war, heimzufahren. Keiner an Bord widersprach. Also stapfte der kleine, alte Kutter tapfer durch die Wellenberge, war mal ganz oben, mal ganz unten, schlingerte durch die zusehends rauer werdende See und steuerte auf die dänische Westküste zu. Ich war total alle, suchte mir eine halbwegs trockne Stelle mittschiffs, versuchte ein wenig auszuruhen. War doch alles ganz schön anstrengend gewesen, stellte ich jetzt fest. Doch einschlafen konnte ich dann doch nicht. Zu wild schaukelte der Kahn. Zu nass wurde es an meinem doch nicht so sicheren Platz. Mal schmeckte das Wasser neutral, das war dann Regen – mal extrem salzig, das war dann wohl die Nordsee, die immer wieder Ströme von Gischt übers Schiff jagte. Zumindest hatte ich auf diese Weise eine gewisse Abwechslung. Der Käpt‘n war der einzige an Bord, der noch stand – dort hinter seinem großen Steuerrad. Alle anderen hatten sich längst verkrochen, liegend oder wie ich sitzend zusammen gesunken. Ich hatte keine Ahnung, wie lange wir noch brauchten bis in den Hafen. Fünf Stunden, sechs Stunden? Der Kutter machte nur sachte Fahrt, musste die Wellenberge und -täler geschickt mitnehmen. So stampften wir im Bummeltempo über die Nordsee, ohne Horizont, ohne Anfang, ohne Ende. Manchmal wurde das Holzschiff regelrecht von besonders hartnäckigen Wellen erschüttert; durchgerüttelt, dass ich schon dachte, es bräche in der Mitte entzwei. Doch irgendwie fuhr der Kutter immer weiter, als wüsste er ganz genau, was er tun musste, um den sicheren Hafen doch noch zu erreichen.
Ich hatte keine Vorstellung mehr davon, wie lange wir unterwegs gewesen waren, seit wir die beiden großen Dorsche an Bord genommen hatten. Es kam mir sehr zeitlos vor. Als wenn ich schon ewig auf diesem Schiff unterwegs war. Als ob es gar keine Zeit mehr gab. Ich war für immer auf diesem Kutter, der sich hob und senkte. Draußen nur graues, raues Meer, weiße Gischtfahnen strömten über die Wellen. Die Wolken über uns waren ebenso dunkelgrau in vielen Schattierungen. Unglaublich, wie viele unterschiedliche Grautöne es gab! Ich habe mal gelesen, dass die Inuit hunderte verschiedene Worte für Schnee hatten. Wenn wir es darauf anlegen wollten, könnten wir glaube ich auch hunderte verschiedene Grautöne der norddeutschen und dänischen Regenwolken bestimmen. Ich musste grinsen. Stellte mir vor, wie sich zwei Nordlichter beim Blick in den mal wieder grauen Himmel über die Nuancen des Graus unterhielten. Eine unendliche Geschichte.
Unsere Sturmfahrt neigte sich jetzt tatsächlich dem Ende zu. Plötzlich tauchten die Molenköpfe an Back- und Steuerbord auf. Ganz schnell wurde alles ruhiger. Das Schiff hörte auf zu rollen und zu wogen, fuhr ganz gemütlich in den Hafen von Hirtshals ein. Kaum war die raue See hinter uns, ausgesperrt von mächtigen Mauern aus Beton, tauchten unsere Leute wie Geister an Deck auf. Das Grüne in vielen Gesichtern wechselte chamäleonartig zu Aschgrau und Weiß. Nicht schön, aber immerhin ein Fortschritt. Wortlos sammelten sie ihre sieben Sachen zusammen, beziehungsweise das, was noch übrig geblieben war. Denn schnell stellte sich heraus, dass während unseres verwehten Törns einiges an Ausrüstung über Bord gegangen war. Ruten, Taschen, Eimer. Wir schossen noch ein paar Fotos von unseren großen Dorschen. Auf See war ans Fotografieren ja nicht zu denken gewesen.
Ob das mit dem Training für die Europameisterschaft denn jetzt komplett in die Hose gegangen sei, wollte ich noch vom Präsidenten wissen. Der lachte und meinte nur, dass das Team jetzt jedenfalls wusste, was es zu erwarten hätte – im schlimmsten Fall. Allerdings würden die Meisterschaften unter solchen Wetterbedingungen wohl nicht abgehalten werden.
Dann verabschiedeten wir uns vom Käpt‘n und unseren Mitfahrern und machten uns auf den Weg Richtung Süden nach Hamburg. Allerdings zeigte sich jetzt, dass wir nicht nur eine extrem anstrengende Schiffsfahrt hinter uns gebracht hatten, sondern auch bereits seit über 30 Stunden nahezu ohne Schlaf unterwegs waren. Keine sonderlich guten Voraussetzungen, um über 500 Kilometer durch Dänemark und Norddeutschland mit dem Auto zurückzulegen. Mein Kollege startete den Leihwagen und los ging es. Die ersten 100 Kilometer waren kein Problem, da wir ausreichend spannenden Gesprächsstoff angesichts unseres Horrortrips parat hatten. Wir brachen immer wieder in brüllendes Gelächter aus, wenn wir bestimmte Szenen noch einmal mit Worten in die Gegenwart holten. Unser seekranker Kollege fand das eher weniger witzig, hatte er eigentlich von der ganzen Tour nur sehr wenig mitbekommen. Größtenteils hatte er sich im dunklen »Salon« des Kutters unter Deck in einer Art Dämmerschlaf befunden. Immer wieder unterbrochen von Würgereizen und dessen Befriedigung. Eine völlig ausgebrannte Kehle hätte er, grummelte er von der Sitzbank im Fond.
Doch irgendwann in der Wärme des Autos wuchs eine Gefahr, die weit größer war, als das Gewürge an Bord eines schlingernden Kutters. Ich spürte schon, wie meine Augenlider schwer und schwerer wurden. Immer wieder dämmerte ich für Sekunden weg.
»Noch fit?«, wollte ich von unserem Fahrer wissen. Der nickte, konnte aber ein Gähnen nicht unterdrücken. Natürlich war er alles andere als fit. Genauso fertig wie ich, müde, erschöpft. Ich wollte eine Pause vorschlagen, doch dämmerte vorher anscheinend wieder weg. Als ich das nächste Mal die Augen öffnete, befand sich die Mittelleitplanke der Autobahn eine Haaresbreite entfernt von unserem Wagen! Ich schrie auf, boxte den Fahrer in die Seite. Dieser war schlagartig wieder wach und machte zum Glück das einzig Richtige: Er steuerte sanft nach rechts und riss das Lenkrad nicht in Panik herum. Dann hätten wir uns garantiert überschlagen. So landeten wir wieder in der richtigen Spur. Hinter uns war kein anderes Auto gewesen – doppelt Glück gehabt! Ohne ein weiteres Wort steuerte unser Fahrer den nächsten Parkplatz an und stellte den Wagen ab.
»Schlafpause, Jungs!« Ich nickte zustimmend. Die nächste Stunde war Ruhe angesagt. Ein klein wenig erholt setzten wir die Fahrt dann fort, übernahmen nacheinander das Steuer. Wir kamen ohne Probleme in Hamburg an. Eine denkwürdige Tour aufs Gelbe Riff hatten wir erlebt. Von diesem Angeltrip sollten wir noch Jahre später erzählen. Diese Ausfahrt war mit ein Grund dafür, dieses Buch zu schreiben. Denn nachdem sich in vielen Jahren meines Lebens als Angelmagazin-Redakteur so viele unglaubliche, verrückte und spannende Geschichten ergeben hatten, war mir klar: Irgendwann musst Du die mal aufschreiben und auch für andere zur Verfügung stellen. Der Kopf des Dorsches, den ich auf dieser Tour gefangen hatte, ziert übrigens mein Redaktionsbüro. Den Kopf hatte ich damals voller Stolz von einer Präparatorin der schleswig-holsteinischen Landesmuseen präparieren lassen. Immer wenn ich ihn ansehe, muss ich an diesen Trip zurückdenken. Wie jung ich damals war, wie unerfahren. Einer der Kollegen, der »Seekranke«, ist bereits vor längerer Zeit verstorben. Er war ein sehr talentierter Schreiber, hätte an dieser Geschichte, die ich hier das erste Mal in dieser Form erzähle, sicherlich seine Freude gehabt. Dank dir, Michael, für so manche tolle Reportage, die wir zusammen erstellen durften. Und auf Wiedersehen in einer besseren Welt!
Um diese Geschichte richtig einordnen zu können, müssen Sie kurz innehalten und sich in die wilden Anfänge der 1990er Jahre zurückversetzen: Nachdem die Berliner Mauer am 9. November 1989 fiel und sich im März 1991 das Militärbündnis »Warschauer Pakt« offiziell auflöste, brach im Dezember des gleichen Jahres die Sowjetunion zusammen. Das führte in großen Teilen der neu entstandenen russischen Föderation zum totalen Chaos, da es keine geordneten Strukturen mehr gab, Befehlsketten verschwanden und Behördenmitarbeiter schlichtweg überfordert waren. Allerdings schaffte dieser massive Umbruch auch Möglichkeiten, die es so in der ehemaligen Sowjetunion nie gegeben hätte.