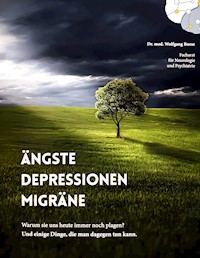
Ängste, Depressionen, Migräne: Warum sie uns heute immer noch plagen? Und einige Dinge, die man dagegen tun kann E-Book
Wolfgang Boese
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eigenverlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch wurde geschrieben, vor allem für Patienten, aber auch für alle diejenigen, welche sich für diese Thematik interessieren. Es ist so konzipiert, dass einzelne Teile unabhängig von einander gelesen werden können. Der 1. Teil befasst sich mit den biologischen Grundlagen der Entstehung von bestimmten Krankheiten. Wer sich aber vor allem für eine bestimme Erkrankung informieren möchte, kann auch mit dem 2. Teil beginnen, am besten ist es dann den allgemeinen Teil des 2. Abschnitts zu lesen und dann das Kapitel, welches besonders interessiert (z.B. die Migräne). Der 3. Abschnitt befasst sich allgemein mit Dingen, welche wir zur Verbesserung unserer Gesundheit und unserer Lebensqualität in der heutigen Zeit (mit allen ihren Vorzügen und allen ihren Schwierigkeiten) unternehmen können. In dieses Buch eingeflossen ist nicht nur das Wissen aus Büchern, Vorträgen, Kongressbesuchen, Seminaren und der Facharztausbildung, sondern vor allem auch die Erfahrung mit über 20.000 Patientinnen und Patienten im Lauf von nun 30 Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zum Autor:
Einleitung
Teil 1: Zu Grundlagen der menschlichen Biologie
Zuerst einige wichtige Begriffe
Woher wir kommen
Das Zusammenleben in ursprünglichen Gesellschaften
Umweltfaktoren
"Die Natur macht nichts Schlechtes." Oder doch?
Unsere Vorfahren - wir können stolz auf sie sein
Die Entwicklung des Nervensystems und des Gehirns
Einige grundlegende Funktionen des Nervensystems
Gleichgewicht von Antrieb und Hemmung
Das vegetative Nervensystem: Sympathikus und Parasympathikus
Fehlregulationen des vegetativen Nervensystems:
Nachteile eines großen Gehirns
Vorteile eines großen Gehirns:
Sprache und Abstraktionsfähigkeit
Aufrechtes Gehen: Freie Hände, Gebrauch von Werkzeug und Feuer
Aufrechtes Gehen: Kooperatives Jagen und gut schwitzen können
Nachteile eines aufrechten Ganges
Komplexe soziale Strukturen
Sexualität und Partnerschaft
Das Zusammenwirken von körperlichen und seelischen Vorgängen
Häufige Gesundheitsstörungen: Haben die auch einen Zweck?
Schmerzen
Angst- und Panikstörungen sowie Zorn
Depressionen
Borderlinestörung
Ein bisschen Paranoia schadet nicht
Sensitivität und Migräne
Zwanghaftigkeit und Ekel
Und warum Europäer bei einer Lungeninfektion Klopapier kaufen
Die Verheißung des Glücks
Angekommen im 21. Jahrhundert.
Und was Homo Sapiens nicht so gut kann:
Kulturentwicklung, Evolution von Memen
Große Gesellschaften
Kontrolle von Instinkten
Reizüberflutung
Gestörte Nachtruhe
Bewegungsmangel
Kopfarbeit
Mathematik
Zu einfache Lösungen für komplizierte Probleme
Nahrungsmittelüberschuss
Luxusgüter
Zurück zum einfachen Leben? Bitte nicht!
Teil 2: Zu Ängsten, Depressionen, Migräne:
Allgemeines:
Multimodale individuelle Behandlung:
Unterschied zwischen Ursache und Auslöser:
Zu diagnostischen Begriffen:
Zu Medikamenten:
Zu pflanzlichen Wirkstoffen:
Zu Spurenelementen und Nahrungsergänzungsmitteln:
Zu Homöopathie:
Angststörungen:
Zur Behandlung von Angststörungen:
Angststörungen - Medikamentöse Behandlungen:
Antidepressiva
Trazodon
Benzodiazepine
Pregabalin
Betablocker
Neuroleptika
Angststörungen – Psychotherapie:
Ängste und Suchtmittel:
Koffein
Nikotin:
Alkohol:
Cannabis:
Weitere Drogen:
Angststörungen - Lebensstilmodifikation:
Depressionen:
Anpassungsstörungen und Burn out
Trauerreaktion
Zur Behandlung von Depressionen:
Depressionen – medikamentöse Behandlungen:
SSRI
SNRI
Bupropion
Trizyklische Antidepressiva
Trazodon
Mirtazapin
Tianeptin
Johanniskraut
Hormonpräparate
Neuroleptika
Depressionen - Phasenprophylaxe (Vorbeugung):
Depressionen - Elektrokrampftherapie (EKT):
Depression - Neurostimulationsverfahren:
Depressionen - Psychotherapie:
Depressionen und Suchtmittel:
Depressionen - Lebensstilmodifikation:
Kopfschmerzen:
Spannungskopfschmerzen und Nackenschmerzen:
Migräne:
Phasen eines Migräneanfalls:
Chronische Kopfschmerzen:
Was also ist Migräne?
Zur Behandlung von Kopfschmerzen:
Kopfschmerzen - Medikamente:
Spezifische Migränemedikamente bei Kopfschmerzattacken:
Kopfschmerzen - Medikamentöse Prophylaxe (Vorbeugung):
Betablocker
Flunarizin
Antiepileptika
Antidepressiva
CGRP - Antagonisten
Botulinumtoxin-Behandlung
Entspannungsverfahren und Biofeedback:
Sport, Bewegung, Haltung und Halswirbelsäulengymnastik:
Elektrotherapie:
Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin:
Stressfaktoren identifizieren:
Ernährung: Gibt es Auslöser?
Kopfschmerzen und Hormone:
Achten auf ausreichend Schlaf:
Kopfschmerzen – Lebensstilveränderungen:
Teil 3: Besser, gesünder leben –
Salutogenese und Resilienz heute
Grundbegriffe:
Was ist eigentlich gesund?
Die kränkliche Gesellschaft
Die gekränkte Gesellschaft
Resilienz und Salutogenese
Die Realität wahrnehmen so wie sie ist
Und die Wahrheit benennen
Achtsamkeit
Die Opferrolle vermeiden
Erkennen, dass man sich in eine unnötige Opferrolle begibt:
Sich entscheiden: Lieber Opfer bleiben?
Oder besser doch Veränderung?
Nicht andere in eine Opferrolle drängen:
Und wie ich einer Kollegin durch mangelnde Fürsorge einmal sehr geholfen hatte:
Nicht delegieren was nicht delegiert werden kann
Verantwortung übernehmen und Schuldzuweisungen vermeiden
Es nicht allen recht machen wollen oder darüber dass man keinen Esel tragen soll
Die notwendigen Unvollkommenheiten akzeptieren
Der Narr muss dem Meister voraus gehen
Ausreichend erholsamer Schlaf
Sich in die Natur begeben
Bewegung
Bewusst Haltung annehmen
Einen Selbstverteidigungskurs machen
Selbstdisziplin
Mit widrigen Umständen umgehen
Ernährung
Angenehme und unangenehme Botschaften achtsam bedenken
Zufriedenheit
Akzeptieren, dass man einmal sterben wird
Epilog
Quellenverzeichnis
Impressum
Ängste
Depressionen
Migräne
Warum sie uns heute immer noch plagen?
Und einige Dinge, die man dagegen tun kann
Dieses Buch wurde geschrieben, vor allem für Patienten, aber auch für alle diejenigen, welche sich für diese Thematik interessieren.
Es ist so konzipiert, dass einzelne Teile unabhängig von einander gelesen werden können.
Der 1. Teil befasst sich mit den biologischen Grundlagen der Entstehung von bestimmten Krankheiten.
Wer sich aber vor allem für eine bestimme Erkrankung informieren möchte, kann auch mit dem 2. Teil beginnen, am besten ist es dann den allgemeinen Teil des 2. Abschnitts zu lesen und dann das Kapitel, welches besonders interessiert (z.B. die Migräne).
Der 3. Abschnitt befasst sich allgemein mit Dingen, welche wir zur Verbesserung unserer Gesundheit und unserer Lebensqualität in der heutigen Zeit (mit allen ihren Vorzügen und allen ihren Schwierigkeiten) unternehmen können.
In dieses Buch eingeflossen ist nicht nur das Wissen aus Büchern, Vorträgen, Kongressbesuchen, Seminaren und der Facharztausbildung, sondern vor allem auch die Erfahrung mit über 20.000 Patientinnen und Patienten im Lauf von nun 30 Jahren.
Impressum:
2021 Boese Wolfgang Dr.
Alle Rechte beim Autor
Zum Autor:
Dr. Wolfgang Boese wurde geboren im Jahr 1963.
Nach Absolvierung des humanistischen Gymnasiums in Salzburg, Studium der Medizin an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Anschließend Praktikum am Ramathibodi Hospital in Bangkok.
Ausbildung zum Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Neurologie und an der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses Rankweil in Vorarlberg, sowie im Krankenhaus Maria Rast in Schruns.
Seit August 2000 Inhaber einer Facharztpraxis für Neurologie und Psychiatrie in Feldkirch/Vorarlberg.
Einleitung
Seit 30 Jahren arbeite ich als Arzt und habe nun seit 20 Jahren eine eigene Praxis für Neurologie und Psychiatrie.
Die Idee, ein Buch zu schreiben hatte ich schon lange, aber immer vor mir hergeschoben. Der konkrete Entwurf dieses Buches hat begonnen im März 2020. Zu diesem Zeitpunkt war ich 56 Jahre alt. Und zu dieser Zeit wurden aufgrund der Covid-19-Pandemie zum ersten Mal in meinem Leben massive Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeit sowie der Bewegungsfreiheit verfügt. Es gab also, neben einem massiven Umsatzeinbruch, vor allem wenig zu tun. Und so schrieb ich an meine Assistentinnen folgenden Satz (Spruch aus dem antiken China):
„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen einige Menschen Mauern. Andere bauen Windmühlen.“
Man kann Hindernisse als Hindernisse sehen. Oder auch als Möglichkeiten. Und so beschloss ich, die plötzlich (und unerbetene) frei gewordene Zeit zu nutzen und konkret an dem Buch zu arbeiten.
Warum habe ich ausgerechnet die drei Themenbereiche Ängste, Depressionen und Kopfschmerzen gewählt? Es handelt sich um komplexe Probleme, welche sehr häufig Thema in der Praxis des Neurologen und Psychiaters sind. Des Weiteren besteht zwischen diesen Bereichen eine durchaus erhebliche Komorbidität. Das bedeutet, dass das Vorhandensein einer dieser Gesundheitsstörungen das Auftreten einer der anderen Störungen begünstigt. Und sie können sich in wechselhafter Weise negativ beeinflussen.
Die Thematik ist komplex und ist es daher nicht möglich, eine einfache, schnelle Lösung anzubieten. Tut mir leid. Ratgeber, welche Dinge verheißen wie: „Essen und gleichzeitig schlank werden“, „Mit dieser einen Methode nie mehr Schmerzen“, „Durch zwei Übungen keine Rückenbeschwerden mehr“, und so weiter, machen lediglich falsche Versprechungen, welche in der Praxis nicht erfüllt werden können. Es ist aber durchaus möglich, mehr Verständnis zu gewinnen für verschiedene Aspekte der beschriebenen Gesundheitsstörungen. Darüber hinaus gibt es sehr wohl eine Menge Möglichkeiten zur Behandlung von chronischen Gesundheitsstörungen und Verbesserung der Lebensqualität. Wenn sie auch nicht einfach umzusetzen sind und Geduld sowie Ausdauer benötigen, können sie dennoch sehr wirksam sein, vor allem längerfristig.
Gesundheit und Lebensqualität sind nicht etwas, das man einfach hat, oder was sich - auch nicht in der modernen Medizin - mit viel Geld schnell erwerben lässt. Hinter Wohlbefinden und Gesundheit stehen Prozesse, welche immer wieder angestoßen werden müssen. Dabei benötigt es immer auch die Eigenverantwortung, um das Leben in die Hand zu nehmen und positiv zu gestalten.
In diesem Buch sollen Aspekte dargelegt werden, welche hierfür wichtig sind. Damit die Darlegung möglichst klar ist, verzichte ich ganz bewusst auf die heutzutage weit verbreitete speech correctness. Wenn zum Beispiel von Patienten die Rede ist, dürfen sich alle angesprochen fühlen, ob männlich, weiblich, transgender oder keinem Geschlecht zugehörig, ob jung oder alt und alle Leser können hoffentlich von dem einen oder anderen Teil dieses Buches profitieren.
Das Buch gliedert sich in drei Abschnitte, welche auch unabhängig voneinander gelesen werden können:
Der erste Abschnitt befasst sich mit biologischen Grundlagen unseres körperlichen, sozialen und mentalen Daseins, sowie den daraus resultierenden Grundlagen für bestimmte Gesundheitsstörungen.
Der zweite Abschnittl befasst sich speziell mit Angststörungen, Depressionen und Kopfschmerzen, insbesondere Migräne sowie den Therapiemöglichkeiten.
Der dritte Abschnitt befasst sich mit Aspekten unserer Lebensführung und ihrer Bedeutung, nicht nur zur Entstehung von Krankheiten sondern auch zur Entstehung von Gesundheit. Hierfür ist die Entwicklung von Resilienz (bedeutet hier sowohl körperliche, als auch seelische Widerstandskraft) besonders wichtig.
Wer eher an bestimmten Gesundheitsstörungen interessiert ist, kann gleich mit dem zweiten Abschnitt beginnen. Zuerst mit dem allgemeinen Teil und dann mit dem Kapitel, welches besonders interessiert, z.B. der Migräne.
Wer eher an allgemeinen Aspekten der Lebensführung interessiert ist, kann auch mit dem dritten Teil beginnen. Von diesem sind zwei Dinge besonders wichtig, welche aus meiner Sicht die Basis für alles Weitere bilden, nämlich:
Die Realität so wahrnehmen, wie sie ist.
Die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und sein Glück nicht an Andere (Mitmenschen, Eltern, Vorgesetzte oder die Gesellschaft im Allgemeinen und so weiter) zu delegieren.
Wem ein grundlegenderes Verständnis der Gesundheitsstörungen wichtig ist, sollte aber auch den ersten Teil des Buches lesen. Ein Verständnis für biologische Zusammenhänge verhilft zu einem besseren Umgang mit der Thematik, sowie auch zur Erkenntnis, dass es sich bei Angststörungen, Depressionen und Kopfschmerzen nicht einfach nur um Krankheiten handelt, sondern darüber hinaus um wichtige Aspekte unserer Biologie und damit unseres Daseins.
Teil 1: Zu Grundlagen der menschlichen Biologie
Zuerst einige wichtige Begriffe
Evolution (Lateinisch: Entwicklung)
Die Entwicklung der Lebewesen ist andauernden Veränderungen unterworfen und es hat sich je nach Umweltbedingungen eine große Vielzahl von biologischen Merkmalen herausgebildet.
Die zahllosen Anpassungsvorgänge und die Entstehung der enormen Artenvielfalt werden von der Evolutionstheorie sehr gut beschrieben und sie erklärt, wie sich beispielsweise Körperbau und Körperfunktionen im Rahmen von Umweltanpassungen entwickelten, zum Beispiel warum Parasiten existieren und Abwehrmechanismen gegen eben diese Parasiten, warum es in der Natur zahllose Giftstoffe gibt und Pflanzenfresser dennoch prächtig gedeihen können, warum es Pfauenfedern und überhaupt Federn gibt, Stacheln für den Igel, Vögel und Fledermäuse Flügel entwickelt haben, Pinguine und Sträuße das Fliegen wieder verlernt haben und vieles mehr. Vor allem erklärt die Evolutionstheorie auch wie, warum und mit welchen Eigenschaften sich unsere Vorfahren entwickelt haben.
Voraussetzungen dafür, dass Evolution im biologischen Sinn stattfinden kann sind:
Vererbung
Mutation
Selektion
Vererbung
Das, was vererbt wird, ist durch die Gene bestimmt. Die genetische Information (sozusagen der Bauplan und die Funktionsanweisung für den Organismus) wird in Form von Desoxyribonukleinsäure (DNS bzw. englisch DNA) an die nächste Generation weitergegeben. Die Struktur der DNA bestimmt, welche Proteine zu welchem Zeitpunkt in den Zellen produziert werden und entscheidet daher darüber, welche Merkmale von der einzelnen Zelle bis zum gesamten Körperbau ausgebildet werden.
Mutation (Lateinisch: Veränderung)
Es kommt bei der Weitergabe von Genen an die Nachkommenschaft andauernd zu Änderungen der DNA-Struktur. Mutationen können neutral, günstig, ungünstig und sowohl günstig als auch ungünstig sein. Welchen Effekt Mutationen letztendlich haben, hängt von den jeweiligen Umweltbedingungen ab.
Die gesamte Genausstattung der Individuen einer Art ändert sich einerseits durch die Mutation einzelner Gene. Andererseits ändert sich die Genausstattung mittels Durchmischung der Gene im Rahmen der sexuellen Fortpflanzung. Dadurch entstehen in jeder neuen Generation zahllose neue Kombinationen von Genvarianten, welche wiederum zu veränderten Merkmalen führen können. Darüber hinaus ist es wichtig, welche Abschnitte der DNA aktiviert oder inaktiviert werden, dies nennt man epigenetische Faktoren.
Die evolutionäre Entwicklung baut dabei immer auf dem auf, was bereits vorhanden ist.
Es ist nicht so dass plötzlich ein völlig neues Merkmal von einer zur nächsten Generation auftaucht (also geschah es nicht, dass einer unserer Urahnen auf 4 Beinen lief und seine Kinder plötzlich Hände hatten). Sondern von einer zur nächsten Generation verändern sich bereits vorhandene Merkmale ein wenig und über viele Generationen können
Körperstrukturen und Funktionen eine neue Bedeutung erlangen. Zum Beispiel verwendeten unsere Vorfahren die vorderen Extremitäten zuerst zum Klettern in Bäumen. Da bereits eine gute Greiffunktion vorhanden war, konnten später auch andere Dinge mit den vorderen Extremitäten gegriffen werden, z.B. Steine oder Äste. Mit der Zeit entwickelte sich eine immer geschicktere Handfunktion. Einige Vögel wie Strauße haben sich wie die Vorfahren der Menschen einmal auf das Laufen spezialisiert. Flügel konnten aber nicht schnell mal zu solchen Extremitäten umfunktioniert werden, mit denen ein geschicktes Greifen möglich war und haben sich die Flügel einfach mangels Gebrauch zurückgebildet.
Selektion (Lateinisch: Auslese, Auswahl)
Es geht dabei um die Auswahl der Individuen, welche ihre Gene weitergeben können. Das geschieht im Zusammenspiel von durch die von den Genen (einschließlich deren Mutationen sowie durch deren Durchmischung) bedingten Eigenschaften auf der einen Seite. Und den jeweiligen Umweltbedingungen auf der anderen Seite, wobei sich die Umweltbedingungen andauernd verändern. Es werden insgesamt Merkmale, welche unter den gegebenen Bedingungen vorteilhaft sind, vermehrt an die Nachkommenschaft weiter gegeben. Weniger vorteilhafte Merkmale bilden sich zurück. Individuen mit ungünstigen Eigenschaften haben schlechtere Chancen, ihre Gene weiter zu geben. Und vielfach spielt außerdem der Zufall eine Rolle.
Selektion bedeutet auf keinen Fall, dass sich immer der Stärkere durchsetzt. Die Selektion von positiven Merkmalen bedeutet auch nicht ausschließlich einen andauernden Kampf. Kämpfe von Individuen einer Art untereinander oder zwischen verschiedenen Arten sind zwar durchaus häufig, aber es gibt eine Menge anderer Überlebensstrategien. Oft ist Kooperation erfolgreicher. Und das nicht nur mit Individuen der gleichen Art, sondern auch mit anderen Arten. Beispielsweise kommen Raubfische an Korallenriffen mit Putzerfischen hervorragend zurecht, da ihnen diese Putzerfische Parasiten entfernen. Für die Putzerfische wiederum bedeutet dies eine sichere und leicht zu erlangende Mahlzeit. Andere Beispiele wären die Kooperation von Ameisen und Blattläusen, Termiten mit Pilzen, welche sie in Gärten züchten oder Mensch und Wolf beim gemeinsamen Jagen.
Nicht immer behauptet sich somit die stärkere Art, sondern eine, welche z.B. sozialer ist oder geschickter, beweglicher, besser getarnt ist, lange Ruhepausen wie einen Winterschlaf einlegen kann, bestimmte Lebenszyklen entwickelt (Singzikaden paaren sich zum Beispiel alle 17 Jahre, daran können sich ihre Fressfeinde nicht gut anpassen) oder sich schneller vermehren kann. Auch Rückzug in extreme Regionen kann helfen, Kaiserpinguine brüten auf den Eisfeldern der Antarktis, allen Beutegreifern ist es dort einfach zu kalt, um überhaupt zum Brutplatz hin zu kommen.
Selektion gegenüber Artgenossen und sexuelle Selektion:
Selektion geschieht immer auch innerhalb einer Art. Hat sich eine Art gerade erfolgreich angepasst an die aktuellen Umweltbedingungen, dann haben alle in etwa die gleiche Chance, ihre Gene weiterzugeben, sofern alle Individuen im wesentlichen mit den gleichen Genen ausgestattet sind. Dadurch kommt es zu einem Selektionsdruck innerhalb der eigenen Art: Sind alle gleich, dann ist man dann erfolgreicher in der Weitergabe seiner Gene wenn man sich in irgendeinem Merkmal von den anderen unterscheidet. Ein sehr schönes Beispiel sind die Pfauen und die Paradiesvögel. Die bunten Federn der Männchen sind für das Überleben an sich nutzlos oder sogar hinderlich. Sie liefern keinen Beitrag zu Nahrungssuche, Widerstandskraft gegen Infektionen, Schutz vor Beutegreifern. Das Männchen mit den schöneren Federn präsentiert aber damit den Weibchen seine besondere Fitness und kommt daher bei der Paarung eher zum Zug als der biedere gut getarnte graubraune Vogel.
Oder wenn alle Rechtshänder sind, ist es ein Vorteil, der einzige Linkshänder im Stammesdorf zu sein, zumindest dann, wenn es häufig zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt (also in den allermeisten Zeiten der Menscheitsgeschichte). Die anderen sind es ja immer gewohnt gegen Rechtshänder zu kämpfen und werden schneller mal unvermutet von der linken Faust getroffen. Ein paar gewonnene Rangkämpfe verbessern die Aussichten auf Weitergabe der Gene des Linkshänders. Gibt es aber zu viele Linkshänder verschwindet dieser Vorteil wieder.
Unsere Vorfahren waren diejenigen, welche nicht nur die Selektion durch die Umwelt überstanden hatten, sondern sich auch innerhalb ihrer Gruppe ausreichend durchgesetzt haben. Für den Menschen als soziales Wesen ergab und ergibt sich einerseits die Notwendigkeit der Anpassung an die Gemeinschaft, andererseits die Notwendigkeit der Konkurrenz untereinander.
Exponentielles Wachstum
Dies bedeutet eine Verdoppelung in regelmäßigen Zeitintervallen durch ein regelmäßiges prozentuelles Wachstum. Das ist äußerst wichtig bei der Betrachtung der Ausbreitung von kleinen Populationen in ressourcenreichen Gebieten, ebenso des globalen Bevölkerungswachstums, der Ausbreitung von Epidemien in einer immunologisch nicht angepassten Bevölkerung, des Wirtschaftswachstums und vieler anderer Dinge. Für das menschliche Gehirn ist exponentielles Wachstum mit allen seinen Konsequenzen nur schwer zu begreifen.
Darum ein Beispiel: Die Bevölkerung eines großen Landes verdoppelt sich alle 30 Jahre. In diesem Land lebt ein einziges Paar, Adam und Eva. Die Beiden bekommen Kinder, von denen 4 das Erwachsenenalter erreichen, diese wiederum nach 30 Jahren 8 Kinder, nach weiteren 30 Jahren sind es 16, und so weiter. Nach 300 Jahren leben 1048 Menschen, was in einem großen Land als sehr geringe Bevölkerungsdichte erscheint. Nach 600 Jahren sind es 1 Million (noch nicht so viel), nach 900 Jahren über 1 Milliarde und in 1200 Jahren wären es über 1 Billion (Also das Millionenfache einer Million. Faktisch hat Hunger, Krieg oder anderes Übel natürlich das Wachstum längst vorher gestoppt!). Bei Betrachtung des exponentiellen Wachstums wird auch klar ersichtlich, dass in einer endlichen Welt zwar längerfristiges, aber niemals dauerhaftes prozentuelles Wirtschaftswachstum geben kann!
Für die Betrachtung der Evolutionsbiologie ergibt sich, dass kleine Populationen unter günstigen Bedingungen zuerst rasch wachsen und immer an den Punkt kommen, an dem das Wachstum durch Mangel an Ressourcen oder andere ungünstige Umstände begrenzt wird. Daraus ergibt sich wiederum, dass die meisten Lebewesen - einschließlich dem Großteil unserer Vorfahren! - regelmäßig mit Mangel an Nahrungsmitteln und anderen Ressourcen zu kämpfen hatten und haben. Kleinen Bevölkerungen ging es oft gut, großen praktisch immer schlecht! Deswegen haben sich in allen Arten Strategien entwickelt, mit Ressourcenknappheit in der einen oder anderen Form umzugehen, einschließlich beim Menschen. Solche, die keine passenden Strategien entwickelt haben sind ausselektiert worden.
Unsere Biologie ist auf die Bewältigung von Mangelzuständen ausgerichtet. Der Wille zu überleben, Gier und Hunger haben über Millionen von Jahren unseren Körper und unseren Geist geprägt.
Pleistozän
Das Pleistozän begann vor 2,588 Millionen Jahren und endete vor 11700 Jahren. Seit Beginn des Pleistozäns kommt es zu zyklischen Vereisungen der Nordhalbkugel unseres Planeten (die Antarktis ist seit circa 34 Millionen Jahren bereits vergletschert). Die Kaltzeiten dauerten meist 100.000 bis 200.000 Jahre und wurden unterbrochen von relativ kürzeren Erwärmungsphasen von einigen 1000 bis einigen 10.000 Jahren. Durch die andauernd wechselnden klimatischen Bedingungen entstand im Pleistozän ein hoher Anpassungsdruck auf Pflanzen und Tiere. Unter anderem entwickelten sich in dieser Zeit in Afrika die Hominiden und schlussendlich Homo Sapiens (also wir).
Holozän
Dieses Zeitalter beginnt vor 11700 Jahren und dauert bis Heute. Der Beginn des Holozäns war das Ende der letzten Eiszeit, es kam zu einer Erwärmung, Abschmelzen eines Großteils der Gletscher im Norden, Anstieg des Meeresspiegels und feuchterem Klima. Diese veränderten klimatischen Bedingungen ermöglichten die Entwicklung von Landwirtschaft in Süd- und Mittelamerika, Mesopotamien und der Levante, sowie Indien und China. Mit dem Beginn des Holozäns und der Landwirtschaft änderten sich die Lebensbedingungen der Menschen grundlegend. Landwirtschaft ermöglichte, dass mehr Menschen ernährt werden konnten, allerdings war die Ernährung für den Einzelnen wahrscheinlich gleichzeitig schlechter geworden und weniger abwechslungsreich als für die Jäger und Sammler. Mehr Menschen und kollektives Betreiben von Landwirtschaft bedingte die Entwicklung von größeren Gesellschaftsstrukturen und letztendlich Staaten.
Hominiden (Menschenaffen)
Dieser Begriff wird unterschiedlich verwendet. Zur Gruppe der Hominiden wurden früher die Menschen und „nahe Verwandte“ gezählt wie Australopithecus, Homo erectus, Neandertaler, Denisovamenschen. Heutzutage werden von vielen Wissenschaftlern auch Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen zu den Hominiden gerechnet. Die Hominiden entwickelten sich seit 5 - 7 Millionen Jahren in Afrika.
Unter den wechselnden klimatischen Bedingungen des Pleistozäns kam es immer wieder zur Herausbildung zahlreicher neuer Hominidenarten, uns eingeschlossen.
Homo Sapiens
Dieser Begriff bedeutet wissender oder auch vernünftiger Mensch. Damit bezeichnen wir also uns selbst. Durch Fossilfunde ist belegt, dass Homo Sapiens, also unsere direkten Vorfahren, bereits vor etwa 300.000 Jahren in Afrika existierten. Vor circa 100.000 Jahren begannen unsere Vorfahren sich über die Grenzen von Afrika hinaus auszubreiten.
Woher wir kommen
Der moderne Mensch entwickelte sich vor circa dreihunderttausend Jahren im südlichen oder östlichen Afrika.
Gedanken an die frühe Menschheitsgeschichte werden heutzutage oft mit romantisierenden Vorstellungen verbunden. Die Menschen lebten in Eintracht mit der Natur in kleinen Gruppen und in Harmonie miteinander... in Afrika, ein weiter Kontinent mit vielgestaltiger Landschaft in der sich Savannen und Wälder abwechseln, reich an Nahrungsmitteln, angenehme klimatische Bedingungen.
... Hier müssen wir leider die STOPTASTE drücken. Stimmt in dieser Form nicht. Überhaupt nicht. Leider.
Das Zusammenleben in ursprünglichen Gesellschaften
Hartnäckig hält sich der Gedanke von dem edlen Frühmenschen, der noch nicht von der Zivilisation verdorben war und in Harmonie mit der Natur sowie mit seinesgleichen lebte. Dies ist eine Vorstellung, welche sich vor etwa 200 Jahren im Zeitalter der Romantik entwickelt hatte und von europäischen Philosophen (welche niemals selbst indigene Völker besucht hatten!) z. B. Rousseau geprägt wurde. Auch unter anderem von Karl Marx wurde die Vorstellung eines idealen Urzustandes der Menschheit übernommen, in welchem die Menschen frei gleich und gerecht waren, keine staatlichen Organisation und keine Gefängnisse brauchten. Eine Gesellschaft in der jeder nach seinen Fähigkeiten sich einbrachte und jeder seine Bedürfnisse stillen konnte.
Es handelte sich dabei aber nicht um anthropologische Erkenntnisse! Sondern es waren idealisierte Gegenentwürfe zu den negativen Auswüchsen der europäischen Zivilisation oder zu einer als leidvoll erlebten Gegenwart überhaupt.
Vielleicht war die Idealisierung von "Naturvölkern" außerdem Ausdruck und Kompensation eines schlechten Gewissens, nachdem man sie kolonialisiert, zwangsmissioniert, versklavt und ihre Stammeslande ethnisch gesäubert hatte.
In Europa sind diese Vorstellungen zusätzlich - ohne dass wir es meistens bewusst wahrnehmen - mitgeprägt von der Vorstellung eines früheren Paradieses, in dem die Menschen glücklich lebten, solange sie die Gebote Gottes nicht übertraten. Die Geschichte von Adam und Eva im Paradies wird den Kindern in Europa immerhin schon seit über 1000 Jahren gelehrt und ist in unserer Kultur verinnerlicht. Psychologisch gesehen handelt es sich bei der Idee von einem paradiesischen Urzustand wohl auch um eine Rückerinnerung an eine frühe Zeit der kindlichen Geborgenheit.
Die historische Realität ist aber eine andere.
Inzwischen existieren zahlreiche anthropologische Untersuchungen über indigene Völker, aus denen man Rückschlüsse auf unsere Vorfahren ziehen kann. Wissenschaftler können darüber hinaus immer besser fossile Spuren interpretieren. Das Leben unserer Vorfahren war sicher nicht einfach, und das Zusammenleben für Homo Sapiens mit seinesgleichen nur selten harmonisch. Gewalt untereinander ist in indigenen Völkern sehr häufig, sowohl innerhalb der Gruppe, als auch unter verschiedenen Gruppierungen in Form von Stammeskriegen. Bevor die Europäer Amerika und Afrika betraten, waren Kriege unter den Stämmen die Regel. Und aus archäologischen Funden weiß man, dass schon vor vielen Tausend Jahren bereits sich die Menschen organisiert hatten, um größere Schlachten gegeneinander zu führen. Gefängnisse gibt es bei „Naturvölkern“ zwar nicht, sehr wohl aber die Todesstrafe und die Gründe für eine Exekution können vielfältig sein. Allein der Verdacht, von einem bösen Geist befallen zu sein, kann ausreichen. Bei den Achè in Paraguay kann man schon dann von den Kollegen erschlagen werden, wenn man der Gruppe einfach nur zur Last fällt. Des Weiteren haben die meisten indigenen Völker besondere Tabus. Diese zu brechen wird regelmäßig mit Tod oder Verbannung bestraft (Verbannung war nur mit einer geringen Chance verbunden zu überleben). Wenn ein paar Jäger sich auf eine mehrtägige Expedition aufmachten und einer krank wurde, dann ließ man den Kranken üblicherweise zurück. Hatte er Glück und wurde wieder gesund, konnte er sich wieder den anderen anschließen. Wahrscheinlich gibt es in den ursprünglichen Sprachen kein Wort für die Übersetzung des unseres Begriffes „soziale Sicherheit“.
In kleinen Gruppen war zwar keine staatliche Organisation in unserem Sinne erforderlich und sind kleine Gruppen überschaubar genug, dass sich jedes Mitglied auf seine Weise irgendwie einbringen kann, allerdings immer nur im Rahmen bestehender Hierarchien (welche übrigens von Volk zu Volk äußerst unterschiedlich ausgeprägt sind), der gruppenspezifischen Moralvorstellungen und vor allem unter Beachtung der jeweils geltenden Tabus. Diese Einschränkungen können äußerst streng sein.
Leben war immer ein Überleben.
Umweltfaktoren
Klimatische Bedingungen und andere Umweltbedingungen waren tatsächlich günstig für die Entwicklung der Spezies Mensch. Aber es war alles andere als angenehm und nicht das, was man in Reiseprospekten vermittelt bekommt.
Die Landschaft war vielfältig strukturiert, bot dichte Baumbestände und offene Savannen und tatsächlich ein reichhaltiges Angebot an pflanzlicher und tierischer Nahrung. Es half den Menschen dabei sehr, dass sie äußerst flexibel auf verschiedenste Nahrungsmittel zugreifen können. Koalas sind zum Beispiel dagegen sehr spezialisiert: Sie brauchen Eukalyptusblätter zum Essen. Wo es keine Eukalyptuswälder gibt, dort gibt es keine Koalas. Menschen können sich dagegen von allem Möglichen ernähren, von Wild ebenso wie von Insektenlarven, Fischen Muscheln, oder Wurzeln, Blättern, Gräsern, Früchten. Selbst von der Muttermilch anderer Tiere. Dennoch war die Konkurrenz groß und Nahrung keinesfalls leicht verfügbar
Das Klima war häufigen Veränderungen unterworfen seit Beginn des Pleistozäns vor etwa 2,588 Millionen Jahren. Seit dieser Zeit kommt es zu zyklischen Vereisungen der nördlichen Regionen unterbrochen von kurzen Warmzeiten. Die andauernden klimatischen und ökologischen Veränderungen erzeugten einen hohen Anpassungsdruck.
Neben Anpassungen an längerfristige Veränderungen mussten auch die kurzfristigen Veränderungen bewältigt werden. Am Vormittag herrschten meistens angenehme Temperaturen, im Tagesverlauf wurde es aber recht heiß, und die Nächte können auch in Afrika recht kalt werden. Dazu kamen Trockenzeiten und Regenzeiten. Mit diesen kurzfristigen Veränderungen kam Homo Sapiens zurecht.
Dann forderte die Auswanderung aus Afrika wiederum erhebliche Anpassungen an zahlreiche neue Gegebenheiten. In Europa und im nördlichen Asien mussten - und konnten - auch die strengen Winter überlebt werden, da der Mensch dank seines Großhirns und der Möglichkeit, zahlreiche unterschiedliche Nahrungsquellen für sich zu verwenden, mit einer erheblichen Flexibilität ausgestattet ist. Außerdem war Feuer beherrschbar und konnte das fehlende Fell durch Kleidung kompensiert werden.
Darüber hinaus überstanden unsere Vorfahren Parasiten, Infektionskrankheiten, Gifttiere, giftige Pflanzen und Pilze, außerdem kleine sowie größere Beutegreifer. Und mit den Mitmenschen musste man ja auch noch zurecht kommen!
Die Anpassungen betreffen natürlich nicht nur den Menschen sondern alle lebendigen Organismen. Tiere lassen sich nicht gerne jagen und Pflanzen zum Beispiel „möchten“ nicht gegessen werden. Deswegen produzieren Pflanzen zahlreiche Giftstoffe oder mechanische Abwehrmethoden wie Dornen, Wachsschichten usw. Tiere welche Pflanzen verzehren verfügen - so wie der Mensch - wiederum über zahlreiche biochemische Ausstattungen verfügt, mit denen Gifte mehr oder weniger gut neutralisiert werden können.
Das ergibt einen steten Wettstreit zwischen z.B. Pflanzen welche immer wieder neue Gifte produzieren und Pflanzenessern welche immer neue Entgiftungsmethoden entwickeln.
Teilweise setzt sich auch hier Kooperation zum gegenseitigen Vorteil durch: Die Pflanze produziert neben Dornen Giften usw. Teile welche sie „zum Verzehr anbietet“ wie Früchte oder Blüten. Dadurch werden die Samen der Pflanze besser verbreitet, und die Pflanzenesser haben mehr Nahrung. Oft gilt das Angebot allerdings nur sehr exklusiv für einzelne Arten. Die Früchte der Tollkirschen zum Beispiel sind für manche Vogelarten und Schnecken genießbar, für die meisten Säugetiere und die meisten Vögel dagegen ziemlich giftig.
Im Rahmen der evolutionären Entwicklung hat der Mensch gelernt, Pflanzen zu züchten und an seine Bedürfnisse anzupassen. Aber auch Weizen, Reis usw. gewinnen einen Vorteil. Die Pflanze bietet dem Menschen Nahrung, dafür sorgt der Mensch für ihre Ausbreitung, ausreichend Wasser und Schutz vor Insekten sowie vor Überwucherung durch Unkraut.
Die Zeit ab dem Ende des letzten Vereisungszyklus vor 11.700 Jahren wird als Holozän bezeichnet. Seit damals entwickelten die Menschen unter nun für sie günstigeren Bedingungen Landwirtschaft und größere staatliche Strukturen. Staatenbildung und mehr Nahrung bedeutete mehr Bevölkerung, aber für die einzelnen Menschen war das Leben weiterhin hart. Die Ernährung wurde mit der Landwirtschaft einseitiger, da vorzugsweise einige wenige Pflanzen kultiviert wurden. Die Bevölkerung wuchs teils rasch und konnte prinzipiell solange wachsen, wie Nahrungsquellen erschlossen werden konnten. Eine größere Bevölkerungsdichte begünstigt die Ausbreitung von Seuchen, und kurzfristige Wetterkapriolen konnten Hungersnöte bewirken.
Und rasch verstanden einige Homo Sapiens, dass die Arbeit in der Landwirtschaft mühseliger ist, als die Nahrung von anderen zu nehmen. Man konnte andere berauben oder versklaven. Gegen solche üblen Artgenossen lernte man aber auch, sich zu schützen. Nicht nur mit Stadtmauern. Mit besserer Organisation und fortschrittlicheren Waffen konnten Kriege nun in größerem Ausmaß geführt werden. Und es waren die staatlichen Strukturen sehr rigide. Dies beschreibt zum Beispiel das Gilgamesch-Epos, welches weit über 3.000 Jahre alt ist. Von diesem Gilgamesch, einem legendärem Stadtkönig von Uruk in Mesopotamien heißt es ebendort: „….gezückt sind seine Waffen. Mit dem Pukku hält er seine Genossen in Schach, ständig lässt er die jungen Leute grollend umhergehen, Gilgamesch lässt den Sohn nicht zum Vater, Tag und Nacht treibt er ihn an mit Macht …“ Die genaue Bedeutung eines Pukku ist unbekannt, möglicherweise war es eine Art Hockeyschläger. Jedenfalls wussten die Menschen in Babylonien und Assyrien, welche diese Geschichte aufgeschrieben hatten, was es bedeutete, wenn der Stadtkönig mit seinem Gerät daherkam: Man hatte zu gehorchen, hart zu arbeiten und die Befindlichkeit der Menschen interessierte die Herrscher nicht. Zumindest aber schützten die Herrscher ihre Untertanen vor den Räubern, welche von auswärts kamen. Kollektive freier selbstbestimmter Menschen dagegen waren anderen gegenüber vergleichsweise wehrlos.
Zusammengefasst:
Die Bedingungen waren also gegeben, dass Menschen überleben konnten, aber für die Menschen nur selten angenehm und schon gar nicht harmonisch. Die meiste Zeit unserer Geschichte war von einem Mangel an Nahrung geprägt. Nur unter günstigen Bedingungen kommt es zu Wachstum der Population, das aber dann sehr schnell (exponentiell) geht. Das geht so lange bis Ressourcenknappheit herrscht, also Hunger oder andere ungünstige Faktoren wie Seuchen oder Kriege die Bevölkerungszahl reduzieren. Im Laufe der Geschichte litten also immer viele an Hunger während nur wenige unter günstigen Bedingungen sich sattessen und friedlich leben konnten. Hunger bewirkt eine Verschärfung des Konkurrenzkampfes, da einfach nicht alle eine Hungerperiode überleben konnten. Und wir sind die Nachkommen von zahlreichen Ahnen welche Hungerperioden irgendwie überlebt haben.
"Die Natur macht nichts Schlechtes." Oder doch?
Im Licht der Evolution gibt es kein gut oder schlecht im moralischen Sinne. Eigenschaften und Verhaltensweisen wirken sich entweder günstig oder ungünstig aus.
Andererseits muss es für jedes Wesen, das irgendetwas wahrnehmen und die Wahrnehmung erleben kann, ein gut oder schlecht im Sinne von angenehm oder unangenehm (und außerdem neutral) geben. Und dies ist gleichbedeutend mit nützlich oder schädlich. Nahrung ist zum Beispiel gut, etwas Verdorbenes, Giftiges ist schlecht. Hunger ist unangenehm, essen ist angenehm. Gutes muss angestrebt werden, schlechtes vermieden werden. Eine fehlende Empfindungsfähigkeit für das, was angestrebt werden soll und dem, was vermieden werden soll, ist mit dem Überleben nicht vereinbar. Wozu essen wenn Hunger nicht unangenehm ist und Nahrung nicht schmeckt? Oder warum nicht ohne jegliche Umsicht auf einen steilen Felsen klettern, wenn das Herunterfallen keine Unannehmlichkeit darstellt?
Ein Adler handelt aus Sicht des Adlers "gut" wenn er einen Hasen fängt. Für den Hasen sind die Jagdfähigkeiten des Adlers "schlecht", und der Hase dann gut, wenn er eben diesem Adler rechtzeitig davon läuft. (Wenn es ein Hasenmännchen ist. Hasenweibchen laufen nicht immer davon, sondern attackieren durchaus mal einen angreifenden Adler mit Tritten, um ihre Kinder zu schützen. Das kann dem Adler schon mal eine Rippe brechen.)
Bestimmte Eigenschaften sind im Rahmen konkreter Umweltbedingungen entweder förderlich, dann breiten sich die Eigenschaften aus oder sie sind hinderlich, dann bilden sich die Eigenschaften eben zurück. Für den Adler ist es förderlich, effizienter zu jagen, dem Hasen dagegen nützt es, schneller zu rennen oder sich geschickter zu verstecken.
Es macht überhaupt keinen Sinn, in der Biologie „gut“ oder „schlecht“ im Sinne moralischer Kategorien anzuwenden. Moralische Kategorien entwickelten sich erst später im Rahmen der Evolution von Kultur und Religion.
Es können daher auch der Mensch und seine natürlichen Eigenschaften an sich weder gut noch schlecht im moralischen Sinne beurteilt werden. Dies ist wichtig, wenn man die Geschichte oder jetzt existierende indigene Völker betrachtet. Viele Vorgänge, Vorschriften, Bräuche und so weiter mögen aus unserer Sicht komisch, fremd, bösartig oder abstoßend wirken. Alles hat sich aber irgendwann einmal entwickelt, da es unter speziellen Umständen zum Überleben einmal förderlich war.
Ebenso sind Kategorien wie "schön" "oder hässlich" keine objektiven Maßstäbe, sondern unterliegen biologischen Vorgaben und beim Menschen nun auch sehr der kulturellen Entwicklung.
Es ist zum Beispiel moralisch oder ästhetisch an sich weder gut noch schlecht, dass der Mensch im Lauf seiner Evolution den Großteil seines Fells verloren hat. Der Effekt war schlicht und einfach der, dass er dadurch schwitzen kann und damit seine Körpertemperatur besser regulieren kann, was nützlich ist beim Laufen über lange Strecken. Allerdings waren die kalten Nächte für den Menschen dadurch wiederum ein größeres Problem. Anpassungen haben immer auch einen Preis, der mal gering, mal hoch sein kann. In Afrika war der Fellverlust immerhin zu einem "vertretbaren Preis" möglich und durch die Innovation der Feuerbeherrschung kompensierbar. Hätte sich die Menschheit nicht in Afrika sondern in Sibirien entwickelt, wäre ein Verlust der Fellbehaarung nicht mit dem Überleben vereinbar gewesen.
Wir würden einen Menschen mit Fell aufgrund unseres gewohnten Menschenbildes eher als hässlich empfinden. Wäre unsere Welt aber andauernd kalt und hätten wir keine technischen Mittel, um uns zu wärmen, würden wir Schwiegerkinder mit reichlich Körperbehaarung als attraktiv für unsere Kinder ansehen und hoffen, dass auch unsere Enkel mit viel Fell auf die Welt kommen.
Für das, was aus der Natur kommt, gibt es kein allgemein gültiges gut oder schlecht. Die Eigenschaften aller Lebewesen entwickeln sich in andauernder Anpassung an wechselnde Umweltbedingungen und Anpassung untereinander.
Unsere Vorfahren - wir können stolz auf sie sein
Keine Sorge, ich möchte keine Konflikte mit Ihren Eltern oder Großeltern ansprechen, es geht um die entfernteren Vorfahren. Bevor Sie auf die Welt kamen, hatten Sie zwei Eltern, davor vier Großeltern, acht Urgroßeltern und da auch Uroma und Uropa nicht aus dem Nichts heraus in die Welt traten, hatten diese wiederum Eltern und Großeltern. Betrachten Sie dies immer weiter, kommen Sie zurück zu Ihren Vorfahren in der Neuzeit, davor im Mittelalter, in der Antike, vielleicht war unter den Vorfahren irgendein mittelalterlicher Tuchhändler oder eine germanische Kriegerin, oder der eine oder andere Angehörige eines asiatischen Reitervolkes, welcher römische Städte plünderte oder auch ein römischer Legionär, welcher eben diese Stadt ein paar Hundert Jahre vor den Galliern erobert hatte und eine Gallierin (ebenfalls Ihre Ahnin) zur Sklavin gemacht hatte. Weiter zurück geht es über die Bronzezeit zur Jungsteinzeit, dann zur Altsteinzeit.
Die Vorfahren in der Steinzeit waren uns von der biologischen Ausstattung her sehr ähnlich. Die Menschenart, die damals existierte und deren Linie bis zu uns führt, nennt sich Homo Sapiens. Homo Sapiens entwickelte sich langsam vor etwa 300.000 Jahren, soweit derzeit bekannt ist. Noch weiter zurück, kommen wir zu einer Gruppe von Hominiden, welche sehr menschenähnlich waren. Über einige Millionen Jahre geht es dann weiter zurück zu affenartigen Vorfahren, noch weiter zu kleinen Säugetieren, welche irgendwie den großen Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren überlebt haben, und so weiter. Im Prinzip ließe sich für jeden Einzelnen von uns einen Stammbaum aufzeichnen, welche bis über 3 Milliarden Jahre zu den ersten Einzellern zurück reicht. Im Laufe der Entwicklung gab es zahllose Anpassungen an die jeweiligen Umweltbedingungen. Der Bauplan des Körpers wurde über die DNA jeweils an die nächste Generation weiter gegeben und leicht modifiziert. Während dieser langen Entwicklung sind über 99,99% aller Tier- und Pflanzenarten längst ausgestorben. Teilweise waren sie nicht ausreichend angepasst, teilweise hatten sie einfach Pech (zum Beispiel lebten sie zum Zeitpunkt des Asteroideneinschlages auf der falschen Seite des Planeten). Zu jedem einzelnen unserer Vorfahren bis hin zu den allerersten Einzellern, welche irgendwo an einer heißen vulkanischen Quelle im Ozean oder in einem Gezeitentümpel an einer längst versunkenen Meeresküste heranwuchsen, verbindet uns eine ununterbrochene Linie mit Milliarden Verbindungsgliedern. Wäre auch nur ein einziges Bindungsglied unterbrochen worden, Sie würden nicht existieren, könnten also jetzt dieses Buch gerade nicht lesen.
Es benötigte viele Millionen Anpassungen damit Sie gerade jetzt und gerade so existieren, wie Sie sind. Ein paar andere Genmutationen vor 500 Millionen Jahren und wir würden vielleicht als röhrenwurmähnliche Wesen heute auf dem Meeresboden herumgrundeln. Zu unserem Glück haben wir uns aber über viele Stufen zum Homo Sapiens entwickelt.
Homo Sapiens bedeutet: „Der wissende (oder vernünftige) Mensch“. Also so benennen wir uns selbst. Tatsächlich sind die Entwicklung und die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns ein herausstehendes Merkmal. Der „wissende Mensch“ bezeichnet sich oft gerne auch mal als „Krone der Schöpfung“. Wenn auch die Leistungen, die der Mensch in den letzten 100 000 Jahren hervorgebracht hatte, sicher herausragend sind, so ist „Krone der Schöpfung“ wohl zu hoch gegriffen. Milliarden Jahre der Evolution sind nicht jetzt zu Ende, bloß weil wir gerade da sind. Und ganz so einzigartig sind unsere Eigenschaften nicht. Auch Tiere können Emotionen haben, sind zu hohen kognitiven Leistungen fähig, (abstraktes Denken und Werkzeuggebrauch ist nicht nur bei unseren nächsten affenartigen Verwandten, sondern auch bei Oktopus oder Krähen nachgewiesen worden), und haben Fähigkeiten, welche als „theory of mind“ (=die Fähigkeit, sich in den Gemütszustand anderer Wesen versetzen zu können) bezeichnet werden. Und die Fähigkeit ein „Ich“ von der Umwelt zu unterscheiden. Viele Experimente hat man hierzu bei Raben oder Hunden zum Beispiel gemacht. Ob Katzen über diese Fähigkeiten verfügen weiß man nicht, Katzen arbeiten schlicht und einfach bei den Experimenten nicht ausreichend mit. Katzenliebhaber würden dies für Ihre Katzen aber ohne weiteres bejahen.
Auch die sprachliche Kommunikation kann bei Tieren sehr komplex sein.
Und die ursprünglich nur den Menschen zugeschriebene Fähigkeit zum Altruismus hat man nicht nur bei uns biologisch nahestehenden Tieren entdeckt, sondern sogar bei Ameisen, (es gibt Ameisenarten, welche bei Kriegszügen gegen andere Ameisenkolonien nicht nur Soldatenameisen einsetzen, sondern auch solche, welche sich als „Feldsanitäter“ betätigen und verletzte Ameisen zurück in den Bau bringen um sie gesund zu pflegen).
Es ist auch nicht so, dass die circa 300 000 Jahre oder vielleicht ein paar 100 000 Jahr mehr, welche der Mensch existiert, im Licht der evolutionären Entwicklung besonders lange wären. Neunaugen existieren bereits seit über 300 Millionen Jahre, ohne daß sie sich seither (soweit man aus Fossilfunden ableiten kann) wesentlich verändert haben. Ob uns also unsere genetische Ausstattung längerfristig das Überleben sichert, bleibt noch abzuwarten.
Dennoch besitzt insgesamt die Art Homo Sapiens eine Kombination von Merkmalen, welche nicht nur das Überleben in einer harschen Umwelt ermöglicht, sondern letzten Endes auch die Entwicklung von Kultur und Zivilisation. Wie sich das alles entwickelt hatte ist natürlich nicht bis ins Detail geklärt und war ja auch niemand von denen, die heute daran forschen, damals dabei. Im Laufe der Zeit hat die wissenschaftliche Forschung aber doch vieles geklärt.
Was gehört also zu unseren herausragenden Merkmalen?
Die Entwicklung des Nervensystems und des Gehirns
Nervensysteme gibt es mindestens seit 500 Millionen Jahren. Als Neurologe nennt man natürlich als großen Vorzug der Menschheit den größten Verbund von Nervenzellen, also das Gehirn. Das Gehirn des Menschen ist nicht nur im Vergleich zur Körpergröße relativ groß, sondern es hat auch im Vergleich zu anderen Tieren recht viele Verknüpfungen (Synapsen) zwischen den Nervenzellen.
Einige grundlegende Funktionen des Nervensystems
Gleichgewicht von Antrieb und Hemmung
Die Prozesse in unserem Körper werden zu einem wesentlichen Teil über das Nervensystem durch ein Gleichgewicht von Antrieb und Hemmung gesteuert.
Das Prinzip lässt sich gut erfassen, wenn man es mit dem Auto fahren vergleicht. Stellen Sie sich ein Auto vor mit einem Lenkrad, das ausschließlich nach links lenkt, Sie können mehr nach links lenken oder weniger nach links. Es ist klar, dass Sie damit nicht mehr als einige Meter weit kommen werden. Am besten fährt es sich wenn das Lenkrad in gleicher Weise nach links wie nach rechts gewendet werden kann. Beim Geradeausfahren halten Sie es in der Mittelstellung, (tatsächlich macht man immer wieder ganz kleine Korrekturbewegungen, mal nach links, mal nach rechts), und je nach Situation lenken Sie, wenn es erforderlich ist, dann mal mehr zur linken, mal mehr zur rechten Seite.
Auch unsere Muskelbewegungen funktionieren nach diesem Prinzip. Wenn Sie den Bizeps anspannen, um den Arm zu beugen, hält der Trizepsmuskel etwas dagegen, damit die Bewegung harmonisch verläuft. Und für jeden einzelnen Muskel muss die Spannung ebenfalls reguliert werden. Es gibt Nervenzellen (die motorischen Neurone), welche die Muskelspannung erhöhen. Diese werden wiederum in ihrer Aktivität durch andere Nervenzellen im Rückenmark und Gehirn gehemmt. Im Normalfall hat der Muskel eine passende Grundspannung, ist weder schlaff, noch verkrampft. Es stehen bereits hinter einem einfachen Vorgang wie dem Beugen eines Armes recht komplexe Vorgänge.
Für jede Bewegung und vor allem für feine Bewegungen unserer Finger führt unser Gehirn über ein Dutzend Korrekturen pro Sekunde durch. Meistens bemerken wir diese nicht. (Manche bemerken allerdings das feine Zittern der Finger bei Bewegungen, dies ist genetisch bedingt verstärkt ausgeprägt.)
Wenn wir etwas in die Hand nehmen, nehmen wir es genau so in die Hand, dass wir es halten können und damit eine Aktion durchführen können. Dafür erhält das Gehirn andauernd Rückmeldungen von zahlreichen Sensoren in der Haut, Muskeln, Gelenkkapseln und Sehnen. Damit kann der Griff reguliert und Bewegungen sehr fein abgestimmt werden. Wie komplex dies in Wirklichkeit ist, wissen die Hersteller von Robotern. Es ist extrem schwierig einen Roboter so zu konstruieren, dass er ein Werkzeug in die Hand nimmt und damit einfache Aktionen ausführt. Immerhin ist das möglich. Trotz enormer Fortschritte in der Entwicklung künstlicher Intelligenz und der Robotik ist es bisher aber noch nicht gelungen, eine Roboterhand so zu konstruieren, dass der Roboter einerseits einen Hammer so in die Hand nehmen kann, dass er ihn benützen kann ohne aus der Hand zu fliegen und andererseits ein rohes Ei so aufzunehmen, dass dieses Ei weder aus der Hand fällt, noch zerbricht. Uns gelingt das meistens ziemlich locker. Für solche alltäglichen Aktionen muss die Spannung der Muskulatur andauernd mal etwas erhöht, mal etwas reduziert werden und nur wenn Antrieb der Muskelspannung und Hemmung der Muskelspannung genau reguliert werden, ist die Bewegung flüssig und der Griff genau richtig.
Auch auf der emotionalen Ebene unterliegt das Gehirn ebenfalls Prozessen von Antrieb und Hemmung der Antriebe. Freud, der sich sehr ausführlich mit den in seinem Zeitalter sehr verdrängten Trieben beschäftigt hatte, erkannte nicht nur dass der Sexualtrieb ein enorm starker (und weil verdrängt vielfach unbewusster und deswegen dann problematischer) Antrieb ist, sondern dass es zu jedem Trieb auch eine starke Hemmung geben muss. Gäbe es zum Beispiel nur einen Sexualtrieb ohne Hemmung, hätten sich unsere Vorfahren fröhlich vergnügt, hätten aber nie Zeit gehabt für Nahrungserwerb oder sich um die Kinder zu kümmern.





























