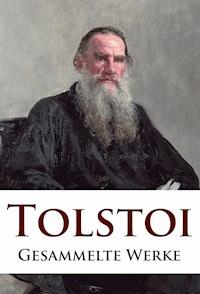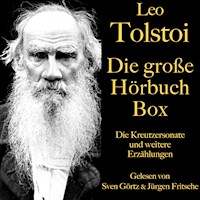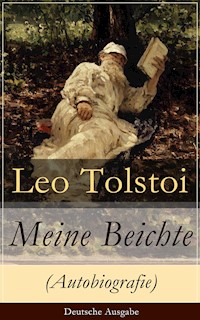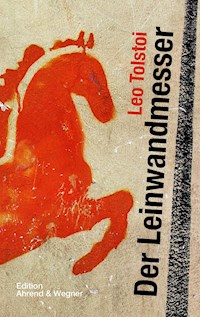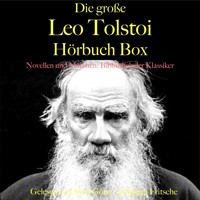0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
»Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich.« - Schon der erste Satz lässt einen nicht mehr los. Anna Karenina - Leo Tolstois Mammutwerk über Ehe und Moral in der adligen russischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Erstmalig erhalten Sie hier die vollständige Ausgabe für elektronische Lesegeräte mit interaktivem Inhaltsverzeichnis, Fußnoten und Personenverzeichnis Das achtteilige Romanepos verwebt die Geschichten dreier adliger Familien: des Fürsten Oblonski und seiner Frau Dolly, Dollys junger Schwester Kitty Schtscherbazkaja und des Gutsbesitzers Lewin, sowie schließlich Anna Karenina, der Schwester des Fürsten, die mit dem Staatsbeamten Karenin verheiratet ist. Annas Liebesaffäre mit dem Grafen Wronskij führt schließlich zum Bruch der Ehe und ihrer Selbsttötung. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1913
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lew Tolstoi
Anna Karenina
Überarbeitete und kommentierte Fassung
Lew Tolstoi
Anna Karenina
Überarbeitete und kommentierte Fassung
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Hermann Röhl EV: Leipzig, Insel-Verlag, 1921 6. Auflage, ISBN 978-3-954180-00-4
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Personenregister
Motto
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
Fünfter Teil
Sechster Teil
Siebenter Teil
Achter Teil
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Personenregister
Die Oblonskijs
Fürst Stepan Arkadjewitsch Oblonskij (genannt Stiwa), höherer Beamter
Fürstin Darja Alexandrowna Oblonskaja (geb. Schtscherbazkaja, genannt Dolly), seine Frau
Tanja Stepanowna Oblonskaja, seine Tochter
Grischa Stepanowitsch Oblonskij, sein Sohn
Lilli Stepanowna Oblonskaja, seine Tochter
Nikolaj Stepanowitsch Oblonskij, sein Sohn
Mascha Stepanowna Oblonskaja, seine Tochter
Die Karenins
Alexej Alexandrowitsch Karenin, hoher Beamter
Anna Arkadjewna Karenina, seine Frau und (geb. Oblonskaja, Schwester des Stepan A. Oblonskij)
Sergej Alexejewitsch Karenin, (genannt Serjoscha) sein Sohn
Anna Alexejewna Karenina (genannt Anny), die illegitime Tochter der Anna A. Karenina und Alexej Wronskijs
Die Wronskijs
Graf Alexej Kirillowitsch Wronskij, (genannt Aljoscha),
1
der Geliebte Anna A. Kareninas, Oberst a.D. und Großgrundbesitzer
Graf Alexander Kirillowitsch Wronskij, sein älterer Bruder
Gräfin Warja Wronskaja, seine Schwägerin
Gräfin Wronskaja, seine Mutter
Die Schtscherbazkijs
Fürst Alexander Schtscherbazkij
Fürstin Schtscherbazkaja, seine Frau
Darja Alexandrowna Schtscherbazkaja, seine Tochter (verh. Oblonskaja, gen. Dolly)
Natalia Alexandrowna Schtscherbazkaja, seine Tochter (verh. Ljwowa)
Jekatarina Alexandrowna Schtscherbazkaja, seine Tochter (verh. Ljewina, gen. Kitty)
Die Ljewins
Konstantin Dmitrijewitsch Ljewin, (genannt Kostja), Gutsbesitzer und Jugendfreund Stepan A. Oblonskijs
Jekatarina Alexandrowna Ljewina, (geb. Schtscherbazkaja, genannt Kitty), seine Frau
Dmitrij Konstantinowitsch Ljewin, (genannt Mitja),
2
sein Sohn
Nikolaj Dmitrijewitsch Ljewin, sein Bruder
Wanja Nikolajewitsch Ljewin, sein Neffe
Sergej Iwanowitsch Kosnyschew, sein Stiefbruder, berühmter Schriftsteller
Weitere Personen
Fürstin Betsy Twerskaja, Ehefrau eines Vetters der Anna A. Karenina
Gräfin Lydia Iwanowna, Dame der St. Petersburger Gesellschaft
Marja Nikolajewna, (genannt Mascha), Lebensgefährtin des Nikolaj Dmitrijewitsch Ljewin
Diminutiv von Alexej <<<
Diminutiv von Dmitri <<<
Motto
Die Rache ist mein, Ich will vergelten.
Erster Teil
1
Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich. Der ganze Haushalt der Familie Oblonski war in Unordnung geraten. Die Hausfrau hatte erfahren, dass ihr Mann mit einer französischen Gouvernante, die sie früher im Hause gehabt hatten, ein Verhältnis unterhielt, und hatte ihm erklärt, sie könne nicht länger mit ihm unter einem Dache wohnen. Drei Tage schon währte nun dieser Zustand, und er wurde sowohl von den Ehegatten selbst wie auch von den übrigen Familienmitgliedern und dem Hausgesinde als eine Qual empfunden. Alle Familienmitglieder und das Hausgesinde hatten das Gefühl, dass ihr Zusammenleben gar keinen Sinn mehr habe und dass in jeder Herberge die Leute, die sich dort zufällig zusammenfänden, in engerer Beziehung untereinander stünden als sie, die Mitglieder und das Gesinde der Familie Oblonski. Die Hausfrau verließ ihr Zimmer nicht; der Hausherr war zwei Tage lang nicht nach Hause gekommen. Die Kinder liefen im ganzen Hause wie verloren umher; die englische Miss hatte sich mit der Wirtschafterin gezankt und einen Brief an eine Freundin geschrieben, ob sie ihr nicht eine andere Stelle verschaffen könne; der Koch war schon gestern vor dem Mittagessen davongegangen; die Küchenmagd und der Kutscher baten um ihren Lohn, um den Dienst zu verlassen. Am dritten Tage nach dem Streite erwachte Fürst Stepan Arkadjewitsch Oblonski (Stiwa, wie er von seinen Bekannten genannt wurde) zur gewohnten Stunde, das heißt um acht Uhr morgens, aber nicht im gemeinsamen Schlafzimmer, sondern in seinem Arbeitszimmer auf dem Ledersofa. Er wälzte seinen gut genährten und gepflegten Körper auf dem Sofa ein paarmal hin und her, als ob er noch weiterschlafen wolle, umfasste das Kopfkissen fest von unten her und drückte die Wange dagegen; plötzlich aber fuhr er in die Höhe, setzte sich auf dem Sofa aufrecht hin und öffnete die Augen.
›Ja, ja, wie war das doch nur?‹ dachte er, indem er sich auf seinen Traum zu besinnen suchte. ›Ja, wie war das doch nur? Ja! Alabin gab ein Diner in Darmstadt; nein, nicht in Darmstadt, es war irgendwo in Amerika. Ja, aber Darmstadt lag dabei in Amerika. Ja, Alabin gab ein Diner auf gläsernen Tischen, ja, – und da waren solche kleine Likörflaschen, die sangen: Il mio tesoro,1 oder vielmehr nicht Il mio tesoro, sondern ein noch schöneres Lied, und auf einmal waren die Likörflaschen Weiber‹, erinnerte er sich.
Stepan Arkadjewitschs Augen leuchteten fröhlich auf, und lächelnd überließ er sich seinen Gedanken. ›Ja, schön war es, sehr schön. Es war auch sonst noch viel Vergnügliches dabei; aber wenn man aufgewacht ist, kann man es sich nicht mehr in Gedanken klarmachen und es nicht mit Worten ausdrücken.‹ Und als er einen Lichtstreifen bemerkte, der sich an dem einen Fenster neben dem Stoffvorhang ins Zimmer stahl, hob er in heiterer Stimmung die Beine vom Sofa herunter, suchte mit ihnen nach den goldfarbenen Saffianpantoffeln, die ihm seine Frau gestickt und im vorigen Jahre zum Geburtstage geschenkt hatte, und streckte nach alter, neunjähriger Gewohnheit, ohne aufzustehen, die Hand nach der Stelle aus, wo im Schlafzimmer sein Schlafrock zu hängen pflegte. Dabei kam es ihm auf einmal zum Bewusstsein, dass und warum er nicht in dem gemeinsamen Schlafzimmer geschlafen hatte, sondern in seinem Arbeitszimmer; das Lächeln verschwand von seinem Gesichte, und er runzelte die Stirn.
»Ach, o weh, o weh!« stöhnte er, da ihm alles Vorgefallene wieder ins Gedächtnis kam. Und vor seinem geistigen Blicke erschienen wieder alle Einzelheiten seines Streites mit seiner Frau und die ganze Misslichkeit seiner Lage und, was ihn am allermeisten quälte, seine eigene Schuld.
›Ja, das wird sie nicht verzeihen und kann sie nicht verzeihen. Und das Schauderhafteste dabei ist, dass ich selbst an alledem schuld bin; – ich bin an alledem schuld und kann doch eigentlich nichts dafür. Das ist das Tragische bei der Sache‹, dachte er. »O weh, o weh!« sagte er verzweifelt vor sich hin, in Erinnerung an jene Einzelheiten des Streites, die auf ihn den stärksten Eindruck gemacht hatten.
Am unangenehmsten war jener erste Augenblick gewesen, als er, heiter und zufrieden aus dem Theater heimkehrend, seine Frau, für die er eine gewaltig große Birne in der Hand trug, zu seinem Erstaunen weder im Salon noch in ihrem Zimmer vorgefunden und endlich im Schlafzimmer erblickt hatte, in der Hand den unglückseligen Brief, der alles verraten hatte.
Sie, die sonst stets sorglich geschäftige und seiner Ansicht nach etwas beschränkte Dolly, hatte mit dem Briefe in der Hand regungslos dagesessen und den Eintretenden mit einer Miene des Schreckens, der Verzweiflung und des Zornes angeblickt.
»Was ist das hier? Was ist das?« hatte sie, auf das Schreiben deutend, ihn gefragt.
Als peinlich und beschämend empfand Stepan Arkadjewitsch bei dieser Erinnerung, wie das oft so geht, weniger den Vorfall selbst, als vielmehr die Art, wie er auf diese Worte seiner Frau geantwortet hatte.
Es war ihm in diesem Augenblick ergangen, wie es nicht selten Leuten ergeht, die unversehens auf einer recht schmählichen Tat ertappt werden. Er hatte es nicht verstanden, seine Miene der Lage anzupassen, in die er seiner Frau gegenüber durch die Aufdeckung seines Vergehens geraten war. Anstatt den Gekränkten zu spielen, zu leugnen, sich zu rechtfertigen, um Verzeihung zu bitten oder auch einfach nur gleichgültig zu bleiben (alles dies wäre besser gewesen als das, was er in Wirklichkeit getan hatte), statt dessen hatte sein Gesicht ganz unwillkürlich (›Reflexe des Gehirns‹, dachte Stepan Arkadjewitsch, der sich gern ein bisschen mit Physiologie abgab) sich zu seinem gewohnten gutmütigen und daher in diesem Falle dummen Lächeln verzogen.
Dieses dumme Lächeln konnte er sich nicht verzeihen. Beim Anblicke dieses Lächelns war Dolly wie infolge eines körperlichen Schmerzes zusammengezuckt, hatte mit der ihr eigenen Heftigkeit einen Strom scharfer Worte hervorgesprudelt und war aus dem Zimmer geeilt. Seitdem hatte sie ihren Mann nicht mehr sehen wollen.
›An alledem ist dieses dumme Lächeln schuld‹, dachte Stepan Arkadjewitsch.
›Aber was ist zu machen? Was ist zu machen?‹ fragte er sich in seiner Verzweiflung und fand keine Antwort darauf.
Mein Schatz. <<<
2
Stepan Arkadjewitsch war sich selbst gegenüber stets aufrichtig und wahrheitsliebend. Er war unfähig, sich selbst zu betrügen und sich einzureden, dass er das Getane bereue. Zur Zeit war er nicht imstande, Reue darüber zu empfinden, dass er, ein vierunddreißigjähriger, hübscher, liebeslustiger Mann, nicht mehr in seine Frau verliebt war, die ihm fünf noch lebende und zwei bereits verstorbene Kinder geboren hatte und nur um ein Jahr jünger war als er selbst. Das einzige, was er bereute, war, dass er es nicht besser verstanden hatte, seiner Frau die Sache zu verheimlichen. Aber er empfand in vollem Umfange die Misslichkeit seiner Lage und bedauerte seine Frau, die Kinder und sich selbst. Vielleicht hätte er sich auch erfolgreicher bemüht, seine Sünden vor seiner Frau zu verbergen, wenn er geahnt hätte, dass diese Nachricht auf sie so stark wirken würde. Klar nachgedacht hatte er über diesen Punkt allerdings nie: aber er hatte die undeutliche Vorstellung gehabt, seine Frau ahne schon längst, dass er ihr untreu sei, sehe aber dabei durch die Finger. Er war sogar der Ansicht, eine schon so welke, gealterte, bereits unschöne Frau, die nichts Besonderes an sich habe, sondern lediglich eine einfache, brave Familienmutter sei, müsse aus einer Art von Gerechtigkeitsgefühl heraus sich nachsichtig zeigen. Und nun hatte er gerade das Gegenteil davon erlebt.
›Schauderhaft! O weh, o weh, schauderhaft!‹ sagte Stepan Arkadjewitsch einmal über das andere vor sich hin, ohne dass er einen Ausweg ersinnen konnte. ›Und wie nett war alles bisher, wie gut haben wir miteinander gelebt! Sie war zufrieden und glücklich über ihre Kinder; ich kam ihr in keiner Weise in die Quere und ließ sie bei den Kindern und beim Hauswesen herumwirtschaften, wie sie wollte. Freilich, dass »sie« in unserem Hause Gouvernante gewesen ist, das ist übel. Das ist übel. Es liegt immer etwas Gewöhnliches, Unwürdiges darin, wenn man einer Gouvernante der eigenen Kinder den Hof macht. Aber was ist diese Gouvernante auch für ein Weib!‹ (Er erinnerte sich lebhaft an Mademoiselle Rolands schwarze Schelmenaugen und an ihr reizendes Lächeln.) ›Aber solange sie bei uns im Hause war, habe ich mir ja auch nichts erlaubt. Das Schlimmste ist, dass sie jetzt … Das muss auch alles wie mit Absicht gleichzeitig über mich hereinstürzen! O weh, o weh! Aber was in aller Welt soll ich nun tun?‹
Eine Antwort gab es darauf nicht außer jener allgemeinen Antwort, die das Leben auf alle Fragen gibt, selbst auf die verwickeltsten und unlösbaren. Und diese Antwort lautet: Man muss sein Leben ausfüllen mit dem, was der Tag bringt und fordert, das heißt, man muss dadurch zu vergessen suchen. Aber durch Schlafen und Träumen Vergessenheit zu suchen, das war nicht mehr möglich, wenigstens nicht vor der nächsten Nacht; es ging nicht mehr an, zu jenem musikalischen Genusse, dem Gesange der Likörflaschen, die dann auf einmal Weiber waren, zurückzukehren. Also musste er Vergessenheit suchen in der Ablenkung, die das Leben mit sich brachte.
›Na, es wird sich ja bald zeigen‹, sagte Stepan Arkadjewitsch zu sich selbst, stand auf, zog den grauen, mit blauer Seide gefütterten Schlafrock an, schlang die in Quasten ausgehenden Schnüre zu einem Knoten zusammen, sog in kräftigen Atemzügen die Luft in seinen breiten Brustkasten, trat mit dem gewohnten munteren Schritt der auswärts gerichteten Füße, die seinen vollen Körper so leicht trugen, zum Fenster, hob den Vorhang auf und klingelte laut. Auf das Klingeln trat sogleich sein altvertrauter Kammerdiener Matwei ins Zimmer, der die Kleider, die Stiefel und ein Telegramm brachte. Hinter Matwei kam auch der Barbier mit seinem Rasiergerät herein.
»Sind Akten von der Behörde gekommen?« fragte Stepan Arkadjewitsch, indem er das Telegramm nahm und sich vor den Spiegel setzte.
»Sie liegen im Esszimmer auf dem Tische«, antwortete Matwei und richtete einen fragenden Blick voller Teilnahme auf seinen Herrn; dann, nach einer kurzen Pause, fügte er mit einem schlauen Lächeln hinzu: »Es ist jemand von dem Fuhrherrn hier gewesen.«
Stepan Arkadjewitsch gab keine Antwort und blickte nur im Spiegel nach Matwei hin; an den Blicken, mit denen sie sich im Spiegel trafen, konnte man sehen, wie gut sie einander verstanden. Stepan Arkadjewitschs Blick fragte gleichsam: ›Wozu sagst du das? Weißt du etwa nicht, wie’s steht?‹
Matwei steckte die Hände in die Taschen seiner Jacke, setzte den einen Fuß ein wenig seitwärts und blickte schweigend, mit gutmütiger Miene und beinah mit einem Lächeln seinen Herrn an.
»Ich habe ihm gesagt, er möchte erst nächsten Sonntag wiederkommen und bis dahin weder Ihnen noch sich selbst unnötige Mühe machen«, antwortete er mit einem offenbar vorher zurechtgelegten Satze.
Stepan Arkadjewitsch erkannte, dass Matwei einen kleinen Scherz machen und die Aufmerksamkeit auf sich lenken wolle. Er riss das Telegramm auf, las es, wobei er die, wie stets, entstellten Worte sinngemäß verbesserte, und sein Gesicht leuchtete auf.
»Matwei, meine Schwester Anna Arkadjewna kommt morgen«, sagte er und hemmte für einen Augenblick die dicke, fettglänzende Hand des Barbiers, der dabei war, den rosigen Zwischenraum zwischen dem rechten und linken krausen Backenbart rein zu putzen.
»Gott sei Dank!« rief Matwei und zeigte durch diese Antwort, dass er die Bedeutung dieses Besuches ebensowohl zu würdigen wusste wie sein Herr, indem er nämlich zuversichtlich glaubte, dass Anna Arkadjewna, Stepan Arkadjewitschs Schwester, die dieser sehr liebte, eine Versöhnung zwischen Mann und Frau werde zustande bringen können.
»Kommt die gnädige Frau allein oder mit dem Herrn Gemahl?« fragte Matwei.
Stepan Arkadjewitsch konnte nicht sprechen, da der Barbier mit seiner Oberlippe beschäftigt war, und hob einen Finger in die Höhe. Matwei nickte nach dem Spiegel hin mit dem Kopfe.
»Allein. Soll ich oben alles instand setzen lassen?«
»Melde es meiner Frau. Sie wird das Nötige anordnen.«
»Der Frau Gemahlin?« fragte Matwei wie im Zweifel, ob er richtig gehört habe.
»Ja, melde es ihr! Und da, nimm das Telegramm mit und gib es ihr, was sie wohl dazu sagt.«
›Das soll ein Fühler sein‹, dachte Matwei verständnisvoll; aber er antwortete nur: »Zu Befehl!«
Stepan Arkadjewitsch war schon gewaschen und gekämmt und wollte sich eben ankleiden, als Matwei, mit seinen knarrenden Stiefeln langsam daherkommend, das Telegramm in der Hand, wieder ins Zimmer trat. Der Barbier war nicht mehr da.
»Darja Alexandrowna hat befohlen, zu melden, dass sie wegfährt; sie sagte: ›Es kann alles eingerichtet werden, wie es ihm‹, das heißt Ihnen, ›genehm ist‹«, berichtete er; dabei lachte er nur mit den Augen, schob die Hände in die Taschen und blickte mit seitwärts geneigtem Kopfe seinen Herrn unverwandt an. Stepan Arkadjewitsch schwieg ein Weilchen. Dann erschien ein gutmütiges und etwas klägliches Lächeln auf seinem hübschen Gesichte.
»Nun, Matwei?« fragte er und wiegte den Kopf hin und her.
»Das ist weiter nicht schlimm, gnädiger Herr; es wird sich schon alles wieder einrenken«, erwiderte Matwei.
»Du meinst, es wird sich wieder einrenken?«
»Ganz gewiss.«
»Meinst du? Wer ist denn da?« fragte Stepan Arkadjewitsch, da er auf der anderen Seite der ein wenig geöffneten Tür das Rascheln von Frauenkleidern hörte.
»Ich bin es«, sagte eine fest und angenehm klingende weibliche Stimme, und in der Tür erschien das ernste, pockennarbige Gesicht der alten Kinderfrau Matrona Filimonowna.
»Nun, was gibt es, liebe Matrona?« fragte Stepan Arkadjewitsch, indem er zu ihr an die Tür trat.
Obgleich Stepan Arkadjewitsch seiner Frau gegen über durchaus im Unrecht war und dies selbst fühlte, waren doch fast alle im Hause auf seiner Seite, sogar die Kinderfrau, die sich mit Darja Alexandrowna außerordentlich gut stand.
»Nun, was gibt es?« fragte er in bedrücktem Tone.
»Sie sollten doch noch einmal hingehen, gnädiger Herr, und sich schuldig bekennen. Vielleicht hilft Gott. Sie quält sich sehr, es ist kläglich anzusehen, und im Hause geht alles drunter und drüber. Die Kinder, gnädiger Herr, die Kinder können einem leid tun. Bekennen Sie sich schuldig, gnädiger Herr! Was können Sie auch sonst tun? Wenn man etwas erreichen will, darf man sich keine Mühe verdrießen lassen.«
»Aber sie wird mich gar nicht empfangen!«
»Tun Sie nur das Ihrige! Gott ist barmherzig; beten Sie zu Gott, gnädiger Herr, beten Sie zu Gott!«
»Na schön, geh nur!« antwortete Stepan Arkadjewitsch; er war auf einmal ganz rot geworden. »Nun, dann hilf mir beim Ankleiden«, wandte er sich an Matwei und warf mit einer entschlossenen Bewegung den Schlafrock ab.
Matwei hielt bereits das Hemd, von dem er etwas Unsichtbares wegblies, in Form eines Kumtes zum Überstreifen bereit und hüllte mit sichtlichem Vergnügen den wohlgepflegten Körper seines Herrn darin ein.
3
Nach dem Ankleiden besprengte sich Stepan Arkadjewitsch mit Parfüm, zupfte die Manschetten zurecht, steckte mit den ihm geläufigen Bewegungen in die einzelnen Taschen die Zigaretten, die Brieftasche, die Zündhölzer, die Uhr mit doppelter Kette und Berlocken, schüttelte das Taschentuch auseinander und fühlte sich nun sauber, wohlduftend, gesund und körperlich munter, trotz seinem Unglück. Auf jedem Bein sich ein wenig hin und her wiegend, ging er in das Esszimmer, wo der Kaffee bereits auf ihn wartete und neben dem Kaffeegeschirr seine Briefe und die von der Behörde eingelaufenen Akten lagen.
Er las die Briefe. Einer darunter war ihm recht unwillkommen – von dem Händler, mit dem er wegen des Verkaufes eines Waldes auf dem Gute seiner Frau in Unterhandlung stand. Er musste diesen Wald unbedingt verkaufen; aber jetzt, vor einer Versöhnung mit seiner Frau, konnte davon nicht die Rede sein. Am peinlichsten war ihm dabei, dass sich auf diese Weise Geldfragen in das bevorstehende Werk seiner Versöhnung mit seiner Frau hineinmischten. Und der Gedanke, dass es scheinen könnte, als lasse er sich von diesem Interesse leiten und als veranlasse ihn die Aussicht auf den Verkauf dieses Waldes, die Versöhnung mit seiner Frau anzustreben, dieser Gedanke hatte für ihn geradezu etwas Beleidigendes.
Als Stepan Arkadjewitsch mit den Briefen fertig war, zog er die Akten zu sich heran, durchblätterte schnell zwei Sachen und machte darin mit einem großen Bleistift ein paar Bemerkungen. Darauf schob er die Akten wieder zur Seite und machte sich an seinen Kaffee; während des Kaffeetrinkens breitete er die noch feuchte Morgenzeitung auseinander und begann sie zu lesen.
Stepan Arkadjewitsch hielt und las eine liberale Zeitung, nicht ein extremes Blatt, sondern von der Richtung, zu der sich die Mehrheit des gebildeten Publikums bekannte. Und obgleich weder Wissenschaft noch Kunst, noch Politik ihn sonderlich interessierten, so hielt er doch auf allen diesen Gebieten energisch an den Anschauungen fest, denen die Mehrheit und seine Zeitung anhingen, und änderte diese Anschauungen nur dann, wenn auch die Mehrheit das gleiche tat, oder, richtiger gesagt, er änderte sie nicht, sondern sie änderten sich von selbst unvermerkt in seinem Geiste.
Stepan Arkadjewitsch wählte sich weder seine Grundsätze noch seine Ansichten aus, sondern diese Grundsätze und Ansichten kamen von selbst zu ihm, ganz ebenso, wie er die Formen seines Hutes oder seines Rockes nicht auswählte, sondern einfach die nahm, die allgemein getragen wurden. Und Ansichten zu haben, war für ihn, der in einem bestimmten gesellschaftlichen Kreise lebte und ein Verlangen nach einiger Denktätigkeit verspürte, wie es sich gewöhnlich in reiferen Lebensjahren herausbildet, – Ansichten zu haben, war für ihn ebenso eine Notwendigkeit, wie einen Hut zu haben. Wenn wirklich ein Grund vorhanden war, weshalb er die liberale Richtung der konservativen vorzog, der doch auch viele aus seinem Gesellschaftskreise anhingen, so lag dieser Grund jedenfalls nicht etwa darin, dass er die liberale Richtung für vernünftiger gehalten hätte, sondern darin, dass sie mit der Gestaltung seines eigenen Lebens mehr übereinstimmte. Die liberale Partei behauptete, in Russland sei alles schlecht, und tatsächlich hatte Stepan Arkadjewitsch viele Schulden und konnte mit seinem Gelde absolut nicht auskommen. Die liberale Partei erklärte die Ehe für eine Einrichtung, die sich überlebt habe und unbedingt umgestaltet werden müsse, und wirklich machte das Eheleben Stepan Arkadjewitsch wenig Vergnügen und nötigte ihn dazu, zu lügen und sich zu verstellen, was doch seiner Natur sehr zuwider war. Die liberale Partei sagte oder, richtiger ausgedrückt, ließ als ihre Meinung durchblicken, dass die Religion nur ein Zügel für den ungebildeten Teil der Bevölkerung sei, und in der Tat vermochte Stepan Arkadjewitsch nicht einmal einen ganz kurzen Gottesdienst ohne Schmerzen in den Beinen auszuhalten und konnte gar nicht begreifen, was dieses ganze großartige, hochtrabende Gerede von jener Welt für einen Zweck habe, da es sich doch auch auf dieser Welt sehr vergnüglich leben lasse. Außerdem fand Stepan Arkadjewitsch, der ein munteres Späßchen liebte, seine Freude daran, ab und zu einen harmlosen Menschen durch Äußerungen wie diese zu verblüffen: wolle man den Stolz auf die Abstammung einmal gelten lassen, so sei es nicht recht, bei Rurik stehenzubleiben und den ersten Stammvater, den Affen, zu verleugnen. Auf diese Weise war die liberale Richtung für Stepan Arkadjewitsch eine Sache der Gewohnheit geworden, und er liebte seine Zeitung wie die Zigarre nach dem Mittagessen wegen der leisen Benommenheit, die sie in seinem Kopfe hervorrief. Heute las er den Leitartikel, in dem auseinandergesetzt wurde, dass in unserer Zeit völlig ohne Grund ein Jammergeschrei erhoben werde, als drohe der Radikalismus alle konservativen Elemente zu verschlingen und als sei die Regierung verpflichtet, Maßregeln zur Überwältigung der revolutionären Hydra zu ergreifen. »Ganz im Gegenteil«, hieß es, »liegt unserer Ansicht nach die Gefahr nicht in der vermeintlichen revolutionären Hydra, sondern in der Starrköpfigkeit der Reaktionäre, die jeden Fortschritt hemmen.« Auch einen zweiten Artikel, finanziellen Inhalts, las er durch, in dem Bentham und Mill zitiert wurden und einige gegen das Ministerium gerichtete boshafte Sticheleien vorkamen. Mit der ihm eigenen Schnelligkeit der Auffassung verstand er die Bedeutung einer jeden dieser Sticheleien, von wem sie ausging und gegen wen sie gerichtet war und welcher Anlass ihr zugrunde lag, und das machte ihm, wie immer, ein gewisses Vergnügen. Indes wurde heute dieses Vergnügen durch die Erinnerung an Matrona Filimonownas Ratschläge und an die unerfreulichen Umstände im Hause stark beeinträchtigt. Er las auch, dass Graf Beust, wie verlaute, nach Wiesbaden gereist sei, und eine Anzeige: »Keine grauen Haare mehr!«, und über den Verkauf einer leichten Equipage,1 und dass ein junges Mädchen eine Stellung suche; aber diese Nachrichten bereiteten ihm nicht das stille, ironische Vergnügen wie früher.
Als er mit der Zeitung, einer zweiten Tasse Kaffee und einer Buttersemmel fertig war, stand er auf, klopfte sich die Semmelkrümel von der Weste, reckte seine breite Brust und lächelte dabei heiter, nicht als ob ihm gerade besonders froh zumute gewesen wäre, vielmehr wurde das heitere Lächeln durch die gute Verdauung hervorgerufen.
Aber dieses heitere Lächeln brachte ihm auch sofort wieder die ganze Wirklichkeit zum Bewusstsein, und er wurde ernst und nachdenklich.
Zwei Kinderstimmen (Stepan Arkadjewitsch erkannte die Stimmen seines jüngsten Sohnes Grigori und seines ältesten Töchterchens Tanja) wurden vom Nebenzimmer her durch die Tür vernehmbar. Die Kinder fuhren mit etwas umher, und es fiel etwas auf den Fußboden.
»Ich habe es dir doch gesagt: auf das Dach darfst du keine Fahrgäste setzen!« rief das kleine Mädchen auf englisch. »Nun kannst du sie auch aufheben!«
›Alles ist aus der gewohnten Ordnung gekommen‹, dachte Stepan Arkadjewitsch. ›Da laufen nun die Kinder ganz allein im Hause umher.‹ Er ging zur Tür und rief sie zu sich. Sie ließen die Schachtel, die einen Eisenbahnzug darstellte, liegen und kamen zu ihrem Vater herein.
Das Mädchen, des Vaters Liebling, lief dreist herein, umarmte ihn und hängte sich ihm lachend an den Hals; sie freute sich wie immer über den ihr wohlbekannten Duft des Parfüms, den sein Backenbart ausströmte. Nachdem sie endlich sein von der gebückten Haltung gerötetes und von Zärtlichkeit strahlendes Gesicht geküsst hatte, löste sie die Arme von seinem Halse und wollte wieder weglaufen; aber der Vater hielt sie zurück.
»Was macht Mama?« fragte er und strich mit der Hand über das glatte, zarte Hälschen seiner Tochter. »Guten Morgen!« sagte er lächelnd zu dem Knaben, der ihn begrüßte.
Er war sich dessen bewusst, dass er den Knaben weniger liebte, und gab sich stets Mühe, die Kinder gleichmäßig zu behandeln; aber der Knabe empfand das und erwiderte das kalte Lächeln des Vaters seinerseits nicht mit einem Lächeln.
»Mama? Die ist schon aufgestanden.«
Stepan Arkadjewitsch seufzte.
›Da hat sie also wieder die ganze Nacht nicht geschlafen‹, dachte er.
»Nun, und ist sie vergnügt?«
Das kleine Mädchen wusste, dass es zwischen Vater und Mutter einen Streit gegeben hatte, und dass die Mutter nicht vergnügt sein konnte, und dass der Vater das wissen musste, und dass er sich verstellte, wenn er so leichthin danach fragte. Und sie errötete für ihren Vater. Er verstand das sofort und errötete nun gleichfalls.
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie. »Sie hat gesagt, wir sollten heute keinen Unterricht haben, sondern mit Miss Hull zu Großmama gehen«
»Na, dann geh, meine liebe kleine Tanja! Ja so, warte noch mal«, sagte er, indem er sie doch noch zurückhielt und ihr zartes Händchen streichelte.
Er nahm vom Kaminsims eine Schachtel Konfekt herab, die er gestern dahin gestellt hatte, und gab ihr zwei Stückchen; er wählte solche, die sie am liebsten aß: eine Schokoladenpraline und einen Fruchtbonbon.
»Für Grigori?« fragte das Kind und zeigte auf die Praline.
»Ja, ja!« Nochmals streichelte er ihr die Schulter und küsste sie auf die Stirn beim Haaransatz und auf den Hals; dann ließ er sie fort.
»Der Wagen steht bereit!« meldete Matwei. »Es ist auch eine Bittstellerin da«, fügte er hinzu.
»Ist sie schon lange hier?« fragte Stepan Arkadjewitsch.
»Etwa ein halbes Stündchen.«
»Wie oft habe ich dir befohlen, mir die Leute sofort zu melden!«
»Sie müssen doch Ihren Kaffee in Ruhe trinken können«, erwiderte Matwei in einem freundlich-groben Tone, über den sein Herr nicht zornig werden konnte.
»Na, dann bitte sie jetzt schnell herein«, sagte Oblonski, ärgerlich die Augenbrauen zusammenziehend.
Die Bittstellerin, eine Frau Hauptmann Kalinina, bat um etwas ganz Unmögliches und Unvernünftiges; aber nach seiner Gewohnheit ersuchte Stepan Arkadjewitsch sie, Platz zu nehmen, hörte ihr, ohne sie zu unterbrechen, aufmerksam zu und gab ihr ausführliche Ratschläge, an wen sie sich zu wenden habe und wie sie es angreifen müsse, und schrieb sogar in gewandtem, bündigem Stile mit seiner großen, sperrigen, hübschen, klaren Handschrift einen Brief für sie an die Persönlichkeit, die ihr behilflich sein konnte. Nachdem er die Frau Hauptmann entlassen hatte, nahm er seinen Hut und stand noch einen Augenblick da, um zu überlegen, ob er auch nichts vergessen habe. Er überzeugte sich, dass er nichts vergessen hatte außer dem einen, was er gern vergessen wollte, – seine Frau.
›Ach ja!‹ Er ließ den Kopf sinken, und sein hübsches Gesicht nahm einen sorgenvollen Ausdruck an. ›Soll ich zu ihr hingehen oder nicht?‹ erwog er. Und eine innere Stimme sagte ihm, es sei zwecklos, hinzugehen, es liefe doch alles nur auf Lüge hinaus; ihre gegenseitigen Beziehungen wiederherzustellen und in Ordnung zu bringen, sei unmöglich, weil es weder möglich sei, Dolly wieder zu einem anziehenden, reizenden Weibe noch sich selbst zu einem alten, der Liebe unfähigen Manne zu machen. Es war jetzt alles notwendigerweise voller Lüge und Unwahrhaftigkeit; Lüge und Unwahrhaftigkeit aber waren seiner Natur zuwider.
›Indessen, irgendeinmal muss es doch geschehen; so kann die Sache ja nicht bleiben‹, sagte er zu sich, bestrebt, sich Mut zu machen. Er reckte die Brust heraus, holte eine Zigarette hervor, zündete sie an, rauchte ein paar Züge, warf sie in das Aschenschälchen aus Perlmutter, durchmaß mit schnellen Schritten den Salon und öffnete die Tür zum Schlafzimmer seiner Frau.
Gepäck <<<
4
Er fand Darja Alexandrowna in der Nachtjacke, die Flechten ihres bereits recht dünn gewordenen, früher so dichten schönen Haares am Hinterkopf aufgesteckt, mit verfallenem, hagerem Gesicht und großen, erschrockenen Augen, die infolge der Hagerkeit des Gesichts stark hervortraten. Sie stand mitten unter allerlei Sachen, die im Zimmer umhergeworfen waren, vor einem offenen Wäscheschrank, aus dem sie einzelnes heraussuchte. Als sie die Schritte ihres Mannes hörte, hielt sie inne und blickte nach der Tür, wobei sie sich ohne Erfolg bemühte, ihrem Gesichte einen strengen, verächtlichen Ausdruck zu verleihen. Sie fühlte, dass sie vor ihm Furcht hatte und sich vor der bevorstehenden Aussprache ängstigte. Eben erst hatte sie von neuem versucht, das zu tun, was sie schon zehnmal in diesen drei Tagen zu tun versucht hatte: von den Sachen der Kinder und von ihren eigenen das Notwendigste herauszusuchen, um es zu ihrer Mutter bringen zu lassen. Und wieder konnte sie sich nicht endgültig dazu entschließen; aber auch jetzt sagte sie sich ebenso wie bei den früheren Versuchen, dass dieser Zustand nicht fortdauern könne; sie müsse irgend etwas unternehmen, ihren Mann bestrafen, bloßstellen, sich an ihm rächen, indem sie ihm wenigstens einen kleinen Teil des Schmerzes antäte, den er ihr zugefügt habe. Sie sagte sich immer noch, dass sie ihn verlassen wolle, fühlte aber, dass das unmöglich sei; unmöglich aber war es deswegen, weil sie nicht davon lassen konnte, ihn als ihren Gatten zu betrachten und zu lieben. Außerdem sah sie voraus, dass, wenn sie schon hier, im eigenen Hause, mit der Pflege und Beaufsichtigung ihrer fünf Kinder kaum fertig wurde, diese dort, wohin sie sich mit ihnen allen begeben wollte, noch schlechter versorgt werden würden. War doch schon in diesen drei Tagen der Jüngste von schlechter Fleischbrühe, die er bekommen hatte, krank geworden, und die übrigen hatten gestern fast gar kein Mittagessen gehabt. Sie fühlte, dass es ihr unmöglich sei, von hier wegzugehen; aber sie täuschte sich trotzdem selbst etwas vor, suchte die Sachen zusammen und tat, als ob sie weg wolle.
Als sie ihren Mann erblickte, versenkte sie die Hände in ein Fach des Wäscheschrankes, als ob sie etwas suchte, und sah sich nach ihm erst um, als er ganz dicht an sie herangetreten war. Aber ihr Gesicht, dem sie einen strengen, entschlossenen Ausdruck verleihen wollte, sprach nur von Ratlosigkeit und tiefem Leide.
»Dolly!« sagte er mit leiser, schüchterner Stimme. Er hatte den Kopf in die Schultern hineingezogen und wollte sich gern ein klägliches, demütiges Aussehen geben, aber dabei strahlte er doch von Frische und Gesundheit. Mit einem schnellen Blicke überschaute sie vom Kopf bis zu den Füßen seine prächtige, lebensfrohe Gestalt. ›Ja, er ist glücklich und zufrieden!‹ dachte sie. ›Aber ich? … Und diese widerwärtige Gutmütigkeit, um derentwillen ihn alle lieben und loben; ich hasse an ihm diese Gutmütigkeit.‹ Ihr Mund presste sich zusammen; die Wangenmuskeln auf der rechten Seite ihres bleichen, nervösen Gesichtes zuckten.
»Was wünschen Sie?« fragte sie schnell in unnatürlich klingendem Tone.
»Dolly«, sagte er noch einmal, und seine Stimme zitterte dabei. »Anna kommt heute her.«
»Was geht es mich an? Ich kann sie nicht empfangen!« schrie sie auf.
»Aber es wird doch nötig sein, Dolly …«
»Gehen Sie weg, gehen Sie weg!« rief sie, ohne ihn anzublicken, als wäre dieser Aufschrei durch einen körperlichen Schmerz hervorgerufen.
Stepan Arkadjewitsch hatte wohl ruhig sein können, solange er an seine Frau nur dachte; da hatte er hoffen können, es werde sich alles, nach Matweis Ausdruck, wieder einrenken, und hatte in dieser Hoffnung ruhig seine Zeitung lesen und seinen Kaffee trinken können; als er aber jetzt ihr abgehärmtes Märtyrergesicht vor sich sah und diesen Ton ihrer Stimme hörte, aus dem ihre Ergebung in das Schicksal und ihre Verzweiflung herausklangen, da war es ihm, als wenn er ersticken müsste; es stieg ihm etwas in die Kehle, und seine Augen füllten sich mit Tränen.
»Mein Gott, was habe ich getan, Dolly! Um Gottes willen! Ich habe ja …« Er konnte nicht weiterreden; ein Schluchzen verschloss ihm die Kehle.
Sie schloss die Schranktür und blickte ihn an.
»Dolly, was kann ich sagen? Nur das eine: Verzeih mir! Denke zurück; können denn nicht neun Jahre des Zusammenlebens einige wenige Augenblicke aufwiegen, in denen …«
Sie hatte die Augen auf den Boden gerichtet und hörte ihm zu, als warte sie, was er wohl sagen werde, als flehe sie ihn an, sie irgendwie von seiner Schuldlosigkeit zu überzeugen.
»… einige wenige Augenblicke, in denen ich mich hinreißen ließ …«, fuhr er fort und wollte weitersprechen; aber bei diesen Worten pressten sich ihre Lippen wieder wie infolge eines körperlichen Schmerzes zusammen, und wieder zuckten die Muskeln ihrer rechten Wange.
»Gehen Sie weg, gehen Sie weg von hier!« schrie sie noch durchdringender. »Und sprechen Sie zu mir nicht davon, dass Sie sich hätten hinreißen lassen, und nicht von dem, was Sie Schändliches getan haben!«
Sie wollte hinausgehen; aber sie wankte und fasste nach einer Stuhllehne, um sich zu stützen. Sein Gesicht zog sich in die Breite, seine Lippen wurden dicker, und die Tränen strömten ihm aus den Augen.
»Dolly!« sagte er schluchzend. »Um Gottes willen, denke an die Kinder; sie tragen ja keine Schuld. Ich bin der Schuldige; strafe mich, lass mich meine Schuld büßen. Womit ich sie nur zu büßen vermag, ich bin zu allem bereit! Ich habe gefehlt, und es ist gar nicht mit Worten zu sagen, wie schwer ich gefehlt habe! Aber dennoch, Dolly, verzeihe mir!«
Sie setzte sich hin. Er hörte ihr schweres, lautes Atmen und empfand ein unsägliches Mitleid mit ihr. Sie setzte mehrere Male an, etwas zu sagen, war aber dazu nicht imstande. Er wartete.
»Du denkst an die Kinder nur, um mit ihnen zu spielen; wenn ich aber an sie denke, so weiß ich dabei, dass sie jetzt zugrunde gehen müssen«, sagte sie; es war dies offenbar eine der Redewendungen, die sie sich im Laufe dieser drei Tage immer wieder vorgesprochen hatte.
Sie hatte du zu ihm gesagt, und darum blickte er sie voll Dankbarkeit an und machte eine Bewegung, um ihre Hand zu ergreifen; aber sie wich mit Abscheu vor ihm zurück.
»Ich denke an die Kinder, und deshalb würde ich alles tun, was menschenmöglich ist, um sie zu retten; aber ich weiß selbst nicht, wodurch ich sie retten kann: ob dadurch, dass ich sie von ihrem Vater wegnehme, oder dadurch, dass ich sie bei ihrem liederlichen Vater lasse, – jawohl, bei ihrem liederlichen Vater. Nun, sagen Sie selbst, ist es denn nach allem, was geschehen ist, überhaupt noch möglich, dass wir weiter miteinander leben? Ist das überhaupt noch möglich?« fragte sie noch einmal mit erhobener Stimme. »Nachdem mein Mann, der Vater meiner Kinder, sich in eine Liebschaft mit der Erzieherin seiner eigenen Kinder eingelassen hat …«
»Aber was ist nun zu machen? Was ist nun zu machen?« fragte er in kläglichem Ton; er wusste selbst nicht recht, was er sagte, und ließ den Kopf immer tiefer und tiefer herabsinken.
»Sie sind mir widerwärtig und ekelhaft!« schrie sie, immer mehr in Hitze geratend. »Ihre Tränen sind weiter nichts als Wasser! Sie haben mich nie geliebt; Sie besitzen weder ein Herz noch eine vornehme Gesinnung! Sie sind mir verhasst und ekelhaft; Sie sind mir ein Fremder, ja, ein ganz Fremder!« Mit bitterem Schmerze und tiefem Ingrimm sprach sie dieses Wort ›ein Fremder‹ aus, das ihr selbst schrecklich erschien.
Er blickte sie an, und der Ingrimm, der auf ihrem Gesichte zum Ausdruck kam, versetzte ihn in Schrecken und Staunen. Er begriff nicht, dass gerade sein Mitleid mit ihr sie reizte. Sie bemerkte bei ihm nur ein Gefühl des Bedauerns für sie, aber keine Liebe. ›Nein, sie hasst mich; sie wird mir nicht verzeihen‹, dachte er.
»Das ist furchtbar, ganz furchtbar!« sprach er vor sich hin.
In diesem Augenblick fing im Nebenzimmer eines der Kinder, das wahrscheinlich hingefallen war, an zu schreien. Darja Alexandrowna horchte auf, und ihre Miene wurde plötzlich milder.
Es schien, als sammle sie einige Sekunden lang ihre Gedanken, wie wenn sie nicht recht wüsste, wo sie sich befinde und was sie zu tun habe. Dann stand sie schnell auf und ging zur Tür hin.
›Also liebt sie doch mein Kind‹, dachte er, da er die Veränderung ihres Gesichtes beim Schreien des Kindes bemerkt hatte. ›Sie liebt mein Kind; wie kann sie dann mich hassen?‹
»Dolly, noch ein Wort!« sagte er, ihr nachgehend.
»Wenn Sie mir folgen, so rufe ich die Leute und die Kinder! Mögen sie es alle hören, dass Sie ein Schurke sind! Ich verlasse noch heute dieses Haus, und Sie können dann hier mit Ihrer Mätresse zusammen wohnen!«
Damit ging sie hinaus und schlug die Tür heftig hinter sich zu.
Stepan Arkadjewitsch seufzte, trocknete sich die Tränen vom Gesichte und ging mit leisen Schritten zu der Tür, durch die er gekommen war. ›Matwei sagt, es wird sich wieder einrenken; aber wie? Ich sehe schlechterdings keine Möglichkeit. Ach, was für eine schreckliche Lage! Und in welcher gewöhnlichen Weise sie schrie! Was für Ausdrücke!‹ sagte er zu sich selbst in Erinnerung an ihr Schreien und an die Worte Schurke und Mätresse. ›Vielleicht haben es sogar die Dienstmädchen gehört! Furchtbar gewöhnlich, wahrhaftig!‹ Stepan Arkadjewitsch blieb noch einige Sekunden allein stehen, trocknete sich die Augen, nahm eine feste Haltung an und verließ das Zimmer.
Es war Freitag, und im Esszimmer zog gerade der deutsche Uhrmacher die Uhr auf. Stepan Arkadjewitsch erinnerte sich an einen Scherz, den er einmal über diesen pünktlichen, kahlköpfigen Uhrmacher gemacht hatte: dieser Deutsche sei wohl selbst einmal für das ganze Leben aufgezogen worden, um Uhren aufzuziehen. Und diese Erinnerung entlockte ihm ein Lächeln.
Stepan Arkadjewitsch liebte einen guten Witz. ›Vielleicht renkt es sich wieder ein! Ein hübscher Ausdruck das: Es renkt sich wieder ein‹, dachte er. ›Den muss ich weitererzählen.‹
»Matwei!« rief er und trug ihm auf, als er erschien: »Richte also mit Marja alles im Fremdenzimmer für Anna Arkadjewna her!«
»Zu Befehl.«
Stepan Arkadjewitsch zog seinen Pelz an und trat vor den Hauseingang hinaus.
»Werden Sie zu Hause speisen?« fragte Matwei, der ihn hinausbegleitete.
»Ich weiß noch nicht. Wie es sich gerade machen wird. Aber hier nimm das für Auslagen«, sagte er und händigte ihm aus seiner Brieftasche zehn Rubel ein. »Wird es reichen?«
»Es lässt sich vorher nicht sagen; jedenfalls werde ich es einzurichten suchen«, erwiderte Matwei, schlug den Kutschenschlag zu und trat auf die Stufen vorm Haustor zurück.
Darja Alexandrowna hatte unterdessen das Kind beruhigt, und als sie an dem Geräusche des Wagens merkte, dass ihr Mann weggefahren sei, kehrte sie in das Schlafzimmer zurück. Dies war immer ihre Zuflucht vor den häuslichen Sorgen; sobald sie diese Zuflucht verließ, stürmten die Sorgen stets wieder von allen Seiten auf sie ein. Auch jetzt, während sie die paar Minuten im Kinderzimmer gewesen war, hatten die Engländerin und Matrona Filimonowna die Gelegenheit benutzt, um ihr verschiedene Fragen vorzulegen, die keinen Aufschub duldeten und die sie allein entscheiden konnte: Was die Kinder zum Spaziergang anziehen sollten. Ob sie Milch bekommen sollten. Ob ein anderer Koch zur Aushilfe angenommen werden solle.
»Ach, lasst mich, lasst mich!« antwortete sie, kehrte in das Schlafzimmer zurück und setzte sich auf denselben Platz, auf dem sie mit ihrem Manne gesprochen hatte; sie presste die abgemagerten Hände zusammen, an denen ihr die Ringe von den knochigen Fingern zu gleiten drohten, und ging in der Erinnerung das ganze vorhergehende Gespräch noch einmal durch. ›Er ist weggefahren! Aber wie mag er sich mit dieser Person auseinandergesetzt haben?‹ dachte sie. ›Ob er sie wohl noch besucht? Warum habe ich ihn nicht danach gefragt? Nein, nein, eine Aussöhnung ist unmöglich. Und selbst wenn wir in demselben Hause bleiben, so werden wir doch einander fremd sein. Fremd für immer!‹ Auf dieses ihr so furchtbare Wort kam sie immer wieder mit besonderem Nachdruck zurück. ›Und wie habe ich ihn geliebt, o mein Gott, wie habe ich ihn geliebt, wie habe ich ihn geliebt! – Und liebe ich ihn denn nicht auch jetzt noch? Liebe ich ihn nicht noch mehr als früher? Das Schrecklichste ist …‹ Aber sie beendete diesen angefangenen Gedanken nicht, da Matrona Filimonowna durch die Tür hereinblickte.
»Gestatten Sie doch, dass ich meinen Bruder holen lasse«, sagte sie. »Der kann das Mittagessen herrichten; sonst bekommen die Kinder wieder wie gestern bis sechs Uhr nichts zu essen.«
»Nun gut, ich komme gleich und werde alles, was nötig ist, anordnen. Ist nach frischer Milch geschickt?«
Und Darja Alexandrowna versenkte sich in die Sorgen des Tages und betäubte dadurch für einige Zeit ihren Gram.
5
Stepan Arkadjewitsch hatte in der Schule dank seinen trefflichen Fähigkeiten gut gelernt, war aber träge und ausgelassen gewesen und infolgedessen bei der Entlassung in der Rangordnung einer der letzten geworden; aber trotz seinem allzeit lockeren Lebenswandel, trotz der Kürze seiner Dienstzeit und trotz seinem verhältnismäßig jugendlichen Lebensalter bekleidete er die angesehene, gut besoldete Stellung des Direktors einer Moskauer Verwaltungsbehörde. Diesen Posten hatte er durch Alexei Alexandrowitsch Karenin, den Gatten seiner Schwester Anna, erhalten, der eine der höchsten Stellen in dem Ministerium einnahm, dem jene Behörde unterstellt war. Aber auch wenn Karenin seinen Schwager nicht in diese Stelle gebracht hätte, so würde Stiwa Oblonski doch durch hundert andere Personen, durch Brüder, Schwestern, Vettern, Onkel und Tanten, diese oder eine andere, ähnliche Stelle mit etwa sechstausend Rubeln Gehalt bekommen haben; und eine solche Einnahme brauchte er recht nötig, da seine Geldverhältnisse trotz dem bedeutenden Vermögen seiner Frau sich in arger Zerrüttung befanden.
Halb Moskau und Petersburg war mit Stepan Arkadjewitsch verwandt oder befreundet. Er war mitten unter den Leuten geboren, die die Mächtigen dieser Welt waren oder wurden. Ein Drittel der hohen Regierungsbeamten, die älteren Männer, waren Freunde seines Vaters gewesen und hatten ihn noch im Kinderkleidchen gekannt; das zweite Drittel stand mit ihm auf du und du; und das dritte waren gute Bekannte. Somit waren die Verteiler irdischer Güter, als da sind Ämter, Pachtungen, Konzessionen und dergleichen, sämtlich mit ihm befreundet und konnten ihn als einen der Ihrigen nicht übergehen; und Oblonski brauchte sich nicht sonderlich zu bemühen, um eine einträgliche Stelle zu erhalten; er brauchte eine solche nur nicht auszuschlagen, sich nicht missgünstig zu zeigen, sich mit niemandem zu überwerfen, sich nicht gekränkt zu fühlen, was er auch sowieso zufolge der ihm eigenen Gutmütigkeit niemals tat. Es wäre ihm lächerlich erschienen, wenn man ihm gesagt hätte, er würde keine Stelle mit einem Gehalte, wie er es brauchte, erlangen, umso mehr, da er nichts Außerordentliches beanspruchte; er wollte nur das, was seine Standesgenossen meist erlangten, und einen derartigen Posten konnte er ebenso gut ausfüllen wie jeder andere.
Stepan Arkadjewitsch war nicht nur bei allen, die ihn kannten, wegen seines gutmütigen, heiteren Charakters und seiner unzweifelhaften Ehrenhaftigkeit beliebt, sondern in seinem ganzen Wesen, in seiner schönen, glänzenden Erscheinung, den blitzenden Augen, den schwarzen Brauen und Haaren, dem frischen, gesunden Gesicht lag etwas, was schon durch die rein physische Wirkung alle, die mit ihm in Berührung kamen, für ihn einnahm und in eine fröhliche Stimmung versetzte. »Ah! Stiwa! Oblonski! Da ist er ja auch!« riefen fast immer die, die mit ihm zusammentrafen, mit vergnügtem Lächeln. Und wenn sie nach einem Gespräche mit ihm sich bewusst wurden, dass eigentlich nichts besonders Vergnügliches vorgekommen sei, so freuten sie sich doch am anderen und am dritten Tage alle wieder ganz ebenso bei einer Begegnung mit ihm.
Schon mehr als zwei Jahre bekleidete Stepan Arkadjewitsch den Direktorposten bei der Moskauer Verwaltungsbehörde und hatte sich während dieser Zeit wie die Zuneigung so auch die Achtung seiner Kollegen, Untergebenen und Vorgesetzten und aller, die mit ihm zu tun hatten, erworben. Die Eigenschaften, die hauptsächlich dazu beitrugen, ihm diese allgemeine Achtung in dienstlicher Hinsicht zu verschaffen, waren erstens seine außerordentliche Leutseligkeit, die bei ihm auf dem Bewusstsein seiner eigenen Mängel beruhte; zweitens seine durchaus liberale, fortschrittliche Gesinnung, nicht die, die er sich aus den Zeitungen zu eigen machte, sondern die, die ihm im Blute steckte und infolge deren er alle Menschen, ohne jede Rücksicht auf ihren Stand und Beruf, völlig gleich und unparteiisch behandelte; drittens (und das war wohl die Hauptsache) seine vollständige Gemütsruhe gegenüber den Angelegenheiten, mit denen er sich zu beschäftigen hatte, sodass er sich niemals von Erregungen hinreißen ließ und keine Übereilungsfehler machte.
Als Stepan Arkadjewitsch heute in seinem Wagen zu der Stätte seiner dienstlichen Tätigkeit gelangt war, begab er sich, begleitet von dem ehrerbietigen Pförtner, der ihm die Aktenmappe trug, in sein kleines Arbeitszimmer, zog die Uniform an und trat in den Sitzungssaal. Die Schreiber und Beamten erhoben sich sämtlich und verbeugten sich mit freundlicher, achtungsvoller Miene. Stepan Arkadjewitsch ging wie immer schnellen Schrittes zu seinem Platze, drückte den Räten die Hand und setzte sich. Er scherzte und plauderte ein wenig mit ihnen, gerade so viel, wie schicklich war, und nahm dann die Arbeit in Angriff. Niemand verstand es besser als Stepan Arkadjewitsch, jene Grenzlinie zwischen harmlosem, schlichtem Benehmen und dienstlicher Haltung zu finden, deren Innehaltung für eine angenehme Amtstätigkeit erforderlich ist. Freundlich und achtungsvoll, wie sich eben alle in Stepan Arkadjewitschs Amtsbereich benahmen, trat der Sekretär mit einigen Schriftstücken zu ihm heran und sagte in dem freien, ungezwungenen Tone, den Stepan Arkadjewitsch eingeführt hatte:
»Wir haben doch noch von dem Gouvernement Pensa die Nachrichten erhalten. Hier, ist es Ihnen vielleicht gefällig …«
»Haben wir sie endlich bekommen?« erwiderte Stepan Arkadjewitsch und schob einen Finger in das Aktenstück vor ihm an der Stelle, wo er es nachher aufschlagen wollte. »Nun, meine Herren …« Und die Sitzung begann.
›Wenn die wüssten‹, dachte er, während er mit bedeutsamer Miene beim Anhören eines Berichtes den Kopf zur Seite neigte, ›welch ein zerknirschter Sünder noch vor einer halben Stunde ihr Vorsitzender gewesen ist!‹ Seine Augen lachten während der Verlesung des Berichtes. Bis zwei Uhr musste nach der bestehenden Ordnung die Arbeit ohne Unterbrechung fortgeführt werden; um zwei Uhr kam dann eine Frühstückspause.
Es war noch nicht zwei Uhr, als die große Glastür des Sitzungssaales plötzlich geöffnet wurde und jemand hereinkam. Alle Beamten blickten, erfreut über eine kleine Ablenkung, zur Tür hin; aber der Türhüter, der dort seinen Posten hatte, wies den Eindringling sofort wieder hinaus und machte die Glastür hinter ihm wieder zu.
Als die Verlesung des gerade vorliegenden Schriftstückes beendet war, erhob sich Stepan Arkadjewitsch, reckte sich ein wenig, holte noch im Sitzungssaale, den fortschrittlichen Anschauungen der modernen Zeit Rechnung tragend, eine Zigarette hervor und machte sich auf nach seinem Arbeitszimmer. Zwei seiner Kollegen, der bejahrte, bereits in hohem Dienstalter stehende Nikitin und der Kammerjunker Grinjewitsch, gingen mit ihm zusammen hinaus.
»Nach dem Frühstück werden wir schon mit der Sache zu Ende kommen«, bemerkte Stepan Arkadjewitsch.
»Mit Leichtigkeit!« versetzte Nikitin.
»Aber ein gehöriger Gauner muss doch dieser Fomin sein«, meinte Grinjewitsch mit Bezug auf eine der Personen, die an der zur Untersuchung stehenden Sache beteiligt waren.
Stepan Arkadjewitsch runzelte bei Grinjewitschs Worten die Stirn, womit er zu verstehen gab, dass es unpassend sei, vorzeitig ein Urteil auszusprechen, und gab ihm keine Antwort.
»Wer kam denn da vorhin herein?« fragte er den Türhüter.
»Ich kenne ihn nicht, Euer Exzellenz. Er drang, ohne zu fragen, ein, als ich gerade einmal einen Augenblick den Rücken kehrte. Er fragte dann nach Ihnen. Ich habe ihm gesagt: wenn die Herren herauskommen, dann …«
»Wo ist er denn?«
»Er muss wohl eben auf den Flur hinuntergegangen sein; bis vor kurzem ist er immer hier auf und ab gewandert. Da ist er«, sagte der Türhüter und wies auf einen kräftig gebauten, breitschulterigen, krausbärtigen Mann, der, ohne seine Schaffellmütze abzunehmen, schnell und behänd die abgetretenen Stufen der Steintreppe heraufgelaufen kam. Ein hagerer Beamter, der mit den übrigen, seine Aktenmappe unter dem Arm, die Treppe hinunterstieg, blieb stehen, warf einen missbilligenden Blick auf die Beine des Laufenden und blickte dann fragend Oblonski an.
Stepan Arkadjewitsch stand oben an der Treppe. Sein gutmütig glänzendes Gesicht über dem gestickten Uniformkragen strahlte plötzlich noch heller auf, als er den Heraufkommenden erkannte.
»Wahrhaftig! Ljewin! Endlich einmal!« rief er mit einem freundschaftlichen, ein wenig spöttischen Lächeln, während er den zu ihm tretenden Ljewin musterte. »Wie hast du es nur über dich gewinnen können, mich in dieser Räuberhöhle aufzusuchen?« fuhr Stepan Arkadjewitsch fort und begnügte sich nicht mit einem Händedruck, sondern küsste seinen Freund herzlich. »Bist du schon lange in Moskau?«
»Ich bin eben erst angekommen und wollte dich gern sprechen«, antwortete Ljewin und blickte dabei schüchtern und zugleich ärgerlich und unruhig um sich.
»Na, komm mit in mein Arbeitszimmer!« sagte Stepan Arkadjewitsch, der die empfindliche, leicht reizbare Schüchternheit seines Freundes kannte; er fasste ihn an der Hand und zog ihn mit sich, als ob er ihn durch drohende Gefahren hindurchgeleiten wollte.
Stepan Arkadjewitsch stand mit fast allen seinen Bekannten auf du und du: mit alten Männern von sechzig Jahren und mit jungen von zwanzig Jahren, mit Schauspielern, Ministern, Kaufleuten und Generaladjutanten, sodass sehr viele seiner Duzfreunde sich an den beiden entgegengesetzten Enden der gesellschaftlichen Stufenleiter befanden und sehr verwundert gewesen wären, zu erfahren, dass sie in Oblonski einen gemeinsamen Berührungspunkt hatten. Er duzte sich mit allen, mit denen er Champagner getrunken hatte, und Champagner trank er mit all und jedem. Traf er nun in Anwesenheit von Beamten, die ihm unterstellt waren, mit seinen ›kompromittierenden Duzfreunden‹, wie er im Scherze viele seiner Freunde nannte, zusammen, so verstand er es mit dem ihm eigenen Takte, den unangenehmen Eindruck abzuschwächen, den dies auf seine Untergebenen machen konnte. Ljewin gehörte nicht zu diesen kompromittierenden Duzfreunden; aber Oblonski merkte mit dem feinen Gefühl, das er für solche Dinge besaß, dass Ljewin glaubte, er, Oblonski, möge vor seinen Untergebenen nicht gern sein engeres Verhältnis zu ihm, Ljewin, bekunden; darum beeilte sich Oblonski, ihn in sein Arbeitszimmer zu führen.
Ljewin war beinah gleichen Alters mit Oblonski, und seine Duzfreundschaft mit ihm stammte nicht etwa nur vom Champagner her. Ljewin war schon in früher Jugend sein Kamerad und Freund gewesen. Sie mochten einander gern trotz der Verschiedenheit der Charaktere und Neigungen, wie eben Freunde einander gern haben, die sich in früher Jugend zusammengefunden haben. Aber trotzdem ging es auch bei ihnen, wie so oft bei Leuten, die sich für stark verschiedene Arten von Tätigkeit entschieden haben: obgleich ein jeder von ihnen der Tätigkeit des anderen bei genauerer Überlegung Gerechtigkeit widerfahren ließ, schätzte er sie doch im Grunde seiner Seele gering. Jedem schien das Leben, das er selbst führte, das einzig wahre Leben zu sein und das des Freundes nur eine Karikatur des Daseins. Oblonski konnte, sobald er Ljewin zu sehen bekam, ein leises, spöttisches Lächeln nicht unterdrücken. Wer weiß wie oft hatte er ihn nun schon von seinem Gute, wo er sich irgendwelcher Tätigkeit hingab, nach Moskau kommen sehen; aber was er dort eigentlich tat, das hatte Stepan Arkadjewitsch nie so recht begreifen können, und es interessierte ihn auch nicht besonders. Wenn Ljewin nach Moskau kam, so war er immer stark aufgeregt, in großer Hast, ein wenig befangen und eben infolge dieser Befangenheit sehr reizbar, und meistens hatte er sich inzwischen irgendeine völlig neue, überraschende Anschauung über diesen oder jenen Gegenstand zu eigen gemacht. Stepan Arkadjewitsch lachte über das Wesen seines Freundes, hatte es aber doch gern. Ganz ebenso verachtete auch Ljewin im Grunde seiner Seele die städtische Lebensweise des anderen und seine dienstliche Tätigkeit, der er jeden Wert absprach, und machte sich darüber lustig. Aber ein Unterschied bestand darin, dass Oblonski, der so lebte wie alle anderen Menschen auch, wenn er über seinen Freund spottete, dies voll Selbstvertrauen und in gutmütiger Weise tat, Ljewin dagegen ohne rechtes Selbstvertrauen und mitunter in aufgebrachtem Tone.
»Wir haben dich schon lange erwartet«, sagte Stepan Arkadjewitsch beim Eintritt in sein Zimmer und ließ nun Ljewins Hand los, wie wenn er dadurch ausdrücken wollte, dass hier keine Gefahr mehr sei. »Ich bin sehr, sehr erfreut, dich wiederzusehen«, fuhr er fort. »Nun, was machst du? Wie geht es dir? Wann bist du angekommen?«
Ljewin schwieg und richtete seine Blicke auf die ihm unbekannten Gesichter der beiden Kollegen Oblonskis und namentlich auf die Hände des eleganten Grinjewitsch mit den langen, weißen Fingern, mit den langen, gelben, an den Spitzen gekrümmten Nägeln und den riesigen, blitzenden Manschettenknöpfen. Diese Hände nahmen augenscheinlich Ljewins ganze Aufmerksamkeit in Anspruch und ließen ihn an nichts anderes mehr denken. Oblonski bemerkte das sofort und lächelte.
»Ach ja, gestatten Sie, dass ich Sie miteinander bekannt mache«, sagte er. »Meine Kollegen: Filipp Iwanowitsch Nikitin, Michail Stanislawitsch Grinjewitsch«, und auf Ljewin deutend: »Ein Koryphäe der ländlichen Selbstverwaltung, ein moderner Landwirt, ein Athlet, der mit einer Hand anderthalb Zentner hebt, Viehzüchter, Jäger und mein Freund, Konstantin Dmitrijewitsch Ljewin, ein Bruder von Sergei Iwanowitsch Kosnüschew.«
»Sehr angenehm«, sagte der alte Beamte.
»Ich habe die Ehre, Ihren Bruder Sergei Iwanowitsch zu kennen«, bemerkte Grinjewitsch und streckte ihm seine schmale Hand mit den langen Nägeln hin.
Ljewin zog ein finsteres Gesicht, reichte ihm kühl die Hand und wandte sich sofort Oblonski zu. Obgleich er seinen mit ihm von derselben Mutter stammenden Stiefbruder, einen in ganz Russland bekannten Schriftsteller, sehr hoch schätzte, konnte er es doch nicht leiden, wenn man ihn im Verkehr nicht als Konstantin Ljewin, sondern als den Bruder des berühmten Kosnüschew behandelte.
»Nein, ich beteilige mich nicht mehr an der ländlichen Selbstverwaltung. Ich habe mich mit allen überworfen und fahre nicht mehr zu den Versammlungen«, sagte er, zu Oblonski gewendet.
»Das ist einmal flink gegangen!« erwiderte Oblonski lächelnd. »Aber warum? Wie ist das gekommen?«
»Das ist eine lange Geschichte. Ich will sie dir ein ander Mal erzählen«, antwortete Ljewin, begann aber mit der Erzählung doch sofort. »Nun, um es kurz zu machen, ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es eine ersprießliche ländliche Selbstverwaltung nicht gibt und nicht geben kann«, fing er an, und zwar mit einer Heftigkeit, als hätte ihn soeben jemand beleidigt. »Erstens ist es eine Spielerei, man spielt Parlament; ich bin aber weder jung genug noch alt genug, um an Spielereien Vergnügen zu finden. Und zweitens« (er begann zu stottern) »ist das für die feinen Leute im Kreise ein Mittel, um Geld herauszuschlagen. Früher dienten dazu die Vormundschaftsämter und Landschaftsgerichte, jetzt jedoch die Kreisverwaltung. Sie bereichern sich zwar nicht durch Annahme von Bestechungsgeldern, wohl aber durch Bezug von Gehältern, für die sie nichts leisten.« Er brachte das alles so hitzig vor, wie wenn einer der Anwesenden seine Ansicht bestritte.
»Ei sieh einmal! Du befindest dich ja, merke ich, wieder auf einer neuen Entwicklungsstufe; du bist jetzt konservativ«, sagte Stepan Arkadjewitsch. »Je doch, darüber sprechen wir später einmal.«
»Ja, ja, später. Aber ich habe notwendig mit dir zu reden«, versetzte Ljewin mit einem hasserfüllten Blick auf Grinjewitschs Hände.
Stepan Arkadjewitsch lächelte kaum merklich.
»Hast du nicht vor kurzem gesagt, du wolltest nie mehr europäische Kleidung tragen?« fragte er, während er Ljewins neuen Anzug, offenbar das Werk eines französischen Schneiders, musterte. »Ja, ja, ich sehe schon, eine neue Entwicklungsstufe!«
Ljewin errötete plötzlich, aber nicht so, wie erwachsene Leute erröten, nur so ein wenig und ohne sich dessen selbst bewusst zu werden, sondern so, wie Knaben erröten, die fühlen, dass sie durch ihre Befangenheit lächerlich erscheinen und die nun infolgedessen sich noch mehr schämen und noch mehr erröten, beinah bis zum Weinen. Der Anblick dieses klugen, männlichen Gesichtes in einem so kindlichen Zustande wirkte so befremdend, dass Oblonski die Augen davon wegwandte.
»Also, wo wollen wir denn zusammenkommen? Ich muss nämlich notwendig, ganz notwendig mit dir reden«, sagte Ljewin.
Oblonski überlegte einen Augenblick.
»Wir könnten es so machen: wir fahren jetzt gleich zu Gurin, frühstücken da und reden dabei miteinander. Bis drei Uhr bin ich frei.«
»Das geht nicht«, antwortete Ljewin nach kurzem Nachdenken. »Ich habe jetzt noch eine notwendige Besorgung.«
»Nun gut, dann wollen wir zusammen Mittag essen.«
»Mittag essen? Etwas Besonderes habe ich dir eigentlich nicht zu sagen; es sind nur ein paar Worte; ich wollte dich etwas fragen. Nachher können wir ja miteinander plaudern.«
»So sage doch die paar Worte jetzt gleich; dann können wir uns bei Tische vollständig einer gemütlichen Unterhaltung widmen.«
»Die paar Worte sind nämlich die«, sagte Ljewin. »Übrigens ist es weiter nichts Besonderes.«
Sein Gesicht nahm plötzlich einen ärgerlichen Ausdruck an, der durch die Anstrengung hervorgerufen wurde, mit der er seiner Verlegenheit Herr zu werden suchte.
»Was machen denn Schtscherbazkis? Alles beim alten?« fragte er.
Stepan Arkadjewitsch, der schon lange wusste, dass Ljewin in seine, Stepans, Schwägerin Kitty verliebt war, lächelte leise, und seine Augen blitzten lustig.
»Da hast du nun also deine paar Worte gesagt; ich kann dir aber nicht mit ein paar Worten antworten, weil … Entschuldige einen Augenblick!«
Ein Sekretär kam herein. Mit einer Art von achtungsvoller Vertraulichkeit und einem gewissen, bei allen Sekretären zu findenden bescheidenen Bewusstsein der eigenen Überlegenheit über den Dienstherrn, was Geschäftskenntnis anlangt, trat er mit einigen Aktenstücken in der Hand an Oblonski heran und begann, unter der Form einer Frage, irgendeine Schwierigkeit auseinanderzusetzen. Stepan Arkadjewitsch hörte ihn nicht bis zu Ende an, sondern unterbrach ihn, indem er ihm freundlich die Hand auf den Rockärmel legte.
»Nein, machen Sie das doch nur so, wie ich gesagt habe«, versetzte er, wobei er den Tadel, der in dieser Bemerkung lag, durch ein Lächeln milderte. Dann erklärte er ihm kurz, wie er die Sache auffasse, und schob die Papiere mit den Worten zurück: »So also machen Sie es, bitte, so, Sachar Nikitisch.«
Verlegen entfernte sich der Sekretär. Ljewin, der während der Erörterung mit dem Sekretär seine Befangenheit vollständig überwunden hatte, stand mit beiden Händen auf eine Stuhllehne gestützt da, und auf seinem lächelnden Gesichte malte sich ein spöttisches Interesse.
»Mir unbegreiflich, mir unbegreiflich«, sagte er.
»Was ist dir denn unbegreiflich?« fragte Oblonski, gleichfalls heiter lächelnd, und holte eine Zigarette hervor. Er erwartete, dass Ljewin wieder einmal in besonderer Weise losbrechen werde.
»Es ist mir unbegreiflich, mit welchen Dingen ihr euch da abgebt«, erwiderte Ljewin achselzuckend. »Wie kannst du dergleichen nur ernsthaft betreiben!«
»Wieso?«
»Nun, weil es eigentlich doch eine Art Müßiggang ist.«
»Das denkst du so; aber wir sind mit Arbeit überhäuft.«
»Mit papierener Arbeit. Na ja, dafür hast du ja eine Begabung«, fügte Ljewin hinzu.
»Das heißt, du meinst, dass es mir anderweitig mangelt?«
»Kann schon sein«, versetzte Ljewin. »Aber trotzdem bewundere ich deine hervorragenden Eigenschaften und bin stolz darauf, einen so großen Mann zum Freunde zu haben. – Aber du hast mir auf meine Frage noch nicht geantwortet«, fügte er hinzu und blickte mit verzweifelter Anstrengung dem anderen gerade in die Augen.
»Na schön, schön! Warte nur, du kommst auch noch einmal auf unseren Standpunkt. Du bist ja gut dran mit deinen dreitausend Deßjatinen im Kreise Karasinsk und mit solchen Muskeln und mit solcher Lebensfrische wie ein zwölfjähriges Mädchen, – aber auch du wirst noch auf unsere Seite kommen. Ja, also was deine Frage betrifft: es hat sich da nichts geändert; aber schade, dass du so lange nicht hier gewesen bist.«
»Wieso?« fragte Ljewin erschrocken.
»Nun, es ist nichts Besonderes«, antwortete Oblonski. »Wir sprechen schon noch darüber. Aber zu welchem Zwecke bist du denn eigentlich hergekommen?«
»Ach, darüber können wir ja auch später noch sprechen«, erwiderte Ljewin und wurde wieder rot bis über die Ohren.
»Na schön, gewiss«, versetzte Stepan Arkadjewitsch. »Siehst du, ich würde dich gern zu mir einladen; aber meine Frau ist nicht recht wohl. Aber weißt du was? Wenn du die Schtscherbazkischen Damen sehen willst, die sind heute höchstwahrscheinlich von vier bis fünf im Zoologischen Garten. Kitty läuft da Schlittschuh. Fahre da hin; ich hole dich nachher ab, und wir essen dann zusammen irgendwo zu Mittag.«
»Ausgezeichnet! Also auf Wiedersehen!«
»Aber denk auch daran! Dass du es ja nicht etwa vergisst oder wohl gar plötzlich aufs Land zurückfährst! Ich kenne dich!« rief Stepan Arkadjewitsch lachend.
»Nein, nein, du kannst dich auf mich verlassen.«
Erst als er an der Tür war, fiel es Ljewin ein, dass er ja vergessen hatte, sich von Oblonskis Kollegen zu verabschieden; hastig holte er das Versäumte nach und verließ das Zimmer.
»Wohl ein sehr energischer Herr?« bemerkte Grinjewitsch, als Ljewin hinausgegangen war.
»Ja, liebster Freund«, antwortete Stepan Arkadjewitsch, den Kopf hin und her wiegend, »das ist ein Glückskind! Dreitausend Deßjatinen im Kreise Karasinsk, das ganze Leben noch vor sich, und was für eine Frische! Nicht so wie unsereiner!«
»Sie wollen sich beklagen, Stepan Arkadjewitsch, Sie?«
»Ja, scheußlich geht es einem, gar zu schlimm!« antwortete Stepan Arkadjewitsch mit einem schweren Seufzer.
6
Als Oblonski an Ljewin die Frage gerichtet hatte, zu welchem Zwecke er denn eigentlich nach Moskau gekommen sei, war Ljewin rot geworden und ärgerte sich nun nachher eben darüber, dass er rot geworden war und es nicht fertiggebracht hatte, ihm zu antworten: ›Ich bin hergekommen, um deiner Schwägerin einen Heiratsantrag zu machen‹, wiewohl dies der einzige Zweck seiner Reise war.