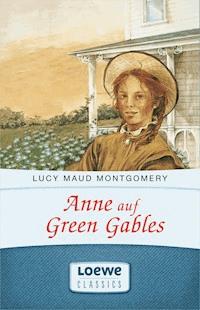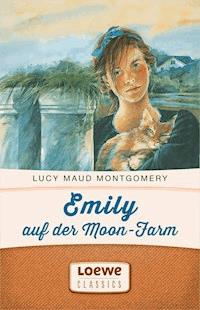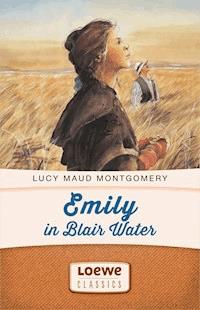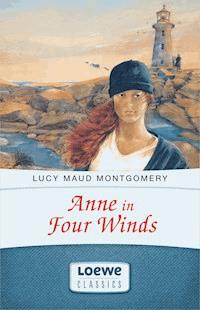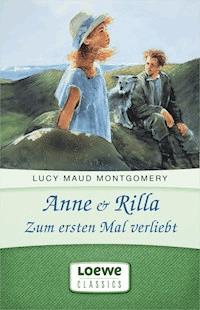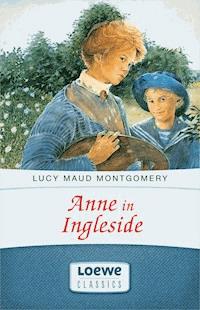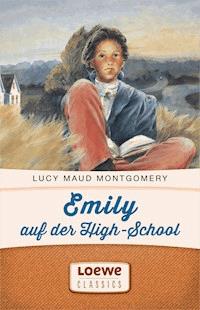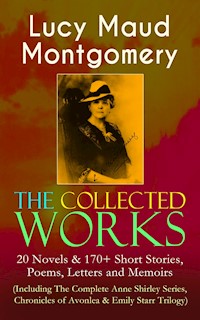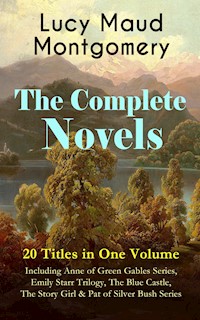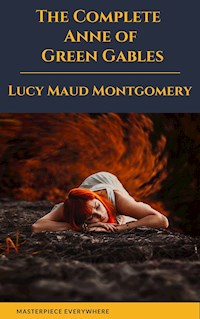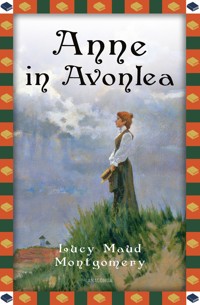
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Anaconda Kinderbuchklassiker
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die rothaarige Anne mit der regen Fantasie lebt mit ihrer Ziehmutter Marilla auf Green Gables und ist unten im Ort, in Avonlea, nun als Lehrerin aktiv. In ihrer quirligen Klasse ist natürlich immer was los, und bei all den kauzigen Leuten in der Nachbarschaft auch. Trubel bringen die Adoptiv-Zwillinge Davy und Dora ins Haus. Insgesamt lebt es sich herrlich auf der kleinen kanadischen Insel, denn Anne liebt die Begegnungen mit Menschen aller Art und die aufregenden Abenteuer in der Natur. Dieses Buch über Annes Teenagerjahre schließt an die hinreißend erzählten Kindheitsjahre von »Anne auf Green Gables« an, dem endlich auch in Deutschland vielgelesenen Mädchenbuch-Klassiker.
- Pippi Langstrumpfs Vorbild aus Kanada
- Das quirlige Waisenmädchen mit den roten Haaren: Selbstbewusste Heldin mit Riesenfangemeinde
- Hier geht's um Ganze: Gerechtigkeit, Toleranz, Selbstbestimmung, Liebe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Ähnliche
Lucy Maud Montgomery
Anne in Avonlea
Roman
Deutsch von Jan Strümpel
Anaconda
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Anne of Avonlea (Boston 1909)
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Covermotiv: James Hill, »Anne Shirley on the Hill«, The Sullivan Collection / © James Hill. All Rights Reserved 2023 / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: Achim Münster, Overath
ISBN 978-3-641-29163-1V002
www.anacondaverlag.de
Inhalt
1 – Ein erzürnter Nachbar
2 – Überstürzter Kuhhandel
3 – Bei Mr Harrison
4 – Meinungsverschiedenheiten
5 – Hinein ins Berufsleben
6 – Menschen aller Arten und Sorten
7 – Pflichtbewusstsein
8 – Marilla nimmt Zwillinge zu sich
9 – Ein buntes Durcheinander
10 – Davy sorgt für Aufsehen
11 – Wunsch und Wirklichkeit
12 – Ein rabenschwarzer Tag
13 – Ein goldenes Picknick
14 – Noch mal gut gegangen
15 – Ferienbeginn
16 – Große Vorfreude
17 – Pleiten, Pech und Pannen
18 – Ein Abenteuer an der Tory Road
19 – Ein rundum gelungener Tag
20 – Unverhofft kommt oft
21 – Herzige Miss Lavendar
22 – Dieses und jenes
23 – Miss Lavendars Liebeserlebnis
24 – Prophet im eigenen Land
25 – Skandal in Avonlea
26 – Hinein in die Biegung
27 – Ein Nachmittag beim Steinhaus
28 – Der Prinz kehrt zurück zum verwunschenen Schloss
29 – Poesie und Prosa
30 – Eine Hochzeit im Steinhaus
Die Knospen erblühen, wo sie betritt
Die achtsamen Pfade der Pflicht,
Wo sie ist, werden die Falten schön
Im noch so verhärteten Angesicht.
John G. Whittier
Meiner ehemaligen Lehrerin Hattie Gordon Smith, deren Verständnis und Förderung in dankbarer Erinnerung bleibt.
1 – Ein erzürnter Nachbar
An einem Spätnachmittag im August setzte sich ein großes, schlankes Mädchen, sechzehneinhalb, mit ernsten grauen Augen und – wie ihre Freunde sagten – goldbraunem Haar auf die breite, rote Steinstufe eines Farmhauses auf der Prinz-Edward-Insel in der festen Absicht, Verse von Vergil zu übersetzen.
Doch ein Augustnachmittag, an dem sich blauer Dunst auf die erntereifen Hänge legt, ein Lüftchen elfenhaft in den Pappeln säuselt und in einer Ecke des Kirschgartens eine wogende Pracht roter Mohnblumen leuchtend gegen das dunkle Geäst junger Tannen absticht, verführt doch eher zum Träumen als eine tote Sprache. Bald glitt der Vergil unbeachtet zu Boden, und Anne, das Kinn auf die Hände gestützt, den Blick auf die prächtige Masse fluffiger Wolken gerichtet, die direkt über dem Haus von Mr J. A. Harrison wie ein hoher weißer Berg emporragte, befand sich weit weg in einer herrlichen Welt, in der eine ganz bestimmte Lehrerin großartige Arbeit leistete, die Talente künftiger Staatenlenker förderte und Herzen und Hirne junger Menschen für hehre Ziele begeisterte.
Nun ja, die schnöde Faktenlage – mit der sich Anne, zugegeben, selten befasste, außer es ließ sich gar nicht vermeiden – sprach gegen allzu viele verheißungsvolle Anwärter für Berühmtheiten an der Schule von Avonlea; aber man wusste nie, was passieren mochte, wenn eine Lehrerin ihre ganze Strahlkraft entfaltete. Anne hatte rosarot durchwirkte Idealvorstellungen davon, was eine Lehrerin erreichen konnte, wenn sie es nur richtig anging; und sie steckte mitten in einer hinreißenden Szene vierzig Jahre in der Zukunft mit einer berühmten Persönlichkeit – der genaue Grund für ihre Berühmtheit blieb im Unklaren, doch Anne gefiel der Gedanke, dass es ein Universitätspräsident war oder ein kanadischer Premierminister –, die sich tief über ihre runzlige Hand beugte und ihr beteuerte, niemand anderes als sie habe damals seinen Ehrgeiz entfacht, und dass seine gesamte Lebensleistung auf dem Unterricht beruhe, den sie vor ach so langer Zeit an der Schule von Avonlea erteilt habe. Eine höchst unschöne Störung machte dieses schöne Traumbild zunichte.
Eine scheue kleine Jerseykuh kam des Weges getrabt, und fünf Sekunden darauf war auch Mr Harrison eingetroffen – wobei das Wort »eintreffen« zu neutral gewählt sein mag, um die Art zu beschreiben, wie er in den Garten platzte.
Statt das Tor zu öffnen, sprang er über den Zaun und baute sich wütend vor der verblüfften Anne auf, die sich erhoben hatte und ihn einigermaßen verwundert ansah. Mr Harrison war der neue Nachbar zur Rechten, sie hatte ihn schon ein, zwei Mal gesehen, aber noch nie getroffen.
Anfang April – Anne war da noch nicht vom Queen’s College nach Hause zurückgekehrt – hatte Mr Robert Bell, dessen Farm westlich an das Grundstück der Cuthberts grenzte, alles verkauft und war nach Charlottetown gezogen. Erworben hatte seinen Hof ein gewisser J. A. Harrison, von dem man nicht mehr wusste als diesen Namen und dass er aus New Brunswick stammte. Aber er lebte noch keinen Monat in Avonlea, da stand er bereits in dem Ruf, eine seltsame Person zu sein – ein »Spinner«, wie Mrs Rachel Lynde sagte. Mrs Rachel nahm nie ein Blatt vor den Mund, wie diejenigen unter euch, die bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, sicher noch wissen. Mr Harrison war eindeutig anders als die übrigen Leute – was, wie jedermann weiß, einen Spinner auszeichnet.
Zunächst einmal erledigte er seinen Haushalt selbst und hatte öffentlich geäußert, er könne keine blöden Weiber in seiner Hütte gebrauchen. Avonleas Frauen revanchierten sich mit Schauergeschichten über seine Qualitäten im Putzen und Kochen. Der kleine John Henry Carter aus White Sands arbeitete für ihn, von ihm nahmen die Geschichten ihren Ausgang. Bei Harrison gab es zum Beispiel keine festen Essenszeiten. Mr Harrison »machte sich was«, wenn er hungrig war, und wenn sich John Henry gerade in der Nähe befand, bekam er etwas davon ab, andernfalls musste er solange warten, bis Mr Harrison wieder einmal Kohldampf hatte. John Henry beteuerte, er wäre glatt verhungert, hätte er sich sonntags nicht zu Hause sattessen können, und dass seine Mutter ihm montagmorgens immer einen »Fresskorb« mit auf den Weg gab.
Was den Abwasch betraf, rührte Mr Harrison grundsätzlich keine Hand, bis es sonntags mal regnete. Dann machte er sich ans Werk, spülte das gesamte Geschirr in der Regentonne und ließ es zum Trocknen stehen.
Zudem war Mr Harrison »knickrig«. Als man ihn um einen Beitrag zum Gehalt von Pfarrer Allan bat, sagte er, er wolle erst abwarten und sehen, welchen baren Nutzen er aus dessen Predigten ziehe – er halte nichts davon, die Katze im Sack zu kaufen. Und als Mrs Lynde erschien, um ihn um eine Spende für die Mission zu bitten – und dabei nebenher einen Blick in sein Haus zu werfen –, sagte er ihr, unter den alten Tratschweibern von Avonlea wären mehr Gottlose als irgendwo sonst, und er würde mit Freuden für deren Missionierung spenden, sollte sie sich dessen annehmen. Mrs Rachel zog wieder ab und sagte, es sei ein Segen, dass die arme Mrs Bell fest in ihrem Grab liege, denn der Anblick ihres heruntergekommenen Hauses, auf das sie immer so viel Sorgfalt verwandt hatte, hätte ihr das Herz gebrochen.
»Den Boden ihrer Küche hat sie jeden zweiten Tag geschrubbt«, erzählte Mrs Lynde empört Marilla Cuthbert, »und du glaubst nicht, wie der jetzt aussieht! Ich musste die Röcke anheben, als ich drüber wegging.«
Schließlich hatte Mr Harrison auch noch einen Papagei namens Ginger. Niemand in Avonlea hatte je einen Papagei besessen; nur zu verständlich, dass man überhaupt nichts davon hielt. Und was war das für ein Papagei! Der böseste Vogel aller Zeiten, nach dem Urteil John Henry Carters. Er fluchte ganz furchtbar. Mrs Carter hätte ihren Sohn sofort heimgeholt, hätte sie ihn problemlos andernorts unterbringen können. Ginger hatte John Henry zudem ein Stück aus dem Nacken gebissen, als er sich einmal zu nahe am Käfig bückte. Wenn der arme John Henry sonntags nach Hause kam, zeigte Mrs Carter allen die Stelle.
All dies schoss Anne durch den Kopf, während Mr Harrison vor ihr stand, offenbar derart wütend, dass er kein Wort herausbrachte. Selbst in seiner aufgeräumtesten Stimmung konnte er nicht als freundlicher Mensch gelten; er war klein, dick und hatte eine Glatze; und jetzt, dachte Anne, mit diesem vor Zorn lila angelaufenen Mondgesicht und den fast aus dem Kopf springenden blauen Glupschaugen, war er wirklich der hässlichste Mensch, der ihr je untergekommen war.
Aber dann hatte sich Mr Harrison gefasst.
»Ich nehme das nicht mehr hin«, stammelte er, »keinen Tag länger, hören Sie, Miss? Donnerschreck, das war jetzt das dritte Mal, Miss … das dritte Mal! Meine Geduld ist aufgebraucht, Miss. Beim letzten Mal habe ich Ihre Tante gewarnt, dass sie das unterbinden muss … aber was ist … sie hat’s schon wieder … warum nur tut sie das, das möchte ich mal wissen. Aus diesem Grund bin ich hier, Miss.«
»Was ist denn bitte das Problem?«, fragte Anne in höchst würdevollem Ton. Sie hatte das in letzter Zeit gründlich geübt, damit es richtig saß, wenn ihr Schuldienst begann; aber auf den wütenden J. A. Harrison verfehlte es jede Wirkung.
»Problem, ja? Donnerschreck, und ob das ein Problem ist. Das Problem, Miss, besteht darin, dass ich diese Kuh Ihrer Tante schon wieder in meinem Hafer vorgefunden habe, keine halbe Stunde her. Zum dritten Mal, wohlgemerkt. So wie letzten Dienstag und wie gestern. Ich war schon mal hier und hab’ Ihrer Tante gesagt, dass sie das unterbinden muss. Aber es ist wieder passiert. Wo ist denn Ihre Tante, Miss? Ich will sie nur kurz sehen und ihr die Meinung geigen – die Meinung von J. A. Harrison, Miss.«
»Wenn Sie Miss Marilla Cuthbert meinen, sie ist nicht meine Tante, und sie ist nach East Grafton gefahren, um eine entfernte Verwandte zu besuchen, die sehr krank ist«, sagte Anne, mit jedem Wort würdevoller. »Es tut mir sehr leid, dass meine Kuh an Ihren Hafer gegangen ist – die Kuh gehört mir, nicht Miss Cuthbert. Matthew hat sie Mr Bell abgekauft und mir geschenkt, vor drei Jahren, da war sie noch ein Kälbchen.«
»›Es tut mir leid‹, Miss? ›Es tut mir leid‹ nützt hier gar nichts. Gehen Sie lieber mal hin und schauen Sie sich an, was für eine Verwüstung dieses Tier in meinem Haferfeld angerichtet hat – das ist von der Mitte bis ganz nach außen niedergetrampelt, Miss.«
»Es tut mir sehr leid«, wiederholte Anne mit Nachdruck, »aber vielleicht hätte Dolly es gar nicht betreten, wenn Sie sich besser um Ihre Zäune kümmern würden. An der Stelle, wo Ihr Haferfeld an unsere Weide grenzt, ist das Ihr Zaun, und mir ist neulich erst aufgefallen, dass der nicht gut in Schuss ist.«
»Mein Zaun ist in Ordnung«, raunzte Mr Harrison, jetzt noch wütender angesichts dieser Kriegserklärung. »Eine Teufelskuh wie diese hält nicht mal ein Gefängnisgitter ab. Und eins sag ich Ihnen, Sie rothaarige Range, wenn das Ihre Kuh ist, wie Sie sagen, dann täten Sie gut daran, sie von den Feldern anderer Leute fernzuhalten, statt hier rumzusitzen und Groschenromane zu lesen« – wobei er abschätzig auf den dunkelgelben Band Vergil zu Annes Füßen blickte.
In diesem Moment waren nicht nur Annes Haare rot – seit jeher ihre empfindliche Stelle.
»Lieber rote Haare als gar keine bis auf so ein paar rund um die Ohren«, konterte sie.
Der Hieb saß, denn in Sachen seiner Glatze war Mr Harrison überaus empfindlich. Vor Zorn versagte ihm erneut die Stimme, er hatte nur bohrende Blicke für Anne, die sich wieder beruhigt hatte und ihren Vorteil nutzte.
»Ich habe Nachsicht mit Ihnen, Mr Harrison, denn ich verfüge über Fantasie. Ich kann mir leicht vorstellen, wie belastend das ist, eine Kuh in seinem Haferfeld vorzufinden, und ich verübele Ihnen nichts von dem, was Sie gesagt haben. Ich verspreche Ihnen, dass Dolly niemals mehr in Ihren Hafer hineinläuft. Da gebe ich Ihnen mein Ehrenwort.«
»Na, das will ich hoffen«, murmelte Mr Harrison, irgendwie kleinlaut, stapfte dann aber wütend davon, und Anne hörte ihn vor sich hin grummeln, bis er außer Hörweite war.
Innerlich schwer beunruhigt, marschierte Anne über den Hof und sperrte die freche Jerseykuh in den Melkstall.
»Solange sie nicht das Gitter niederreißt, kommt sie da nie raus«, überlegte sie. »Jetzt wirkt sie ganz ruhig. Kann sein, dass ihr schlecht ist von dem vielen Hafer. Ich hätte sie doch Mr Shearer verkaufen sollen, als er sie letzte Woche haben wollte, aber da wollte ich noch bis zur Auktion warten, auf der der ganze Viehbestand verkauft wird, und sie dann alle zusammen abgeben. Ich glaube, es stimmt, dass Mr Harrison ein Spinner ist. Auf jeden Fall hat er überhaupt nichts von einem Seelenverwandten.«
Anne hatte immer einen wachsamen Blick für Seelenverwandte.
Als Anne vom Stall zurückkehrte, kam Marilla Cuthbert auf den Hof gefahren, und Anne machte sich eilig daran, den Tee zu kochen. Am Teetisch sprachen sie über die Sache.
»Ich werde froh sein, wenn die Auktion vorbei ist«, sagte Marilla. »Die Belastung ist einfach zu groß, wenn man so viel Vieh hat und nur diesen unzuverlässigen Martin, der sich darum kümmert. Er ist immer noch nicht wieder hier, dabei hatte er versprochen, gestern Abend zurück zu sein, wenn ich ihm für die Beerdigung seiner Tante freigebe. Keine Ahnung, wie viele Tanten der hat. Das ist schon die vierte, die gestorben ist, seit er vor einem Jahr bei uns angefangen hat. Ich werde mehr als dankbar sein, wenn die Ernte eingebracht ist und Mr Barry die Farm übernimmt. Dolly bleibt im Stall, bis Martin kommt, denn sie muss auf die hintere Weide, und da muss erst etwas am Zaun repariert werden. Wahrlich, die Welt ist voller Leiden, wie Rachel sagt. Die arme Mary Keith liegt jetzt im Sterben, und was dann aus ihren beiden Kindern wird – ich weiß es nicht. Sie hat einen Bruder in British Columbia, dem sie in dieser Sache geschrieben hat, aber sie hat noch nichts von ihm gehört.«
»Was sind das für Kinder? Wie alt sind sie?«
»Sechs durch – es sind Zwillinge.«
»Ach, Zwillinge fand ich immer besonders interessant, seit Mrs Hammond so viele hatte«, sagte Anne vergnügt. »Sind sie hübsch?«
»Herrje, das kann ich nicht sagen – sie waren zu schmutzig. Davy war draußen, Matschkuchen backen, und Dora ging zu ihm hin, um ihn reinzurufen. Davy hat sie kopfüber in den größten Kuchen gedrückt, und weil sie geschrien hat, hat er sich selbst auch hineingetunkt und darin gewälzt, um ihr zu zeigen, dass es keinen Grund zum Schreien gibt. Mary sagt, Dora sei ein wirklich sehr braves Kind, aber Davy würde nur Unfug anstellen. Er hat keinerlei Erziehung genossen, mag man einwenden. Sein Vater starb, als er noch ein Baby war, und Mary ist seither fast ständig krank gewesen.«
»Kinder, die keine Erziehung genießen, tun mir immer leid«, sagte Anne ruhig. »Mit mir war es ja genauso, bis du dich meiner angenommen hast. Ich hoffe, dass ihr Onkel sich um sie kümmert. Wie bist du mit Mrs Keith verwandt?«
»Mit Mary? Gar nicht. Ihr Mann war ein Cousin dritten Grades von uns. Da kommt Mrs Lynde über den Hof. Ich dachte mir schon, dass sie sich nach Mary erkundigen will.«
»Sag ihr bloß nichts über Mr Harrison und die Kuh«, flehte Anne.
Marilla versprach es, aber das wäre gar nicht nötig gewesen, denn kaum hatte Mrs Lynde sich ordentlich hingesetzt, sagte sie schon:
»Als ich heute aus Carmody zurückkam, habe ich gesehen, wie Mr Harrison deine Kuh aus seinem Hafer vertrieben hat. Er wirkte ganz schön wütend. Hat er einen großen Aufstand gemacht?«
Anne und Marilla lächelten einander verstohlen zu. Was immer in Avonlea passierte, Mrs Lynde bekam es mit. Erst heute Morgen hatte Anne gesagt: »Wenn du mitternachts in dein Zimmer gehst, die Tür schließt, die Jalousie runterziehst und dann niesen musst, wird Mrs Lynde dich am nächsten Tag fragen, was deine Erkältung macht!«
»Ich glaub schon«, sagte Marilla. »Ich war nicht da. Er hat Anne die Meinung gegeigt.«
»Er ist ein sehr unsympathischer Mensch«, sagte Anne und schüttelte verärgert ihren roten Kopf.
»Da sprichst du ein wahres Wort«, sagte Mrs Rachel ernst. »Als Robert Bell seine Farm an einen Mann aus New Brunswick verkaufte, war mir klar, dass Ärger blüht. Wo soll das noch hinführen mit Avonlea, wenn so viele Leute von auswärts zuziehen? Bald wird man sich nicht mal mehr im eigenen Bett sicher fühlen.«
»Wieso, wer wird denn noch zuziehen?«, fragte Anne.
»Hast du das nicht mitbekommen? Na, da wären die Donnells, eine ganze Familie. Sie haben das alte Haus von Peter Sloane gemietet. Der Mann soll Peters Mühle betreiben. Sie kommen aus dem Osten, niemand weiß etwas über sie. Dann zieht diese träge Familie von Timothy Cotton von White Sands hierher, die wird uns allen im Ort zur Last fallen. Er ist ständig erschöpft – außer wenn er klaut –, und seine Frau ist ein faules Biest, das kaum den Hintern hochbekommt. Die setzt sich sogar zum Geschirrspülen. Mrs Pye hat den verwaisten Neffen ihres Mannes George zu sich geholt, Anthony Pye. Er wird bei dir in die Schule gehen, Anne, also mach dich auf was gefasst. Und noch einen Schüler von außerhalb kriegst du. Paul Irving kommt aus den USA, um bei seiner Großmutter zu leben. Erinnerst du dich noch an seinen Vater, Marilla – Stephen Irving, der, der Lavendar Lewis aus Grafton sitzengelassen hat?«
»Ich glaube nicht, dass er sie sitzengelassen hat. Es hat Streit gegeben … Ich denke, die Schuld trifft beide.«
»Na, egal, jedenfalls hat er sie nicht geheiratet, und sie ist höchst seltsam seither, wie man hört. Sie wohnt ganz allein in diesem kleinen Steinhaus, das sie Echo Lodge nennt. Stephen ging in die Staaten, er ist in das Geschäft seines Onkels eingetreten und hat eine Yankeefrau geheiratet. Er war nie wieder zu Hause, nur seine Mutter hat ihn ein, zwei Mal besucht. Vor zwei Jahren ist seine Frau gestorben, und er hat den Jungen für eine Weile heim zu seiner Mutter geschickt. Er ist zehn, und ich weiß ja nicht, ob er einen willkommenen Schüler abgeben wird. Bei den Yankees weiß man nie.«
Mrs Lynde begegnete allen Menschen, die das Pech hatten, kein Kind der Prinz-Edward-Insel zu sein, mit einer Was-soll-von-anderswo-schon-Gutes-kommen-Haltung. Durchaus möglich, dass sie gute Menschen waren, allemal; aber man war doch klüger beraten, es zu bezweifeln. »Yankees« gegenüber pflegte sie ein ausgeprägtes Vorurteil. Ihr Mann war einmal in Boston von einem Auftraggeber um zehn Dollar Lohn betrogen worden, und jetzt konnte keine irdische oder himmlische Macht Mrs Rachel davon abbringen, die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika dafür verantwortlich zu machen.
»Ein bisschen frisches Blut kann der Schule von Avonlea nicht schaden«, sagte Marilla trocken, »und wenn dieser Junge nur ein klein wenig nach seinem Vater kommt, wird er in Ordnung sein. Steve Irving war der netteste Bursche, den diese Gegend je hervorgebracht hat, auch wenn ein paar Leute ihn für hochmütig hielten. Mrs Irving wird sich sehr über das Kind freuen, denke ich. Seit dem Tod ihres Mannes ist sie sehr einsam gewesen.«
»Oh, der Junge mag tadellos sein, aber er wird anders sein als die Avonlea-Kinder«, erwiderte Mrs Rachel, als sei damit alles gesagt. Mrs Rachels Ansichten zu Leuten, Orten oder Sachen waren stets unanfechtbar. »Ich hörte, du willst einen Dorfverschönerungs-Verein gründen, Anne. Was hat es damit auf sich?«
»Ich habe darüber nur mit ein paar Mädchen und Jungen aus dem Debattierclub gesprochen«, sagte Anne errötend. »Denen hat die Idee ganz gut gefallen – und Mr und Mrs Allan auch. In vielen Dörfern gibt es bereits einen.«
»Na, damit wirst du dich hübsch in die Nesseln setzen. Lass lieber die Finger davon, Anne. Die Leute wollen nicht, dass man an ihnen herumdoktert.«
»Oh, es geht uns doch nicht um die Leute. Es geht um Avonlea selbst. Es gibt viele Stellen, die sich verschönern lassen. Wenn wir zum Beispiel Mr Levi Boulter dazu bringen könnten, dieses grässliche alte Haus auf seiner oberen Farm abzureißen, das wäre doch wohl eine Verbesserung.«
»Das auf jeden Fall«, gab Mrs Rachel zu. »Diese alte Ruine ist uns allen seit Jahren ein Dorn im Auge. Aber wenn Ihr Verschönerer Levi Boulter dazu bewegen wollt, unbezahlt etwas für das Gemeinwesen zu tun, möchte ich mitkommen und zuhören. Ich will dir nicht den Mut nehmen, Anne, denn deine Idee hat etwas, auch wenn mir scheint, dass du sie aus irgendeiner miesen Yankee-Gazette hast; aber mit deiner Schule wirst du alle Hände voll zu tun haben, und ich gebe dir nur den freundschaftlichen Rat, dich nicht mit Verschönerungen herumzuplagen. Aber was du dir einmal in den Kopf gesetzt hast, da bleibst du dran, das ist mir auch klar. Irgendwie setzt du dich ja immer durch.«
Der energische Zug um Annes Lippen verriet, dass Mrs Rachel mit dieser Einschätzung nicht ganz falsch lag. Mit ganzer Seele wollte Anne den Verschönerungsverein gründen. Gilbert Blythe, der Lehrer in White Sands war, aber das Wochenende immer zu Hause verbrachte, war begeistert von der Sache; und die anderen Leute wollten überwiegend auch gern an irgendetwas mitwirken, das für gelegentliche Treffen und damit »Spaß« sorgte. Um was für »Verschönerungen« es gehen mochte, das wusste niemand so recht – bis auf Anne und Gilbert. Die beiden hatten sie diskutiert und durchgeplant, bis in ihrer Vorstellung ein ideales Avonlea erstanden war.
Mrs Rachel hatte noch eine Neuigkeit parat.
»Die Schule in Carmody übernimmt eine Priscilla Grant. Bist du nicht mit einem Mädchen dieses Namens zusammen auf dem Queen’s College gewesen, Anne?«
»Ja, und ob. Priscilla wird also in Carmody unterrichten! Wie herrlich!«, rief Anne, deren Augen wie Abendsterne zu funkeln begannen. Was Mrs Lynde wieder einmal denken ließ: Ob Anne Shirley nun wahrhaft hübsch war oder nicht, das würde sie wohl niemals zu ihrer Zufriedenheit sagen können.
2 – Überstürzter Kuhhandel
Am folgenden Nachmittag fuhr Anne für eine Einkaufstour nach Carmody und nahm Diana Barry mit. Diana war, versteht sich, ein künftiges Mitglied des Verschönerungsvereins, und während der gesamten Fahrt nach Carmody und zurück sprachen die beiden Mädchen über kaum etwas anderes.
»Wenn wir loslegen, müssen wir als allererstes diesen Saal da streichen«, sagte Diana, als sie am Gemeindesaal von Avonlea vorbeifuhren, ein unansehnlicher Bau in einer rundum von Fichten zugewucherten Senke. »Das sieht schauderhaft aus und ist sogar noch eher dran als der Versuch, Mr Boulter zum Abreißen seines Hauses zu bewegen. Vater sagt, das würden wir nie schaffen. Levi Boulter sei viel zu knauserig, um Zeit dort hineinzustecken.«
»Vielleicht dürfen die Jungen es abreißen, wenn sie versprechen, die Bretter fortzuschaffen und Kleinholz für ihn daraus zu machen«, sagte Anne hoffnungsvoll. »Wir müssen unser Bestes geben und uns erst einmal mit kleinen Schritten begnügen. Wir dürfen nicht erwarten, dass sich alles auf einen Schlag verschönern lässt. Und natürlich müssen wir zunächst auf die öffentliche Meinung einwirken.«
Diana war nicht ganz klar, was ›auf die öffentliche Meinung einwirken‹ bedeutete; aber es klang gut, und sie empfand Stolz darüber, bald einem Verein anzugehören, der ein solches Ziel verfolgte.
»Letzte Nacht kam mir eine Idee, was wir noch tun könnten, Anne. Kennst du dieses dreieckige Stück Grund, wo die Straßen von Carmody, Newbridge und White Sands zusammenlaufen? Es ist ganz mit jungen Fichten zugewuchert; aber es könnte doch schön sein, wenn man die alle entfernt und nur die zwei oder drei Birken stehen lässt, die dort wachsen.«
»Großartig«, stimmte Anne fröhlich zu. »Und dann kommt eine Bank unter die Birken. Und im Frühjahr legen wir mitten darauf ein Blumenbeet an und pflanzen Geranien.«
»Ja; nur dass wir dann noch irgendwie Mrs Hiram Sloane davon abbringen müssen, ihre Kuh auf die Straße zu lassen, weil die sonst alle Geranien auffrisst«, sagte Diana lachend. »Langsam wird mir klar, was du damit meinst, auf die öffentliche Meinung einzuwirken, Anne. Da steht dieses alte Haus vom Boulter. Hat man je so eine Bruchbude gesehen? Und auch noch direkt an der Straße. Ein altes Haus ohne Fensterrahmen kommt mir immer vor wie ein totes Tier mit ausgepickten Augen.«
»Für mich ist ein leer stehendes altes Haus ein ganz trauriger Anblick«, sagte Anne verträumt. »Es scheint mir jedes Mal über seine Vergangenheit zu grübeln und alten Freuden nachzutrauern. Marilla sagt, dass vor langer Zeit eine große Familie in dem alten Haus gelebt hat und es sehr schön dort war mit einem herrlichen Garten und Rosen, die daran emporwuchsen. Lauter kleine Kinder hat es dort gegeben, viel Lachen und Singen; jetzt steht es leer, und nur der Wind geht noch hindurch. Es muss sich sehr einsam und traurig fühlen! Vielleicht kehren sie in mondhellen Nächten alle dorthin zurück – die Geister der Kinder aus ferner Zeit, der Rosen und Lieder – und dann fühlt sich das alte Haus für einen kurzen Moment wieder jung und fröhlich.«
Diana schüttelte den Kopf.
»Ich stelle mir keine solchen Sachen mehr über Orte vor, Anne. Weißt du nicht mehr, wie verärgert Mutter und Marilla damals waren, als wir uns die Gespenster im Geisterwald ausmalten? Bis heute laufe ich im Dunkeln ungern durch dieses Wäldchen; und wenn ich erst anfange, mir so Sachen über das alte Haus von Boulter vorzustellen, gehe ich auch an dem nur noch ängstlich vorüber. Abgesehen davon sind diese Kinder gar nicht tot. Sie sind alle erwachsen und wohlauf – und eins von ihnen ist Metzger. Und Blumen und Lieder haben überhaupt keine Geister.«
Anne verkniff sich ein leises Seufzen. Sie liebte Diana heiß und innig, und sie waren gute Kameradinnen seit jeher. Doch sie hatte längst begriffen, dass sie ihre Ausflüge ins Reich der Fantasie allein machen musste. Der Weg dorthin führte über einen verwunschenen Pfad, auf dem selbst ihre Herzliebsten sie nicht begleiteten.
Während die Mädchen in Carmody waren, ging ein Gewitterschauer nieder; er war rasch wieder vorbei, und die Rückfahrt war herrlich: Über den Wegen funkelten die Regentropfen auf den Zweigen, und in den kleinen laubbedeckten Tälern entstieg ein würziger Duft dem durchfeuchteten Farn. Doch als sie eben in die Zufahrt der Cuthberts einbogen, sah Anne etwas, das ihr die Schönheit der Landschaft verdarb.
Rechter Hand erstreckte sich nass und sprießend das weite, graugrüne Haferfeld von Mr Harrison; und mitten darauf stand, bis zu den gestriegelten Flanken im üppigen Korn, ihnen zwischen den Stirnfransen hindurch behäbig zuzwinkernd, eine Kuh!
Anne ließ die Zügel sinken, erhob sich und presste die Lippen in einer Weise aufeinander, die für den räuberischen Vierbeiner nichts Gutes verhieß. Sie sagte kein Wort, stieg nur fix vom Wagen, und Diana hatte noch gar nicht begriffen, was los war, da hatte Anne schon den Zaun übersprungen.
»Anne, komm zurück«, rief Diana, wieder im Besitz ihrer Stimme. »Du ruinierst dir dein Kleid in den feuchten Halmen – du ruinierst es dir. Sie hört mich nicht! Aber sie bekommt die Kuh doch niemals allein da weg. Ich muss hin und ihr helfen.«
Anne pflügte durch das Korn wie eine Wahnsinnige. Diana sprang flink hinab, band das Pferd an einen Pfahl, zog sich den Rock ihres hübschen Karokleids über die Schultern, stieg über den Zaun und nahm die Verfolgung ihrer panischen Freundin auf. Sie rannte schneller als Anne, die behindert war durch ihr nasses, auf der Haut klebendes Kleid, und hatte sie bald eingeholt. Sie hinterließen eine Trampelspur, bei deren Anblick Mr Harrison das Herz brechen musste.
»Anne, um Himmels willen, halt an«, keuchte Diana. »Ich krieg keine Luft mehr und du bist völlig durchnässt.«
»Die Kuh … muss hier … weg … bevor … Mr Harrison … sie sieht«, japste Anne. »Das müssen … wir schaffen … und wenn ich … dabei absaufe.«
Doch die Jerseykuh sah keinen einleuchtenden Grund, sich von ihrer saftigen Weide drängen zu lassen. Als die beiden atemlosen Mädchen sie fast erreicht hatten, drehte sie bei und sauste über das Feld in Richtung des anderen Endes fort.
»Schnapp sie dir!«, schrie Anne. »Lauf, Diana, lauf.«
Und Diana lief. Anne hinterher, und die böse Kuh stapfte wie vom Teufel besessen über das Feld. Störrisch ist die, dachte Diana. Erst geschlagene zehn Minuten später hatten sie sie abgefangen und durch eine Lücke im Zaun auf den Weg zur Cuthbert-Farm befördert.
Annes Laune war in diesem Augenblick nicht eben die beste. Es beruhigte sie auch nicht im mindesten, dass sie einen Einspänner direkt an der Zufahrt halten sah, in dem Mr Shearer aus Carmody und sein Sohn saßen, beide mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
»Du hättest mir die Kuh wohl besser doch verkauft, als ich sie letzte Woche haben wollte, Anne«, gluckste Mr Shearer.
»Ich geb’ sie Ihnen, wenn Sie sie haben wollen«, sagte ihre zerzauste und zornrote Besitzerin. »Wir können das gleich hier abwickeln.«
»Abgemacht. Ich gebe dir die zwanzig Dollar, die ich schon angeboten hatte, und Jim kann sie gleich nach Carmody schaffen. Sie geht mit der übrigen Lieferung heute Abend in die Stadt. Mr Reed aus Brighton will eine Jerseykuh haben.«
Fünf Minuten später waren Jim Shearer und die Kuh auf der Straße unterwegs, und Anne fuhr mit ihren zwanzig Dollar über die Zufahrt nach Green Gables.
»Was wird Marilla dazu sagen?«, fragte Diana.
»Ach, der ist das egal. Dolly hat mir gehört, und auf der Auktion hätte sie wohl auch nicht mehr als zwanzig Dollar erbracht. Aber herrje, wenn Mr Harrison sein Feld sieht, wird er wissen, dass sie wieder drin war, und das, obwohl ich ihm mein Ehrenwort gab, dass es nie wieder passiert! Na, immerhin ziehe ich daraus die Konsequenz, Kühe von meinem Ehrenwort auszunehmen. Einer Kuh, die über das Gatter unseres Melkstalls springt oder es durchbricht, kann man einfach nicht trauen.«
Marilla war bei Mrs Lynde gewesen und wusste bereits alles über Dollys Verkauf und Abtransport, denn Mrs Lynde hatte Teile des Geschäfts an ihrem Fenster mitverfolgt und sich das Übrige gedacht.
»Jetzt ist sie halt weg, auch gut. Wobei du schon schrecklich impulsiv handelst, Anne. Wie sie es aus dem Stall geschafft hat, verstehe ich aber nicht. Sie muss einige Bretter durchbrochen haben.«
»Ich habe noch nicht nachgeschaut«, sagte Anne, »mache das aber gleich mal. Martin ist immer noch nicht zurück. Vielleicht sind noch ein paar mehr Tanten von ihm gestorben. Das ist ein bisschen wie bei Mr Peter Sloane und den Methusalems. Einmal sagte seine Frau beim Zeitunglesen zu ihm: ›Hier steht, dass gerade wieder ein Methusalem gestorben ist. Was ist denn ein Methusalem, Peter?‹ Und Mr Sloane sagte, das wüsste er nicht, aber es müssten wirklich arme Wichte sein, schließlich höre man von ihnen immer nur, wenn sie sterben. So wie bei Martins Tanten.«
»Martin ist genau wie all die anderen Französischen«, sagte Marilla voll Abscheu.1 »Nicht einen Tag lang ist auf sie Verlass.«
Marilla sah sich gerade an, was Anne in Carmody gekauft hatte, als sie einen schrillen Schrei vom Hof her hörte. Kurz darauf kam Anne händeringend in die Küche gestürzt.
»Anne Shirley, was ist denn nun wieder los?«
»Ach, Marilla, was soll ich jetzt nur tun? Es ist schrecklich. Und alles meine Schuld. Ach, werde ich je lernen, erst kurz nachzudenken, bevor ich dummes Zeug mache? Mrs Lynde hat mir immer gesagt, dass ich eines Tages etwas Schlimmes anrichte, und jetzt hab’ ich’s getan!«
»Anne, du kannst einen wirklich zur Verzweiflung bringen. Was hast du getan?«
»Hab’ Mr Harrisons Kuh verkauft – die, die er Mr Bell abgekauft hat – an Mr Shearer! Dolly steht friedlich im Melkstall.«
»Anne Shirley, träumst du?«
»Wenn es bloß so wäre. Das ist kein Traum, oder vielmehr doch, ein Albtraum. Und Mr Harrisons Kuh ist schon in Charlottetown. Ach, Marilla, ich dachte, das mit den Fettnäpfchen hätte ich hinter mir, und nun bin ich in den übelsten Fettnapf meines Lebens getreten. Was kann ich jetzt tun?«
»Tun? Da gibt’s nur eins zu tun, Kind, du musst das mit Mr Harrison klären. Wir können ihm unsere Jerseykuh als Ersatz anbieten, wenn er kein Geld annehmen will. Sie ist genauso gut wie seine.«
»Er wird trotzdem sicher sehr böse und unangenehm sein«, klagte Anne.
»Vermutlich ja. Er ist offenbar ein leicht aufbrausender Mensch. Wenn du magst, gehe ich hin und erkläre es ihm.«
»Oh nein, so ein Drückeberger bin ich auch wieder nicht«, rief Anne. »Das ist alles meine Schuld, und für die kannst nicht du die Strafe übernehmen. Ich gehe selbst, und zwar sofort. Je eher ich das hinter mir habe, desto besser, denn es wird schrecklich blamabel.«
Anne, die arme, nahm ihren Hut und ihre zwanzig Dollar und blickte beim Rausgehen beiläufig durch die offenstehende Tür in die Speisekammer. Auf dem Tisch stand ein Nusskuchen, den sie am Morgen gebacken hatte – eine ungemein leckere Kreation mit rosa Glasur und Walnuss-Verzierung. Anne hatte ihn für Freitagabend gedacht, da trafen sich die jungen Leute von Avonlea auf Green Gables, um den Verschönerungsverein zu gründen. Aber was galten sie, verglichen mit dem gerade vor den Kopf gestoßenen Mr Harrison? Anne überlegte, dass dieser Kuchen das Herz eines jeden Menschen erweichen müsse, erst recht das eines Menschen, der selbst kochte, und packte ihn rasch in eine Schachtel. Sie würde ihn Mr Harrison mitbringen, als Friedensangebot.
»Vorausgesetzt, dass er mich überhaupt zu Wort kommen lässt«, dachte sie traurig; sie stieg über den Zaun und nahm eine Abkürzung über die Felder, die im Licht des traumhaften Augustabends golden erstrahlten. »Jetzt weiß ich, wie Menschen sich fühlen, die zu ihrer Hinrichtung geführt werden.«
1 Die »Französischen« sind die Bewohner Kanadas, die selbst oder deren Vorfahren aus Frankreich eingewandert waren und Französisch als Muttersprache beibehalten. Die mehrheitlich englischsprachige Bevölkerung Kanadas scheint ein bisschen auf sie hinabzublicken. (Anmerkung des Übersetzers.)
3 – Bei Mr Harrison
Mr Harrison bewohnte ein altmodisches, weiß getünchtes Haus mit tiefer Dachtraufe, hinter dem ein dichtes Fichtenwäldchen stand.
Mr Harrison saß hemdsärmelig auf seiner von Weinranken beschatteten Veranda und schmauchte seine Abendpfeife. Als er sah, wer da des Weges kam, sprang er sofort auf, flitzte ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Er tat dies, weil er so überrascht war, aber auch ein wenig aus Scham über seinen Wutausbruch tags zuvor. Anne verlor dadurch noch ihr letztes bisschen Mut.
»Wenn er jetzt schon so grollt, wie wird das erst sein, wenn er hört, was ich getan habe«, dachte sie bang, als sie an die Tür klopfte.
Doch Mr Harrison öffnete ihr, lächelte verlegen und bat sie recht sanft und freundlich, wenn auch etwas nervös, einzutreten. Er hatte seine Pfeife weggelegt und seine Jacke angezogen; sehr höflich bot er Anne einen sehr verstaubten Stuhl an, und sie hätte sich rundum freundlich aufgenommen gefühlt, wäre da nicht diese Quasselstrippe von Papagei gewesen, der mit bösen goldgelben Augen durch die Stäbe seines Käfigs stierte. Kaum hatte sich Anne gesetzt, rief Ginger auch schon:
»Donnerschlag, was will die rothaarige Range hier?«
Schwer zu sagen, wer daraufhin stärker errötete, Mr Harrison oder Anne.
»Beachten Sie den Papagei gar nicht«, sagte Mr Harrison mit einem zornigen Blick in Richtung Ginger. »Er … er redet ständig Unsinn. Ich habe ihn von meinem Bruder, der ist Matrose gewesen. Matrosen drücken sich nicht immer sehr gewählt aus, und Papageien sind gut im Nachplappern.«
»Scheint so«, sagte Anne, die mit Blick auf die hier zu erledigende Aufgabe ihren Verdruss überwand. So wie die Dinge standen, konnte sie es sich kaum leisten, Mr Harrison vor den Kopf zu stoßen. Wer gerade ohne Wissen und Billigung des Besitzers kurzerhand dessen Kuh verkauft hat, sollte einen unhöfliches Zeug redenden Papagei einfach ignorieren. Und doch gab sich die »rothaarige Range« nicht so kleinlaut, wie sie es andernfalls getan hätte.
»Ich bin hier, um Ihnen etwas zu gestehen, Mr Harrison«, sagte sie entschlossen. »Es geht … um … um diese Kuh.«
»Donnerschlag«, rief Mr Harrison erregt, »ist sie wieder in meinen Hafer gegangen? Na, schon gut … das macht doch nichts. Schwamm drüber … wirklich, ich … ich war zu übereilt gestern, ganz klar. Macht gar nichts, wenn sie’s getan hat.«
»Tja, wenn es nur das wäre«, seufzte Anne. »Aber es ist zehn Mal schlimmer. Ich hab’ da …«
»Donnerschlag, ist sie jetzt etwa in meinen Weizen gegangen?«
»Nein … nicht … nicht in den Weizen. Sondern …«
»In den Kohl! Ist sie an meine Kohlköpfe gegangen, die Zucht für die Leistungsschau, ja?«
»Ihrem Kohl geht’s gut, Mr Harrison. Ich sage Ihnen alles – deshalb bin ich ja hier … aber fallen Sie mir bitte nicht ständig ins Wort. Es macht mich nervös. Lassen Sie mich einfach erzählen und schweigen Sie, bis ich fertig bin – danach werden Sie garantiert Redebedarf haben«, sagte Anne abschließend, aber nur in Gedanken.
»Ich bin ganz still«, sagte Mr Harrison und hielt sich daran. Ginger allerdings fühlte sich an kein Schweigegebot gebunden und stieß immer wieder »rothaarige Range« hervor, was Anne mit der Zeit rasend machte.
»Gestern habe ich meine Jerseykuh in unseren Stall gesperrt. Heute Morgen war ich in Carmody und sah bei der Rückkehr eine Jerseykuh in Ihrem Hafer. Diana und ich haben sie daraus vertrieben, Sie ahnen nicht, wie mühsam das war. Ich war schrecklich nass und müde und sauer – und genau in diesem Moment kam Mr Shearer des Weges und bot mir an, die Kuh zu kaufen. Für zwanzig Dollar habe ich sie ihm sofort gegeben. Es war falsch von mir. Natürlich hätte ich abwarten und mich zunächst mit Marilla besprechen sollen. Aber ich habe die schreckliche Angewohnheit, Dinge zu tun, ohne erst nachzudenken – alle, die mich kennen, werden Ihnen das bestätigen. Mr Shearer hat die Kuh gleich mitgenommen, damit sie noch mit dem Nachmittagszug weitertransportiert wird.«
»Rothaarige Range«, sagte Ginger voller Verachtung.
Da erhob sich Mr Harrison mit einem zornigen Blick, der jedem anderen Vogel Angst eingejagt hätte, trug Gingers Käfig in ein angrenzendes Zimmer und schloss die Tür. Ginger kreischte, fluchte, machte seinem schlechten Ruf alle Ehre, verstummte jedoch mürrisch, als er merkte, dass er allein war.
»Entschuldigen Sie bitte und sprechen Sie weiter«, sagte Mr Harrison, der sich wieder hinsetzte. »Mein Bruder, der Matrose, hat diesem Vogel keine Manieren beigebracht.«
»Ich ging nach Hause und nach dem Tee in den Melkstall. Mr Harrison« – Anne beugte sich vor, rang in ihrer kindlichen Art die Hände und blickte den verwirrten Mr Harrison aus großen Augen flehend an –, »und da sah ich, dass meine Kuh immer noch in dem Stall steckte. Ich hatte Mr Shearer Ihre Kuh verkauft.«
»Donnerschlag«, rief ganz verblüfft Mr Harrison, der mit dieser Wendung so gar nicht gerechnet hätte. »Das ist ja wirklich ein Ding!«
»Ach, und bestimmt nicht das letzte Ding, das ich mir leisten werde«, sagte Anne betrübt. »Ich bin bekannt dafür. Man sollte meinen, dass ich da längst rausgewachsen sein müsste … nächsten März werde ich siebzehn … aber ich bin’s offenbar nicht. Mr Harrison, Sie werden mir das doch hoffentlich verzeihen? Ihre Kuh bekommen wir nicht zurück, dafür ist es zu spät, aber hier ist das für sie gezahlte Geld – oder Sie kriegen meine Kuh dafür, wenn Ihnen das lieber ist. Ein sehr gutes Tier. Und ich kann gar nicht sagen, wie leid mir das alles tut.«
»Schon gut, schon gut«, sagte Mr Harrison munter, »reden Sie nicht mehr davon, Miss. Es macht doch nichts … überhaupt nichts. So etwas passiert. Ich bin selbst auch manchmal zu impulsiv, Miss – viel zu sehr. Aber ich spreche einfach deutlich aus, was ich denke, und die Leute müssen mich so nehmen, wie ich bin. Wäre die Kuh jetzt in meinem Kohl gewesen – aber egal, sie war’s nichts, also ist alles gut. Ich würde als Ersatz lieber Ihre Kuh nehmen, zumal Sie sie loswerden wollen.«
»Ach, danke, Mr Harrison. Ich bin so froh, dass Sie nicht verärgert sind. Das hatte ich nämlich befürchtet.«
»Und vermutlich hatten Sie Todesangst vor dem Schritt hierher nach dem ganzen Theater, das ich gestern veranstaltet habe, hm? Aber beachten Sie mich gar nicht, ich bin nur ein offenherziger alter Knabe, sonst nichts … einer, der frei von der Leber weg redet und dabei auch mal deutliche Worte findet.«
»Wie Mrs Lynde«, rutschte es Anne heraus.
»Wer? Mrs Lynde? Vergleichen Sie mich nicht mit dieser alten Tratschtante«, sagte Mr Harrison irritiert. »Ich bin doch nicht … also kein bisschen. Was haben Sie denn da in der Schachtel?«
»Einen Kuchen«, sagte Anne heiter. Die Erleichterung über Mr Harrisons unverhoffte Freundlichkeit hatte ihrer Laune mächtig Auftrieb gegeben. »Er ist für Sie – ich dachte, vielleicht gibt es bei Ihnen nicht sehr oft Kuchen.«
»Das stimmt wohl, dabei mag ich ihn so gern. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Von außen sieht er schon mal gut aus. Ich hoffe, dass es drinnen ebenso gut weitergeht.«
»Das tut es«, sagte Anne überzeugt. »Früher habe ich auch Kuchen gebacken, von denen sich das nicht sagen ließ, wie Mrs Allan Ihnen bezeugen könnte, aber dieser ist gelungen. Ich habe ihn für den Verschönerungsverein gebacken, für den gibt es jetzt einen neuen.«
»Wissen Sie was, Miss? Sie müssen mir beim Aufessen helfen. Ich setze Wasser auf, und wir trinken einen Tee zusammen. Was meinen Sie?«
»Darf ich den Tee zubereiten?«, fragte Anne skeptisch.
Mr Harrison kicherte.
»Wie ich sehe, trauen Sie meinen Künsten nicht viel zu. Da liegen Sie falsch – ich koche Ihnen den besten Becher Tee aller Zeiten. Aber machen Sie nur. Zum Glück hat es letzten Sonntag geregnet, es gibt genug sauberes Geschirr.«
Anne sprang flink auf und machte sich ans Werk. Sie spülte den Teekessel mehrmals frisch aus, bevor sie den Tee aufgoss. Dann wischte sie den Herd ab und deckte den Tisch, wozu sie das Geschirr aus der Speisekammer holte. Diese Speisekammer befand sich in einem üblen Zustand, aber Anne war so klug, nichts zu sagen. Mr Harrison sagte ihr, wo sie Brot und Butter fand und wo eine Dose Pfirsiche. Anne schmückte den Tisch mit einem Strauß Blumen aus dem Garten und sah über die Flecken auf der Tischdecke hinweg. Rasch war der Tee fertig, und mit einem Mal saß Anne gegenüber von Mr Harrison an dessen Tisch, schenkte ihm Tee ein und plauderte offen mit ihm über ihre Schule, Freunde und Pläne. Sie konnte kaum glauben, dass dies gerade wirklich stattfand.
Mr Harrison hatte Ginger zurückgeholt; der arme Vogel sei einsam, behauptete er. Und Anne, die geneigt war, allem und jedem zu verzeihen, bot ihm ein Stück Walnuss an. Ginger jedoch fühlte sich schwer gekränkt in seiner Ehre und ließ sämtliche Freundschaftsangebote abblitzen. Er saß mürrisch auf der Stange und plusterte seine Federn auf, bis er wie ein grün-goldener Ball aussah.
»Warum haben Sie ihn Ginger genannt?«, fragte Anne, die passende Namen mochte und fand, dass ginger – gelblichbraun – überhaupt nicht zu diesem prächtigen Gefieder passte.
»Der Name ist von meinem Bruder, dem Matrosen. Der Vogel bedeutet mir viel – Sie würden staunen, wenn Ihnen klar wäre, wie viel. Er hat seine Fehler, gewiss. Dieser Vogel hat mir so oder so schon viel Ärger eingebracht. Manche beklagen sich über sein Fluchen, aber man gewöhnt es ihm nicht ab. Ich hab’s versucht – und nicht nur ich. Andere haben Vorurteile gegenüber Papageien. Albern, nicht wahr? Ich mag sie. Ginger ist mir eine liebe Gesellschaft. Nichts könnte mich dazu bewegen, diesen Vogel herzugeben – nichts auf der ganzen Welt, Miss.«
Diesen letzten Satz schleuderte Mr Harrison Anne derart heftig entgegen, als verdächtige er sie einer leisen Absicht, genau dies tun zu wollen. Dabei begann Anne den so ulkig lärmenden gefiederten Kerl zu mögen, und noch im Verlauf der Teestunde waren sie miteinander gut Freund. Mr Harrison erkundigte sich nach dem Verschönerungsverein und fand ihn eine sympathische Idee.
»Ganz recht. Weiter so. In dieser Siedlung gibt es so manches zu verbessern – und an den Menschen auch.«
»Ach, ich weiß nicht«, erwiderte Anne. Sich selbst oder ihrem engsten Kreis gegenüber hätte sie wohl zugegeben, dass Avonlea und seine Bewohner über manch kleine Unzulänglichkeit verfügten, die leicht abzustellen war. Aber dies aus dem Mund eines Außenstehenden wie Mr Harrison zu hören, war etwas ganz anderes. »Avonlea ist ein herrlicher Ort, und die Menschen, die hier leben, sind auch sehr nett.«
»Sie haben ein ziemlich heißblütiges Wesen«, bemerkte Mr Harrison angesichts der rot angelaufenen Wangen und des empörten Blicks ihm gegenüber. »Gehört wohl dazu, wenn man solches Haar hat. Avonlea ist ein recht sittsamer Ort, sonst wäre ich nicht hierhergezogen; aber ich schätze, selbst Sie würden zugeben, dass hier nicht alles ohne Fehl und Tadel ist.«
»Umso lieber ist er mir«, sagte Anne loyal. »Ich mag Orte oder Menschen nicht, die keinerlei Fehler haben. Eine rundum perfekte Person wäre doch völlig uninteressant. Mrs Milton White sagt, sie sei nie einem perfekten Menschen begegnet, habe aber ganz viel gehört von einem, der es gewesen sein soll – die erste Frau ihres Mannes. Es ist sicher sehr schwierig, mit einem Mann verheiratet zu sein, dessen erste Ehefrau perfekt war, nicht wahr?«
»Noch schwieriger muss es sein, mit einer perfekten Frau verheiratet zu sein«, sagte Mr Harrison mit plötzlicher, unerklärlicher Wärme.
Nach dem Tee bestand Anne darauf, das Geschirr abzuspülen, auch wenn Mr Harrison ihr versicherte, er hätte so viel im Haus, dass es noch für Wochen reiche. Sie hätte liebend gern auch den Boden gewischt, aber sie sah nirgendwo einen Schrubber und wollte nicht fragen, wo er stand, aus Sorge, dass es überhaupt keinen gab.
»Kommen Sie doch mal wieder rüber auf einen Schwatz«, regte Mr Harrison an, als sie ging. »Sie haben’s nicht weit, und wozu hat man denn Nachbarn? Ihr Verein da macht mich neugierig. Könnte eine ganz unterhaltsame Sache werden. Wen knöpfen Sie sich als erstes vor?«
»Wir befassen uns nicht mit Leuten – wir wollen nur bestimmte Dinge verschönern«, sagte Anne würdevoll. Sie hatte das leise Gefühl, dass sich Mr Harrison über ihr Vorhaben lustig machte.
Als sie gegangen war, blickte ihr Mr Harrison vom Fenster aus nach – ein anmutiges, mädchenhaftes Wesen, das in der Abendröte der untergegangenen Sonne sorglos über die Wiese stolperte.
»Ich bin ein mürrischer, einsamer, nörgelnder alter Sack«, sagte er laut, »aber dieses Mädchen bewirkt, dass ich mich wieder jung fühle – eine höchst angenehme Empfindung, die gern öfter aufkommen darf.«
»Rothaarige Range«, krächzte Ginger spöttisch.
Mr Harrison reckte dem Papagei die Faust entgegen.
»Zankhafter Vogel du«, murmelte er, »ich wünschte fast, ich hätte dir den Hals umgedreht, als mein Bruder der Matrose dich mitbrachte. Musst du mir denn immer weiter Ärger machen?«
Anne lief vergnügt nach Hause und berichtete alles Marilla, die wegen ihres langen Fortbleibens schon in Sorge gewesen war und gerade überlegt hatte, sie suchen zu gehen.
»Die Welt ist doch gut eingerichtet, meinst du nicht auch, Marilla?«, schloss Anne zufrieden. »Mrs Lynde hat sich neulich beklagt, dass mit der Welt nicht viel los sei. Sie sagte, wenn du dich auf etwas Schönes freust, wirst du jedes Mal mehr oder weniger enttäuscht – und vielleicht stimmt das. Aber es hat auch seine gute Seite. Umgekehrt treffen schlimme Dinge nicht immer so ein wie befürchtet – in aller Regel fallen sie viel besser aus als gedacht. Als ich heute Nachmittag zu Mr Harrison ging, rechnete ich mit einer furchtbar unangenehmen Begegnung, aber siehe da, er war ganz freundlich, und ich bin durchaus gern dort gewesen. Mit ganz viel gegenseitiger Toleranz werden wir noch richtig gute Freunde, scheint mir, und dann wird sich alles zum Besten wenden. Aber wie auch immer, Marilla, ich verkaufe bestimmt keine Kuh mehr, ohne vorher die Besitzerfrage zu klären. Und Papageien kann ich nicht leiden!«
4 – Meinungsverschiedenheiten
Eines Abends zur Zeit des Sonnenuntergangs saßen Jane Andrews, Gilbert Blythe und Anne Shirley im Schatten sanft schwingender Fichtenzweige an einem Zaun, wo ein Hohlweg – Birkenweg genannt – in die Hauptstraße mündete. Jane war am Nachmittag zu Besuch bei Anne gewesen, die sie ein Stück nach Hause begleitete; am Zaun waren sie Gilbert begegnet, und alle drei sprachen nun über den Schicksalstag morgen, denn dieser Tag war der erste September, an dem die Schule begann. Dann würde Jane nach Newbridge gehen und Gilbert nach White Sands.
»Ihr beide seid mir gegenüber im Vorteil«, seufzte Anne. »Ihr werdet Lehrer von Kindern, die euch nicht kennen; ich dagegen muss meine eigenen alten Schulkameraden unterrichten, und Mrs Lynde sagt, sie befürchtet, dass sie mich nicht so respektieren wie jemanden von außerhalb, wenn ich sie nicht vom ersten Tag an hart rannehme. Aber ich finde nicht, dass Lehrer einen hart rannehmen sollten. Ach, ich empfinde solche Verantwortung!«
»Ich denke, wir kriegen das gut hin«, sagte Jane ganz entspannt. Jane plagten keinerlei Absichten, das Gute im Menschen zu fördern. Sie wollte ordentlich Geld verdienen, es den Leuten, die die Schule finanzierten, recht machen und irgendwann ihren Namen auf der Ehrentafel verdienter Lehrer lesen. Größere Ambitionen hatte sie nicht. »In der Hauptsache hat man für Ordnung zu sorgen, und dazu muss man als Lehrerin ein bisschen streng sein. Schüler, die nicht gehorchen, werden bestraft.«
»Wie?«
»Dann gibt es ein paar tüchtige Hiebe, natürlich.«
»Oh, Jane, das tust du nicht«, rief Anne schockiert. »Jane, das kannst du nicht!«
»Doch, ich tu’s und ich kann’s, wenn es sein muss«, sagte Jane entschieden.
»Ich könnte niemals ein Kind schlagen«, sagte Anne ebenso entschieden. »Ich halte überhaupt nichts davon. Miss Stacy hat uns nie geschlagen und hatte alles völlig im Griff; Mr Phillips dagegen hat ständig geschlagen und hatte gar nichts im Griff. Nein, wer es nicht ohne Gewalt schafft, sollte nicht als Schullehrer arbeiten. Es gibt viel bessere Methoden. Ich werde meine Schüler für mich zu gewinnen versuchen, und dann wollen sie ganz von selbst tun, was ich ihnen sage.«
»Und wenn nicht?«, fragte Jane, patent wie sie war.
»Jedenfalls würde ich sie nicht schlagen. Es kann einfach nichts Gutes bewirken. Ach, schlag deine Schüler nicht, Jane, Liebes, was immer sie auch anstellen.«
»Was meinst du denn dazu, Gilbert?«, wollte Jane wissen. »Meinst du nicht, dass manchen Kindern ab und zu ein paar Schläge nicht schaden?«
»Meinst du nicht, dass es grausam und roh ist, Kinder zu schlagen – grundsätzlich?«, rief Anne, rot vor Entrüstung.
»Nun«, sagte Gilbert langsam, hin und her gerissen zwischen seiner tatsächlichen Meinung und dem Wunsch, Annes Idealvorstellung gerecht zu werden, »ich will zu beiden Ansichten etwas sagen. Ich halte nichts davon, Kinder oft zu schlagen. Ich denke wie du, Anne, dass es im Normalfall bessere Wege gibt und dass die Prügelstrafe das letzte Mittel der Wahl sein sollte. Auf der anderen Seite glaube ich wie du, Jane, dass es im Einzelfall Kinder gibt, denen man anders nicht beikommt und denen, kurz gesagt, ein paar Schläge durchaus guttun. Deshalb halte ich an Prügel als allerletzter Maßnahme fest.«
In seinem Versuch, beide Seiten zufriedenzustellen, stellte Gilbert – was normal ist und gar nicht anders sein kann – keine von beiden zufrieden. Jane schüttelte den Kopf.
»Ich werde meine Schüler schlagen, wenn sie unartig sind. Das ist die schnellste und einfachste Methode, sie zu überzeugen.«
Anne warf Gilbert einen enttäuschten Blick zu.
»Ich werde niemals ein Kind schlagen«, wiederholte sie dezidiert. »Nach meiner Überzeugung ist das weder richtig noch notwendig.«
»Angenommen, du trägst einem Jungen etwas auf, und er kommt dir frech«, sagte Jane.
»Mit dem würde ich nach der Schule freundlich, aber entschieden reden«, sagte Anne. »Jeder Mensch hat seine guten Seiten, man muss nur bis zu ihnen vordringen. Sie zu finden und zu fördern, das ist Aufgabe der Lehrer. So wurde uns das auch bei der Lehrerausbildung am Queen’s College beigebracht. Glaubst du etwa, du dringst zu den guten Seiten eines Kindes vor, indem du es schlägst? Man soll im rechten Sinn auf die Kinder einwirken, das sei noch wichtiger, als ihnen Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, hat Professor Rennie gesagt.«
»Aber sie werden zu genau diesen Fertigkeiten geprüft, und wenn sie da nicht gut abschneiden, gibt es schlechte Noten«, widersprach Jane.
»Meine Schüler sollen mich lieben und Jahre später denken, dass ich sie tüchtig vorangebracht habe, das ist mir wichtiger, als auf der Ehrentafel zu landen«, erklärte Anne mit Nachdruck.
»Würdest du ungezogene Kinder denn überhaupt nicht bestrafen?«, fragte Gilbert.
»Ach doch, ich werde es wohl müssen, obwohl es mir gegen den Strich ginge. Aber man kann sie in der Ecke stehen oder sie nachsitzen lassen und ihnen Schreibaufgaben geben.«
»Mädchen zur Strafe zu den Jungen zu setzen, wäre wohl nicht deine Sache«, sagte Jane verschmitzt.
Gilbert und Anne sahen einander an und grinsten dümmlich. Einst, vor langer Zeit, hatte sich Anne zur Strafe neben Gilbert setzen müssen – mit beklagenswerten, schmerzlichen Folgen.
»Nun, die Zukunft wird zeigen, was der beste Weg ist«, sagte Jane philosophisch zum Abschied.
Den Weg zurück nach Green Gables nahm Anne durch den rauschenden, Farnduft verströmenden schattigen Birkenweg über den Veilchengrund, vorbei am Weidenmeer, wo Hell und Dunkel sich unter den Tannen küssten, dann den Pfad der Liebenden hinab – Orte, denen sie und Diana vor langer Zeit diese Namen gegeben hatten. Sie ging langsam, voller Freude an der Anmut von Feld und Wald und der sternenklaren Abenddämmerung, und war in Gedanken bei der neuen Aufgabe, die sie morgen übernehmen sollte. Als sie den Hof von Green Gables erreichte, hörte sie die Stimme von Mrs Lynde laut und vernehmlich durch das offene Küchenfenster dringen.
»Mrs Lynde ist da, um mir für morgen gute Ratschläge zu geben«, dachte Anne und verzog das Gesicht, »aber ich gehe einfach nicht hinein. Ihre Ratschläge sind wie Pfeffer – vorzüglich in kleinen Prisen, aber viel zu massiv in ihrer hohen Dosierung. Da gehe ich lieber noch mal rüber auf einen Plausch mit Mr Harrison.«