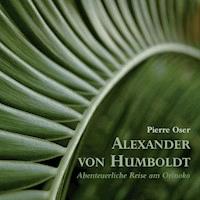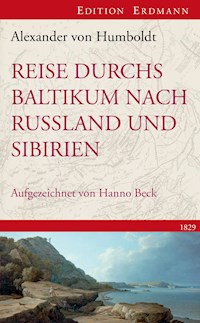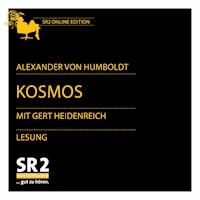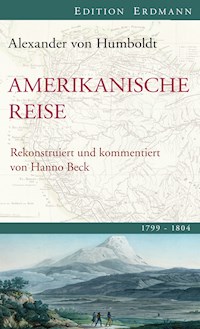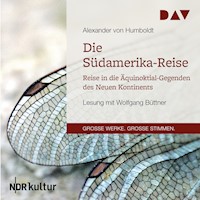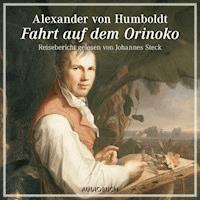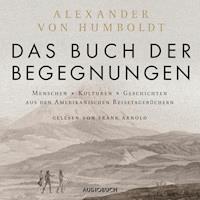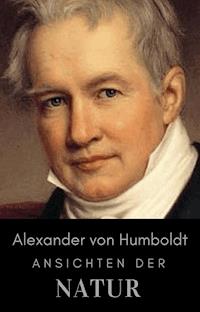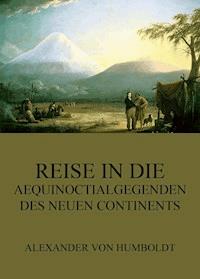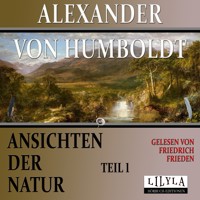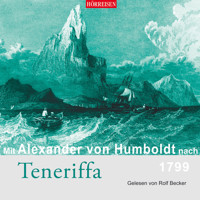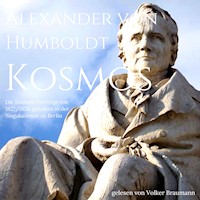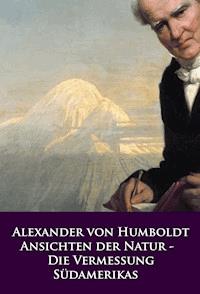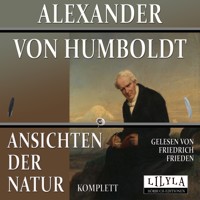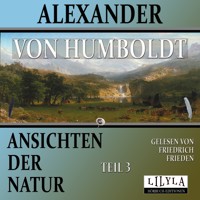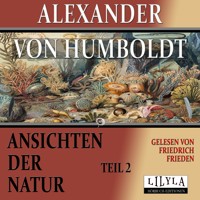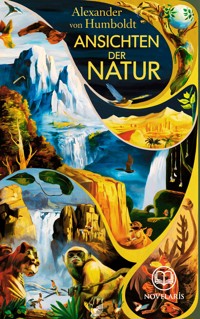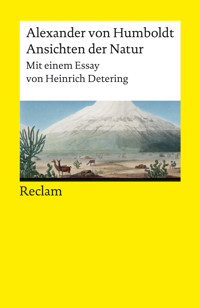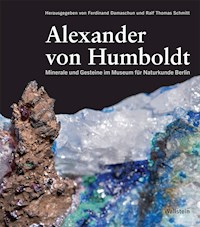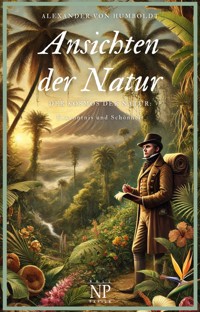
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sachbücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (geboren 14. September 1769 in Berlin; gestorben 6. Mai 1859 ebenda) war ein deutscher Naturforscher mit weit über die Grenzen Europas hinausreichendem Wirkungsfeld. Dies ist Humboldts erstes größeres Werk und auch sein erfolgreichstes. Man könnte es auch als vorweggenommene Quintessenz des Mammutwerkes »Kosmos« bezeichnen. 1808 lieferte Humboldt den ersten erfahrungswissenschaftlichen Beweis, dass sich Praxisnähe und wissenschaftliches Theoriedenken nicht nur nicht ausschließen, sondern sogar befruchten. Humboldt war Abenteuer und Denker, Entdecker und Wissenschaftler zugleich. Seine Forschungsreisen führten ihn nach Lateinamerika, in die Vereinigten Staaten sowie nach Zentralasien. Alexander von Humboldts Denken war in einem umfassenden Sinn auf die Welt im Ganzen gerichtet. Er war ein wahres Multitalent mit unerschöpflichem Forscherdrang. In Deutschland erlangte er vor allem mit den "Ansichten der Natur" und dem "Kosmos" außerordentliche Popularität. Er war einer der ersten populärwissenschaftlichen Autoren überhaupt. Mehr als 30.000 Briefkontakte mit den bekanntesten Köpfen seiner Zeit aus Wissenschaft, Kultur und Politik zeugen von seiner Verbundenheit zu den intellektuellen Eliten; er wurde somit Vordenker einer globalisierten Wissenschaft. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander von Humboldt
Ansichten der Natur
Alexander von Humboldt
Ansichten der Natur
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: J.G. Cotta’scher Verlag, Stuttgart und Augsburg, 1859 2. Auflage, ISBN 978-3-954183-10-4
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Widmung
Vorrede zur ersten Ausgabe
Vorrede zur zweiten und dritten Ausgabe
Über die Steppen und Wüsten
Über die Wasserfälle des Orinoco bei Atures und Maipures
Das nächtliche Tierleben im Urwalde
Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse
Über den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in den verschiedenen Erdstrichen
(Diese Abhandlung wurde gelesen in der öffentlichen Versammlung der Akademie zu Berlin den 24. Jan. 1823.)
Die Lebenskraft oder der modische Genius
Eine Erzählung
Das Hochland von Caxamarca, der alten Residenzstadt des Inka Atahualpa
Erster Anblick der Südsee von dem Rücken der Andeskette
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Sachbücher bei Null Papier
Aufstand in der Wüste
Das Leben Jesu
Vom Kriege
Geschmacksverirrungen im Kunstgewerbe
Ansichten der Natur
Über den Umgang mit Menschen
Die Kunst Recht zu behalten
Walden
Römische Geschichte
Der Untergang des Abendlandes
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (* 14. September 1769 in Berlin; † 6. Mai 1859 ebenda) war ein deutscher Naturforscher mit weit über die Grenzen Europas hinausreichendem Wirkungsfeld.
Dies ist Humboldts erstes größeres Werk und auch sein erfolgreichstes. Man könnte es auch als vorweggenommene Quintessenz des Mammutwerkes »Kosmos« bezeichnen.
1808 lieferte Humboldt den ersten erfahrungswissenschaftlichen Beweis, dass sich Praxisnähe und wissenschaftliches Theoriedenken nicht nur nicht ausschließen, sondern sogar befruchten. Humboldt war Abenteuer und Denker, Entdecker und Wissenschaftler zugleich.
Seine Forschungsreisen führten ihn nach Lateinamerika, in die Vereinigten Staaten sowie nach Zentralasien. Alexander von Humboldts Denken war in einem umfassenden Sinn auf die Welt im Ganzen gerichtet. Er war ein wahres Multitalent mit unerschöpflichem Forscherdrang.
In Deutschland erlangte er vor allem mit den »Ansichten der Natur« und dem »Kosmos« außerordentliche Popularität. Er war einer der ersten populärwissenschaftlichen Autoren überhaupt. Mehr als 30.000 Briefkontakte mit den bekanntesten Köpfen seiner Zeit aus Wissenschaft, Kultur und Politik zeugen von seiner Verbundenheit zu den intellektuellen Eliten; er wurde somit Vordenker einer globalisierten Wissenschaft.
*
Widmung
Seinem teuren Bruder Wilhelm von Humboldt in Rom Berlin, im Mai 1807
der Verfasser
Vorrede zur ersten Ausgabe
Schüchtern übergebe ich dem Publikum eine Reihe von Arbeiten, die im Angesicht großer Naturgegenstände, auf dem Ozean, in den Wäldern des Orinoco, in den Steppen von Venezuela, in der Einöde peruanischer und mexikanischer Gebirge entstanden sind. Einzelne Fragmente wurden an Ort und Stelle niedergeschrieben und nochmals nur in ein Ganzes zusammengeschmolzen. Überblick der Natur im großen, Beweis von dem Zusammenwirken der Kräfte, Erneuerung des Genusses, welchen die unmittelbare Ansicht der Tropenländer dem fühlenden Menschen gewährt, sind die Zwecke, nach denen ich strebe. Jeder Aufsatz sollte ein in sich geschlossenes Ganzes ausmachen, in allen sollte eine und dieselbe Tendenz sich gleichmäßig aussprechen. Diese ästhetische Behandlung naturhistorischer Gegenstände hat, trotz der herrlichen Kraft und der Biegsamkeit unserer vaterländischen Sprache, große Schwierigkeiten der Komposition. Reichtum der Natur veranlaßt Anhäufung einzelner Bilder, und Anhäufung stört die Ruhe und den Totaleindruck des Gemäldes. Das Gefühl und die Phantasie ansprechend, artet der Stil leicht in eine dichterische Prosa aus. Diese Ideen bedürfen hier keiner Entwickelung, da die nachstehenden Blätter mannigfaltige Beispiele solcher Verirrungen, solchen Mangels an Haltung darbieten.
Mögen meine Ansichten der Natur, trotz dieser Fehler, welche ich selbst leichter rügen als verbessern kann, dem Leser doch einen Teil des Genusses gewähren, welchen ein empfänglicher Sinn in der unmittelbaren Anschauung findet. Da dieser Genuß mit der Einsicht in den inneren Zusammenhang der Naturkräfte vermehrt wird, so sind jedem Aufsatze wissenschaftliche Erläuterungen und Zusätze beigefügt.1
Überall habe ich auf den ewigen Einfluß hingewiesen, welchen die physische Natur auf die moralische Stimmung der Menschheit und auf ihre Schicksale ausübt. Bedrängten Gemütern sind diese Blätter vorzugsweise gewidmet. »Wer sich herausgerettet aus der stürmischen Lebenswelle«, folgt mir gern in das Dickicht der Wälder, durch die unabsehbare Steppe und auf den hohen Rücken der Andeskette. Zu ihm spricht der weltrichtende Chor:
Auf den Bergen ist Freiheit! Der Hauch der Grüfte Steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte; Die Welt ist vollkommen überall, Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual.
Humboldt hat den Ansichten der Natur umfangreiche »Erläuterungen und Zusätze« beigegeben, die sich in vielen Fällen zu eigenen Abhandlungen ausweiten und nur noch in losem Zusammenhang mit den sieben Essays, den »Naturgemälden« der amerikanischen Tropen, stehen; sie sind in dieser Ausgabe weggelassen. <<<
Vorrede zur zweiten und dritten Ausgabe
Die zwiefache Richtung dieser Schrift (ein sorgsames Bestreben, durch lebendige Darstellungen den Naturgenuß zu erhöhen, zugleich aber nach dem dermaligen Stande der Wissenschaft die Einsicht in das harmonische Zusammenwirken der Kräfte zu vermehren) ist in der Vorrede zur ersten Ausgabe, fast vor einem halben Jahrhundert, bezeichnet worden. Es sind damals schon die mannigfaltigen Hindernisse angegeben, welche der ästhetischen Behandlung großer Naturszenen entgegenstehn. Die Verbindung eines literarischen und eines rein szientifischen Zweckes, der Wunsch, gleichzeitig die Phantasie zu beschäftigen und durch Vermehrung des Wissens das Leben mit Ideen zu bereichern, machen die Anordnung der einzelnen Teile und das, was als Einheit der Komposition gefordert wird, schwer zu erreichen. Trotz dieser ungünstigen Verhältnisse hat das Publikum der unvollkommenen Ausführung meines Unternehmens dauernd ein nachsichtsvolles Wohlwollen geschenkt.
Die zweite Ausgabe der Ansichten der Natur habe ich in Paris im Jahr 1826 besorgt. Zwei Aufsätze: ein »Versuch über den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in den verschiedenen Erdstrichen« und die »Lebenskraft oder der rhodische Genius«, wurden damals zuerst beigefügt. Schiller, in jugendlicher Erinnerung an seine medizinischen Studien, unterhielt sich während meines langen Aufenthalts in Jena gern mit mir über physiologische Gegenstände. Meine Arbeit über die Stimmung der gereizten Muskel- und Nervenfaser durch Berührung mit chemisch verschiedenen Stoffen gab oft unsern Gesprächen eine ernstere Richtung. Es entstand in jener Zeit der kleine Aufsatz von der Lebenskraft. Die Vorliebe, welche Schiller für den »modischen Genius« hatte, den er in seine Zeitschrift der Horen aufnahm, gab mir den Mut, ihn wieder abdrucken zu lassen. Mein Bruder berührt in einem Briefe, welcher erst vor kurzem gedruckt worden ist (Wilhelm von Humboldt’s Briefe an eine Freundin T. II. S. 39), mit Zartheit denselben Gegenstand, setzt aber treffend hinzu: »Die Entwickelung einer physiologischen Idee ist der Zweck des ganzen Aufsatzes. Man liebte in der Zeit, in welcher derselbe geschrieben ist, mehr, als man jetzt tun würde, solche halbdichterische Einkleidungen ernsthafter Wahrheiten.«
Es ist mir noch im achtzigsten Jahre die Freude geworden, eine dritte Ausgabe meiner Schrift zu vollenden und dieselbe nach den Bedürfnissen der Zeit ganz umzuschmelzen. Fast alle wissenschaftliche Erläuterungen sind ergänzt oder durch neue, inhaltreichere ersetzt worden.1 Ich habe gehofft den Trieb zum Studium der Natur dadurch zu beleben, daß in dem kleinsten Raume die mannigfaltigsten Resultate gründlicher Beobachtung zusammengedrängt, die Wichtigkeit genauer numerischer Angaben und ihrer sinnigen Vergleichung untereinander erkannt und dem dogmatischen Halbwissen wie der vornehmen Zweifelsucht gesteuert werde, welche in den sogenannten höheren Kreisen des geselligen Lebens einen langen Besitz haben.
Die Expedition, die ich in Gemeinschaft mit Ehrenberg und Gustav Rose auf Befehl des Kaisers von Rußland im Jahre 1829 in das nördliche Asien (in den Ural, den Altai und an die Ufer des Kaspischen Meeres) gemacht, fällt zwischen die Epochen der 2. und 3. Ausgabe meines Buches. Sie hat wesentlich zur Erweiterung meiner Ansichten beigetragen in allem, was die Gestaltung der Bodenfläche, die Richtung der Gebirgsketten, den Zusammenhang der Steppen und Wüsten, die geographische Verbreitung der Pflanzen nach gemessenen Temperatureinflüssen betrifft. Die Unkenntnis, in welcher man so lange über die zwei großen schneebedeckten Gebirgszüge zwischen dem Altai und Himalaja, über den Thian-schan und den Kuen-lün, gewesen ist, hat bei der ungerechten Vernachlässigung chinesischer Quellen die Geographie von Innerasien verdunkelt und Phantasien als Resultate der Beobachtung in vielgelesenen Schriften verbreitet. Seit wenigen Monaten sind fast unerwartet der hypsometrischen Vergleichung der kulminierenden Gipfel beider Kontinente wichtige und berichtigende Erweiterungen zugekommen. [...] Die von früheren Irrtümern befreiten Höhenbestimmungen zweier Berge in der östlichen Andeskette von Bolivia, des Sorata und Illimani, haben dem Chimborazo seinen alten Rang unter den Schneebergen des Neuen Kontinents mit Gewißheit noch nicht ganz wiedererteilt, während im Himalaja die neue trigonometrische Messung des Kinchinjinga (26 438 Pariser Fuß) diesem Gipfel den nächsten Platz nach dem nun ebenfalls trigonometrisch genauer gemessenen Dhawalagiri einräumt.
Berlin, im März 1849
Über die Steppen und Wüsten
Am Fuße des hohen Granitrückens, welcher im Jugendalter unseres Planeten, bei Bildung des antillischen Meerbusens, dem Einbruch der Wasser getrotzt hat, beginnt eine weite, unabsehbare Ebene. Wenn man die Bergtäler von Caracas und den inselreichen See Tacarigua, in dem die nahen Pisangstämme sich spiegeln, wenn man die Fluren, welche mit dem zarten und lichten Grün des tahitischen Zuckerschilfes prangen, oder den ernsten Schatten der Kakaogebüsche zurückläßt, so ruht der Blick im Süden auf Steppen, die scheinbar ansteigend, in schwindender Ferne, den Horizont begrenzen.
Aus der üppigen Fülle des organischen Lebens tritt der Wanderer betroffen an den öden Rand einer baumlosen, pflanzenarmen Wüste. Kein Hügel, keine Klippe erhebt sich inselförmig in dem unermeßlichen Raume. Nur hier und dort liegen gebrochene Flözschichten von zweihundert Quadratmeilen Oberfläche bemerkbar höher als die angrenzenden Teile. Bänke nennen die Eingebornen diese Erscheinung, gleichsam ahndungsvoll durch die Sprache den alten Zustand der Dinge bezeichnend, da jene Erhöhungen Untiefen, die Steppen selbst aber der Boden eines großen Mittelmeeres waren.
Noch gegenwärtig ruft oft nächtliche Täuschung diese Bilder der Vorzeit zurück. Wenn im raschen Aufsteigen und Niedersinken die leitenden Gestirne den Saum der Ebene erleuchten oder wenn sie zitternd ihr Bild verdoppeln in der untern Schicht der wogenden Dünste, glaubt man den küstenlosen Ozean vor sich zu sehen. Wie dieser erfüllt die Steppe das Gemüt mit dem Gefühl der Unendlichkeit und durch dies Gefühl, wie den sinnlichen Eindrücken des Raumes sich entwindend, mit geistigen Anregungen höherer Ordnung. Aber freundlich zugleich ist der Anblick des klaren Meeresspiegels, in welchem die leichtbewegliche, sanft aufschäumende Welle sich kräuselt; tot und starr liegt die Steppe hingestreckt wie die nackte Felsrinde eines verödeten Planeten.
In allen Zonen bietet die Natur das Phänomen dieser großen Ebenen dar; in jeder haben sie einen eigentümlichen Charakter, eine Physiognomie, welche durch die Verschiedenheit ihres Bodens, durch ihr Klima und durch ihre Höhe über der Oberfläche des Meeres bestimmt wird.
Im nördlichen Europa kann man die Heideländer, welche, von einem einzigen, alles verdrängenden Pflanzenzuge bedeckt, von der Spitze von Jütland sich bis an den Ausfluß der Schelde erstrecken, als wahre Steppen betrachten, aber Steppen von geringer Ausdehnung und hochhüglichter Oberfläche, wenn man sie mit den Llanos und Pampas von Südamerika oder gar mit den Grasfluren am Missouri und Kupferflusse vergleicht, in denen der zottige Bison und der kleine Moschusstier umherschwärmen.
Einen größeren und ernsteren Anblick gewähren die Ebenen im Innern von Afrika. Gleich der weiten Fläche des Stillen Ozeans hat man sie erst in neueren Zeiten zu durchforschen versucht; sie sind Teile eines Sandmeeres, welches gegen Osten fruchtbare Erdstriche voneinander trennt oder inselförmig einschließt, wie die Wüste am Basaltgebirge Harudsch, wo in der dattelreichen Oasis von Siwa die Trümmer des Ammon-Tempels den ehrwürdigen Sitz früher Menschenbildung bezeichnen. Kein Tau, kein Regen benetzt diese öden Flächen und entwickelt im glühenden Schoß der Erde den Keim des Pflanzenlebens. Denn heiße Luftsäulen steigen überall aufwärts, lösen die Dünste und verscheuchen das vorübereilende Gewölk.
Wo die Wüste sich dem Atlantischen Ozean nähert, wie zwischen Wadi Nun und dem Weißen Vorgebirge, da strömt die feuchte Meeresluft hin, die Leere zu füllen, welch durch jene senkrechten Winde erregt wird. Selbst wenn der Schiffer durch ein Meer, das wiesenartig mit Seetang bedeckt ist, nach der Mündung des Gambia steuert, ahndet er, wo ihn plötzlich der tropische Ostwind verläßt, die Nähe des weitverbreiteten wärmestrahlenden Sandes.
Herden von Gazellen und schnellfüßige Strauße durchirren den unermeßlichen Raum. Rechnet man ab die im Sandmeere neuentdeckten Gruppen quellenreicher Inseln, an deren grünen Ufern die nomadischen Tibbos und Tuaryks schwärmen, so ist der übrige Teil der afrikanischen Wüste als dem Menschen unbewohnbar zu betrachten. Auch wagen die angrenzenden gebildeten Völker sie nur periodisch zu betreten. Auf Wegen, die der Handelsverkehr seit Jahrtausenden unwandelbar bestimmt hat, geht der lange Zug von Tafilet bis Tombuktu oder von Murzuk bis Bornu: kühne Unternehmungen, deren Möglichkeit auf der Existenz des Kamels beruht, des Schiffs der Wüste, wie es die alten Sagen der Ostwelt nennen.
Diese afrikanischen Ebenen füllen einen Raum aus, welcher den des nahen Mittelmeeres fast dreimal übertrifft. Sie liegen zum Teil unter den Wendekreisen selbst, zum Teil denselben nahe, und diese Lage begründet ihren individuellen Naturcharakter. Dagegen ist in der östlichen Hälfte des alten Kontinents dasselbe geognostische Phänomen mehr der gemäßigten Zone eigentümlich.
Auf dem Bergrücken von Mittelasien zwischen dem Goldberge oder Altai und dem Kuen-lün von der Chinesischen Mauer an bis jenseits des Himmelsgebirges und gegen den Aralsee hin, in einer Länge von mehreren tausend Meilen, breiten sich, wenn auch nicht die höchsten, doch die größten Steppen der Welt aus. Einen Teil derselben, die Kalmücken- und Kirgisen-Steppen zwischen dem Don, der Wolga, dem Kaspischen Meere und dem chinesischen Dsaisang-See, also in einer Erstreckung von fast 700 geographischen Meilen [5200 km], habe ich selbst zu sehen Gelegenheit gehabt, volle dreißig Jahre nach meiner südamerikanischen Reise. Die Vegetation der asiatischen, bisweilen hügeligen und durch Fichtenwälder unterbrochenen Steppen ist gruppenweise viel mannigfaltiger als die der Llanos und Pampas von Caracas und Buenos Aires. Der schönere Teil der Ebenen, von asiatischen Hirtenvölkern bewohnt, ist mit niedrigen Sträuchern üppig weißblühender Rosazeen, mit Kaiserkronen (Fritillarien), Tulpen und Cypripedien geschmückt. Wie die heiße Zone sich im ganzen dadurch auszeichnet, daß alles Vegetative baumartig zu werden strebt, so charakterisiert einige Steppen der asiatischen gemäßigten Zone die wundersame Höhe, zu der sich blühende Kräuter erheben: Saussureen und andere Synanthereen, Schotengewächse, besonders ein Heer von Astragalus-Arten. Wenn man in den niedrigen tatarischen Fuhrwerken sich durch weglose Teile dieser Krautsteppen bewegt, kann man nur aufrecht stehend sich orientieren und sieht die waldartig dichtgedrängten Pflanzen sich vor den Rädern niederbeugen. Einige dieser asiatischen Steppen sind Grasebenen, andere mit saftigen, immergrünen, gegliederten Kalipflanzen bedeckt, viele fernleuchtend von flechtenartig aufsprießendem Salze, das ungleich, wie frischgefallener Schnee, den lettigen Boden verhüllt.
Diese mongolischen und tatarischen Steppen, durch mannigfaltige Gebirgszüge unterbrochen, scheiden die uralte, langgebildete Menschheit in Tibet und Hindostan von den rohen, nordasiatischen Völkern. Auch ist ihr Dasein von mannigfaltigem Einfluß auf die wechselnden Schicksale des Menschengeschlechts gewesen. Sie haben die Bevölkerung gegen Süden zusammengedrängt, mehr als der Himalaja, als das Schneegebirge von Sirinagur und Gorka den Verkehr der Nationen gestört und im Norden Asiens unwandelbare Grenzen gesetzt der Verbreitung milderer Sitten und des schaffenden Kunstsinns.
Aber nicht als hindernde Vormauer allein darf die Geschichte die Ebene von Innerasien betrachten. Unheil und Verwüstung hat sie mehrmals über den Erdkreis gebracht. Hirtenvölker dieser Steppe: die Mongolen, Geten, Alanen und Usün haben die Welt erschüttert. Wenn in dem Lauf der Jahrhunderte frühe Geisteskultur gleich dem erquickenden Sonnenlicht von Osten nach Westen gewandert ist, so haben späterhin, in derselben Richtung, Barbarei und sittliche Roheit Europa nebelartig zu überziehen gedroht. Ein brauner Hirtenstamm (tukiuischer, d. i. türkischer Abkunft), die Hiongnu, bewohnte in ledernen Gezelten die hohe Steppe von Gobi. Der chinesischen Macht lange furchtbar, ward ein Teil des Stammes südlich nach Innerasien zurückgedrängt. Dieser Stoß der Völker pflanzte sich unaufhaltsam bis in das alte Finnenland am Ural fort. Von dort aus brachen Hunnen, Avaren, Chasaren und mannigfaltige Gemische asiatischer Menschenrassen hervor. Hunnische Kriegsheere erschienen erst an der Wolga, dann in Pannonien, dann an der Marne und an den Ufern des Po: die schön bepflanzten Fluren verheerend, wo seit Antenors Zeiten die bildende Menschheit Denkmal auf Denkmal gehäuft. So wehte aus den mongolischen Wüsten ein verpesteter Windeshauch, der auf zisalpinischem Boden die zarte, langgepflegte Blüte der Kunst erstickte.
Von den Salzsteppen Asiens, von den europäischen Heideländern, die im Sommer mit honigreichen, rötlichen Blumen prangen, und von den pflanzenleeren Wüsten Afrikas kehren wir zu den Ebenen von Südamerika zurück, deren Gemälde ich bereits angefangen habe mit rohen Zügen zu entwerfen.
Das Interesse, welches ein solches Gemälde dem Beobachter gewähren kann, ist aber ein reines Naturinteresse. Keine Oase erinnert hier an frühe Bewohner, kein behauener Stein, kein verwilderter Fruchtbaum an den Fleiß untergegangener Geschlechter. Wie den Schicksalen der Menschheit fremd, allein an die Gegenwart fesselnd, liegt dieser Erdwinkel da, ein wilder Schauplatz des freien Tier- und Pflanzenlebens.
Von der Küstenkette von Caracas erstreckt sich die Steppe bis zu den Wäldern der Guyana, von den Schneebergen von Mérida, an deren Abhange der Natriumsee Urao ein Gegenstand des religiösen Aberglaubens der Eingebornen ist, bis zu dem großen Delta, welches der Orinoco an seiner Mündung bildet. Südwestlich zieht sie sich gleich einem Meeresarme jenseits der Ufer des Meta und des Vichada bis zu den unbesuchten Quellen des Guaviare und bis zu dem einsamen Gebirgsstock hin, welchen spanische Kriegsvölker, im Spiel ihrer regsamen Phantasie, den Paramo de la suma paz, gleichsam den schönen Sitz des ewigen Friedens, nannten.
Diese Steppe nimmt einen Raum von 16.000 Quadratmeilen1 ein. Aus geographischer Unkunde hat man sie oft in gleicher Breite als ununterbrochen bis an die Magellanische Meerenge fortlaufend geschildert, nicht eingedenk der waldigen Ebene des Amazonenflusses, welche gegen Norden und Süden von den Grassteppen des Apure und des La-Plata-Stromes begrenzt wird. Die Andeskette von Cochabamba und die brasilianische Berggruppe senden, zwischen der Provinz Chiquitos und der Landenge von Villabella, einzelne Bergjoche sich entgegen. Eine schmale Ebene vereinigt die Hyläa2 des Amazonenflusses mit den Pampas von Buenos Aires. Letztere übertreffen die Llanos von Venezuela dreimal an Flächeninhalt. Ja ihre Ausdehnung ist so wundervoll groß, daß sie auf der nördlichen Seite durch Palmengebüsche begrenzt und auf der südlichen fast mit ewigem Eise bedeckt sind. Der kasuarähnliche Tuyu (Struthio Rhea) ist diesen Pampas eigentümlich wie die Kolonien verwilderter Hunde, welche gesellig in unterirdischen Höhlen wohnen, aber oft blutgierig den Menschen anfallen, für dessen Verteidigung ihre Stammväter kämpften.
Gleich dem größten Teile der Wüste Sahara liegen die Llanos, oder die nördlichste Ebene von Südamerika, in dem heißen Erdgürtel. Dennoch erscheinen sie in jeder Hälfte des Jahres unter einer verschiedenen Gestalt: bald verödet, wie das libysche Sandmeer, bald als eine Grasflur, wie so viele Steppen von Mittelasien.
Es ist ein belohnendes, wenngleich schwieriges Geschäft der allgemeinen Länderkunde, die Naturbeschaffenheit entlegener Erdstriche miteinander zu vergleichen und die Resultate dieser Vergleichung in wenigen Zügen darzustellen. Mannigfaltige, zum Teil noch wenig entwickelte Ursachen vermindern die Dürre und Wärme des neuen Weltteils.
Wird daher eine Seite unsers Planeten luftfeuchter als die andere genannt, so ist die Betrachtung des gegenwärtigen Zustandes der Dinge hinlänglich, das Problem dieser Ungleichheit zu lösen. Der Physiker braucht die Erklärung solcher Naturerscheinungen nicht in das Gewand geologischer Mythen zu hüllen. Es bedarf der Annahme nicht, als habe sich auf dem uralten Erdkörper in der östlichen und westlichen Hemisphäre ungleichzeitig geschlichtet der verderbliche Streit der Elemente; oder als sei aus der chaotischen Wasserbedeckung Amerika später als die übrigen Weltteile hervorgetreten, ein sumpfreiches, von Krokodilen und Schlangen bewohntes Eiland.
Allerdings hat Südamerika, nach der Gestalt seines Umrisses und der Richtung seiner Küsten, eine auffallende Ähnlichkeit mit der südwestlichen Halbinsel des alten Kontinents. Aber innere Struktur des Bodens und relative Lage zu den angrenzenden Ländermassen bringen in Afrika jene wunderbare Dürre hervor, welche in unermeßlichen Räumen der Entwickelung des organischen Lebens entgegensieht. Vier Fünfteile von Südamerika liegen jenseits des Äquators: also in einer Hemisphäre, welche wegen der größeren Wassermenge und wegen mannigfaltiger anderer Ursachen kühler und feuchter als unsre nördliche Halbkugel ist. Dieser letzteren gehört dagegen der beträchtlichere Teil von Afrika zu.
Die südamerikanische Steppe, die Llanos, haben, von Osten gegen Westen gemessen, eine dreimal geringere Ausdehnung als die afrikanischen Wüsten. Jene empfangen den tropischen Seewind, diese, unter einem Breitenzirkel mit Arabien und dem südlichen Persien gelegen, werden von Luftschichten berührt, die über heiße, wärmestrahlende Kontinente hinwehen. Auch hat bereits der ehrwürdige, langverkannte Vater der Geschichte, Herodot, im echten Sinn einer großen Naturansicht alle Wüsten in Nordafrika, in Yemen, Kerman und Mekran (der Gedrosia der Griechen), ja bis Multan in Vorderindien hin als ein einziges zusammenhängendes Sandmeer geschildert.