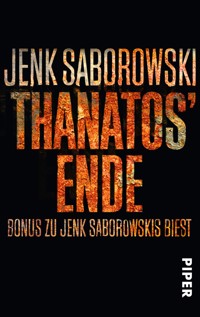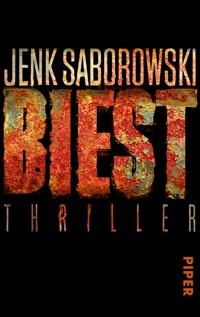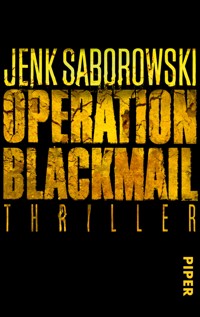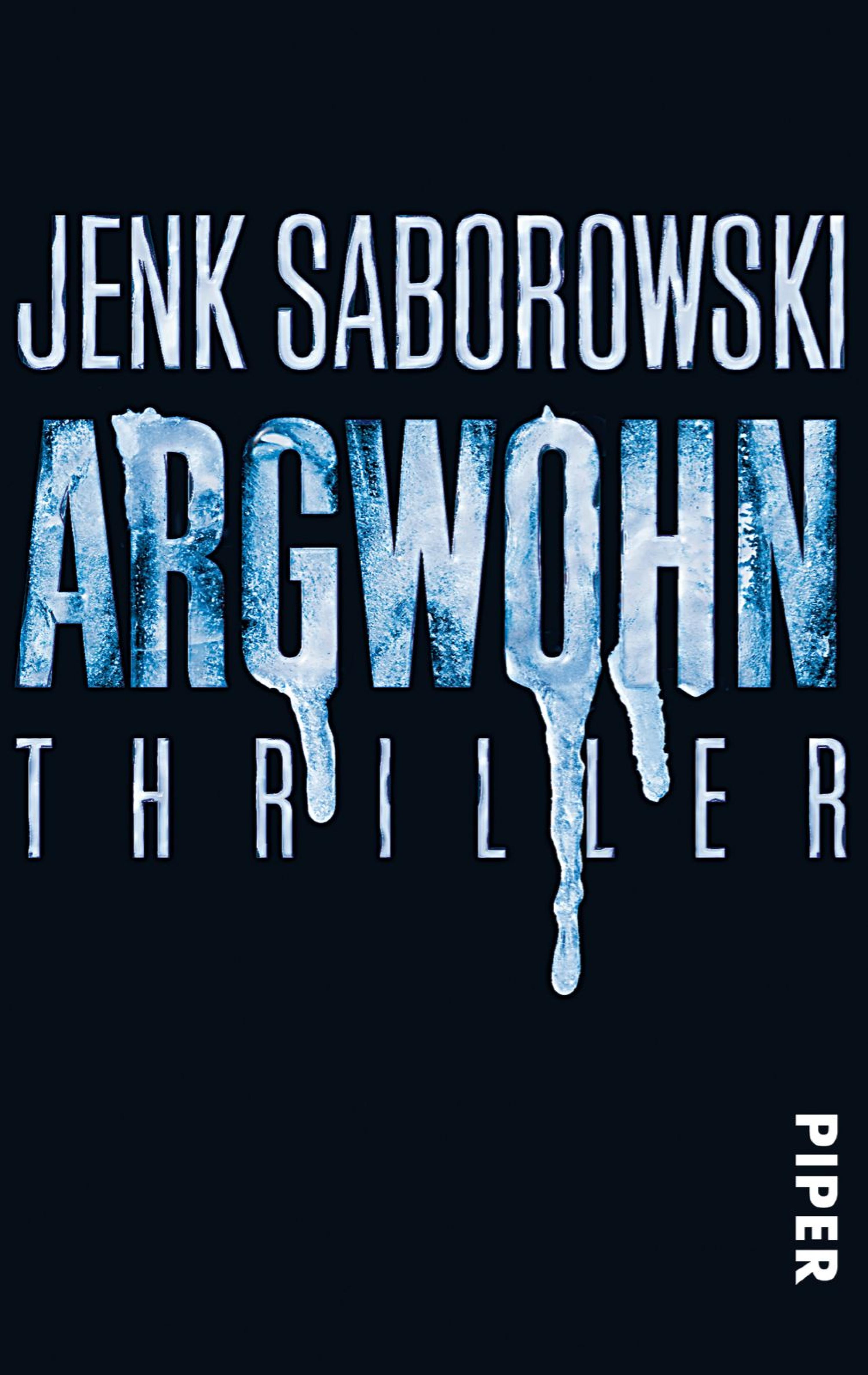
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Karriere von Hauptkommissar Paul Regen scheint am Ende, als ein formalingetränkter Arm auf seinem Schreibtisch landet. Vor einigen Jahren wurden in Frankreich zwei Beinpaare auf einer Mülldeponie entdeckt. Ein Zufall? Zur gleichen Zeit verüben Menschenhändler einen Anschlag auf die Europapolizei ECSB. Die Ermittlungen führen Agentin Solveigh Lang tief in den Sumpf des organisierten Verbrechens. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen? Sicher ist nur: Nichts ist, wie es scheint ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
»Argwohn« ist eine fiktive Geschichte. Ereignisse, Personen und Institutionen sind frei erfunden, jede Übereinstimmung mit der Realität wäre reiner Zufall.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96304-6
© Piper Verlag GmbH, München 2014
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur
Umschlagmotiv: Getty Images, Corbis
Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
»Aus kleinen Missverständnissen zimmern wir uns Glaubensvorstellungen und Hoffnungen zurecht und sprechen von den Brotrinden, die wir Kuchen nennen, wie arme Kinder, die Glücklichsein spielen.«
Fernando Pessoa
TEIL 1
Die Prophezeiung, der Anschlag und die Wette.
KAPITEL 1
Iliciovca (Drochia), Moldawien
Montag, 3. Juni 2013, 7.09 Uhr
Obwohl Lila längst verlernt hatte zu träumen, erwachte sie jeden Morgen voller Zuversicht und weckte ihre Großeltern mit dem lauten Quietschen der Fensterläden. Nicht alle Mädchen in ihrem Dorf hatten das Glück, dass beide noch lebten, um den Garten zu bestellen, zu kochen und sie zur Schule zu schicken. Eltern gab es in Iliciovca keine mehr.
Lila wartete auf die Bläschen im Wasser, aber ausgerechnet heute schien die Flamme kleiner als sonst. Als sie Großmutters schlurfende Schritte auf dem Weg ins Bad hörte, war der Tee fertig. Sie verschüttete beim Eingießen etwas davon und beeilte sich, den Fleck aufzuwischen. Die schweren Schuhe ihres Großvaters schoben sich unter den Tisch. Sie reichte ihm seinen Becher und eine Schale mit Mamalyga. Sein gebeugter Rücken bildete eine schöne Kurve vom Fuß seines Schemels bis zur Tasse, wie eine Funktion in der Mathematik. Er starrte auf Lilas Brief. Die brüchige Haut seiner Finger strich über den Schmetterling, den ihre Mutter auf den Umschlag gezeichnet hatte. Dann wog er ihn in der Hand. Lila spürte die Hoffnung auf Geld hinter seinen Augenlidern. Sie nahm ihm den Brief aus der Hand, und die Kurvenfunktion fiel in sich zusammen. Aber er lief ihr nicht hinterher, als sie ihr Schulbündel schnappte und die Tür hinter sich zuschlug. Lila und die anderen Kinder hatten gelernt, mit den dünnen Briefen ihrer Eltern zu leben, mit den vielen Worten und den wenigen Scheinen für Bücher, Zahnpasta und den Arzt. Normalerweise öffneten sie die Briefe am Küchentisch und berieten, was am nötigsten gebraucht wurde. Aber nicht heute. Heute nicht. Heute war Lilas fünfzehnter Geburtstag.
»Wir kaufen dir ein Kleid«, sagte Ioana, als sie nach der Schule zum Busbahnhof liefen. »Fürs Mittsommerfest.«
Lila beobachtete die Kieselsteine vor ihren Schuhspitzen. Sie glaubte an die Logik und die Mathematik. All ihre Berechnungen sprachen sich dagegen aus, bei der Wahl zur Mittsommerkönigin anzutreten, denn das Ergebnis war jedes Mal, dass eine andere gewinnen würde. Lila war dünn wie die Beine eines Ziegenbocks, und sie hatte eine große Lücke zwischen den Schneidezähnen. Ioana hingegen trugen die Jungs wie auf Kissen gebettet in einer Sänfte durch die Schulflure. Die Summe aller Berechnungen sah jedoch Lila im Plus, denn sie glaubte, dass es für ein Mädchen aus Moldawien ungesund ist, sich nicht anstrengen zu müssen. Das Leben würde noch hart genug werden, wenn sie erst mit der Schule fertig waren. Eine Zukunft gab es für sie nämlich nicht. Die Schulen waren ein Relikt aus den guten Zeiten, als ihre Republik der Garten aller Sowjetstaaten gewesen war und die Exporte von Wein, Tabak und Gemüse ihren Wohlstand gesichert hatten. Als eigenständiger Staat hatte Moldawien seinen Kindern nichts zu bieten.
»Wie viel haben sie dir geschickt?«, fragte Ioana.
Lila zog den Umschlag mit dem Schmetterling zwischen den Schulbüchern hervor. Zwischen zwei Zeitungsseiten steckte der gefaltete Schein. Die orangefarbene Banknote knisterte beim Öffnen, und Stück für Stück kam das Bild einer mittelalterlichen Festung zum Vorschein. Einhundert Lei.
Ioana pfiff leise durch die Zähne, Lila hätte das besser gekonnt.
»Für hundert Lei kannst du die halbe Siedlung kaufen. Lass uns wenigstens schauen, was sie haben.«
Lila nickte. Die Siedlung vielleicht nicht, aber eine ganze, riesengroße Salami vermutlich schon. Oder ein Kleid. Vielleicht sogar eines mit einem Aufdruck. Etwas Modernes. Eines, in dem sie nicht mehr aussah wie das Bein eines Ziegenbocks, wie Bence sie genannt hatte. Sein Kommentar saß tiefer, als sie gedacht hatte. Ioana hatte recht: Was günstige Textilien anging, war der Markt vor der Stadt nicht zu schlagen. Die Großeltern sahen es nicht gerne, wenn Lila dorthin ging, weil die Frauen angeblich Hexen waren und einige mit dem Teufel paktierten, was Lila für nicht sehr wahrscheinlich hielt. Außerdem mussten sie es ja nicht erfahren. Ebenso wenig, dass es ursprünglich einhundert Lei gewesen waren. Ioana hatte sie angesteckt. Zumindest ein wenig.
Lila und Ioana umkurvten die unberechenbaren Pfützen und liefen an den Häusern mit den Töpfen und den Stühlen vorbei bis zum Platz zwischen den Hütten, die wie eine kleine Wagenburg zusammenstanden. In der Mitte hingen ihre Waren, hauptsächlich Kleidung unter großen Schirmen. Vor den Häusern saßen breitbeinig alte Frauen in schmutzigen Kleidern, um zu demonstrieren, dass sie sich nichts davon leisten konnten. Was, wie Lila vermutete, nicht einmal gelogen war. Ioana begann systematisch an einer Schirmstrebe zu suchen und schob die Plastikkleiderbügel auseinander und wieder zusammen. Lila beobachtete die Frauen. Eine von ihnen zurrte ihre grauen Haare noch fester und legte ihre rechte Hand wieder in eine Schale mit Wasser und Blüten. Lila starrte sie an, erst auf ihren strengen Dutt, dann auf die Schale. Die Frau hob den Kopf, und Lila beeilte sich, hinter einem Vorhang aus Hosen in Deckung zu gehen.
»Hast du die gesehen?«, flüsterte sie Ioana zu, die unbeirrt Plastikbügel um Plastikbügel durchging.
»Wen?«, fragte Ioana.
»Die alte Frau. Großmutter sagt, hier in der Siedlung hätten es manche mit dem Teufel.«
Ioana lachte, aber Lila bedeutete ihr, leise zu sein.
»So ein Unfug«, sagte Ioana. »Meine Eltern schreiben mir immer, ich soll nicht alles glauben, was die alten Leute erzählen.«
»Hast ja recht«, sagte Lila und warf einen letzten verstohlenen Blick durch die Hosenbeine. Die alte Frau murmelte etwas und schien wieder mit sich selbst beschäftigt.
Lila wanderte hinter Ioana die Stangen mit den Kleidern entlang. Beim ersten Durchgang schloss sie die Augen und fühlte nach den Stoffen. Die weiche Baumwolle, die geriffelte Schurware und die glänzende falsche Seide. Lila hatte noch niemals ein Kleid aus Seide angefasst, aber sie kannte die Beschreibung aus einem Buch. Es war das Zarteste, was man mit Geld kaufen konnte. Und sie würde es sich niemals leisten können. Beim zweiten Durchgang betrachtete Lila die Farben der Kleider, während ihre Finger sich an das Gefühl erinnerten. Ioana hielt ihr ein Kleid nach dem anderen vor die Brust, aber Lila dachte an das Geld und ihre Großeltern. Die meisten Kleider kosteten über fünfzig Lei, so viel wie ein Huhn, das jeden dritten Tag ein Ei legte. Ioana war gerade hinter einem der Vorhänge verschwunden und suchte etwas Günstigeres, als Lila spürte, wie plötzlich jemand hinter sie trat. Sie drehte sich um. Dort stand die alte Frau und starrte sie an, ihr Gesicht keine zwanzig Zentimeter von ihrem entfernt.
»Du suchst ein besonderes Kleid?«
Lila schluckte. Sie wollte in die Stoffe abtauchen, für immer verschwinden, aber der Blick der alten Frau hielt sie fest. Sie nickte. Wo war Ioana? Lila blickte nach rechts. Dann war die Frau verschwunden, und Ioana tauchte mit einem blauen T-Shirt wieder auf.
»Wo warst du?«, fragte Lila.
»Nur dahinten«, sie deutete auf eine Kleiderstange am anderen Ende des Schirms. »Was ist passiert? Du siehst aus, als hättest du einen Werwolf gesehen.« Lila sagte nichts. Sie starrte an Ioana vorbei. Die Frau war zurück. Und sie trug ein schwarzes Kleid unter dem Arm, das auf keiner der Stangen gehangen hatte. Es war aus einem seidig weichen Stoff und wirkte wie aus einer anderen Zeit. Es hatte Ränder mit fein gehäkelten Spitzen und eine rote Schleife um die Taille. Es kostete mit Sicherheit ein Vermögen. Sie drückte es Lila in die Hand.
»Wer dieses Kleid trägt«, sagte die alte Frau, »wird eines Tages eine Königin sein.«
Ioana klatschte in die Hände: »Genau das, was wir gesucht haben!«
»Was kostet es?«, fragte Lila.
Die alte Frau tätschelte Lila den Arm und legte das Kleid darüber. »Für dich nur zwölf Lei, mein Kind.«
Nur zwölf Lei? Das war weniger als ein Viertel dessen, was all die anderen Kleider kosteten.
»Warum ist es so günstig?«, fragte Lila.
»Alles hat seinen eigenen Preis«, lächelte die Frau und machte sich auf den Rückweg zu ihrem Hocker vor der Hütte. Lila sah ihr nach und betrachtete ihre alten Füße in den sauberen Schuhen, darunter der lehmige Boden. Sie spürte, wie Ioana an ihrem Ärmel zupfte, während die alte Frau ihre Hände in dem Blütenwasser wusch, als hätte sie sich die Hände an dem Kleid schmutzig gemacht. Das Kleid einer Königin, dachte Lila. Vielleicht war die alte Frau doch eine Hexe? Ihre Großmutter behauptete, dass es gute und schlechte unter ihnen gebe. Manche bekämpften das Übel, andere huldigten dem Bösen. Kann der Satan eine Königin schaffen? Lila zog den Hundert-Lei-Schein aus dem Briefumschlag, spürte das Knistern des Papiers zwischen ihren Fingern und betrachtete die alte Frau mit einem mulmigen Gefühl im Bauch.
KAPITEL 2
Landeskriminalamt, München, Bayern
Donnerstag, 13. Juni 2013, 16.07 Uhr (zehn Tage später)
Paul Regen schlug den Fisch in Zeitungspapier, beschriftete das Paket mit leidlich verstellter Schrift und lehnte sich zurück. Die Sonne schien durch die schräg gestellten Lamellen, und unter der Druckerschwärze begannen die Bakterien mit der Zersetzung der Eiweiße und der Fettsäuren. Er trug das Paket wie Kaspar die Myrrhe über den ausgetretenen Teppichboden seines Büros. Mit einer Hand öffnete er die Tür zum Auswärtigen Amt, wie er sein Vorzimmer insgeheim nannte.
Adelheid Auch schob ihre Brille auf eine der Falten ihrer Stirn und beobachtete seine Prozession zum Fach für die Hauspost von ihrem Schreibtisch aus.
»Mit Essen spielt man nicht, Herr Regen«, sagte sie mit ihrer kratzigen Altersstimmbruchstimme.
»Sparus aurata ist nicht umsonst gestorben, Frau Auch«, sagte Paul Regen und schnüffelte an dem Paket. »Er hatte sehr viele Zähne, glauben Sie mir, er wollte nicht spielen.«
»Ist das für den Kriminaldirektor?«, fragte Adelheid Auch. »Sie wissen, dass er in Urlaub auf Mykonos ist.«
Paul Regen seufzte. Er wusste, dass sich Adelheid nur um seine Zukunft sorgte, dabei lag der Fisch in der Vergangenheit begraben. Außerdem schien es ihm unbegreiflich, wie Adelheid Auch angesichts der letzten acht Jahre noch ernsthaft an eine Zukunft des Kriminalhauptkommissars Paul Regen glauben konnte. Aber er liebte sie für ihren unerschütterlichen Optimismus, den sie mit ihrer vorsichtigen Frage nach der Bestimmung des Fischs wieder einmal unter Beweis gestellt hatte. »Ich weiß nicht, was der Kriminaldirektor Wochinger gegen eine gute Dorade einzuwenden haben könnte«, sagte Paul Regen.
»Immer dieser Zynismus«, stellte Adelheid Auch fest. »Das Kurzschwert des Griesgrams.«
»Eine Woche ist nichts für einen guten Fisch«, fügte Paul Regen hinzu. »Früher haben die von Brindisi bis München zehn Arbeitstage gebraucht, und dieser hier hat vorgestern noch im Mittelmeer gebadet.«
»Und Sie glauben, dass er es an seinem Sekretariat vorbei schafft?«
»Zufällig weiß ich, dass Kriminaldirektor Wochinger kürzlich ein Extrapostfach für Pakete in seinem Büro installieren ließ wegen der Geschenke.«
»Eine kluge Entscheidung«, bemerkte Adelheid Auch, setzte die Brille auf die Nase und erklärte damit ihre Unterhaltung für beendet.
»Im Übrigen«, fügte er hinzu, »ist ein Griesgram einer, der sich grämt. Ich gräme mich nicht.«
Adelheid Auch unterbrach ihr Stakkatogetippe: »Nein, Herr Regen, das tun Sie tatsächlich nicht.«
Paul Regen legte die Hand an die Türklinke seines winzigen Büros, das ungefähr ein Viertel der Grundfläche von Adelheid Auchs Auswärtigem Amt ausmachte.
»Sie könnte man aufgrund Ihrer Kostüme übrigens als Partyblume bezeichnen, was auch nichts Besseres ist als ein Griesgram.« Paul Regen sagte das nicht, um sie mit ihren eigenwilligen Modevorlieben aufzuziehen, sondern weil er es vorzog, seine Unterhaltungen selbst zu beenden. Adelheids Brille wanderte wieder auf die Stirn, und der Drehstuhl quietschte, als sie sich zu Regen umdrehte. Ihr Faible für Mintfarbenes war unerschütterlich.
»Bleistiftröcke waren niemals aus der Mode, Herr Regen. Im Gegensatz zu Ihrem Kleinkrieg mit dem Kriminaldirektor. Kaum zu glauben, dass Sie beide früher beste Freunde und Partner waren.«
»Würde es Ihnen besser gefallen, wenn ich mit einer Handgranate in den vierten Stock laufen würde?«
»Ein Selbstmordattentat hatte ich nicht gerade im Sinn«, sagte Adelheid Auch und drehte sich wieder zu ihrer Tastatur.
Paul Regen grinste und hörte, kurz bevor er die Tür zu seinem Büro schloss, wie sie hinzufügte: »Andererseits würde dann mal jemand gewinnen.«
Da hatte sie nicht einmal so unrecht.
Paul Regen suchte im Internet nach einem Segelboot, das er sich leisten konnte und das es bis nach Kroatien schaffen würde, als er hörte, wie im Auswärtigen Amt das Telefon klingelte. Paul Regen ging nicht einmal ran, wenn Adelheid Auch auf der Toilette war. Es gab immer die Möglichkeit, dass Wochinger dran war. Zudem war das AA für alles zuständig, was sich außerhalb seines Büros abspielte. Seit Klaus Wochinger vor sieben Jahren als Kriminalrat von der Hochschule in Münster zurückgekehrt war, ernteten sie nur noch die Jobs, die wirklich niemand erledigen wollte. Zurzeit beschäftigten sich Paul Regen und seine Kriminalhauptmeisterin Adelheid Auch mit der Einführung einer neuen Informationstechnologie, dem »Erkennungsdienst digital«, was genauso spannend war, wie es sich anhörte. Kriminaldirektor Wochinger war kein einfacher Feind, aber Paul Regen war im Recht. So einfach war das. Und doch so kompliziert.
Es klopfte keine zwei Minuten später, und die Tür wurde geöffnet, ehe er sich wehren konnte.
»Können Sie nicht warten, bis ich ›herein‹ sage?«, fragte er mit gespielt vorwurfsvollem Ton.
»Sie haben einen Arm«, sagte Adelheid Auch. Ihre Brille saß immer noch auf der Stirnfalte.
»Sie meinen, mir wuchs zwischenzeitlich ein dritter Arm, den Sie sehen, aber den ich nicht bewegen kann, oder hatten Sie etwas anderes im Sinn?«, fragte Paul Regen.
»Sie haben einen Arm an der Isar gefunden«, fuhr das Auswärtige Amt unbeirrt fort.
»Heißt das, wir können den Termin wegen der neuen Schnittstelle absagen?«, fragte Paul Regen hoffnungsvoll.
»Das glaube ich nicht«, sagte Auch. »Sie wissen genau, dass Kriminaldirektor Wochinger persönlich kontrolliert, ob Sie hingehen.«
»Sie wissen genau, dass die jede Woche neue Probleme aus dem Hut zaubern wie zum Beispiel die Frage, ob unsere brillante Software auch erkennt, dass ein Auge gar nicht tätowiert sein kann. Ich meine, wem fällt denn so was ein?«
»Ich weiß«, sagte Adelheid Auch, und es klang sogar mitfühlend. »Aber die Sache mit dem Arm ist schnell erledigt. Sie wollen das offenbar als Test für unser neues System.«
Wohl eher als Offenbarungseid, dachte Paul Regen, hütete sich aber, es laut auszusprechen. Seufzend schloss er die Seite mit den Segelbooten und blickte fragend zu Adelheid.
»Der Arm ist offenbar abgerissen, ob vom Hochwasser oder vorher, können sie noch nicht sagen.«
»Haben wir keinen anderen für so etwas? Das klingt doch nach was, so ein abgerissener Arm.«
»Offenbar ist er alt.«
»Wer ist alt?«, fragte Regen. »Der, der dranhing am Arm?«
»Nein. Also keine Ahnung. Jedenfalls wurde der Arm irgendwie konserviert und ist jetzt durch das Hochwasser angespült worden. Sie schätzen, er ist einige Jahre alt.«
»Das heißt, keine Leiche?«
Adelheid Auch schüttelte den Kopf.
Natürlich nicht, dachte Paul Regen und ärgerte sich, dass man ihn nicht in Ruhe lassen konnte. Er nahm den Trenchcoat vom Haken und warf einen skeptischen Blick auf seine frisch geputzten Wanderschuhe und die saubere Jeans. Hatte das Auswärtige Amt nicht etwas von Hochwasser gesagt? Und kam das nicht einer Reisewarnung gleich? Paul Regen beschloss, dass der Arm bis nach einem frühen Abendessen auf dem Markt warten konnte. »Verschieben Sie die Schnittstelle auf morgen Mittag«, rief er im Rausgehen, sodass Adelheids Widerworte im leeren Flur verhallten.
KAPITEL 3
Amsterdam, Niederlande
Donnerstag, 13. Juni 2013, 18.48 Uhr (am selben Tag)
»Ich weiß nicht, warum du mich anreisen lässt, um dann mit mir Schluss zu machen«, sagte Marcel. »Das hättest du auch am Telefon haben können.«
Solveigh schluckte eine bissige Bemerkung herunter und konzentrierte sich auf die Schale mit Erdnüssen. Das Schulterholster drückte kalt auf ihre Rippen, wenn sie sich vorbeugte. Dann nippte sie an ihrem Scotch und sagte: »Du hast dich verändert, Marcel.«
»Und du bist nie da«, sagte Marcel. Solveigh wusste, worauf das hinauslief. Ihr Job war mal wieder der Grund für alles.
»Marcel, die wievielte war das jetzt?«, fragte Solveigh. Ein weiterer Schluck Scotch.
»Ich weiß nicht, wovon du redest«, sagte Marcel. Und sah sehr gut aus, als er das sagte. Nur nicht besonders glaubwürdig. Solveigh dachte an die Bilder in der Akte. Sie hatte nicht gewusst, dass auch die Partner von Mitarbeitern überprüft wurden, aber es wunderte sie auch nicht besonders. Nur hatte sie nicht darum gebeten, über Marcels Affären informiert zu werden. Vermutlich hatte ihr der Kollege einen Gefallen tun wollen und das Gegenteil erreicht. Vielleicht hatte Marcel recht, und dieser Job zerstörte alles Private. Bei dem Gedanken an letzten Februar wurde ihr schlecht. Zerstört ist hier wörtlich zu nehmen, dachte sie.
»Marcel, hör zu. Es geht nicht nur um deine Bettgeschichten. Du bist ein anderer Mensch geworden, als du vor zwei Jahren warst. Und ich glaube, das weißt du auch.«
»Ich weiß nicht, was das alles mit mir zu tun haben soll!«, sagte Marcel. Seine Aggressivität, seine Angriffslust, das waren einmal Eigenschaften gewesen, die sie an ihm gemocht hatte. Vielleicht hatte auch sie sich verändert.
Als er nach ihrer Hand griff, starrte sie in den Fernseher, der über der Bar hing. Der Nachrichtenkanal wechselte von einer Dokumentation über die größten Schaufelradbagger der Welt zu einer aktuellen Sondermeldung. Wie passend, dachte Solveigh und beobachtete Marcels Hand auf ihrer, die sich fremd anfühlte, wie aus einer anderen Zeit. Trotzdem entzog sie sich ihm nicht. Noch nicht. War sie bereit für diesen Schritt? Der Fernseher zeigte Bilder aus dem Helikopter, ein brennendes Haus. Offenbar hatte es am Stadtrand eine Explosion gegeben. Ein Terroranschlag? Solveigh musste das vermuten, dafür war sie schließlich ausgebildet. Für Gefühle war sie offenbar nicht gut genug ausgebildet worden.
»Alles hat mit dir zu tun, Marcel. Weil es mit uns zu tun hat. Uns beiden, verstehst du? Ich gebe dir keine Schuld, aber …«
Solveighs Stimme versagte. Ein Reporter stand vor dem Hochhaus, Feuerwehrleute rannten hinein, zwei andere schleppten eine Trage hinaus. Sie kannte das Gebäude. Es war das Gebäude, in dem sie arbeitete.
»Slang«, versuchte Marcel ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. »Bitte wirf das alles nicht einfach weg. Wirf uns nicht einfach weg.«
Solveigh war wie gelähmt. Will, Eddy, ihre Kollegen.
»Slang, was ist los?«
»Nicht jetzt, Marcel.«
Er folgte ihrem Blick. »O mein Gott«, sagte er, und die Hand, die eben noch auf Solveighs geruht hatte, wanderte zu seiner Fototasche. Die Reflexe eines Reporters.
Solveighs Handy klingelte.
»Ich muss los«, sagte sie. Sie goss den Rest des Wassers in ihr Glas und leerte es in einem Zug.
»Natürlich«, antwortete Marcel. »Kann ich mitkommen?«
»Untersteh dich«, sagte Solveigh und griff nach ihrer Tasche.
»Ich liebe dich immer noch!«, rief er ihr hinterher, als sie an den Barhockern entlang Richtung Ausgang rannte und dabei ihr Handy aus der Tasche kramte.
»Das Notfallprotokoll wurde aktiviert«, sagte eine blecherne Computerstimme. »Ihr Evakuierungspunkt ist der Leidseplein. Melden Sie sich bei der Zentrale, wenn Sie Ihren Evakuierungspunkt erreicht haben.«
An der frischen Luft sog Solveigh Sauerstoff in die Lungen. Wie viel hatte sie getrunken? Zwei Gläser. Sie halluzinierte nicht, oder? Das Notfallprotokoll. Der allerletzte Ausweg nach einem direkten Angriff auf eine Institution der EU. Evakuierung bedeutete, dass alle Mitarbeiter der ECSB aufgeteilt und auf neue Büros verteilt wurden, um von dort die Arbeit wieder aufzunehmen. Geschwächt, aber einsatzfähig, so schnell wie möglich. Solveigh war bewusst, dass von ihr erwartet wurde, den Anweisungen des Protokolls genau Folge zu leisten. Selbst eine minimale Abweichung würde der direkten Missachtung eines Befehls gleichkommen. Vor der Laterne mit ihrem Rennrad blieb sie stehen und überlegte. Der Leidseplein war nicht weit entfernt, mit dem Rad wäre sie in weniger als fünf Minuten an ihrem Evakuierungspunkt.
Aber was, wenn es Eddy mit seinem Rollstuhl nicht rechtzeitig herausgeschafft hatte? Sie wählte seine Nummer und steckte den Kopfhörer ins Ohr. Solveigh hatte nicht vor, sich zu dem Evakuierungspunkt zu begeben. Sie musste herausfinden, was passiert war. Und Eddy finden. Sie schwang sich auf das Rennrad und trat in die Pedale. Es klingelte, aber er ging nicht ans Telefon. Eddy ging immer ans Telefon. Er war ihr Alter Ego, ihr bester Freund. Er war immer für sie erreichbar, selbst wenn er betrunken in seiner Bodega hing. Und sie war für ihn da, wenn er sie brauchte. Sie musste zum Büro. Nach Süden. Weg vom Leidseplein. Hinein ins Chaos.
KAPITEL 4
Iliciovca, Moldawien
Donnerstag, 13. Juni 2013, 19.04 Uhr (am selben Tag)
Das lange Gras kitzelte Lilas Kniekehlen, während sie versuchte, ihre Hand so ruhig zu halten, dass der Grashüpfer sie für sicheres Terrain hielt. Als er heruntersprang, drehte sich Lila um. Sie betrachtete Ioanas Busen, der sich im Schlaf gleichmäßig hob und senkte. Bis die Bewegung kurz innehielt. Sie war aufgewacht.
»Glaubst du, sie war eine Strigoaică?«, fragte Lila.
»Es gibt keine Hexen, Lila. Alles Aberglaube der Alten. Wir sollten nicht so viel mit den Alten zu tun haben. Es ist nicht gesund.«
»Hast du die Schale mit dem Wasser und den Blüten gesehen? Großmutter sagt, das hilft gegen die bösen Geister.«
»Quatsch«, sagte Ioana und setzte sich auf. Sie verscheuchte eine Fliege von ihrem Oberschenkel. »Sag mir lieber, wie du dich entschieden hast.«
Lila seufzte. Konnte sie nie damit aufhören? Das Mittsommerfest war in zwei Tagen, dann wäre der Spuk vorbei.
»Du weißt, dass ich nicht mitmache«, sagte Lila.
»Aber jetzt, wo du das Kleid hast, wäre das doch eine Verschwendung, oder nicht? Sie hat gesagt, es ist das Kleid einer Königin.«
»Ich dachte, du glaubst nicht an den Spuk.«
»Tu ich auch nicht.«
Lila betrachtete Ioana und bewunderte sie für ihre Unbekümmertheit. Lila machte sich Gedanken über ihre Zukunft. Ob sie Freundinnen bleiben würden, wenn es ernst wurde? Sie hoffte es.
»Was machen wir eigentlich nächstes Jahr?«, fragte Lila und zeichnete den Umriss ihres Körpers auf den niedergedrückten Grashalmen nach.
Ioana zuckte mit den Schultern: »Du meinst, wenn wir mit der Schule fertig sind? Was sollen wir schon tun?«
»Ich würde gerne studieren«, sagte Lila.
»Du bist nicht die Tochter vom Bürgermeister«, stellte Ioana fest.
»Ich weiß«, sagte Lila.
»Wenn du natürlich bei der Wahl mitmachen würdest …«
Die Mittsommerkönigin bekam eine Einladung zum Ferienkolleg der Universität in Kischinau. Ein Ticket, mit dem man beweisen konnte, dass man an die Akademie gehörte anstatt auf die Felder der Großeltern. Lila wusste, dass sie es schaffen würde, wenn sie die Chance bekam. Sie wusste natürlich ebenso, dass es keinen Sinn für sie hatte, an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen.
»Wenn es nicht klappt mit dem Studieren, gehen wir wohl in die Ukraine zum Arbeiten«, sagte Ioana. »Wie unsere Eltern. Und wenn wir Kinder bekommen, schicken wir sie hierher zurück, bis sie groß sind.«
»Der Kreislauf eines moldawischen Lebens«, sagte Lila und dachte an Bence. Ob Bence einen Ziegenbock heiraten würde? Und was hatte sie eigentlich zu verlieren, wenn sie doch mitmachte? Die Häme, wenn sie verlor, würde sie aushalten. Waren nicht gerade die Außenseiter diejenigen mit den besten Aussichten bei einem Wettbewerb, egal, wie er ausging? Lila dachte nach, über den Kreislauf des moldawischen Lebens und das Mittsommerfest.
»Glaubst du wirklich, mit dem Kleid hätte ich eine Chance?«, fragte Lila schließlich.
Ioana ließ sich ins Gras fallen und lachte: »Ich wusste es. Natürlich hast du eine Chance! Es ist ja nun nicht so, dass du wirklich aussiehst wie ein Ziegenbock. Du bist dünn, okay. Aber deine Zahnlücke ist süß. Ich finde, sie macht dich unverwechselbar.«
»Klar«, sagte Lila. Sie starrte in den Himmel und wünschte kurz, sie könnte mit den Wolken ziehen. Wenn sie Mathematik studieren könnte, würde sie in Kischinau leben. Vielleicht könnte sie für die Regierung arbeiten oder selbst unterrichten. Es wäre ein Leben mit einer eigenen Familie, und sie würde die Kinder nicht ihren Eltern überlassen müssen. Es war nicht gerecht, dass ein dämlicher Schönheitswettbewerb die Chancen auf ein Studium steigerte. Und nicht mal das war sicher, dachte Lila. Es war nur eine Legende. Wie die Sache mit dem Kleid.
»Übrigens kommt Radu zum Mittsommer.«
»Im Ernst?«, fragte Lila.
»Er hat gesagt, das lässt er sich nicht entgehen, wenn seine Cousine bei der Wahl antritt.«
»Wow«, sagte Lila.
»Hoffen wir nur, dass er die weite Reise nicht umsonst macht«, sagte Ioana.
Radu lebte im Westen, in Bukarest. Für die beiden Mädchen war das gleichbedeutend mit Amerika oder Berlin. Eine unerreichbare Welt, in der es angeblich keine Armut gab und wo die Eltern zusammen mit ihren Kindern lebten. Angeblich war Bukarest mehr als doppelt so groß wie Kischinau.
»Er muss uns davon erzählen«, sagte Lila.
»Ich bin sicher, dazu werden wir ihn nicht ermutigen müssen«, sagte Ioana.
»Ich kann das Kleid ja noch einmal anprobieren«, schlug Lila vor und versuchte, dabei so unbeteiligt wie möglich zu klingen.
Ioana sprang auf: »Endlich nimmst du Vernunft an, Lila! Ich flechte dir den Zopf. Wollen wir doch mal sehen, ob du dann nicht aussiehst wie eine echte Königin.«
Hand in Hand rannten Ioana und Lila über die Wiese, den Hügel hinunter zum Haus ihrer Großeltern.
KAPITEL 5
München, Deutschland
Donnerstag, 13. Juni 2013, 19.12 Uhr (zur gleichen Zeit)
Paul Regen hasste Regen. Vor allem wegen der Pfützen und der muffig-dampfenden Jacken nach seinen Spaziergängen. In München regnete es seit Wochen, was Paul gehörig auf die Laune schlug. Trotzdem war er zum Isarwerk II zu Fuß unterwegs, was ihm immerhin eine gute Stunde Diskussion mit der EDV erspart hatte. Er lief über den hölzernen Flauchersteg und winkte von oben den Kollegen zu, die sich bemühten, das improvisierte Zelt in der immer noch viel Wasser führenden Isar am Wegschwimmen zu hindern. Auf der anderen Flussseite stolperte er den Zubringer zum Radweg hinunter und dann über die Kiesbetten, auf denen in jedem anderen Juni die Sonnenanbeter gelegen hätten, bis zu der Stelle, wo sie den Arm gefunden hatten. Ein ganz und gar verschwendeter Sommer, dachte Paul Regen.
Am nördlichen Rand der südlichsten Isarinsel stand das Zelt der Kollegen, direkt unterhalb des Wehrs. Sie trugen Gummistiefel und die weißen Ballonanzüge mit Polizei-Schriftzug. Die Kriminaltechnik konnte sich einen guten Geschmack bei ihren Uniformen nicht leisten.
»Was habt ihr?«, fragte Paul und betrachtete seine Wanderschuhe, die sich bisher erfolgreich gegen die Nässe wehrten.
»Kriminalhauptkommissar Regen«, sagte der leitende Beamte, Peter Schmidt, »dich hab ich ja ewig nicht gesehen.«
Er machte Anstalten, ihn zu umarmen, hob dann aber entschuldigend die Hände.
»Ich verstehe schon, keine Zärtlichkeiten vor zwanzig Uhr«, sagte Paul Regen und grinste.
»Dass sie dich mal wieder rauslassen …«
»Ich bin häufiger an der frischen Luft als früher«, korrigierte Paul Regen. »Und ehrlich gesagt, hast du mir nicht gerade gefehlt.«
»Ich glaube dir kein Wort«, sagte Schmidt.
»Das macht nichts. Also, was ist nun mit dem Arm?« Paul Regen trat von einem Bein auf das andere, damit seine Socken trocken blieben.
»Kann ich dir zeigen. Ziemlich mysteriös das Ganze«, sagte Schmidt und stapfte zu seinem Zelt. Er kam mit einem dicken Plastikschlauch zurück, dessen Enden mit Kabelbindern zusammengehalten wurden.
Paul Regen nahm den Arm in die Hand und versuchte, durch das dicke Plastik ein paar Details zu erkennen. Genauer gesagt handelte es sich nicht um einen vollständigen Arm, sondern um einen Unterarm. Anhand der Behaarung ließ sich zumindest erkennen, dass es sich um ein männliches Exemplar handelte, und zwar ein ziemlich großes.
»Pranke mit Stumpf hätte es besser getroffen«, sagte Paul Regen. Schmidt nickte. »Außerdem ist er ziemlich nass«, sagte Paul Regen.
»Was einen nicht verwundern sollte«, sagte Schmidt.
»Was einen nicht verwundern sollte«, wiederholte Paul Regen mit einem Seitenblick auf den Fluss.
»Wusste ich, dass du das denkst«, sagte Schmidt, der stets einen Spaß daran fand, die Schreibtischtäter vom LKA vorzuführen. »Aber das ist kein Wasser.«
»Nein?«, fragte Paul Regen und betrachtete die dicken Tropfen auf der Innenseite des Beutels.
»Er war in einem schwarzen Müllbeutel eingewickelt, und darin war eine ganze Menge Chemie. Ich tippe auf Formalin, kann ich aber noch nicht beschwören.«
»Er war konserviert«, stellte Paul Regen fest.
Schmidt nickte: »Und vermutlich vergraben. Die Flut hat ihn aufgespült und bis hierher getrieben. Was machst du eigentlich hier?«
Eine durchaus berechtigte Frage des Kollegen Schmidt, denn Paul Regen arbeitete ja nunmehr bei den Vampiren der EDV.
»Der Arm wird ein Modellprojekt für den neuen Erkennungsdienst digital«, sagte Paul Regen wahrheitsgemäß. Er fügte nicht hinzu, dass er eine Ahnung hatte, was den Arm und das Schicksal von Kriminalhauptkommissar Paul Regen betraf. Wenn er es richtig anstellte, könnte so ein Arm sogar seine Karriere retten. Und die von Adelheid Auch gleich mit.
»Wie alt ist das Ding eigentlich?«, fragte Paul Regen.
»Kann ich nicht sagen. Vielleicht Jahre. Das ist ja nun mal der Sinn von einer Konservierung, oder?«
Paul Regen musste das zugeben. Trotzdem wurde er nicht daraus schlau. Wer konserviert einen Arm und vergräbt ihn dann in einer Plastiktüte? Und vor allem: warum? War der Arm aus einem pathologischen Institut gestohlen worden? War es ein besonders pietätloser Studentenstreich? Paul Regen beschlich eine Ahnung, warum der Wochinger ausgerechnet diesen Fall als Prüfstein für ihr neues Computersystem ausgesucht hatte. Bei einem alten Arm, zudem noch einem von einem Baum von einem Mann, gab es kaum etwas zu gewinnen, aber eine Menge zu verlieren. Es würde nahezu unmöglich sein, den Fall aufzuklären, und das wusste natürlich auch sein Chef. Paul störte es nicht, insbesondere, da er spürte, dass hier mehr dahinter steckte. Irgendetwas stimmte mit dem Arm in seiner Hand nicht.
»Es war nur der Arm, oder?«
Schmidt nickte.
»Hast du dir den Stumpf näher angeschaut?« Eine rhetorische Frage.
Schmidt nickte erneut: »Auf den ersten Blick ein ziemlich sauberer Schnitt. Vielleicht sogar ein professioneller.«
Paul Regen fand, dass sie Fortschritte machten. Vorbehaltlich der gerichtsmedizinischen Untersuchung handelte es sich bei seinem Arm also um einen amputierten Unterarm, der zunächst konserviert und dann an der Isar vergraben wurde. Hätte es den Regen nicht gegeben, wäre Regen das alles erspart geblieben. Dann hätte es kein Hochwasser gegeben, und statt des Arms lägen hier die nackerten Grillfreunde im Kies. Paul Regen dachte nach und beschloss, den Regen als Chance zu betrachten. In seiner Situation gab es davon nicht mehr viele. Er zückte sein Handy und wählte die Nummer von Adelheid Auch. Es galt, einige Termine zu verschieben.
KAPITEL 6
Amsterdam, Niederlande
Donnerstag, 13. Juni 2013, 19.28 Uhr (zur gleichen Zeit)
Auf dem Spaklerweg rasten die Spritzenwagen der Brandweer und die Einsatzfahrzeuge der Polizei keinen halben Meter von ihrem Lenker an Solveigh vorbei, die Kakofonie ihrer Sirenen unterstrich das Ausmaß der Katastrophe. Über ihrem Kopf kreiste der Hubschrauber von rtl 4 und sendete die Livebilder in die warmen Wohnzimmer der Schaulustigen. Sie trat in die Pedale, und das Tempo trieb ihr den Nieselregen ins Gesicht. Je näher sie der Zentrale kam, desto beißender wurde der Geruch von verbranntem Zellstoff und geschmolzenem Plastik. Sie bremste hinter einem Einsatzwagen der Feuerwehr und warf ihr Rad gegen die Bushaltestelle, die dem unscheinbaren Bürogebäude gegenüberlag, das sein Innerstes bis heute erfolgreich gehütet hatte. Eine Mimese zur Tarnung, wie die lebenden Steine, eine Pflanzengattung, die von den Steinen in ihrer Umgebung nicht zu unterscheiden war. Eines der bestgehüteten Geheimnisse der Europäischen Union, die grenzübergreifend agierende Sondereinheit des Europäischen Rats. Angestellte, die aussahen wie die Mitarbeiter einer Rechtsanwaltskanzlei in einem Büro, das aussah wie das einer Steuerberatungsgesellschaft. Ein Stein unter vielen. Ihre Nachbarn lieferten keinen Grund für einen Sprengstoffanschlag. Jemand musste ihre Taktik durchschaut haben. Jemand musste erkannt haben, dass es sich bei diesem Stein nicht um einen Stein handelte. Für Solveigh gab es keinen Zweifel, dass der Anschlag der ECSB gegolten hatte.
Solveigh rannte auf das Gebäude zu, mitten hinein in das Chaos. Notärzte ordneten die Verletzten nach der Triage für Rettungseinsätze mit vielen Opfern in drei Gruppen: Schwerverletzte ohne Überlebenschance, Schwerverletzte mit Überlebenschance und den Rest. Die Tragen waren für die zweite Gruppe reserviert. Solveigh sah mindestens zwanzig von ihnen, seitlich aufgereiht auf dem Platz vor dem Gebäude. Die Fensterscheiben des zweiten Stocks waren geborsten, die Splitter des Sicherheitsglases funkelten wie Diamanten auf dem Pflaster zwischen den Tragen und den Menschen, die noch sitzen oder stehen konnten. Viele husteten vom stark beißenden Geruch der Chemikalien. Es musste eine ganze Menge Sprengstoff gewesen sein. Solveigh suchte die Reihen nach ihren Leuten ab. Sie entdeckte eine Gruppe von Analysten, die aber alle nicht schwer verletzt schienen. Als sie bei den Tragen angekommen war, bemerkte sie einen ihrer Kollegen, einen Agenten im Außendienst: Pollux. Er sah schlechter aus als die anderen, aber er hatte sich schon wieder aufgesetzt. Ein dünnes Rinnsal Blut tropfte von seiner Nase auf das blaue Hemd.
»Was ist passiert, Pollux?«
»Es war eine Bombe neben Wills Büro. Keine Ahnung, woher die wussten, wo sein Schreibtisch steht, aber die Platzierung kann kein Zufall sein.«
»Neben Wills Büro? Wo ist er? Ist ihm etwas passiert? Und wo ist Eddy? Habt ihr Eddy gesehen?«
»Keine Ahnung, wo Eddy ist. Ich glaube, Will fahren sie gerade weg. Er war bei der zweiten Gruppe.«
Er deutete auf fünf Krankenwagen, die nebeneinanderstanden und mit offenem Heck auf die eiligsten Fälle warteten. Pollux musste Solveigh nicht sagen, was es hieß, zur zweiten Gruppe einer Triage zu gehören. Will war nach Einschätzung der Notärzte schwer verletzt. Solveigh rannte los, quer über den Platz. Sie sprang über prall gefüllte Schläuche, die Wasser ins Innere des Gebäudes pumpten, um die Schwelbrände zu löschen, die noch in den Verkabelungen saßen. Sie erkannte ihren Chef von Weitem. Sein Kopf war mit einer Zervikalstütze fixiert und sein graues Haar blutverkrustet. Ein Sanitäter schob die Trage gegen das Heck des Krankenwagens, und das Gestell klappte bereits ein, als Solveigh ihn zurückhielt.
»Warten Sie einen Moment, wenn er nicht gerade stirbt, okay?«
Der Sanitäter sah nicht ein, warum er ihrer Bitte nachkommen sollte, und schob die Trage ins Innere des Wagens.
»Ist schon gut«, sagte eine erschreckend schwache Stimme von der Trage. Der Sanitäter hielt inne. Solveigh kletterte auf das Trittbrett des Krankenwagens und zog sich zu Will hoch.
»O mein Gott, Will«, flüsterte Solveigh.
»Es ist nicht so wild«, sagte er. Sein Husten bei seinen ersten Worten strafte ihn Lügen.
»Haben wir eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?«, fragte Solveigh.
Will Thater schüttelte den Kopf: »Schön, dich wohlbehalten zu sehen, Slang.«
»Wo ist Eddy? War Eddy auch im Büro?« Eddy war immer im Büro. Wenn er nicht in seiner Bodega war und sich betrank. Und er ging nicht ans Telefon. Sein Smartphone legte er selbst mit 1,5 Promille nicht zur Seite.
»Hab ihn nicht gesehen, Slang. Tut mir leid.«
»Was sollen wir jetzt machen, Will? Der Evakuierungsplan wurde aktiviert.«
»Scheiß auf das Standardprotokoll«, sagte Will Thater, »das hier riecht nach einem Maulwurf. Es gibt eine Akte für solche Fälle in meinem Büro.« Wieder wurde er von einem starken Hustenanfall unterbrochen. »Besorg diese Akte, Slang, sie liegt in meinem Safe. Oder lag zumindest dort.«
»Ginge das etwas genauer?«, fragte Solveigh nach einem Blick auf das Gebäude. Es sah aus, als könnte es jeden Moment einstürzen. Was war das für ein Zeug, das die hier verwendet hatten? Solveigh kannte sich mit den Sprengstoffen C4 und Semtex aus. Das hier war nichts von beidem.
»Auf dem Ordner steht ›ELMSFEUER‹«, röchelte Will. »Es enthält genaue Anweisungen für den Fall eines Verräters bei der ECSB. Ich brauche diese Akte, Slang.«
»Gibt es denn keine Kopie?«, fragte Solveigh.
Will Thater versuchte, den Kopf zu schütteln, aber die Cervixstütze hielt sein Genick eisern umklammert.
»Es war doch vollkommen undenkbar, dass es gleichzeitig einen Anschlag und einen Verräter in den eigenen Reihen gibt. Jedes der beiden für sich genommen hätte ich ausgeschlossen.«
»Und seit dem Stuxnetvirus vertraust du nicht einmal mehr unseren Computern, oder wie darf ich das verstehen?«, fragte Slang empört.
Will warf ihr einen bösen Blick zu: »Frag mal Eddy, wie überzeugt er von der Sicherheit unserer Netzwerke ist. Die Amerikaner kommen überall rein, sagt er. Und wenn der Maulwurf nun von der CIA eingeschleust wurde? Papier ist das Neueste in Sachen Vertraulichkeit, Solveigh.«
Solveigh hob abwehrend die Hände: »Schon gut. Die Kombination für den Safe?«
Will Thater gab sie ihr. Der Sanitäter hinter Solveigh ließ sich nicht länger davon abhalten, seinen Patienten ins Krankenhaus zu fahren. Sie sah, wie Wills Gesicht zwischen den Geräten verschwand.
»Besorg mir die Totenliste, Slang!«, hörte sie ihn noch rufen. »Und meldet euch nur bei mir. Vertraue niemandem! Hörst du? Nur bei mir persönlich!« Dann wurden die beiden Türen von innen zugezogen.
Tote? Davon hatte niemand etwas gesagt. Sie sprang von dem Trittbrett, nicht ohne eine Hand auf die Hecktür des Wagens zu legen mit einem stillen Stoßgebet für Wills Gesundheit. Und Eddys.
Solveigh lief durch die Reihen mit den leichter Verletzten in Richtung des zerstörten Hochhauses und hegte die leise Hoffnung, zwischen den vielen Menschen einen Rollstuhl zu entdecken und festzustellen, dass sie Eddy aus dem Gebäude geschoben hatten, ohne dass er sein Handy mitnehmen konnte. Aber da war kein Rollstuhl. Auch auf den verbliebenen Tragen konnte sie ihn nicht entdecken. ELMSFEUER, dachte Solveigh. Sie hätte niemals gedacht, dass Will einen Plan haben könnte, gegen seine eigenen Leute vorzugehen. War es sicher, die Akte zu bergen? Oder könnte das Gebäude tatsächlich einstürzen? Offene Brandherde waren zumindest nicht mehr zu erkennen.
Als sie an einem Mannschaftswagen der Feuerwehr vorbeilief, dessen Seitentür offen stand, griff sie nach einer Feuerwehrjacke und einem Helm. Im Gehen schlüpfte sie in den schweren Mantel und zog den Helm mit dem Plexiglasvisier über den Kopf. Niemand beachtete sie. Wer wäre auch verrückt genug, ein brennendes Gebäude zu betreten? Offenbar sie selbst. Und das nur, um ein Stück Papier zu bergen, das so vertraulich war, dass ihr Chef es keinem Computer anvertrauen wollte. Die Ärmel der Jacke reichten weit über ihre Handflächen, und der Helm schlackerte auf ihrem Kopf, aber für den ersten Teil ihres Wegs würde es reichen müssen. Rettungskräfte mit Atemschutzmasken kamen ihr entgegen, sie war die Einzige, die in Richtung Gebäude unterwegs war. Solveigh hielt den Kopf gesenkt, damit sie niemand als Fremde identifizieren konnte. Zwei Minuten später betrat sie die Lobby im Erdgeschoss.
Das Wasser tropfte aus den oberen Etagen durch die Decke auf den ehemaligen Empfangstresen. Der Strom war im ganzen Gebäude zusammengebrochen oder abgestellt worden, auch die Fahrstühle funktionierten erwartungsgemäß nicht. Solveigh drückte die Tür zum Treppenhaus auf. Auf dem Weg in den zweiten Stock kam ihr nur noch ein Brandschutzteam entgegen. Offenbar war das Schlimmste überstanden. Bis heute war ihr Büro vom Treppenhaus nicht zugänglich gewesen, der einzige Weg in die Räume der ECSB hatte über die Büros der Loude IT Services im Stockwerk darüber geführt. Die Tarnfirma war mit der Explosion hinfällig geworden, die Feuerschutztüren hatten sich automatisch entriegelt und standen sperrangelweit offen. Solveigh zog sich den Helm vom Kopf. Die weiß verschalten Gänge ihrer Zentrale waren rußgeschwärzt, überall lagen umgekippte Tische und Stühle, darunter begraben Computer und Bildschirme. Wenn sie nicht von der Druckwelle der Explosion umgerissen worden waren, hätten die sechs Bar, mit dem die Spritzen der Feuerwehr das Löschwasser ins Gebäude gepumpt hatten, den Rest besorgt. Jetzt lag eine gespenstische Stille in den Gängen, die Solveigh so vertraut vorkamen. Und doch war nichts mehr, was es gestern noch gewesen war. Solveighs Schritte patschten in den tiefen Pfützen, als sie durch den Gang in Richtung von Wills Büro lief. Je näher sie dem Explosionsherd kam, desto deutlicher wurde der eigentümliche Geruch nach Marzipan. Nur ein Hauch lag davon in der Luft, aber für ihre feine Nase deutlich wahrnehmbar. Es gab keine andere Erklärung, als dass er von der Explosion herrühren musste, mit jedem Schritt wurde er intensiver. Und keine zwanzig Meter vor ihr lag ihr eigenes Büro, das sie sich mit Eddy teilte, nur zwei Gänge vom Epizentrum entfernt. Sehr nah dran. Solveigh schluckte, als sie die geborstene Tür erblickte. Was erwartete sie? Lag Eddys Rollstuhl umgekippt auf dem Boden? Die Feuerwehrleute hätten ihn doch niemals liegen gelassen, oder? Die Angst um ihren besten Freund spielte ihr einen Streich. Natürlich nicht. Sie schluckte, als sie im Türrahmen stand. Das Regal hinter ihrem Schreibtisch war nach vorne gekippt, der Bilderrahmen mit dem Foto ihrer Mutter lag zerborsten auf dem Boden. Aber keine Spur von Eddy. Solveigh ging in die Knie, fischte das Bild aus den Scherben und trocknete es an ihrer Hose. Dann hörte sie ein Geräusch. Schritte, die sich langsam und vorsichtig durch das zentimeterhohe Löschwasser tasteten. Zu vorsichtig. Kein Mitglied der Rettungstrupps würde sich so leise fortbewegen. Dazu hätten sie keinen Grund. Solveigh steckte das Foto in die Hosentasche und schälte sich aus der Feuerwehrjacke. Der schwere Stoff mit den Leuchtstreifen am Rücken und den Armen knisterte, wenn man ihn knickte. Solveigh legte sie mit dem Innenfutter nach oben über den Fuß eines umgekippten Schreibtischstuhls. Dann zog sie ihre Glock aus dem Schulterholster und drückte sich gegen das, was von der Wand ihres Büros übrig geblieben war, und lauschte. Die Schritte kamen aus der Richtung, in der Wills Büro lag. Wusste noch jemand von ELMSFEUER? Und wenn ja, was hatte das zu bedeuten? Solveigh atmete ein und hob die Jericho mit beiden Händen. Dann schlich sie in den Flur.
KAPITEL 7
Veiros, Portugal
Donnerstag, 13. Juni 2013, 19.31 Uhr (zur gleichen Zeit)
Er stellte sich mitten zwischen die Menschen und beobachtete. Er sah den Mann in dem dunklen Gewand, der durch die Menge schritt, als stünde er über den Menschen. Wie jeden Tag. Der ewige Gang. Er betrachtete die Frau mit den ausgeprägten Wangenknochen, die abgewandt in der dunklen Ecke vor dem Lokal stand und die niemanden beachten wollte, als ginge sie die Schlacht des Lebens gar nichts an. Er beobachtete, wie ihr die Abendsonne bis kurz vor die Füße fiel und sie doch nicht berührte. Ihr Haar hing ihr seitlich ins Gesicht und zerschnitt die Linienführung ihrer Lippen, zum stummen Gebet gepresst. »Herr, ich habe zu dir gehalten, bin immer standhaft gewesen.« Er faltete den kleinen Klappstuhl auf und begann zu zeichnen. Als die Sonne längst verschwunden war und der Moment verflossen, saß er immer noch auf seinem Hocker und zeichnete die Erinnerung, den perfekten Moment, das perfekte Bild, die perfekte Szene. Noch als es Nacht wurde und ein kalter Zug um seine nackten Beine wehte, spürte er das Kratzen des Bleistifts auf dem rauen Papier. Er musste noch eine zweite Zeichnung anfertigen. Das Spiegelbild der ersten. Und doch eine ganz andere. Er wartete auf den Mond. Und dann sah er den leeren Platz, und es formte sich eine Szene. Eine Haltung. Er begann mit einer groben Skizze. Wie kniete das Spiegelbild der standhaften Frau? Der Stift kratzte ein Bein, aufgestellt zum Schwur. Ein zweites, dann ihre Hände über dem Knauf des Schwerts gefaltet. Ihr Blick nach oben gerichtet, zu ihrem Herrn. Ein Gesichtsausdruck entstand auf einem zweiten Blatt. Flehende Augen, ein Moment der Schwäche oder der Bewunderung. Es war wichtig, dass dieser Unterschied später nicht zu deuten war. Es war wichtig, wie jedes Detail wichtig war. Jeder Ring an ihren Fingern, jede Wimper ihrer Augen, jede Ader auf ihren Händen. Alles war wichtig, nichts durfte dem Zufall überlassen werden. Es gab keine Alternative. Nicht für ihn. Sondern für die Menschheit. Niemand wusste, wie wichtig es war, dass er ihren Gesichtsausdruck richtig hinbekam. Nur in der Perfektion lag die Unsterblichkeit. Erst nach Stunden erhob er sich, seine Glieder waren steif, seine Beine schmerzten. Aber er hatte eine Vorstellung davon, wie es werden könnte. Morgen Abend würde er wiederkommen und warten, bis sich die Frau mit den ausgeprägten Wangenknochen und die Sonne beinah trafen, wie jeden Tag. Er würde ihren Gesichtsausdruck bewundern und dann an ihrem Gegenstück arbeiten. Die ganze Nacht, bis zum nächsten Morgen. Wie oft würde er sie noch malen müssen? Wie lange würde er mit einem Bild vorliebnehmen müssen? Es war kein adäquater Ersatz. Eher ein Vorspiel. Das Vollkommene braucht Zeit, ermahnte er sich. Dann ging er nach Hause, stellte Teewasser auf den Ofen und holte Käse und Oliven aus dem Kühlschrank.
KAPITEL 8
Amsterdam, Niederlande
Donnerstag, 13. Juni 2013, 20.12 Uhr (zur gleichen Zeit)
Solveigh schob langsam einen Fuß vor den anderen. Es war ein Ding der Unmöglichkeit, sich im stehenden Wasser fortzubewegen, ohne ein Geräusch zu verursachen. Einzig das Kreisen des Hubschraubers über dem Gebäude und die Aufräumarbeiten zwei Stockwerke unter ihr verschafften ihr alle paar Sekunden ein kurzes Zeitfenster für eine schnelle Bewegung. Kurz bevor sie Wills Büro erreichte, hielt sie noch einmal inne und lauschte. Sie hatte keine Schritte mehr gehört. Stattdessen vernahm sie ein metallisches Kratzen. Jemand versuchte, eine Schranktür zu öffnen. Oder etwas Ähnliches. Oh, Eddy, ich bin es nicht gewohnt, so etwas alleine machen zu müssen, flehte sie, obwohl sie wusste, dass sie nicht mit seiner Unterstützung rechnen konnte. Wo zum Teufel war der Mistkerl? Solveigh hielt die Luft an und schwang ihre Pistole um die Ecke in den Gang vor Wills ehemaligem Büro. Der Gang existierte nicht mehr, die Explosion hatte die Wände zu beiden Seiten fast vollständig zerstört. Der Lauf ihrer Waffe streifte die Löcher in den Wänden, Schwaden von Staub und Rauch hingen immer noch in der Luft. Aber der Verursacher der Geräusche war nirgends zu erkennen. Solveigh stieg über Metallstreben und Betonbrocken, die Jericho weiter im Anschlag. Das Kratzen wurde lauter. Es kam aus dem Nachbarzimmer. Hinter ihr. Solveigh fuhr erschrocken herum, aber ihr Fuß fand keinen Halt. Ihr Schuh platschte ins Wasser. Viel zu laut, Solveigh. Sie hielt inne und wartete auf eine Reaktion des Unbekannten. Das Kratzen hatte aufgehört. Keine Sekunde nach ihrem Abrutschen. Solveigh gab ihre Vorsicht auf und lief den Gang hinunter. Es hatte keinen Sinn, darauf zu hoffen, dass ihr Gegner sie unterschätzte. Initiative war bedeutend mehr wert in dieser Situation. Die Wand zum Nebenzimmer war intakt geblieben, ebenso wie die Tür. Offenbar hatte die Bombe einen Großteil ihrer Sprengkraft in die andere Richtung abgegeben. Solveigh hörte Schritte hinter der Wand. Sie drückte die Klinke nach unten und stieß die Tür mit dem Fuß auf. Eine dunkle Gestalt mit einer Sturmhaube auf dem Kopf kletterte über die Reste der Rückwand zu Wills Büro. Die Bombe hatte sie beinah komplett eingerissen.
»Stehen bleiben!«, rief Solveigh.
Die Gestalt machte keine Anstalten, sich zu ergeben. Solveigh feuerte einen Warnschuss in die Luft und riss sofort wieder beide Arme nach vorne, um sie ins Visier zu nehmen. Die Gestalt bewegte sich ohne Angst, was sehr ungewöhnlich war. Sie war zu breitschultrig für eine Frau. Der Mann mit der Maske hatte die Figur eines Kraftsportlers, und doch wirkten seine Schritte federleicht. Ein Boxer vielleicht. Zumindest ein Profi, der nicht zum ersten Mal unter Beschuss stand. In diesem Moment ertönte der typische Dreiklang für den Eingang einer SMS. Ihr Handy.
»Scheiße!«, fluchte sie, als sie bemerkte, dass dem Mann eine halbe Sekunde Ablenkung gereicht hatte, um hinter dem Schutthaufen zu verschwinden. Solveigh ignorierte das Handy und rannte zurück in den Flur. Sie hörte seine schnellen Schritte im Wasser und sah seinen Rücken, vielleicht zehn, zwölf Meter von ihr entfernt. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist es nicht leicht, mit einer kurzläufigen Waffe einen rennenden Menschen zu treffen, vor allem, wenn man die Beine treffen muss. Solveigh legte an und zielte auf seinen Rücken. Erst im letzten Moment senkte sie den Lauf und feuerte zweimal auf seine Kniescheiben. Und verfehlte. Die dunkle Gestalt verschwand hinter einer Ecke.
Was hatte das zu bedeuten?, fragte sich Solveigh. Wusste noch jemand von dem geheimen Plan? Wer könnte von ELMSFEUER wissen? Der Maulwurf selbst? Oder die Leute, die den Anschlag geplant hatten? Heute würde sie es nicht mehr herausfinden. Solveigh zog ihr Handy aus der Tasche und las die SMS:
»Bin am Evakuierungspunkt Leidseplein. Wo bist du?«
Eddy. Solveigh fluchte. Und war froh, dass er lebte. Sie hoffte für ihn, dass er eine gute Erklärung für sein Verschwinden hatte. Sie tippte eine Antwort: »Komme, warte auf mich.«
Dann steckte sie die Jericho in ihr Holster und lief zurück in das Büro. Der Mann hatte vor Wills Safe gehockt, als sie ihn überrascht hatte. Der Safe lag zwischen dem Schutt in der Mitte des Nebenzimmers. Die Wucht der Explosion musste ihn mitsamt der halben Wand herausgesprengt haben. Aber er wirkte intakt und lag glücklicherweise mit der Tür nach oben. Solveigh stellte die Kombination ein und drehte an dem dreiarmigen Griff. Sie hörte, wie sich die Bolzen im Inneren bewegten. Er ließ sich tatsächlich noch öffnen. Sie brauchte drei Anläufe, bis es ihr gelang, die Tür über ihren Schwerpunkt zu ziehen. Das schwere Metall krachte auf den Schutt und wirbelte trotz der Nässe eine Staubwolke auf. Solveigh hustete, als sie den Inhalt des Safes durchsuchte. Die Akten lagen durcheinander auf der Rückseite. Solveigh wühlte sich durch die Seiten, bis sie den roten Umschlag entdeckte.
»ELMSFEUER«, stand in Wills krakeliger Schrift auf der Außenseite. Er war säuberlich verklebt. Hab ich dich, dachte sie, während sie in den Trümmern nach einer brauchbaren Metallstrebe suchte, mit der sie die Tür des Tresors wieder zustemmen konnte. In ihrem Büro steckte sie den Umschlag unter die durchnässte Feuerwehrjacke und machte sich auf den Weg zum Evakuierungspunkt. Dem Spanier, wie sie Eddy manchmal nannte, würde sie etwas erzählen, wenn sie ihn in die Finger bekam.
Eine Viertelstunde später stieg Solveigh am Leidseplein aus einem Taxi. Etwa zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ECSB standen ganz und gar nicht konspirativ in dem kleinen Park und warteten darauf, dass sie jemand abholte oder ihnen weitere Instruktionen gab. Auch die ECSB war vor Pannen nicht gefeit, dachte Solveigh. Wie fast alle Evakuierungspläne, auch die des Katastrophenschutzes, stießen sie in der realen Welt auf unüberbrückbare Hindernisse. Bei einem ihrer Aufträge vor einem halben Jahr hatte die deutsche Regierung beispielsweise festgestellt, dass bei einem atomaren Zwischenfall im AKW Neckarwestheim zweihundert Busse am Heidelberger Hauptbahnhof auf sechstausend Bürger warten sollten – auf der entsprechenden Vorfahrt fanden aber nur vier Busse Platz. Evakuierungspläne wurden eben meist mit dem Wohlwollen verfasst, dass man sie nicht brauchen würde, wusste Solveigh. Sie sah Eddy schon von Weitem in seinem Rollstuhl inmitten der Kollegen. Solveigh nickte dem einen oder anderen zu, als sie durch die Reihen ging. Und doch war einer von ihnen möglicherweise der Verräter. Und verantwortlich für den Tod von mehreren Menschen. Sie konnte sich von keinem der Anwesenden vorstellen, dass er oder sie es sein könnte. Aber das konnte man nie, wusste sie. Ein ebenso ungeschriebenes Gesetz wie die Fehlbarkeit eines jeden noch so guten Plans. Sie begrüßte Eddy kühler, als sie es gewohnt waren. Und sie fragte ihn nicht, wo er gewesen war. Das würden sie unter vier Augen besprechen.
»Lass uns hier verschwinden«, sagte Solveigh und legte ihre Hände auf die Griffe seines Rollstuhls. Eddy kurbelte und drehte sich geschickt von ihr weg.
»Nicht so schnell«, sagte Eddy. »Ich will erst wissen, was los ist.«
»Später«, sagte Solveigh, packte ihn von hinten und schob ihn durch die kleine Versammlung in Richtung Leidseplein.
»Es ist viel komplizierter, als du denkst«, sagte sie, als sie außer Hörweite der anderen waren. »Will setzt einen Plan mit dem Namen ›ELMSFEUER‹ in Kraft, was auch immer das heißen soll.«
»ELMSFEUER?«, fragte Eddy. »Verdammt noch mal, Slang, jetzt sag mir endlich, was los ist!«
»Nicht jetzt, Eddy«, sagte Solveigh. »Wo warst du überhaupt?«
»Herrgott noch mal, Slang! Darf man denn nicht einmal fünf Minuten seine Privatsphäre genießen?«
Solveigh hörte ihn kaum noch. Ihr Blick war fest auf den Leidseplein gerichtet. Etwas hatte ihren Instinkt geweckt. Ein Auto.
»Weißt du, ob es ein Unfall war? Und ob es welche von unseren Leuten erwischt hat?«, fragte Eddy, während er wild auf seinem Handy herumtippte. »In den Nachrichten sagen sie nur etwas von vielen Schwerverletzten.«
Ein Van. Schwarz. Am Steuer ein Mann in Schwarz. Genau wie der in Wills Büro. Und der Fahrer trug eine Sturmhaube.
»Jetzt red endlich mit mir, Slang!«, forderte Eddy sie auf. »Ist Will etwas passiert? Wie geht es den anderen? Was ist mit Pollux und Maria? Was hat es mit der Evakuierung auf sich?«
Es gab nur eine Erklärung: Es war noch nicht vorbei. Solveigh versetzte Eddys Rollstuhl einen Tritt gegen die Lehne. Er rollte über den Rasen in Richtung einer Bank.
»Runter!«, schrie Solveigh, so laut sie konnte. Sie beobachtete, wie die Seitentür des Vans geöffnet wurde. Eddy hatte seinen Rollstuhl umgekippt und lag flach auf dem Boden, so sicher es in dieser Situation möglich war.
»Runter!«, schrie sie noch einmal. Nur wenige ihrer Kollegen reagierten. Von den zweihundert Agenten der ECSB arbeitete der weitaus größte Teil in der Zentrale, nur etwa vierzig von ihnen waren an der Waffe geschult wie Solveigh. Einige legten sich auf den Boden, ein Kollege zog eine Pistole. Aus dem Lieferwagen ragten die Gewehrläufe von automatischen Waffen. Sie waren hoffnungslos unterlegen. Nicht nur, dass sie in dem Park standen wie auf dem Präsentierteller, auch was die Feuerkraft anging, würden sie mit ihren Pistolen einen fahrenden, bis an die Zähne bewaffneten Van nicht aufhalten können. Solveigh schwante, dass der Evakuierungsplan für einen Brand in der Zentrale geschrieben worden war und nicht etwa für einen Terroranschlag mit dem Ziel, die ECSB zu vernichten. Solveigh feuerte zwei Schüsse ab, bevor die Maschinengewehre losratterten. Sie ging hinter einem Baum in Deckung und beobachtete, wie die Salven die Leiber ihrer Kollegen in die Luft rissen. Auf der Bluse einer jungen Dolmetscherin, die Solveigh gut kannte, bildeten sich rote Blutflecken, die rasch größer wurden. Sie kippte nach hinten, ihre Augen vor Entsetzen geweitet. Es war ein Massaker. Nichts anderes als ein verdammtes Massaker. Als der Van mit quietschenden Reifen die Stadhouderskade hinunter verschwand, rannte Solveigh hinter ihm her und feuerte ihr Magazin leer. Sinnlos. Dann lief sie zu der jungen Frau, um ihr zu helfen. Aber Solveigh starrte in ein lebloses Augenpaar. Beim nächsten Opfer das gleiche Bild. Sie wählte die Nummer des Notrufs. Sie konnten doch unmöglich alle tot sein! Einige hatten mit Sicherheit überlebt und brauchten Hilfe. Als sie in das nächste leblose Gesicht blickte, tropften ihre Tränen auf die erkaltende Haut. Dann hörte sie ein Stöhnen. Also gab es doch Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, erinnerte sich Solveigh an einen Leitsatz ihres Vaters. Er war ein Zyniker gewesen, den sie nie besonders gemocht hatte. Er hatte es negativ gemeint, aber er hatte trotzdem recht behalten. Jemand versuchte, die ECSB auszulöschen. Gänzlich. Aber sie war noch da. Und Will Thater hatte auch überlebt. Es braucht nicht viele Menschen, um die Welt zu verändern. Nur einen, der damit anfängt.
KAPITEL 9
Iliciovca, Moldawien
Freitag, 14. Juni 2013, 13.36 Uhr (am nächsten Tag)
Lila trug den Nagellack an der rechten Hand zum dritten Mal auf.
»Lass mich das machen«, sagte Ioana und entfernte die Farbreste mit Alkohol und einem Lappen. »Ist ja nicht gerade so, dass wir viel davon haben.«
»Entschuldige«, sagte Lila.
»Ich weiß gar nicht, was du hast«, sagte Ioana. »Das wird sicher lustig. Und außerdem kommen doch nur Leute, die wir kennen.«
»Und Radu«, fügte Lila hinzu.
»Du kennst ihn doch gar nicht«, sagte Ioana. »Und ich übrigens auch nicht. Also kaum. Ich habe ihn vielleicht sechsmal gesehen bei den Familienfesten. Früher.«
»Und, sieht er gut aus?«
Ioana seufzte und griff nach dem roten Nagellack. Sie hielt ihn skeptisch gegen die Lampe über dem Esstisch von Lilas Großeltern: »Wie oft hast du mich das schon gefragt, seit du weißt, dass er kommt? Neun Mal?«
»Vergiss es einfach«, sagte Lila und hielt ihr die Hand hin. Sie konnte es immer noch nicht glauben, dass sie sich wirklich darauf eingelassen hatte. Das Mittsommerfest, das im Gegensatz zu den nordischen Ländern schon einen Monat früher und an wechselnden Wochenenden gefeiert wurde, war das wichtigste gesellschaftliche Ereignis des Jahres in Iliciovca. Zwei Tage dauerten die Festivitäten, und die Wahl zur Königin war der Höhepunkt am Samstagabend.
»Hier, probier, ob es passt«, stolperte ihre Großmutter in den Raum. Sie hatte die traditionelle Tracht von ihrer Mutter für Lila umgenäht, da ihr das Kleid viel zu groß war. Bei der Wahl zur Mittsommerkönigin des Ortes wurden zwei Outfits erwartet. Zuerst das traditionelle, zu dem die Mädchen Blumen im Haar trugen und mit dem alle Teilnehmerinnen in das Gemeindezentrum einziehen würden, und ein zweites für das Finale. Falls sie es tatsächlich bis dahin schaffte, würde sie das neue tragen. Das sie zu einer Königin machen würde, wenn die Prophezeiung der Alten aus Drochia stimmte.
»Danke, Bunică«, sagte Lila und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Dabei lächelte die alte Frau wie ein Kind.
»Mach dir keine Sorgen, Lila, du wirst toll aussehen morgen«, sagte sie, nicht ohne hinzuzufügen: »Und du natürlich auch, Ioana.« An ihr war eine Diplomatin verloren gegangen.
KAPITEL 10
Amsterdam, Niederlande
Freitag, 14. Juni 2013, 14.04 Uhr (zur gleichen Zeit)
Solveigh Lang fühlte sich elend. Elend, weil sie das Schicksal ihrer Kollegen in die Hände der Rettungskräfte gelegt und die Flucht ergriffen hatte. Elend von dem metallischen Geruch von Blut und dem Tod so vieler Menschen, die sie gekannt hatte. Und noch mehr, die sie besser hätte kennen sollen. Ihre Hände zitterten leicht von dem Schlafmangel einer durchwachten Nacht in einer billigen Pension und von den Gesprächen mit Eddy über das, was passiert war. Und das, was sie nicht fassen konnten: dass jemand versuchte, sie alle umzubringen. Das Ziel der Anschläge war es nicht, die ECSB aufzuhalten. Spätestens seit dem Attentat auf den Evakuierungspunkt war klar, dass es ihrem Gegner darum ging, sie vollständig zu vernichten.
In dem Elektronikmarkt schob Eddy seinen Rollstuhl vor das Regal mit den Prepaidhandys und zog ein Paket nach dem anderen von den Metallhaken. Er reichte sie Solveigh über seine Schulter, und sie packte die Geräte in den Einkaufswagen, den sie vor sich herschob. In der Computerabteilung besorgte Eddy Ersatz für ihre Laptops, die bei dem Feuer zerstört worden waren und die sie aus Sicherheitsgründen wohl ohnehin verschrottet hätten. Solveigh hatte für diesen Einkauf ihre sämtlichen Ersparnisse geplündert, auf ihrem Konto herrschte jetzt gähnende Leere. Aber nach dem Angriff auf die ECSB hatte sie es nicht riskieren wollen, ihre Kreditkarte zu verwenden. Bargeldloses Bezahlen war in etwa so riskant wie Telefonieren, wenn man von der Bildfläche verschwinden wollte. Noch immer trug sie den ELMSFEUER-Umschlag in ihrer Handtasche bei sich. Sobald sie sich mit neuen Handys versorgt hatten, konnte sie es riskieren, Kontakt zu Will Thater aufzunehmen.
Eine Dreiviertelstunde später saßen Solveigh und Eddy in der hintersten Ecke eines Cafés am Nieuwmarkt und schoben eine SIM-Karte nach der anderen in die Telefone. Als Solveigh das erste aktiviert hatte, wählte sie die Nummer der ECSB-Zentrale.
»Herzlich willkommen bei Loude IT-Services, wie kann ich Ihnen helfen?« Die falsche Empfangssekretärin würde sie nicht verbinden, sie wusste nicht einmal, dass sie nicht für Loude IT-Services arbeitete. Erstaunlich, dass zumindest die Telefonleitung schon wieder funktioniert, dachte Solveigh. Wenn man bedenkt, was sonst alles schiefgelaufen ist.
Solveigh drückte eine Nummernfolge, gefolgt von der Rautetaste, um schließlich ihre PIN einzugeben.
»Willkommen, Agent Lang«, sagte eine Computerstimme.
»Notfalllokalisation Thater, William«, sagte Solveigh.
»Bitte warten Sie«, sagte der Computer.
»Der Aufenthaltsort kann nicht ermittelt werden«, lautete das Ergebnis. Ob Will das selbst entschieden hatte?
»Bitte geben Sie den Autorisationscode für die laufende Operation ein, um fortzufahren.«
Was für einen Code?
»Sie wollen einen weiteren Code«, sagte Solveigh zu Eddy. Eddy legte den Akku des achten Handys beiseite und zuckte die Achseln. Ein Autorisationscode für eine laufende Operation? So etwas hatte der Telefoncomputer noch nie verlangt. Solveigh dachte an den Umschlag in ihrer Handtasche. Über die Tastatur tippte sie wie bei einer SMS den Zahlencode für ELMSFEUER ein: 33555677777777333338833777.
»Bitte warten Sie«, sagte die Stimme. Ausdruckslos. Einige Sekunden später hörte Solveigh das Geräusch eines klingelnden Anschlusses.
»Ja?«, fragte eine ihr wohlvertraute Stimme.
»Will?«, fragte Solveigh. »Gott sei Dank!«
Er hustete.
»Hast du die Akte?«, fragte er.
Solveigh tastete nach dem Umschlag in ihrer Handtasche.
»Ja«, bestätigte sie.
»Mach sie auf«, verlangte Will Thater.
Solveigh zog den roten Umschlag hervor und riss mit ihrem Zeigefinger die Lasche auf. Weitere Kuverts glitten auf den blank polierten runden Bistrotisch. Vier Stück an der Zahl, alle ebenso rot wie der große. TEAM 1, TEAM 2 und TEAM 3 sowie einer, auf den Will KOORDINATION geschrieben hatte. Solveigh wurde klar, dass sie Sir Williams letzte Festung in der Hand hielt. Den Plan für ein Ereignis, das niemals hätte eintreten dürfen. Er hatte die Einsatzpläne selbst verfasst und auf keinem Computer gespeichert. Keine Sekretärin hatte sie abgetippt, kein Drucker ausgedruckt. Dies war der analoge Plan eines altmodischen Geheimdienstlers, der niemandem mehr vertraute außer denen, die er selbst in ELMSFEUER einweihte.
»Öffne den Umschlag für Team 1«, sagte Will.