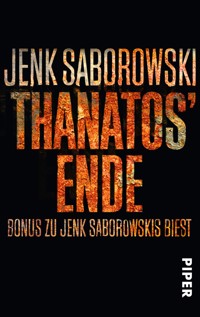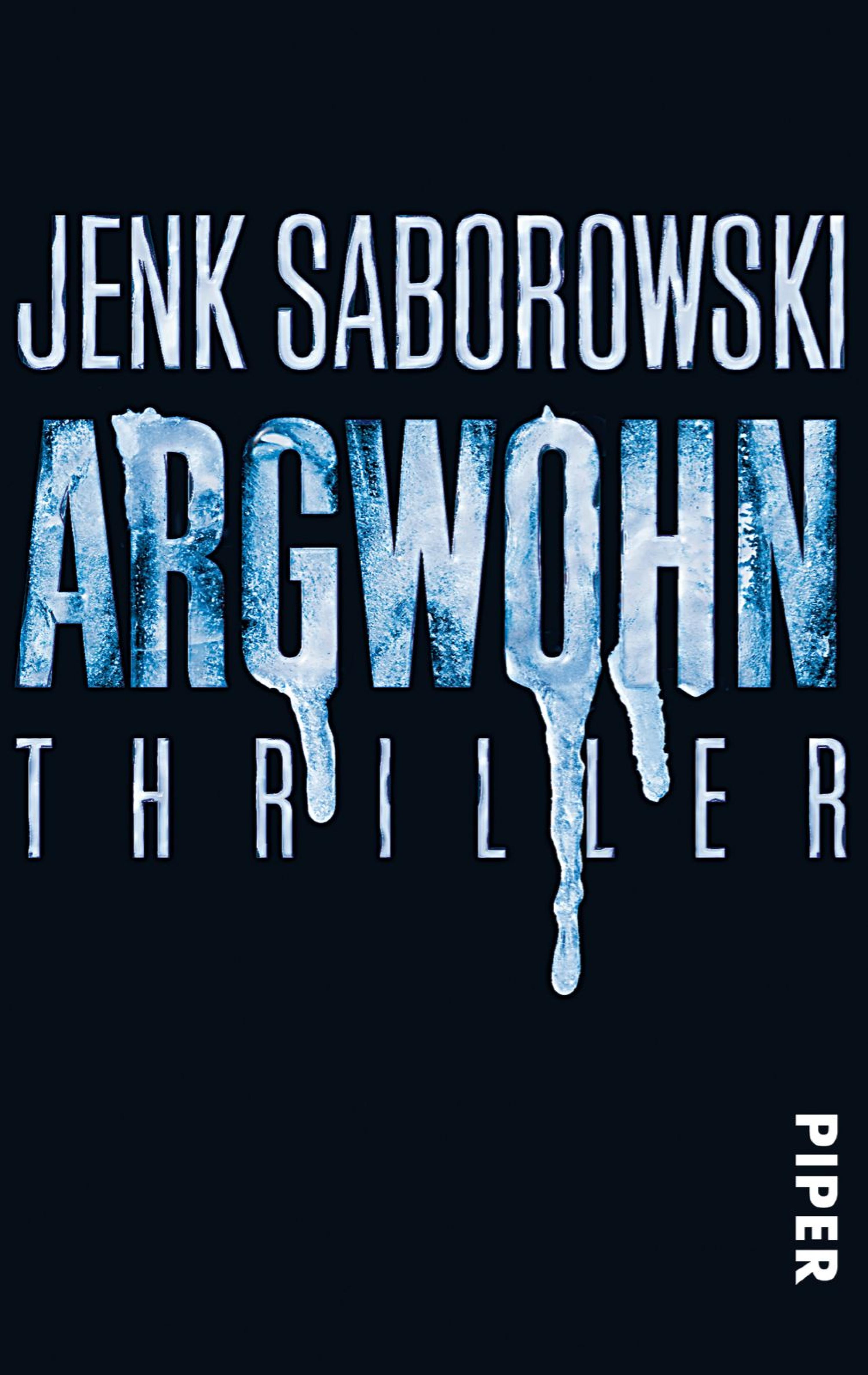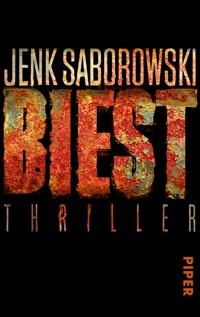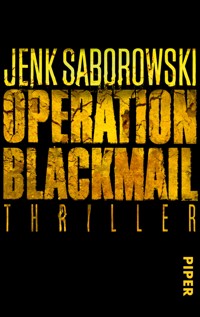
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Paris wird eine junge Bankangestellte auf offener Straße erschossen, in Bologna stirbt ein ranghoher Mitarbeiter desselben Instituts bei einem Anschlag. Per E-Mail fordern Erpresser 500 Millionen Euro, sonst werden weitere der 60.000 Mitarbeiter irgendwo in Europa sterben. Ein Fall für die geheime, grenzüberschreitend agierende Eliteeinheit ECSB. Agentin Solveigh Lang und ihr Team ermitteln, kompromisslos und mit modernsten Methoden. Als sie erkennt, wie skrupellos und gerissen ihr Gegner wirklich ist, beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Operation Blackmail ist eine fiktive Geschichte. Alle Ereignisse, Personen und Institutionen sind frei erfunden, jede Übereinstimmung mit der Realität wäre reiner Zufall.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95237-8
© Piper Verlag GmbH, München 2011 Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur
»Wir können im engen Raum Europa das Unwesen krimineller Banden nur stoppen und nachdrücklich bekämpfen, wenn wir Polizeieinheiten schaffen, die auch juristisch legitimiert europaweit handeln können.«
Dr. Helmut Kohl, April 1997
TEIL 1
KAPITEL 1
Paris, Avenue Friedland
Tag 0: Freitag, 4. Januar, 08:34 Uhr
Leonid Mikanas blies warmen Rauch hinaus in die nasskalte Luft des verregneten Pariser Januarmorgens. Wie immer drückte er seine Zigarette so kunstfertig aus, dass sie neben den anderen vierzehn im Aschenbecher auf der Spitze stehen blieb. Um den beißenden Tabakgeschmack von seiner Zunge zu vertreiben, nahm er einen Schluck aus der mitgebrachten Wasserflasche und kontrollierte zum wiederholten Mal die Einstellung seines Zielfernrohrs. Dabei ließ er das renommierte Bankhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht aus den Augen. Er beobachtete geduldig, wie sich die Angestellten durch die Drehtüren vor dem Regen in Sicherheit brachten. Einer nach dem anderen, wie die Glieder einer Kette. Mit einem Blick auf die kleine Stofffahne, die er an einer Straßenlaterne gegenüber angebracht hatte, analysierte er den Wind, berechnete im Kopf zentimetergenau die Abweichung des Projektils. Obwohl es nicht notwendig war, sah er noch einmal kurz hinüber zum Foto seines Zielobjekts, das er mit einem Reißnagel am Fensterbrett fixiert hatte. Die Frau war hübsch, auf dem Foto wirkte sie gelöst und lachte, war sich der heimlichen Aufnahme nicht bewusst. Während der letzten Woche hatte er sich ihr Gesicht anhand vieler ähnlicher Bilder genau eingeprägt. Seine Vorbereitungen waren abgeschlossen, er atmete zunehmend flacher, bis kaum noch eine Bewegung seines Brustkorbs wahrzunehmen war, den Personaleingang der Bank im Visier.
Da war sie. Sein Ziel. Ohne Zweifel. Sie machte einen gehetzten Eindruck, als sie sich in die kurze Schlange einreihte, die sich vor der Drehtür gebildet hatte. Ihm blieb nicht viel Zeit. Das Fadenkreuz seines Zielfernrohrs tanzte kaum merklich um das Zentrum ihres Hinterkopfs. Wie immer, wenn er im Begriff war zu töten, fühlte er das Adrenalin pulsierend durch seine Venen jagen. »Für dich, Mischa«, flüsterte er kaum hörbar. Der Profi in ihm zog ohne das geringste Zögern den Abzug durch.
Durch die Optik beobachtete er, wie ihr Kopf von der Wucht der Kugel zur Seite geschleudert wurde, ihre Gesichtsmuskeln zuckten den erstaunten Tanz eines unerwarteten Todes. Die Menschen um sie herum stoben panisch auseinander, ihr Körper stürzte, schlug auf den Asphalt und lag grotesk verdreht in einer roten Pfütze aus Blut, die schnell größer wurde.
Wie es ihm sein Ausbilder vor mehr als dreißig Jahren beigebracht hatte, sammelte Leonid Mikanas seine Patronenhülse ein, zerlegte die Waffe und verstaute sie in einer unauffälligen schwarzen Nylontasche. Sein Blick fiel auf den Aschenbecher mit den fünfzehn kerzengerade aufgestellten Zigarettenkippen. Ganz nach seiner Gewohnheit schnippte er mit dem rechten Zeigefinger die Erste an, woraufhin alle anderen der Reihe nach umfielen wie Dominosteine. Er hatte seinen Auftrag erfüllt.
KAPITEL 2
Paris, Boulevard Haussmann
Tag 0: Freitag, 4. Januar, 08:52 Uhr
Im Café Friedland balancierte Marcel Lesoille unruhig auf den hinteren Beinen seines Stuhls und stocherte frustriert in seinem weichgekochten Ei. Ihn plagten heftige Gewissensbisse, im Grunde hatte er bereits gestern gewusst, dass Linda ausrasten würde. Seine Lebensgefährtin saß ihm in diesem Moment gegenüber und schielte ihn aus wütend zusammengekniffenen Augen an, ihr Frühstück hatte sie noch nicht angerührt. Natürlich war sie sauer, aber schließlich ging es um seine Leidenschaft, damit würde sie sich abfinden müssen. Er erinnerte sich an ihren letzten Streit vor wenigen Wochen. Wie immer war es um seine beruflichen Ambitionen gegangen. Oder besser: ihr Fehlen. Er wusste, dass sie seit einem halben Jahr auf den Antrag wartete. Mit Ring, Stein und allem, was dazugehört. Bringen wir erst mal diese Kuh vom Eis, nahm er sich vor, dann sehen wir weiter. Er konnte nicht gut mit ihr streiten.
»Hör mal, Linda«, brach er gepresst das Schweigen. »Es ist ja nicht so, dass ich das Geld versoffen hätte. Mir ist es ernst, ich möchte damit später mal meine Brötchen verdienen. Für uns. Oder traust du mir das nicht zu?« Ihre Stimmungslage war nach wie vor frostig und kühlte weiter ab, er musste es mit einer anderen Taktik versuchen: »Außerdem gibt mir mein Vater auch einen Anteil dazu.«
»Aha. Wenn ich mich recht entsinne, kann sich dein Vater nicht einmal einen neuen Anzug leisten. Da wird dir seine mildtätige Spende wohl kaum eine große Hilfe sein.«
Gut, zumindest antwortet sie, schöpfte Marcel zaghaft Hoffnung. Jetzt bloß nicht zu früh auf sie eingehen, er hatte nicht vor, sich weiter als unbedingt nötig in die Ecke des Boxrings treiben zu lassen, den sie Beziehung nannten.
Unbeirrt setzte Linda ihre Tirade fort: »Ich kann einfach nicht verstehen, wieso das sein muss. Ein mittelloser Student, der nicht mal genug Geld zum Kinderkriegen hat und der eher seine Eltern unterstützen sollte statt umgekehrt. Ausgerechnet der braucht eine neue Kamera für fünftausend Euro? Haben sie dir im Krankenhaus gleich das Kleinhirn mit rausoperiert?«
»Linda, es war der Blinddarm. Meinem Kleinhirn geht es prächtig«, versuchte Marcel sein Glück. Normalerweise waren sein markantes Kinn und das schiefe Lächeln eine Kombination, der Frauen nicht widerstehen konnten. Vielleicht gelang es ihm so, ein fingernagelkleines Loch in ihre Mauer aus Wut zu hämmern. Genau da, wo sie gerade kurz ob ihrer eigenen Formulierung den Mundwinkel zu einem Beinahe-Lächeln verzogen hatte.
»Du hast dir also wirklich in den Kopf gesetzt, Fotoreporter zu werden, statt Arzt? Und wie willst du damit unsere Familie ernähren? Was verdient denn so ein Profi-Knipser?«, ätzte Linda.
Marcel erahnte Sonnenstrahlen, die den Nebel zwischen ihnen vertreiben könnten. Linda sprach gern über Geld, vor allem zur Finanzierung ihrer künftigen Familienpläne.
»Na ja«, setzte er an. »Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Manchmal, wenn man wirklich Glück hat, kann man schon mal mit einem Foto ein paar Tausender machen.«
»Wer ist denn so bescheuert und zahlt für ein einziges Bild so viel Geld?«, echauffierte sich Linda.
Die Auseinandersetzung war noch nicht vorbei, und Marcel ging ihr simples Gemüt auf die Nerven. Vielleicht sollte er sich doch unter seinen Kommilitoninnen nach einer neuen Freundin umsehen, statt weiter auf Linda zu setzen. Sie sah zwar umwerfend aus, war aber augenscheinlich gierig und teilte sich zudem das Intelligenzniveau mit einer Tomatenstaude. Seufzend widmete sich Marcel wieder seinem Frühstücksei, als ihn Sirenen aus seinen Gedanken rissen. Für jeden Fotoreporter, auch einen Anfänger wie ihn, waren die schrillen Fanfaren von Polizei, Feuerwehr und Notärzten Musik in den Ohren. Allerdings würde sich Lindas Wut, wenn er jetzt ging, nicht so schnell legen, im Gegenteil. Kurz wog er ab, ob er nicht doch bleiben sollte, aber seine neue Kamera hatte den Kampf schon vorab gewonnen. Hektisch wühlte er in seiner Tasche nach einem Zwanzig-Euro-Schein. »Ich muss los, entschuldige«, bemerkte er und küsste Linda, die dasaß, als hätte sie der Blitz getroffen.
»Du spinnst ja. Das kannst du doch nicht machen«, legte sie los, aber er war schon aufgesprungen und hechtete den Sirenen hinterher. Um Linda würde er sich später kümmern.
Während er durch den kalten Regen lief, zählte Marcel acht Polizeifahrzeuge und dazu mehrere Krankenwagen, die mit hohem Tempo in die Avenue Friedland einbogen. Da muss etwas Größeres passiert sein, dachte Marcel und kramte seine Leica M8 aus der Fototasche. Endlich besaß er das richtige Werkzeug, eine Profi-Kamera, deren digitaler Chip Bilder aufnahm, die auch den Ansprüchen großer Tageszeitungen genügen würden. Als er die Avenue Friedland erreicht hatte, keuchte er heftig, und sein Puls raste. Scheiß Zigaretten. Zu seinem Glück blieben die Streifenwagen etwa hundert Meter von ihm entfernt stehen und riegelten die gesamte vierspurige Straße ab, was die Pariser Pendler mit einem gellenden Hupkonzert beantworteten. Marcel verlangsamte seinen Schritt und hob den Sucher vor sein Auge. Die Leica war nichts für Anfänger, er musste jedes Bild einzeln scharf stellen. Pah, Autofokus ist doch was für Touri-Knipser, er hatte es gestern Abend lange geübt. Außerdem war das genau der Grund, warum Reporter die Leica so schätzten: Angeblich bekam man mit der Zeit das Gefühl, mitten in seinem Motiv zu stehen. Na ja, was nicht ist, kann ja noch werden, machte sich Marcel Mut. Ihm war die Bedienung noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen, und so brauchte er einen Augenblick, um sich zu orientieren: Die Polizeiwagen bildeten eine Barriere direkt vor der Pariser Filiale der EuroBank, einem großen Geldinstitut aus Deutschland. Klick. Auch von der anderen Seite waren Einsatzkräfte angerückt, sodass vor dem Gebäude ein Sicherheitskordon entstanden war. Klick. Ein Beamter zog das Visier seines Schutzhelms herunter. Eine Spezialeinheit. Klick. Sie brachten ihre Waffen in Anschlag. Klick. Die Fahrer nahe stehender Autos waren ausgestiegen, um einen Blick auf das Spektakel zu erhaschen. Ein rothaariger Gaffer mit einem Flickenteppich aus Muttermalen und einem Glimmstängel im Gesicht, wild gestikulierend. Klick. Eine Frau reckte den Hals, um besser sehen zu können, blankes Entsetzen. Klick. Es herrschte das reinste Chaos, der Einsatzleiter der Polizei schrie etwas, das Marcel nicht sofort verstand. Sein Gesicht war ernst, professionell, ausgeprägte Wangenknochen und ein Dreitagebart. Klick. Was hatte er gesagt? Marcels Gehirn verarbeitete das ungewohnte Wort ein paar Sekunden nachdem er es gehört hatte. Panisch vor Angst warf er sich hinter eines der Polizeiautos mitten in eine große Pfütze: Der Kommandant hatte seine Leute vor einem Scharfschützen gewarnt. Nicht nur er hatte es gehört, neben ihm kniete ein Polizist, der mit dem Sucher seiner automatischen Waffe das Haus gegenüber abscannte. Marcel lief Angstschweiß den Rücken herunter, aber er besann sich auf seine zukünftige Reporterehre und schoss blind einige Bilder rücklings über die Motorhaube. Klick. Klick. Er atmete tief ein und drückte sich so fest er konnte gegen den Kotflügel. Sechzig Sekunden, eine gefühlte Ewigkeit später, ging die Polizei davon aus, dass keine akute Bedrohung mehr vorlag, denn alle Beamten waren aufgestanden und sicherten routiniert die Szene. Gebückt schlich sich Marcel an den Streifenwagen entlang, um eine Lücke zu finden, durch die er zum Eingang der EuroBank vordringen konnte. Er ging fest davon aus, dass ein sensationelles Motiv auf ihn wartete. Und tatsächlich fand er zwischen zwei Stoßstangen einen Spalt, durch den er sich quetschen konnte, ohne aufgehalten zu werden. So ruhig wie möglich hob er seine Leica ans Auge und dokumentierte: Vor dem Eingang der Bank knieten zwei Notärzte vor einem leblosen Körper. Der Kleidung nach zu urteilen, handelte es sich um eine Frau. Klick. Sie drehten sie auf den Rücken. Da war kein Gesicht mehr. Klick. Die Blutlache floss über den Asphalt, breitete sich aus wie ein verschüttetes Glas Wein. Es roch ekelhaft nach Eisen. Klick. Der zweite Arzt schüttelte den Kopf. Klick. Der andere nickte. Sie bedeckten ihren Körper mit einer golden glänzenden Folie, zogen sie bis über ihr Gesicht. Klick. Klick. Ein Polizeibeamter in voller Kampfmontur kam auf ihn zu, ein Maschinengewehr an der Schulter. Klick. Kevlar-Panzer an Brust, Schienbeinen und Oberarmen. Klick. Hinter ihm erschienen die ersten Uniformierten ohne Panzerung. Klick. Er hielt ihm die Linse der Kamera zu und drängte ihn aus dem Kreis, den die Streifenwagen bildeten. Marcel blickte zurück. Klick. Sein Job war erledigt.
An der nächsten Straßenecke kotzte er in einen Gulli. Er hatte noch nie eine Tote gesehen, und obwohl die Leiche frisch war, roch der Tod grauenhaft: das Blut wie Eisenkraut, die austretenden Körpersäfte nach Kot und Essig. Ach du Scheiße, dachte Marcel und lehnte sich erschöpft an eine raue Hauswand, die ihn am Rücken kratzte. Er blieb ein paar Minuten auf dem kalten Gehsteig sitzen, bis er den Mut aufbrachte, seine Ausbeute auf dem digitalen Display seiner Kamera zu begutachten. Einige Bilder waren unscharf. Eines fand er richtig gut: Der Polizist, der mit ihm hinter dem Wagen gekauert hatte, von der Seite und von unten fotografiert, das Maschinengewehr im Anschlag, Angst im Gesicht, Schweiß auf der Stirn. Als er durch die Bilder blätterte, fiel ihm auf, wie sehr er zitterte. Er konnte die kleinen Tasten kaum kontrolliert drücken. Es kostete ihn endlos lange Zeit, sein Handy aus der Jackentasche zu ziehen und die Nummer eines befreundeten Bildredakteurs zu wählen.
»Hey, Anon. Ich hab was für dich. Vor der Zentrale der EuroBank ist eine Frau von einem Scharfschützen erschossen worden. Ich habe Bilder.«
»Wovon hast du Bilder?«, fragte sein Freund, der Bildredakteur.
»Von allem. Von der Polizei, den Notärzten und sogar von der Frau selbst, bevor sie ihr eine Decke über den Kopf gezogen haben.«
Anon lachte herzlich. »Ist ja super, kannst du dir an den Kühlschrank hängen. Die ersten Bilder kamen vor zehn Minuten, online über das Handy vom Fotografen. Unser Chefredakteur hat längst ausgewählt. Junge, wir sind in Paris, hier gibt es Fotografen wie Sand am Meer. Und nicht wenige davon hören den Polizeifunk. Mach das nächste Mal ein Foto vom Mord selbst, das ist sensationell. Für alles andere musst du früher aufstehen. Tut mir leid, Mann.«
»Schon klar. In Ordnung. Danke dir, Anon.«
»Okay. Ich will dich nicht entmutigen. Ruf wieder an, wenn du was hast.«
Frustriert legte Marcel auf. Vielleicht war es doch nicht so einfach, vom Medizinstudenten auf Fotoreporter umzusatteln. Er hatte noch viel zu lernen. Und Linda würde sauer sein. Richtig sauer. Dabei hatte er nichts, um sie zu beruhigen. Obwohl, vielleicht doch, sinnierte er, als er sich hochstemmte und mit zittrigen Knien zur nächsten U-Bahn-Station wankte.
KAPITEL 3
Paris, Boulevard Haussmann
Tag 0: Freitag, 4. Januar, 09:14 Uhr
Fünfzig Meter entfernt atmete Dominique Lagrand hörbar aus. Endlich hat sich die verdammte Journaille verzogen, dachte der Adjutant des Polizeipräsidenten, der als erster Stabsoffizier vor Ort war. Ein fucking Albtraum: Irgendein Wahnsinniger hatte am helllichten Tag eine Passantin von einem belebten Pariser Bürgersteig geputzt. Das versprach Ärger, und sein cholerischer Chef würde toben. Er musste die Lage so schnell wie möglich in den Griff kriegen, was ihm wie immer nicht leichtfallen dürfte. Trotz seiner mittlerweile fast achtundzwanzig Jahre sah er mit seiner Täubchenbrust, so sein ehemaliger Sportlehrer, immer noch aus wie ein Teenager. Er hatte blonde Haare, war mit 1 Meter 68 auch nicht gerade groß gewachsen und musste regelmäßig bei Discobesuchen seinen Ausweis vorzeigen. Keine guten Voraussetzungen, um sich bei einer testosteronstrotzenden Spezialeinheit durchzusetzen. Aber Dominique war vom Leben nicht eben verwöhnt worden, er war hart im Nehmen, und die ihm übertragenen Aufgaben pflegte er mit geradezu selbstloser Hartnäckigkeit zu erledigen. Und er brauchte nun einmal den Bericht. So baute er seine schmale Statur so gut es ging vor dem Einsatzleiter auf, einem Mann Mitte fünfzig mit wettergegerbtem Gesicht und Dreitagebart, der genauso aussah, wie Dominique gerne ausgesehen hätte. Wenn er sich drei Tage nicht rasierte, machte ihn sein dünner Flaum auch nicht männlicher. Dominique Lagrand war Realist, und er setzte Vertrauen in die Streifen seiner Uniform: »Guten Morgen, Capitaine, können Sie mich bitte ins Bild setzen?«
Der Leiter des Sondereinsatzkommandos stand lässig an einen Mannschaftswagen gelehnt und rauchte einen nach verbrannten Autoreifen stinkenden Zigarillo. Geduldig musterte ihn der erfahrene Beamte, letztendlich fiel seine Antwort jedoch gar nicht so abschätzig aus, wie Lagrand erwartet hatte: »Sie müssen der Neue von Rocard sein, nicht wahr?«, fragte er und spuckte Tabakfetzchen auf den Boden.
»Das stimmt, Monsieur«, seufzte Dominique.
»Na gut, Sie können ja nichts für den Bastard. Da wir beide wissen, dass sich die aufgeblasene Kröte gleich hier blicken lassen wird, um der Presse seine Meinung aufs Auge zu drücken, will ich Ihnen nicht den Freitagabend vermiesen.«
»Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar«, gab Dominique zurück und entspannte sich etwas.
»Im Moment scheint keine Gefahr mehr zu bestehen, von dem Täter fehlt jede Spur. Laut Ausweis heißt das Opfer Sophie Besson, eine Angestellte der EuroBank, die gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Ob sie es wirklich war, können wir derzeit nicht sagen. Er hat ihr das halbe Gesicht weggepustet, so wie ich den Notarzt verstanden habe, mit einem ziemlich großen Kaliber. Üble Austrittswunde, ich tippe auf ein Gewehr. Genaueres bekommen Sie erst vom Gerichtsmediziner. Wie schon gesagt: Unsere Arbeit ist getan, die Straße ist sicher. Jetzt sind Sie dran, und ich schätze, Sie werden nicht so schnell wieder in die gemütliche Kaserne kommen. Obwohl, bei Rocards Leuten weiß man nie, angeblich kriecht ihr ja in die Wärme eurer Büros wie die Motten zum Licht«, lachte der Beamte schallend und zündete sich noch einen Zigarillo an. Aus dem Augenwinkel beobachtete Lagrand, wie sich die silberne Limousine seines Vorgesetzten näherte.
»Besten Dank erst einmal, Capitaine, Sie haben mir schon sehr geholfen«, murmelte er zum Abschied und bereitete sich auf die Ankunft Seiner Majestät, des selbst ernannten Königs von Paris, vor. Der schwere Wagen kam neben ihm zum Stehen, und noch während er ausrollte, wurde energisch die hintere Tür geöffnet: General Rocard betrat die Szene. Seine Uniform sah aus, als hätte er heute schon vier beschwerliche Stunden im Dienst der Republik absolviert, obwohl Lagrand wusste, dass er seine Haushälterin anwies, an Arm- und Kniebeugen Falten hineinzubügeln. Du bist fast genauso ein dämlicher Lackaffe wie mein Alter, dachte er im Stillen. Äußerlich das Gegenteil des schweren Rocard, war ihm sein Vater charakterlich umso ähnlicher. Eitel von den Haarspitzen bis zur Schuhsohle, hatte ihn der Pedant in den kindlichen Wahnsinn getrieben. Und schließlich aus reiner Rebellion gegen das verhasste Jurastudium in den Polizeidienst und damit indirekt in die Arme des ebenso eitlen Rocard. Nachdem er seinen Chef über die Lage informiert hatte, unterbreitete er ihm seine Vorschläge: Spurensicherung, Durchsuchung aller umliegenden Wohnungen, Befragung der Anwohner sowie der Kollegen in der Bank.
»Bei der zu erwartenden Publicity würde ich Ihnen Commissaire Fallot vorschlagen. Sie ist kompetent und wird Ihnen auf der Pressekonferenz nicht den Rang ablaufen«, schloss er mit einem Lächeln. Er wusste, dass die Erwähnung der Medien seinen Chef eher dazu bringen würde, seine Vorschläge zu akzeptieren. Sein eigentlicher Beweggrund für die Ernennung von Catherine Fallot zur Leiterin der Sonderkommission war die Tatsache, dass sie ihn nicht wie alle anderen herablassend behandelte. Viele sahen in ihm den unerfahrenen Jagdhund vor der Eignungsprüfung, dabei hatte er sein Studium an der Polizeiakademie mit Prädikat abgeschlossen. In diesem Fall hatte ihn sein Urteilsvermögen nicht getäuscht, und der General winkte seine Pläne ohne jede Änderung durch. »Pressekonferenz um 13 Uhr«, verlangte er noch, bevor er wieder in seinen Dienstwagen stieg und es Lagrand überließ, seine Anweisungen umzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Dominique Lagrand nicht, dass auch die überaus kompetente Catherine Fallot den ersten brauchbaren Hinweis auf ein Motiv erst 72 Stunden später erhalten sollte.
KAPITEL 4
Frankfurt am Main, Konzernzentrale der EuroBank
Tag 1: Montag, 7. Januar, 08:17 Uhr
Bläulich schimmernd spiegelten die zwei Türme der EuroBank-Konzernzentrale die Strahlen der Morgensonne über der Mainmetropole wider. Zwischen den im Konferenzraum versammelten Vorstandsmitgliedern lag eine nicht fassbare Spannung. Niemand der Anwesenden kannte den Grund ihres eiligst anberaumten Meetings an diesem Morgen. Jeder Einzelne hatte einen Anruf von der persönlichen Assistentin ihres neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen: »Dr. Heinkel erwartet Sie um 8:30 Uhr in seinem Konferenzraum wegen eines Notfalls.« Nun saßen zehn der einflussreichsten Bankmanager der Welt im 33. Stock eines Frankfurter Hochhauses und fragten sich, welche schlechten Nachrichten so dringend sein konnten, dass ein Termin zu derart früher Stunde notwendig war.
Um exakt 8:20 Uhr öffnete sich die Tür, eine gespannte Stille legte sich über den großen Konferenztisch. Schwungvoll betrat Dr. Peter Heinkel in einem dunkelblauen Maßanzug mit faltenfrei gestärktem Hemd und passender Krawatte den Raum. Er war ein respektierter Manager, der sein Imperium in den vergangenen Monaten weitgehend ohne Schaden durch eine der schwersten Finanzkrisen in der Geschichte der Menschheit gesteuert hatte, aber heute stand ihm die größte Herausforderung seiner Karriere bevor. Hinter ihm schloss Paul Vanderlist, der Sicherheitschef des Instituts, die schwere Eichentür.
»Meine Herren, bereits am Freitag habe ich Sie über den kaltblütigen Mord an unserer Mitarbeiterin Sophie Besson informiert. Die Polizei tappt bisher im Dunkeln, aber ich befürchte, ich kann Ihnen heute eine Erklärung für ihr plötzliches Ableben liefern«, eröffnete Heinkel seinen Vorstandskollegen. Mit einem kurzen Nicken bedeutete er seinem Assistenten, den Beamer einzuschalten.
»Wir werden erpresst«, fuhr er fort. »Folgende E-Mail ging gestern Abend bei mir ein.« Auf der glatten Wand erschien die auf zwei mal drei Meter vergrößerte Abbildung einer einfachen E-Mail:
von: [email protected]
an: <Heinkel, Dr. Peter>
Paris war erst der Anfang. Wir werden Mitarbeiter von Ihrer Bank töten, bis Sie uns die Summe von 500000000 Euro übergeben haben. Sollten Sie in die Zahlung einwilligen, lassen Sie die Bürobeleuchtung in Ihrer Frankfurter Firmenzentrale nach folgendem Muster an einem beliebigen Tag um 01:30 für zehn Minuten an- und ausgehen:
27. Stock: Büros 27.1001 bis 1040 Intervall 30 Sekunden
18. Stock: Büros 18.2010 bis 2080 Intervall 15 Sekunden
40. Stock: Büros 44.3000 bis 3040 Intervall 60 Sekunden
22. Stock: Büros 22.4050 bis 4090 Intervall 120 Sekunden
»Ich hielt es zunächst für einen groben Scherz«, erklärte Heinkel, »aber ich habe unseren Sicherheitsberater hinzugezogen, und er hat mich überzeugt, dass wir diese Drohung ernst nehmen müssen. Paul …«, übergab er das Wort an den Sicherheitsexperten der Bank.
Äußerlich die Ruhe selbst, erhob sich Paul Vanderlist, der in seinem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte aussah wie ein Bestattungsunternehmer. Er stützte sich mit den Handballen auf die Tischplatte: »Der Brief ist mit neunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit echt. Aus primär drei Gründen. Erstens ist die Summe viel zu hoch: Harmlose Nachahmer schreiben Summen ab, die sie aus Hollywood kennen, und die liegen in solchen Fällen eher im zweistelligen Millionenbereich. Zweitens ist die Idee mit den Bürotürmen mehr als clever. Die Kommunikation ist die Achillesferse jeder Erpressung, aber das scheinen sie alles bedacht zu haben. Sie müssen nicht mal vor Ort sein, um unsere Antwort abzuwarten, ihnen reichen die zahllosen Webcams, die auf die Frankfurter Skyline gerichtet sind. Ich bin überzeugt, dass wir sie ernst nehmen sollten. Vor allem, wenn man den Tod von Sophie Besson hinzurechnet. Für einen Trittbrettfahrer liegen die beiden Ereignisse zeitlich viel zu nah beieinander«, schloss der Sicherheitschef und strich sich über den Bart, der sein Gesicht wie ein grauer Teppich bedeckte.
»Ich sehe das mittlerweile genauso«, pflichtete ihm Heinkel bei. »Andererseits können wir uns auch nicht von jedem Dahergelaufenen erpressen lassen. Ansonsten wären Nachahmern Tür und Tor geöffnet. Paul, Sie waren Offizier, deshalb haben wir Sie eingestellt. Haben Sie einen Vorschlag?«
»Wir kommen gar nicht umhin, offiziell die Polizei zu informieren. Das weiß offensichtlich auch die Gegenseite, schließlich macht sie uns, was das betrifft, keine überflüssigen Vorschläge. Setzen wir also die Behörden in Kenntnis, aber es darf kein Wort an die Öffentlichkeit gelangen. Wenn die Presse Wind davon bekommt, könnte sich unter unseren Mitarbeitern Panik ausbreiten. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern.«
»Und«, ergänzte Heinkel, »wir zahlen auf keinen Fall. Das kommt nicht infrage. Die EuroBank lässt sich nicht erpressen.«
KAPITEL 5
London, Flughafen Heathrow
Tag 1: Montag, 7. Januar, 09:38 Uhr
Die hagere Frau undefinierbaren Alters schlurfte mit hängenden Schultern über den Linoleumfußboden des Flughafengebäudes und schob einen Putzwagen vor sich her. Bei jedem Schritt verursachten die Gummisohlen ihrer Turnschuhe ein schmatzendes Geräusch. Ihr Haar hatte sie mit einem karierten Tuch zurückgebunden, damit die langen Strähnen sie nicht beim Reinigen der Toiletten stören würden. Es verbarg außerdem den kleinen Ohrstöpsel, der Solveigh Lang mit der Außenwelt verband. Neben ihr waren nur ein paar Passagiere in dem abgelegenen Korridor unterwegs, die sich im Abfluggate geirrt hatten. Der Gang verband im Untergeschoss zwei Terminals miteinander und war eine der zahlreichen Versorgungsadern, die den Flughafen durchzogen. Eine Ader, die Solveigh nutzen wollte, um dem Flughafen ihr tödliches Gift zu injizieren, das sich in der unscheinbaren Putzmittelflasche mit der Aufschrift »MR Zinc Spray grey« befand. Mit missmutiger Miene und gerade so schnell, dass niemand wegen ihres Schneckentempos auf sie aufmerksam geworden wäre, steuerte sie ihren Putzwagen auf die unscheinbare kleine Sicherheitsschleuse zu, die in den gesperrten Bereich führte.
Hinter dieser Tür lagen die Eingeweide von Heathrow: Hunderte von Kilometern mit Förderbändern, die Koffer zu ihrem Anschlussflug brachten, Tausende Kilometer Gänge und unterirdische Straßen, bevölkert von den unsichtbaren Geistern, die den Flughafen am Leben hielten. Wie jeden Tag während der vergangenen zwei Wochen grüßte sie den Beamten an der Sicherheitsschleuse und zeigte ihren gefälschten Ausweis vor. Der Mitarbeiter der externen Sicherheitsfirma, der hier jeden Werktag Dienst tat, hieß Mark Kenwright, ein schwergewichtiger Ire mit leuchtend roter Mähne. Mark war ihnen schon beim ersten kleinen Test positiv aufgefallen: In ihrer Rolle einer jungen Frau mit Kinderwagen und zu viel Gepäck hatte er ihr sehr bemüht geholfen, als ihr ein schwerer Rucksack von der Schulter gerutscht war. Ein banales, aber effektives erstes Auswahlkriterium für einen »freien Mitarbeiter«, wie sie es ausdrückten. Sein psychologisches Profil hatte ergeben, dass er hilfsbereit und ethnischen Minderheiten gegenüber aufgeschlossen war. Dies machte ihn zwar für sie persönlich sympathisch, aber hier ging es um einen Job, und sie hatte kein Problem, seine Hilfsbereitschaft auszunutzen. Vor etwa einer Woche hatte Mark aufgehört, ihren Putzeimer zu kontrollieren. Damit hatte er den Zeitpunkt, den ihr Psychologe vorhergesagt hatte, um nur 24 Stunden verpasst. Auch heute machte er keine Anstalten, der unterernährten Frau mehr Schwierigkeiten zu machen als unbedingt nötig. Freundlich lächelnd trat er beiseite und ließ sie durch den Metalldetektor treten. Er schlug nicht an, denn sie hatte kaum Metall an sich, selbst auf einen Gürtel hatte sie verzichtet, um ganz sicherzugehen. Hinter der Schleuse begann sie, den Boden zu wienern, wie es ihr offizieller Auftrag war. Wieder und wieder schob sie den Putzwagen ein Stückchen weiter und wischte das nächste Segment des Plastikbodens, bis sie außer Sichtweite war. Für die Putzrunde hatte sie in der Vergangenheit etwa zwei Stunden gebraucht. Länger als ihre Vorgängerin, aber nicht zu lange, um Kenwright misstrauisch zu machen. Und für ihr heutiges Vorhaben würde sie exakt zwei Stunden und zehn Minuten brauchen. Sollte der Wachmann misstrauisch werden, wäre es schon zu spät. Mit einem letzten Blick zurück vergewisserte sie sich, dass ihr niemand gefolgt war, und startete den Zeitmesser ihrer Armbanduhr. Es war ihre eigene, ein teures Herrenmodell, aber sie hatte darauf bestanden, es war ein Erbstück ihres Großvaters, ihr Glücksbringer. Diese kleine Extravaganz konnte sie sich leisten, denn sie gehörte zu den besten ihrer Zunft. 00:00:10. Sie atmete tief ein. Die Zeit lief.
KAPITEL 6
Frankfurt am Main, Konzernzentrale der EuroBank
Tag 1: Montag, 7. Januar, 09:44 Uhr
In seinem Büro tigerte der Sicherheitschef der Bank nervös vor der bodenlangen Fensterfront des 40. Stocks auf und ab und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Auf seiner Stirn bildeten sich erste Tröpfchen. Er wusste, dass ihm binnen Minuten das Hemd am Körper kleben würde. Da war er wieder, der Angstschweiß. Was hatte Heinkel damit andeuten wollen: »Sie waren schließlich Offizier?« Natürlich erwarteten seine Vorgesetzten von ihm Souveränität. Er würde sie ihnen nicht so einfach liefern können. Ja, er hatte bei der Bundeswehr gedient, zum Schluss im Rang eines Majors bei der Eliteeinheit KSK. Aber er war abgestürzt. Tief. Nachdem bei einem Einsatz unter seiner Leitung acht Kameraden und über vierzig Zivilisten den Tod gefunden hatten, war in seinem Leben kein Stein auf dem anderen geblieben: er hatte den Dienst quittiert. Und seine Frau hatte die Konsequenzen gezogen, die sie ihm schon jahrelang angedeutet hatte. Jede Nacht wachte er auf, verschwitzt und schuldbeladen. Sein Versagen. Er hatte Unschuldige getötet. Nicht im Krieg, sondern bei einer sogenannten Friedensmission. Niemals wieder durfte er Verantwortung für Menschenleben übernehmen. Nicht er, der Gescheiterte. Er hatte Jahre gebraucht, um wieder arbeiten zu können. Nur die Unterhaltsansprüche seiner zwei Kinder hatten ihn letztlich dazu getrieben, den Job bei der EuroBank anzunehmen. Akten und E-Mails statt Gewehre und Munition. Hier hätte er alt werden sollen, seinem Nachwuchs das Studium finanzieren. Selbst die Anruftiraden seiner rachsüchtigen Frau waren seltener geworden. Und jetzt ermordete ein Verrückter Mitarbeiter der Bank. Was sollte er tun? Er schaute an seinem Hemd hinunter, durch den nassen Stoff waren bereits die grauen Brusthaare zu erkennen. Er sollte kalt duschen gehen. In diesem Moment klopfte seine Sekretärin an die Tür und riss ihn aus seinen Gedanken: »Die Herren vom Bundeskriminalamt sind da«, kündigte sie an.
»Gut, wir fangen gleich an«, seufzte Paul und knöpfte sein Jackett zu, um wenigstens notdürftig seine Schweißattacke zu kaschieren. Die drei Männer in Zivil betraten sein Büro. Sie stellten sich ihm als die beiden Vizepräsidenten und als Leiter der Abteilung SO vor, was für Schwere und Organisierte Kriminalität stand. Nach einer knappen Begrüßung kam Letzterer umgehend zur Sache: »Herr Vanderlist, was Sie uns vorhin am Telefon geschildert haben, klingt zutiefst beunruhigend. Würden Sie uns jetzt bitte umfassend über Ihre Situation aufklären?«
Paul kam dem Wunsch des Beamten nur zu gerne nach, vielleicht wussten wenigstens die Profis, was zu tun war. Nach Abschluss seines Berichts reichte er jedem einen Ordner mit der Personalakte von Sophie Besson und einem Ausdruck der Erpresser-E-Mail. Wortlos nahmen drei der obersten Polizisten der Bundesrepublik ihre Kopien entgegen. Sie baten um einen Beamer und zogen einen dicken Laptop aus einem Pilotenkoffer. Paul runzelte die Stirn, als er das Ungetüm aus längst vergangener Zeit sah, aber der Beamte fummelte unbeirrt an dem Verbindungskabel zum Projektor. Paul schwante Übles. Die nächsten fünfzehn Minuten gingen für eine PowerPoint-Präsentation drauf, die betroffenen Unternehmen die Konsequenzen aufzeigte: Einrichtung eines Krisenstabes auf einem eigenen Stockwerk, Abschottung der Pressestelle, Bestellung eines Krisenmanagers.
»Es gibt dafür spezielle Unternehmensberatungen«, referierte Klaus Sperber, der erste Vizepräsident des BKA. Scheiße, die haben für so was tatsächlich ein PowerPoint. Wahnsinn, dachte Paul, hütete sich aber, seine Gedanken laut zu äußern. Die Grafiken sahen aus, als seien sie von einer in den Gulag strafversetzten Sekretärin zusammengeschustert worden. An der Hochglanzleinwand seines designprämierten Büros wirkte die Präsentation primitiv, geradezu vorsintflutlich. Doch die Beamten schien das nicht zu stören. Voller Stolz demonstrierten sie ihren technischen Fortschritt. Wahrscheinlich hattet ihr letztes Jahr noch Schwarz-Weiß-Folien. Die riesigen Lettern, die für zehn Jahre alte Projektoren notwendig gewesen wären, brannten Paul in den Augen.
Der Leiter der Abteilung SO schloss mit den Worten: »Wenn wir die Situation unter Kontrolle behalten, haben wir keine schlechten Chancen auf einen guten Ausgang. Dennoch will ich Ihnen nicht verschweigen, dass es diese Art von Erpressung noch nie gegeben hat.«
»Selbstverständlich werden wir alle Ihre Vorschläge uneingeschränkt umsetzen«, versprach Paul und fühlte verstohlen mit der Hand den Zustand seiner Schweißdrüsen – zumindest die Sturzbäche waren versiegt. Vielleicht gab es doch einen Ausweg. Schließlich waren im Grunde eher Sperber und Co. verantwortlich, oder nicht? Aber was meinte er mit »dieser Art« von Erpressung? Er fragte geradeheraus, Drumherumreden hatte keinen Zweck.
»Nun ja«, räusperte sich Sperber, ein ruhiger und bedächtiger Mann mit schmalen Lippen und einem roten Schnauzer. »Bei Firmenerpressungen haben wir normalerweise eine hohe Aufklärungsquote. Gier ist das schlechteste Motiv, es zieht fast immer Fehler nach sich. Und schließlich die Kontaktaufnahme, die Geldübergabe, das alles sind ideale Zeitpunkte für einen Zugriff. In Ihrem Fall scheinen mir die Täter allerdings sehr gerissen. Die Idee zur Kommunikation über die Beleuchtung Ihrer Bürotürme ist erschreckend brillant. Zusätzlich haben wir da natürlich noch das Problem, das mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet …«
Paul platzte fast der Kragen: Wieso konnte der Mann nicht schneller zum Punkt kommen? Am liebsten hätte er dem Polizisten den blasierten Bart poliert, damit er endlich mit der Sprache herausrückte. Doch Vizepräsident Sperber ließ sich nicht beirren: »Was den Fall besonders kompliziert macht, ist die Tatsache, dass Sie als deutsche Firma mit einem Mord in Paris erpresst werden. Internationale Fälle sind eine außergewöhnliche Herausforderung, da die lokalen Dienststellen koordiniert werden müssen. Aber wir sind vorbereitet, ich werde als Delegierter bei Interpol umgehend Kontakt zu den Kollegen in Paris aufnehmen.«
»Sagen Sie, Herr Vanderlist«, mischte sich der Leiter der Abteilung SO ein. »Wie viele Mitarbeiter hat Ihre Bank? 80000?«
»Etwas über 75000 weltweit.«
»Weniger, als ich befürchtet hatte, aber leider nicht wenig genug: Wir können so gut wie nichts für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter tun, derart viele potenzielle Ziele lassen sich nicht effektiv schützen. So hart das klingt, aber da wir im Moment nur vermuten, dass der Mord an Sophie Besson auf das Konto der Erpresser geht, bleibt uns nur abzuwarten, bis sie wieder zuschlagen. Vielleicht war alles nur ein schrecklicher Zufall.«
»Wenn Sie meinen …«, seufzte Paul zweifelnd. »Wir müssen unbedingt eine Panik bei den Mitarbeitern vermeiden, ich gehe davon aus, dass ich mich auf Ihre Diskretion verlassen kann?«
»Selbstverständlich, Herr Vanderlist«, antwortete der Abteilungsleiter. »Wir setzen unseren besten Mann auf Ihren Fall an: Ulrich Thoma wird den Krisenstab übernehmen. Er hat viel Erfahrung mit der Erpressung von Unternehmen und ist über jeden Zweifel erhaben«, postulierte der Beamte und stemmte sich aus dem bequemen Ledersessel. Er hielt Paul zum Abschied die Hand hin und schaute ihm gerade in die Augen. »Wir tun unser Bestes, Herr Vanderlist. Versprochen.«
Paul schöpfte Hoffnung: Ulrich Thoma war kein Unbekannter. Er hatte die Erpressung eines Lebensmittelkonzerns vor einigen Jahren erfolgreich aufgeklärt, und die Geschichte war glimpflich ausgegangen, erinnerte er sich. Der Aktienkurs des Unternehmens hatte die Krise fast ohne Schaden überstanden, die Täter saßen hinter Schloss und Riegel. Er gab den Männern die Hand zum Abschied: »Danke für Ihr Kommen, ich gehe davon aus, dass sich Herr Thoma schnellstmöglich mit mir in Verbindung setzt.«
Als die Beamten sein Büro verlassen hatten, ließ sich Paul in seinen Schreibtischstuhl fallen und knöpfte sein Jackett auf. Sein Hemd war schon beinahe wieder trocken. Thoma würde wissen, was zu tun war, der Mann war ein Profi, sinnierte er, als ihn ein Klopfen an der Tür aus seinen Gedanken riss. Klaus Sperber, der Vizepräsident des BKA, stand in der Tür.
»Verzeihung, ich habe meinen Stift bei Ihnen vergessen«, entschuldigte er sich mit einem Nicken Richtung Konferenztisch, auf dem ein wertvoll aussehender Füller lag.
»Kein Problem«, winkte ihn Paul herein. Sperber steckte den Stift in die Jacketttasche, machte aber keinerlei Anstalten zu gehen. Stattdessen baute er sich vor Pauls Schreibtisch auf.
»Herr Vanderlist, ich war vorhin nicht ganz aufrichtig zu Ihnen, aber Sie werden verstehen, dass ich das, was ich jetzt sagen werde, nicht vor meinen Kollegen zugeben konnte.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte Paul, vom Tonfall des hohen Beamten beunruhigt. Schon bildeten sich wieder erste Tröpfchen auf seiner Stirn. Da fing es immer an.
»Wir haben die Zusammenarbeit der Europäischen Polizeidienste als Herausforderung dargestellt. Die Wahrheit ist: Ihr Fall ist der Albtraum aller Polizisten in Europa, der Präzedenzfall für die Initiative, eine länderübergreifende Polizeibehörde zu schaffen. Deutschland und Großbritannien bemühen sich seit mehr als zehn Jahren darum.« Er machte eine Kunstpause. »Ich will ehrlich zu Ihnen sein: Wir sind auf ein solches Verbrechen nicht vorbereitet. Und Interpol mit seinen 500 Beamten, die sich hauptsächlich um Terrorismus und Drogenschmuggel kümmern, schon gar nicht.«
Nachdem Paul zunächst Hoffnung geschöpft hatte, wuchs jetzt wieder sein Gefühl der Hilflosigkeit, der Kloß in seinem Magen wurde größer. Er knöpfte sein Jackett wieder zu. Das konnte doch gar nicht sein, wie war das möglich? Die Europäische Union gab es seit mehr als fünfzehn Jahren. Er schluckte: »Ist das Ihr Ernst?«
»Leider ja«, antwortete Sperber. »Sie können ohne jede Kontrolle von Sizilien nach Helsinki reisen, aber bis ich den Papierkram ausgefüllt habe, um in Südfrankreich eine Wohnung stürmen zu lassen, hat sich der Täter woanders schon ein Haus gebaut. Und ich selbst darf mit meiner Dienstwaffe nur in Ausnahmefällen über die Grenze, das ist die Realität, Herr Vanderlist, die politische Realität, wie ich hinzufügen möchte. Die Polizeibehörden arbeiten ständig daran, die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Ausland zu verbessern. Und wir können durchaus Erfolge vorweisen, allerdings fast ausschließlich bei langfristig geplanten Aktionen. Geschwindigkeit ist leider nicht unsere Stärke in Europa, aber genau die ist bei einer Erpressung von zentraler Bedeutung. Aber wir werden alle verfügbaren Kräfte mobilisieren, Sie bekommen sämtliche Unterstützung, die wir Ihnen bieten können.«
Fassungslos starrte Paul ihn an: »Und was sollen wir Ihrer Meinung nach jetzt unternehmen?«
»Hören Sie, Herr Vanderlist, ich darf Ihnen das nicht sagen und habe das offiziell auch niemals getan. Ich bin genauso entsetzt wie Sie. Ich weiß nicht, ob Ihr Fall die notwendigen Kriterien erfüllt, niemand von uns weiß das, aber ich empfehle Ihnen, sich ans Bundeskanzleramt zu wenden«, schlug der Beamte vor. »Dr. Heinkel wird keine Schwierigkeiten haben, zur Kanzlerin durchzukommen.«
Paul hatte keine Ahnung, worauf der Mann hinauswollte: »Und was soll das nützen?«
»Tun Sie es einfach. Allein dieser Tipp könnte mich meinen Stuhl kosten. Vertrauen Sie mir. Wir werden verfahren, als ob dieses Gespräch niemals stattgefunden hätte. Viel Glück, Herr Vanderlist, Sie werden es brauchen«, verabschiedete er sich und gab ihm ein zweites Mal die Hand.
KAPITEL 7
London, Flughafen Heathrow
Tag 1: Montag, 7.Januar, 09:45 Uhr
Nachdem sie den Sicherheitsbereich betreten hatte und der Wachmann außer Sicht war, machte sich Solveigh Lang auf die Suche nach Raum 01.20.213, in dem ihre Ausrüstung deponiert worden war. Das Nervengift hatte sie selbst in einem ihrer Reinigungsmittel eingeschmuggelt, aber in der Verkleidung als Putzfrau könnte sie sich im nächsten Abschnitt nicht frei bewegen. Als sie die winzige Kammer gefunden hatte, zog sie die Tür hinter sich zu und schaltete das Licht ein. Es roch muffig, nach abgestandener Luft. Und einem prall gefüllten Staubsaugerbeutel. Solveighs Nase war ihr stärkster Sinn, sie kam an keinem Duft vorbei, und wehte er noch so flüchtig vorüber. Segen und Fluch zugleich. Automatisch wanderte ihre Hand zu einem kleinen Tiegel in ihrer Hosentasche. Während sie sich in der Kammer umsah, schmierte sie mit dem Zeigefinger eine durchsichtige Paste auf ihre Oberlippe. Menthol und Kampfer vertrieben den unangenehmen Mief, der Tiegel wanderte zurück an seinen Platz. Wie verabredet, hingen an der Innenseite der Tür ein roter Overall sowie einige einfache Werkzeuge, bei denen der Metalldetektor der Sicherheitsschleuse Alarm geschlagen hätte. Als Erstes musste sie sich bei Eddy melden, wahrscheinlich machte er sich schon Sorgen.
»Ich bin drin«, zischte sie, während sie begann, sich auszuziehen.
»Verstanden«, lautete die knappe Antwort. Zunächst polsterte sie ihre Hüften und ihre Arme mit einigen Schaumstoffpads, die sie gut fünfzehn Kilo schwerer aussehen ließen. Es war zwar nicht zu erwarten, dass sie jemand wiedererkennen würde, aber ihre dürre Statur passte nicht zu ihrer neuen Rolle. Nachdem sie den hässlichen roten Overall übergestreift hatte, zog sie Schuhe und Signalweste an und legte den Gurt mit dem flughafeninternen Funkgerät um. Ihrem Putzwagen entnahm sie die Flasche mit der Industriebodenversiegelung »MR Zinc Spray grey« und verstaute sie in der Wadentasche. Eine Schusswaffe hatte sie zwar nicht, so einfach hatte es ihnen Heathrow nicht gemacht, aber sie hatte auch nicht vor, jemand zu erschießen. Und zur Not tat es auch der schwere Schraubenschlüssel, der zu ihrem Werkzeug gehörte.
Nach einem letzten prüfenden Blick auf ihre neue Verkleidung verließ sie die Abstellkammer und machte das Schloss mit einem speziellen Gel aus ihren Putzutensilien unbrauchbar, das binnen Minuten aushärtete. Niemand würde aufgrund einer kaputten Abstellkammertür Alarm auslösen, aber ein verlassener Putzwagen wäre ein anderes Kaliber.
Sie lief jetzt nicht mehr wie eine ältliche Putzfrau, sondern hatte ihren Gang der neuen Rolle angepasst. Ihre Schritte waren selbstbewusst, breitbeiniger, dynamischer. Nachdem sie einen weiteren Korridor durchquert hatte, öffnete sie die Tür, hinter der die Förderbänder lagen. Ihr schlug ohrenbetäubender Lärm entgegen: Überall ratterten Walzen, Metall donnerte auf Metall, wenn die Koffer von den riesigen Sortierarmen ihren Bestimmungsorten zugewiesen wurden. Ohne sich darum zu scheren, ging sie zügig in Richtung Terminal 3, in dessen unmittelbarer Nähe ihr eigentliches Ziel lag. Niemand sprach sie an, warum auch? Wer hätte im Terminal 1 Interesse an Bodenpersonal aus T3, und an ihrem roten Overall war deutlich zu erkennen, welcher Crew sie angehörte. Laut den Dienstplänen, die erstaunlich einfach zu besorgen waren, wurde häufig zwischen den Terminals Personal getauscht, so fiel Solveigh Lang nicht auf. Nur einmal während ihres fast drei Kilometer langen Marschs wurde sie von einem verzweifelten Kollegen um Hilfe gebeten, der versuchte, zwei verkeilte Snowboards voneinander zu trennen. Sie half ihm gerne und lächelte freundlich, er roch nach billigem Deo, das sicher mit Attributen wie »meerfrisch« oder »vital« vermarktet wurde. Trotz dieses unvorhergesehenen Zwischenfalls lag sie immer noch gut im Zeitplan. Als sie Terminal 3 erreicht hatte, öffnete sie eine Klapptür zu einem engen Schacht und stieg eine Etage tiefer, unter das Flughafengebäude. Jetzt kommt der spannende Teil, dachte Solveigh Lang, denn hier fand ihre sorgfältige Planung ein Ende. Die Baupläne für die Versorgungsschächte des Flughafens unterlagen strengsten Sicherheitsbestimmungen, trotz intensiver Bemühungen hatte Eddy ihrer nicht habhaft werden können. Sie zog die Luke wieder zu und schaltete ihre Taschenlampe ein, als sie den Schatten bemerkte. Hektisch kramte sie nach dem Verapamil. Sie litt seit Jahren unter der seltenen Krankheit, die ihr die Schatten brachte. Diesen Vorboten heftiger Schmerzen, der jetzt um ihr linkes Auge tanzte. Als sie die Tablette gefunden hatte, ließ sie sich an der rauen Wand in die Hocke sinken. »Cluster-Kopfschmerz« lautete die Diagnose ihres alle paar Wochen urplötzlich auftretenden Leidens. Einige Ärzte behaupteten, ihr beinahe schon pathologischer Geruchssinn sei eine Folge davon. Oder auch die Ursache. Wie auch immer. Mit den verschreibungspflichtigen Tabletten aus Amerika, die ihr ein Arzt gegen ein horrendes Honorar monatlich schickte, hatte sie ihre Cluster im Griff. Ursprünglich war Verapamil ein Herzmedikament, aber es half auch manchen Kopfschmerzpatienten. Ihr zum Glück auch, zumindest meistens. Erleichtert spürte sie, wie die Chemiekeule den Schatten vertrieb. Ein paar Minuten blieb sie mit geschlossenen Augen sitzen. Nur ein paar Minuten. Aber irgendwann musste sie weitermachen. Eddy und die anderen wussten nichts von ihrem kleinen Problem mit den Pillen, und das sollte unbedingt so bleiben. Endlich stemmte sie sich hoch und tastete mit dem dünnen Lichtstrahl die Wände des Schachts ab, überall verliefen Rohre und Kabel. »Wegpunkt 10«, berichtete sie. »Wie geht’s weiter?«
»Laut den Auftragsbüchern der für den Flughafen tätigen Handwerksfirmen liegt für deine Sektion nichts vor, das heißt, wir dürften unsere Ruhe haben. Ich stelle dich jetzt zu Murat, er hat ›Schwarzbär‹.«
Schwarzbär war ihr interner Codename für den Ingenieur, der die Klimaanlage von Heathrow geplant hatte. Eddy gab ihr damit zu verstehen, dass er zur Kooperation bereit war, das waren gute Neuigkeiten. Solveigh Lang begann zu schwitzen. Irgendwo hinter ihr musste ein Belüftungsmotor sein, es war drückend heiß in dem Schacht. Mit dem Ärmel ihres Overalls wischte sie ihre Stirn trocken.
»Murat, Solveigh hier. Lass hören.«
Als Nächstes vernahm sie Schwarzbärs zittrige Stimme. Wie unpassend für einen Bären, dachte Solveigh bei sich und tadelte Murat innerlich, der dem Mann sicher gerade eine Pistole an die Schläfe hielt.
»Die Systeme … sind getrennt angelegt.« Die Stimme räusperte sich. »Aber Sie sind noch zu weit entfernt. Sie müssen mindestens bis zum Schott ›T3-AC-0107‹. Erst dahinter läuft das Sicherheitssystem mit dem vom Terminal parallel.«
Fluchend arbeitete sich Solveigh auf Knien durch die enge Röhre, an jeder Luke machte sie halt und überprüfte ihre Zeit. Langsam wurde es knapp, wenn sie es noch rechtzeitig rausschaffen wollte, dachte sie, als sie hinter sich ein metallisches Kratzen vernahm. Instinktiv begriff sie, dass die Protokolle der Servicefirmen unvollständig sein mussten. Es waren doch Arbeiten an der Anlage vorgesehen, sie saß in der Falle. So schnell es die engen Platzverhältnisse erlaubten, drehte sie sich um und zog den Schraubenschlüssel aus der Tasche ihres Overalls. »Eddy, schmeiß Murat aus der Leitung, wir haben ein Problem«, flüsterte sie in ihr Headset.
»Was?«, kam die knappe Antwort.
»Hier ist doch jemand, direkt hinter mir«, keuchte sie.
Eine ihr wohlbekannte, ruhige Stimme mischte sich ein und gab ihr präzise Anweisungen, was sie zu tun hatte: »Ausschalten, aber leise.«
Witzbold, dachte Solveigh bei sich. Eine Waffe, mit der ich hier einen ordentlichen Lärm veranstalten könnte, habe ich doch eh nicht. Sie drückte sich so weit sie konnte in die Ecke und knipste die Taschenlampe aus, es wurde stockfinster. Über ihrem Kopf öffnete sich die graue Luke mit einem Knarren. Das plötzliche grelle Neonlicht blendete sie, nur langsam gewöhnten sich ihre Augen wieder an normale Beleuchtung. Viel schlimmer als das Licht war die Duftwolke, die sich ihrer Nase förmlich aufzwängte. Eine ekelerregende Mischung aus wiedererwärmtem Schweiß und ungewaschenen Haaren. Sie würgte. Ihr zehnter Hirnnerv, den sie durch ihre Geruchsempfindlichkeit mit Vornamen kannte, schickte heftige Impulse an ihre Speiseröhre. Verrat dich nicht Solveigh, nicht jetzt. Sie rang mit ihrem Nervus vagus, kämpfte ihn nieder, bis er schließlich aufgab. Der ekelhafte Geruch blieb, nahm sogar an Intensität zu, aber zumindest würde der Störenfried keinen kotzenden Eindringling vorfinden.
Von oben tastete sich ein Schuh an der Wand des Schachts entlang, suchte die oberste Sprosse der kurzen Leiter. Sie musste sich blitzschnell entscheiden. War der Mann alleine? Wahrscheinlich, denn sie hörte im Hintergrund leise Musik, ein Radio. Er hatte es mitgebracht, um etwas Unterhaltung bei der Arbeit zu haben. Solveigh entschloss sich, das Risiko einzugehen, packte den Fuß und zog ihn mit aller Kraft nach unten. Ihr Gegner hatte noch keinen Halt gefunden und fiel wie ein Stein. Der riecht nicht nur grauenhaft, der ist auch noch verdammt schwer, dachte Solveigh, deren zierlicher Brustkorb unter dem enormen Gewicht des Technikers zusammengedrückt wurde. Sie musste handeln, bevor der Mann einen klaren Gedanken fassen konnte. Da er über ihr lag, blieb ihr keine große Wahl. Sie legte den Unterarm um seine Kehle und drückte seine Luftröhre zusammen, während sie ihm ins Ohr flüsterte: »Wenn du mitspielst, passiert dir nichts. Keinen Ton, okay?«
Sie atmete so flach wie möglich, um den Geruch der fettigen Haare von sich fernzuhalten. Als Solveigh keine Antwort bekam, zog sie noch fester an ihrem Unterarm, bis sie schließlich den Ansatz eines Nickens spürte. Daraufhin löste sie ihre Umklammerung langsam, um notfalls sofort wieder zudrücken zu können, wenn der Mann Anstalten machte, um Hilfe zu rufen. Als nichts dergleichen geschah, schob sie seinen schweren Leib beiseite und ging vor ihm in die Knie. Er war dick und hatte ein feistes Gesicht, seine Augen starrten Solveigh angsterfüllt an. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie, wie er ungelenk in seiner Hosentasche kramte. »Denk nicht mal dran«, bemerkte sie trocken, hob blitzschnell den Schraubenschlüssel und schickte ihn mit einem gezielten Schlag auf die Stirn ins Reich der Träume. Sie zog seine Hand, mit der er nach etwas getastet hatte, aus der Tasche und entdeckte ein Handy. Wusste ich es doch, dachte sie, und überprüfte die gewählten Rufnummern. Der letzte Eintrag war mehr als eine Stunde her, er hatte es also nicht geschafft, einen Notruf abzusetzen. Gut. Er würde zwar höllische Kopfschmerzen davontragen, aber überleben, deshalb hatte sie nicht auf die Schläfe gezielt, das konnte eher ins Auge gehen. Und reguläre Kopfschmerzen waren ein Leiden, das Solveigh nicht einmal ein müdes Lächeln abrang.
Mit einem Blick aus der Luke überzeugte sie sich, dass der Mann alleine gekommen war. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Solveigh atmete auf und stemmte sich rittlings aus dem Loch, um die Werkzeuge des Mannes einzusammeln, bevor sie sich erneut ins Dunkel des Schachts zurückzog und die Öffnung schloss. Nachdem sie den Techniker mit seinen eigenen Schnürsenkeln gefesselt und mit einem Schaumstoffteil ihrer Verkleidung geknebelt hatte, setzte sie ihre Mission fort. Als ihr Hirn spürte, wie ihre Anspannung nachließ, startete es einen erneuten Versuch. Begleitet von heftigem Würgereiz kroch sie weiter. Wieder einmal verfluchte sie ihre Krankheit.
Sie erreichte ihr Ziel 34 Minuten vor Ablauf der Zeit. Eine gute halbe Stunde, das war knapp, aber gerade noch zu schaffen. Mit ruhiger Hand schraubte sie den Deckel von »MR Zinc Spray grey« ab und entnahm ihr eine kleine Ampulle, auf der ein roter Aufkleber mit der Warnung vor einer tödlichen Substanz klebte. Der einfache Timer war schon voreingestellt. Mit einem winzig kleinen Bohrer durchlöcherte sie auf Anweisung von »Schwarzbär« das mit der Farbe Lila gekennzeichnete Rohr der Klimaanlage des Towers von London Heathrow und befestigte dahinter den Behälter, sodass er auf den ersten Blick nicht zu sehen war. Schließlich aktivierte sie den chemischen Timer, der die Substanz bis auf fünf Minuten zuverlässig in einer halben Stunde freisetzen würde. Ihr blieben 25 Minuten, bis das Chaos ausbrechen würde.
Exakt 23 Minuten später verließ Solveigh Lang in der Uniform einer Stewardess von Virgin Atlantic den Terminal 3 und atmete die kerosinschwangere Airportluft. Diesen Geruch mochte sie, er versprach die weite Welt. Heute allerdings würde niemand mehr von Heathrow verreisen. Außerhalb des Trubels vor dem Gebäude lehnte sie sich an eine Betonbrüstung und öffnete eine Dose Cola light. Sie trank schnell, das kaltprickelnde Getränk war eine Wohltat für ihre ausgedörrte Kehle. Nachdem ihr Durst gestillt war, schaute sie auf die Armbanduhr ihres Vaters. Zeit zu gehen. Neun Minuten später gab der Tower Alarm.
KAPITEL 8
Amsterdam, Flughafen Schiphol
Tag 1: Montag, 7.Januar, 14:00 Uhr
Nur anderthalb Stunden nach seinem Gespräch mit dem Bundeskriminalamt saß Paul Vanderlist in einem Firmenjet der EuroBank auf dem Weg nach Amsterdam. Als sein Jet in Schiphol aufsetzte, regnete es Bindfäden. Das Privatflugzeug wurde an einem abgeschiedenen Terminal außerhalb der Fluggastzone abgefertigt, sodass er binnen zehn Minuten in einer schwarzen Limousine Richtung Innenstadt raste. Laut seinem Fahrer würde er in etwa 25 Minuten bei der Adresse im Amstel Business Park ankommen. Während sie sich durch den dichten Verkehr schlängelten und der Chauffeur versuchte, ein paar Minuten gutzumachen, kämpfte Paul mit alten Gefühlen und Erinnerungen. Er durfte seiner Vergangenheit nicht erlauben, ihn zu kontrollieren. Noch immer hatte er die Bilder nicht besiegt, immer wieder tauchten Fetzen vor seinem geistigen Auge auf. Und noch immer verfolgten ihn üble Schweißattacken, das letzte Mal kurz vor der Landung. Aber im Großen und Ganzen hatte er sich im Griff. Weil es keine Alternative gab für die Mitarbeiter der EuroBank, deren Leben bedroht wurde. Wo würden die Täter als Nächstes zuschlagen? An der Börse in Stockholm? Oder vielleicht doch in einer Filiale auf dem Land, irgendwo zwischen Chemnitz und Kaufbeuren? Sie hatten alleine in Deutschland über 600 Büros. Das Damoklesschwert der Erpresser schwebte über jedem einzelnen Mitarbeiter. Das Telefonat mit dem Referenten der Bundeskanzlerin hatte ihm ein wenig Mut gemacht, er hatte zwar nur vage von einer »möglichen Hilfe« gesprochen, aber für Paul klang das bedeutend vielversprechender als sein Gespräch mit den Herren vom BKA. Außerdem hatte es ihm die Möglichkeit eröffnet, der hitzigen Atmosphäre der Frankfurter Zentrale zu entkommen. Oder war er einfach nur froh, sich vor der Verantwortung drücken zu können? Vor seinem Abflug hatte er seinen Stellvertreter beauftragt, einen internen Krisenstab zu bilden, und einen externen Berater engagiert, der auf Erpressungen spezialisiert war. Mutete er ihnen zu viel zu? Nein, entschied Paul, der besonnene und souveräne Henrik eignete sich viel besser für die Leitung des Stabs als er. Er ließ sich in das teure Leder des Luxusschlittens sinken und atmete durch. Und schließlich tat er doch sein Bestes, um dieser Krise Herr zu werden, oder nicht? Die »mögliche Hilfe« bestand zunächst nur aus einer Adresse, die ihm ein Kurier des Bundeskanzleramts auf dem Frankfurter Flughafen übergeben hatte. Was verbarg sich dahinter? Worum machte die Politik in Deutschland ein derartiges Geheimnis? Jenseits aller Dämonen der Vergangenheit war seine Neugier geweckt.
Als sie die mysteriöse Anschrift erreicht hatten, ließ er sich noch zwei Straßenecken weiter fahren. Er wollte sich in Ruhe einen ersten Eindruck verschaffen und ging zu Fuß zu dem anonymen Bürogebäude aus Beton und Glas, das überall hätte stehen können, ausdruckslos und nichtssagend. Eine ideale Fassade für ein Staatsgeheimnis, das musste er zugeben. Es war kurz nach Mittag, die Angestellten strömten schirmbewehrt zurück zu ihren Arbeitsplätzen, niemand schenkte ihm Beachtung. Er las die Schilder der hier ansässigen Firmen, fand aber nur Unauffälliges: eine kleine Bank, eine Versicherung, ein IT-Unternehmen – die übliche Vorstadtmischung an einer zweitklassigen Adresse. Entschlossen betrat Vanderlist die kalte Eingangshalle, orientierte sich in Richtung des kleinen, etwas heruntergekommenen Tresens im rechten Eck.
»Guten Tag, mein Name ist Vanderlist, und ich habe einen Termin bei Herrn Heegen von der Loude IT Services«, stellte sich Paul vor. Gelangweilt deutete der Mann hinter dem halbrunden Empfangspult auf die Fahrstühle und und brummelte: »vierter Stock.« Doch Vanderlists durch seine militärische Vergangenheit geschultes Auge ließ sich nicht von der schäbigen Fassade täuschen: Die Beule unter dem Jackett und sein muskulöser Körperbau straften das gelangweilte Zeitunglesen und seine schnodderige Art Lügen. Das war kein einfacher Wachmann, SAS vielleicht oder ein deutscher Kampfschwimmer, auf jeden Fall ein ehemaliger Kollege. Wäre sein Unterarm nicht durch seine Kleidung verdeckt worden, hätte er sicher eines der für Eliteeinheiten typischen Tattoos entdeckt.
Gemeinsam mit einer aktenbewehrten Frau in den Vierzigern und einem Fahrradkurier betrat er den Aufzug und drückte die Taste für die vierte Etage. Begleitet vom Rauschen seines Funkgeräts verließ der Kurierfahrer im zweiten Stock die Kabine. Die leuchtende Neun verriet ihm, dass seine zweite Mitfahrerin noch weiter wollte.
Als sich die Aufzugstür in der vierten Etage mit einem scheppernden »Ding« öffnete, fand sich Vanderlist in einem schmucklosen Flur wieder. Die Farbe blätterte von den ehemals weißen Zargen der Tür, auf der Loude IT Services stand. Schulterzuckend drückte er die Klingel, was beinahe sofort mit einem lauten Summen des Türschlosses beantwortet wurde.
Auch im Inneren unterhielt die angebliche Computerfirma ein Büro, wie es allein in Amsterdam Tausende geben musste: ein Empfangsbereich, der in den Achtzigerjahren für die Ewigkeit gebaut worden war, mit einer jungen, aber nicht allzu hübschen Empfangssekretärin dahinter. Er wollte gerade die Tagesform seines Charmes an ihr überprüfen, als aus dem rechten Gang eine etwa dreißigjährige Frau auf ihn zukam. Sie war sehr schlank, hatte kastanienbraune, längere Haare und trug ein teures schwarzes Kostüm mit Stöckelschuhen, das Paul furchtbar spießig fand. Sie wäre auch bei der EuroBank nicht aufgefallen. Obwohl, vielleicht doch, dachte er, als er ihr in die Augen schaute.
»Hallo, Mr. Vanderlist, ich bin Agent Solveigh Lang.« Ihr Lächeln war sehr verbindlich und schien ihm ob der Situation unangemessen. Das Auffälligste an ihr waren die Augen. Trotz ihrer dunklen Haare waren sie von einem sehr hellen Blaugrau, irgendwie unheimlich. Sie erinnerten ihn an einen Wolf, nur funkelten sie aufgeschlossen, statt kalt und berechnend zu starren. Diese Augen konnten auch anders, da war er sicher.
»Guten Tag, Frau Lang, mein Name ist Paul Vanderlist. Von der EuroBank.«
»Wenn ich Sie Paul nennen darf, dürfen Sie Solveigh zu mir sagen«, bot sie ihm an, während sie seine Hand schüttelte. War das ein Naserümpfen gewesen? Nein, entschied Paul, er schwitzte ja gar nicht mehr.
Ihr Händedruck war fest, bei näherem Hinsehen wirkte sie gar nicht mehr so dünn, sondern sehr kraftvoll. Durchtrainiert. »Sehr gerne, Solveigh, ich heiße Paul.«
»Folgen Sie mir bitte, Sie werden schon erwartet.«
Energisch schritt Agent Lang den Gang hinunter, vorbei an geschlossenen Bürotüren mit kleinen weißen Schildern neben jeder Tür. »Customer Service« stand auf den meisten, manchmal ein Name und ein hochtrabender Titel. Es war bemerkenswert still für ein Büro, einzig das Stakkato ihrer Schritte auf dem ausgetretenen harten Teppichboden war zu hören.
Am Ende des Gangs öffnete sie schwungvoll die Tür zu einem schmucklosen Konferenzraum. »Conference 2« stand auf der angestaubten Tafel neben der Tür.
Die Büros sind nicht echt, dämmerte es Paul. So etwas kannte er nur aus Spionagefilmen. Brad Pitt in einem chinesischen Restaurant in Soho. Hinter der Küche findet er eine Tür, die sich nur mit einem Code öffnen lässt. Brad Pitt betritt ein geheimes Waffenlager der CIA. Oder so ähnlich. Paul ließ seinen Blick durch den Raum streifen und fragte sich, ob in dem kargen Konferenzraum auch eine Geheimtür verborgen war. Quatsch, alles Hollywood, sagte er sich und strich sich über den grauen Bart.
»Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir Besucher empfangen, ich hoffe, Sie haben Verständnis für unsere Sicherheitsmaßnahmen«, leitete Agent Lang ein.
»Aber natürlich«, sagte Paul und grinste schief.
Agent Lang öffnete ein Wandpaneel, hinter dem sich eine Tastatur mit einer Reihe von Sensoren verbarg.
»Ihnen wurde eine fünfzehnstellige Zahlenkombination übergeben. Bitte identifizieren Sie sich mit dieser Nummer an dem Terminal, und erlauben Sie danach einen Iris-Scan, den wir mit Ihren Biodaten abgleichen, die wir vom Bundeskanzleramt erhalten haben. Damit wir uns sicher sind, dass Sie auch wirklich Paul Vanderlist sind«, zwinkerte sie ihm zu.
Paul trat vor, fischte aus seiner Jacketttasche den Ausdruck mit dem Code hervor und gab die endlose Zahlenreihe ein. Er versuchte krampfhaft, nicht zu blinzeln, als das grünliche Licht über sein rechtes Auge streifte, bevor die Bestätigung »confirmed« auf dem Display erschien.
»Na dann, Herr Paul Vanderlist von der EuroBank, willkommen bei der European Council Special Branch oder kurz ECSB«, vermeldete Agent Lang. Am Ende des Konferenzraums glitt lautlos ein Teil der Wand zur Seite und gab einen engen Fahrstuhl frei. Solveigh und Paul betraten die schwarz gestrichene Kabine. Als sich die Tür schloss, klang die Welt um ihn plötzlich dumpf, als bestünden die Wände aus dickem Leder. Nach einem weiteren Iris-Scan, diesmal bei ihrem Auge, setzte sich der Aufzug in Bewegung.
KAPITEL 9
Asti (Piemont), Italien
Tag 1: Montag, 7.Januar, 14:54 Uhr
Für Leonid Mikanas war die Fahrt durch die bergige Landschaft des Piemont der Vorhof zur Hölle. Die Italiener fuhren für seinen Geschmack viel zu schnell, und die Autobahnen waren so furchtbar eng, dass er sich fragte, ob ein Umweg über die Landstraßen nicht sicherer war. Nein, es würde zu lange dauern, besann er sich auf ihren eng gesteckten Zeitplan, den er und Mao besprochen hatten. Das Problem war nicht etwa, dass die Italiener schlechte Autofahrer wären, im Gegenteil. Aber sie riskierten bei ihren halsbrecherischen Überholmanövern und dem schnellen Ein- und Ausscheren Blechschäden, und er konnte auch den kleinsten Eintrag in das Register seiner Versicherung auf dieser Fahrt nicht gebrauchen. Kleinigkeiten sind die Sandkörner im Getriebe eines guten Plans, hatte Mao ihm erläutert. Sein chinesischer Partner liebte Sinnsprüche und ging Leonid immer wieder damit auf die Nerven. Er war ein Mann der Tat, ein Soldat, ein Mörder vielleicht. Aber kein Dummschwätzer. Einmal hatte er Mao sogar Schläge angedroht, wenn er nicht aufhörte, in einer Tour den alten Mann zu zitieren, gemeint war Konfuzius, unerschöpfliche Quelle von Maos Schlaumeierei. Dennoch hatte er natürlich recht: Ein Auffahrunfall, eine Panne auf einer einsamen Passstraße und ähnliche widerliche Kleinigkeiten waren die wenigen Unbekannten in ihrem Masterplan. Aber auch dafür hatten sie vorgesorgt, in seiner Tasche hatte er über fünftausend Euro in bar für Unvorhersehbares: Schmiergeld für einen Polizisten, schnelles Bares für einen Blechschaden. Geld ist der Motor der Wirtschaft, Bargeld der Arschtritt des kleinen Mannes. Leonid ärgerte sich darüber, dass er sich noch einen der dummen Sprüche gemerkt hatte. Aber auch er war Profi und sich darüber im Klaren, wie wichtig es war, dass er sein nächstes Ziel erreichte, ohne Spuren zu hinterlassen. Deshalb hatte er schon vier Mal das Auto gewechselt und würde heute noch einmal in ein neues umsteigen. Anfangs hatte er dagegen argumentiert, er hatte solch übertriebene Vorsicht noch nie walten lassen, aber ihr Unterfangen hatte eine neue Dimension, das musste er zugeben. Zum Glück galt das auch in finanzieller Hinsicht, denn dies sollten die letzten Bluttaten seiner Karriere sein.
Ein Mensch wie Mao war ihm noch nicht untergekommen. Obwohl er ihm nicht vertraute, hatten ihn sein Charisma und nicht zuletzt die Kühnheit seines Plans tief beeindruckt. Aber Maos Innerstes war schwarz wie die Seele eines Raben, das hatte Leonid an seinen Augen gesehen, kalte dunkel schimmernde Perlen, lidlos und böse. Er würde Vorkehrungen treffen müssen, damit er am Ende nicht selbst auf Maos Opferliste landete. Dem Halbchinesen war es egal, dass Menschen starben, und obwohl auf Leonids Konto mehr Morde gingen, als er Finger hatte, war ihm dennoch keines seiner Ziele gleichgültig. Das Töten war notwendig, er tat seine Arbeit, so wie früher. Und die Umsetzung ihres Plans war nicht mehr aufzuhalten, an seinem Ende wartete ein Topf mit Gold, wie am Ende des Regenbogens. Grundsätzlich störte es Leonid nicht, Unrechtes zu tun. Dazu waren seine Instinkte nach Jahren des Tötens zu abgestumpft, aber tief in seiner Brust nagte der Zweifel. War es richtig, Sophie Besson zu erschießen? War es richtig, das Opfer abzuschlachten, zu dem er jetzt unterwegs war? Denn nichts anderes waren die Mitarbeiter der Bank: unschuldige Opfer.
Ende der Leseprobe