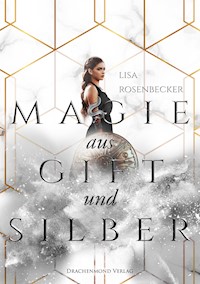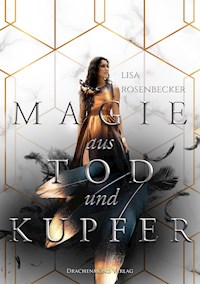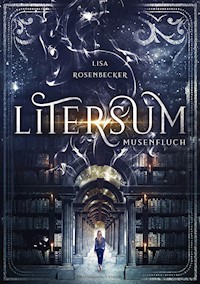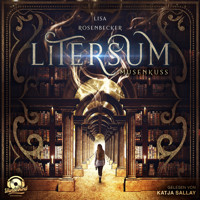Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Arya hat ihre Zukunft als Leibwächterin klar vor Augen: Sie will ihrer Freundin Elena um jeden Preis zur Seite stehen. Schon seit vielen Jahren bereitet sie sich darauf vor und nimmt sogar ihre verhasste Gabe in Kauf, die ein gut behütetes Geheimnis ist. Ebenso wie Elenas wahre Herkunft. Aus diesem Grund lässt sich Arya auf eine Reise ein, bei der sie nicht nur mit ihrer Vergangenheit, sondern auch mit der Zukunft konfrontiert wird. Denn ihr Reisegefährte Finn weckt unbekannte Gefühle in ihr. Während Arya versucht auf ihr Herz zu hören, kristallisiert sich eine Bedrohung für das gesamte Königreich heraus, der sich die Gefährten am Ende gemeinsam stellen müssen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lisa Rosenbecker
Arya & Finn
Im Sonnenlicht
Astrid Behrendt Rheinstraße 60, 51371 Leverkusenwww.drachenmond.de, [email protected]
Satz, Layout Martin Behrendt
Korrektorat Lillith Korn
Illustrationen Slava Gerj / shutterstock.com
Umschlaggestaltung Alexander Kopainski / Kopainski Artwork
ISBN: 978-3-95991-234-1 ISBN der Druckausgabe: 978-3-95991-134-4
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Epilog
Danksagung
Für meine Familie und Malte
Weil die kleine Träumerin dank euch ihre Träume auch erfüllen kann.
Prolog
Arya
Die Feuerbestattung begann mit dem ersten Sonnenstrahl des Tages.
In allen mir bekannten Abenteuergeschichten harmonierte das Wetter mit der Verfassung des Helden. War er in guter Stimmung, schien die Sonne, hatte er einen schlechten Tag, regnete es. Im echten Leben verhielt es sich anders. Auch an Tagen voller Trauer schien die Sonne manchmal mit all ihrer Kraft – so wie heute.
Während ich mein Gesicht in die wärmenden Strahlen hielt, freute ich mich jedoch darüber. Onkel Relior hatte die Sonne und ihre Göttin sein ganzes Leben lang verehrt, und es hätte ihm Freude bereitet, von ihnen in einen strahlend blauen Himmel aufgenommen zu werden. Er hatte mir immer erzählt, wie wichtig der Glaube an die Götter und an ein Leben nach dem Tode für viele Menschen sei. Für sie waren die Schattenseiten des Alltags mit diesem Glauben und der damit verknüpften Hoffnung auf ein erfülltes Leben nach dem Tod einfacher zu ertragen gewesen. Ich glaubte nicht daran, würde es aber niemals schlechtreden wollen. Ich fand den Gedanken an über uns wachende Götter ein wenig tröstlich, aber tot bedeutete für mich tot. Ich machte mir keine Gedanken um ein Leben danach, sondern lebte lieber im Hier und Jetzt. Und genau in diesem Augenblick verspürte ich eine große Sehnsucht nach meinem Onkel, die mir wie eine schwere Last auf dem Herzen lag.
Ich ließ meinen Blick über die anderen Anwesenden schweifen. Es waren viele Leute in den Garten des Schlosses gekommen, um von meinem Onkel Abschied zu nehmen. Wir alle standen in einem Halbkreis um den Scheiterhaufen herum und betrachteten den Priester, der sich uns zugewandt hatte. In den meisten Gesichtern sah ich Trauer. Die anderen hatten gelernt, ihre Gefühle zu kontrollieren und gaben nichts davon preis. Doch auch sie trauerten um den Mann, der vor zwei Tagen seiner schweren Krankheit erlegen war. Ich kannte jeden von ihnen und wusste, wie es in ihrem Inneren aussah. Für viele von ihnen war er ein Mentor gewesen. Insbesondere für mich. Relior war mein Onkel, Ziehvater, Meister, Lehrer und Freund gewesen, vereint in einer Person. Alles was ich heute war, verdankte ich ihm und seinem großen Herzen. Seit meinem dritten Lebensjahr hatte er mich aufgezogen, als meine Mutter es nicht mehr konnte und wollte, und mich somit vor einem Leben im Waisenhaus bewahrt. Als ich älter wurde, lehrte er mich das Kämpfen und brachte mir bei, was ich für mein Leben wissen musste. Ich liebte ihn für alles, was er für mich getan hatte.
Die Stimme des Priesters erfüllte den Garten, doch ich hörte nicht hin, weil ich mir meine eigenen Gedanken über meinen Onkel machen wollte. Ich wusste, was der Priester erzählen würde, denn er hatte gemeinsam mit mir an seiner Rede gearbeitet. Ich blickte zum Scheiterhaufen hinauf, auf dem mein Onkel eingehüllt in ein weißes Laken lag. Durch die Sonne schimmerte der Stoff leicht golden, und es wirkte so majestätisch, dass es mir Tränen in die Augen trieb und mich meinen Blick abwenden ließ, um ihnen nicht nachzugeben zu müssen. Ich ließ mich doch auf die Worte ein, die der Priester sprach.
Er erzählte vom letzten Lebensabschnitt meines Onkels, den er dem Schutz des Königs gewidmet hatte. Er listete seine Erfolge als einfacher Soldat und später dann als Hauptmann der königlichen Leibwache auf. Ezra Relior habe das Land Maljonar und seinen König mit Stolz erfüllt. Dass dies der Wahrheit entsprach, erkannte man daran, dass auch König Trystan an diesem Morgen zur Bestattung gekommen war. Er stand links von mir zwischen seinen Männern in der ersten Reihe. Auch in seinen Augen konnte ich Tränen glänzen sehen.
Am Ende seiner Rede bat der Priester um einen Moment der Stille, in der jeder für sich Abschied von meinem Onkel nehmen konnte. Im Anschluss daran bat der Priester mich, zu ihm zu treten. Es wurde Zeit, dass ich meine Pflicht erfüllte und den Scheiterhaufen in Brand setzte. Ich trat an den bereitstehenden Feuerkessel und nahm die vom Priester dargebotene Fackel entgegen, die ich in die Flammen hielt. Es dauerte nicht lange und das Feuer sprang auf die in Öl getränkte Fackel über und entzündete sie. Der Rauch kratzte in meinem Hals und brannte in meinen Augen, doch ich ließ mir nichts anmerken.
Als ich mich dem Scheiterhaufen zuwandte, schluckte ich schwer. Meine Hand und die Fackel darin zitterten leicht. Ich hatte Menschen schlimme Dinge angetan, doch zu meinem Entsetzen war mir das leichter gefallen als die Aufgabe, die ich nun vor mir hatte.
Ich zögerte. Und während ich dastand und mich vor dem nächsten Schritt fürchtete, dachte ich daran zurück, wie Relior mir im Alter von sechs Jahren beigebracht hatte, dass dieses Zögern etwas Schlechtes war. Wir hatten auf einer Wiese gesessen und er meinte zu mir, dass ich bei allem, was ich tat, überzeugend wirken musste. Ich hatte mir einen Blumenkranz auf den Kopf gesetzt und versucht, ihn davon zu überzeugen, dass ich eine Elfe und er ein Elfenkönig war. Es hatte nicht funktioniert, aber mein Eifer ließ ihn Schmunzeln.
Zögere niemals, Arya. Bei der Erinnerung an diesen Moment vor siebzehn Jahren hörte ich seine Worte deutlich in meinem Ohr. So, als stünde er neben mir und würde sie mir zuflüstern. Mit gestrafften Schultern trat ich vor und steckte den Scheiterhaufen in Brand. Ohne zu zögern.
»Möge deine Seele in den Himmel fahren und von unseren Göttern in ein neues Leben geführt werden«, zitierte ich laut. Leise fügte ich hinzu: »Und möge dein neues Leben von der Sonne beschienen sein.« Das Feuer breitete sich rasch aus. Es sprang mit einem Knistern von einem Holzscheit zum anderen, während die Flammen größer wurden.
Lebe wohl, alter Elfenkönig. Ich danke dir für alles.
Kapitel 1
Arya
Es dauerte den ganzen Tag und die darauffolgende Nacht, bis der Scheiterhaufen heruntergebrannt war und nichts als glühende Asche übrig blieb. Als letztes verbliebenes Familienmitglied war es meine Pflicht gewesen, das Feuer zu bewachen, bis die letzte Glut verglommen war.
Dem Götterglauben zufolge bewahrte man die Seele des Verstorbenen mit diesem Ritual davor, auf ihrem Weg in das nächste Leben von Dämonen abgefangen und misshandelt zu werden. Gleichzeitig bekundete man damit seinen Respekt und seine Zuneigung. Schon zu Lebzeiten hatte ich Relior diese spüren lassen, trotzdem wollte ich ihm auf diese Art die letzte Ehre erweisen und seinen Glauben würdigen.
Im Schneidersitz saß ich auf dem Rasen vor den Überresten des Scheiterhaufens und wischte mir mit dem Handrücken mehrmals die Ascheflocken vom Gesicht, die sich durch den Wind in alle Richtungen verteilten. Ich hatte mir in den letzten Stunden verboten, darüber nachzudenken, dass die Asche nicht nur aus Holz entstanden war, hatte meinen Kopf von allen Gedanken befreit und versucht, mich nur auf die Geräusche der Umgebung zu konzentrieren. Ich wollte in den letzten Augenblicken seines Daseins in unserer Welt stark für ihn sein und nicht über das Morgen nachdenken.
Für meinen Onkel hatte ich sogar die Anwendung meiner mir verhassten Gabe in Kauf genommen, da es die einzige Möglichkeit gewesen war, um bei ihm bleiben zu können. Auch wenn ich diese Gabe und die Tatsache, dass man mich gezwungen hatte sie einzusetzen, hasste. Ich hasste diesen Teil von mir.
Ich schob den linken Ärmel meiner dunklen Uniform ein Stück nach oben und betrachtete die grauen Linien auf meiner Haut. Sie waren das Einzige, das mich äußerlich von Menschen unterschied, die keine Gabe hatten. Verschnörkelt liefen sie von meinem Handgelenk den Arm hinauf, bis über meinen Rücken und hinunter über meinen rechten Oberschenkel. Sie waren schlicht, wie eine Tintenzeichnung unter der Haut, und doch so mächtig.
Als würde es diese Ansicht bestätigen wollen, begann das Mal zu brennen und ich verzog vor Schmerzen das Gesicht. Früher waren diese Schübe nur ein Zwicken gewesen. Erst in den letzten Jahren hatten sie an Intensität zugenommen und fühlten sich nun an wie Feuer auf meiner Haut. Ich sah zu den Resten des Scheiterhaufens vor mir und dachte darüber nach, wie es von nun an mit mir und meiner Gabe weitergehen sollte.
Bisher hatte Hauptmann Fanras meinen Onkel als Druckmittel benutzt, um mir seinen Willen aufzwingen zu können. Hätte ich mich widersetzt, hätte er dafür gesorgt, dass ich meinen Onkel nie wiedersah. Er drohte mir damals, dass auch der König nichts daran ändern könnte, wenn er sich dazu entschloss, uns zu trennen. Er sagte, er hätte Mittel und Wege, um seinen Willen durchzusetzen. Aber nun, da Relior nicht mehr am Leben war? Würde Fanras endlich Ruhe geben?
Ich seufzte resigniert. Niemals würde er mich so leicht davonkommen lassen. Sicherlich würde ihm ein neues Druckmittel einfallen, um mich weiterhin nach seinem Belieben als Waffe einsetzen zu können.
Wie sehr ich ihn hasste. Für die nächsten zwei Tage hatte ich noch Ruhe vor ihm, so viel Zeit musste er mir zum Trauern gewähren. An das Danach wollte ich gar nicht denken.
Silas’ Stimme riss mich aus meinen Gedanken, als ich ihn meinen Namen rufen hörte. Er kam den Hügel hinauf, auf dem der Scheiterhaufen stand. Von hier oben hatte man einen wunderbaren Blick auf die Dächer der Hauptstadt Belessan, die Felder und Berge in der Ferne. Normale Bürger wurden außerhalb der Stadtmauern verbrannt. Enge Vertraute des Königs bekamen das Privileg der Verbrennung auf diesem Hügel im Schlossgelände.
Die Sonne war gerade erst am Horizont aufgegangen und belohnte die Frühaufsteher, wie Silas einer war, mit einem wunderschön rot und violett gefärbten Himmel. Er war der Sohn einer Köchin und deswegen lag ihm das frühe Aufstehen im Blut. »Guten Morgen, Arya«, begrüßte er mich, als er bei mir angekommen war, und ließ sich neben mir nieder. Er zog die Beine seiner hellen Leinenhose mit einer Hand ein Stück hoch, um bequem sitzen zu können. Mit der anderen hielt er mir eine Schüssel hin. »Meine Mutter hat mich gebeten, dir eine Suppe vorbeizubringen.« Der Inhalt der Schüssel dampfte und roch verführerisch. Ich nahm sie ihm aus der Hand und allein die Wärme des Tons wirkte Wunder auf meine kalten Hände. Aber Yusras Suppen halfen nicht nur bei Hunger oder kalten Fingern, sie waren auch Nahrung für die Seele, wenn man ihren eigenen Worten Glauben schenken wollte.
»Richte ihr bitte meinen Dank aus. Es riecht herrlich!«, sagte ich begeistert. Und ebenso herrlich schmeckte es. Während ich die Suppe aß, blickte ich gemeinsam mit Silas auf die letzten glühenden Überreste des Scheiterhaufens. »Dein Onkel war ein herzensguter Mann, Arya. Es tut mir furchtbar leid, dass du ihn verloren hast.« Mir fiel keine passende Antwort ein, die mich nicht in Tränen hätte ausbrechen lassen. Also schwieg ich und lächelte ihn an.
»Ich habe Relior gerne bei seinen Kampfübungen zugesehen«, fuhr er fort. »Es war, als würde er mit den Schwertern tanzen. Er war ein Meister seines Fachs.« Ich lächelte bei der Erinnerung an diese Schwerttänze und fand endlich meine Stimme wieder.
»Du hast recht, er war ein wahrer Meister. Zum großen Teil hat er das seiner Gabe für das Kämpfen zu verdanken. Er hat mich zwar seit meiner Kindheit unterrichtet, aber so gut wie er werde ich niemals sein.«
»Wer weiß, vielleicht macht deine Gabe dich eines Tages auch zu einer Meisterin der Schwerter.« Er lächelte mir aufmunternd zu. Ich wusste, er meinte es gut, aber leider wusste ich es noch ein bisschen besser. Es gab eine Einschränkung in meinem Leben, die meine Gabe mir auferlegte. Wenn ich nicht wollte, dass meine Freunde mich verabscheuten, durfte ich ihnen niemals von ihrer wahren Natur erzählen. Ich selbst kam mit diesem Teil von mir nicht zurecht, wie sollte es dann anderen gehen? Bis auf wenige Ausnahmen wusste niemand von den Zügen, die meine Gabe angenommen hatte. Meine Freunde waren der Überzeugung, dass die Art meiner Gabe noch im Dunkeln lag. Ganz abwegig war dies nicht. Viele gezeichnete Menschen fanden niemals heraus, worin ihre Gabe bestand. Ich gab vor, einer von ihnen zu sein.
»Wie geht es Elena? Sind ihre Kopfschmerzen besser geworden? Yusra hatte doch bestimmt ein Zaubermittel, mit dem sie ihr helfen konnte?«, fragte ich, um Silas von diesem Thema abzulenken.
»Sag das bloß nicht zu meiner Mutter«, schimpfte Silas. »Du weißt doch, Magie ist ihr nicht geheuer. Aber ja, Elena geht es besser. Sie ist auf ihrem Zimmer und hat nach dir gefragt.«
»Danke. Ich werde so bald wie möglich zu ihr gehen.« Das bedeutete, sobald ich meine Gedanken sortiert hatte und zu einem normalen Gespräch fähig war. Silas nickte, nahm mir die leere Schüssel aus der Hand und stand auf. Er wandte sich zum Gehen, hielt aber mitten in der Bewegung inne und drehte sich noch einmal zu mir um.
»Dir ist bewusst, dass ich alles für Elena tun würde, oder?«
Stirnrunzelnd sah ich zu ihm auf. Ich wusste nicht, worauf er hinauswollte, aber bevor ich etwas sagen konnte, plapperte er auch schon weiter.
»Natürlich weißt du das und niemand versteht das besser als du. Immerhin wirst du bald ihre Leibwächterin sein und würdest sogar dein Leben für sie geben.« Er fuhr sich mit einer Hand durch die Haare und verriet dadurch seine Aufregung. Ich unterbrach ihn nicht.
»Ich möchte einfach, dass du weißt, dass ich auch dumme Sachen für sie machen würde. Sehr dumme. Und es wäre schön, wenn du dahingehend auch etwas offener sein könntest. Oder mir zumindest nicht den Hals umdrehst. Oder ihr.« Er blickte mich mit einer Mischung aus Verzweiflung und Hoffnung an, aus der ich nicht schlau wurde.
»Silas, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Hat Elena vor, eine Dummheit zu begehen?« Ich musterte ihn misstrauisch. Dieses Verhalten passte nicht zu ihm.
Silas biss sich auf die Unterlippe und sagte einen Moment lang nichts. Plötzlich lockerte sich seine Haltung und er lächelte mich an, als wäre nie etwas gewesen. »Ach, du kennst uns. Wir träumen von großen Abenteuern und haben die eine oder andere blöde Idee. Absolut nicht ernst zu nehmen.«
Skeptisch hob ich eine Augenbraue und fixierte ihn. Dieser Blick bedeutete so viel wie »Und da bist du dir ganz sicher?«. Ich musste nichts sagen.
»Ehrlich! Du kannst mir glauben! Oh, war das nicht meine Mutter? Ich muss los. Bis bald, Arya!« Er wirbelte herum und rannte den Weg zum Schloss zurück. Ich konnte nur den Kopf schütteln. Feigling. Was die beiden sich wohl dieses Mal ausgedacht hatten? Gemeinsam kamen sie immer auf unsinnige Ideen.
Zum zweiten Mal an diesem Morgen wurden meine Gedanken unterbrochen. Der Priester von der Bestattung war eingetroffen. Er würde die Asche meines Onkels segnen und sie in ein dafür vorgesehenes Holzkistchen füllen, das ich später an einem ausgewählten Ort begraben würde.
Ich schloss die Augen und hielt mein Gesicht in die Sonne. Der Sommer kehrte ein und mit ihm dieses wundervolle Wetter. Diese Jahreszeit hatte mein Onkel immer am liebsten gehabt. Doch dieses Jahr würde er den Sommer nicht erleben.
Der Frühling ging und nahm meinen Onkel mit sich.
Am nächsten Abend ging ich nach ein paar Übungsstunden im Hof in Yusras Küche. Dort roch es nach allen nur erdenklichen Gewürzen, die sich in einem riesigen Regal an der Wand stapelten. Dosen verschiedener Größen, getrocknete Pflanzenbüschel, klobige Wurzeln und allerlei mehr tummelten sich auf den Regalbrettern. Sie waren Yusras ganzer Stolz. Früher hatte ich hier sehr viel Zeit verbracht, mir all die verschiedenen Dinge in den Regalen genauestens angesehen und mir von ihr erklären lassen. Heute hatte ich das meiste schon wieder vergessen.
Die rundliche Yusra wirkte nach außen hin ruppig, aber sie besaß ein Herz aus Gold. Als Elena, Silas und ich noch Kinder gewesen waren, hatte sie unsere Versteckspielchen in ihrer großen und geschäftigen, aber gemütlichen Küche geduldet, uns frisches Brot gebacken und mit heißer Milch versorgt. Die Versteckspiele hatten wir hinter uns gelassen, aber das Brot und die Milch gab es noch immer. Auch an diesem Abend hatte Yusra mich mit einem Becher davon versorgt und die Milch mit Honig und Zimt verfeinert. »Für die ganz schweren Fälle von Herzschmerz«, hatte sie gesagt. Sie wuselte durch die Küche und gab den Küchenmädchen und Dienern die letzten Anweisungen für das Abendessen. Halbe Sachen gab es bei ihr nicht, es musste alles perfekt sein. Töpfe klapperten, kleine Flüche wurden ausgestoßen und mit jedem Atemzug roch es besser. Das Wasser lief mir im Mund zusammen und das, obwohl ich keinen Hunger hatte. Nachdem sie die letzten Befehle erteilt hatte, setzte sie sich zu mir an den Esstisch. Mehl hing in ihren hochgesteckten braunen Haaren und auf ihrer Schürze klebten ein paar Teigreste.
»Manche Sachen lernen diese jungen Dinger nie!«, beschwerte sie sich und wedelte sich mit der Hand Luft zu. »Rosmarin und Thymian zusammen in einem Gericht. Pah! So etwas gibt es bei mir nicht.« Sie atmete zur Beruhigung einmal tief durch. Dann nahm sie meine Hand in ihre und tätschelte sie mit der anderen.
»Hat die Milch geholfen? Ich weiß, dass nichts deinen Verlust aufwiegen kann. Aber vielleicht hilft sie, den Schmerz wenigstens für eine Weile verschwinden zu lassen.«
»Das hat sie. Danke, Yusra. Ich werde den Verlust für den Rest meines Lebens spüren, aber ich werde mich nicht davon unterkriegen lassen und versuchen, Stärke daraus zu ziehen, um meinen Onkel stolz zu machen.« Um sie zu beruhigen, bemühte ich mich um ein halbwegs fröhliches Lächeln. Doch Yusra konnte man nicht so leicht etwas vormachen. Ihre Augen waren bei meinen Worten feucht geworden und glänzten verräterisch.
Sie drückte meine Hand. »Du bist eine starke junge Frau. Dein Onkel war stets stolz auf dich. Und bei mir ist es auch so.« Ein lautes Scheppern aus dem hinteren Teil der Küche ließ Yusra die Augen verdrehen.
»Göttin, wenn doch nur alle Mädchen mich stolz machen würden.« Sie warf die Hände in die Luft und erhob sich, bereit, den Störenfried ausfindig zu machen.
Ich beschloss zu verschwinden. Schnell trank ich den letzten Schluck Milch und sah zu, dass ich schleunigst aus der Küche kam. Ich vernahm noch die Worte »Wie oft soll ich es euch noch sagen …«, dann war ich aus der Tür gehuscht und auf dem Weg zu Elena.
Kapitel 2
Finn
Etwa zwei Wochen zuvor
Das Wirtshaus Goldener Eber am Rande von Belessan war nicht gut besucht, was mir recht war. Nur ein paar der alten, dunkelbraunen Holztische waren besetzt und die Lautstärke erträglich. Ich wollte einen Krug Bier, einen Tisch für mich alleine und keinen, der mich in meiner Ruhe störte, damit ich endlich dazu kam, meine Landkarte zu bearbeiten und die neu gefundenen Handelspartner und ihre Standorte einzutragen.
Bero hatte mich wie eine unerwünschte Katze aus unserem Haus verscheucht, weil ich ihn angeblich beim Kochen störte. Ich musste lächeln, da der Vergleich hervorragend zu meinem Spitznamen passte.
Ich maß mit den Fingern gerade eine grobe Entfernung auf der Karte ab, als ein Schatten darauf fiel.
»Bist du Finn, der ›Streuner‹?«
Ich betrachtete noch einen Moment lang die vor mir ausgebreitete Landkarte, ehe ich hoch sah.
Was ich sah, überraschte mich. Vor mir stand ein Mädchen, vielleicht drei oder vier Jahre jünger als ich, in einem zerschlissenen grünen Umhang mit Kapuze. Auch ihr Kleid war grün, aber ganz offensichtlich nicht ihr eigenes. Es war ihr viel zu groß. Unter der Kapuze kamen lange hellblonde Haare zum Vorschein. Sie war ein hübsches Ding, aber nicht mein Geschmack.
»Ich bevorzuge nur Finn, aber ja, ich bin der, den alle ›Streuner‹ nennen. Wie kann ich dir helfen?« Ich lehnte mich auf der Holzbank zurück und trank einen Schluck Bier. Eigentlich mochte ich dieses Gebräu nicht, aber das Wasser hier schmeckte noch schlimmer. Nicht mal aufgekocht für einen Tee war es genießbar.
»Mir ist zu Ohren gekommen, dass keiner das Königreich Maljonar so gut kennt wie du. Außerdem habe ich gehört, dass du für eine angemessene Entlohnung Aufträge annimmst. Um einen Gegenstand von einem Ort zum anderen zu transportieren, zum Beispiel.«
Soso. Was sie wohl überbracht haben wollte? Liebesbriefe? Neue Kleider?
»Es kommt ganz darauf an, um was es sich handelt. Je wichtiger oder …«, ich beugte mich verschwörerisch vor, »illegaler der Gegenstand, desto höher ist der Preis.« Ich lehnte mich wieder nach hinten. Aus dem Augenwinkel konnte ich eine Bewegung hinter dem Mädchen wahrnehmen. Ich sah gerade noch einen Schopf blonder Locken unter einem Tisch verschwinden. Ilias.
»Was wäre der Preis für zwei junge Frauen?«, fragte sie unbeirrt.
Im ersten Moment war ich entsetzt, im nächsten musste ich lachen. Diese Frage war zu absurd. »Tut mir leid, aber Menschenhandel ist selbst für mich eine Nummer zu groß. Immerhin habe ich einen Ruf zu verlieren!«, sagte ich empört.
Sie war doch tatsächlich so dreist und rollte mit den Augen, bevor sie fortfuhr. »Nicht im Sinne von Ware. Ich würde sie eher als Reisegäste bezeichnen«, erklärte sie.
Das machte mich nun doch neugierig. Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Und wo, wenn ich fragen darf, soll es hingehen?«
»Nach Letilis, die Stadt im Wasser«, sagte sie.
Ich konnte meine ernste Miene kurz bewahren, dann musste ich erneut lachen. Das wurde ja immer besser! »Mädchen, das ist eine Reise von mindestens einer Woche. Auf dem Rücken eines Pferdes. Ich glaube nicht, dass du das wirklich willst. Was gibt es da, das dich interessiert? Ich gehe doch davon aus, dass du einer der dieser zwei Reisegäste wärst.« Den letzten Teil sagte ich nicht ganz ohne Belustigung in der Stimme.
Sie ließ sich davon nicht irritieren, sah mir mit erhobenem Kopf in die Augen und erwiderte ernst: »Dein Auftrag würde so aussehen: Du bringst uns nach Letilis zum Lichterfest, dort bleiben wir ein paar Tage und dann bringst du uns zurück nach Belessan. Nenn mir deinen Preis und ich zahle ihn.« So langsam kam mir die Vermutung, dass ich es hier mit einem Mädchen aus reichem Hause zu tun hatte, das rebellieren wollte. Und was wäre besser dafür geeignet, als auszureißen? Ich war mir sicher, dass sie jeden Preis zahlen konnte, aber für kein Geld der Welt würde ich diesen Auftrag annehmen.
Ich betrachtete sie genauer. Sie hielt sich sehr gerade und strahlte etwas aus, das respekteinflößend wirkte. Ihre Kleidung hatte sie vermutlich einem Dienstmädchen abgeschwatzt, um in diesem weniger noblen Teil der Stadt nicht aufzufallen. Das war sehr schlau, aber gleichzeitig auch sehr gefährlich.
»Tut mir leid, ich muss ablehnen. Unbelebte Dinge sind mein Spezialgebiet. Ich bin doch kein Fremdenführer.« Mit einem Wink meiner Hand gab ich ihr zu verstehen, dass das Gespräch für mich beendet war. Ich hoffte, dass sie den Hinweis verstand, und beugte mich wieder über meine Karte.
»Gut. Aber falls du es dir anders überlegen solltest, kannst du beim Gewürzhändler auf dem Markt eine Nachricht für mich hinterlassen. Es ist mir wirklich wichtig, sonst wäre ich nicht persönlich hergekommen«, sagte sie mit Nachdruck.
Ich hatte es geahnt. Sie plante, heimlich auszureißen. Wahrscheinlich hatten ihre Eltern ihr das hundertste Kleid verwehrt und dies war ihre Art, sich dafür zu rächen. Ohne aufzublicken erwiderte ich: »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Meinung nicht ändern werde. Tut mir leid. Wirklich.« Ich sah kurz zu ihr auf und schenkte ihr ein Lächeln, das normalerweise alle Mädchen zum Schmachten gebracht hätte. Aber bei ihr erwies es sich als wirkungslos.
»Mein Name ist Elena«, sagte sie und verschwand.
Ich schüttelte den Kopf. Frauen waren komische Wesen.
»Du kannst jetzt rauskommen, Ilias«, murmelte ich, während ich erneut die Karte studierte. Für seine sieben Jahre war Ilias noch recht klein, aber flink und unglaublich geschickt im Anschleichen. Vermutlich war es purer Zufall gewesen, dass ich seinen Lockenschopf überhaupt bemerkt hatte. Er rutschte zu mir auf die Bank und sah dem Mädchen hinterher.
»Solltest du nicht eigentlich zu Hause bei Bero sein?«, fragte ich.
»Er schickt mich, weil das Essen fertig ist und ich dir Bescheid sagen soll.«
»Was gibt es denn?«
»Wildschwein.«
»Dann aber nichts wie los! Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen.« Beros Kreationen in der Küche waren ein Gaumenschmaus, den ich nicht verpassen wollte. Ich rollte meine Karte zusammen, verkorkte das Tintenglas und steckte alles in meine Tasche. Nachdem ich das Bier beim Wirt bezahlt hatte, machte ich mich mit Ilias auf den Heimweg.
Wir liefen gerade über den leeren Marktplatz, als er mich fragte: »Wieso willst du den Auftrag nicht annehmen, Finn? Sie schien doch ganz nett zu sein und wir waren schon oft in Letilis.«
»Das mag sein, aber mach so eine Reise mal mit Frauen. Das ist kein Spaß. «
»Wieso?« Mit seinen großen blauen Augen sah er mich fragend an, während er neben mir her hüpfte.
»Frauen bringen auf Reisen Unglück. Und sie sind anstrengend. Ständig muss man sie beschützen. Oder aber es ist ihnen zu dreckig oder zu kalt. Oder beides«, erwiderte ich genervt.
»Magst du Frauen nicht?«, fragte Ilias.
»Doch, doch, ich mag sie. Nur nicht auf Dauer.«
»Aha.« Ilias tat so, als würde er verstehen, was ich meinte. Dann aber siegte seine Neugierde über seinen Stolz. »Was genau bedeutet das?«
»Das erkläre ich dir, wenn du älter bist. Und jetzt komm.« Ich zerzauste Ilias’ blonden Haarschopf, nahm ihn hoch und setzte ihn mir auf die Schultern. »Lass uns schnell nach Hause gehen, sonst verputzt Bero das ganze Wildschwein alleine.«
Ilias lachte und dieser schöne Klang begleitete uns auf dem Rest des Weges.
Beros Wildschweinbraten war absolut göttlich. Ich hatte mich mit Fleisch, Kartoffeln und Gemüse so vollgestopft, dass ich fluchte, als es nach dem Essen an der Tür klopfte. Am liebsten hätte ich mich kein Stück mehr bewegt. Ich erhob mich ächzend und schleppte mich durch den kleinen Flur zur Tür.
Meine Laune besserte sich nicht, als ich sah, wer vor der Tür stand. Es war Jarwen, ein Handlanger meines Vaters. Er war in schwarz gekleidet und der Schlag Mann, dem man abends in dunklen Gassen lieber aus dem Weg ging.
»Dein Vater will dich sehen. Jetzt«, raunte er. Dann verschwand er in der dunklen Straße und wurde eins mit den Schatten.
Mein Vater war vor einigen Monaten zurück nach Belessan gezogen und ich hatte ihn bisher erst einmal besucht. Wenn er zu so später Stunde nach mir schicken ließ, war es ernst und ich wollte ihn nicht warten lassen. Vielleicht hatte er einen neuen, akzeptablen Auftrag für mich, den ich gut gebrauchen konnte. Doch das Geld war noch nicht so knapp, als dass ich deswegen zu einem Reiseführer für zwei Mädchen geworden wäre.
Ich brachte Ilias noch ins Bett, der nach dem Essen fast sofort einschlief. Wie gerne hätte ich mit ihm getauscht. Bero werkelte in der Küche, als ich ging, und war so in seine Arbeit versunken, dass er mein Gehen nicht bemerkte. Die Küche war sein Reich, in dem er am liebsten alles allein regelte. König Bero und seine Geschirr-Untertanen im Reich der Küchen.
Die frische Luft und der Spaziergang zum Haus meines Vaters taten mir gut. Als ich bei ihm ankam, fühlte ich mich nicht mehr so träge und müde. Ich machte mich mit dem Türklopfer bemerkbar. Jarwen öffnete mir wenig später.
»Im Arbeitszimmer«, sagte er und zog sich dann in das obere Stockwerk des großen Hauses zurück. In all den Jahren, in denen ich ihn kannte, war er noch nie sehr gesprächig gewesen. Bei seinem Arbeitgeber war das aber auch nicht verwunderlich. Er hielt nicht viel von unnötigen Gesprächen.
Ich atmete tief durch, bevor ich durch den dunklen Gang des Hauses zum Arbeitszimmer ging und vor der Tür stehen blieb. Das Haus meines Vaters zeugte in Größe und Ausstattung von seinem Reichtum, um den ihn viele in der Stadt beneideten. Ich klopfte an, wartete auf das »Komm rein« meines Vaters und trat dann ein.
Das Arbeitszimmer war ein großer Raum. Die Möbel waren alt und dunkel, allerdings von beachtlichem Wert. An der linken Wand standen Regale, die mit Büchern, Schriftrollen und anderen Mitbringseln von den Reisen meines Vaters gefüllt waren. Neben dem Schreibtisch standen zwei Sessel und ein kleiner Tisch. Es roch leicht muffig. Nur auf einer Seite gab es ein Fenster, von dem aus man in den Innenhof blicken konnte. An diesem Fenster stand mein Vater und sah hinaus in die Dunkelheit.
Er drehte sich nicht um, als ich eintrat, sondern blieb weiterhin mit hinter dem Rücken verschränkten Armen am Fenster stehen. Mein Vater war groß und hielt seinen Körper aufrecht, doch sein Auftreten hatte in den letzten Jahren etwas von seiner Härte verloren. Seine Haare waren mittlerweile von vielen grauen Strähnen durchsetzt und verliehen ihm einen gealterten und ausgemergelten Ausdruck. Wenn man ihn so sah, würde man ihn älter schätzen, als er in Wahrheit war.
Meine Begrüßung fiel knapp aus, und ich ließ mich in einen der Sessel sinken. Nach außen hin versuchte ich Selbstbewusstsein auszustrahlen, in Wirklichkeit war mir ganz anders zumute. Ich fühlte mich in der Gegenwart meines Vaters nie besonders wohl.
Er sah noch einige Augenblicke aus dem Fenster, ehe er sagte: »Ich wusste nicht, dass du so wählerisch geworden bist, mein Sohn.« Sein Tonfall war eine Mischung aus Verärgerung und Belustigung. Als er sich zu mir umdrehte, sah ich, dass die Verärgerung dominierte. Er hatte seine dunklen Augen herausfordernd zusammengekniffen.
Ich nahm mir eine Münze vom Tisch und drehte sie zwischen meinen Fingern hin und her, um meine Anspannung zu überspielen. »Ich weiß nicht, was du meinst, Vater«, antwortete ich wesentlich ruhiger, als ich es für möglich gehalten hätte.
»Ich meine damit«, begann er, »dass du heute einen vielversprechenden Auftrag abgelehnt hast.« Er setzte sich hinter seinen Schreibtisch, stützte die Arme darauf ab und verschränkte die Hände ineinander. Er wirkte wie ein Lehrer, der seinen Schüler tadeln wollte. Es verfehlte seine Wirkung nicht. Ich fühlte mich, als hätte ich etwas falsch gemacht und würde nun auf meine gerechte Bestrafung warten. Er musste von dem Auftrag sprechen, mit dem das Mädchen zu mir gekommen war. Außer diesem hatte ich heute keine angeboten bekommen, geschweige denn abgelehnt. Woher er davon wusste, war mir schleierhaft. Ich hatte im Goldenen Eber keinen seiner üblichen Handlanger gesehen, die ihm davon hätten berichten können. Entweder hatte er neue Männer angeheuert, oder aber seine alten wurden besser im Spionieren. Dies würde allerdings auch bedeuten, dass meine Aufmerksamkeit nachgelassen hatte. Doch egal, woher er davon wusste, es passte mir nicht.
Ehe ich etwas erwidern konnte, sprach er weiter. »Ich weiß nicht, in wessen Auftrag das Mädchen dir dieses Angebot gemacht hat, aber dass es sich für dich gelohnt hätte, habe ich mitbekommen.«
Interessant. Anscheinend waren seine Männer doch nicht so gut, wie ich dachte. Sie schienen nur Fetzen des Gesprächs mitbekommen zu haben, sonst hätten sie gewusst, dass das Mädchen selbst der Auftraggeber war. »Ich bin kein Fremdenführer. So ein Auftrag würde mehr Probleme als Vorteile bedeuten. Insofern empfand ich ihn als nicht lohnend genug.«
»Was ist mit Bero und Ilias? Für sie bist du auch wie ein Fremdenführer.«
»Sie sind meine Freunde. Das ist etwas anderes.«
Vater kniff die Augen zusammen. Das bedeutete nichts Gutes. »Finn, ich erwarte von dir, dass du diesen Auftrag annimmst.«
Ich verstand nicht, wieso er so darauf beharrte. Doch so wie ich ihn kannte, würde er es mir bald erklären. Kampflos würde ich mich nicht geschlagen geben.
»Aber …«
»Kein Aber, Finn.« Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und legte die noch immer verschränkten Hände in seinen Schoß. Obwohl wir auf einer Höhe saßen, kam es mir so vor, als würde er auf mich herabsehen. »Du weißt ganz genau, dass du und deine Freunde das Geld brauchen«, sprach er weiter. »Wenn du den Auftrag nicht annimmst, bekommst du kein Geld. Auch nicht von mir. Bisher war ich dir gegenüber sehr großzügig, aber es gibt immer ein letztes Mal.« Das Wort ›Freunde‹ spuckte er geradezu verächtlich aus. Seine Lippen verzogen sich zu einem süffisanten Lächeln. Da er mein Vater war, hätte ich ihn bedingungslos lieben sollen, aber es gab Momente, in denen ich mir wünschte, nicht auf diesen Mann angewiesen zu sein.
»Seit du vor ein paar Jahren darauf verzichtet hast, mit mir durch das Land zu reisen und stattdessen hierhergezogen bist, habe ich dich beobachten lassen. Doch wie ich dich kenne, hast du das mitbekommen. Ich wollte sehen, wie du und deine Freunde zurechtkommen, wenn ihr euch vorrangig auf deine eigenen Aufträge verlasst. Dass das nicht sonderlich gut geklappt hat, weißt du ja selbst, zumal Bero noch immer keine Arbeit gefunden hat.«
Zu meiner Schande musste ich mir eingestehen, dass er recht hatte. Anfangs hatte ich uns drei noch gut versorgen können, doch mit der Zeit wurde das Geld knapp und ich hatte mich hilfesuchend an meinen Vater gewandt. Und das, obwohl ich eigentlich nicht mehr für ihn arbeiten wollte. Doch solange Bero keine Arbeit fand, ging es nicht anders.
»Du kannst dir den Luxus, solch einen Auftrag abzulehnen, nicht mehr erlauben«, schloss er.
Ich biss mir auf die Innenseite meiner Wange, um das Erste, was mir in den Sinn gekommen war, nicht auszusprechen. Seine weisen Worte konnten mir gestohlen bleiben. Wäre es hier nur um mich gegangen, dann hätte ich protestiert, aber es ging hier auch um Bero und Ilias. Die beiden zählten auf mich. Lehnte ich den Auftrag ab, würde das Geld schnell zur Neige gehen, wenn mein Vater tatsächlich beschloss, uns nicht mehr zu helfen. Und das traute ich ihm zu. Er würde sicherlich einiges dafür geben, um mir eine Lektion zu erteilen. Manchmal glaubte ich, dass er diese Macht über mich genoss.
Und ich hatte ihm nichts entgegenzusetzen, denn so bekannt, wie ich gerne wäre, war ich in Wirklichkeit nicht.
Ich dachte an Beros Freude, die er am Kochen hatte, rief mir Ilias’ Lächeln vor Augen, wenn wir ihm auf dem Markt diese kleinen Zuckergebäcke mit Zimt kauften. Für beides brauchten wir Geld. Mir blieb nur eine Möglichkeit. »Du hast recht, Vater. Meine Einschätzung war falsch. Ich werde den Auftrag annehmen.«
Ohne ein weiteres Wort stand ich auf und wollte gehen, als er mich noch einmal zurückhielt. »Wohin soll die Reise gehen?«
»Diese Frage müsstest du mir nicht stellen, hätten deine Männer bessere Arbeit geleistet«, konterte ich schadenfroh.
Mein Vater sah verärgert aus und bestätigte mir damit, dass ich ins Schwarze getroffen hatte. »Gute Männer sind nicht leicht zu finden«, gestand er zähneknirschend.
»Wenn du es unbedingt wissen willst, es geht nach Letilis.«
»Und wie viele Leute sollst du mitnehmen? Das Mädchen war doch sicherlich ein Dienstmädchen, das im Auftrag ihrer Herren mit dir sprach«, mutmaßte er.
Es gefiel mir, dass ich mehr wusste als mein Vater. »Wie du eben richtig gesagt hast, Vater, muss ich mir mein Geld selbst erarbeiten. Dazu gehört auch, dass ich mir von den gegebenen Informationen mein eigenes Bild mache. Deswegen werde ich alles Weitere für mich behalten und versuchen, meine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen«, gab ich zurück.
Dass ihm seine eigene Argumentation zum Verhängnis wurde, passte ihm ganz offensichtlich nicht. Mit einem Wink seiner Hand entließ er mich. Ich erschrak, als ich mich selbst in dieser Geste erkannte, mit der ich das Mädchen vorhin fortgeschickt hatte.
Als ich aus der Tür ins Freie trat, atmete ich auf. Das unbehagliche Gefühl, das ich in seiner Gegenwart hatte, verließ mich allmählich. Ich ärgerte mich, dass mein Vater mich dazu gebracht hatte, den Auftrag doch anzunehmen. Ich wusste jedoch, dass es im Grunde genommen das Beste und Einzige war, was ich tun konnte. Dies war meine Chance, unsere finanzielle Situation zu verbessern. Es ging uns nicht schlecht, aber etwas mehr Sorglosigkeit würde mir gefallen. Wenn ich dabei auch noch eine große Distanz zwischen meinen Vater und mich bringen konnte, sollte es mir recht sein. Nicht zum ersten Mal fragte ich mich, wieso er sich überhaupt um mich kümmerte. Seit ich mich erinnern konnte, war er mir gegenüber kühl gewesen und hatte nur das Nötigste mit mir gesprochen. Bis ich alt genug gewesen war, um für ihn zu arbeiten, war ich gemeinsam mit ihm gereist, aber dabei war ich für ihn eher wie ein Klotz am Bein gewesen, als eine Bereicherung. Nach einer Familie hatte sich unser Verhältnis jedenfalls nie angefühlt. Schon alleine deswegen, weil meine Mutter nicht mehr am Leben war. Vielleicht erkannte er zu viel von ihr in mir und hatte mich deshalb nicht irgendwo abgeben, obwohl er nichts mit mir anfangen konnte.
Manchmal wünschte ich mir, er hätte es getan. Dann hätte ich mich niemals in der heutigen Situation befunden und vielleicht eine herzlichere Familie gehabt. Andererseits hätte ich dann wahrscheinlich weder Bero noch Ilias kennengelernt. Die beiden waren meine wahre Familie und ich wollte sie für kein Geld der Welt hergeben. Es gab immer zwei Seiten einer Medaille.
Vielleicht bot dieser Auftrag wirklich die Möglichkeit, mich endlich und endgültig von meinem Vater zu lösen und etwas Eigenes aufzubauen.
Es gab zwei Dinge, die ich dazu erledigen musste. Ich musste eine Nachricht an das Mädchen – Elena – schreiben und ich durfte Bero und Ilias von unserem Glück erzählen. Wenn ich auf Reisen ging, waren die beiden immer mit von der Partie. Wir waren eine eingeschworene Bande und hatten auf unseren Reisen immer Spaß. Vorausgesetzt, es gab unterwegs keine bösen Zwischenfälle. Wie aber würde es sein, wenn wir von zwei Mädchen begleitet wurden, die vermutlich eitel und verwöhnt waren? Würde das Unglück uns auf Schritt und Tritt verfolgen?
Kapitel 3
Arya
Elenas Zimmer lag in einem abgelegenen Teil des Schlosses, in dem nur wenige andere adelige Frauen lebten. Niemand außer ein paar ausgewählten Bediensteten und der Schlosswache hatte Zutritt zu diesem Abschnitt. Und keine der dort lebenden Frauen ahnte, dass nur ein paar Zimmer weiter eine Prinzessin schlief. Für sie war Elena eine Adelige und entfernte Verwandte des Königs, die wie viele andere aus blaublütigen Familien im Schloss lebte. Nichts weiter. Der Grund hierfür lag weit in der Vergangenheit und hatte mit Elenas Mutter Jasha zu tun.
Seit sie bei Elenas Geburt vor einundzwanzig Jahren gestorben war, plagten König Trystan schwere Verlustängste, die sich auf seine Tochter übertrugen. Diese Angst war so übermächtig, dass er kurz nach Elenas Geburt einen folgenschweren Entschluss fasste. Er hatte das Gerücht streuen lassen, dass nicht nur seine geliebte Frau, sondern auch seine Tochter in jener Nacht ums Leben gekommen sei. Seiner Meinung nach war die Gefahr für Elena umso geringer, je weniger Leute über ihre wahre Herkunft Bescheid wussten. Elena wurde von da an im Geheimen großgezogen und erst im Kleinkindalter offiziell zu einer neu eingetroffenen Bewohnerin des Schlosses erklärt. Sie wurde als verwaistes Kind von entfernten Verwandten eingeführt, das König Trystan aus Güte aufgenommen hatte und nun nach den Wünschen ihrer Eltern erzog. Da sie seiner Familie angehörte, wunderte sich niemand darüber, dass sie besser bewacht wurde als manch anderer Adeliger, der im Schloss wohnte.
Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr glaubte Elena diese Lüge selbst. Dann aber belauschte sie ein Gespräch zwischen dem König und einem seiner Berater, in dem es um sie und ihre Herkunft ging, und das nicht für ihre Ohren bestimmt gewesen war. Dieses Gespräch war es, das uns beide zusammengebracht hatte.
Ich erinnerte mich noch genau daran, wie ich die zwei Jahre jüngere Elena in einer Nische von Yusras Küche gefunden hatte. Ich hatte mich zu ihr gesetzt und mit ihr geredet. Unter Tränen erzählte sie mir von dem belauschten Gespräch. Ich war Elena noch nie vorher begegnet, aber ich fühlte mich von da an verantwortlich für sie. Mit ihren langen blonden Haaren, der zierlichen Figur und den strahlend blauen Augen gab sie das Bild einer zerbrechlichen Elfe ab, die einen Beschützer brauchte.
Ich wollte diese Rolle schon damals übernehmen und in nur wenigen Monaten, nach ihrem einundzwanzigstem Geburtstag, würde ich offiziell ihre Leibwächterin sein.
Zu verdanken hatten wir das meinem Onkel Relior. Ich war damals mit Elena zu ihm gegangen und wie sich herausstellte, kannte er die Wahrheit über Elena. Er war mit uns zu König Trystan gegangen und zu viert hatten wir ein langes Gespräch geführt. Elena verstand das Handeln ihres Vaters und versprach ihm, weiterhin so zu leben wie bisher. Sie knüpfte allerdings eine Bedingung daran. Sie wollte mich als Freundin haben und die Erlaubnis, Zeit mit mir zu verbringen.
Und so fand ich in ihr meine beste Freundin und meine Lebensaufgabe.
Bis ein Tag, kurz nach meinem zehnten Geburtstag, mein Leben erneut auf den Kopf stellten sollte.
Ebenso gerne, wie ich an diese zwei schönen Jahre dachte, versuchte ich die meisten Erinnerungen an die darauffolgenden Jahre zu verdrängen. Nicht die Aspekte, die Elena betrafen. Sie war mir in dieser Zeit wie eine Schwester ans Herz gewachsen. Was ich an meinem neuen Leben nicht mochte, war die Manifestation meiner Gabe und die Verantwortung, die diese mir auferlegte.
Wie schon zwei Tage zuvor, spürte ich ein Brennen an meinem Arm, dessen Male ich unter den langen Ärmeln meiner schwarzen Uniform verbarg. Elena wusste von den grauen Linien. Ich trug sie schon mein Leben lang.
Ich wollte nicht weiter über diesen Teil meines Lebens nachdenken. Dass er mich viele Stunden am Tag und auch nachts in den Wahnsinn trieb, reichte mir. Um meine Gedanken loszuwerden, schüttelte ich leicht den Kopf und konzentrierte mich auf den Klang meiner Schritte, der von den dicken, hohen Steinwänden um mich herum widerhallte. Durch den Gang vor Elenas Zimmer streiften zwei Wachen. Beide waren einige Jahre älter als ich. Ich wandte mich an Joan, den Größeren der beiden und fragte ihn, ob Elenas Kopfschmerzen sich gebessert hatten. Das Abendessen würde bald im kleinen Saal serviert werden, doch Elena hatte sich entschuldigen lassen. Alle anderen Bewohner dieses Ganges waren schon zum Essen gegangen.
»Ich habe lange kein Geräusch mehr gehört. Sie schläft vermutlich oder liest. Oder malt. Was Frauen halt so tun«, feixte er. Normalerweise würde eine Wache nicht in diesem Ton von der zukünftigen Königin reden, doch Elena hatte sich mit den beiden jungen Männern angefreundet. Sie vertraute ihnen und hatte sie darum gebeten, sie normal zu behandeln und nicht wie eine Prinzessin. Die Wachen wussten um Elenas wahre Herkunft Bescheid und hatten den Auftrag, besonders gut auf sie aufzupassen.
Ich klopfte an die Tür. Bevor ich auf Elenas Aufforderung hin eintrat, entließ ich die beiden Wachen zum Abendessen. Solange ich an Elenas Seite war, mussten keine anderen Wachen in unmittelbarer Nähe sein. Falls Eindringlinge es wie durch ein Wunder doch in dieses Zimmer schaffen sollten, würde ich alleine mit ihnen fertig werden. Mein Schwert und mein Dolch, die ich an meinem Gürtel befestigt hatte, verliehen mir die nötige Sicherheit.
In Elenas Zimmer roch es nach frischen Blumen. Durch das große Fenster an der gegenüberliegenden Seite konnte man die langsam untergehende Sonne sehen, die dem Zimmer einen warmen Schimmer verlieh. Elena saß in einem großen gepolsterten Sessel neben dem Fenster und las. Sie stand auf, als ich hereinkam, und umarmte mich fest.
»Arya, Arya. Du kannst das Ende der Trauertage wohl kaum erwarten, was? Sehnst du dich so sehr danach, deiner Pflicht nachzukommen?« Ein Lachen lag in ihrer Stimme, als sie mich gespielt tadelte. Sie drückte mich, ehe sie mich auf Armeslänge von sich wegschob.
»Um ehrlich zu sein, hatte ich nichts anderes erwartet. Komm, ich gieße dir einen Tee ein. Er wird dir gut tun.« Was für den einen wie Plapperei klang, war für mich eine willkommene Abwechslung, und Elenas Art, mich aufzumuntern. Wenn es mir schlecht ging, war mir nicht nach reden zumute, und ich freute mich über jeden, der es mir abnahm. Sie wusste, dass ich nicht über Reliors Bestattung reden wollte. Wir hatten bereits während seiner Krankheit viel über das Thema Tod gesprochen und es war nichts, was ich noch weiter vertiefen wollte.
Stattdessen sprachen wir über schöne Erinnerungen, die wir mit Relior verbanden. Darunter waren die Stunden, die wir in Yusras Küche verbracht hatten, die Abende, an denen er uns Geschichten über Maljonar erzählt hatte und die Rosinenschnecken, die er uns vom Markt mitgebracht und heimlich zugesteckt hatte. Ich dachte außerdem an die vielen Gespräche und Übungsstunden, die wir miteinander verbracht hatten, bevor und nachdem sich meine Gabe offenbart hatte.
Als hätte Elena meine trüben Gedanken erraten, wechselte sie das Thema. Ihr einundzwanzigster Geburtstag stand bevor, und damit der erste Schritt in das Erwachsensein. Für Elena würde dieser Tag allerdings viel mehr bedeuten. König Trystan wollte diesen Anlass nutzen, um seine Untertanen von Elenas wahrer Herkunft in Kenntnis zu setzen. Es war riskant, da er die Reaktionen der Menschen nicht abschätzen konnte, aber es blieb ihm keine andere Wahl. Nach dem Tod seiner Frau hatte er nicht erneut geheiratet und keinen neuen Thronfolger gezeugt. Sein älterer Bruder Magnus hatte vor vielen Jahren auf sein Geburtsrecht als ältester Sohn verzichtet. Die Liebe zu einer Frau war es, die diesen Entschluss hatte reifen lassen. Doch leider war den beiden kein Glück gegönnt. Magnus und seine geliebte Frau starben wenig später bei einem Unfall in den Bergen, bevor sie Kinder in die Welt gesetzt hatten.
Elena würde eines Tages nach ihrem Vater den Thron besteigen, und mit dieser Tatsache musste König Trystan ihre künftigen Untertanen vertraut machen. Bisher waren sie davon ausgegangen, dass nach seinem Tod sein nächster noch lebender Verwandter, ein Vetter zweiten Grades, das Erbe antreten würde.
Elena gab es nicht gerne zu, aber sie hatte viel mehr Angst vor der Enthüllung als ihr Vater. König Trystan war ein gütiger und geschätzter König, der von den Leuten gemocht und respektiert wurde. Er hoffte und glaubte, dass sie seine Gründe verstehen und Elena in ihr Herz schließen würden.
Elena war sich da nicht so sicher. Ich redete ihr oft gut zu, dass sie sich keine Sorgen machen musste. Wer sie sah, erkannte sofort ihre starke Präsenz, und dass sie das Zeug dazu hatte, eines Tages Königin zu werden.
Auch an diesem Abend erzählte sie von ihren Zweifeln und ich versuchte, sie zu beruhigen. Doch Elena war nicht leicht zu überzeugen. »Wie soll ich ein Königreich regieren, das ich noch nie richtig gesehen habe, Arya? Wie sollen die Menschen mich akzeptieren, wenn ich nichts von ihnen weiß und sie nicht von mir?«, fragte sie mich und hatte den grüblerischen Ausdruck auf dem Gesicht, den ich nur zu gut von ihr kannte.
Seit einiger Zeit kam dieses Thema immer wieder zur Sprache. Deshalb antwortete ich, wie ich es bisher immer getan hatte. »Das stimmt so nicht und das weißt du auch. Du kennst die Geschichte deines Königreiches so gut wie dein Vater und bist bestens vorbereitet. Wenn du Königin bist, dann wirst du noch genug Zeit haben, dein Königreich zu sehen und kennenzulernen. Dein Vater ist auch des Öfteren auf Reisen und sieht sich Land und Leute an. Das wirst du ebenfalls tun.«
»Seine Reisen haben aber politische Hintergründe. Es geht nicht um das Königreich an sich. Nicht um seine Natur, nicht um seine Kultur und nicht um seine Eigenarten, sondern um politische und finanzielle Interessen. Ich würde gerne die andere Seite kennenlernen. Die menschlichere Seite«, lamentierte sie.
»Das wirst du auch. Früher oder später.« Mir wäre später lieber gewesen, aber ich wusste, dass Elena anderer Meinung war. Als ihre Untergebene sollte ich ihr nicht widersprechen, doch als Freundin empfand ich es als meine Pflicht, sie zu warnen. Ich würde sie nicht ewig von der Welt fernhalten können, das wusste ich. Ich versuchte es nur, solange ich konnte. Wenn sie wüsste, was für Menschen in der Welt lebten und was für schreckliche Dinge sie sich gegenseitig antaten, wäre sie vielleicht nicht so erpicht darauf, die Welt kennenzulernen. Innerlich lachte ich über die Ironie meiner Gedanken.
Wenn sie wüsste, was ich für Dinge tat, dann würde sie auch mich nicht mehr um sich haben wollen. Ich war einer dieser schrecklichen Menschen. Ihr hätte ich jedoch niemals etwas angetan.
Für ein paar Augenblicke sagte niemand von uns ein Wort, während Elena mich lediglich aus ernsten Augen ansah. »Was glaubst du, würde mein Vater mich vor meinem Geburtstag eine Reise durch unser Königreich machen lassen, wenn ich ihn darum bitte?«, fragte sie mich dann in einem verträumten Tonfall.
Ich konnte mir ein kleines Lachen nicht verkneifen. »Das würde er niemals erlauben und das weißt du ganz genau.« Ich hatte das Gefühl, dass mit Elena etwas nicht stimmte. Es war nicht das erste Mal, dass sie solch eine Reise ansprach, aber heute war es irgendwie anders.
»Was meinst du dazu?«, wollte sie wissen.
»Ich bin einer Meinung mit deinem Vater.«
»Findest du nicht, dass es wichtig wäre, dass ich mein Land und die Menschen kennenlerne und mir ein Bild von ihnen mache?«
»Wenn das Land und die Menschen nicht so grausam wären, wie sie es sind, dann würde ich dir zustimmen. Aber unter diesen Umständen ist es viel zu gefährlich«, erwiderte ich.
Elena nickte und betrachtete ihre Teetasse, während sie mit dem Daumen über deren Henkel strich. »Auch wenn du mich begleiten würdest?«, fügte sie leise hinzu, ohne mich anzusehen.
»Das würde nichts an meiner Einstellung ändern. Wir beide können nicht alleine gegen die Welt da draußen bestehen. Wenn es nach mir ginge, kann sie uns noch lange gestohlen bleiben.«
»Woher willst du das wissen, Arya? Du hast diese Mauern genau so wenig von außen gesehen wie ich. Die drei Jahre in der Obhut deiner Mutter zähle ich nicht mit. Seit sie dich hier abgegeben hat, hast du noch nie einen Fuß vor die Stadtmauern, geschweige denn vor das Schlossgelände gesetzt.« Sie sah zu mir auf, und ich erschrak vor ihrer eisigen Stimme sowie ihrem vorwurfsvollen Blick.
Ich hätte es ihr sagen können. Ich hätte ihr von all den schrecklichen Gedanken der Menschen da draußen erzählen können, denen ich fast täglich ausgesetzt war. Mordgelüste, Neid, Gier, Hass … Die Erinnerungen und Gedanken der Menschen waren voll davon und sie erschreckten mich immer wieder, wenn ich sie mit meiner Gabe sah. Dann hätte ich allerdings Elena diese Gabe offenbaren müssen und das konnte und wollte ich nicht.
Nun war es an mir, meine Teetasse anzustarren. Stille breitete sich im Raum aus. Ein Seufzen von Elena unterbrach sie schließlich, und ich atmete erleichtert auf. »Wärst du so gut und würdest mir eine Decke holen? Mir ist kalt«, bat sie mich mit zittriger Stimme.
Ich kam ihrer Bitte nach und holte eine Decke aus der Kommode, die gegenüber des Bettes stand. »Es tut mir leid, ich bin momentan nicht ich selbst«, entschuldigte ich mich, als ich sie ihr überreichte.
Elena nickte verständnisvoll, während sie sich in die Decke einwickelte. »Trink noch eine Tasse Tee, das hilft immer«, riet sie mir.
Sie lächelte mich an und schenkte mir noch eine Tasse ein, die ich in wenigen Zügen leertrank, da das Getränk mittlerweile nur noch lauwarm war. Der bittere Nachgeschmack ließ mich die Lippen kräuseln.
Wärme erfüllte mich von innen und ich fühlte mich schwer und müde. Meine Augenlider fühlten sich an, als würden sie heruntergezogen und ich hatte große Mühe, die Augen offen zu halten. Ich wollte aufstehen, um die Müdigkeit abzuschütteln, doch meine Beine gehorchten mir nicht mehr richtig. Ich musste mich an der Lehne des Sessels festhalten, um nicht umzufallen. Mir wurde schwindelig und ich ließ mich zurücksinken. Auch meine Zunge wollte nicht mehr wie ich und ich brachte keinen Ton heraus.
Ich sah Elena an. Anstatt Sorge las ich in ihrem Gesicht etwas Flehendes und Trauriges. Sie kam zu mir herüber und strich mir ein paar Strähnen aus dem Gesicht. »Es tut mir so leid, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Hättest du doch einfach Ja gesagt. Das wäre so viel einfacher gewesen. Du verstehst doch, dass ich nicht ohne dich gehen kann, oder?«
Gehen? Wohin? Was war hier los? Dann dämmerte es mir. Ich sah zu der Teekanne, dann zurück zu Elena. Sie hatte mir etwas in den Tee getan.
Ich wurde panisch, konnte mich aber kaum noch regen. Mein Körper und meine Mimik ließen sich nicht mehr kontrollieren und ich scheiterte bei dem Versuch, Elena einen bösen Blick zuzuwerfen.
»Ich hoffe, eines Tages bist du mir dankbar für alles, was nun kommt, und kannst mir verzeihen.« Sie gab mir einen Kuss auf die Stirn und ich versank in Dunkelheit.
Kapitel 4
Finn
Bei Sonnenuntergang war es Zeit für das Treffen mit den Mädchen. Bero, Ilias und ich warteten mit unseren Pferden unter einer Gruppe von Bäumen nahe der Stadtmauer und dem Tor, durch welches wir Belessan später verlassen würden. An diesem Abend hatte einer meiner Bekannten Wache und ich hoffte, unangenehmen Fragen zu entgehen und die beiden Mädchen schnellstmöglich hinauszuschaffen. Nach Sonnenuntergang wurde man zwar durch die aufziehende Dunkelheit vor neugierigen Blicken anderer geschützt, aber die Kontrollen an den Toren wurden strenger. Aus diesem Grund hatte ich den heutigen Abend, zwei Wochen nach meinem ersten Treffen mit dem Mädchen, für unsere Abreise ausgewählt. Es war unwahrscheinlich, dass mein Bekannter Alan uns am Tor Schwierigkeiten machen würde, und damit hatten wir zwei Vorteile auf unserer Seite.
Wir wussten nicht, aus welcher Richtung Elena und ihre Begleiterin kommen würden, und hielten daher alle Möglichkeiten im Blick. Ich lehnte an einem der Baumstämme und versuchte meine Aufregung zu verbergen. Wenn ich es nicht schaffte, Ruhe zu bewahren, könnte diese Reise enden, bevor sie richtig begonnen hatte, weil ich damit nur unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehen würde.
Als ich Bero und Ilias von meinem Auftrag erzählt hatte, waren ihre Reaktionen ganz unterschiedlich ausgefallen. Ilias hatte sich gefreut, Bero war nicht so schnell Feuer und Flamme gewesen. Er hielt es für eine schlechte Idee, weil wir keinerlei Erfahrungen mit anderen Reisegefährten hatten. Allerdings wusste er genauso gut wie ich, dass mein Vater Ernst machen würde und uns keine andere Wahl blieb. Bero war außerdem der Meinung gewesen, dass er besser für unsere Verpflegung sorgen konnte als irgendwer sonst.
Jedes Mal, wenn wir gemeinsam zu einem Abenteuer aufbrachen, wie Ilias es nannte, dachte ich darüber nach, wie ungewöhnlich unsere kleine Gruppe doch war. Drei ›Jungs‹, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Die Umstände, unter denen wir zusammengefunden hatten, waren ebenso bemerkenswert. Ungewöhnlich sagten die einen, völlig kurios die anderen. Bero hatte ich kennengelernt, als mir zum zweiten Mal in meinem Leben die Nase gebrochen worden war. In der Kneipe, in der Bero damals gearbeitet hatte, war mein Schummeln beim Kartenspiel entdeckt worden und einer meiner Mitspieler nahm dies nicht gut auf. Er schlug mich mitten ins Gesicht und nur Beros beherztem Eingreifen war es zu verdanken, dass es bei einer gebrochenen Nase geblieben war. Im Anschluss daran versorgte er meine Verletzung und im Laufe des Abends wurden wir Freunde. Er hatte seine Arbeit zwischen all den Kochkunst-Ignoranten, wie er sie nannte, aufgegeben und war von da an mit mir durch das Land gezogen, wenn ich einen Auftrag für meinen Vater ausführte. Dass manche dieser Aufträge nicht ganz legal waren, fand Bero nicht gerade gut, aber alles schien besser zu sein, als in einer winzigen Küche zu arbeiten, wo die Leute ihn wegen seiner Leidenschaft zum Kochen auslachten. Es würde nicht zu einem Bär von einem Mann passen, wie Bero einer war, sagten die Leute immer, bei denen er sich seitdem um eine Arbeitsstelle beworben hatte. Sie schickten ihn weg, ohne sich von seinen Kochkünsten zu überzeugen. Keiner von ihnen ahnte, was für einen begabten Koch sie ziehen ließen.
Bei der Erinnerung an meine erste Begegnung mit Bero fuhr ich mir mit Zeige- und Mittelfinger über die Nase. Ein kleiner Höcker war vom unsauber zusammengewachsenen Bruch zurückgeblieben.
Wir hörten Hufgetrappel. Da nicht mehr viele Leute unterwegs waren, und erst recht nicht auf Pferden, mussten es die beiden Mädchen sein.
Auf dem vorderen Rappen erkannte ich Elena, die mich in der Schänke aufgesucht hatte. Ihr Kleid passte dieses Mal besser, aber sie war in dezenteren Farben gekleidet. Anstelle von grün dominierten grau, schwarz und braun ihre Kleidung. Auf dem zweiten Pferd, einem braunen schönen Tier, sah ich niemanden sitzen. Da bemerkte ich, dass Elena es an den Zügeln führte.
»Hat deine Freundin es sich anders überlegt, oder musste sie noch mal wohin?«, neckte ich sie.
Sie ging nicht auf meinen Kommentar ein und deutete nur auf das Pferd. »Sie ist hinter mir.« Das war sie tatsächlich. Auf den zweiten Blick sah ich es. Ein Mädchen in einem dunkelgrünen Kleid lag bäuchlings auf dem anderen Tier und schien zu schlafen. Sie war mit einem langen Tuch an den Sattel gebunden. Von dort, wo ich stand, blickte ich auf ihre ansehnliche Rückseite.
Ilias ging um das Pferd herum und betrachtete sie von vorne. Er legte den Kopf schief. »Hast du die Erdgöttin entführt?«, fragte er mit respektvoller Stimme.
Ich schmunzelte. Kinder. Manchmal sagten sie die komischsten Sachen.
Auch Elena konnte sich ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen. »Nein. Das ist meine Zofe. Sie hatte ein bisschen zu viel Beruhigungstee, das ist alles«, antwortete sie.