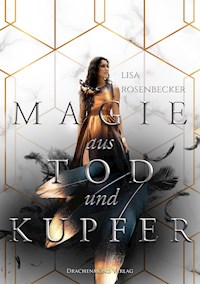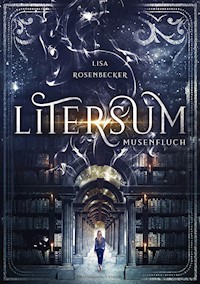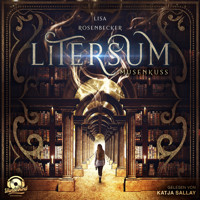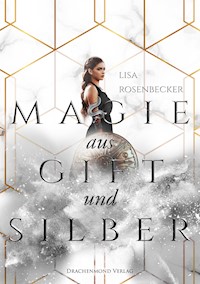
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Rya ist gefangen in einem Körper aus Stein.Seit einer Ewigkeit fristet sie ein Dasein als Statue in einem Museum und beobachtet voller Neid das bunte Leben der Menschen.Bis eines Tages Nick auftaucht, der sie hinter der Fassade aus Marmor spüren kann. Mit einem Kuss erweckt er Rya zum Leben und sie stolpert in eine Welt, die magischer ist, als sie es sich erträumt hatund viel gefährlicher. Sie wird in einen uralten Krieg zwischen Gorgonen und den Nachfahren von Perseus hineingezogen, ohne zu ahnen, wie eng ihr Schicksal mit ihnen verknüpft ist. Während die Konturen von Gut und Böse verschwimmen, muss sie sich entscheiden: Will sie zu einer Heldin werden oder ihr Herz verlieren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Magie aus Gift und Silber
Lisa Rosenbecker
Copyright © 2019 by
Lektorat: Stephan R. Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Illustrationen: Sophie Usui / Yomiya
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-449-9
Alle Rechte vorbehalten
Für Mama
Mit deinem Lachen verlor meine Welt
eine ihrer schönsten Farben
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Nachwort
Danksagung
Kapitel Eins
Ich genoss den ersten Atemzug des Museums. Der Haupteingang lag in weiter Ferne, noch nie hatte ich gehört, wie er geöffnet wurde und die Besucher hereinströmten. Und doch spürte ich es, wenn der Wind von draußen in das alte Gemäuer eindrang und ihm Leben einhauchte. Die Luft knisterte voll Vorfreude und die Staubkörner tanzten im Licht der Sonnenstrahlen. Obwohl ich Tag für Tag, Jahr für Jahr ein und denselben Ausblick hatte, wurde ich seiner nie überdrüssig. Mir direkt gegenüber war ein großes, bodentiefes Fenster mit Blick in den Museumsgarten. Die Jahreszeiten und das Wetter wechselten sich vor meinen Augen ab, alles hatte einen eigenen Charme. Am liebsten hatte ich jedoch den Regen.
Die grauen, dunklen Wolkendecken hüllten den Flur des Museums in gedämpftes Licht und verliehen den Bildern an der Wand links daneben eine andere, faszinierende Atmosphäre. Die stetig fallenden Tropfen waren beruhigend. Auch das Geräusch bei ihrem Aufprall auf die Scheibe war wie Musik für mich. An jenen Tagen herrschte im Museum auch der meiste Betrieb, was mich ebenfalls freute. Ich mochte es, Menschen zu beobachten und hatte einen guten Platz dafür. Genügend Raum für mich, einen schönen Ausblick und viel Unterhaltung, wenn sich die Menschen auf der Bank vor dem Fenster niederließen und miteinander redeten. Sie kannten ganz wundervolle Geschichten, manchmal redeten sie aber auch nur über ganz belanglose Dinge, was eine schöne Abwechslung war. Ich konnte rechts und links von mir in die Flure spähen und nicht alle Standorte waren so beliebt und belebt wie meiner. Ich hatte es nicht schlecht getroffen für eine Statue.
Das war wohl, was ich war. Zumindest nannten mich die Menschen so, die an mir vorüberliefen, stehen blieben und meine Plakette lasen. Soweit ich es mitbekommen hatte, stand auf der kleinen Tafel zu meinen Füßen: Marmorstatue einer unbekannten jungen Frau, Herkunft und Künstler ebenfalls unbekannt, vermutlich aus dem Jahr 430. v. Chr. Laut den Menschen im Museum war ich eine ›alte Schachtel‹. Wenn ich wirklich so alt war, dann stimmte das vermutlich.
Doch die Erinnerungen an mein bisheriges Dasein waren vage. Die Jahre verschwammen, Zeit war ein diffuses Gefühl. Schätzungsweise einhundert Jahre stand ich nun schon in diesem Museum, aber die Einzelheiten waren mir entglitten. Von allem, was noch weiter zurücklag, war nichts mehr übrig geblieben.
Dabei beobachtete ich die Menschen aufmerksam und versuchte, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Sie waren eine unerschöpfliche Quelle an Informationen und so wandelbar. Mein gesamtes Wissen hatte ich durch sie erlangt. Auch die Erkenntnis, dass es noch unglaublich viel gab, was ich niemals mit eigenen Augen sehen, geschweige denn verstehen würde. Ich malte mir gerne aus, wie es in der Welt außerhalb des Museums aussah.
Malen. Das war etwas, was ich zu gerne ausprobiert hätte.
Mein Blick schweifte zu der Pinnwand hinüber, die neben dem Fenster hing. Dort klebten lauter Zettel mit Informationen. Zumindest standen die Menschen ständig davor und schauten nach etwas, um dann nickend weiter ihres Weges zu gehen. Doch darüber hingen Bilder, die die Museumsguides zusammen mit den Kindern angebracht hatten, die diese kleinen Kunstwerke erschaffen hatten. Es waren mit Wasserfarben angefertigte Nachzeichnungen von Gemälden, die im Museum hingen. Und diese Farben … Ich wurde nie müde, sie anzusehen. Vor allem das Blau faszinierte mich.
Eine Tür fiel ins Schloss. So gut ich es in meinem starren Zustand – der leider mein Sichtfeld mit einschloss – konnte, sah ich nach rechts, um den Neuankömmling zu begrüßen, der sich mit lauten Schritten ankündigte.
»Hallo, Miss.« Eddie, einer der Wachmänner im Museum, kam um die Ecke geschlendert, begleitet vom Klirren seines Schlüsselbundes, und begrüßte mich – wie jeden Tag. Er lächelte und tippte sich an die Mütze, die zu seiner Uniform gehörte. Unter dem Arm trug er einen Stapel Papier. Ein Blatt davon heftete er an die Pinnwand. Ich konnte nicht lesen, was draufstand, dazu war es zu weit weg.
Pfeifend führte Eddie seinen Rundgang durch das Museum fort. Er lief zwischen dem Fenster und mir vorbei.
»Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Morgen.« Lächelnd sah er mich an und ging weiter. Er blieb nie stehen, um auf eine Antwort zu warten. Ich hätte sie ihm nicht geben können, aber ich versuchte immer wieder, irgendetwas an mir zu bewegen, um ihm zu zeigen, dass ich ihn hörte. Aber es hatte keinen Zweck. Nichts bewegte sich und kein Ton kam mir über die geschlossenen Lippen. Dabei hätte ich seinen Gruß gerne erwidert. Nur ein einziges Mal.
Ich sah Eddies dünner Gestalt so lange nach, wie ich konnte. Dann wartete ich auf die Besucher.
»Mama, was hat sie da in den Händen?« Ein kleines Mädchen zog am roten Wollpullover ihrer Mutter und deutete auf mich. Die Frau drehte sich um und sah auf die Stelle, auf die die Kleine zeigte. Durch den Sockel, auf dem ich stand, überragte ich die Frau ein gutes Stück und sie musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um auf Augenhöhe mit meinen Händen zu gelangen. Ich hielt sie geschlossen und übereinandergelegt vor meiner Brust. Die Frau schaute von links, von rechts und zuckte dann mit den Schultern.
»Ich kann es leider nicht erkennen, mein Schatz.«
Missmutig sah die Kleine mich an. »Was hast du da?«, fragte sie mich.
Ich weiß es selbst nicht, antwortete ich in Gedanken.
Sie legte den Kopf schief und für einen Moment glaubte ich, dass sie mich tatsächlich gehört hatte. Doch sie rümpfte nur die Nase und wandte sich ab.
»Sie ist unhöflich«, sagte das Mädchen zu seiner Mutter und zog sie von mir weg.
Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich in schallendes Gelächter ausgebrochen.
Wenig später stand eine Gruppe männlicher Teenager vor mir. Sie unterhielten sich lautstark und schubsten sich gegenseitig spielerisch. Einer, der gerade eine aufgeschraubte Wasserflasche in der Hand hielt, stolperte und konnte sich gerade noch so fangen, kurz bevor er gegen meinen Sockel gestoßen wäre. Das Wasser allerdings ließ sich nicht aufhalten. Ein kleiner Schwall schwappte aus der Flasche und landete auf meinen steinernen Füßen. Zum Glück war gerade keiner der Aufseher da, denn das hätte sonst eine Menge Ärger für die jungen Leute bedeutet. Der Übeltäter tat so, als wäre nichts geschehen und drehte sich zu seinen Freunden um.
»Diese respektlose Jugend!«, keifte eine Stimme. »Was glaubt ihr, wo ihr hier seid?«
Der Junge mit der Wasserflasche drehte sich erschrocken um, auch seine Freunde verstummten und wandten sich der Stimme zu. Ein Päckchen Taschentücher flog in die Mitte der Gruppe und die Jugendlichen stoben auseinander.
»Mann, die Alte ist verrückt. Lasst uns abhauen!« Sie verschwanden prustend im Gang und eine ältere Dame schob sich in mein Sichtfeld. Kopfschüttelnd und ächzend bückte sie sich und hob das Päckchen wieder auf, wobei ihr fast die silberne Brille von der Nase rutschte. Sie zog eines der Taschentücher heraus und tupfte damit an der Stelle auf meinem Fuß herum, auf der das Wasser gelandet war.
»Keinen Respekt mehr, diese Jugend«, wiederholte die Dame.
Sie sah mit ihren grauen Augen zu mir auf. »Du bist aber wirklich ein hübsches Ding.« Sie tupfte noch ein bisschen weiter, dann knüllte sie das Taschentuch zusammen. Nachdem sie fertig war, nickte sie zufrieden und ging. In Gedanken schickte ich ihr ein von Herzen kommendes »Danke« hinterher. Doch sie drehte sich nicht noch mal um. In diesen Momenten frustrierte es mich, dass ich kein Mensch war. Ich wollte auch laut sein. Lustig. Lebendig. Ich wollte leben. Mein Dasein hatte nichts damit gemeinsam und ich wusste nicht, womit ich es verdient hatte, so nah und doch so fern davon zu sein.
War ich es nicht würdig, ein Leben wie die Menschen zu führen? War meine Existenz eine Strafe? Auch wenn alles andere mit der Zeit verflog – diese Fragen blieben. So gut es ging hielt ich sie im hintersten Winkel meiner Gedanken versteckt und akzeptierte die Tatsache, dass ich darauf wahrscheinlich nie eine Antwort erhalten würde.
Ein Kreischen ließ mich aufsehen. Die Jungengruppe war zurückgekehrt und nun damit beschäftigt, die gleichaltrigen Mädchen ihrer Klasse zu ärgern. Alle Anwesenden zuckten teils erschrocken, teils empört zusammen. Alle, bis auf einen.
Auf dem Gang stand ein junger Mann, der lediglich kurz die dunklen Augen verengte, als die Jugendlichen an ihm vorbeirannten. Er machte einen eleganten Schritt zur Seite, damit sie nicht gegen ihn liefen, und verschränkte die Arme vor dem Körper, sodass sich der Stoff seines dunkelblauen Pullovers über den Muskeln straffte. Das alles tat er, während er mich ansah.
Sein Blick durchfuhr mich wie ein Blitz und eine eigenartige Unruhe erfasste mich. Viele Menschen betrachteten mich tagtäglich. Schauten mir manchmal sogar in die Augen. Aber nicht so, wie er es tat. So direkt. So wissend. Als hätte er eine Ahnung, dass ich hier drin war. Dass ich da war.
In der nächsten Sekunde spannte er seinen Körper an, auch seine Gesichtszüge verzogen sich, wobei seine Kieferknochen kurz hervortraten. Einer der Jugendlichen war gegen seinen Rücken geprallt und hingefallen. Der junge Mann wandte den Blick kurz von mir ab und drehte sich zu dem Jungen um, der schon wieder auf den Beinen war.
»Alles in Ordnung?« Seine Stimme war ebenso warm wie seine Augen, trotzdem wich der Jugendliche einen Schritt zurück, murmelte eine Entschuldigung und rannte davon.
Der junge Mann schüttelte schmunzelnd den Kopf, wobei ihm eine schwarze Haarsträhne vor die Augen fiel, die er zurückstrich, als er sich wieder zu mir umdrehte.
Was wollte er? Wieso starrte er mich so an?
Kannst du mich hören?
Es war albern zu versuchen, ihn telepathisch zu erreichen. Er rührte sich nicht, zeigte keine Anzeichen dafür, dass er etwas hörte. Er wandte den Blick aber auch nicht ab, sah mir weiter unverhohlen in meine leeren Augen, die nicht mal ich selbst ertrug, wenn ich sie in der Fensterscheibe erspähte. Ein eigenartiges Kribbeln erfasste mich. Ein mir bisher unbekanntes Gefühl. Die steinerne Hülle, die mich umgab, fühlte sich an wie ein Gefängnis. Zu eng. Zu fest. Zu ewig.
Lasst mich hier raus!
Doch niemand hörte mich. Die Zeit stand still. Das erste Mal seit immer.
Der junge Mann verharrte ebenso starr wie ich noch ein paar Minuten an Ort und Stelle, dann stieß er sich von der Wand ab und ging.
Der Rest des Tages zog an mir vorbei. Ich achtete nicht auf die Menschen, die meinen Gang passierten, mit mir redeten oder mich einfach nur ansahen. Denn bei keinem von ihnen war es wie bei ihm. Es war nicht echt.
Ich fühlte mich eingeengt, allein und kalt. So wie immer. Bisher hatte ich mich mit diesem Zustand und all den Fragen, die damit verbunden waren, abgefunden. Doch in diesem Moment wollte ich die Antworten darauf so sehr wie noch nie zuvor. Denn da musste doch mehr in mir sein, wenn er mich sehen konnte. Oder? War es vielleicht nur Einbildung gewesen?
Die mühsam aufgebaute Akzeptanz meines Daseins hatte einen Riss bekommen. Und das nur wegen eines einzigen Blickes.
Hibbelig, so hätten die Menschen meinen Zustand genannt. Den Rest des Tages war ich hibbelig und konnte mich auf nichts konzentrieren. Normalerweise verbrachte ich die Nacht in einer Art Dämmerzustand, in dem ich alles um mich herum mitbekam, aber nicht darüber nachdenken konnte. Doch heute war es anders. Ich war hellwach, ließ meinen Blick nervös hin und her schweifen. Doch außer den alltäglichen Besuchern und der Putzkolonne, die nach der Schließung des Museums durch die Flure fegte, gab es nichts Außergewöhnliches mehr. Die Hauptlichter gingen wie jeden Abend um acht aus, draußen blieb es noch eine ganze Weile hell. Den Garten im Hinterhof in aller Ruhe bewundern zu können, war normalerweise einer der schönsten Vorteile des Sommers. Heute aber hatte ich keine Augen für ihn. Ich schrak auf, als einer der Wachmänner, der seine allnächtliche Runde drehte, in meinen Gang abbog und pfeifend an mir vorüberlief. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie spät es geworden war.
Die Dunkelheit brach herein, bis die Gänge nur noch von einer schwachen Beleuchtung und dem hereinfallenden Mondlicht erhellt wurden. Nie hatte mir diese Atmosphäre etwas ausgemacht, aber in dieser Nacht gruselte es mich.
Was war nur los mit mir? Mit geschlossenen Augen, oder wie auch immer man das bei mir nennen würde, blendete ich die Außenwelt aus. Ich musste mich beruhigen.
Alles wird gut, Rya. Du hast es all die Jahre geschafft, nicht verrückt zu werden, da wirst du doch wohl diese eine Nacht überstehen. Was soll schon passieren?
Ganz genau. Nichts. Wie immer, da ich verdammt noch mal nur eine Statue war! Ich riss die Augen wieder auf und schrie. Außer mir hörte mich natürlich niemand, aber es tat gut, den Frust rauszulassen. Das ging ungefähr eine Stunde so, bis meine Kräfte aufgebraucht waren und ich mich besser fühlte. Die Stille und der Blick in den Garten verschafften mir wieder die innere Ruhe, die mir verloren gegangen war.
Gegen Mitternacht hörte ich dann die Schritte.
Erst glaubte ich, dass ich sie mir nur einbildete, dann wurden sie immer deutlicher. Sie kamen von rechts. Waren schon wieder mehrere Stunden vergangen und die Wachmänner drehten ihre nächste Runde?
Wenig später schob sich eine Person in mein Blickfeld. Mir fiel sofort der dunkelblaue, fast schwarze Pullover auf, der im Licht an manchen Stellen zu schimmern schien. Das war definitiv keiner der Wachmänner, und er kam direkt auf mich zu. Die Person blieb stehen und sah zu mir auf. Und endlich konnte ich das Gesicht erkennen. Sein Gesicht. All die Gelassenheit, die ich mir in den letzten Stunden mühsam erkämpft hatte, verpuffte ins Nichts. Wie zuvor starrte der junge Mann mir direkt in die Augen.
Er streckte die Hände in Höhe meiner Taille aus, packte zu und zog sich hoch. Im nächsten Moment stand er gemeinsam mit mir auf meinem Sockel und überragte mich um gut einen Kopf. Meine Sicht wurde von seinen breiten Schultern verdeckt. Er lehnte sich leicht zurück, hob eine Hand und umfasste damit meine Wange. Mit schief gelegtem Kopf musterte er mich. Dann senkte er sein in Schatten gehülltes Gesicht zu mir herab und überbrückte die letzte Distanz zwischen uns. Er schloss die Augen und … Was genau machte er da? Verdammter Körper aus Stein, ich spürte nichts! Er würde doch nicht … Küsste er mich etwa? Ich schielte und versuchte zu erkennen, was genau er von sich wo genau an mich drückte, aber es war zwecklos. Und genauso schnell wie er angefangen hatte, hörte er auch schon wieder auf. Er zog den Kopf zurück, blickte mir noch einmal in die Augen und sprang dann behände vom Sockel herunter. Ich war wieder allein. Auf eine ganz andere Art als zuvor. Seine Berührung, auch wenn ich sie nicht direkt hatte spüren können, hatte eine Wärme hinterlassen, die von der Kälte der Nacht wieder zerstört wurde. Ich hatte einen Eindruck davon bekommen, wie es war, jemandem nahe zu sein. Und das wieder genommen zu bekommen, war schlimmer, als es nie erfahren zu haben.
Statt schnell wieder zu verschwinden, lehnte er sich mit verschränkten Armen an die Wand neben dem Fenster und … wartete? Er ließ mich nicht aus den Augen und machte nicht den Eindruck, als ob er sich in nächster Zeit bewegen wollte. In Ordnung. Wenn ich eines hatte, dann Zeit. Vielleicht würde er mir noch verraten, warum er sich mitten in der Nacht in einem Museum rumtrieb und sich an Statuen heranmachte.
Das durch das Fenster fallende Mondlicht malte seine Züge weich und brachte sein Oberteil zum Schimmern. Jetzt erkannte ich, dass es nicht aus normalem Stoff, sondern einem festen, dunklen Material war. Vielleicht Leder? An einigen Stellen waren silbrige Verzierungen eingearbeitet. Auch an seiner Hüfte glänzte etwas. Es sah aus wie der Griff eines großen Messers, das in einem Futteral am Gürtel befestigt war. Ein Dolch? Wer in aller Welt war dieser Kerl?
Für mehrere Minuten blieb er reglos an derselben Stelle stehen, als wäre er selbst auch aus Stein. Und als würde er auf eine Reaktion von mir warten, ließ er mich keinen Moment aus den Augen. Umgekehrt tat ich dasselbe, weil ich keine Regung verpassen wollte, die mir vielleicht doch noch verriet, was hier vor sich ging.
Wenig später waren erneut Schritte zu hören. Das musste nun aber einer der Wächter sein. Meinem Besucher entging das ebenfalls nicht, er drehte den Kopf in Richtung des Geräuschs, bewegte sich sonst aber keinen Zentimeter. So würde man ihn doch sofort entdecken! Doch als der Wachmann kam und zwischen dem Fenster und mir entlanglief, reagierte er gar nicht auf den Eindringling. Er musste ihn doch sehen. Er stand nur einen Meter neben ihm! Doch der Wachmann lief einfach weiter. Die einzige Reaktion des jungen Mannes war ein zufriedenes Nicken.
Das war nicht normal. Und das sagte ich. Die Statue.
Stunden vergingen, in denen nichts passierte, außer dass draußen die Dämmerung hereinbrach. Auch bei seinen zwei weiteren Runden hatte der Wachmann den Eindringling nicht bemerkt, Letzterer stand noch immer regungslos an die Wand gelehnt und sah mich nach wie vor an.
Wie am Tag zuvor spürte ich auch dieses Mal den Moment, in dem das Museum erwachte. Eddie würde gleich kommen. Er würde ihn doch sicherlich bemerken, oder? Wenig später hörte ich tatsächlich seine Schritte und den rasselnden Schlüsselbund im Flur. Aber waren das nicht zwei Paar Füße, die da über den Boden liefen? Als Eddie um die Ecke kam, wurde er von einem Mann verfolgt, der dieselbe Kleidung trug wie mein Beobachter und sich nahezu lautlos neben diesen stellte. Sie hatten eine ähnliche Statur, doch der zweite Mann war blond und wirkte freundlicher als der nächtliche Besucher. Eddie begrüßte mich wie jeden Morgen und ging seiner Wege. Er hatte keinen der beiden Eindringlinge auch nur eines Blickes gewürdigt. Die Männer grüßten sich mit einem Handschlag, als Eddie außer Hörweite war.
»Nichts passiert?«, fragte der Mann, der eben gekommen war, und deutete mit einer Kopfbewegung auf mich.
»Bisher noch nicht.« Die Stimme des Dunkelhaarigen war tief und schön, und glitt kribbelnd über mich, wie der intensive Blick seiner Augen.
Der Neue strich sich mit den Fingern über die blonden Bartstoppeln am Kinn. »Bist du dir sicher, dass sie eine von ihnen ist? Ich kann nichts spüren.« Wovon redete er da?
»Ganz sicher«, sagte der andere. Er stieß sich von der Wand ab und richtete sich auf.
»In Ordnung. Ich vertraue deinem Bauchgefühl, Nick.« So hieß der Eindringling also.
»Es hat nichts mit Bauchgefühl zu tun. Es ist wie bei allen anderen auch«, sagte jener Nick mit Nachdruck. Der andere Mann kniff die Augen zusammen.
»Wenn du das sagst.«
Nick öffnete den Mund, doch dann hielt er inne, als wäre ihm gerade etwas eingefallen, was er vergessen hatte. Er biss sich kurz auf die Lippe und sammelte sich.
»Danke fürs Übernehmen, Linos. Bis heute Abend.«
»Bis dann.«
Nick verschwand. Doch er warf mir einen letzten, langen Blick zu, ehe er um die Ecke bog. Und da war es wieder. Dieses Gefühl, zurückgelassen worden zu sein.
»Dann machen wir beiden Hübschen uns mal einen schönen Tag«, sagte Linos und setzte sich auf die Bank. Dort blieb er, bis die ersten Besucher kamen – und ihn nicht sahen. Als es voller wurde, machte er die Bank für die Besucher frei und stellte sich ähnlich wie Nick an die Wand. Doch bald wurde es ihm anscheinend zu langweilig, denn er schritt den Gang auf und ab und betrachtete die Exponate. Zwischenzeitlich kam er immer wieder zu mir zurück, wie um sich zu vergewissern, dass ich noch da war. Als könnte ich irgendwo anders hin.
Moment mal. War das möglich? Würde ich verschwinden? Wollten die beiden mich auslöschen? Mein Innerstes zog sich zusammen, ich musste einen Schrei unterdrücken, als sich ein Gefühl in mir breitmachte, das mir fremd geworden war. Angst. Zum ersten Mal, seit ich mich erinnern konnte, bangte ich um das bisschen Dasein, das ich hatte. Trotz dessen, dass ich dazu mehr Fragen als Antworten hatte, wollte ich mich nicht auflösen! Ich wollte ein Teil dieser Welt bleiben! Vor meinem inneren Auge malte ich mir aus, wie ich in meine Einzelteile zerfiel und nicht mehr von mir übrig blieb als feiner Staub. Ich würde die Menschen nicht mehr beobachten, den Ausblick auf den Garten nicht mehr genießen können. All die Jahre war mir das wenig vorgekommen, doch jetzt, da es auf dem Spiel zu stehen schien, wurde mir bewusst, dass ich es nicht aufgeben wollte.
Aber lag das nun noch in meiner Hand? Meine Gedanken rasten. Wie viel Zeit blieb mir noch? Was würde passieren? Ich richtete meinen Blick auf den Garten, um mich zu beruhigen. Es half nicht viel, aber zumindest der unmittelbare Gedanke an eine Zukunft als Staubwolke ließ sich vertreiben. Das Beobachten der Besucher tat für den Rest des Tages sein Übriges, sodass ich am Abend nicht mehr das Bedürfnis hatte zu schreien. Doch das ungute Ziehen in meinem Inneren war noch da, ich fühlte mich erschöpft und nahm alles wie durch einen Schleier wahr.
Mit Einbruch der Dunkelheit kam Nick zurück. Als er um die Ecke bog, huschte sein Blick sofort zu mir. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen und seine Schultern sackten nach unten. »Noch immer nichts?«
»Nicht ein Staubkorn hat sich bewegt«, erwiderte Linos und beschwor damit erneut die düsteren Bilder in meinen Gedanken. »Bist du dir auch wirklich ganz, ganz sicher? Es wäre schade, wenn wir unsere Zeit hier vergeuden.«
»Ja. Ganz sicher.« Nick verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich an die Wand. Er presste die Lippen zusammen.
Linos seufzte. »In Ordnung. Dann bis morgen.« Er winkte kurz und verschwand. Nick blieb still stehen und sah mich an. Auch in dieser Nacht rührte er sich nicht und er redete auch nicht mit mir. Sosehr seine Aufmerksamkeit mich anfangs gereizt hatte, so sehr nervte sie mich jetzt. Konnte er nicht einfach wieder verschwinden und mich in Ruhe lassen? Bevor er aufgetaucht war, hatte es keine schlimmen Gedanken, keine Angst gegeben. Jetzt fürchtete ich mich vor den Schatten, vor dem Nichts und war der Angst hilflos ausgeliefert.
Leck mich am Sockel, dachte ich und vergrub mich in mein Innerstes, wo ich nicht nachdenken konnte.
Drei Tage lang wiederholte sich dieses Spiel. Nick überwachte mich in der Nacht, Linos am Tag. Nick stand wie festgeklebt an der Wand, Linos streifte durchs Museum und sah nur ab und an nach mir. Auch wenn ich mich in meinen Dämmerzustand versetzt hatte, so war da doch dieses Zerren in meinem Inneren, die Angst, dass ich mich auflösen würde. Da weder Nick noch Linos mit mir redeten, wusste ich nicht, was mich erwartete. Meine Gedanken stellten allerlei Vermutungen an, doch ich ließ mich nicht länger darauf ein, da es mich sonst verrückt machte. Vielleicht hatten sie sich aber auch geirrt, in Bezug auf was auch immer, und würden mich bald wieder in Ruhe lassen.
Am vierten Tag taten sie mir diesen Gefallen tatsächlich. Linos kam, um Nick von seiner Nachtwache abzulösen. Doch statt die Plätze zu tauschen, blieben beide vor mir stehen.
»Die drei Tage sind rum«, meinte Linos. »War wohl doch ein falscher Alarm.«
Nick richtete den Blick auf die Plakette zu meinen Füßen und steckte die Hände in die Hosentaschen.
»Dabei war ich mir absolut sicher«, sagte er so leise, dass ich ihn kaum verstand. Linos sah zwischen ihm und mir hin und her.
»Bauchgefühl, hm? Wohl eher Wunschdenken, oder?«
Nick boxte ihn spielerisch gegen den Arm und lächelte bitter. »Halt die Klappe und lass uns gehen.«
Die beiden drehten sich ohne ein weiteres Wort um und gingen. Doch kurz bevor sie um die Ecke bogen und aus meinem Sichtfeld verschwanden, warf Nick mir einen letzten Blick zu, der meine Erleichterung über sein Verschwinden kurz ins Wanken brachte. Dann waren sie weg und kamen nicht wieder. Der Einzige, auf den wie immer Verlass war, war Eddie, der schon wenig später durch den Flur lief und mich grüßte. Dann kamen die Besucher und lenkten mich von meinen düsteren Gedanken ab, die mich trotz allem noch fest im Griff hatten. Die unmittelbare Gefahr schien vorüber, doch noch traute ich mich nicht aus dem Dämmerzustand. Ich wollte mir noch einen Tag Ruhe gönnen.
Doch die folgende Nacht war von einer Stille erfüllt, die mich wahnsinnig machte. Die Stimmen in meinem Kopf waren viel zu laut und nervtötend. Schlimmer noch als in der Anwesenheit von Nick und Linos. Hätte er mich doch bloß nie entdeckt. Morgens hatte ich mir gewünscht, dass die beiden mich in Ruhe ließen, doch mit der Nacht kam die Einsamkeit zurück, die mir zum ersten Mal etwas ausmachte. Es war alles in Ordnung gewesen, bevor die beiden aufgetaucht waren.
Oder?
Nicht wirklich. Auch davor war nicht alles gut gewesen, aber ich hatte es akzeptiert und gelernt, damit umzugehen. Doch jetzt, da ich wusste, wie es war, wirklich bemerkt zu werden, war dieses Alleinsein fast unerträglich. Ich blieb im Dämmerzustand und konnte nur darauf hoffen, dass es irgendwann besser wurde.
Drei weitere Tage dämmerte ich vor mich hin, ließ das bunte Leben der Menschen einfach an mir vorüberziehen. Ich hatte keinen Spaß daran, sie zu beobachten. Es führte mir nur vor Augen, was ich niemals haben würde. Ebenso das Gewitter und der auf die Scheibe prasselnde Regen, die am dritten Abend nach dem Verschwinden der beiden vor dem Fenster tobten, konnten mich nicht besänftigen. Ich würde niemals spüren, wie sich Gewitterluft oder die Tropfen auf meiner Haut anfühlen würden. Mein graues Dasein widerte mich in diesem Moment so sehr an wie noch niemals zuvor. Ich wollte leben.
Knack.
Das Geräusch zerriss die Stille um mich herum. Ich hatte es aber nicht nur gehört, ich hatte auch etwas gespürt. Direkt an meinen Lippen.
Knack. Knack. Knack.
Auf meinen Händen, in denen ich das unbekannte Etwas vor meiner Brust hielt, war ein Riss. Ein langer, breiter Spalt in meiner Steinhaut.
Zerfiel ich nun doch noch zu Staub?
Kapitel Zwei
Kurz vor dem Morgengrauen zogen sich die Risse über meinen ganzen Körper. Alles an mir schien zu vibrieren. Es war überwältigend und furchtbar zugleich, weil ich nicht wusste, ob es gut oder schlecht ausgehen würde. Ich verfiel in eine Art Schockstarre, in der ich mich noch eingeschlossener fühlte als zuvor. Egal, was nun geschah, es gab kein Zurück mehr. Nicks Kuss hatte etwas ausgelöst, das sich nicht mehr aufhalten ließ. Er und Linos mussten auf diese Reaktion gewartet haben, die verzögert einsetzte. Nun war ich allein und wusste nicht, was zu tun war. Ich schrie meinen Frust hinaus, doch wie immer verloren meine Schreie sich im Nichts und meine Frustration wuchs, dicht gefolgt von Verzweiflung. Ich konnte nur dabei zusehen, wie mein Körper Stück für Stück aufsplitterte.
Knack. Knack. Knack. Meine Haut aus Stein riss unaufhaltsam weiter auf, ein dichtes Geflecht zog sich über meinen Körper.
Dann wurde es still.
Ein letztes, lautes ›Knack‹ verhallte in den Gängen, dann zerbrach der Sockel unter mir und ich fiel in einer Staubwolke zu Boden. Reflexartig streckte ich die Arme aus, um den Fall abzubremsen. Steinsplitter, die um mich herum zu Boden fielen, schnitten mir beim Aufprall in die Hände und ich keuchte, als der Schmerz einsetzte. Meine Beine waren zu schwach, knickten ein. Einen Moment blieb ich röchelnd liegen und wartete, bis alle Gesteinsbrocken zur Ruhe kamen. Dann rappelte ich mich mühsam hoch und kniete mich hin. Ich betrachtete meine blutenden Hände. Meine menschlichen Hände. Auf ihnen lag eine dicke graue Schicht Staub, aber ich konnte die blasse Haut darunter erkennen. So wie sie auch bei den Menschen aussah. Ich fuhr mit dem Finger meiner rechten über die Handinnenfläche meiner linken Hand und verschmierte dabei das Blut. Ich blutete! Etwas, das nur Menschen konnten!
Meine lederne Kleidung war an einigen Stellen voller Kratzer und hier und da von Löchern durchzogen, doch ansonsten schien sie intakt. Das Oberteil knarzte im Rücken, als ich mich bewegte, doch der Stoff über den Armen war weich. Die Kleidung ließ mir genug Bewegungsfreiheit, um mich hinzustellen. Ich kam kurz ins Wanken, als meine wackeligen Knie nachgaben. Meine Füße waren nackt. Die Steinfliesen brachten mit ihrer Kälte und rauen Struktur meine Fußsohlen zum Prickeln.
»Ups.« Der Klang meiner eigenen Stimme ließ mich erschrecken. Dann lachte ich, laut, einfach weil ich es konnte. Ich mochte meine Stimme. Ich legte mir eine Hand auf die Brust und bekam dabei das zu fassen, was all die Jahre in meinen Händen versteckt gewesen war. Es war eine Phiole aus Glas, die mit einem Korken verschlossen war. In diesem Korken steckte ein kleiner Haken, an dem ein Band befestigt war, das um meinen Hals hing. In dem Fläschchen befand sich eine dunkelgraue Substanz, die sich beim Schütteln der Phiole bewegte. Es schien Staub zu sein. Ich ließ die Phiole wieder sinken und fasste mir erneut an die Brust.
Bumm bumm. Bumm bumm.
Mein Herz. Es schlug und pumpte Blut durch mich hindurch. Mein Brustkorb hob und senkte sich. Ich atmete. Wie ein Mensch. Ich lachte erneut und stieß einen Freudenschrei aus. Ich war nicht länger eine Statue! Ich ging ein paar Schritte. Es kostete mich viel Kraft, aber ich ging umher! Wankend gelangte ich zum Fenster und stützte mich an der Scheibe ab. Draußen tobte noch immer das Gewitter. Endlich konnte ich ungehindert zu den dunklen Wolken hinaufsehen. Ein Blitz gefolgt von einem Donner erfüllte die Nacht. An einigen Stellen erlaubte die Wolkendecke einen Blick auf den dunkelblauen, fast schwarzen Mitternachtshimmel, an dem die Sterne leuchteten. Es war wunderschön. Meine Finger folgten den Spuren der Tropfen, die am Fenster hinunterliefen. Meine Haut sehnte sich danach, sie zu berühren.
Erneut sah ich an mir herab und konnte es nicht glauben. Nicks Kuss hatte mich aus meinem Gefängnis befreit, ich war nun Teil des Lebens und nicht mehr bloß ein Beobachter. Womit hatte ich das verdient? Es war dieselbe Frage wie zuvor, doch nur innerhalb von ein paar Augenblicken hatte sie einen völlig neuen Kontext bekommen. Aber es gab auch eine Frage, die sich in diesem Moment zum ersten Mal stellte. Und die mir fast genauso viel Angst einjagte wie alle anderen.
Was sollte ich jetzt tun?
Ich wickelte mir eine braune Haarsträhne um den Finger und betrachtete sie, während ich über den nächsten Schritt nachdachte. Warten, ob Nick und Linos zurückkamen? Warten, bis einer der Wachmänner oder Eddie kam und sie um Hilfe bitten?
Vor dem Fenster leuchtete ein Blitz auf und ich hob den Blick. Nein. Ich hatte lange genug gewartet. Ich musste raus. Zumindest einmal wollte ich den Regen auf meiner Haut spüren, bevor ich entschied, wie es weitergehen sollte.
Doch welcher Weg führte nach draußen? Eddie musste jeden Morgen in das Gebäude, bevor er seine Runden drehen konnte, also befand sich in der Richtung, aus der er kam, sicherlich ein Ein- und Ausgang. Ich würde versuchen, seinen Weg zu rekonstruieren.
Mit einem letzten sehnsuchtsvollem Blick nach draußen stieß ich mich vom Fenster ab und folgte dem Gang in die Richtung, aus der Eddie jeden Morgen kam. Meine Schritte waren anfangs zögerlich, wurden dann aber selbstsicherer, so als erinnere sich mein Körper daran, wie Laufen funktionierte. Ich musste auch nicht darüber nachdenken, wie ich meine Arme und Hände oder meinen Kopf bewegen musste. Woher wusste ich das? Es war ein so eigenartiges Gefühl. Aber auch beeindruckend. Auf meinem Weg fasste ich alles an, was ich zwischen die Finger bekam. Glas. Stein. Plastik. Papier. Metall. Es war berauschend, die unterschiedlichen Materialien zu spüren.
Ziellos streifte ich in den halbdunklen Gängen umher, bis ich die ersten Schilder sah, die auf den Ausgang verwiesen. Ich folgte ihnen und bestaunte die vielen Ausstellungsstücke auf meinem Weg. Erst waren es nur Bilder und Statuen, doch dann kam eine Abteilung mit Dingen aus dem Alltag längst vergangener Zeiten. In kleinen Glaskästen waren Tonkrüge, Schmuck, Figuren und Dekoration ausgestellt. Die Farben zogen mich an und ich trat näher an den Schaukasten heran. Draußen könnte ich etwas Wertvolles zum Tausch sicherlich gut gebrauchen. Doch Stehlen war eine Straftat und ich wollte weder dem Museum noch Eddie schaden. Es musste auch einen anderen Weg geben. Der Gedanke war kaum zu Ende gedacht, als mein Magen unangenehm brummte. Hunger, flüsterte mir mein Instinkt zu. Das Problem musste ich also eher früher als später angehen. Doch erst mal wollte der Weg nach draußen gefunden werden.
Also folgte ich weiter den Schildern, ohne mich andauernd ablenken zu lassen. Aus der Ferne hörte ich ein Rauschen und Schritte. Schnell und leise presste ich mich an die nächste Wand und lauschte.
»Hier Jones. Bin auf dem Weg in den Mittelalter-Saal. Wo bist du?« Klick. Einer der Wachmänner kam von hinten direkt auf mich zu. Sollte ich mich ihm zeigen? Nein, das war keine gute Idee. Meine Erklärung würde er mir nicht glauben. Der Gang vor mir gabelte sich auf, einmal in einen kleinen Saal rechts und in einen etwas größeren links. In letzterem befand sich in der Mitte ein halbhoher Kubus, auf dem obenauf kleinere Exponate unter einer Glaskuppel lagen. So leise ich konnte, sprintete ich in den linken Saal und ließ mich hinter die Auslage gleiten. Wenn ich Glück hatte, bog der Wachmann namens Jones in den anderen Raum ab. Natürlich hatte ich Pech. Wenige Sekunden später war er im selben Raum. Ich hielt mir die Hand vor den Mund, damit er meine Atmung nicht hören könnte. Anhand der Schritte war auszumachen, in welche Richtung er sich bewegte.
»Hier Jones. Saal 3.5 ist leer. Bin jetzt in 3.3. Habe keinen Blickkontakt zur Verdächtigen. Was sagen die Kameras?« Klick. Gleich war er auf einer Höhe mit mir. Das Wort Kameras brachte meinen Magen in Aufruhr. Ich wusste, wozu diese Geräte dienten, ich hatte sogar schon für das eine oder andere Selfie der Besucher herhalten müssen. Dass sie auch überall im Museum verteilt waren, hatte ich vergessen. Wie so vieles.
»Hier Avery. Wir sind auf dem Weg«, krächzte eine Stimme in den Raum hinein. Jetzt erinnerte ich mich daran, wie diese Geräte hießen, mit denen die Wachmänner kommunizierten. Walkie-Talkies. Ich musste verschwinden, bevor noch mehr von den Männern hier auftauchten. Als Jones langsam an der Auslage vorbeiging, kroch ich vorsichtig um die gegenüberliegende Ecke und hielt mich geduckt. Jetzt war er näher am Ausgang als ich. Ein anderer Weg musste her. Ich blickte mich um und entdeckte ein Leuchtschild, das auf einen Notausgang verwies. Klang wie für mich gemacht.
»Jones!«, brüllte es aus dem Walkie-Talkie. »Sie ist in 3.3! Hinter dem Kubus!«
Die Schritte des Wachmanns hielten inne, dann stürmte er direkt auf mich zu. Ich sprang auf und rannte los, ohne mich umzudrehen. Meine Beine protestierten gegen diese schnellen und heftigen Bewegungen, doch der Wachmann war mir dicht auf den Fersen, Stehen bleiben war keine Option, auch wenn er mir das hinterherbrüllte. Ich folgte den Schildern in Richtung Notausgang.
»Halt!«, rief Wachmann Jones.
Ich gelangte an eine Tür, die in ein Treppenhaus führte, und stieß sie auf. Auf der gegenüberliegenden Seite war eine Tür, über der ebenfalls ein Notausgangschild hing. Doch sie öffnete sich gerade. Verdammt, was nun? Zurück ins Museum? Nein, ich war so nah dran, ich würde nicht wieder zurückgehen. Ich sprintete die Treppe hinauf und umrundete gerade den Absatz, als ich wieder das Rauschen eines Walkie-Talkies hörte.
Der Wachmann eilte mir hinterher, während er gleichzeitig in sein Walkie-Talkie brüllte. »Hier Avery. Sie ist im Treppenhaus Ost und auf dem Weg zum Dach!« Dann schrie er mir hinterher. Wieder öffnete sich eine Tür und ein zweites Paar Schritte folgte mir. Auch Jones musste nun im Treppenhaus sein.
»Bleiben Sie stehen!«, rief einer der beiden.
Als ob ich auf sie hören würde. Ich rannte bis ganz nach oben in das letzte Geschoss und auf das grell schimmernde Licht eines weiteren Notausgangs zu. Mit aller Kraft warf ich mich gegen die Tür und fiel durch die Öffnung auf das Dach. Wind peitschte mir ins Gesicht, die kalte Luft ließ mich zusammenzucken. Dicke Tropfen fielen vom Himmel und kitzelten meine Haut. Doch es blieb keine Zeit, das atemberaubende Gefühl der Freiheit zu genießen. Die Wachmänner waren mir dicht auf den Fersen. Kieselsteine knirschten unter meinen Füßen und stachen mir in die Haut, doch ich bemerkte es kaum. Ich rannte weiter auf den Rand des Daches zu – bis es nicht mehr weiterging. Ein kurzer Blick über die Brüstung verriet mir, dass es mehrere Stockwerke nach unten ging. Ein Sprung kam somit nicht infrage.
Ein Schuss krachte durch die Nacht.
Ich wirbelte herum. Wachmann Avery stand auf dem Dach und hielt seine Pistole Richtung Himmel. Er hatte einen Warnschuss abgegeben. Der nächste würde sein Ziel sicherlich finden. Doch ich hielt nicht still, sondern sprang zur Seite und rannte an der Brüstung entlang nach rechts. Ein Stück weiter stand links ein anderes Haus, das ebenfalls zu dem Gebäudekomplex des Museums gehören musste, da es äußerlich fast identisch war. Es war ungefähr zwei Meter entfernt und ein bis zwei Meter tiefer als das Haupthaus. Ich könnte es schaffen. Ich lachte auf, als ich mir des Irrsinns meiner Gedanken bewusst wurde. Vor wenigen Augenblicken hatte ich nicht mal laufen können, jetzt wollte ich schon über Dächer springen. Doch es blieb mir nichts anderes übrig, wenn ich diese Nacht überleben wollte.
»Bleiben Sie stehen oder ich schieße!«, rief der Wachmann hinter mir. Doch ich holte in einem kleinen Bogen aus und rannte dann mit aller Kraft auf den Abgrund zu.
»Was … Nein! Halt!«, brüllte der Mann. Es war zu spät. Ich erreichte die Kante, sprang auf die kniehohe Brüstung und stieß mich ab.
Ein weiterer Schuss hallte durch die Nacht, als ich gemeinsam mit dem Regen fiel.
Ich schaffte es gerade so auf das Dach des anderen Gebäudes und rollte mich instinktiv ab. Der Aufprall erschütterte meinen Körper, doch ich kämpfte mich zurück auf die Beine und lief weiter. Im Zickzack rannte ich über das Dach auf die andere Seite. Irgendwo musste es einen Weg nach unten geben. Eine Feuerleiter vielleicht, schoss es mir durch den Kopf. Plötzlich war da ein Bild vor meinen Augen, das ich mit diesem Wort verknüpfte. So eine wie an dem Gebäude, das den Garten umschloss, den ich von meinem Fenster aus gesehen hatte. Dort führte sie aus dem abgeschotteten Garten direkt aufs Dach. In mir steckten zum Glück doch noch mehr Erinnerungen als angenommen. Ein kurzer Blick über die Schulter verriet mir, dass der Wachmann noch immer auf dem Dach des Museums stand und aufgeregt in das Walkie-Talkie sprach. Solange würde er zumindest seine Waffe nicht erneut auf mich richten. Endlich war das Geländer der Feuerleiter in greifbarer Nähe. Ich griff danach, zog mich über den Rand, sprang auf die erste Plattform und stieg die Stufen so schnell hinab, wie ich konnte. Meine Lunge brannte vor Anstrengung, die kühle Luft schnitt mir in die Brust. Der Regen prasselte unaufhörlich weiter und machte die Stufen rutschig. Mehrmals war das Geländer meine letzte Rettung und bewahrte mich vor einem Sturz. In der Ferne konnte ich ein Donnern hören. Und trotz dessen, dass ich auf der Flucht war, fühlte ich mich so gut wie nie. Mittlerweile hatten die Tropfen auch den Staub von meinen Kleidern und meiner Haut gewaschen. Ich war durchnässt bis auf die Knochen, doch es störte mich nicht.
Am unteren Ende der Leiter angekommen, sprang ich den letzten Meter auf die Straße. Ich rannte planlos weiter, wollte nur weg vom Museum und den Wachmännern. Ich bog mal rechts, mal links in eine Gasse ab und verlor dabei selbst die Orientierung. Mein Atem ging rasselnd, meine Muskeln zitterten vor Erschöpfung. Ich hörte Stimmen, lautes Brummen und Musik. Eine Menschenansammlung? Das war ein gutes Versteck. Also folgte ich den Geräuschen. Sie führten mich um eine Ecke, dann sah ich eine breitere Straße am Ende der Gasse, in der ich mich gerade befand. Ich verlangsamte meine Schritte und ging die letzten Meter, um zu Atem zu kommen.
Als ich aus der Gasse trat, traute ich meinen Augen nicht. Die Besucherströme im Museum waren das eine, aber das hier … das überstieg meine Vorstellungskraft. Vor mir lag ein riesiger Platz, umsäumt von himmelhohen Gebäuden. Wolkenkratzer, die metallisch schimmerten und die Straßen und unzähligen Menschen zu ihren Füßen in künstliches Licht tauchten. Auf der Straße fuhren Autos, die ich zum ersten Mal mit eigenen Augen sah. Der Lärm war gigantisch, sogar der Regen oder das Donnern des Gewitters wurden davon verschluckt.
Jemand rempelte mich an.
»Pass doch auf!« Der Mann lief mit dem Handy am Ohr weiter, ohne sich umzudrehen. Ich drückte mich an die nächste Hauswand und bestaunte das bunte Treiben vor mir. Es war verrückt. Ich war wirklich hier, unter Menschen. Ich bewegte mich wie sie, atmete wie sie und blutete wie sie. Und es fühlte sich so unglaublich gut an. Doch wohin nun? Die Aufregung verebbte und der Hunger meldete sich wieder. Ich brauchte etwas zu essen und musste mir dann überlegen, was ich mit meiner neu gewonnenen Freiheit anfangen sollte.
Wie zuvor den Geräuschen, folgte ich nun meiner Nase und kam vor einem kleinen Laden zum Stehen, der Essen zum Mitnehmen verkaufte. Er war zur Straße hin überdacht und mir fehlte das stetige Tröpfeln des Regens auf meiner Haut, als ich mich unterstellte. Die verwunderten Blicke der Leute um mich herum entgingen mir nicht, aber sie waren mir egal. Ich war es gewohnt, angestarrt zu werden. Dazu war ich da. Gewesen. Grinsend stellte ich mich an die Theke, von der aus man bedient wurde.
»Hey«, grüßte mich einer der jungen Verkäufer, als er auf mich aufmerksam wurde. Er deutete auf mich. »Stellst du jemanden aus Game of Thrones dar?« Ich sah an mir hinunter, wusste aber nicht, was er meinte. Zu perplex war ich, dass er mich wirklich ansah und mit mir redete. Mit mir! Nicht über mich! Und doch war sein Blick kein Vergleich zu Nicks …
»Wer ist es?«, fuhr der Mann fort, als ich nicht sofort antwortete. Dann schüttelte er die Hände. »Nein, lass mich raten.« Er zählte einige seltsame Namen auf, mit denen ich nichts anfangen konnte.
»Ich hätte gerne etwas zu essen«, sagte ich. Mein erster ausgesprochener Satz in der Menschenwelt war nicht sonderlich beeindruckend, aber das kribbelnde Gefühl in meinem Hals, meinem Bauch und meinen Lippen war schöner als jedes Wort.
Der Verkäufer musterte mich skeptisch. »Kannst du denn auch bezahlen?«
Ich griff nach der Phiole um meinen Hals. Sie war das einzig halbwegs Wertvolle, was ich bei mir trug. Doch sie jetzt einzutauschen, würde mir nur kurzfristig helfen, danach musste ich bei null anfangen. Also doch lieber behalten?
»Sorry, aber wir nehmen hier nur Dollar an. Hier wird nicht getauscht, so wie in …« Er drehte sich zu seinem Kollegen um. »Mike, wie heißt noch mal das Land in Game of Thrones?« Doch besagter Mike zuckte nur mit den Schultern. Der Verkäufer schüttelte den Kopf. »Jedenfalls; wir nehmen hier nur Geld an.«
»Ich habe aber keines«, antwortete ich.
Der Verkäufer rollte mit den Augen. »Du nimmst das mit deiner Rolle ganz schön ernst, oder? Okay, dann geh zum Pfandleiher, der gibt dir Geld für deine Kette. Straße runter, dann die erste wieder rechts. Großes schwarz-goldenes Schild.« Kopfschüttelnd wandte er sich ab und begrüßte den nächsten Kunden. Vermutlich hielt er mich für verrückt, was ich ihm nicht einmal verübeln konnte. Ich selbst war mir in diesem Moment auch nicht sicher, ob das hier gerade wirklich passierte.
Nur die Ruhe, sagte ich zu mir selbst. Du schaffst das. Ich folgte den Anweisungen des Mannes und ging weiter die Straße entlang. Dabei hielt ich das Gesicht in den Regen. Meine Füße waren eiskalt und wegen des Wassers bereits runzelig, aber das störte mich nicht. Nach all den Jahren ohne Bewegung und diese starken Gefühle genoss ich alles. Außer den stechenden Schmerz in meinem Bauch.
Auch die kopfschüttelnden Leute, die an mir vorbeiliefen, konnten mir meine gute Laune nicht verderben.
»Verrückte Cosplayer«, murmelte eine Frau abwertend. Was auch immer das bedeuten sollte. Ich bog in die kleine Straße ab, die der Verkäufer mir genannt hatte. Das Schild des Pfandleihhauses war schon von Weitem zu sehen. Es waren nur noch wenige Meter, die mich von dem Eingang trennten, als ich hinter mir plötzlich schnelle, schwere Schritte hörte. Als ich mich umdrehte, fand ich mich vier uniformierten Männern gegenüber. Einer von ihnen war einer der Wachmänner aus dem Museum, die anderen hatten dunklere, dickere Kleidung an. In dicken Lettern stand ›Police‹ auf ihren Uniformen. Das war gar nicht gut. Wie hatten Sie mich so schnell gefunden? Sie zogen ihre Waffen aus den Holstern und richteten sie auf mich.
»Hände nach oben und auf die Knie!«, rief einer der Polizisten. Ich tat, was er sagte. Die anderen Männer kamen mit zügigen Schritten auf mich zu. Der Mann, der mich als Erstes erreichte, zerrte meinen rechten Arm nach unten und legte mir etwas Kühles ums Handgelenk. Dann wiederholte er es mit dem linken Arm. Klick, und ich konnte meine Arme nicht mehr bewegen. Er faselte etwas von Rechten und betete eine ganze Liste voller Sätze runter, die wie auswendig gelernt klangen. Ich hörte gar nicht richtig hin, weil sich in meinem Bauch eine ganz andere Art von Leere ausbreitete.
So schnell, wie meine Freiheit begonnen hatte, fand sie auch schon wieder ihr Ende. Doch ich bereute keine Sekunde davon.
Kapitel Drei
Sie nahmen mir die Phiole ab und steckten mich in eine Zelle. Dass die Kette und der Anhänger mir gehörten, hatte niemanden interessiert. Auf dem Weg zur Polizeistation hatten sie mich nur ununterbrochen mit Fragen gelöchert, auf die ich keine Antworten hatte. Also hatte ich geschwiegen. Meine erste Fahrt in einem Auto hatte ich deswegen auch nicht genießen können. Jetzt saß ich noch immer triefend nass auf einer unbequemen Metallbank in einer Verwahrungszelle und blickte durch das Gitter in einen kahlen Flur. Fast vermisste ich meinen Standort im Museum. Dort hatte ich wenigstens nach draußen sehen können. An der Hose wischte ich mir die letzten Reste Tinte ab, mit der sie meine Fingerabdrücke abgenommen hatten. Ich schloss die Augen und lehnte den Kopf an die Wand hinter mir. Obwohl die Situation wirklich verfahren war, musste ich lächeln. Ich erinnerte mich an den Regen auf meiner Haut, die Steine unter meinen Füßen. Das Brennen in der Lunge und das Vibrieren in meinem Bauch, das ich beim Lachen verspürt hatte. Ich war unendlich dankbar für die wenigen Minuten Leben, die ich hatte auskosten dürfen. Auch nach Stunden in der leeren Zelle zehrte ich noch davon.
»Du hast es ja nicht lange draußen ausgehalten«, sagte plötzlich eine mir bekannte Stimme.
Ich riss die Augen auf. Das konnte nicht sein. Doch da war er. Nick lehnte vor der Zelle mit verschränkten Armen am Gitter, das mich von der Freiheit trennte. Sein rechter Mundwinkel zuckte. Machte er sich etwa lustig über mich?
Ich sprang auf. Nick blieb wie all die Nächte zuvor stoisch ruhig und ließ mich nicht aus den Augen, als ich auf ihn zuging und dicht vor den Gitterstäben stehen blieb. Doch seine Augen blitzten lebendig. Tausend Gedanken gingen mir durch den Kopf, tausend Fragen, die ich mir in den vergangenen Tagen und Nächten gestellt hatte, aber nicht hatte aussprechen können. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, aber kein Wort kam über meine Lippen. Meine Knie zitterten, ich griff Halt suchend nach den Stäben und lehnte die Stirn an das kühle Metall, ohne Nick aus den Augen zu lassen. Er stellte sich aufrecht hin und schob die Hände in die Hosentaschen. Er roch nach frischem Regen. Nach Freiheit.
»Du hast mich ohne Vorwarnung geküsst und dann unwissend zurückgelassen«, platzte es aus mir heraus. All die aufgestauten Gefühle, die sich in mir angesammelt hatten, brodelten in mir. Nick öffnete den Mund, doch ich ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Ich dachte, ich löse mich in Luft auf. Sechs Tage lang.« Ich packte die Gitterstäbe fester. Die Angst griff nach mir und ich musste sie endlich in Worte fassen, um sie zu begreifen und loszuwerden. In meinem Inneren war ich Nick überaus dankbar, und doch sollte er wissen, dass er nicht so mit mir hätte umgehen sollen. Der amüsierte Zug um seinen Mund verschwand. »Oder du hättest mir Kontaktdaten dalassen können, damit ich dich fragen kann, wie das mit diesem Menschsein funktioniert. Denn offensichtlich habe ich es falsch gemacht.« Ich deutete auf die Zelle hinter mir und konnte mir jetzt selbst ein bitteres Lächeln nicht verkneifen.
Nick zog fragend die Brauen zusammen, als würde das, was ich sagte, überhaupt keinen Sinn ergeben. Er musterte mich aus dunkelbraunen warmen Augen.
»Wie meinst du das?«, fragte er.
»Was?«
»Dass du nicht weißt, wie das mit dem Menschsein funktioniert.«
Nun war ich es, die den Kopf schief legte und ihn verwirrt ansah. »Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Ich war bisher nur eine Statue.«
»Aber …« Weiter kam er nicht, da er durch das Zuschlagen einer Tür unterbrochen wurde. Jemand kam auf uns zu. Nick senkte die Stimme.
»Ich hole dich hier raus, sobald die anderen da sind. Bleib ruhig, tu so, als wäre ich nicht da und sag am besten gar nichts.«
Rückwärts ging er zu der gegenüberliegenden Wand und blieb dort stehen. Auch ich löste mich vom Gitter und ging ein Stück zurück, ohne ihn aus den Augen zu lassen. War er wirklich hier, um mir zu helfen?
Ein Mann in Polizeiuniform und ein zweiter in einer schrill rotorangen Jacke, die das Licht reflektierte, und mit einem kleinen Koffer in der Hand traten in den Gang vor meiner Zelle. Den Polizisten kannte ich, den anderen Mann jedoch nicht.
Ersterer zückte einen Schlüsselbund und schloss die Zelle auf. »Leg die Hände an den Kopf.«
Ich kam der Aufforderung nach und wich noch einen Schritt zurück. Mein Herz schlug schneller, ich schluckte schwer.
»Wir werden dir etwas Blut abnehmen. Vielleicht finden wir so heraus, wer du bist. Du hast jetzt die letzte Chance, es freiwillig zu verraten.« Der Polizist öffnete die Zellentür und sah mich abwartend an. Als ich nicht reagierte, schüttelte er den Kopf. »Wie du willst. Sie gehört Ihnen, Doc.«
Besagter Doc, was ein wirklich komischer Name war, betrat die Zelle. »Setz dich bitte.«
Ich ließ mich zurück auf die Liege sinken. Doc kniete sich vor mich und stellte den Koffer neben sich ab.
»Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte er. »Es tut nicht weh.« Er kramte ein paar Utensilien aus dem Koffer, wickelte sie aus knisternden Verpackungen und steckte sie zusammen. Der Polizist trat hinter ihn und legte eine Hand demonstrativ an seine Waffe, deren Halterung er bereits geöffnet hatte. Eine falsche Bewegung von mir und ich würde lernen, was er damit anrichten konnte. Trotz der nassen Kleidung lief mir der Schweiß den Rücken hinab.
»Hast du irgendwelche Erkrankungen?«, wollte Doc wissen. »Diabetes zum Beispiel? Bist du auf Medikamente angewiesen? Blutverdünner oder etwas in der Richtung?«
Als ich nicht antwortete, seufzte er. »Du bist ganz blass. Ich würde dir gerne helfen, wenn du mich lässt. Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen?«
Auch wenn der Mann einen sympathischen Eindruck auf mich machte, blieb ich ihm die Antwort schuldig. Noch nie, hätte er mir ohnehin nicht geglaubt.
Er streckte die Hand aus. »Gib mir bitte deinen linken Arm. Oder bist du Linkshänderin?«
Ich streckte ihm den gewünschten Arm entgegen, den anderen behielt ich weiter hinter meinem Kopf. Doc schob den Ärmel meines Oberteiles nach oben und legte die Ellenbeuge frei. Er zog ein Gummiband über meine Hand und zog es an meinem Oberarm fest.
»Jetzt die Hand zur Faust machen, öffnen und das Ganze ein paar Mal wiederholen.«
Ich warf einen kurzen Blick zu Nick. Zustimmend senkte er den Kopf. Ich schluckte und folgte den Anweisungen. Der Druck in meinem Arm wurde mit jedem Pumpen schmerzhafter, die blauen Linien unter meiner Haut traten stärker hervor.
Doc sprühte eine klare Flüssigkeit auf meine Haut und wischte mit einem Stückchen Stoff darüber. Dann griff er nach etwas, das er eben mit den Materialien aus seinem Koffer zusammengebastelt hatte. Es war ein kleines Röhrchen, an dessen Ende ein dünner Metallstab angebracht war.
Ich rutschte ein Stück zurück, meine Schultern verspannten sich.
»Du wirst die Nadel kaum spüren, versprochen. Wenn du kein Blut sehen kannst, mach am besten die Augen zu oder sieh nach vorne.«
Doch ich sah nicht weg. Mit den Fingern meiner freien Hand krallte ich mich in meinen Haaren fest und sah Doc dabei zu, wie er die Nadel auf meine Haut legte. Er tippte auf die dickste der blauen Linien, dann stach er zu. Er hatte recht, ich spürte es kaum, doch der Druck, den die Nadel unter meiner Haut ausübte, war unangenehm. Dann zog er an dem Röhrchen und dunkelrotes Blut floss hinein. Ich hörte meinen Herzschlag in den Ohren, mein Atem ging schneller. Die Finger meiner linken Hand zitterten.
Eiskaltes Metall drückte sich in meine Haut. Der erste Blutstropfen quoll hervor und lief die glänzende Klinge hinunter. Tiefer, immer tiefer drang sie in meine Brust ein, bis da nichts mehr war als Schmerz.
Gelbe und orangefarbene Lichtpunkte tanzten vor meinen Augen. Ich spürte einen Dolch auf meiner Brust, der mit tödlicher Präzision in mich eindrang.
»Nein«, keuchte ich. Das Flackern vor meinen Augen wurde schlimmer, es war grell und nahm mir die Sicht.
»Es ist gleich vorbei«, sagte Doc.
Er würde mich umbringen. Mein Herz drohte aus meiner Brust zu springen, mein ganzer Körper vibrierte vor Anspannung und ich konnte nicht mehr geradeaus sehen. Mit der linken Hand packte ich Docs Jacke und krallte mich daran fest. Ich wollte nicht sterben.
»Nein«, sagte ich mit rauer Stimme, bevor mein Brustkorb sich zusammenzog. Mein Blick fokussierte sich wieder auf das Blut, das unaufhörlich in das Röhrchen floss und mein Leben mit sich riss. In diesem Augenblick war es mit meiner Selbstbeherrschung vorbei, mein Magen summte unangenehm. Ich beugte mich vor und packte mit meiner freien Hand Docs Hals und drückte zu. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie der Polizist seine Waffe zog, doch im nächsten Moment sackte er zusammen.
Ich sah Doc tief in die Augen. »Du wirst mich nicht töten.« Der Mann erstarrte. Sein Hals fühlte sich hart unter meinen Händen an. Seine Haut färbte sich von meinen Fingern ausgehend weiß und wurde kalt. Meine Panik verflog so schnell, wie sie gekommen war. Ich atmete tief ein und starrte auf meine zitternde Hand. Ich zog sie zurück, doch Doc bewegte sich nicht mehr.
Zurück blieb Fassungslosigkeit über das, was sich vor mir abspielte. Der Mann erstarrte zu Stein und wenige Sekunden später blickten mir nur noch leere grauen Augen entgegen. Genau wie meine. Ich griff erneut nach ihm und fuhr über die marmorne Kontur, die bis vor wenigen Sekunden noch aus Haut bestanden hatte. Was hatte ich getan? Mein Körper sackte nach vorne, ich musste mich an der Liege festhalten, um nicht vornüberzukippen.
Ich hob den Blick und sah Hilfe suchend zu Nick, der sich über den Polizisten gebeugt hatte. Er starrte erst die Statue an, dann mich. Seine Hände waren zu Fäusten geballt.
»Zeig mir bitte deinen Nacken.«
»Was?«
»Zeig mir bitte deinen Nacken«, wiederholte er. Ich drehte ihm meinen Oberkörper zu und hob kurz meine Haare hoch. Im nächsten Moment stürmten drei Männer in den Flur vor der Zelle. Einer von ihnen war Linos, der abwechselnd mit Nick im Museum Wache gehalten hatte. Er erfasste die Situation mit einem Blick.
Ein Fluch entkam seinen Lippen und ich wusste, dass ich jetzt so richtig in der Klemme steckte. Ich hatte einen Mann, der trotz aller Umstände nett zu mir gewesen war, in Stein verwandelt. Doch wie um alles in der Welt hatte ich das getan?
Linos übernahm die Führung. »Santos und Pio, ihr kümmert euch um die Männer, ich mich um die Statue. Nick, bring das Mädchen weg.« Wollten sie mir noch immer helfen, oder mich wegsperren?
Ich erwartete, dass Nick mich grob packen und hinter sich herschleifen würde, doch das Gegenteil war der Fall. Er legte mir eine Hand auf den Rücken, half mir auf und schob mich sanft aus der Zelle. Diese überraschend behutsame Berührung wischte meine Zweifel beiseite und brachte mich dazu, ihm zu folgen. Ich konnte meinen Blick nicht von dem versteinerten Mann am Boden lösen. Erst als wir ihn und den Polizisten hinter uns ließen, kam ich wieder zur Besinnung. Linos nahm Nicks Platz neben dem Polizisten ein. Die anderen beiden Männer zogen silbrig schimmernde Steine aus einem Beutel an ihrem Gürtel und zerrieben sie in den Händen zu einem feinen Pulver. Verwirrt sah ich wieder nach vorne und ließ mich von Nick durch das Gebäude leiten.
»Was ist gerade passiert?«, fragte ich.
Der Druck seiner Hand auf meinem Rücken wurde stärker. »Weißt du es wirklich nicht?«
»Nein.«
Nick schob mich durch die Eingangstür auf den Gehweg. Komischerweise bemerkte uns keiner der anderen Polizisten, die durch die Wache liefen. Waren wir unsichtbar, so wie Nick im Museum?
Bevor ich ihm weitere Fragen stellen konnte, drückte er mich weiter in Richtung eines Autos, dessen schwarzer Lack im Licht der Laternen glänzte. Nick öffnete mir die Beifahrertür und ich setzte mich hinein. Kühle, trockene Luft empfing mich im Innenraum. Wenige Sekunden später öffnete sich die Tür auf der anderen Seite und Nick stieg ein. Er zog sich eine Art schwarzen Gürtel quer über die Brust und befestigte ihn mit einem Klicken an seiner Seite.
»Schnall dich an.«
»Bitte was soll ich?« Es war meine zweite Fahrt in einem Auto, aber was damit gemeint war, wusste ich nicht. Wie so vieles andere auch.
Nick sah mich entgeistert an. Dann schüttelte er den Kopf und löste das Band wieder. Er schob ihn sich von der Schulter und beugte sich über mich. Mit der linken Hand griff er nach etwas hinter meinem Kopf. Ich war viel zu erschrocken über diese plötzliche Nähe, als dass ich reagieren konnte.
Sein Regenduft stieg mir in die Nase. Eine Ader an seinem Hals pulsierte und mein Blick blieb wie von selbst daran hängen. Auf seiner Haut hatte er an einigen Stellen kleine, punktförmige Narben, die durch die Zeit bereits verblasst waren. Ohne darüber nachzudenken streckte ich meine Hand aus und legte die Finger darauf. Seine Haut fühlte sich warm am, überraschend weich und die Bewegung unter meinen Fingern jagte mir einen Schauer über den Rücken. So also fühlte sich Leben an.
Nick zuckte zusammen und ich zog hastig meine Hand zurück. Nach kurzem Innehalten fuhr er in der Bewegung fort und legte auch mir einen Gürtel um Oberkörper und Hüfte und verschloss ihn.
»Das ist ein Sicherheitsgurt. Anschnallen bedeutet, dass man ihn sich umlegt, bevor man losfährt.« Ich behielt für mich, dass die Polizisten sich auf dem Weg zum Revier nicht die Mühe gemacht hatten, sich oder mich anzuschnallen. Nick deutete auf meine blanken Füße. »Willst du ein Paar Socken oder Schuhe? Wir haben vielleicht welche im Kofferraum.«
»Nein danke. Ich mag es so.«
»Wie du willst.«
Er schnallte sich selbst an und startete den Wagen, der unter uns summend und brodelnd zum Leben erwachte.
Ich krallte meine linke Hand in den Sitz, mit der rechten hielt ich mich an einem Griff an der Tür fest, als Nick den Wagen auf die Straße lenkte. Er beschleunigte und ich wurde in den Sitz gedrückt. In meinem Magen entstand ein Loch, das sich überraschend angenehm anfühlte. Jetzt, da ich darauf achtete, konnte ich das Gefühl der Geschwindigkeit genießen. Die Gebäude und Menschen zogen an uns vorbei, ich konnte die ganzen Eindrücke gar nicht in mich aufnehmen.
Dann entdeckte ich mein Abbild im Seitenspiegel und erschrak. Nicht meine Augen blickten mir entgegen, sondern die des Mannes, die mich grau und leer angestarrt hatten.